Michael Hamburger: In einer kalten Jahreszeit
1
Mit Worten unerreichbar in seinem Wortgefängnis
Der Mensch mordete mit Worten weil sie Worte
aaaaawaren
Frauen Kinder die Zahlen für ihn waren
Und bis heute Zahlen sind, aber aufgesagte
In die Luft geschnellte, in Bezirken außerhalb des
aaaaaHörens
Ungesehen zu stürzen, unzerbrochen ihre Schale aus
aaaaaMetall.
Für Worte unerreichbar, doch ich mach noch mehr Worte
Um Wortberichte aufgesagte Worte
Die erzählten wie er mit seinen Worten Menschen tötete
Frauen Kinder die Worte waren und Zahlen
Und er sich besann oder nicht besinnen konnte
Der Worte und der Zahlen die andere aufsagten
Den Mann bei Worten zu ertappen der mordete mit Worten.
Mit Worten unerreichbar die Kinder, Frauen, Männer
Die nicht Worte oder Zahlen waren eh sie starben
Weil unter einer Last von Angst das klamme Herz geklammert
War an Zahlen Worte die nicht schluchzten wimmerten
Wie es Kinder tun auf Lastwagen geladen um zu sterben
Die nicht zwei Tode starben wie sie Mütter sterben
Die ihre Kinder sehen auf Lastwagen geladen um zu sterben.
Das titelgebende Gedicht
„In einer kalten Jahreszeit“ entstand 1961, während des Prozesses gegen Adolf Eichmann, dem Leiter des Judenreferats zur NS-Zeit. „Der Band enthält vier Texte: den Gedichtzyklus ,In a Cold Season‘, zwei längere Gedichte sowie einen Essay zu Doderer, Arendt und Adolf Eichmann. Es sind Texte über ,Worte und Zahlen‘, über Berechnung und Vernichtung, über jene Experten der Erfassung, Zuführung und Endlösung, die Menschen ,in Wort und Zahlen‘ umrechnen konnten, um sie zu ,addieren und subtrahieren‘“ (Die Zeit) Inmitten dieser Litanei der Monstrosität taucht das Bild der Großmutter auf, die nicht mitgehen wollte ins Exil, das Michael Hamburger und seine Familie wählten. Der Lyriker spricht sich gegen die Todesstrafe aus, die Adolf Eichmann traf, und stößt damit in der Presse Englands und Israels auf heftige Ablehnung.
Folio Verlag, Ankündigung, 2000
Im Wortgefängnis
− Michael Hamburgers Holocaust-Gedichte. −
Als seine Familie im November 1933 Berlin verließ, hatte der neunjährige Michael Hamburger gerade begriffen, daß er sich beim Völkerball in die „jüdische“ Gruppe einzureihen hatte. Die Emigration nach England zerstörte ihm die frühe Einheit der Dinge und Worte. Vielleicht war es aber dieser Riß, der Hamburger zum Dichter machte – zu einem englischen Dichter. Aber sein erstes veröffentlichtes Gedicht schrieb er über Hölderlin; und das im Kriegsjahr 1941. Es eröffnet noch heute seine Collected Poems.
Zwanzig Jahre später, als Eichmann in Jerusalem der Prozeß gemacht wurde, muß dieses Ereignis bei Michael Hamburger das Gefühl erneuert haben, der Vernichtung entronnen zu sein. Er schrieb in der Folge drei Gedichte zum Thema des Holocaust. Das erste und längste, das fünfteilige „In a Cold Season“, formuliert bereits in seiner Eingangszeile das Problem der literarischen Darstellung des Schreibtischtäters Eichmann:
Words cannot reach him in his prison of words.
Oder in der deutschen Fassung von Peter Waterhouse:
Mit Worten unerreichbar in seinem Wortgefängnis.
Das Gedicht arbeitet sich an diesem Paradox ab, indem es die Stilebenen trennt. Deportation und Mord erscheinen im Blankvers, der dem Leid einen Rest von Würde bewahrt. Die Figur des mörderischen Bürokraten wird ironisch-sachlich im Freivers dargestellt:
Eichmann Adolf, Staatsbeamter (im Ruhestand):
Ein milder Mann, gewissenhaft auf seine Weise,
Gegner von Gewalt
Und anderer Verstöße
In seinem Beisein ausgeführt
Hamburger weiß, daß solche Mimesis des Banalen den Kern des Problems nicht berührt. Er begreift, daß die „Schale“, die ihn von der Wahrheit trennt, mit Worten nicht zu zerbrechen ist. Das einzige Reimpaar im sonst reimlosen Gedicht zieht die Summe dieser Erkenntnis:
Und bin für seine ganze Wahrheit nicht bereit:
Vielleicht sein Innerstes ist die Unwirklichkeit.
Aber wo der Gedanke scheitert, ist die Poesie noch nicht verloren. Gegen Eichmanns innerste Unwirklichkeit setzt sie die lebendige Erfahrung. Sie verbürgt eine Wahrheit, die dem Menschen zugänglich ist. Hier ist es die Biographie des Emigranten, aus dessen Familie viele ermordet wurden. So hat der Dichter dem Poem von der kalten Jahreszeit etwas sehr Persönliches eingefügt, nämlich die Erinnerung an seine von den Nazis deportierte Großmutter. Sie hatte die Gefahr unterschätzt, war in Berlin geblieben und bezahlte so ihre Arglosigkeit mit dem Leben. Zweimal nennt der Dichter sie „guileless“, also „arglos“. Wenn Waterhouse formuliert: „Nur daß die Liebende starb“, geht diese historische Pointe verloren.
Die beiden später entstandenen Gedichte „Treblinka“ (1967) und „Between the Lines“ (1968) sind Rollengedichte. Die lyrische Persona tritt für die fehlende direkte Erfahrung ein. Hamburger schrieb „Treblinka“ nach dem Bericht eines Überlebenden, den das englische Fernsehen gesendet hatte. „Zwischen den Linien“ folgt einem Gefängnistagebuch. Hier triumphiert das Opfer über seine Peiniger, indem es den Moment seines Todes als Befreiung antizipiert. So lebt die Poesie von dem Paradox, daß die Toten fähig sind „Licht zu geben“ – zwischen den Linien, aber auch zwischen den Zeilen; wie es der Doppelsinn des englischen Titels nahelegt.
Wichtig also, daß diese drei Gedichte nun in einem kleinen Band zusammengefaßt sind. Peter Waterhouse setzt damit die verdienstvolle Folge seiner Hamburger-Editionen fort. An den Schluß hat er – quasi als nachgereichten Schlüssel – einen Essay des Dichters gesetzt, der unter dem Titel „Entdämonisierung: Realisierung“ die Darstellbarkeit des Bösen in der Literatur reflektiert. „Eichmanns Wahnsinn war kein Fall von Besessenheit, sondern von Leere“, diese Quintessenz, die Hamburger aus der Lektüre von Hannah Arendts berühmtem Buch gezogen hat, steht bereits in seinen Gedichten.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.4.2001
Eine Poetik der Jetztzeit
− Michael Hamburger über das Erdenken des Unbewussten. −
Die Stimmhaftigkeit von Ideen ist Lyrikern sinnstiftendes Tagesbrot. Der britische Autor und Übersetzer Michael Hamburger verrückt sprachliche Verlassenschaften und Zwischenzeiten-Blaupausen also nur, um sie selbstversagten Figuren anzulegen. In einer kalten Jahreszeit, sein Gedicht- und Essayband zehrt von widerläufiger Clarté. Wirklichkeitshunger nämlich, man hat dies im Bozner Verlag erkannt (und seit einigen Jahren begonnen, Hamburgers Texte nach Mitteleuropa handlich zu retournieren), ist nur mit Literatur als Perspektive beizukommen.
Europäische Lebenszusammenhänge versteht Hamburger, 1924 als Sohn jüdischer Eltern in Berlin geboren und später nach England emigriert, entgegen provinziellen Beißreflexen zu transportieren: Seine Gedichte, politisch-soziale Signaturen der Paralyse, sind Haarsterne im Rückenmark der Verfechter assimilatorischer Leitkultur. Über Treblinka wird Stille ausgebreitet, „wir Schmutz gewesen den man löscht, Staub den man zerstäubt / – Älter als jener, alt wie Gottes Schweigen“, grell liegen „unsre hundert Sprachen gesammelt in ein Schweigen“. In einer kalten Jahreszeit dann, dem Rang nach Titelpoem, steht die „Eichmann Adolf; Staatsbeamter (im Ruhestand): / gewissenhaft auf seine Weise“ gewidmete Pathologie als Bedarfsfall des Konformismus da. Hamburger plädierte für eine bewusste Erkenntniserweiterung der Erinnerung, Zeit-Hohlwege jedoch machen es unmöglich, „Mann bei Worten zu ertappen / der mordete mit Worten“. So liegt einer der Materialspeicher von Hamburgers Textur in Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem: „dort…“ schreibt sie, hatte ihm (das Gedächtnis) einen letzten Streich gespielt: er fühlte sich ‚erhoben‘, wie bei einer Beerdigung und hatte vergessen, dass es die eigene war.“ Es ist etwas gleichartiges in allen Erzählungen, „Frauen Kinder… Zahlen für ihn… / Und bis heute Zahlen sind, aber aufgesagte“, inmitten Eichmann selbst, als Bauchredner mit Katasterwaffen, Identitäts-Kanzleipapier bewehrt: „ein gutes Zahlengedächtnis (head of figures im Original ist nicht beizukommen), geordnetes Familienleben, / Stets unauffällig.“.
„Kurz und schmerzlos“ sind die Wortleichname, so schön vakuumverpackt im Frischfleischhausrat der deutschen Sprache: Wenn sich die Nachdichtungen von Peter Waterhouse im eigenwilligen Duktus vor die Originale schieben, verdeutlicht dies eine ebenso artifizielle wie missstimmige Celanisierung („Sterbe-Antlitz“ für „dying face“) – poetische Gummigebisse verschmecken Hamburgers Lyrik als Sussex-Vorgartensonette und halluzinieren sich in maliziöses Apfelgrün. Das „Denken des Unbewussten“, haben, so Hamburger, europäische Systemtotalitäten den Menschen ausgetrieben, durchaus zwiespältig als Verweis auf Splitter der Intentionalität, die Arendts Banalitäts-Stehphrase leugnete: „Nicht Raum nicht Zeit daß das Gedächtnis tauen könnte / Ein einzelnes Gesicht das seine Worte Lügen strafte“, „… wütende Bücherverbrenner / Die betäubt sind vom eisigen Drang, nichts zu wissen.“ Der Mensch („auch diese Körper am Ende fähig, Licht zu geben“, heißt es in Treblinka) ist allen anderen gegenüber ein Ausnahmefall, hat Franz Schuh einmal geschrieben – das Aufbegehren gegen die Selbstdefinition über Untertänigkeitverhältnisse ist Michael Hamburgers Hauptanliegen In einer kalten Jahreszeit.
In einem Interviewband wird Isaiah Berlin, ein anderes Mastodon des westeuropäischen Liberalismus, zitiert:
Eichmann believed in what he did, it was, he admitted, in the center of his being.
Hamburger schließt:
Mit ihren Worten seine Worte prüfend versagen meine Worte…
Und bin ich für seine ganze Wahrheit nicht bereit: Vielleicht sein Innerstes ist die Unwirklichkeit
Franz Fillafer , Standart-Album, 20.4.2002
Aus der Werkstatt eines gegenstandsbezogenen Lyrikers
Wenn ich versuche, über die bald fünfzig Jahre meines Schreibens etwas auszusagen, wird mir vor allem klar: Am Anfang war die Praxis. Ein Nachdenken über Poetik und poetologische Fragen kam für mich immer erst nachträglich, nach dem Akt des Gedichtschreibens; ganz besonders aber zu kritischen Zeitpunkten, nämlich wenn ich mit dem zuletzt Geschriebenen unzufrieden war und einen Wandel benötigte, der auf sich warten ließ und indessen das Weiterkommen blockierte. Kritisch konnte eine solche Wartezeit auch in einem anderen Sinne sein, da ich sie meistens entweder mit kritischen Schriften oder mit Übersetzungen ausfüllte – wobei es freilich vorkommen mochte, daß eigene Gedichte verdrängt oder abgetrieben wurden, weil ich mich zu jeder Zeit nur auf eine literarische Tätigkeit konzentrieren kann und Gedichte zwar plötzlich geboren, aber lange ausgetragen werden. Sogar beim Übersetzen kam das Nachdenken nach der Praxis, so daß ich in den meisten Fällen kritische Arbeiten über jene Autoren schrieb, mit denen ich mich schon als Übersetzer, durch das Übersetzen, engagiert hatte. (Wenn die Übersetzungen – wie meine ersten von Gedichten Hölderlins – unzulänglich waren, hatten auch die davon abgeleiteten kritischen Erkenntnisse wenig Gültigkeit.)
Beim Gedichtschreiben selber ist jede Problematik aufgehoben oder wird durch den Vorgang gelöst, wenn auch nur für die Dauer des einzelnen Gedichts, manchmal auch des einzelnen Gedichtzyklus oder der einzelnen Gedichtreihe, insofern im Konzept des einzelnen Gedichts schon Zusammenhänge mit anderen bewußt geworden sind. Eine auf das ganze Werk zutreffende Poetik wäre für mich ein Programm oder ein Manifesto, an das ich mich zu halten hätte; und nichts liegt mir ferner, als meine Gedichte dadurch einzuengen, daß ich ihnen meine Entschlüsse aufzwinge.
Schranken und Grenzen sind mir ohnehin gegeben durch meine Beschaffenheit, mein Bewußtsein und Unbewußtsein, meine Zeitbedingtheit, durch das, was mich angeht, und das, was mich nicht angeht, das, wozu meine Sprache hinreicht, und das, wozu sie nicht hinreicht. Daß es aber ein Spannungsfeld mit entgegengesetzten Polen ist, immer war und bleibt, halte ich für so wesentlich, daß ich auch als Kritiker dazu neige, die Gegensätze und Widersprüche in einem dichterischen Werk hervorzuheben – als Indiz seiner Dynamik und seiner Spannungsweite. Innerhalb des mir gegebenen Spannungsfelds sollen aber meine Gedichte jede mögliche Freiheit haben; vor allem jene, in allen Richtungen den ihnen gegebenen Kreis immer wieder bis zur Grenze abzuschreiten. Ob die damit erreichten Wandlungen im Werk als ganzem eine Entwicklung, einen Fortschritt oder eine Steigerung ergeben – sie könnten auch ein Rückzug, eine Regression oder ein Absinken sein −, vermag ich erst hinterher oder nie zu beurteilen; versuche es auch nur, wenn ich zur Auswahl aus meinen Gedichten gezwungen bin und dadurch zu ihrem Kritiker werde. Wenn diese Kritik aber schon beim Schreiben eines Gedichts einsetzt, ist das Gedicht verloren: es wird abgebrochen oder vernichtet. Bei einer Übersetzung, die während der Arbeit problematisch wird, geht es mir genauso, obwohl für abgebrochene Übersetzungen ein zweiter Anlauf – öfters nach vielen Jahren – nicht ausgeschlossen ist. Hier ist problematisch keineswegs mit schwierig gleichzusetzen. Semantisch, syntaktisch und metrisch schwierige Texte – von Goethes Pandora bis zur Lyrik Celans – reizen mich nicht nur zur Übersetzung, sondern eignen sich auch dazu, da die ausgeprägteste Idiosynkrasie dasjenige ist, was eine andere Literatur bereichern kann. Als problematisch, weil im Grunde unübersetzbar, erwiesen sich oft die anscheinend kunstlosesten Lieder im naiven Ton.
Jene Kritik, die zum Vorgang des Schreibens (oder Übersetzens) gehört – die werkimmanente, welche auch Änderungen anbringt und mehrere Fassungen erfordert −, ist etwas ganz anderes, weil sie im Spannungsfeld bleibt, den Impuls des Schreibens zwar leitet, aber nicht unterbricht. Das Urteil, wie das Nachdenken, steht außerhalb des Vorgangs, wenn es sich auch um Einsicht und Einfühlung bemüht. Darum ist es mir nie gelungen, ein vor langer Zeit geschriebenes, dann mir unsympathisch gewordenes Gedicht gründlich zu verbessern. Ich konnte Zeilen streichen, im Glücksfall auch einige Wörter umstellen oder ersetzen – also chirurgische Eingriffe anbringen −, den verfehlten Akt des Schreibens aber nie eigentlich wiederholen. Dagegen geschah es in späteren Jahren öfters, daß ein vor langer Zeit geschriebenes, fast schon vergessenes Gedicht ganz unerwartet eine Fortsetzung oder einen Nachtrag erhielt. Überhaupt nahmen die zyklischen Wandlungen und die Variationenform überhand, nachdem sich das 1968 entstandene und als kurzes Gedicht veröffentlichte Travelling zwei Jahre später – wieder unerwartet, ungeplant – zum Ansatz eines längeren Zyklus erweitert hatte, an dem ich dann bis 1976 arbeitete.
Mit den Worten Einsicht und Einfühlung habe ich vielleicht schon auf eine der mir gesetzten Grenzen hingewiesen nämlich die, daß ich als Gegenstandslyriker begann und auch enden werde, niemals „konkrete“ (oder auch abstrakte) Texte geschrieben habe, schreiben wollte oder konnte. Mein Spannungsfeld reichte also nie bis zur Sprache allein, als Material und Form, medium und message zugleich. (Warum es für mich nicht in Frage kam, diese Grenze zu überschreiten und mich damit von Zwängen und Konflikten zu lösen, die sich aus der Bindung der nicht-„konkreten“ Lyrik an Erfahrung, Erlebnis, Bekenntnis, Einbildung und Stimmung ergeben, ist eine autobiographische und psychologische Frage, deren Beantwortung hier zu weit führen würde.) Je reiner die sprachexperimentelle Poesie, desto mehr langweilt sie mich, weil ihr die für mich wesentliche Spannung und Reibung fehlen. Auch als Leser und Kritiker interessieren mich aber solche Texte, in denen rein sprachliche Permutationen an ihren Gegenpol stoßen, an äußere oder innere Gegenstände – was in den Texten Helmut Heißenbüttels und Ernst Jandls immer wieder geschah, selbst wo es nicht um in der „Alltagssprache“ geschriebene Texte ging (wie Ernst Jandl einen der ihm zur Verfügung stehenden Gedichttypen nennt).
Mir genügte ein Spielraum innerhalb der Grenzen einer mehr oder weniger mimetischen Sprache. Indem ich mich als Gegenstandslyriker bezeichne, muß ich hinzufügen, daß für mich sogar Träume zu den Gegenständen gehören – mit dem gleichen Anspruch, wahrheitsgetreu, mimetisch dargestellt zu werden, wie die gesellschaftlichen und individuellen, zivilisatorischen und natürlichen, äußeren und inneren Phänomene jeder Art. Daß Träume zudem die äußeren Phänomene beleuchten und klären können, hat selbst Brecht in seiner späten Lyrik anerkannt und bezeugt, obgleich Brecht wohl derjenige Lyriker dieses Jahrhunderts war, der seinen Gedichten die strengste ideologische Selbstzensur auferlegt hat – sich aber jenseits dieser Selbstzensur wieder eine beträchtliche Bewegungsfreiheit sichern konnte. Da ich beim Schreiben meiner Traumgedichte, wie bei allen anderen, mimetisch verfahre, zeichnen sich diese durch surreale Bild- und Handlungsketten aus, die ich in anderen Gedichten nur selten zulasse. Nur darum habe ich sie in Sammlungen oder Auswahlbänden von den übrigen Gedichten getrennt: in ihnen waltet eine andere Logik, eine andere Assoziationsfolge als in denen aus dem wachen Leben. (Nur im weiteren Raum des Gedichtzyklus Travelling ist es mir gelungen, einige Übergänge von einem Bereich zum anderen zu schaffen.) Trotzdem nehme ich an, daß meine Leser unter anderem geträumt haben, daher dem Traummaterial und den Traumvorgängen nicht fremder gegenüberstehen als Bildern aus der sogenannten Wirklichkeit, den Zivilisations- und Naturphänomenen. Um den Gegensatz subjektiv und objektiv kümmere ich mich immer weniger. In der gegenständlichen Lyrik, wenn sie gelingt, findet das Subjektive immer sein objektives Korrelat, wie es T.S. Eliot nannte; übrigens auch das Objektive sein subjektives. Dazu kommt, daß vieles von dem, was ich früher für individuell und subjektiv hielt – und in meinen früheren Gedichten symbolisch oder metaphorisch verkleidete – nun für mich zu Varianten und Mutationen der conditio humana geworden ist; und auch in dieser läßt sich praktisch und existentiell das Äußere vom Inneren eigentlich nicht trennen, da ja Menschen mehr oder minder fühlende und denkende Wesen sind. Da ich mir aber innerhalb meiner Gegenstandsbezogenheit kein Programm, keine weltanschauliche Selbstzensur auferlege – auch diese stellt sich ohnehin durch die mir gegebenen Grenzen ein, durch das, was ich glaube, erhoffe und liebe, wie aus seinem Gegenteil −, passiert es auch, daß ein Gedicht dem, was ich für meinen Arbeitsprozeß halte, überraschend zu widersprechen scheint. Erst beim Vorlesen des Gedichts „Loach“ („Schmerle“) bemerkte ich, daß der englische Name dieses kleinen Fisches zu einem hohen Grade meine Wortwahl in diesem Text bedingt hatte, in dem die erste Hälfte des Gedichts vom Vokal „O“ und dem Konsonanten „l“ beherrscht, ein thematischer Wendepunkt mit dem „ch“-Laut im Worte „richly“ eingetreten war. Dabei ist „Loach“ eines der nüchternsten, faktischsten meiner Dinggedichte, aus langer Beobachtung dieses unauffälligen Tiers entstanden, mit keiner anderen Absicht, als dessen Wesenheit in Worte zu fassen. Die Aufteilung und Modulation der Laute in einem einzelnen Wort sind aber ein Verfahren, das in der „konkreten“ Poesie konsequent und methodisch betätigt wird. Mein Gedicht sollte in einem ganz anderen Sinne konkret sein – in Bezug auf den Gegenstand, nicht auf das Medium, die Sprache. Les extrêmes se touchent – weil auch die Möglichkeiten einer Lyrik überhaupt begrenzt sind und es auch im größeren Wandel der Kunsttendenzen keinen linearen Fortschritt, sondern kreisende, spiralige Bewegungen gibt.
Die zweifache Konkretheit des Gedichts ging in meiner eigenen Verdeutschung des Textes verloren, da mein Deutsch zu einer akustischen Mimetik nicht ausreichte und diese ja vom englischen Namen des Fisches ausgegangen war. Falls mein Verfahren im Originaltext auf Nominalismus oder Wortmagie deutet, weiß ich keine Begründung oder Erklärung dafür. Rezensenten meiner Gedichte heben gerade meine Sprachskepsis hervor. Daß das eine das andere nicht ausschließt, Sprachskepsis und Sprachmystik zu spannungserzeugenden Gegenpolen werden können, haben zum Beispiel Hofmannsthal, Fritz Mauthner, Gustav Landauer, Ludwig Wittgenstein und Ingeborg Bachmann auf verschiedene Weisen, lyrisch und prosaisch, dargelegt.
Wenn es aber in lyrischen Gedichten seit der Romantik ein Denken gibt, ist dieses fast immer ein ganz anderes als das philosophische. Was in einem Gedicht an Gedanklichem ins Spiel kommt, mag sich mit philosophischen Erkenntnissen decken, hat aber nicht die Verbindlichkeit philosophischer Aussagen. (Das hat sich freilich seit Hesiod und den Vorsokratikern geändert. Die Philosophie war einmal dichterisch. Die Dichtung konnte auch noch so lange philosophisch sein, bis sich die Naturwissenschaften zu sehr spezialisierten und verselbständigten. Goethes Die Morphologie der Pflanzen war ein später Versuch, diese Entwicklung rückgängig zu machen, diese Spezialisierung und Verselbständigung durch Konzentration auf das sinnlich und übersinnlich erfaßte Phänomen aufzuheben. Die spätere Unverbindlichkeit hat der portugiesische Lyriker Fernando Pessoa zu einem Prinzip gemacht, als er für die Lyrik die Freiheit des Dramatikers und Romanciers, imaginäre Personen zu schaffen, forderte und sich selber in vier verschiedene Personen, samt ihren Weltanschauungen, aufteilte.) Daher der nie endende Streit über die Deutung lyrischer Texte.
In einer 1967 geschriebenen Selbstinterpretation – oder auch Verweigerung einer Selbstinterpretation – eines Rollengedichts von mir, dem Beethoven-Gedicht „At Fifty-Five“ (welches manche Kritiker als ein persönliches Bekenntnisgedicht deuteten, mit um so mehr Berechtigung, als der Name Beethovens weder im Text noch im Titel genannt wird), formulierte ich das so:
Was also sagt das Gedicht aus? Es stellt überhaupt keine Behauptung auf. Es führt einen Prozeß aus. Und was mich betrifft, so macht es wenig aus, ob die Person im Gedicht wiedergibt, was ich gesehen oder gehört habe oder was in meiner Vorstellung ein anderer gesehen oder gehört haben mag. Der Gegenstand eines Gedichts ist der irreführendste Faktor an ihm. Es ist der Gegenstand unter dem Gegenstand, der eine untergründige Einheit stiftet in dem Werk eines Autors als Ganzem, wie unterschiedlich und unvereinbar die in den Titeln herausgestellten Anlässe auch sein mögen. Dieser Gegenstand unter dem Gegenstand ist der Kontrolle des Dichters entzogen. Nur beim Wiederlesen seines Werks oder beim Lesen der Reaktionen anderer darauf wird er sich des Zusammenhangs bewußt… Gedichte wissen es besser. Eines der größten Glücksgefühle beim Gedichtschreiben besteht darin, daß Gedichte einem mitteilen, was man denkt oder fühlt, was man ist, war oder sein wird, woher man kommt und wohin man geht. Es gab eine Zeit, da ich zu wissen meinte, woran ich glaubte, und ich bürdete dieses Wissen den Gedichten auf, die ich schrieb. Das sind Gedichte, die mir heute peinlich sind. Diejenigen aber, die mir nicht peinlich sind, überraschen mich, denn sie wissen wirklich mehr als ich – sogar über mich selbst.
Verwandte Einsichten, die aber in keine Behauptungen münden, sondern einen Prozeß ausführen oder nachvollziehen, haben vielleicht an dem nur wenig später geschriebenen Gedicht „Envoi“ mitgewirkt – dem einzigen aus reiferen Jahren, aus dem ich selber poetologische Schlüsse ziehen könnte, wenn auch widerspruchsvolle, ganz und gar nicht programmatische; und auch das nur, weil es bei der Zusammenstellung eines Gedichtbuchs entstand, die darin enthaltenen Texte gewissermaßen verabschiedete und damit eine Stellungnahme hervorrief:
Goodbye, words.
I never liked you,
Liking things and places, and
Liking people best when their mouths are shut.
Go out and lose yourselves in a jabbering world.
Be less than nothing, a vacuum
Of which words will beware
Lest by suction, your only assertion, you pull them in.
For that I like you, words,
Self-destroyed, self-dissolved
You grow true.
To what? You tell me, words.
Run, and I’ll follow,
Never to catch you up.
Turn back, and I’ll run.
So goodbye.
Obwohl auch dieses Gedicht zu den ganz wenigen gehört, die ich selber übersetzte, weil es kein anderer getan hatte und ich eine Übersetzung für eine deutsche Auswahl brauchte, zitiere ich es im englischen Originaltext. Eine Selbstinterpretation verweigere ich wieder, schon weil ich sie ausnahmsweise mit der eben zitierten Prosa halbwegs vorweggenommen habe. Insofern es aber ein Gedicht ist, mußte es über die prosaischen Erkenntnisse hinausgehen, sich lakonischer und drastischer, rücksichtsloser und provozierender betragen.
Dadurch, daß ich in meiner biographisch zweiten Sprache schreibe, die früh zu meiner literarisch ersten wurde, gelte ich unter Lyrikern als Sonderfall. Die mir zugeschriebene Zweisprachigkeit ist aber eine sehr beschränkte, da es mir nur einmal gelungen ist, ein nicht ganz verwerfliches Gedicht auf deutsch zu schreiben; und das war ein Gedicht, welches sich aus der Lektüre deutscher Gedichte und der Sympathie mit ihrem Verfasser, Ernst Meister, ergab, darum sich auch sprachlich nicht weit von seiner Quelle entfernte – also auch ein Sonderfall.
Was die Sprachskepsis anbelangt, das Mißtrauen gegenüber den Wörtern, mag meine mit dieser anscheinenden, unvollständigen Zweisprachigkeit zusammenhängen, obwohl sich meine Vorliebe für die nicht redenden Wesen Tiere, Pflanzen und sogar Steine – schon in der frühen Kindheit, vor der Emigration aus Deutschland, bemerkbar gemacht hatte. Eine plötzliche Versetzung mit neun Jahren von einem Sprachbreich in einen anderen – wobei der Sprachbereich ja zugleich ein Erlebnis-, Kultur- und Gesellschaftsbereich ist – hat die Wucht eines zweiten Sündenfalls oder einer zweiten Sprachverwirrung. Sie ist der Verlust jeder sprachlichen Unschuld und Unbefangenheit, die man der Selbstverständlichkeit des Nennens verdankt und die einem erlaubt, so zu reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Eine gewisse Sprachverfremdung, Sprachkritik oder auch Sprachskepsis hat zwar an dem Entstehen jeder literarischen Eigenart einen Anteil, meistens aber auf eine weniger traumatische Weise. Die verlorene Unschuld mußte ich nun zum Teil hinter den Namen, immer mehr in den Dingen und Wesen selber suchen. Da ich mit spätestens fünfzehn Jahren ernstlich begann, englische Gedichte zu schreiben und deutsche zu übersetzen, liegt diese Besonderheit für mich so weit zurück, daß ich mir auch darüber keine Gedanken mehr mache, wenn mich nicht die Kritiker meiner Gedichte darauf aufmerksam machen, was immer wieder geschieht. Zwischen den Sprachen hieß eine nicht sehr glückliche Zusammenstellung von ins Deutsche übersetzten Gedichten und vermischten Prosatexten, die ich entweder auf englisch oder auf deutsch geschrieben habe, nachdem mich Rudolf Hartung dazu gebracht hatte, im Alter von bald vierzig Jahren meine ersten kleinen Prosastücke auf deutsch zu schreiben. Rudolf Hartung hatte übrigens dieses Buch nicht nur bewerkstelligt und betreut, sondern auch den Titel beigetragen. Weder er noch ich können damals bedacht haben, daß ein Aufenthalt „zwischen den Sprachen“ für einen Schreibenden einem Zwischen-zwei-Stühle-Gefallensein gleichkommt. Das traf wohl auch auf meine steife, schwerfällige deutsche Prosa zu. Was meine englischen Gedichte betrifft, hatte ich jedoch keinen Grund zu bezweifeln, daß sie – trotz Sprachskepsis in der Umgangssprache und der tradierten lyrischen einigermaßen behaust waren. Ein zweiter Schnabel hatte Zeit gehabt, den durch Nichtbenutzung zur Atrophie verdammten zu ersetzen.
Andere sollen beurteilen, inwiefern mich meine Zweisprachigkeit zu einem Sonderfall unter den englischen Lyrikern macht. Daß ich zwischen den Literaturen und den verschiedensten Literaturtraditionen begann, kann ich ohne weiteres bestätigen. Das erste Gedicht von mir, welches über Schulzeitschriften hinaus veröffentlicht wurde, war ein mit siebzehn Jahren geschriebenes Rollengedicht in der Person des greisen Hölderlin. Meine erste Buchveröffentlichung war der Übersetzungsband Poems of Hölderlin – mit einer viel zu langen, ausschweifenden Einleitung −, den ich mit achtzehn Jahren abgeschlossen hatte und der zum 100. Todestag Hölderlins erschien. Trotzdem waren die meisten meiner Gedichte aus dieser Zeit mehr von englischen und französischen Lehrmeistern abhängig als von irgendeinem deutschen Lyriker, obwohl ich dann noch mindestens 50 Jahre lang an meinen Hölderlinübersetzungen arbeitete. Nach der jugendlichen Selbstprojektion in diesen Dichter konnte ich weder aus der Thematik noch der Metrik Hölderlins irgend etwas übernehmen. Erst meine Jahrzehnte später geschriebenen Variationszyklen „Travelling“ und „In Suffolk“ ließen mich vermuten, daß durch die intensive und wiederholte Übersetzungstätigkeit etwas von der Dynamik, der Architektonik und dem langen Atem Hölderlins (der sich ja nicht nur durch die Zeilen, sondern auch durch die Strophen ziehen konnte) für mich brauchbar geworden war, für Themen und Gegenstände, die mit seinen höchstens unterschwellig zusammenhingen. Die zeitliche und kulturgeschichtliche Nähe von T.S. Eliot und W.B. Yeats – wie auch noch der französischen Dichter seit Baudelaire – machte diese zu bei weitem gefährlicheren Verhinderungen meiner Selbständigkeit. Im germanistischen Lehrplan Oxfords endete die „moderne“ Lyrik mit dem Triumvirat George-Hofmannsthal-Rilke. Trakl kam durch eigene Bemühungen früh hinzu. In einem Londoner Antiquariat fand ich auch während des Krieges das Heft Spaltung von dem mir ganz unbekannten Gottfried Benn und kaufte es mir. Obwohl ich später Gedichte von Benn, wie von Trakl, übersetzte und über beide schrieb, lag mir Benns Abart der „absoluten Kunst“ so fern, daß sie mein Gedichteschreiben nicht beeinflussen konnte. Weder Brecht noch deutsche Lyrik einer jüngeren Generation waren mir in jenen Kriegs- und frühen Nachkriegsjahren bekannt oder zugänglich. Da ich damals unter den englischen Zeitgenossen für W.H. Audens Lyrik wenig übrig hatte, glaube ich, daß ich auch die Lyrik Brechts zu jener Zeit abgelehnt hätte. Wie die Lyriker – Sidney Keyes, Philip Larkin, John Heath-Stubbs und David Wright −, mit denen ich 1941-1942 in Oxford verkehrte, war ich nämlich noch in einer romantisch-symbolistischen Tradition verfangen. Eine Lockerung dieser Verfangenheit hätte wohl selbst eine Konfrontation mit Brecht nicht bewirkt. Erst meine Erfahrungen als Soldat haben mich auf den verspäteten Schock einer solchen Konfrontation vorbereitet. Mindestens ein weiteres Jahrzehnt lang habe ich dann noch diesen Kampf der Antinomien in Gedichten ausgefochten; und noch meine 1968 abgeschlossene Arbeit The Truth of Poetry (Wahrheit und Poesie 1985) ging von den Gegensätzen und Widersprüchen aus, die mir schon als Student in den Schriften Baudelaires aufgefallen waren, weil sie sich mit meinen eigenen berührten.
Meine gegenwärtigen Schwierigkeiten sind keine ästhetischen oder poetologischen – diese sind längst arbeitsimmanent geworden −, sondern ergeben sich aus meiner Gegenstandsbezogenheit. „Wozu Dichter in technischer Zeit?“ – um es parodistisch abzukürzen. Dazu einer Zeit, in der das Fortbestehen meiner Gegenstände, der stummen und redenden, immer fraglicher wird. Wenn ich jetzt die zerstörerischen regressiven Wunschträume Gottfried Benns aus den Zwanzigerjahren lese, haben sie eine andere Bedeutung als früher: nämlich daher, daß ich mir nun die Möglichkeit eines wenigstens biologischen Weiterlebens nach der Zerstörung – einer Evolution aus den nie total zu vernichtenden Lebenskeimen vorstellen muß, um nicht aus dem Zweifel an jeder Beständigkeit zu verstummen. Wenn das gelingt, schreibe ich noch Gedichte, zum Beispiel über nicht ganz verschwundene Baumarten oder über die ganz verschwundenen Wandertauben Amerikas; auch immer zugleich über die Menschen, deren Bewußtsein und Unbewußtsein ja zu meinen Gegebenheiten gehören.
Michael Hamburger, in: Wespennest. Zeitschrift für brauchbare texte und bilder, Nr. 66, 1987
W.G. Sebald besucht Michael Hamburger. Ein Text aus dem W.G. Sebald-Forum für den ausgewanderten Schriftsteller, Wanderer, Germanisten, Autor des Elementargedichts „Nach der Natur“ und weiterer Werke. Eingerichtet von Christian Wirth.
ANFRAGE BEI HAMBURGER
NACH BRIEFEN VON BORN
aaaaa1
er müsste
seinen geburtsschein auch
noch unbedingt finden
in seinem keller wär keine
ordnung mehr
nach dem wasserschaden
er müsste
den geburtsschein dringend
suchen und
die alte lebensversicherung
die jetzt nötig wär
aaaaa2
aber die gedichte
wo die augen versagen
die ohren schon aufgegeben
haben
aber die gedichte trotzen
noch immer allen schwächen
schreibt er: weil
keines das letzte sein will
Anna Breitenbach
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLfG + IMDb +
Archiv + Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Voß-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Michael Hamburger: P.E.N. ✝ Die Zeit ✝ BZ ✝ SZ
Michael Hamburger – Ein englischer Dichter aus Deutschland. Ein Film von Frank Wierke (hier in voller Länge).


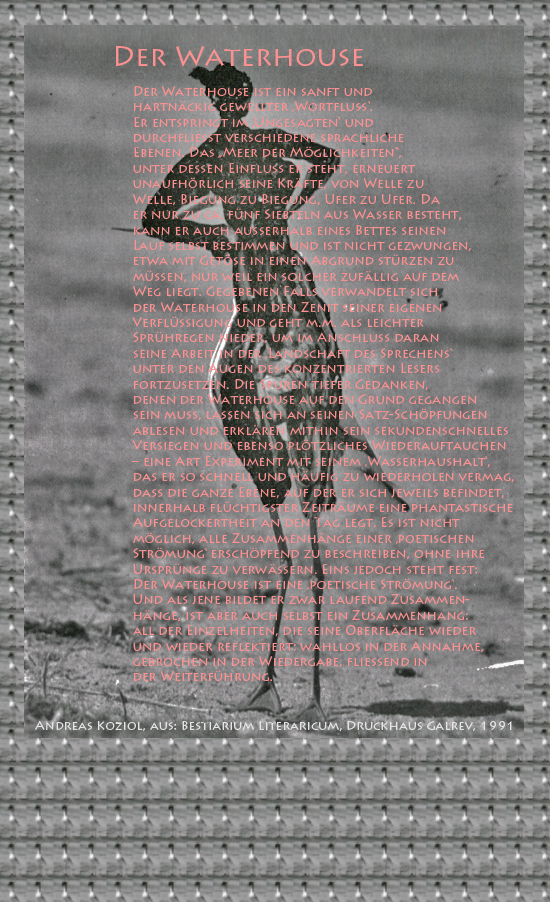













Schreibe einen Kommentar