Michael Hamburger: Todesgedichte
TREFFPUNKT
LCB
Es ist der Morgen nach einer Feier
Zum Gedenken eines toten Dichters, der natürlich
aaaaaauch schon hier war
Wie alle erinnerten Toten, erinnerten Lebenden
Von denen aus fernen Häusern ein paar gekommen
aaaaasind,
Ein paar nicht, zu beschäftigt oder alt,
Körper oder Eitelkeit schon so entkräftet
Daß sie sie nicht in Wagen oder Bahn bringen konnten
Für noch ein Treffen mit ihresgleichen,
Den Toten, ferne Lebende und nahe.
Heute, Kirchenfeiertage, über dem Novembersee
Wo kein Boot und keine Yacht das graue
Auch nicht windgeraufte Wasser spurt, aus der Stadt
Kein Ton und kein Getöse bebt und schwankt,
In der alten Villa haben unsichtbare Hände
Alle Nachreste unsrer nächtlichen Versammlung aufgeräumt.
Übernachtungsgäste sind abgereist. Zum kalten Frühstück,
Heißem Kaffee aus einer Thermoskanne die wartet
Auf mich – den letzten? – oder niemand, von ihr gelassen
Die den Tisch für Nachzügler gedeckt hat,
Gesichtslos ihr und namenlos, geh ich hinunter,
Sitz dort für mich und lausche: keiner regt sich
Von denen die hier waren, jüngst oder längst gegangen.
„Wie geht’s dir?“ wie geht es ihr, ist er nicht hier,
Der Witwe, die ihre Katzen nicht alleine lassen konnte
Weit weg, im Süden; dem Freund, ganz nah,
Der sein Zimmer nie verläßt?, tönte das Gespräch;
Auch Liebe, hinter diesem, zu Toten und den Lebenden,
Nahen, fernen, erinnert oder halbvergessen,
Streckte nervöse Fühler aus, tastete
Und wußte: wie immer es dir, ihr, ihm ginge,
Jeder, ob anwesend, abwesend, irgendwo wäre zu Haus,
Wirklicher als an dem Treffpunkt.
Tod ist hier
sowohl Vergehen und Verlust als auch Übergang, verwandelte Präsenz. Die im 19. Jahrhundert ausgestorbene, ausgerottete Vogelfamilie der Wandertauben, die nicht mehr ist, hinterlässt in der Stille Zeichen, Flügelrauschen und Schatten am Himmel; ihr „Immer-Noch“ ist damit ein wenig auch Gedichten verwandt, in denen Abwesendes zurückkehrt in Gegenwart. Der Winterjasmin, in der kalten Jahreszeit, blüht, öffnet dem „Nichtsein der Bienen“ seine vielen „Scheinsonnen“, seine Blumen, lebt inmitten der Zeit des Todes. Freunde sind tot, aber Erinnerung, Namen, Sprache erblühen in der Winterlichkeit. So sprechen diese Gedichte nicht von Angst, sondern beinahe von einer Zuversicht, von Kontinuität.
Folio Verlag, Ankündigung, 1998
Sprich dich aus, Amsel, schweige, Pfau
Wie die Hand eines Musikers die Balance zwischen vollkommener Ruhe und gespannter Kontrolle wahren muß, um den idealen Ausdruck von Emotionen und Gedanken zu ermöglichen, so hat Michael Hamburger seine englische Eigensprache zu solch absichtsloser Präzision geführt, daß in ihr die ungewöhnlichsten Wahrnehmungen und Sachverhalte Gestalt annehmen können. Nach den Gedichten über Traumerfahrung und Beschreibungen von Bäumen legt Peter Waterhouse nun auch eine Übersetzung der „Todesgedichte“ vor.
Im Original heißen sie zwar bloß „Other Poems“, doch bilden Altern, Tod und späte Begegnungen darin ein so ernstes Motivgeflecht, daß das grelle Etikett gelten mag. Zu den dunkelsten Geschichten der Sammlung gehören jene über die Schwester, die nach einer Schädeloperation im Koma liegt, und die drei Gedichte über das Altern. Andererseits setzen Texte wie „Winterjasmin“ Hamburgers Baumgedichte fort, aber schon das „Wintergeißblatt“ macht wieder aus dem duftenden Weiß mitten im Frost ein lichtes Andenken an eine Tote. Einer der schönsten Texte des Bandes gilt der Begegnung mit dem Dichter Tadeusz Rozewicz, die beinahe an einer Flut in England gescheitert wäre und die dann doch gelang:
Wenn du den Regen zu Ende gehen sahst,
Die Wiesen, die Marsch erstrahlen
In Helligkeit, welche die Linien
Von Plan und Begrenzung ertränkte.
Waren wir vereint in jenem Erstlicht;
Gleicher Schlamm an den Stiefeln, deinen und meinen.
Gemeinsam mit ihnen sehen wir zu den „winzigen Worten, Papierschiffchen / Die eine Weile tänzeln als Zeichen / Auf Wassern gekreuzt und gequert“.
Wie man gerade aus dem Zufälligen Kunst machen kann, zeigt auch das Gedicht „Ein Überlebender“, das einen Besuch im Schloßpark von Niederschönhausen beschreibt, der Residenz des ersten DDR-Präsidenten. Das harmlose Schlendern wird plötzlich zum Blickduell mit einem Eichhörnchen, schwerelos und unwägbar – bis der Eindringling zurückweicht. Hamburger, 1924 in Berlin geboren und 1933 mit seiner Familie nach England emigriert, hat in dieser bizarren Situation jene Zurückhaltung gestaltet, die die Bruchlinien historischer Erfahrung bisweilen auch über die Vernunft hinaus erfordern. Vollends zu sich kommt Hamburgers Dichten in jenen Naturbildern, die keinen symbolischen Modesinn mehr brauchen:
Und jetzt da wir suchen nach nichts, einteilen nichts,
Sitzt die Libelle mit dem Flügelschlag unsichtbar schnell
Still, wärmt sich in Reichweite der Hand.
Ohne zu klassifizieren und ohne täppischen Berührungsversuch trotzdem genau zu sein, darin liegt die beglückende Gewaltlosigkeit von Hamburgers Kunst.
Indes war man selten so dankbar für eine zweisprachige Ausgabe wie für diesen schönen Band, denn Waterhouse, der sich so intensiv für Hamburger einsetzt, unterläuft seine Leistung zugleich auf verstörende Weise. Formen wie „des Gras“ und „Parklein“ sind schlicht falsch. Die Wendung „an openess of sky“ meint gerade nicht „das Himmelszelt“, und der Satz „Ohne viel zu wissen, wissen wir ihn sehr“ ist syntaktisch-semantischer Nonsens. Denn die Worte „By silent rescience we know him best“ bezeichnen die angemessen stille Unvertautheit mit einem zugewanderten Pfau im Garten.
Vollends zum übersetzerischen Wortbruch kommt es im „Gespräch mit einer Amsel“, das lautmalerisch den Dialog des Dichters mit einem Vogel wiedergibt, in dem Dichtung und ihre Theorie zur Sprache kommen. Auf das Vogelgezwitscher des Anfangs antwortet der Dichter:
Übersetzt sagt mein Antwort-Pfiff:
Sprich dich aus, Unsersgleichen liebt
Sicherheit, Lieder mit Ergebnis.
Daß man uns raten läßt,
Ertragen wir nicht lange.
Darauf repliziert, so Waterhouse, der Vogel:
Wir wiederholen, nie wirds ganz.
…
Vermisch. Es ficht mich nicht
Wenn es nicht stimmt.
Im Original freilich besagen die letzten beiden Verse anderes:
Vary it. Don’t care a bit
If it’s indefinite.
Der Vogel „vermischt“ also nichts, vielmehr „variiert“ er, das antiquiert-falsche „Es ficht mich nicht“ steht für das schlichte „Es macht mir nichts“, und das Lieder nicht stimmen, mag zwar Waterhouse egal sein, nicht Hamburgers Amsel. Sie lehrt, auf ein ganz anderes Geheimnis zu hören: Gesang als Natur und höchste Kunst ist „unbestimmt“, darf und muß uneindeutig und unabgeschlossen bleiben.
Ein Übersetzer, der seinen Text an entscheidenden Stellen wie dieser und zahlreichen anderen so weit verfehlt, muß sich dann allerdings fragen lassen, ob er überhaupt richtig zuhört. Und zwar nicht dem Rezensenten, sondern der unverdrehten Sprache von Hamburgers Gedichten.
Thomas Poiss, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.2.1999
Meine Gedichte
Wenn ich mich – über ein halbes Jahrhundert hinweg – meinen literarischen Anfängen zuwende, fällt mir vor allem auf, wie ausschließlich literarisch sie waren – als ob die Literatur eine zweite Welt, eine Gegenwelt, wäre, in die man sich aus der gegebenen flüchten könne. Obwohl mein späteres Gedichteschreiben auf dem entgegengesetzten Sachverhalt beruht, so daß meine Gedichte nur noch solche sein können, deren Rohmaterial die eigene, von mir selber ermittelte und verarbeitete Erfahrung ist, weiß ich jetzt, daß auch diese frühe Phase ihre Berechtigung und Notwendigkeit hatte. Bevor ich überhaupt zu leben und erleben lernte, mit einigermaßen offenen Sinnen, konnte ich nämlich die erste Welt nur durch Vermittlung, durch die Gedichte von anderen, also über jene zweite Welt aufnehmen. Darum wurde jede Entdeckung eines für mich neuen Dichters, mit dem ich mich eine Zeitlang identifizierte, zu der einzigen mir damals angemessenen Art der Selbsterkenntnis und der Selbstentwicklung.
Gewiß sind nicht alle jungen Menschen mit der gegebenen Welt so unzufrieden, wie ich es war, haben darum kein so dringendes Bedürfnis, mit Hilfe des geschriebenen Worts ihre Befremdung zu verstehen, wenn nicht zu überwinden. Für alle ist aber wichtig, was sie in der Kindheit und Jugend lesen und hören, da es nur in den frühen Entwicklungsstadien gar keine Grenze zwischen dem Eigenen und dem Angeeigneten gibt. Noch jetzt bleiben mir jene Gedichte und Gedichtteile im Gedächtnis, die ich damals auswendig lernte, weil sie mich so unmittelbar angingen wie Worte, die man zu mir sprach, oder Dinge, die ich mit eigenen Augen sah manchmal sogar stärker und dringender, da meine Augen so vieles von dem, was sie sahen, gar nicht aufnehmen wollten. Daß das eine „Literatur“ hieß, das andere „Leben“ oder „Wirklichkeit“, hatte für mich noch keine Bedeutung. Fast von Anfang an gehörte zwar vieles und ganz Verschiedenes zu den von mir durch Selbstidentifizierung oder auch Selbstprojektion aufgenommenen Gedichten – die dann fürs ganze Leben meine wurden, weil ich sie, wie man auf englisch sagt, „by heart“ gelernt, mir ins Gedächtnis eingeprägt hatte. Mit 15 Jahren spezialisierte ich mich nämlich schon in der Schule auf die „modernen Sprachen“, Französisch und Deutsch, setzte dann diese Spezialisierung in Oxford fort, wo ich mit kaum 17 Jahren Student wurde. Dazu kam das Latein, in dem man damals noch eine Prüfung bestehen mußte, um in Oxford studieren zu dürfen. Mit 15 Jahren hatte ich auch schon begonnen, neben dem Schreiben englischer Gedichte, die ich für eigene hielt, deutsche zu übersetzen – zuerst ein sentimentales von Theodor Körner, dann ethisch beispielhafte von Goethe – „Edel sei der Mensch…“ – und einige liedhafte von Rilke, bis ich auf Hölderlin stieß, den mein Klassenlehrer nicht zu den beachtenswerten deutschen Dichtern zählte. Damit hatte ich mich, was ich nicht wußte, auf eine lebenslange Übersetzungsarbeit eingelassen. Noch immer arbeite ich an einer letzten, wieder erweiterten Ausgabe meiner Hölderlinübersetzungen, nachdem ich schon mit 17 Jahren eine erste Buchauswahl fertig hatte, die 1943, zum hundertsten Todestag Hölderlins, erschien.
Die vielen Dichter, die ich neben Hölderlin in späteren Jahren übersetzte, möchte ich hier gar nicht aufzählen. Auch wenn das Übersetzen ebenfalls eine Art Aneignung ist, wurde es für mich immer mehr ein Dienst an Texten, der ohne Selbstidentifizierung mit dem Autor verrichtet werden konnte, jedoch keineswegs ein Ersatz für eigenes Schreiben war. Deshalb konnte ich so vieles und Verschiedenes übersetzen aus dem Deutschen Gedichte von Walther von der Vogelweide bis zu Gedichten aus der letzten Zeit, selbstverständlich immer nur in Auswahl, innerhalb der Grenzen meiner Kenntnisse und Sympathien; auch französische Gedichte aus mehreren Jahrhunderten, Gedichte aus Sprachen wie die italienische, die ich nie schulmäßig gelernt hatte, und ausnahmsweise sogar solchen, wie die rumänische, ungarische und – nur einmal! chinesische, die mir ganz fremd und nur aus zweiter Hand zugänglich waren. Immer weniger sollten die von mir übersetzten Gedichte meine Gedichte werden. Nur ganz selten geschah es, daß Bruchstücke aus meinen Übersetzungen in eigene Gedichte eingingen, als Anklänge oder auch Themen für Variationen; wie vor kurzem wieder, als ich eine vor Jahrzehnten gemachte und schon vergessene Übersetzung von Zeilen Walther von der Vogelweides wiederfand und plötzlich darin das Thema und sogar die Bilder eines gerade geschriebenen Gedichts von mir erkannte, dann zwei weitere schrieb, die sich nun auf den übersetzten Text bezogen.
Selbst wenn ich mich hier auf solche Dichter beschränkte, die ich entweder in eigenen Gedichten zitiert und variiert, oder über welche ich in der frühen Phase Gedichte geschrieben habe, durch Selbstidentifizierung oder Projektion, wären das schon zu viele; und andere habe ich bewußt oder unbewußt nachgeahmt, als meine Gedichte noch nicht meine waren. Ich müßte zu meinen ersten Vorbildern zurückgehen in der englischen Lyrik Shakespeare, Sir Walter Raleigh, die sogenannten „metaphysical poets“ (Barockdichter), Thomas Gray im 18., Alfred Tennyson und Gerard Manley Hopkins im 19., T.S. Eliot und Dylan Thomas im 20. Jahrhundert; unter französischen Gérard de Nerval, Baudelaire, Rimbaud und Mallarmé, aber auch Villon, Ronsard und Alfred de Vigny – also von Anfang an eine ganz subjektiv bedingte Auswahl aus dem Verschiedenartigsten, die ich nur autobiographisch begründen könnte.
Deutlich erinnere ich mich an die zufällige Entdeckung eines anderen englischsprachigen Dichters, William Butler Yeats, welcher nicht unter den damals am meisten gelesenen und diskutierten modernen Lyrikern war. Daher kam es wohl, daß ich in Bangor, Wales – wo ich im Jahre 1941 die Ferien verbrachte, nachdem unser Londoner Haus von Bomben beschädigt worden war – in einer Buchhandlung noch drei seiner Bücher fand, die 1935, 1938 und 1940 erschienen und liegengeblieben waren. Jenes von 1935, A Full Moon in March, endete mit einem Gedicht, das mich wie kein anderes ansprach und noch jahrelang beschäftigte, ganz besonders, nachdem ich als Soldat in Italien und Österreich den Zusammenbruch einer Zivilisation erlebt hatte. Das Gedicht heißt „Meru“ – der Ort im asiatischen Rußland, der nach indischer, persischer und arabischer Überlieferung einmal Paradies und Ursprung des Menschengeschlechts gewesen war:
Civilization is hooped together, brought
Under a rule, under a semblance of peace
By manifold illusion; but man’s life is thought,
And he, despite his terror, cannot cease
Ravening through century after century,
Ravening, raging, and uprooting that he may come
Into the desolation of reality:
Egypt and Greece, good-bye, and good-bye, Rome!
Hermits upon Mount Meru or Everest,
Caverned in night und er the drifted snow,
Or where that snow and winter’s dreadful blast
Beat down upon their naked bodies, know
That day brings round the night, that before dawn
His glory and his monuments are gone.
Die Zivilisation hält Bänder zusammen; sie wird
In eine Ordnung, den Anschein des Friedens, gebracht
Durch vielfache Illusion; doch des Menschen Leben ist Denken,
Und er, trotz Todesangst, kann es nicht lassen,
Raubgierig die Jahrhunderte zu durchschweifen,
Raubgierig rasend und entwurzelnd, um einzugehn
In die Verwüstung seiner Wirklichkeit:
Ägypten, Griechenland, lebt wohl, und Rom, leb wohl!
Einsiedler auf dem Berg Meru oder Everest,
In Höhlen nachtend unter gehäuftem Schnee
Oder wo Schnee, wo Winterstürme grausam
Ihnen die nackten Leiber peitschen – diese wissen,
Daß Finsternis dem Licht folgt, daß, wenn es tagt,
Ihm keine Herrlichkeit, kein Denkmal bleibt.
Unter der anti-modernen Rhetorik dieses Gedichts, die aber durch rhythmische Freiheit aufgelockert ist, berührte mich eine durchaus zeitgemäße Erkenntnis, aber aus weiterer und schärferer Sicht als jene der damals als aktueller, zeitgemäßer bewunderten Lyriker, wie W.H. Auden. Die Rhythmik und das – oft sehr viel modernere – Vokabular der späteren Lyrik von Yeats, wie auch etwas von seiner Thematik, wirkten dann ein Jahrzehnt lang so stark auf meine Lyrik, daß ich mich gegen diesen Einfluß wehren mußte.
Daß Yeats, sogar etwas früher, auf die Rhetorik verzichten konnte, um seine überzeitliche, trans-historische Sicht oder Vision zu vermitteln, beweist das kurze Gedicht „Oil and Blood“ welches ich auch in der ausgezeichneten Übersetzung von Franz Baermann Steiner anführen kann:
In tombs of gold and lapis lazuli
Bodies of holy men and women exude
Miraculous oil, odour of violet.
But under heavy loads of trampled clay
Lie bodies of the vampires full of blood;
Their shrouds are bloody and their lips are wet.
In Goldgrüften und Lapislazuli
Leiber der heilgen Männer, heilgen Fraun:
Wundersam Öl entströmt, des Veilchens Duft.
Doch unter schwerer Last gestampften Lehms
Ruhn Leiber der Vampire voll des Bluts;
Blutig ihr Lailach, ihre Lippen naß.
Hier wird die Rhetorik von „Meru“ durch Bildlichkeit ersetzt; aber der gleiche Dualismus – Öl und Blut, Kunst und Natur, die reine platonische Idee und das menschliche Raubtier – tritt noch zugespitzter hervor. Diesen Dualismus wollte ich nicht von Yeats übernehmen.
Daß ich von Hölderlin in meine Gedichte nichts Greifbares übernehmen konnte – weder seine Formen noch seine Thematik, höchstens etwas von seinem Atem – hatte ich längst durch frühe Versuche erfahren. Aber der deutsche Dichter und der mehr als ein Jahrhundert später geborene irische hingen doch für mich zusammen, nämlich durch jenes weltgeschichtliche Bewußtsein und die daraus gewonnene Einsicht in das Tragische, welche Hölderlin in seinem Epigramm über Sophokles so zusammenfaßte:
Viele versuchten umsonst das Freudige freudig zu sagen;
Hier spricht endlich es mir, hier in der Trauer sich aus.
So wie Yeats in den zitierten Gedichten die Zerstörungswut der Menschen nicht verurteilt, sondern darstellt, war es auch in einer der tragischen Oden Hölderlins, „Stimme des Volkes“, geschehen, im Rückblick auf griechische und römische Geschichte:
… Denn selbstvergessen, allzubereit, den Wunsch
aaaDer Götter zu erfüllen, ergreift zu gern
aaaaaaWas sterblich ist, wenn offnen Augs auf
aaaaaaaaaaEigenen Pfaden es einmal wandelt,
Ins All zurück die kürzeste Bahn; so stürzt
aaaDer Strom hinab, er suchet die Ruh, es reißt,
aaaaaaEs ziehet wider Willen ihn, von
aaaaaaaaaKlippe zu Klippe, den Steuerlosen,
Das wunderbare Sehnen dem Abgrund zu;
aaaDas Ungebundne reizet und Völker auch
aaaaaaErgreift die Todeslust und kühne
aaaaaaaaaStädte, nachdem sie versucht das Beste,
Von Jahr zu Jahr forttreibend das Werk, sie hat
aaaEin heilig Ende troffen; die Erde grünt
aaaaaaUnd stille vor den Sternen liegt, den
aaaaaaaaaBetenden gleich, in den Sand geworfen,
Freiwillig überwunden die lange Kunst
aaaVor jenen Unnachahmbaren da; er selbst,
aaaaaaDer Mensch, mit eigner Hand zerbrach, die
aaaaaaaaaHohen zu ehren, sein Werk, der Künstler…
Das ist nur ein Teil eines Gedichts, in dem die Gegensätze, wie meistens bei Hölderlin, dialektisch aufgelöst werden. Erst später und als Kritiker beschäftigte es mich, daß die Einsichten Hölderlins in das, was Yeats „heart mysteries“ (Herzmysterien) nannte, die weltanschaulichen von Nietzsche, Freud und Jung vorweggenommen hatten. Weil Yeats in der Gedankenwelt Nietzsches, Freuds und Jungs lebte, konnte er in einem anderen Gedicht, „The Circus Animals Desertion“, alle Konstruktionen des reinen Geists, wie sie in seinen Gedichten stehen, auf das bloße Menschenherz zurückführen:
aaaaaaaaaa… Now that my ladder’s gone,
I must Iie down where all the ladders start,
In the foul rag-and-bone shop of the heart –
mußte er sich ohne Leiter, unter Lumpen und Knochen, im „dreckigen Trödlerladen des Herzens“ hinlegen, weil dort alle Leitern beginnen. Auch solche Zweifel an der eigenen Berufung hatte Yeats mit Hölderlin gemeinsam. Dadurch, daß sie immer wieder neue Leitern aufstellen mußten, steigerte sich ihre Kunst ins Unerhörte.
Zu den jetzt bekanntesten, aber zu seiner Zeit gewagtesten Gedichten Hölderlins gehört einer seiner „Nachtgesänge“ die letzten, die er zur Veröffentlichung aussandte -: „Hälfte des Lebens“. Meine Übersetzung dieses Gedichts war fast die einzige, die ich seit meiner ersten, mit 17 Jahren versuchten Fassung kaum mehr veränderte −, wohl weil dieses Gedicht so bedingungslos durch seine Bilder, seinen Klang und seine rein poetische Syntax wirkt, daß – abgesehen von der Deutung der „Fahnen“ in der letzten Zeile – diese Bilder, dieser Klang und diese Syntax so genau wie in einer anderen Sprache möglich wiedergegeben werden mußten.
HÄLFTE DES LEBENS
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.
Dieses – wohl als Bruchstück entstandene, aber von Hölderlin als selbständiger Text erkannte – Gedicht erfüllt unter anderem alle Ansprüche, die die Modernisten von Mallarmé bis zu Ezra Pound und Gottfried Benn für die „reine“ oder „absolute“ Poesie viel später stellten: es ist ein Gedicht, dessen Bedeutung nicht durch Paraphrase erläutert werden kann.
Obwohl es mir immer gleichgültig war, ob meine Gedichte für „modern“ oder nicht galten, führte mich die Beschäftigung mit Hölderlin auf eine selbstverständliche Weise zu späteren Dichtern – und zwar nicht nur solchen, die wie der späte Rilke, Trakl, Bobrowski, Celan und Ernst Meister von ihm lernten oder in seine Nachfolge gestellt werden können. In der englischen Lyrik herrschte seit dem ersten Weltkrieg eine entgegengesetzte Richtung vor – fort von der „reinen“ oder „absoluten“ Poesie. Seit Brecht, aber besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde diese Polarisierung auch in der deutschen Lyrik akut.
Ein Jahrzehnt bevor ich mich mit dem Expressionismus oder Brecht oder der deutschen Nachkriegslyrik befaßte, hatten mich schon die Gedichte Georg Trakls gefesselt. Ich weiß nicht mehr, wann ich anfing, Gedichte von ihm zu übersetzen. Aber ein Gedicht über Trakl, welches ich 1946 in Österreich schrieb – wo ich in der britischen Besatzung als Offizier diente −, beginnt mit meiner Übersetzung von Zeilen aus Trakls Gedicht „Grodek“, geht dann zu dem Tod Trakls, nicht als Held, sondern Opfer des Krieges, über. Eine kleine Auswahl aus Trakls Gedichten – die erste überhaupt in englischer Sprache – konnte ich erst 1952 veröffentlichen. Nicht weniger als „Grodek“ hatte mich ein anderes seiner letzten Gedichte, „Klage“, ergriffen:
Schlaf und Tod, die düstern Adler
Umrauschen nachtlang dieses Haupt:
Des Menschen goldnes Bildnis
Verschlänge die eisige Woge
Der Ewigkeit. An schaurigen Riffen
Zerschellt der purpurne Leib
Und es klagt die dunkle Stimme
Über dem Meer.
Schwester stürmischer Schwermut
Sieh ein ängstlicher Kahn versinkt
Unter Sternen,
Dem schweigenden Antlitz der Nacht.
Ähnlich wie Hölderlins „Hälfte des Lebens“ wirkt dieses Gedicht durch seine bildhafte Struktur, auch die eigenartige Syntax, wie der logisch schwer erklärbare Konjunktiv „verschlänge“ in der vierten Zeile, welcher aber durch das Kolon nach dem vorhergehenden Bild der Adler ausnahmsweise doch zu einer Erklärung wird. Die Bilder des Gedichts sind zwar etwas konventioneller, weil weniger aus der Anschauung geholt, also subjektiver oder „expressiver“ als jene in Hölderlins Gedicht. Wenn man aber Trakls Text mit seiner gereimten Vorstufe, auch mit dem Titel „Klage“ vergleicht, wird wieder das Wagnis einer solchen freien Fügung das Erstaunliche an dem Gedicht.
Noch gedrängter und unmittelbarer reihen sich die Bilder in dem etwas früheren Gedicht von Trakl, „Untergang“, welches er an seinen Freund Karl Borromäus Heinrich richtete:
Über den weißen Weiher
Sind die wilden Vögel fortgezogen.
Am Abend weht von unseren Sternen ein eisiger Wind.
Über unsere Gräber
Beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht.
Unter Eichen schaukeln wir auf einem silbernen Kahn.
Immer klingen die weißen Mauern der Stadt.
Unter Dornenbogen
O mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger gen Mitternacht.
Gewiß lassen auch die Bilder in diesem Gedicht eine symbolische Deutung zu. Aber durch Vermeidung der Gleichnisse weIche noch bei Rilke dazu dienten, der Unvernunft der Lyrik einen Anschein von Logik zu geben – sagt das Gedicht nichts anderes aus, als was jeder Leser für sich den Bildern entnehmen kann. Es wird dadurch reine Poesie, daß es sich so weit wie möglich von den belehrenden und berichtenden Funktionen der Sprache entfernt.
Vielleicht habe ich nur angedeutet, daß alle die von mir gewählten Gedichte ihre unerhörte Sprache nicht einem ästhetischen Programm, sondern einer existentiellen – auch gesellschaftlichen und persönlichen – Krise verdanken. Aus existentieller Bedrängnis können aber auch Gedichte entstehen, die mit den gewöhnlichsten Mitteln der Umgangssprache auskommen. So ein kleines anonymes englisches Gedicht aus der Zeit um 1500, welches früh unter den von mir auswendiggelernten war und nicht weniger als die anderen meinen Begriff des Poetischen bestimmt hat – wozu eine Vorliebe für die kürzesten Wörter gehört. Übrigens gehörte der naive Ton auch zu den höchst anspruchsvollen und differenzierten Stilmitteln von Hölderlin – wie zu einer Sprachebene in den Gedichten von Yeats. Die Kürze und Einfachheit des anonymen englischen Gedichts verbieten eine Übersetzung, erübrigen aber auch den Versuch:
O Western wind when wilt thou blow
aaaThat the small rain down can rain?
Christ, that my love were in my arms,
aaaAnd I in my bed again!
Dieses kleine Lied enthält nur zwei Wörter, die mehr als eine Silbe lang sind – was kaum in einer anderen Sprache als der englischen möglich wäre. Ein einziger Reim genügt ihm und Rhythmen, die keine prosodische Regel, sondern das Gehör abgewogen hat. Es besteht zwar aus zwei achtsilbigen und zwei siebensilbigen Zeilen, deren jede aber die Hebungen verschieden verteilt. Auf seine Art war auch dieses Gedicht ein Wagnis – und ein ganz gelungenes, von keinem noch so gebildeten, feinsinnigen und namhaften Dichter übertroffenes, weil es kein überflüssiges Wort enthält. Bei aller Schlichtheit bleiben auch diese Zeilen geheimnisvoll, indem sie die persönlichen Umstände der Ich-Person des Gedichts verschweigen. Warum diese Person von der Geliebten getrennt ist und zur Wiedervereinigung den Westwind und „kleinen Regen“ braucht, wird der Einbildungskraft des Lesers oder Hörers überlassen – nicht anders, als es die vom Dichter nicht erklärten oder gedeuteten Bilder tun, aus denen Trakls Gedichte bestehen.
Ich glaube, daß eine gewisse Verschwiegenheit zum Wesen der Lyrik gehört, außer zu der satirischen, belehrenden, polemischen und ausgesprochen gesellschaftskritischen. Darum sind so viele Gedichte schwer verständlich, wenn wir sie mit den falschen Organen aufzunehmen versuchen. Hölderlins „Sprache des Herzens“, die er in einem Gedicht so nannte, erreichte er mit Hilfe der höchsten Vernunft, der höchsten geistigen Anstrengung. Auch von einer Logik des Herzens könnte man sprechen, die sich von der Logik der Vernunft so unterscheidet, wie jene der Träume von jener unseres wachen Bewußtseins. „Wozu Dichter in dürftiger Zeit“, hat sich Hölderlin gefragt. Vielleicht dazu, immer wieder den Zugang von der Vernunft zur Unvernunft, und umgekehrt, zu finden, damit die Vernunft nicht noch zerstörerischer wird als die losgelassene Unvernunft.
Michael Hamburger, Norddeutscher Rundfunk, 1988
W.G. Sebald besucht Michael Hamburger. Ein Text aus dem W.G. Sebald-Forum für den ausgewanderten Schriftsteller, Wanderer, Germanisten, Autor des Elementargedichts „Nach der Natur“ und weiterer Werke. Eingerichtet von Christian Wirth.
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLfG + IMDb +
Archiv + Kalliope + DAS&D + Johann-Heinrich-Voß-Preis
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Michael Hamburger: P.E.N. ✝ Die Zeit ✝ BZ ✝ SZ
Michael Hamburger – Ein englischer Dichter aus Deutschland. Ein Film von Frank Wierke (hier in voller Länge).


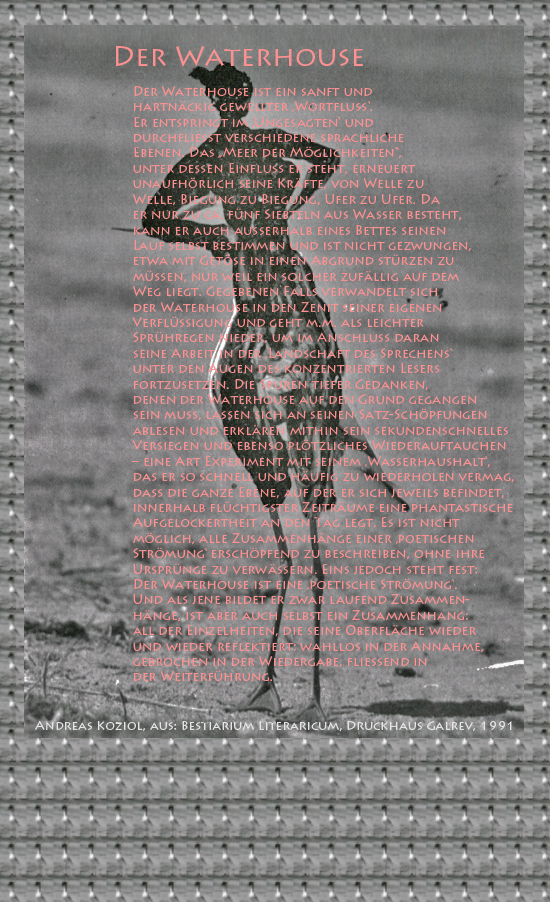














Schreibe einen Kommentar