Michael Krüger: Archive des Zweifels
HOROSKOP
Der Sternenrat hat sich zurückgezogen
hinter die Wolken. Durch ihre dünnen Ränder
ahnt man, wie an meinem Leben geändert wird.
Liebe, Gesundheit, berufliche Aussichten,
dazwischen das kleine Flugzeug „Wenn“,
das von Stern zu Stern fliegt
und die wichtigen Nachrichten ablädt.
Nach Tagen endlich die erlösende Botschaft:
entweder hat sich der Mensch noch nicht gefunden
oder er hat sich für immer verloren.
Das bin ich, hier, mitten unter den Sternen.
Gegen die Zeit
Wer sich mit Michael Krüger beschäftigt, ist mit mindestens zwei Geheimnissen gleichzeitig konfrontiert. Das erste ist bereits legendär und feuilletontauglich: Wie schafft er es nur, Verleger, Herausgeber und Autor in einem zu sein – zumal ein erfolgreicher Verleger, ein leidenschaftlicher Herausgeber und ein exzellenter Autor. Alles Eigenschaften, die für sich allein schon ein ganzes Leben ausfüllen würden. Cees Nooteboom hat darauf einmal die verblüffend klare Antwort gefunden: Michael Krüger produziert sich die Zeit, die ihm notorisch fehlt, ganz einfach selbst. Wie? Indem er, einem Illusionisten gleich, der das bekannte Kaninchen aus dem bekannten Hut hervorzaubert, Gedichte schreibt. Denn ein Gedicht ist, da es auf kleinstem sprachlichen Raum einen größtmöglichen Mehrwert an Sinn und Erkenntnis erzeugt, immer auch geschenkte Zeit. Und da Zeit, heißt es, auch Geld ist, schaffen sie ordentlich an, die Dichter. Aber wie nun ein Gedicht, mit nichts anderem ausgestattet als mit gewöhnlichen Worten, die zunächst einmal stumpf, kalt und instrumental sind, diese weit über die Sprache hinausstrahlende Energie zu erzeugen vermag, wie es also arbeitet und wirkt, das ist sein ureigenstes und einem rationalen Zugriff oft verschlossenes Gesetz. Was freilich nicht heißen soll, daß ein Gedicht naturgemäß immer ein Rätsel ist, denn es gibt einige hinreichende Verfahren, diese Maschine auch zu verstehen, einschließlich ihrer Störungen und Reibungsverluste. Eines aber gilt durchweg, und wenn es nicht gilt, ist das Gedicht zu instabil, zu schwach und zu schlecht: Keine Analyse kann es erschöpfen und damit überflüssig machen, denn in seinem Zentrum, dort, wo es sein Material zu bewegen beginnt, ist es frei. Wie anders schließlich könnten Gedichte über Jahre und Jahrhunderte hinweg, durch zahllose Rezeptionstexte getrieben und oft tausendfach zerlegt, heute noch so lebendig und gültig wie am Tag ihrer Niederschrift sein?
Und über dieses Primärgeheimnis, das aufzuklären ohnehin nur in Annäherung gelingt, kommen wir, auf Michael Krüger bezogen, zu Geheimnis Nummer zwei: Wie vermag er es, jenen schwierigen und äußerst störanfälligen inneren Zustand der Konzentration zu finden, der nötig ist, um Zeit zu komprimieren und dann, im Text, zur Entfaltung zu bringen, wenn er pausenlos unterwegs ist und im Kopf die Schriften seiner Autoren hat? Nur ein Laie im Umgang mit dem literarischen Schreiben kann die Vorstellung haben, daß Sprache keinen Widerstand leistet und flüssig zur Verfügung stehen muß, wenn man zwischendurch einmal ein paar Stunden Zeit hat. Nein, so simpel geht es nicht zu, und es wäre auch, denkt man nur an die Folgen, eher beängstigend als schön. Es gilt zwar immer noch, an ein Wunder zu glauben, wenn aus Zeit im Gedicht eine Ewigkeit wird, womit die Naturgesetze ohnehin schon recht gut hintergangen sind. Aber um auch nur einen brauchbaren Satz zu schreiben, wo das Blatt eben noch leer und die blanke Abweisung war, ist eine Vielzahl sich gegenseitig komplex beeinflussender Bedingungen nötig, die erst einmal geschaffen und aufeinander abgestimmt sein müssen, damit am Ende so etwas wie Poesie herauskommt. Der Dichter oder, wem das Wort zu alt ist, der Gedichtproduzent braucht also auch Zeit, damit seine kleine Maschine zur Erzeugung von Zeit erst einmal in Gang kommen kann. Und wer Michael Krüger kennt, weiß, wie er der Zeit stets hinterherläuft, um ihr für den günstigen Augenblick eines Gedichtes einmal voraus sein zu können. Immer war er da, wo er sein wollte oder mußte, und immer wirkt die Vermutung darüber, wann er nun gekommen und wann gegangen ist, über seine tatsächliche Anwesenheit hinaus. Ja, er geizt mit jeder Minute, wie auch das Gedicht geizt mit jedem Wort, und nur so kann er sich im Gedicht und kann das Gedicht sich in der Sprache verschwenden.
Das nun ist durchaus mehr als eine Anekdote. Es ist schon der Einstieg in das Wesen von Michael Krügers Lyrik, die im Verlauf ihrer Entstehung zwar konzeptionellen Veränderungen folgt, vom Parlando über die Lakonik zur Souveränität des poetischen Bildes, eines aber beibehält: von Zeit zu sprechen; von der privaten Zeit, die zur historischen wird, und von der historischen Zeit, die im Privaten ihre Entsprechungen findet; von sich ereignender Zeit und von Zeit in der Sprache; von empfundener, von gültiger oder von verlorener Zeit. Zugleich aber, wie nun, die Zeit ein zentrales Motiv ist, dem weitere Grundmotive wie Stimme, Sprache und Sprechen, der Blick und das Sehen, Bild und Abbild zugeordnet sind, hebt sie sich im Inneren der lyrischen Textur gewissermaßen auf, verlischt und wird bedeutungslos. Sie ist den Körpern der Gedichte, für die Erscheinen und Verschwinden fast ein und derselbe Vorgang sind, buchstäblich entrissen. Wie das geschieht? Vielleicht durch diese Art von poetischer Verführung, aus einem Wirklichkeitsausschnitt Allegorie werden zu lassen und das Reale so an das Imaginäre zu binden, daß es seine Masse und seine Trägheit verliert und Idee wird. Dabei ist das Subjekt der Gedichte durchaus präsent und sind die Anlässe, die zum Initialmoment werden, durchaus konkret. Eine Fliege auf einem Spiegel, eine Schnecke, die über die Terrasse kriecht, oder die Bettler vor der Kathedrale Saint Pierre, wenn sie ihre Wunden zeigen: Alles ist immer so, wie das Auge es sieht. Sobald aber die sichtbare Welt den Blick des Betrachters passiert, der handelt, indem er sie deutet, ist sie stets auch etwas anderes und findet in der Miniatur ihren Kosmos. Die Spuren des Inhalts verwischen sich wieder, die Worte werden leichtes Material, das zur Musik drängt, und der Gegenstand, über den gesprochen worden ist, erlangt seine Glaubwürdigkeit über die Form.
Eigentlich hat sich nichts verändert:
die Kastanie vor dem Haus, vom Efeu gemartert,
die Pflaumenbäume auf ihrem blauen Teppich,
der süße Geruch der Kindheit und des Verfalls.
So beginnt das Gedicht „Auf den ersten Blick“, und auf den ersten Blick sind wir auf eine Landschaft eingestimmt, die es tatsächlich gibt. Doch wenn es gleich heißt:
Vom Tal herauf dröhnen die Laster,
und der Schatten läuft eilig ums Haus,
gegen die Zeiger der Uhr, und prüft den Kummer.
Sogar der Brunnen steht noch wie ein Gedicht
dann wird uns der feste Boden wieder entzogen. Das Ausgangsbild kündigt seine Verbindlichkeit und wird zur Folie einer subjektiven Verfassung. Sicher ahnen wir schon, daß sich wohl einiges mehr oder gar alles verändert hat, wenngleich die Dinge wie eh und je an ihrem Platz geblieben sind; hier soll uns nur eines interessieren: wie die Gedichte über Schnittstellen verfügen und ihre Stoffe fast nahtlos in größere Räume umlenken können, in denen sie vieldeutig werden und offen. Allein Gedichte wie „Kleines Seestück“, „Aus der Ebene“ oder „Der letzte Versuch, in vier Teilen“ wären eine Arbeit darüber wert, wie aus einer Denk- eine Sprachbewegung bis an die Grenze zum reinen Ton wird. Aber dieser Rhythmus, Atmung und Herzschlag des Textes, durch den die Sprache erst eine Belebung erfährt und Sinnlichkeit noch die kältesten Dinge durchströmt, er ist nur ein wenngleich wichtiges Element dieser Lyrik. Erst im gelungenen Zusammenspiel von Gedanke, Syntax und Bild kommt das Gedicht zu sich selbst und erreicht jene Komplexität, mit der es eine Revolte gegen die Zeit sein kann. Natürlich verfügt jedes gute Gedicht über die Möglichkeit, den Dingen eine andere, neue zeitliche Ordnung zu geben. Krügers Gedichte sind hier aber insofern einer Hervorhebung wert, weil sie diesen Zeitsprung einem Bewußtsein der Anwesenheit verdanken und nicht einer von vornherein sichergestellten Aufhebung von Zeit durch eine Aufhebung von Realität.
Michael Krüger ist ein ganz und gar bewußter und bewußt reagierender Autor, der immer eine Geschichte im Blick hat, die eine Geschichte von Menschen ist. Alles, was ihn beschäftigt und zum Gedicht drängt, ist von einer existentiellen Ernsthaftigkeit und verfügt über eine handlungsorientierte Dimension. Gewiß, der Zugriff auf die Welt wird zunehmend vorsichtiger, auch vermittelter insofern, als die Rhetorik gedrosselt wird und das für sich selbst sprechende Bild an deren Stelle tritt. Doch das ist nur ein anderes technisches Verfahren ein und derselben Autorenposition: ein Subjekt mit dem Anspruch auf Individualität vorzuführen und den eine lyrische Spannung aufbauenden Konflikt auf gesellschaftliche Substanz zu gründen und nicht auf Auslöschung und Leere. Ein alter Hut im Zeitalter der posthistorie und eines Postmodernismus, der die Kopien als Originale behandelt. So jedenfalls scheint es, ehe diese Lyrik, Wort für Wort und Gedicht für Gedicht, das Gegenteil beweist.
Jetzt wird die Geschichte geopfert.
Gelesen habe ich zum Beispiel ein Buch
von einem japanischen Amerikaner über
,Das Ende der Geschichte‘. Kein Meisterwerk
in seiner historischen Herleitung, im Grunde
alles bekannt, den Namen des Autors habe ich
schon vergessen. Und doch hat mich der Text
rasend gemacht, die Überheblichkeit,
Angstlosigkeit, mit der er Abschied nimmt
Was hier in einem „Brief nach Hause“ direkt gesagt wird, kommt einem Bekenntnis gleich, in Geschichte verstrickt zu sein und eine moralische Zuständigkeit anzuerkennen. „Ich will meine Unruhe behalten“, heißt es schon in Reginapoly, dem ersten Gedichtband von 1976, und diese Unruhe, die auch eine Empörung ist, begleitet die Gedichte bis heute.
Daß aus diesem engagierten Verhältnis zur Welt nie Agitation geworden ist – und nur wenige Autoren seiner mit den Aufbrüchen der späten sechziger Jahre großgewordenen Generation haben diese Leistung vollbracht −, verdankt sich einer von Anfang an zwischengeschalteten Skepsis an der Gültigkeit des gesprochenen oder geschriebenen Wortes. Dem liegt die Überzeugung zugrunde, daß die Sprache bereits ein Bestandteil der Verhältnisse ist, die kritisiert werden sollen, denn sie ist, noch ehe sie benutzt werden kann, ideologisch präfiguriert und damit vereinnahmt. Das hat in der Geschichte des Gedichtes zur völligen Atomisierung des sprachlichen Materials geführt, dem keine Aussagekraft mehr zugestanden wurde. Oder eben zu jener im Text selbst sichtbaren Verstörung, der ein tiefes Mißtrauen vorausgegangen ist und vor deren Hintergrund die Sprache beobachtet und unablässig in Frage gestellt wird. Die Einsicht, daß es keine gesicherte Verbindung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnendem gibt, war die Geburt der Moderne, und sie wird, wie schon bei Flaubert, später bei Hofmannsthal oder Rilke, stets neu thematisiert:
Könnte ich doch die flatternden Wimpern
des Lorbeers, die im Sturm auffliegen
und sich erst wieder senken, wenn die Schatten
ihren Schatten nehmen vom dunklen Grün,
mit Worten beschreiben, die ihnen gemäß sind.
Der Sprechakt ist demnach immer auch erschüttert, und die Aussage bleibt fragmentarisch der Sache gegenüber, über die sie etwas mitteilen will. Das genaue Sehen wird entscheidend, der zweite, prüfende Blick:
Man lernt mit den Augen, wie Empfindungen
zu Worte kommen, wie die Wörter heilen
und wir mit den Wörtern. Eine Wunde,
die nicht mehr blutet.
Es ist schon zwingend, daß ein Vertrauen so eher den Bildern gehört als den Wörtern, die sie repräsentieren. Aber wo Bild und Abbild kaum mehr zu unterscheiden sind und wo „das Ende der Geschichte der Fotografie“ mitgedacht werden muß, da ist auch das wieder heikel. Die Welt, so materiell und real die Person im Gedicht sie auch fassen will, sie verschließt sich immer aufs neue zur Chiffre, und „Nur langsam geht die Entzifferung / voran; und gibt den Blick frei / auf eine düstere Reihe / Versprechen.“ Exemplarisch für die Betrachtung der Natur als einen Text, der Zeichen und Sinn gültig zusammenfügt, ohne je lesbar zu werden, ist der Zyklus „Ambach“.
Laut wird der See, die Huldigung
wird verstanden. Rebellisches Rauschen
begleitet das mühsame Sprechen,
Angst ist in dieser Mühe enthalten.
Meine Stimme spricht mit,
bis der Atem sich nicht mehr wehrt.
Dickköpfige Vögel halten sich
zitternd im Wind, ein Wetterleuchten
reizt ihre starrenden Augen.
Kühn waren die Sätze, die ein Strudel
erzeugte, kühn, sich an ihnen zu messen.
Diese Kühnheit, die das Sprechen eines Lyrikers meint, der sich selbst einen „Zwilling des Schweigens“ genannt hat, bezieht gerade aus dem dauernden Zweifel ihr Recht, und aus Unsicherheit wird eine Stärke. Subjekt und bedrohtes Subjekt, Sprache und Sprachkritik, Geschichte und verlorene Geschichte im Gedicht stets dialektisch zu behandeln, auf der Ebene des Inhalts ebenso wie auf der einer poetischen Form, das ist die vielleicht modernste Antwort auf eine Wirklichkeit, von der keiner mehr recht weiß, wo sie anfängt und wo sie wieder aufhört. Aber daß es sie gibt, daran halten diese Gedichte fest, und das ist es, was sie unabweisbar und eindringlich macht. Es „müßte eine Literatur möglich sein“, schrieb Michael Krüger schon vor fast zwanzig Jahren, „die (…) mit Hilfe der bedeutenden ästhetisch-formalen Erfindungen unserer Zeit das noch einmal zusammenbringt, was die Wissenschaft für immer getrennt halten will: Gefühl und Gedanke. Das wäre eine Literatur, die mich interessiert.“ Diese Literatur, deren Kern die Kritik und deren Referenz der empfindsame und in seiner Empfindsamkeit bedrohte einzelne ist, wird gerade deshalb eine Zukunft haben, weil der in die Virtualität flimmernder Monitore entlassene einzelne eben keine Zukunft hat.
Dennoch, bei aller Beladenheit mit Rationalität, Krügers Gedichte erreichen immer Leichtigkeit und werden auf eine komplizierte Weise auch einfach. Sie wollen vor dem Leser nichts verbergen und auf keine dunklen Zonen verweisen, in denen ein Sinn erst erfunden werden muß. Die „Reden“ und „Briefe“, die stets auf der Suche nach dem anderen sind, die Spaziergänge und Reisen, durch eine Landschaft oder ins Innere des Augenblicks: Es ist das Unspektakuläre, in dem sich die Sprache unter Beweis stellen muß, um ihre Wahrheit zu finden. Alltäglichkeiten zu beschreiben und dies so zu tun, daß sie zur Besonderheit werden, gehört zu den größten Herausforderungen in der Literatur. Michael Krüger ist ein Autor der Alltäglichkeiten, und ihm gelingt es, mit jedem Detail und in jedem noch so kleinen Ding die Kraft des Aufruhrs zu zeigen, der Sensation und der Einmaligkeit. Und wenn er uns seine Geschichte erzählt, vom Winter 77 auf der Liebigstraße in München bis zum „Halt auf freier Strecke“ kurz vor einem neuen Jahrtausend, dann ist es immer auch eine kollektive Geschichte, eine deutsche, unsere. Das können nur die wenigsten, denn „das Gedächtnis / ist nicht zu erkennen. Schwer liegt es / hinter den Augen und zischt / wie heruntergebranntes Feuer, / wenn eine Träne hineinfällt.“
PS: Über vieles wäre noch zu sprechen. Aber dafür, leider, fehlt uns die Zeit.
Kurt Drawert, Nachwort
Bereits mit seinem ersten Gedichtband,
dem 1976 erschienenen Reginapoly, hatte Michael Krüger einen unverwechselbaren Ton gefunden; mittlerweile schreibt er in seinem lyrischen Werk drei Jahrzehnte deutscher Wirklichkeit mit und schenkt dabei oft gerade den einfachen Dingen Beachtung, die doch schwer zu sagen sind, weil die hohen Diskurse für sie keine Sprache mehr haben. Dem Spiel eines Illusionisten vergleichbar, geraten hier die Alltäglichkeiten zur Sensation, wie die scheinbaren Sensationen zur Alltäglichkeit schrumpfen; und dem scharfen Blick auf die Dinge steht der Zweifel an der Gültigkeit des Gesagten entgegen. Daß Krügers Gedichte zum gesicherten Bestand der deutschen lyrik zu rechnen sind – so selbstverständlich in ihrer poetischen Energie, so überzeugend in ihrer Suche nach den richtigen Fragen wie ihrer Behauptung, ein Teil der Antwort zu sein −, das belegt diese von Kurt Drawert vorgenommene Auswahl, die drei Jahrzehnte lyrischen Schaffens über die frühen Veröffentlichungen bis hin zum 1998 erschienenen Band Wettervorhersage vorstellt. Die vierte Abteilung versammelt bisher in Buchform unveröffentlichte Gedichte; die „Archive des Zweifels“ finden ihre Fortsetzung.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2001
Beitrag zu diesem Buch:
Timo Brandt: Impressionen zu Michael Krügers Gedichten, gesammelt in Archive des Zweifels
lyrikpoemversgedicht.wordpress.com, 26.2.2014
MICHAEL KRÜGER
Jammerläppchen
In der Stadt mögen sie
den Namen Krüger.
Und Mädchen in blöden
roten Klamotten.
Und Kugelduft gegen Motten
Und Spaten für den Garten Eden
Und schamlose Reden
von Gott, Losigkeit und die
Gier nach dem Privaten.
Und unter allen Gipfel herrscht
Dort Hasenruh und zärtlich
Kreist ein einsames DU
im flaumigen Wind.
Trandüsig taumelt ein Kind
Die Äste der Bäume knarren
die goldene Kugel in seinem Lauf.
Jägerlein wetzt sein blankes Messer
Und Carolin schreibt:
Deine Gedichte waren
Früher deutlich besser.
Peter Wawerzinek
Welche Poeme haben das Leben und Schreiben von Karl Mickel und Volker Braun in der DDR und Michael Krüger in der BRD geprägt? Darüber diskutierten die drei Lyriker und Essayisten 1993.
Das Werk: Michael Krüger am 14.6.2004 im Literarischen Colloquium Berlin
Frank Wierke: Verabredungen mit einem Dichter – Michael Krüger
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Gregor Dotzauer: Das unbändige Leben der Agaven
Der Tagesspiegel, 9.12.2013
Volker Isfort: Er wird noch gebraucht
Abendzeitung München, 8.12.2013
Thomas Steinfeld: Herr K. tritt ab
Süddeutsche Zeitung, 9.12.2013
Charles Simic: Der Regenmantelmann
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Norbert Gstrein: Der leere Raum
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Cees Nooteboom: Der andere Atem
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Peter von Matt: Der Freund auf der Kommandobrücke
Neue Zürcher Zeitung, 9.12.2013
Hans-Dieter Schütt: Warum fallen Sterne nicht herab
neues deutschland, 9.12.2013
Mara Delius: Nach draußen, hinein ins Buch
Die Welt, 9.12.2013
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Britta Schultejans: Michael Krüger wird 75
Abendzeitung, 7.12.2018
Georg Reuchlein: Michael Krüger (75)
BuchMarkt, 9.12.2018
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Gerrit Bartels Interview mit Michael Krüger: „Gott ist ein Melancholiker“
Der Tagesspiegel, 7.12.2023
Willi Winkler Interview mit Michael Krüger: „Ich habe mich der Literatur höflich genähert“
Süddeutsche Zeitung, 7.12.2023
Arno Widmann: Der virtuose Gesang und der Schrei
Frankfurter Rundschau, 9.12.2023
Andrea Köhler: Kaum einer hat so viele Literaturnobelpreisträger in seinem Verlag versammelt wie Michael Krüger
Neue Zürcher Zeitung, 8.12.2023
Hannes Hintermeier: Schwimmer im Meer der Gedichte
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.12.2023
Hans-Dieter Schütt: Wie kommen Sterne an den Himmel?
nd, 8.12.2023
Leander Berger: Lesen als Lebensmittel
Badische Zeitung, 9.12.2023
Quh: Freund der Ziegen
quh-berg.de, 9.12.2023
Martin Schult: „Danke“
Börsenblatt, 8.12.2023
Volker Weidermann: Küsse, Nasenküsse, Ringkämpfe. Abschiedsfest für Michael Krüger.
Ein Abend für Michael Krüger. Michael Krüger ist eine Legende des Literaturbetriebs. Am 16.1.2014 sprach er in der Literaturwerkstatt Berlin mit Harald Hartung über seine Arbeit als Verleger, Herausgeber, Autor und Übersetzer.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.
Michael Krüger erinnert sich an das erste Buch in seinem Leben, das ihn besonders beeindruckt und geprägt hat.
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Instagram + DAS&D +
KLG
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA
Video Porträt: Ute Döring & Kurt Drawert.


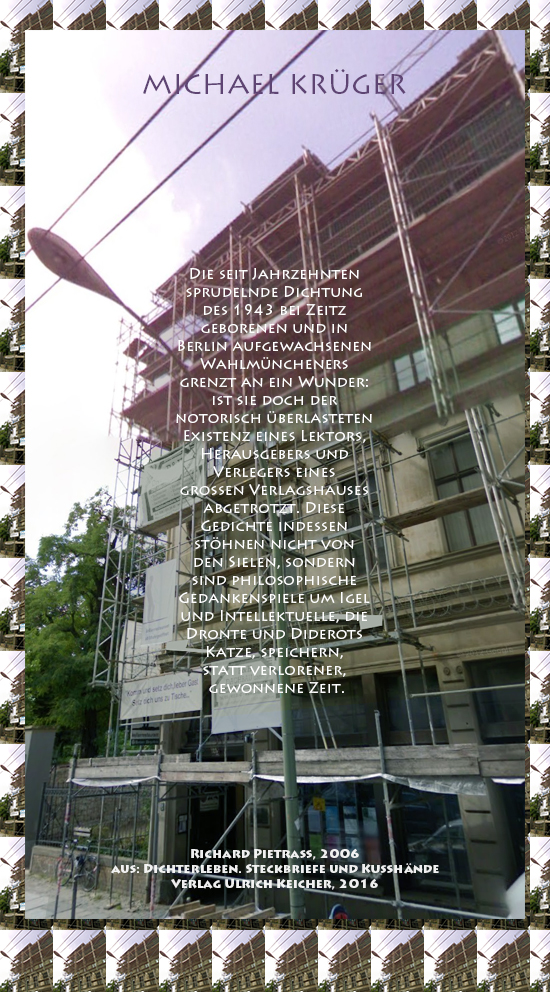













Schreibe einen Kommentar