Oskar Pastior: o du roher iasmin
PULVERGASSE 1952
ich sah heut nacht im traum das meer
und mehr im traum sah ich die nacht
und mich als traum vom meer im schaum
da stehn und mehr auf brautschau gehn
als sonst und auch mehr schaum als o-
der sehr vom meer her – traum – sah
ich die nacht dahinter bald mehr näch-
te sehn als land davor und kaum den
strich zum raum sich drehn als hori-
zont zum pelikan den am kanal ich
durch die haut mich träumen sah von
einem meer von nächten durch die haut
vom meer und nacheinander ein paar ü-
bergänge weiß bis ocker auch ein wenig
Oskar Pastior beschenkt uns Leser
mit einem neuen Gedichtband:
43 Versuche, das Gedicht „harmonie du soir“ von Charles Baudelaire anzupeilen in Anagrammen, Akronymen, Silbengewichtungen, Oberflächenübersetzungen und was Pastiors materiale Strategien der Ordnung und Ortung mehr sind: „hds – durch so viel umgang bereits kürzel im kopf und im asbest meiner oulipotischen sturheit, erpicht auf diesen einen knotentext und begriffsknoten: nichts anderes als immer wieder auf der stelle ihn anvisieren, ,wassertretend‘, ohne aus vorangegangenen varianten groß gelernt zu haben; was auch gar nicht ginge, denn keine hds kann wie die andere lesart ausgehen: rhodos sagen wir darin wird hades hand-some hodensack holder sog von angenähert chandos hasendouble honduras – hidos rumänisch und hideux franzö – an diesem heldensums und heldensaum: oh die see! … und alles in allem, denke ich, demonstration, dass eine übersetzung des gedichts, um das es hier geht, nicht möglich aber auch gar nicht nötig ist, sobald wir nur einigermaßen alphabeth und lautung in mehr als einer sprache kennen.“
Das Buch wird von einer CD begleitet, auf der Oskar Pastior seine Gedichte liest.
Urs Engeler Editor, Ankündigung, 2002
Oskar Pastior: oh du roher iasmin
In Berlin, wo Fledermäuse aus begreiflichen Gründen immer seltener werden – grell erleuchtete Glaspaläste und verblendeter Beton sind einfach kein geeigneter Lebensraum für diese tagscheuen Tiere – ausgerechnet in Berlin behauptet sich noch eine seltene Spezies, von der man allerdings nur ein einziges, einzigartiges Exemplar je zu Gesicht bekam. In Bleis erweitertem Bestiarium wird sie als siebenbürger berliner Oulipo-Stadtfledermaus (vampyrus spectrum) aufgeführt, oder auch als „eule da riba“ aus der Familie der „brue di aale“.
Wir kennen sie unter dem Namen Pastiorfledermaus oder einfach Pastior. Wenn sie sich nach Anbruch der Dämmerung in einem der schön restaurierten Gemäuer des Literaturbetriebs sehen läßt, ist stets eine treue Gemeinde zur Stelle, um ihren unglaublichen Lautgesängen zu lauschen. Neulich, nach einem dieser abendlichen Rituale konnte man erleben, wie die Pastiorfledermaus im eichengetäfelten Treppenflur mit den burgunderroten Stofftapeten plötzlich aus dem Gebälk herunterschoß und sich auf der Schulter der Literaturkritikerin „Queropalpolar“ niederließ, wobei sie ihr etwas ins Ohr fauchte, das so klang wie: „rhino sore du mai-marode uhr“. Das hieß etwa: „Niemand hat meinen Gedichtband besprochen, was soll das“, – Die erschrockene Queropalpolar sagte nur: „Das kann ich nicht glauben.“ – „Debile aura“ fiepte da die Oulipo-Fledermaus, „schläbypopartäne“ – und schlug heftig mit den Flügeln.
Ist es denn möglich? Dichterwaldhüter, hochdekorierte Spezialbürokraten, aus Siebenbürgen eingeflogene Art (brut) pfleger tun alles, um dieses subtile Geschöpf zu umsorgen. Und nun dieses Versagen unseres Feuilletons, das doch bekanntlich das weltbeste ist?
„O du roher iasmin“, so der Titel des noch ungewürdigten Gedichtbandes, – O du „präsumptive Welt ohne Pantum“, vermag denn niemand das „greise geheimnis“, „das letterngewicht“ von „dreiundfuenfzig einheiten ananastee oder sogar einundsechzig stoss spargelzeiten“ in eine kleine Kolumne zu packen?
Man ist betört von den Lautimaginationen, der Sinn- und Silbenmimikry, die auf unsere Gehörknöchelchen trifft, ohne ihr Geheimnis preiszugeben. Pastior findet seine Nahrung in der Welt, die ja bekanntlich (laut Borges) die Bibliothek ist. Mit allerfeinstem Fühl-und Hörvermögen ausgestattet, bewegt er sich überaus gewandt darin, indem er – für unsere Sinne unhörbar – Signale aussendet und so Rücksprache hält mit seiner Beute. Er vertilgt Silben, Wörter, ganze Texte in großer Zahl bzw. schlägt ihnen kleine Wunden, aus denen er das Blut saugt. Er wird auch mit großer und erhabener Beute fertig. Zuletzt hat er das Gedicht „Harmonie du soir“ geschlagen, zerlegt und verzehrt, d.h. den lyrischen Balg in einer opulenten Suite von Verdauungsvorgängen ins Eigene einverleibt und wieder ausgestoßen. Aus „Harmonie du soir“ wurde so, anagrammatisch „o du roher iasmin“, nach der Substantiv-Verb-Adjektiv + 7-Methode (d.h. um sieben Stellen jeweils im Taschenwörterbuch weitergedreht) wiederum „hasard du solde“, was übersetzt als „zufall unterm strich“ herauskommt. Aus Baudelaires Eingangsstrophe „Voici venir les temps où vibrant sur sa tige / Chaque fleur s‘évapore ainsi qu‘un encensoir; / Les sons et les parfums tournent dans l‘air du soir / Valse mélancolique et langoureux vertige!“ – bei Friedhelm Kemp wie folgt übersetzt: „Nun naht die Zeit, wo bebend auf ihrem Stiel die Blüten alle sich verhauchen gleich einem Weihrauchfaß; / Töne und Düfte kreisen in der Abendluft: schwermütiger Walzer und süchtiger Taumel!“ Daraus wird bei Pastior in nur vier Verarbeitungsschritten:
sie graben Würmer aus die spanner! alternde auf ihrer kesselpauke;
der schießprügel geht um wie einer der das meiste bietet;
echolote wie pariser streifen durch den überschuß in achselhöhlen;
pergamentene blasiertheit und laszive anstalt von bedürfnis!
Was diese Zeilen versprechen, hält Pastior mit jedem weiteren Wortbruch respektive Zeilenbruch. Das von eigenen Säften drainierte und mit pastiorschem Weiselsaft aromatisierte Urpoem wird des weiteren „buchstabengewichtet“, „oberflächenübersetzt“: „chaque fleur“ mutiert so zu „schlackenflöhen“, „valse mélancolique“ zu „das falsche mehl kolchis“. Sodann wird in einem weiteren Schritt „syntaktisch aufgeriffelt“, dann im Abstand von einigen Stunden je um 1, 2, 3, 4 vokale weitergedreht, „zungenfrei gepointet“, als „phantasie mit stallgeruch“ filibustert, bis die Vorlage schließlich auch ihre ausgeweidete Form einbüßt zugunsten von „geschwenkten“ Zeilen und „Zopfmodulen“ und ganz ins Pastior-Fledermäusische assimiliert worden ist in dieser großen, reich instrumentierten, sein bisheriges Werk kadenzierenden Dekadenzanstrengung.
Was weiß der Text noch von Baudelaire? Was weiß der Fuchs von der Maus, die er frißt und sich einverleibt samt ihrer Mäuseseele. Der Glanz der Mäuseaugen lebt im Fuchsfell weiter, wenn man so will. Pastior nimmt, was er gebrauchen kann und braut daraus seinen Absurd-Absud.
Dass poetische Sprache „unverständlich“ sein muß, ist selbstverständlich Prämisse. Die Mitteilungssprache ist mit zuviel Sprachschrott kontaminiert, bar jeder Unschuld und also unfruchtbar. Ihn daher Dadaist, Surrrealist, Futurist, Oulipotist zu nennen, kurz: einen Revenant aller bereits kanonisch geglaubten Literaturschrecken wäre nicht falsch, der leidigen Ismen wegen aber auch nicht angemessen. Pastior ist Magier und ein verspielter Komödiant, Prestidigitateur und ein im Nebel-Stochastiker. Das heißt: er läßt nicht das Erlebnis, sondern den ZUFALL, den es für einen gläubigen Atomisten und Kabbalisten seines Schlages eigentlich nicht gibt, sprechen, um ihm dann mit allerlei Reglements, Selbstfesselungskünsten und spitzfindigem Spiel ins Wort bzw. in den Rücken zu fallen. Dem reinen Automatismus der Surrealisten (falls es so etwas überhaupt gibt) zieht Pastior den Somnambulismus der Regeln vor.
Gabriele Killert/Richard Schroetter, Deutschlandfunk, Büchermarkt, 16.7.2003
Oskar Pastior: o du roher iasmin
Jetzt ist er schon fünfundsiebzig geworden, und wenn es mit rechten Dingen zuginge, müsste er der bekannteste Dichter sein. Ist er aber nicht. Pastior ist zu radikal, er sprengt mit seinen gesunden Dichtersinnen die Sprache, bis sie wieder zusammenpasst. Vor sehr vielen Jahren hat er Baudelaires Les fleurs du mal gelesen, jetzt variiert er auf gut oulipotisch Namen, Titel und das Gedicht Harmonie du soir. Erstaunt sieht man, was alles in dieser Dichtung steckt: Viele Sprachen, viel Substanz, viel Musik, viel Tradition. Von Rabelais bis „lemurfassduell“, von „hei duo rosmarin“ bis „attische rehkeule“ übersetzt Pastior die französischen Wörter präzise, dass es sie schaudert, und schüttelt und rührt sie, sie werden „gefeilscht, gefleischt, nein geschleift“, bis sie wieder ihre polyglotte Sinne und ihre neue „harmonie du soir“ wiedergewonnen haben haben. Ist das experimentell? Sprachlicher Untergrundkampf? Nein, es ist nur genau. Dass es dann auch noch witzig ist: umso schöner.
Georg Patzer, lesen-leute, 2003
Oskar Pastior: o du roher iasmin / Mein Chlebnikov
Als vorzüglicher Kenner nicht nur einer Sprache und als Virtuose produktiver Nutzung sprachlicher Materialangebote sieht Oskar Pastior die Kommunikationstauglichkeit der Sprache eher skeptisch. Allzu gut kennt er deren Unschärfen, ihre Ideologiebefrachtung und missbräuchliche Indienstnahme. Darum sucht er für seine Poesie eine Sprache zu gewinnen, die nichts sein will als sie selbst, zweckfreies Materialspiel – möglichst ohne „Innewohnlichkeiten“ und Botschaften. In ähnlichem Sinn distanziert er sich im Titelanagramm des Bandes o du roher iasmin sowie im Nachwort von einem „weihrauchtrunkenen Metapherngeschmack“. (S. 65) Seine 43 intonationen zu „Harmonie du soir“ von Charles Baudelaire seien zwar von „alter anhänglichkeit“ an diesen „betörenden“ Text angeregt worden, doch im Ergebnis stellten sie „materiale strategien der anordnung und ortung“ (S. 65) dar, also Arabesken.
Im Text har mo ni dü so ar (S. 52–53) etwa wird Baudelaires (regelwidrig geschriebener) Gedichttitel in Silben zerlegt (regelabweichend auch das, da der französische Diphthong aus „soir“ getrennt und auf zwei Silben verteilt wird), und aus den so erhaltenen sechs Lautgruppen werden durch Stellungspermutationen die 39 Verse einer Sestine gebildet, wobei nicht nur auf der Senkrechten die Wiederholungsmuster dieser normativen Gedichtform aufscheinen; auch auf der Waagerechten sind die ,Verse‘ so nach der komplexen Sestinenformel gefügt, dass jede Zeile die Verhältnisse einer ganzen Sestinenstrophe spiegelt: Sechs Sestinen also in einer Sestine ähnlich abgebildet, wie in wetscherahnenclub aus sonetburger (1983) vierzehn Sonette in einem Sonett oder wie in kolben und zehen aus Villanella & Pantum (2000) Zeile für Zeile ein Pantum im Pantum erscheint. Ein Text im Korsett künstlicher Regeln, eine Arabeske „unterhalb des gedanklichen Limits“ und ohne naive Harmonieangebote.
Solche Verfahren der „Transscriptase“, d. h. Umgestaltungen oder Umfunktionierungen von Vorlagentexten, sind nicht neu bei Pastior, doch dieser Band bietet ein breites Spektrum unterschiedlicher Umtextungsmöglichkeiten auf der Grundlage begrenzter Vorgaben. Die Autornamen, der Band- und ein Zyklentitel, wenige Einzelzeilen und sonst immer wieder und wieder der zum Kürzel hds destillierte Titel Harmonie du soir veranlassen die 43 „Intonationen“ Pastiors, die sich als Anagramm, Akronym, Sestine, Palindrom darbieten und die verschiedenen Ebenen sprachlicher Materialangebote nutzen.
In den zopfmodulen (S. 56, 57-63) sind es die Buchstaben aus „harmonie du soir“, die sich auf- und absteigend, links- und rechtsbündig hüpfend zu Mustern verschränken, in hds in gleichabständigen reihen (S. 54) bilden die Buchstaben des deutschen Alphabets ein symmetrisches Flächenornament. Buchstabenkombinatorik kann durch Zahlenspiele ergänzt werden (S. 21–22) oder führt über die deutsch-französische Lautungsdifferenz gleicher Grapheme in den umfänglichen Bereich lautbezogener Arbeitstechniken mit vokalischen oder konsonantischen Reihenbildungen (S. 23, 32, 37), gleichabständigen Phonemsubstitutionen (S. 33, 34, 35, 36) oder Lautpalindromen (S. 43). Substitutive Verfahren im Wortbereich stellen die sog. Oberflächenversionen (S. 18) oder Oberflächenübersetzungen (S. 20) dar, neu in diesem Band sind meines Wissens semantisch substitutive Similitäts- und Oppositionsspiele (S. 24, 25, 26, 27) sowie syntaktische Repliken (S. 29). Mehrere Texte sind im Verhältnis zur Vorlage „zungenfrei gepointet“. (S. 38)
Dass „baudelaire“ anagrammatisch (S. 7-9) u. a. als adriabeule, debile aura, idealbauer, dealer baiu oder barde a lieu zu lesen ist, erheitert gewiss, führt aber ebenso gewiss nicht nur von ihm weg, sondern in neuer Weise wieder zu ihm hin. Es ist dabei freilich nicht auszuschließen, dass die geschauten kommenden Zeiten – voici venir les temps – auf dem Weg von Baudelaire zu Pastior irgendwann zu les empty temps (S. 38) geworden sind – empty, englisch „leer“, „hohl“, „nichtig“, „eitel“: voici wenn ihr lest – falls ihr lest – und dann lest dass lest in einer restlichspra- / che ein ballast ist […] lest /emps. (S. 38) So kämen denn doch, nicht ohne Pastiors Willen, hintergründigere „Innewohnlichkeiten“ ins Spiel.
Findet Pastior bei Baudelaire Ausgangsund Anknüpfungsmöglichkeiten, von denen er sich auf eigenen Wegen entfernt, so stellen seine Texte aus Mein Chlebnikov Wege versuchter Annäherungen dar. Der Titel bekundet durch das Possessivpronomen einerseits die Anhänglichkeit an den Russen als Anreger, andererseits stellt er auch klar, dass es sich um keine herkömmlichen Übersetzungen handelt, sondern um Fort- und Umdichtungen Velimir Chlebnikovs (1885–1922) mit Mitteln und Möglichkeiten der deutschen Sprache. Wie anders auch wäre der eigengesetzlichen „Sternensprache“ des russischen Kubofuturisten translatorisch beizukommen, einer Sprache jenseits von Begrifflichkeiten, die Klangprioritäten setzt und Deformationen des Normalsprachlichen zur Grundlage neuer Bezüglichkeiten macht?
Natürlich lassen sich Lautmalereien als klangliche Nachahmungen von Naturlauten in jeder Sprache herstellen (obwohl schon der Hahn in verschiedenen Sprachen recht unterschiedlich kräht), und Kontaminationen oder Zusammensetzungen aus Teilen, die normsprachlich nicht zusammengesetzt werden, lassen sich leicht erkennen; doch wie übersetzt man etwa „vremysch“, gebildet aus „vremja“ (Zeit) in Analogie zu „kamysch“ (Schilfrohr), wenn in Letzterem zugleich die Wortwurzel „kam“ (Stein) steckt und ein Text von nur 21 Wörtern diese drei gleich achtmal einsetzt und miteinander verflicht? Pastiors zeitgeschöhn binsgeschülf (S. 35) stellt eine der Möglichkeiten grundsätzlicher Unmöglichkeit dar. „Chlebnikov spricht, während ich dolmetsche“, heißt es vorlagenabweichend gleich im ersten Text. (S. 13) Originales Sprechen und Verdolmetschung verhalten sich wie Parallelen, die sich angeblich in der Unendlichkeit schneiden.
Pastiors Leistung steht über jedem Zweifel. Es ist bemerkenswert, wie er etwa im Protokoll vom El (S. 9–15) die L-Häufungen der Vorlage in eigenem Wortschatz eher noch überbietet, wie er durch deutsche Alliterationen fesselnde Klangwirkungen erzielt oder wie er – spring knirps – russische Palindrome durch phantasievolle deutsche ersetzt (Rätsel, Nebel, Manie…, S. 71). Vollends überwältigend aber ist die fast grenzenlose, über Chlebnikov hinausgehende wortschöpferische Kunst in Allerleilach (S. 47–49), in Lieb-Satz (S. 51–57) oder in M-Satz (S. 57–63). Spätestens da wird deutlich, dass Pastiors Chlebnikov-Übersetzungen auch jenseits der freien Variation getoengedroehn um den verstand (S. 79–101) ganz erhebliche poetische Eigenleistungen darstellen. Es sind freie Aneignungen, aber auch Anverwandlungen, pastiorsche „Transscriptasen“ über Sprachgrenzen hinweg.
Pastiors Übersetzungen sind nicht neu, der Großteil erschien erstmals 1972 in Peter Urbans deutscher Chlebnikov-Ausgabe. Neu ist die Zusammenfassung der 28 Texte und einer Grafik Pastiors (S. 73) zum eigenständigen Band, der parallele Mitdruck des russischen Originals, vor allem aber die hochwertige Tonaufnahme in der Lesung des Autors. Damit setzen diese beiden Bände die 1997 von Urs Engeler begonnene, gediegen und ansprechend gestaltete Präsentation in Text und Ton hervorragend fort.
Michael Markel, Südostdeutsche Jahresblätter, Heft 1/2004
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Gabriele Killert: Hymnen der Fledermaus
Die Zeit, 9.10.2003
Werkstatt für potenzielle Übersetzung
– Pastior intoniert Baudelaire. –
1
Oskar Pastior war ein bekennendes Mitglied der Gruppe Oulipo, einer 1960 gegründeten und bis heute bestehenden, jegliche Grenzen der sogenannten Nationalliteraturen überschreitenden Vereinigung nicht nur von Schriftstellern, sondern auch von schreibenden Mathematikern, Linguisten, Schachtheoretikern, Architekten und so weiter. Neben Pastior gehörten und gehören dieser Gruppe Autorinnen und Autoren wie François Le Lionnais, Jean Queval, Raymond Queneau, Georges Perec, Michèle Métail, Italo Calvino oder Harry Mathews an, um nur einige bekanntere zu nennen. Anfangs hatte sich die Gruppe noch „S.L.E.“ bzw. „Sélitex“ („Séminaire de littérature expérimentale“) genannt, entschied sich dann aber für den Namen Oulipo: ein Akronym für „Ouvroir de littérature potentielle“, „Werkstatt für potenzielle Literatur“.
Ziel dieser Gruppierung war und ist es, den mystifizierenden Begriff der „Inspiration“ durch den Begriff der „Organisation“ zu ersetzen. Raymond Queneau hat es programmatisch wie folgt auf den Punkt gebracht:
Unsere Absicht besteht darin, ein ganzes Arsenal von Strukturen, Methoden, Techniken anzulegen, in dem der Dichter frei wählen kann, sobald er sich von der sogenannten Inspiration lösen will.
Wenn an die Stelle der „Inspiration“ der Begriff der „Organisation“ tritt, so heißt dies, um nochmals Queneau zu zitieren, „daß eine bestimmte eingegebene Information so behandelt wird, daß alle Möglichkeiten dieser Information systematisch im Lichte eines Modells betrachtet werden“. Daraus erklärt sich auch der Begriff der „Potenzialität“, den die Gruppe im Namen trägt: Es geht ihr um eine größtmögliche Emanzipation des Textes vom Subjekt beziehungsweise von der Subjektivität des Autors zugunsten einer mathematischen Eigengesetzlichkeit oder Eigendynamik des sprachlichen Materials, es geht ihr darum, im Möglichkeitsspielraum der Sprache „systematisch und wissenschaftlich“ auszuloten, was darin angelegt ist, darum, die Differenzialitäten durchzuspielen, durch die Bedeutung produziert wird, darum, den offenen Möglichkeiten der Sprache Priorität einzuräumen vor den faktischen Sprachvollzügen.
Eine solche Elementarteilchenpo(i)etik versteht sich als Arbeit am Signifikanten: am Signifikanten in seinen phonetischen und grafematischen Qualitäten und Phänomenalitäten, an Textmolekülen wie Letter, Silbe, Wort, an Strukturemen wie Kombinatorik, Syntax, Grammatik – also als Arbeit an der Materialität der Sprache. Diese „Arbeit“ („Ouvroir“, „Werkstatt“) folgt einem Verfahren. Das oulipotische Schibboleth dafür heißt „contrainte“: „Zwang“, „Verpflichtung“, „Einschränkung“. Damit sind Spielregeln gemeint, experimentelle Anordnungen, generative Muster, die ihre Potenzen in der Textgenese freisetzen und zu einer Autopoiesis von Texturen führen sollen, sowohl formale als auch materiale (und mitunter semantische) contraintes pour la composition des textes littéraires. – Freilich: Will man die Oulipoten mit ihren eigenen Kampfbegriffen gegen sie selbst ausspielen, so verschiebt sich in ihrem Textbegriff das Moment der Inspiration, das sie so sehr außer Kraft setzen wollen, auf die Ebene der Invention, der Auf– und Erfindung von Regulativen, die die in den sprachlichen Zeichen aufgehobenen Potenzialitäten freisetzen sollen.
Insofern diese écriture sous contrainte – darin nicht unähnlich der surrealistischen écriture automatique, gegen die sie sich literarhistorisch abgrenzt – ihr Prinzip in sich trägt und daraus Texte generiert, führt sie zu einer rencontre interne, zu einer Begegnung der Sprache mit sich selbst, zu einem, mit Foucault geredet, „Rückzug der Sprache auf sich selbst, der dazu führt, daß sie spricht“. Denn letztlich thematisiert ein oulipotischer Text einzig die Verschränkungen seiner Einschränkungen: „Ein Text, der gemäß einer contrainte geschrieben ist, erzählt von dieser contrainte, wie Jacques Roubaud, auch er ein Mitglied der Gruppe, festhält.
Da sich aber diese contraintes auf Sprache beziehen und ihrerseits sprachliche sind, ist ein oulipotischer Text lesbar als einer, in dem die Sprache sich selber liest – wie insbesondere, aber nicht nur, aus den bevorzugten contraintes der Oulipoten deutlich wird; beispielsweise den Anagrammen, in denen die Sprache sich in der Materialität ihrer Lettern liest, oder den Palindromen, in denen sie sich entgegenliest. Das Verfahren ist der Stoff, die Vorgehensweise der Text. Oskar Pastior hat es auf die kürzeste Formel gebracht:
Das ,wie‘ des Verfahrens erweist sich als ontologisches ,daß‘: daß Text da sei. Konjunktivisch, virtuell, potentiell. Oulipo läßt grüßen.
2
Wenn also die Sprache in der oulipotischen Versuchsanordnung einer écriture sous contrainte immer sich selber liest, so heißt dies zugleich, dass sie damit immer auch sich selber übersetzt. Dies gilt nicht nur innerhalb der jeweiligen Sprache, sondern auch für die Sprachen untereinander.
Es fragt sich, was dies für einen „oulipotischen Übersetzungsbegriff“, für eine traduction sous contrainte(s) als eine Technik des literarischen Übersetzens, bedeutet (auf deren Grundlage man dann wiederum das „Outradpo“, das „Ouvroir de traduction potentielle“, als eine weitere unter den zahlreichen Werkstätten des „Ou-x-po“ einrichten könnte…). Ein oulipotischer Übersetzungsbegriff hat sich zumindest bis um 2000 nicht in der Praxis und bis heute nicht in der Theorie etabliert. Auch Pastior beklagt es in seiner Wiener Poetikvorlesung „Vom Umgang in Texten“ aus dem Jahr 1995:
Übertreiben wir mal (was wir ohnehin tun), indem wir reduziert reden (was wir ohnehin tun) – stellen wir uns also möglichst dumm und sagen: Oulipo hin, Oulipo her, die textgenerativen Verfahren und das Übersetzen schließen einander aus. Bewegen sich einfach in unterschiedlichen Dimensionen (…). Der Vorgang ,aus einer Sprache in eine andere Sprache‘ ist noch keine Spielregel (…) – aber Oulipo, die potentielle Werkstatt, könnte doch, bitte sehr, weitere Reduktionsmechanismen auch in dieser Richtung finden, entwickeln, ableiten…
Dabei steht Pastior dem Begriff der „Übersetzung“ grundsätzlich skeptisch gegenüber: „Übersetzen ist das falsche Wort für eine Sache(,) die es nicht gibt“, wie er in seiner Wiener Poetikvorlesung gleich mehrfach betont und auch andernorts des Öfteren wiederholt:
Denn Übersetzung (und nicht nur das, was das Wort vom ,Übersetzen‘ suggeriert) ist streng genommen nicht möglich. Da es das Wort aber gibt, gebrauche auch ich es konventional als Münze; und falle auf den Trugschluß, es gäbe sowas wie einen Gegenwert, immer wieder herein. (…) Nur Texte, die nicht Sprache wären, also keine Texte sind, könnten übersetzt werden.
Dass Übersetzung „streng genommen“ – und das kann hier nur heißen: konventionell verstanden – nicht möglich sei, gilt indes nur im Rückschritt auf einen Begriff von Übersetzung, in der von einer Seite einer mehr oder minder klar gezogenen Trennlinie zwischen zwei Sprachen auf die andere Seite dieser Linie hin übergesetzt würde – über den Ausfallschritt zum transzendentalen Signifikat, der notwendigerweise ein Schritt ins Leere ist. Pastior präzisiert denn auch sogleich:
Wenn es schon keine Übersetzung gibt, dann ist jede sogenannte Übersetzung ein Sonderfall des Selberschreibens.
An seinen eigenen „Sonderfällen des Selberschreibens“ eines Baudelaire-Gedichts, 2002, sieben Jahre nach der Wiener Poetikvorlesung unter dem Titel o du roher iasmin erschienen, lässt sich genau studieren, was unter einem „oulipotischen Übersetzungsbegriff“ verstanden werden kann. Pastior spricht freilich nicht von „Übersetzungen“, sondern von „Intonationen“ – nicht von Intonationen von einem oder auf ein Gedicht Baudelaires, sondern von Intonationen zu: „43 intonationen zu ,Harmonie du soir‘ von charles baudelaire“, wie es im Untertitel heißt. Weit mehr, als ein von oder auf es täten, stellt das zu eine Distanz her zwischen den Texten – und bringt sie zugleich in ein Verhältnis der wechselseitigen Spiegelung: Das zu bezeichnet die weiße Mitte, auf die sich die Texte von beiden Seiten zubewegen und wo jene „Begegnung mit der Grenze“ – die sich nicht ziehen lässt – als „Illusion des Kennens und Lernens“ stattfindet, als die Pastior das Übersetzen schon in den frühen achtziger Jahren bezeichnet hat.
Seine intonationen versteht er als Versuche, den Text Baudelaires „anzupeilen – jeweils aus einem begrenzten (und auch begrenzenden) winkel materialer strategien der anordnung und ortung“, als „anläufe, notgedrungen schiefe“, als „tastbewegung(en) auf eine noch inexistente, aber im detail möglicherweise bereits seltsam umrissene figur hin“. Der Begriff der „Intonation“ ist aber vor allem auch ein phonetischer und musikalischer und meint ein Anstimmen, ein Anklingenlassen, auch einen Tonhöhenverlauf und in einem weiteren Sinne das (möglichst ,reine‘) Zusammenstimmen mehrerer Töne, Klänge, Stimmen – also ein Verhältnis der Stimmung –, und referiert damit in allen Fällen auf etwas, was im Medium der Schrift gerade nicht aufgehoben ist. Die Interferenzen zwischen den Texten Baudelaires und Pastiors sind insofern auch als phonetische und insbesondere als musikalische lesbar: als ein Intonieren von Texttönen, Textstimmen. Textklängen zueinander.
3
Pastiors Intonationen zu Baudelaire beginnen aber nicht mit dem Gedicht „Harmonie du soir“, das sie unaufhörlich, in 43 Anläufen, „anpeilen“ und dessen Anagramm „o du roher iasmin“ sie im Titel tragen, sondern mit dem Autornamen selbst: mit„ Baudelaire“ beziehungsweise „Charles Baudelaire“ – also ausgerechnet mit jenem sprachlichen Sonderfall des Eigennamens, der, wie Derrida schreibt, „stets unübersetzbar“ ist und insofern „strenggenommen nicht zur Sprache oder zu deren System gehört, zumindest nicht so, wie andere Wörter der Sprache angehören“. Pastior intoniert den Eigennamen, indem er ihn dekonstruiert – und das heißt hier: indem er ihn anagrammatisch verflüssigt. Das Buchstabenmaterial „Baudelaire“ wird in eine Kaskade von Anagrammen ,übersetzt‘, die teilweise im Deutschen Bedeutungen freisetzen – als „Fundstück(e) in Bedeutsamkeit arte(n)“, wie Pastior selbst sagen würde (so wird zum Beispiel aus „baudelaire“ „adriabeule“, „idealbauer“, „aber du laie“, „debile aura“) –, die morphologisch-lexikalisch-grammatisch auf das Deutsche, aber auch auf das Französische und Englische rekurrieren oder es auch bloß imitieren (wie etwa „rabe die lau“, „barel adieu“, „dealer baiu“), oder aber die sich einer solchen Zuordbarkeit zu entziehen scheinen (so „leda eurabi“, „baude aleri“ u.ä.). Vergleichbares geschieht im zweiten Gedicht mit dem Buchstabenmaterial „Charles Baudelaire“.
Entscheidend an dieser Ouvertüre ist jedoch weniger die sprachspielerische De- und Rekomposition in ihren konkreten Ausgestaltungen als vielmehr, was sich in ihnen vollzieht: eine Dekonstruktion der Autorinstanz im Horizont einer Reorganisation beziehungsweise Selbstlektüre des sprachlichen Materials gemäß der anagrammatischen contrainte.
Solchermaßen aus seiner auktorialen Festschreibung gelöst, wird das Sprachmaterial von „Harmonie du soir“ immer und immer wieder durch das oulipotische Traduktionslabor geschickt, immer wieder von Neuem intoniert. Das anagrammatische Verfahren, dem neben dem Eigen- beziehungsweise Autornamen „(Charles) Baudelaire“ auch der Werktitel „Les fleurs du mal“, der Sektionstitel „Spleen et idéal“ sowie das Gedicht „Harmonie du soir“ selbst – Zeile für Zeile durchanagrammiert – unterzogen werden, ist dabei nur ein Verfahren unter vielen. Pastior bietet ein ganzes Arsenal an oulipotischen contraintes auf, um Baudelaires Sprachmaterial intonierend zu ,übersetzen‘. Ich kann hier nicht auf alle eingehen, sondern greife einige davon heraus, um den Resonanzraum anklingen zu lassen, der sich in diesen Textinterferenzen allmählich aufbaut.
Ein erster Typus an Intonationen beruft sich nicht, wie die Anagramme, auf den „Letternleib“ des Baudelaire-Gedichts, sondern ganz auf dessen „Lautleib“, unter radikaler Durchstreichung aller Semantik, einzig der Materialphonetik verpflichtet. Ein Beispiel: Was Pastior als „Oberflächenübersetzung“, auch sie ist eine contrainte, bezeichnet, stellt den Versuch dar, sich ausschließlich am Eigenklang, am Klangverlauf, also in mehrfacher Hinsicht an der Intonation des französischen Textes, wie sie im Akt des Übersetzens überhaupt erst intoniert wird, zu orientieren und sie als solche ins Deutsche zu ,übertragen‘, wo sie sich remorphologisiert und mithin resemantisiert. Um es nur an den ersten beiden Verszeilen von Baudelaires Gedicht vorzuführen:
Aus „Voici venir les temps où vibrant sur sa tige / Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir (…)“ wird „wo saß sie wenn ihr (voici venir) gang & viehbrands ur attische (vibrant sur sa tige) / schlackenflöhe (chaque fleur) aus poren des einsickernden zensors (s’évapore ainsi qu’un encensoir)“.
Diese ,Übersetzung‘ ist insofern blind, als das Auge darin keine Rolle spielt. Das Ohr wird zum alleinigen Übersetzungsorgan – jedoch nicht so, dass der Tonhöhenverlauf das Klangspektrum der baudelaireschen Gedichtzeilen in eine amorphe Sprachmaterialmasse aufgelöst würde, sondern am Sprachgitter einer anderen Grammatik – hier der deutschen – anschließt.
Ähnlich und doch ganz anders verhält es sich mit dem, was man als „Konsonantisen“ beziehungsweise „Vokalisen“ bezeichnen kann: Übertragungen der konsonantischen beziehungsweise vokalischen Linearitäten des Ausgangstextes ins Deutsche. Aus „Harmonie du soir“ wird – man denke an die duftenden Blumen Baudelaires – in der Konsonantise ein „aromen–dossier“, aus dem ersten Vers „Voici venir les temps où vibrant sur sa tige“ wird „vesuv – nur alte mäuse wabern so rosa o tasche“ usw. – wobei hier das Ohr auch insofern das alleinige Übersetzungsorgan ist, als es übergeht, was das Auge (im freilich noch nicht intonierten Text) sehen würde: Dass ein französisches „c“ wie ein deutsches „s“ klingt und deshalb aus „voici venir“ „vesuv – nur“ werden kann, dass das „p“ im französischen „temps“ unhörbar ist und deshalb in der deutschen Übertragung auch nicht auftauchen muss, dass das „g“ in „tige“ wie ein deutsches – allerdings stimmloses – „sch“ („tasche“) tönt usw. Dieser Phonozentrismus Pastiors, der bei ihm keineswegs ein allgemeiner ist, manifestiert sich vielleicht am deutlichsten im Palindrom: Wenn er etwa, an ganz anderer Stelle, den Buchstaben „z“ – phonetisch geschrieben „ts“ – palindromisch als „st“ liest.
Die „Vokalisen“ sind ihrem Prinzip nach den „Konsonantisen“ vergleichbar, doch variiert Pastior diesen Intonationstypus ungleich vielfältiger: nicht nur als „Reduktionsvokalise“, die bloß mit den drei hörbaren Vokalen a-o-i des Wortes „harmonie“, also den Harmonievokalen beziehungsweise den Vokalharmonien, arbeitet, oder als „Vokalpalindromase“, die ebendiese Vokale in ein endloses Spiel von in sich gespiegelten Verschiebungen versetzt, sondern auch, indem er den gesamten Gedichttext durchvokalisiert – aber nicht, indem er einfach um die Vokalfolge in Baudelaires Gedicht herum die Konsonanten verändern würde, sondern indem er die Binnenstruktur der Vokale in „Harmonie du soir“ nach dem alphabetisch geordneten Grundschema a-e-i-o-u viermal um je eine Position nach hinten verschiebt, und zwar in vier Durchläufen für jede einzelne Zeile des Gedichts.
Um es nur an der Titelzeile vorzuführen: Aus der phonetischen Vokalkonstellation von „Harmonie du soir“ – a-o-i-u-o-a – wird nach dem alphabetischen Grundschema a-e-i-o-u die Vokalkonstellation e-u-o-a-u-e („deputat – statue“), daraus die Vokalkonstellation i-a-u-e-a-i („insalubre magie“), daraus wiederum die Konstellation o-e-a-i-e-o („monegassipeon“) und schließlich die Konstellation u-i-e-o-i-u („mulinee dos piu“), aus der nach dem Grundschema wieder a-o-i-u-o-a („Harmonie du soir“) folgen müsste.
Ich verzichte darauf, dies hier für sämtliche 16 Zeilen des Gedichts vorzurechnen, und beschränke mich auf die Feststellung, dass im Spiel von der endlosen Verschiebung der Vokale (denn nach fünf Verschiebeoperationen, den Ausgangstext eingerechnet, kann das Spiel wieder von vorne beginnen) – dass in dieser endlosen Verschiebung der Vokale also nicht einfach die Binnenklänge von Baudelaires Gedicht resonieren, sondern deren Binnenstruktur selbst, als eine durch endlose Verschiebung abstrahierte: Das einzige, was in diesen Verschiebungen transportiert und transponiert wird, ist die Vokalkonstellation der vollständig durchpotenzialisierten Vokale selbst. Dies ist eine Form der traduction sous contrainte, die nicht nur jeglicher Semantik radikal abgesagt hat, sondern letztlich eine Form sprachlicher Materialspaltung betreibt.
Es gibt bei Pastior allerdings auch semantische Übertragungen, allesamt einer oulipotischen contrainte gehorchend wie etwa „semantisch gegenteilig“ oder „semantisch schlank“. Um nur den letzten Fall als Beispiel anzuführen, klingt Baudelaires Abendharmonie in knappster Form wie folgt (wobei die Zeilenrepetitionen bzw. -allusionen sich mit denen bei Baudelaire decken):
stengel vibrierend
diverse ausdünstungen
klangwolke duftwelke
schwindeltaumeldrängel
diverse ausdünstungen
es quengelt die geige
schwindeltaumeldrängel
firmament firmament
es quengelt die geige
man ist überfordert
firmament firmament
sonnenuntergangster
man ist überfordert
brunnenschwengel pumpt
sonnenuntergänge
tagebuchimplantat.
Diese semantische Verknappung ist ein Verfahren, das zu den mittlerweile ,klassisch‘ oulipotischen gezählt werden darf und namentlich aus Raymond Queneaus „Exercices de style“ bekannt ist – allerdings nicht zum Zwecke des Übersetzens.
Dasselbe gilt für einen weiteren Übersetzungstypus, der auf einen numerisch-lexikalisch gesteuerten Austauschmechanismus des Wortmaterials setzt. Die entsprechende contrainte heißt SVA + 7 und bezeichnet ein Substitutionsverfahren, in dem in einem gegebenen Text jedes Substantiv, Verb und Adjektiv (SVA) durch das siebte Substantiv, Verb und Adjektiv ersetzt wird, das ihm in einem beliebigen Wörterbuch folgt (das dann meist auch angegeben wird). Diese von Jean Leseure erfundene contrainte, deren sich Pastior nicht nur bei der Übersetzung ins Deutsche bedient, sondern auch bei der Übersetzung von Baudelaires Gedicht vom Französischen ins Französische (aus „Harmonie du soir“ wird „Hasard du solde“), bewegt sich auf den Achsen von Paradigma und Syntagma, von Selektion und Kombination, wie sie Roman Jakobsons formalistischer Textbegriff als strukturale Prinzipien der Sprache überhaupt und der Sprache der Poesie beschreibt. Die Zahl 7 freilich ist arbiträr, ebenso die Auswahl der Wortarten. Wäre nach der Regel x + n die Zahl n mit der Anzahl Einträge der Wortart x in einem bestimmten Wörterbuch identisch, so würde sich der Ausgangstext als n-te Potenzialität seiner selbst begegnen.
Schließlich die Frage: Welches Gewicht besitzt ein Gedicht? Dasjenige Baudelaires jedenfalls wiegt seinem Titel nach 169 – gemessen nach einer oulipotischen contrainte, die von Michelle Grangaud stammt und deren Umsetzungen, „gewichtete Gedichte“, sie als „poèmes timbrés“ bezeichnet hat – was man als „übergeschnappte“ (im Sinne von „cinglés“), aber auch als (besonders stimmlich) „klangfarbige“ und nicht zuletzt als „(ab-)gestempelte“, „frankierte“ Gedichte lesen kann. „Frankiert“ sind diese Gedichte mit der arbiträren Numerik des Alphabetes selbst: A = 1, B = 2, C = 3 bis Z = 26. Pastior war von dieser contrainte, wie er Michelle Grangaud gegenüber brieflich bekannt hat, „von Anfang an elektrisiert“, als er im Januar 1998 davon erfuhr, und schickte – notabene auf postalischem Weg, also mit Briefmarken, „timbres“, versehen – an alle möglichen Freunde und Bekannte solche „frankierte Gedichte“ zu deren jeweiligem Namensgewicht, immer auf Deutsch. In den Baudelaire-Intonationen nun verwendet er diese contrainte zur Übersetzung, indem er aus „Harmonie du soir“ die Zahl 169 errechnet und aus dieser Zahl wiederum deutsche Wörter und Wortfolgen generiert, die dasselbe Gewicht haben: so zum Beispiel „meine mikadozikaden“ oder „orangenbuchstaben“ oder „charles baudelaire du“.
Man mag hier nach traditionellem Verständnis längst nicht mehr von einer „Übersetzung“ reden wollen – und dennoch ist diese oulipotische traduction sous contrainte in gewisser Hinsicht die stringenteste, die sich überhaupt denken lässt: Denn im Akt des Frankierens rekurriert sie auf eine (und vielleicht die einzige) gesicherte Gemeinsamkeit der französischen und der deutschen Sprache, die beide natürlich auch mit vielen anderen Sprachen teilen: auf das zwar arbiträre, aber multi- und interlinguale Ordnungsschema des Alphabetes selbst – das im Französischen genauso wie im Deutschen von A bis Z reicht und dazwischen 24 Buchstaben in identischer Linearität aufreiht. Die Gedichtfrankaturen, denen als briefliche nicht zuletzt auch ein dialogischer, hier zunächst an Baudelaires Gedicht gerichteter Impuls innewohnt, bemessen sich somit nach einem alphaordinatorischen Code, der sich im Akt des Übersetzens vom Französischen ins Deutsche (u.Ä.) nicht ändert. Dass sich im Falle von „Harmonie du soir“ (169) daraus auch das Wort „letterngewicht“ (169) ergibt, ist freilich die raffinierteste Pointe von Pastiors Realisierung dieser contrainte.
Man könnte hier noch länger fortfahren und von „akronymakronymen“ über „akronymakrosticha mit gegenlauf am zeilenende“ bis hin zu diversen „zopfmodulen“ sprechen. Ich will zum Ende aber lieber die Schlussfolgerungen zu ziehen versuchen, die sich aus Pastiors Baudelaire-Projekt für einen oulipotischen Übersetzungsbegriff ergeben.
4
Was hiernach für das Verhältnis von Übersetzung und Original an Bedeutung dem Sinn verbleibt, lässt sich in einen Vergleich fassen. Wie die Tangente den Kreis flüchtig und nur in einem Punkte berührt und wie ihr wohl diese Berührung, nicht aber der Punkt, das Gesetz vorschreibt, nach dem sie weiter ins Unendliche ihre gerade Bahn zieht, so berührt die Übersetzung flüchtig und nur in dem unendlich kleinen Punkte des Sinnes das Original, um nach dem Gesetze der Treue in der Freiheit der Sprachbewegung ihre eigenste Bahn zu verfolgen.
Dieser „Vergleich“ für das „Verhältnis von Übersetzung und Original“, wie ihn Walter Benjamin am Ende seines Essays „Die Aufgabe des Übersetzers“ zieht (den er ja als Einleitung zu seinen eigenen Übersetzungen von Baudelaires „Tableaux parisiens“ aus den Fleurs du mal geschrieben hat und über den er sich gegenüber Scholem dahingehend äußerte, er hätte ihn nicht aus allgemeinen philosophischen Vorarbeiten heraus entwickelt, sondern aus den konkreten Erfahrungen beim Übersetzen Baudelaires) – dieser Vergleich Benjamins ist nur in einem Punkte zu ergänzen, um darin einen oulipotischen Übersetzungsbegriff lesbar zu machen: Der oulipotischen Übersetzungstangente schreibt nicht nur die flüchtige Berührung mit dem Kreis in einem Punkte das „Gesetz“ vor, sondern sie auferlegt sich freiwillig ein weiteres Gesetz, die contrainte, die im Unterschied zu Benjamins Übersetzungsbegriff vorgängig auch den Punkt selbst bestimmt, an dem die Tangente den Kreis flüchtig berühren will, um hernach „nach dem Gesetze der Treue (und das heißt hier: der Konsequenz) in der Freiheit der Sprachbewegung ihre eigenste Bahn zu verfolgen“.
Der Kreis selbst aber ist lesbar als jene „ertastete“ (also berührte), „noch inexistente, aber im detail möglicherweise bereits seltsam umrissene figur“, von der Pastior im Nachwort zu seinen Baudelaire-Intonationen spricht. Gäbe es eine unendliche Anzahl an contraintes, und würde man ihnen gemäß die Tangentialisierungen unendliche Male – und nicht bloß 43 Mal – wiederholen, so müsste sich in der Summe der unendlich vielen Tangentialpunkte im unendlichen Übersetzungstext endlich eine Linie abzeichnen, in der die Kreisfigur des Originals lesbar würde: Am messianischen Ende schlüge die infinite Potenzialität um in die Aktualität der Übersetzung.
Dieses messianische Ende aber, das Benjamin in den vorbereitenden Notizen zu den „Geschichtsphilosophischen Thesen“ als eine „Welt allseitiger und integraler Aktualität“ denkt – somit als Absenz von Potenzialität, die ihrerseits, nach Giorgio Agamben, als „Präsenz einer Absenz“ („presence of an absence“) begreifbar ist –, dieses messianische Ende, als totale Absenz einer Präsenz von Absenz, reflektiert und imaginiert Benjamin in seinem Übersetzeressay vorzugsweise in einem anderen Begriff als dem des Kreises. Er nennt ihn drei Mal: „Harmonie“. Der Begriff vermittelt jene „Illusion von Totalität“, als die ihn Paul de Man zu Benjamins „tropologischen Irrtümern“ gezählt hat. Diese „Totalität“, von der Benjamin im Übersetzeressay auch selbst spricht, bestünde für ihn gerade darin, dass am messianischen Ende der (Sprach-)Geschichte das „Gemeinte“ der „einzelnen“, „unergänzten Sprachen“ nach „stetem Wandel“ endlich „aus der Harmonie all (ihr)er Arten des Meinens als die reine Sprache herauszutreten vermag“.
Einer solchen Sehnsucht nach der lingua adamica hängt auch Pastior an – „naiv“ vielleicht, „zweifelnd“ sicherlich, wie er 1994 in der Frankfurter Poetikvorlesung „Das Unding an sich“ sagt, „als sei eine Paradiessprache doch noch machbar, wiederherstellbar durch hymenoplastische Operationen am Sprachleib der Erkenntnis, am Erkenntnisleib der Sprache…“ Diese Operationen, denen der – hier als weiblicher imaginierte – Leib der Sprache zur Wiederherstellung seiner verlorenen Unschuld („hymenoplastisch“) zu unterziehen wäre, würden, in einer Engführung der Tropen Benjamins und Pastiors gesprochen, am messianischen Ende, am ,Abend‘ der Sprachgeschichte, in einem paradiesischen Resonanzraum in jene ertönende Harmonie münden, in der alle Arten des Meinens der einzelnen unergänzten Sprachen zueinander intoniert wären und als wechselseitige Echos am Schwingen sind. Die Aufgabe des Übersetzers wäre es demnach, als ein Intonierender auf den Aufbau einer Harmonie hinzuarbeiten, die schon Benjamin als eine musikalische denkt.
Thomas Strässle, Text+Kritik, Heft 186, April 2010
PASTORALE FÜR PASTIOR
Vorsichtig muß ich gehen
auf diesem Gartenpfad
um nicht auf einen Buchstaben zu treten
aus seinem Lied
vieles hat er um sich verstreut
nichtvorhandene Kräuter pflanzend
so langsam so zerstreut
so kindlich
ich muß eine Amsel vertreiben
eine zu neugierige
wenn nötig
stelle ich mich mitten in die Beete
in einem ganz bunten Mantel
ich werde die Arme spreizen
komische Grimassen schneiden
nur um jedes seiner Körner
zu bewahren
ein Baum wird daraus wachsen
der prächtigste auf unserem Gut
Bora Ćosić
Aus dem Serbischen von Nikola Krnjaić
Interview mit Oskar Pastior für das Haus des Deutschen Ostens.
Interview mit mir. Diese Aufnahme beinhaltet ein poetologisch dichtes, leider aber nicht realisiertes Interview von Christian Prigent mit Oskar Pastior, dass vermutlich für die von Christian Prigent herausgegebene französische Zeitschrift TXT geführt wurde.
Lesung Oskar Pastior am 20.7.2005 im Deutschen Literaturarchiv Marbach.
Herta Müller: Mein Freund Oskar
Franz Josef Czernin: Die Regel, das Spiel und das Andere. Zum Werk Oskar Pastiors.
Oskar Pastior liest aus seinen verschiedenen Texten und Übersetzungen ein Programm, das die Sprachbewegung jeweils in der Konzentration auf einzelne Laute und Buchstaben nachvollzieht. Aufgenommen auf einem mehrtätigen Festival mit dem Titel Für die Beweglichkeit im Kunstverein Maerz in Linz.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jochen Hieber: Die Suppe ist einmalig
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1987
Herbert Wiesner: Frauen-Bild-Beschreibungsschrift
die tageszeitung, 20.10.1987
Hans Bergel: Vom Rückzug der Sprache auf sich selbst
Siebenbürgische Zeitung, 31.10.1987
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Hannes Schuster: Ein „Wörtlichnehmer“, der das Wörtlichnehmen ertragbar macht
Siebenbürgische Zeitung, 15.11.1992
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Bettina Knauer/Gunnar Och (Hg.): Oskar Pastior, 70
Akzente, 1997
Herta Müller: Minze Minze
Die Zeit, 17.10.1997
Franz Mon: „die krimgotische Schleuse sich entfächern zu lassen“
Der Literaturbote, 2004
Jörg Drews: Eros & Callas?-: Ein Echo-Kollaps
Süddeutsche Zeitung, 20.10.1997
Zsuzsanna Gahse: Schwitt, Schwitter, am Schwittersten
Stuttgarter Zeitung, 20.10.1997
Harald Hartung: Jalousien aufgemacht!
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.10.1997
Paul Jandl: Die Hosenträger der Erkenntnis
Neue Zürcher Zeitung, 20.10.1997
Cornelia Jentzsch: Gimpelschneise in der Winterreise
Berliner Zeitung, 20.10.1997
Dorothea von Törne: Der Meister der Wortlust
Der Tagesspiegel, 20.10.1997
Ernest Wichner: Magier der Vernunft
Frankfurter Rundschau, 20.10.1997
Thomas Krüger: hart pommern die fritten
Die Woche, 31.10.1997
Gerhard Mahlberg: Aus Anlaß seines 70sten Geburtstags am 20. OktoberDeutschlandradio
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Thomas Kling: Die Ballade vom defekten Kabel
Literaturen, Heft 10, Oktober 2002
Thomas Kling: Die glühenden Halden
Frankfurter Rundschau, 19.10.2002
Nachrufe auf Oskar Pastior: NZZ ✝ FAZ ✝ BZ ✝ Der Tagesspiegel ✝
Die Welt ✝ der Freitag ✝ die horen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ✝ AdK ✝
Chimaere ✝ Schreibheft
Weitere Nachrufe:
Nico Bleutge: Ein Verwandlungskünstler der Sprache
Stuttgarter Zeitung, 6.10.2006
Michael Braun: Vom Sichersten ins Tausendste
Basler Zeitung, 6.10.2006
Michael Krüger: Schamane des Experimentellen
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Christine Lötscher: Er verzauberte die Sprache und Menschen
Tages-Anzeiger, 6.10.2006
Martin Lüdke: Aus dem Staub gemacht
Frankfurter Rundschau, 6.10.2006
Peter Mohr: Ein Magier der Sprache
Badische Zeitung, 6.10.2006
Lothar Müller: Der Zungenzwinkerer
Süddeutsche Zeitung, 6.10.2006
Hubert Spiegel: Im Exil bei Freunden
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.10.2006
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1, 2 & 3
und zum IM Stein Otto
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 +
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett + IMAGO +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Oskarine ist ein Gedicht-Generator von Ulrike Gabriel, der auf den Gedichten von Oskar Pastior basiert. Jedes Gedicht spricht sich selbst – immer neu und mit der Dichter-Stimme.


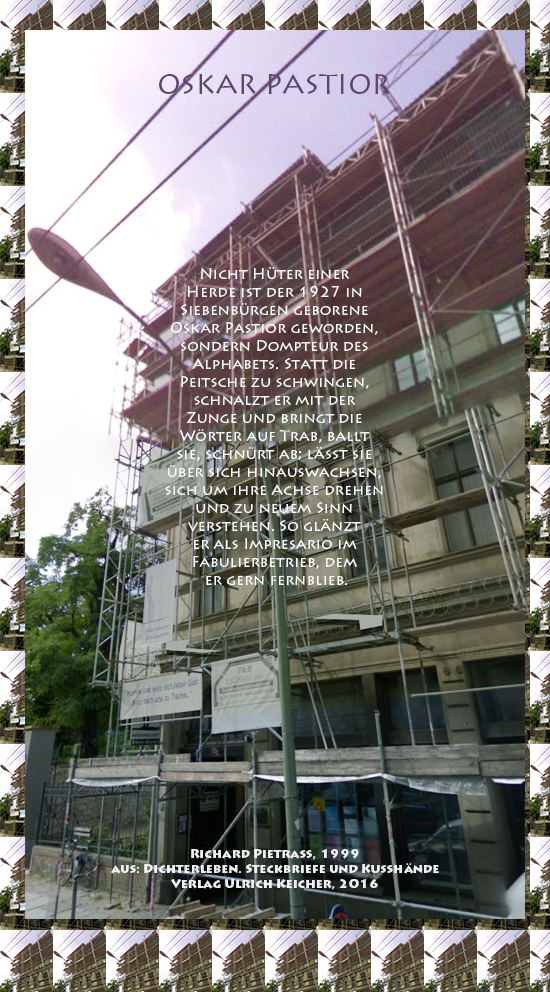












Schreibe einen Kommentar