Peter-Huchel-Preis 1987: Wulf Kirsten
WOHERWOHIN
ich schnauf, ich rühr im schlamm, ich kaue
aaaaasauerampfer,
ich sitz verdreckt auf einem rodestock im wald
und leb getrost im stande der geflickten hosen.
ich schleppe säcke, karre steine, hebe gräben aus,
werd leben wie der rohrleger, der die schneidkluppe
aaaaahält.
ich werd ein fuder heu abstechen,
erst wartend sitzen vor der balkenfahrt und sehn,
daß selbst die steine schwitzen.
aufstehn gleich wie nichts, armselig,
lebensgröße: ein staubkorn,
der schädel dumpf und wie verblödet.
aufstehn gleich wie nichts
aus einem erdwinkel, der in der erinnerung
nach einem schub frischer brotlaibe duftet.
ich, angstschlotternd schaf,
aaaaaaaaaaein sanftes orgelstück zum lebenslauf,
ich, kaffschreiber,
aaaaaaaaaakorrekt vor nackten paragraphen,
ich, landflüchter, dichter im büro,
aaaaaaaaaaentwichen höheren lehranstalten,
ich, redefigur aus erdreich,
aaaaaaaaaaverstreu eine handvoll worte,
ich bin unterwegs ins wolynische Brody
aaaaaaaaaazu einer unterredung mit Babel und Roth,
ich gehe los, werd eine nacht durch wandern,
aaaaaaaaaawie es Paustowski tat,
ich, meine freunde, wir gehen, wir reden
aaaaaaaaaaimmer ein menschliches wort.
Naturlyrik heute
Nach dem Willen seiner Stifter wird der Peter-Huchel-Preis für eine Neuerscheinung des vergangenen Jahres verliehen. Bedingung ist „ein besonders bemerkenswerter Beitrag zur Entwicklung der deutschsprachigen Lyrik.“ Diese Formulierung der Satzung ist staatsgeopraphisch neutral und frei von politischem Hintersinn. Die Jury – sieben Literaten aus drei Ländern – war gehalten, Dichtungen aus dem gesamten deutschen Sprachgebiet, einschließlich der Sprachinseln in Rumänien, Luxemburg und dem französischen Elsaß zu prüfen; unter den Neuerscheinungen aus der Bundesrepublik fanden sich auch deutsche Verse türkischer Staatsbürger. Wir hatten nicht Staatsbürgerschaften zu veranschlagen, sondern einen Beitrag zur deutschen Literatur zu honorieren. Die Wahl des in Weimar lebenden und in der Deutschen Demokratischen Republik hochgeschätzten Lyrikers Wulf Kirsten ist also politisch ebenso untendenziös, wie etwa vor zwei Jahren die rühmende Hervorhebung des Österreichers Peter Waterhouse durch dieselbe Jury. An diese Selbstverständlichkeit zu erinnern, scheint mir heute nicht überflüssig. Denn gewisse Reminiszenzen stellen sich ein, wenn ein Lyriker aus der DDR den Preis erhält, der Peter Huchels Gedächtnis gewidmet ist. Es sind schmerzliche Reminiszenzen, aber wir sind es Huchels Andenken schuldig, sie gerade heute nicht zu verdrängen. Daß dieser Preis in Staufen und nicht etwa in Wilhelmshorst, in Huchels Heimat, übergeben wird, hat trübe politische Gründe. Nicht aus freien Stücken verbrachte Huchel seine letzten Lebensjahre in Staufen; sie wurden durch ein schäbiges Unrecht verbittert, das ihm von den Instanzen des Staates angetan wurde, dessen Nationalpreisträger und bedeutendster Dichter neben Bert Brecht er war. Von diesem Unrecht wirkt heute noch einiges nach. Huchels offizielle Rehabilitierung geschieht zögerlich; mit einer Geste wie dem Nachdruck der von Axel Vieregg besorgten Gesammelten Werke wäre sie vielleicht vollzogen. Huchels Gedichte sind seit mehr als fünfundzwanzig Jahren im Buchhandel der Deutschen Demokratischen Republik nicht erhältlich. Dadurch ist nicht verhindert worden, daß er auch dort seine Leser hat – er hat sie vor allem unter den Autoren. Die deutsche Lyrik dieser Jahrzehnte, im Osten wie im Westen, verdankt Peter Huchel wesentliche Anstöße und einen Maßstab, an dem sich zu messen keiner, der schreibt, umhinkommt und vor dem immer nur wenige bestehen werden. Diesen Einfluß bestätigt auch die offizielle im Verlag Volk und Wissen erschienene Geschichte der deutschen Literatur (Band 11, 1977), und sie betont ihn ausdrücklich in einem Artikel über Wulf Kirsten. Der Verfasser rühmt dort Kirstens Beitrag zur sozialistischen Natur- und Landschaftsdichtung; Kirsten habe „neue Aspekte in die sozialistische Landschafts- und Heimatdichtung“ gebracht und zwar in kritischer Auseinandersetzung mit einer Tradition, die näher bezeichnet wird durch die Namen Theodor Kramer, Johannes Bobrowski und Peter Huchel. Es ist die Tradition großer deutscher Naturlyrik, und daß sie heute in Wulf Kirsten einen ihrer eigentümlichsten Vertreter besitzt, darin stimmen seine Rezensenten in Ost und West überein. Einer speziellen sozialistischen Qualität ist aber, soviel ich weiß, bis jetzt noch keiner habhaft geworden. Es handelt sich hier offenbar um eine polit-ästhetische Leerformel. Die Unterscheidbarkeit einer sozialistischen und einer kapitalistischen Naturlyrik – letztere etwa von einem Schweizer Autor zu erwarten – wäre denn doch wohl das Ende der Poesie. Anders verhält es sich aber mit der heimatlichen, sozialen und lebensgeschichtlichen Prägung eines Lyrikers. Sie macht Kirstens Gedichte unverwechselbar, und sie ist das dominierende Thema seiner Poesie. Hier gilt das Wort aus dem West-östlichen Divan:
Wer das Dichten will verstehen
Muß ins Land der Dichtung gehen;
Wer den Dichter will verstehen,
Muß in Dichters Lande gehen.
Was doch wohl besagen will: die Dichtung hat als Dichtung ihr „eigenes“ Land, ein Land aus Sprache, mit eigenen Gesetzen, Poetik genannt. Nur wer sich dahin begibt – lesend, denkend, fühlend, neugierig auf den Buchstaben und den Geist −, wird begreifen, was Dichten ist. Kennt er aber nicht auch das Land, die Landschaft, den Staat, in denen der Dichter als Bürger zuhause ist, so wird er immer nur halb verstehen, wer zu ihm spricht im Gedicht, und warum es auf diese Weise geschieht. Goethes Maxime bewährt sich sehr eindrucksvoll an Wulf Kirsten und seinen Gedichten. Bereits der Titel des Bandes, dem er die heutige Ehrung verdankt – die erde bei Meißen −, gibt eine starke Bindung an Land und Landschaft zu erkennen. Es ist, wie sich in vielen Versen bestätigt, eine Bindung aus lebensgeschichtlichen Bedingungen, sie hat aber zugleich den Charakter einer Entscheidung. Das Buch enthält Gedichte aus zwei Jahrzehnten. Das früheste trägt die Jahreszahl 1961, die jüngsten wurden 1982 geschrieben. Diese 112 Gedichte sind keine Gesamtausgabe, aber doch eine repräsentative Auswahl, von Eberhard Haufe besorgt – die Revue einer beharrlichen und inspirierten Spracharbeit, durch die uns ein eigenwilliger Dichter, der seine Eigenart gefunden hat, ebenso kenntlich wird wie des Dichters Land: „ich – auf der erde bei Meißen“. Jedenfalls ist solche doppelte Kenntlichkeit – ich und mein Land – Ziel seines Schreibens. Das Gedicht „satzanfang“, 1967 entstanden, liest sich geradezu als ein Programm-Entwurf:
den winterschlaf abtun und die wunschsätze verwandeln! saataufgang heißt mein satzanfang. die entwürfe in grün überflügeln meiner wortfelder langsamen wuchs.
im überschwang sich erkühnen zu trigonometrischer interpunktion! ans licht bringen die biografien aller sagbaren dinge eines erdstrichs zwischenein.
inständig benennen: die leute vom dorf, ihre ausdauer, ihre werktagsgeduld. aus wortfiguren standbilder setzen einer dynastie von feldbestellern ohne resonanznamen.
den redefluß hinab im widerschein die hafergelben flanken meines gelobten lands. seine rauhe, rissige erde nehm ich ins wort.
Programmatische Verse, eine Art poetologischer Selbstverpflichtung. Als Beteuerung vielleicht eine Spur zu pathetisch. Aber an gewisse Pathosformeln gewöhnt man sich bei Kirsten bald, sie gehören seit langem zur Tradition gerade der Naturlyrik. Er verwendet sie oft, in frühen Gedichten öfter als in späteren, häufig in ironischer Brechung. Auftrumpfend und selbstherrlich sind sie nicht, eher gewinnt man den Eindruck, daß der Sprechende sich mit ihnen Mut macht. Und vielleicht brauchte es wirklich Mut, aus dörflich-kleinstädtischem Milieu stammend – „als armer / karsthänse nachfahr“ wie er sich nennt −, überhaupt Verse zu schreiben und die Behauptung „Ich bin ein Dichter“ gegen jeden Widerstand durchzusetzen. In „satzanfang“ gibt er uns zu wissen, daß er seine Richtung, sein Thema gefunden hat, mitten im Schreiben. Er verbindet seine soziale Herkunft mit seiner selbstgewählten Bestimmung, indem er „saataufgang“ und „satzanfang“, Feld und „wortfeld“ in eine Gleichung stellt. Es ist, nebenbei bemerkt, eine sehr alte Gleichung: die sympathetische Analogie von Agrikultur und Sprachkunst, die uns in der lateinischen Bedeutung des Wortes Vers überliefert ist – Furche und Zeile. Aber diese Gleichung wird nicht in artistischer Unverbindlichkeit memoriert. Es ist nicht der Blick des Städters, der hier über Schreibtisch und Bücherbord auf Felder sieht. Kirsten hat in entgegengesetzter Blickrichtung diese Analogie von Feld und Wortfeld, Furche und Zeile begriffen – von den eigenen, gar nicht intellektuellen Anfängen her. Er will das ihm Nächstliegende zur Sprache, die „biografien aller sagbaren dinge“ ans Licht bringen; er will Menschen, die keine „resonanznamen“ haben, Leuten vom Dorf, „standbilder“ aus Worten errichten, will „inständig benennen“. Nichts anderes, unabhängig von allen Sujets, ist die Bestimmung der Poesie. Und nichts ist leichter, als an solchen Vorsätzen zu scheitern; hier liegen Vergeblichkeit und Gelingen dicht beieinander, es kann nicht anders sein. Aber in seinen besten Gedichten gelingen Wulf Kirsten tatsächlich inständige Bennennungen, Biographien sagbarer Dinge, auch Standbilder „aus wortfiguren“. Ein solches Standbild hat er dem Orgelbauer Gottfried Silbermann gewidmet (dies freilich ist ein resonanzstarker Name). Und eine Art Rettung ist ihm in seinem Porträt-Gedicht auf Amalie Dietrich gelungen. (Das Wort „Rettung“ im Sinne Lessings gebraucht, der auch in Kirstens Landschaft gehört; er besuchte die Fürstenschule St. Afra in Meißen.) Amalie Dietrich war ein Armleutekind aus Siebenlehn. Ihren Namen wissen vielleicht noch einige Kenner der Geschichte der Tier- und Pflanzenkunde. Sie war eine Zubringerin der Wissenschaft, unterwegs zwischen Sachsen, Polen und Ungarn, zuletzt in Australien, jahrelang für einen Hungerlohn, meist zu Fuß mit Hund und Karren, auf sich gestellt, das Kind in Pflege gegeben, gestorben 1891. Kirstens Gedicht heißt „ruhm“:
das beutlermädchen aus der niederstadt ein wandelnder pflanzenatlas. im Zellwald den Nossener admiral gejagt, wallwurz und läusekraut präpariert. die liebe wird schnell verblättert. den mehlhändler nahm sie nicht, der ihr goldne pantoffeln versprach. lieber giftpflanzen und ackerkräuter bei wind und wetter gesammelt nach dem Linnéschen system, die sächsische flora komplett, dann bis Salzburg gelaufen, apollofalter zu suchen. fußmärsche bis an den Rhein und nach Polen.
exkursionen mit tragkorb und hundegespann, kreuz und quer durch den erdenschlamm. der wagen so schwer, die wege so schlecht. ihr lebtag träumte sie, es ginge bergauf ein landstörzerleben, verwittert und ausgefärbt, gesegnet mit dem privileg der armut, zwischen Siebenlehn und Rockhampton.
seeigel wollen sie nie getrocknet, sondern nur in spiritus konserviert senden. sie haben eine neue landschnecke gefunden, schrieb ihr der kaufherr Cäsar Godeffroy verbindlichst nach Australien. auch teile ich ihnen mit, daß zwei wespen nach ihnen benannt sind: Nortonia Amaliae Odynerus Dietrichianus.
Wir begegnen solchen Portätgedichten neuerdings bei manchem Lyriker. Hier hat sich offenbar ein eigener Gedichtstyp etabliert; das Muster scheint nicht allzu schwer zu reproduzieren, es gibt bereits eine gewisse Routine. Bei Wulf Kirsten, in diesen vor zwölf Jahren geschriebenen Versen, ist das Porträtgedicht in der heimatlichen Landschaft befestigt; die Arbeit des Benennens richtet sich als Erinnerungsarbeit auf ein historisches Material. Wie denn die Landschaft in seinen Gedichten überhaupt zugleich eine Geschichts- und Gedächtnislandschaft ist, in der sich Zeitschichten überlagern und durchbrechen. Die Tiefe der Zeit erscheint auf der Oberfläche der Erde bei Meißen. So in „schöne aussicht“, einem Gedicht aus dem Jahre 1969:
schöne aussicht übers elbknie von schloß B. durch den geöffneten garten zieht stimmengewirr. schmährufe. unhörbar: die niedriggehaltnen generationen, zusammengedreht, vom fleisch gefallen im Miltitzer ländchen. niegenannter ort, hügelbegrenzt, da steht noch ein altmodischer kornspeicher, der graswuchs ernährt seine herde (merino, vollzuchtstandard). eine trophäe: kam nicht zu pferd, zu pferd sicherlich, Novalis? schöne aussicht! hier – mein land, ich leg mich ins mittel, luftfurchen und wolkengang, mein lichtrecht, ununterbrochen.
Aber Gedicht und Gedächtnis, beschränken sich nicht auf diese eine Landschaft; beide haben, wie die Landschaft selbst, fließende Grenzen. Nie wird bei Kirsten die Nähe zur Enge; wo sie als solche erscheint, gibt er sie auch als Enge zu erkennen. Nicht das Gedicht ist eng, allenfalls das, wovon es spricht. Wo sein Blick auf Idyllisches fällt, etwa auf die Station einer überflüssig gewordenen Sekundärbahn – solche Nebenstrecken werden in der Bundesrepublik rigoros stillgelegt −, läßt er das Vorhandene sein wie es ist und gibt ihm mit gutmütiger Ironie das Recht, im Gedicht zu erscheinen. Es genügt ein Vergleich, ein „wie“ oder ein „als ob“, und der freundliche Anachronismus einer sächsisch-ländlichen Sekundärbahnhofsvorsteherexistenz scheint poetisch legitimiert. Das will gekonnt sein, der Grat zwischen Gutgemeint und Kunst ist hier ganz besonders schmal.
DER BAHNHOF
für Johannes Lindner
die bahn kraucht herauf über holprichte hänge. auf der geblümten lichtung dämmert der bahnhof im halbschlaf eine schlüsselstellung mit gartenfiguren und rassekaninchen. hühner im staubbad, gesperbert, gesprenkelt. das stumpf gleis verliert sich im dickicht. spriegel und striegel, tragkorb und hackstock: die langsam alternden dinge wie handschriftliche äußerungen des lebens. augenschein trügt nicht. schöne aussicht und pilze. die malmzähne der schrotsäge modulieren die sonnenrissige stille. niemand steigt aus, niemand steigt ein. der bahnhofsvorsteher, ein mensch unserer tage, gibt handzeichen, deckelt die dienstmütze ab, speicht sich ein und karrt mit lebensbejahender miene den leeren schiebbock zurück, als wären rad- und weltnabe eins.
Die Schlußverse dieses Gedichts scheinen mir besonders sicher gesetzt: der Mann, der sich ins Rad „speicht“, als wäre der Schiebbock die Welt; seine Miene, lebensbejahend wie die Gartenfiguren, die nebenan ihre Schlüsselstellung behaupten. Aber der Schiebbock, der hier die Welt vertritt, ist leer, und der Mühe Zweck ist kein anderer, als die Bewegung dieses Geräts, eines Mediums, das nichts enthält. Ich denke, hier kommt mehr zur Sprache als ländliche Reichsbahn-Idyllik – der ironische Gestus verbindet Gesagtes mit einigem Ungesagten, Stillgelegtes mit Sichbewegendem. Mir ist aufgefallen, daß in Kirstens Gedichten dynamische Momente häufiger vorkommen als statische; Bewegungsarten wie Wandern und Radfahren gehören sozusagen zum lyrischen Ich. Die meisten Gedichte sind Freiluftgedichte. Diese Bewegungsarten beschränken natürlich (im wörtlichen Sinn) den Erfahrungsradius, obwohl Kirsten dabei sehr viel weiter gelangt, mehr erfährt und mehr Welt sich aneignet als mancher Fernfahrer im grenzüberschreitenden Verkehr. Das Gedicht „wenig gereist“ deutet an, daß die Beschränkung auf die Erde bei Meißen jedenfalls nicht immer ein freiwilliges Indernähebleiben war. Das Gefühl der Einengung, ein Grundgefühl in „Dichters Land“, ist auch ihm nicht fremd. Ironisch spricht er vom beherzten Abschreiten eines Lehrpfades und von der Gewöhnung an das lokale Klima – ein vielleicht nicht nur meteorologisch gemeinter Begriff. Und der Hinweis auf die sowjetische Eisinsel Nowaja Semlja und die Moldawanka als Reiseziele „in reichweite“ sagt deutlich genug, daß geographisch nähere Reiseziele nicht in der gleichen Reichweite sind:
WENIG GEREIST
flußtälerkühl kommen die abendgerüche vors haus; von den hügellehnen fallen die jahreszeiten wie herzliche grüße aus der verwandtschaft, zuverlässigste chronologie. manchmal radtouren in die nähere Umgebung, dem landbriefträger fliegt eine distelwolke zu häupten. aufs maigras den apostelfuß setzen, beherzt-behende durch die nähere umgebung, den lehrpfad abschreiten, ans lokalklima gewöhnt. in reichweite Nowaja Semlja, die Moldawanka. zur person: wenig gereist.
Auch diesen Ton also gibt es in Kirstens Gedichten. Wichtiger ist aber etwas anderes, etwas das die Substanz jeder heutigen Naturlyrik betrifft – ein wirklich „neuer Aspekt“ der Natur- und Landschaftslyrik. Das Reden über die Natur und der Gebrauch von Naturvokabeln, die zum ältesten Bestand der Dichtung gehören, hat in den letzten beiden Jahrzehnten, und wohl für immer, eine neue Qualität angenommen – die Qualität der gefährdeten Natur als Umwelt. Sind wir etwa noch unbeirrt imstande, Natur als den uns vorgegebenen, der Menschengeschichte enthobenen, sie umgreifenden Raum zu erleben? Sie hat aufgehört oder ist doch rapid im Begriffe aufzuhören, uns jene lebenswichtige Erfahrung zu vermitteln, daß es etwas Beständigeres gibt als Kultur und Zivilisation: eine andere Zeitlichkeit, daneben und darüber, eine, in der die Vergänglichkeit eine andere Dauer hat, ein wenig näher an der Ewigkeit als unsere eigene. „Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume!“ heißt es in einem Gedicht bei Günter Eich, und: „Wie gut, daß sie am Sterben teilhaben.“ Diesen Versen eines Naturlyrikers von vor dreißig Jahren fallen unsere Erfahrungen und Ängste heute ins Wort. Wenn es noch nicht so ist, könnte es doch bald so weit sein, daß von den Dingen der Natur, vorab von den Bäumen, im Naturgedicht nur noch als von etwas gesprochen wird, das nicht mehr tröstend teilhat an unserem Sterben, weil es sein Sterben uns verdankt. Uns – einem kollektiven Subjekt, das jedem Einzelnen suggeriert, er sei schuld- und verantwortungslos. Daraus ergibt sich eine neue Qualität nicht nur der Natur- und Landschaftslyrik. In Kirstens Gedichten ist sie bereits da. Etwa in dem Gedicht die „straße“ die Verse:
auf astlosen baumrümpfen
die vegetierende vegetation
… zeitweilig auf erden stationierte
abgasfähnriche sättigen die luft mit blei.
Kirsten hat einen Gedichtband, der 1977 im Aufbau-Verlag erschien, der bleibaum genannt. Das Titelgedicht erinnert an seinem Ende, wenn es die Dichterin Sappho anruft, an bessere Zeiten der Naturlyrik, wo ein Gedicht über Bäume noch nicht ein Gedicht auch über ein kollektives Verbrechen an Bäumen sein mußte:
die kennworte im geriffelten granit mit verwitterungsfarben ausgestrichen. noch zu entziffern ist ein einziger satz, wie geschaffen, als zauberspruch in die wolle der schafe gemurmelt zu werden. das tintenfleckige abendgewölk begräbt eine gedachte landschaft aus schachtelsätzen. erbauungsstunden, die nichts vom geist der gesetze wissen, wenn die rauchsäulen des zementwerks füllen wieder busch und tal mit ruß und staub. o Sappho, wie der apfel sich rötet am obersten aste des bleibaums vorm haus.
Ich hatte im Auftrag der Jury eine Laudatio auf Wulf Kirsten zu halten und habe viel zitiert – aber die beste Laudatio auf einen Dichter sind doch wohl immer seine Gedichte. Ich möchte deshalb zum Ende noch einmal zitieren: ein Gedicht, das sich einer Reise nach Mähren verdankt und das ich für eines der bewegendsten und sprachschönsten halte, die Kirsten geschrieben hat. Es ist ein Landschaftsgedicht besonderer Art, denn von besonderer Art sind die Erinnerungszeichen, die jenem Stück Landschaft seinen Charakter geben: ein aufgelassener, ehemals geschändeter jüdischer Friedhof, nun zugewachsen und der Natur überlassen wie zum Vergessen. Und auf diesem Friedhof ein erinnerungsfähiger, erinnerungsfrommer Mensch, ein Deutscher. Er sagt während des ganzen Textes nicht ein einziges Mal ich; es geht hier nicht um ihn, es kommt darauf an, daß durch ihn Erinnerung geschieht. Er schwingt ein in ein Wir, das Tote und Lebende einschließt, das Fragen stellt und deren Antworten weiß. Die Sprache des Gedichts verbindet sich mit der Sprache der Psalmen. Das Bewußtsein historischen Leids, alte Messias-Hoffnung, Trauer und Sabbatfrieden sind in diesen Versen:
WÜSTGEFALLENER JÜDISCHER FRIEDHOF IN MÄHREN
wer auch sollt noch verharren vor den ausgedörrten steinen zur lichtzeit in andacht außer der erdrebe, der vogelwolke, die ein windstoß aufhebt und davonbläst wie spreu?
wo grab um grab überwuchs das schnellebige jahrhundert, findest du nicht tür mehr noch tor, bruchstücke von steinmetzarbeiten im gras, zerschmetterte vokabeln unter thuja und wilder kirsche.
das los ist uns gefallen aufs lieblichste. wohin rollte der in honig getauchte apfel? wer spricht den lichtsegen nach? alle nach euch wie vieh ausgetrieben und wohin? auf der triumphstraße der barbaren?
der säemann säet das wort in die verwölkten abendweiten, und seine wahrheit so weit die wolken gehen. komm, 0 komm, gestirnte messiaszeit! der wind säet unkraut.
neben dem grabstein Rosa Knöpflmachers stehn hochkant an eine zypresse gelehnt zwei sarg lange schiebböcke. im speichenkranz, bis zu den holmen hinauf rankt ein profanes grün. die abgüsse ortsabständiger stimmen: kürbisblütengelb.
der sabbat wird wie eine haut empfangen.
Die deutschsprachige Poesie ist nicht reich an Gedichten wie diesem, und zu wem sie sprechen, der wird sie als Geschenk empfinden. Ich denke an Peter Huchels Gedicht „Wiepersdorf“ und an Günter Eichs Verse auf dieselben Arnimschen Gräber in der Mark Brandenburg. Das soll kein Vergleich sein, aber ein Hinweis auf geistige Nähe und auf ein Gelingen von Poesie, das unseren Dank verdient.
Peter Horst Neumann, Laudatio auf Wulf Kirsten, 1987
Der große Hof des Gedächtnisses
Was liegt näher, als hier davon zu reden, was mir Peter Huchel, dessen Namen dieser Preis trägt, bedeutet. Ich will versuchen, mich dem Hof seines Gedächtnisses zu nähern. Noch immer, wie vor Jahrzehnten, als einem Sternbild, aus beträchtlicher Entfernung, die mehr als nur den dazwischenliegenden Raum einschließt. Eindringen werde ich gewiß nicht. Während ich den großen Hof umkreise, den Huchel sich aus dem Wort des Augustinus so lange zugeraunt hat, bis daraus der großväterliche Bauernhof in der Mark hervorging, muß ich, das heischt nicht nur der Respekt, draußen vor dem Hoftor bleiben und von mir reden wie auch von meinem Großvater, der sich auch nicht hinein getraut hat. Nahe dem Dorf Alt-Langerwisch, über den Ort Saarmund hinweg, im Waltherschen Forst, wie es in der preußischen Urkunde heißt, zur Gemeinde Nudow gehörig, ist mein Großvater, der außer Haus gesetzte Tischlergeselle Gustav Moritz Leberecht Kirsten an einem Wintertag des Jahres 1908 tot aufgefunden worden. Vermutlich ist er auf seiner Wanderschaft vor Übermüdung eingeschlafen und nächtens erfroren. Das geschah zu einer Zeit, da Peter Huchel nahebei in bäurisch-ländlicher Obhut aufwuchs, als er die Leute sah, die das Brot im Bettelsack trugen, ganz grau bis in die Rinde. Leicht zu denken, welche Bezüge sich damit auf meine Biographie aufstocken lassen, lese ich Huchels Gedichte, in denen von Menschen die Rede geht, unter denen leicht auch mein Großvater gewesen sein könnte. Ich will nur andeuten, woher die Grundierung kommt, für die, die ohne Stimme sind, wie Theodor Kramer gesagt hat. Ich verzichte jedoch auf eine Ableitung pränataler Einflüsse und lasse den Zufall lieber in seiner privaten Merkwürdigkeit auf sich beruhen. Aus Huchels Gedichten springt mich die eigene Kindheit an:
Hier lief ich barfuß einst als Kind
und trug den braunen Kaffeekrug
zur Vesper im Lupinenwind…
und:
Damals ging noch am Abend der Wind
Mit starken Schultern rüttelnd ums Haus.
Das Laub der Linde sprach mit dem Kind…
Selbst einzelne Vokabeln fungieren wie Stichworte zum Lebenslauf, die ganze Bilderketten assoziieren lassen: Gräseratem, Ackerschleife, Dreschtrommel, Brunnenkühle, Ahornfittich, Wetzsteingetön, Petroleumlicht. Mein Hof des Gedächtnisses befand sich, wie bescheiden auch immer dimensioniert, in einer ganz anders modellierten Landschaft, sie war aber mit nicht weniger faszinierendem Inventar ausgestattet wie die des Knaben Peter Huchel. Ich bin auf einem kleinen Rittergutsdorf seitab im Sächsischen, zwischen lehmigen Böden und granitnen Widerristen, auf den Elbhöhen zwischen Dresden und Meißen, geboren und aufgewachsen. Bis zum vierzehnten Lebensjahr habe ich den Dunstkreis des Dorfs, der sich vornehmlich aus Kuh- und Pferdeställen wölkte, kaum verlassen. Erst dem Dreiundzwanzigjährigen sollte es nach mancherlei schwerfälligen Ungeschicklichkeitsbeweisen gelingen, endgültig aus der zu eng gewordenen Herkunftslandschaft auszubrechen. Trotz der politischen Einbrüche und ideologischen Umpolungen, die spätestens den Zehnjährigen in der Pimpfuniform erreichten, hielten sich die durch die Jahrhunderte versteinten patriarchalischen Strukturen zählebig. Die Ochsenfuhrwerke bestimmten das Zeitmaß bis in die Kriegsjahre hinein. Diese auf Deputat und Felddiebstahl gegründete hierarchische Ordnung, die erst 1945 endgültig aus den Fugen geriet, als der Krieg in seiner chaotischen Endsiegphase das Dorf doch noch erreichte, gehört unbestreitbar zu den übermächtigen, zu den prägenden Erscheinungsformen meiner Dorfkindheit. Das alles, was ich damals und dort mit eigenen Augen gesehen habe und was mir die einzig mögliche Lebensform auf Erden zu sein schien, will die Zeitzeichen, die ich erst im Nachhinein historisch zu deuten wußte, nicht wegwischen. Ich hatte es nie darauf abgesehen, das rustikale Idyll einer Heilen-Weh-Parzelle zu zimmern und aus der Welt heraus zumauern. Ich habe das soziale Gefüge in meinen Gedichten nicht ausgespart und die Sympathien für meinesgleichen darin zu erkennen gegeben, es läuft so ziemlich alles auf Chronik und Lebensbericht hinaus. Was ich mit meinen Einblicken ins Landleben gewonnen hatte, ist mir erst reichlich spät, aus der Distanz des Außenstehenden, als Lebensgewinn und Reichtum aufgegangen. Der von frühester Kindheit an geübte, nicht immer freiwillig ausgeübte manuelle Umgang mit Äckern und Wiesen, mit Obstplänen und Druschplätzen, sollte sich am Ende als ein schier unerschöpflicher Erlebnis-Fundus erweisen, als der große Hof meines Gedächtnisses, um wieder mit Peter Huchel zu reden. Dazu gehört das gründliche Ausforschen von Feldscheunen und Heuböden, von Remisen und Stallungen, zu denen sich die juvenile Rotte Korah freien Zutritt anmaßte, als wäre das Dorf mit seinen sechzig Häusern und allem, was darum rainte und steinte, ihre Allmende. Die Dinge und die handgreiflichen Beziehungen zu ihnen ließen sich wie selbstverständlich benennen. Eine Welt voll weitergetragener Namen und Begriffe, aufgeschnappt von den Kutschern und Hofeweibern oder von deren Kindern. Wie sollte ich in meiner Einfältigkeit ahnen, welchen Wert diese Wortfelder einmal bekommen würden, daß daraus Gedichte hervorgehen sollten? Der erlebte und gelebte Wortschatz hat mich getragen wie das Wasser den Schwimmer, als ich nach mehr oder weniger absichtslosen Anläufen, darauf verfiel, die Kindheitslandschaft könnte auch für mich ein Thema sein. Peter Huchel, Erich Jansen und Johannes Bobrowski gaben die entscheidenden Impulse für die Beschränkung auf ein überschaubares Stück Welt, in dem ich mich genau auskannte, für das ich glaubwürdig einstehen konnte. Der Zufall muß es so gewollt haben, daß er mir auf meinem Dorf, auf dem Bücher im allgemeinen nicht eben zu den erstrebenswerten Gütern des Lebens zählten, einige Nummern der Schweriner Zeitschrift Heute und Morgen in die Hand spielte. Darunter das ziegelrote Heft vom Juli 1951, den bevorstehenden Weltfestspielen der Jugend in Berlin gewidmet. Chefredakteur Willi Bredel bringt darin eine kleine, von Peter Huchel selbst getroffene Auswahl von Gedichten: „Der Rückzug“, „Die Schattenchaussee“, „Heimkehr“, „Das Gesetz“. 0hne es wirklich genau zu wissen, nehme ich heute an, von diesem Lyriker dort zum ersten Mal gelesen zu haben. Seine Gedichte haben mich zuerst einmal stutzig gemacht. Ich merkte, da schreibt einer ganz anders als jene, von denen ich bislang gelesen hatte. Mir dämmerte, so also könne man auch Gedichte schreiben. Und ich merkte, Sprache kann etwas Schönes sein. Ich bekam zumindest eine dumpfe Ahnung von Poesie. Ob ich bei dieser Horizonterweiterung auf den Gedanken verfiel, mich selbst zu versuchen mit Gedichten, weiß ich nicht mehr zu sagen. Wohl kaum. Zu jener Zeit begnügte ich mich noch eine ganze Weile damit, Sprüche und Gedichte, die mir unterkamen und gefielen, in Oktavhefte zu schreiben. Darunter standen Namen wie Hebbel, Keller, Lenau, Storm, Liliencron. 1952 fand ich einen Gedichtband des von Bredel vorgestellten Peter Huchel, den er „als einen unserer bedeutendsten Lyriker“ apostrophiert hatte, in einem Verzeichnis lieferbarer Bücher angezeigt. Er gehört zum ersten Dutzend in meiner Bibliothek. Der spartanisch ausgestattete Pappband mit dem filzigen Holzpapier trägt die Nummer neun. Ich habe die Gedichte förmlich aufgesaugt. Wie aus den Romanen von Oskar Maria Graf, Das Leben meiner Mutter, Unruhe um einen Friedfertigen traten mir aus den melodischen Strophen, die ich wieder und wieder beglückt las, Abbilder meiner eigenen Welt entgegen. Meine Wertschätzung für Gedichte wußte ich in jener frühen Zeit der Entdeckungen am besten auszudrücken, indem ich sie auswendig lernte und sie so jederzeit vor mich hersagen konnte. Zu diesem Vorrat gehörten „Löwenzahn“, „Oktoberlicht“, „Ich sah des Krieges Ruhm“ … Später sollte ich mit Vorliebe den Bericht des Pfarrers vom Untergang seiner Gemeinde in mich hinein rezitieren. Ehe ich die thematischen Identifikationsmöglichkeiten genauer wahrnahm und die Landschaft als sozialen Begriff erfaßte wie Huchel, war ich vom Klang der Gedichte eingenommen und von der ungewöhnlichen Wort-Arbeit beeindruckt. Das tiefere Verständnis für die Kunstmittel, wie souverän und sorgfältig Huchel sie handhabte, wuchs erst allmählich, baute jedoch auf die naive Entdeckung auf: Wortbewußtsein als Lebensbewußtsein, Sprache als ein Ausdrucksmittel der Gesinnung und Gesittung, die Einheit von Sprache und Denken als moralisches Wertgefüge, was es mit der individuellen Kunstsprache auf sich hat, die George aus dem Ekel vor tradierten Mustern, vor einer Abnutzung bis zum bloßen Versatzstück eigenhändig neu gesetzt hatte. Niemand hatte mich auf Huchel verwiesen, und ich hatte ebensowenig jemand, dem ich meine große Entdeckung hätte mitteilen können. Huchel ist mir fortan nicht mehr abhanden gekommen, ich blieb auf seiner Spur. Er blinkte zuverlässig als Stern erster Ordnung am Himmel meiner poetischen Weltordnung, was immer auch an ablenkenden und bestärkenden Einflüssen hinzukam. Aus der dörflichen Eingezogenheit und Literaturferne schrieb ich einen verstiegen emphatischen Leserbrief an den Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form. Peter Huchel würdigte mein Elaborat einer freundlichen Antwort. Unter dem 18. April 1956 schrieb er:
Lieber Wulf Kirsten, es ist nun schon Monate her, daß Sie mir so freundliche Worte über meine Gedichte schrieben, und ich hätte Ihnen längst dafür gedankt, wenn meine Arbeit als Chefredakteur, der sich durch den Wust tagtäglich anfallender Redaktionspost graben muß, mir mehr Zeit zum privaten Korrespondieren ließe. Ganz besonders hat es mich gefreut, daß die Lektüre meiner Gedichte Sie zu einem intensiven Lyrikleser gemacht hat. Sie werden in der zeitgenössischen Lyrik gewiß vieles entdecken, das Sie bereichern und beglücken kann. Mit guten Wünschen und freundlichen Grüßen Ihr Peter Huchel.
Jahre später, als ich noch unsicher umhertappte, begann ich eines meiner Kindheitsgedichte ganz im Banne Huchels:
am kälberrohrhange lag ich
scheckenkühe malmten gras und kraut…
Inzwischen hatte ich mich von Freunden überreden lassen, doch noch zu studieren. Als ich 1957 nach Leipzig ging, um das Abitur nachzuholen an der dortigen Arbeiter-und Bauern-Fakultät, ahnte ich nicht, welches Lese-Abenteuer mir bevorstand. Einer der neuen Freunde wußte zu meinem Erstaunen von einer Bibliothek zu berichten, in der angeblich jedes Buch vorhanden sei. Ein unvorstellbarer Gedanke, von dem eine große Verlockung ausging. Der tumbe Tor betrat die heiligen Hallen. Ich hatte den so lange gesuchten Anschluß an die Literatur gefunden. Bei dieser Erkundung der Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts stieß ich wieder auf Peter Huchel, etwa in der Dresdner Zeitschrift Die Kolonne, diesem essentiellen Organ moderner Naturdichtung kurz vor 1933. Zu seinen Mitarbeitern zählten Günter Eich, Horst Lange, Elisabeth Langgässer, Eberhard Meckel, Martha Saalfeld, Georg von der Vring, Guido Zernatto. Oda Schäfer hat mir später von diesem Kreis berichtet. Mit Johannes Lindner habe ich über viele Jahre Briefe und Gedichte getauscht, die Freundschaft mit ihm, der eingezogen in Kärnten lebte und nach 1920 keinen Band mehr veröffentlichen ließ, hatte Michael Guttenbrunner gestiftet. Leider ist Die Kolonne noch nicht wieder zugänglich gemacht worden, und der Nachlaß des Herausgebers Martin Raschke harrt noch der Erschließung. Die Deutsche Bücherei wurde mir zur eigentlichen Universität, das heimliche Zweitstudium ließ sich auf Dauer mit dem offiziellen ersten kaum noch vereinbaren. Zu den denkwürdigsten, für meine literarische Entwicklung folgenreichsten Funden, die ich in den sieben Leipziger Buchjahren machte, zählt Rudolf Ibels Jahrbuch Das Gedicht. Einer dieser vier, fünf Bände bietet eine Anthologie in der Anthologie, für deren Zusammenstellung Peter Huchel zeichnet: Lyrik aus der DDR. Hier stieß ich auf einen neuen Namen. Da war wieder einer mit einer ganz eigenen, unverwechselbaren Stimme, die mich stutzen ließ und die sich im Ohr verfing. Wieder einer, der von seiner Kindheit als einem verlorenen Paradies schrieb:
Da hab ich
den Pirol geliebt.
Fortan stand Bobrowski nun als Leitbild neben Huchel. Ich fand ihn wieder in der von Ad den Bestens herausgegebenen Anthologie Auf der anderen Seite. Schließlich brachte er es mit Levins Mühle, seinem ersten Roman, fertig, mir die Zunge zu lösen. Er brachte mich auf die Idee, ein eigenes Programm zu entwickeln, in dem meine Herkunftslandschaft, das Miltitzer Ländchen, wie sie ehedem nach ihrem Besitzergeschlecht hieß, als geistiges Eigentum zu betrachten und von ihr in Form einer regelrechten Landnahme Besitz zu ergreifen. Die Lebensumstände – Scheitern im Beruf, Schock, Krankheit, Krise als eine Kettenreaktion – haben vermutlich kräftig mitgearbeitet, daß es über Nacht zu einem Neuansatz kam um die Jahreswende 1964/65. Das Gedicht „die erde bei Meißen“ sollte das Terrain sondieren und abstecken helfen. Darauf fußt, was danach entstanden ist. Im Herbst 1965 bin ich dann von Adolf Endler für die Literatur der DDR entdeckt worden. Die territoriale Eingrenzung nehme ich vor, weil es bereits während des Studiums ein weit weniger auffälliges Debüt gegeben hatte, das mir Arnfrid Astel verschaffte, indem er einige Gedichte von mir in seine hektographierte Zeitschrift Lyrische Hefte, zu deren Lesern ich gehörte, einrückte. Eine Mischung aus Brecht und George schien ihm meine Art zu schreiben, womit er die beiden Pole benannt hatte, zwischen denen ich mir die deutsche Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts vorstellte und erklärte. Welche Ermutigung von den persönlichen Begegnungen mit Johannes Bobrowski ausging in einer schwierigen Phase meines Lebens, habe ich bereits bei anderer Gelegenheit darzustellen versucht. Dort, wie auch in allen anderen Äußerungen, ist der Name Peter Huchel nicht ausgespart worden. Ohne seine Gedichte, ohne seine Person vermag ich mir meinen Weg nicht vorzustellen. Auch wenn es stimmt, daß er keine Schule gebildet hat wie Brecht, Maurer, Bobrowski und keinem geselligen Kreis vorstand wie Erich Arendt, dürfte die bislang noch nicht ausgeforschte Huchel-Rezeption in der DDR, zumindest was meine Generation angeht, doch weitverzweigter und vielfältiger sein als dies auf den ersten Blick wahrzunehmen ist. Ohne diesen Bezug genauer ergründet zu haben und nicht auf Vollständigkeit bedacht, fallen mir allein aus meiner Umgebung etliche Namen ein, für die Huchel gezählt hat und noch zählt: Sarah Kirsch, Heinz Czechowski, der sich in dem Materialienband von Axel Vieregg neben Walther Petri zu ihm bekannt hat, Uwe Grüning, Jürgen Rennert, Harald Gerlach, vielleicht auch Kito Lorenc. Auch Jüngere wären zu nennen: Richard Pietraß, Wilhelm Bartsch. Schon 1953 hatte Eduard Zak in seinem reichlich zeitverhafteten Huchel-Büchlein von der Unbestechlichkeit des Poeten geschrieben. Huchel hat bis zu seinem Tode für diese Charaktereigenschaft ein Beispiel gegeben. Wie kaum ein anderer hat er in seinen Gedichten dank einer frappierenden Sehschärfe und Bildauffassung vorgeführt, was es mit der Genauigkeit als einer entscheidenden Kategorie der Lyrik, wohl der Literatur generell, auf sich hat und welche Überzeugungskraft vom Detail ausgeht. Mit expressiver Kraft setzte er Metaphern, die abkürzen, raffen, bündeln und die Gedichte transparent machen und zum Schweben bringen. Wie Kunstsprache aus der Volkssprache zwingend hervorgehen kann, läßt sich bei ihm lernen. Von einer poetischen Genauigkeit ist die Rede, die sinnlich konkret bleibt und sich nichts von der erlebten Wahrheit abhandeln läßt. Seine strengen Maßstäbe, sein sicheres Gefühl für Qualität, seine Sensibilität beim Setzen von Worten zählen für mich zu den moralisch-ästhetischen Vorgaben, der sich die Lyriker, die sich ab 1960 mit einer neuen Denk- und Tonart an die Öffentlichkeit wagten, voller Achtung und Respekt bewußt waren. Huchel war bekannt für seinen Worternst, um ein Wort Hans Mayers aufzugreifen, das mir aus seinen Vorlesungen nachgelaufen ist. Leider ist es Mayer nicht gelungen, den mehrfach angekündigten Gast Peter Huchel zu einer Lesung im Hörsaal zu bewegen. So ist es bei dieser erwartungsvollen Fast-Begegnung geblieben. Und wie sollte dieser gründliche Spracharbeiter, dem die Poesie nicht nur ein Mittel zum Zweck war, dessen Leben und Werk eine Einheit von seltener Integrität bilden, nicht auch moralische Instanz gewesen sein. Die Anthologien jener Jahre, in denen er vertreten ist, sind öffentliche Bekundungen dieser anhaltenden, wenn nicht gestiegenen Wertschätzung, wie ephemer auch immer diese gesetzten Zeichen heute gewertet werden mögen. Ich denke vor allem an Karl Mickels und Adolf Endlers angefochtene Übersicht In diesem besseren Land von 1966, an thematische Sammlungen wie Zwischen Wäldern und Flüssen von Heinz Czechowski, 1965 erschienen, oder an Das Wort Mensch von Bernd Jentzsch, erschienen 1972. Für viele, vor allem jüngere Leser rückte Peter Huchel wider seinen Willen erst ins Bewußtsein, als er gezwungen wurde, als Chefredakteur von Sinn und Form zurückzutreten. Eben weil er unbeirrt an seinen Maßstäben festhielt, die einen weltoffenen Konnex einschlossen, und weil er sich nicht kompromittieren ließ, mußte er die Position, in der er für sein Land international so lange Ehre eingelegt hatte, preisgeben. Ihm ist großes Unrecht widerfahren, das die verflossene Zeit nicht abgewaschen hat. Ein irreparabler Schaden, weit über das persönliche Unglück hinaus, wie ich denke. Auch als es nicht opportun schien, seinen Namen ins Spiel zu bringen, ist er doch für einige, und für einige mehr als in früheren Jahren, während denen er eher zu den Stillen im Lande zählte, nicht wegzudenken gewesen, wie ich mit einigen Beispielen anzudeuten versucht habe, was freilich an den Lebensumständen nichts geändert hat und womit die erlittene Unbill nicht abgemindert werden soll.
Wulf Kirsten, Dankesrede, 1987
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1987
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß(Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Herausgebers
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Herausgebers:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


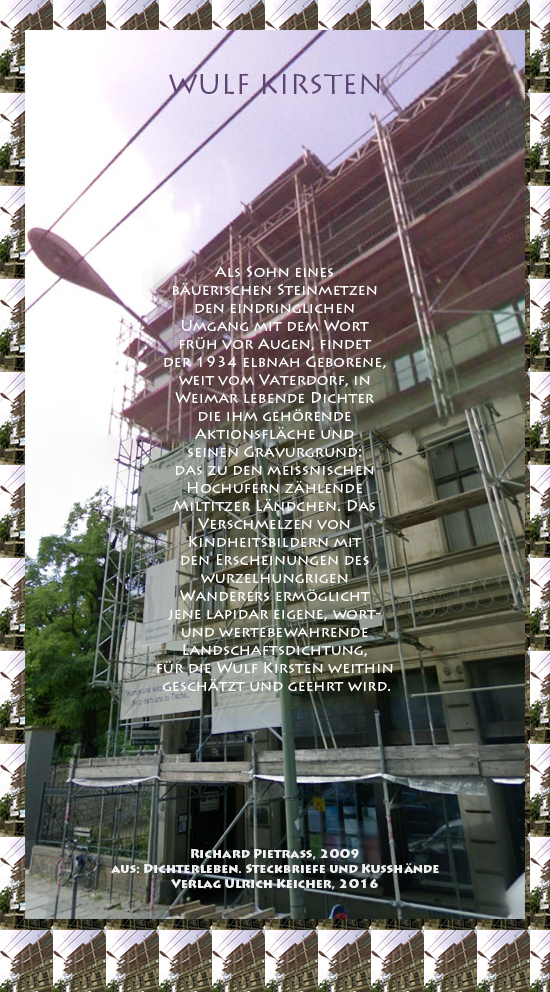












Schreibe einen Kommentar