Peter-Huchel-Preis 1988: Elke Erb
WO IST DIE ELLE?
Der echte untrügliche kriminalistische Spürsinn,
sieht er die Speiche, fragt:
Wo ist die Elle?
September 1982
ASSOZIATIONS-(UM-)FELD:
Die Welt als Blau. Intakt im Kopf.
Der Abend. Die Feier. Der echte. Zur Brust genommen.
Plussammlung: Besitztümer. Eigenschaften. Liegenschaften.
Angebotsform.
Vertreterkoffer: Das Gegenteil (ex-takt)
Durchschaut das fadenscheinige Gewebe
sofort Lügengespinst
Fuchs, der
meistert Kurzbein
Löchrige Situation Schema
Unterarm Kleinigkeit
Radspeiche spielend
Maß Nonsens
Delikt umsonst
Spektralanalyse Lord
Fettlebe. Hänsel. Wo ist das Maß?
Volksheiliger (Bimbam). Mit nichts
ist gesagt, daß er nicht betrügt.
Ihn meine ich, den da! Ja, sie!
Verkürzung. Letzten Endes:
Ein Gruß den Gegebenheiten.
Silberblick, Blinklicht.
Irrlicht, troll dich.
Die Frage „Wo ist das Maß?“
gilt auch dem Schreiben und dem Denken.
Wo bleibe ich, wenn sich meine Assoziationen (Benennungen)
von selbst einholen?
Halte ich sie auf, damit sie nicht zu Kurzschlüssen zerfallen?
Werden sie mich mir – nicht zurück, sondern – weitergeben?
Welches Spiel wird getrieben da, wo ein Entkommen (Auskommen?)
dem Zuschnappen der Falle gleicht?
Auf die Spitze getrieben. Mei Schnalle, mei Schuh!
Laudatio auf Elke Erb
Wir alle, und damit meine ich: die vielleicht wachsende, vielleicht schrumpfende, im gesamtgesellschaftlichen Maßstab jedoch allemal verschwindend kleine Schar derer, die aus beruflicher Pflicht oder gar Neigung (oder gar beidem) regelmäßig oder gelegentlich mit Poesie sich beschäftigen; wir, die wir trotz allem, was dagegen spricht, immer noch oder wieder Lyrik lesen – dagegen aber spricht nachgerade fast alles, was überhaupt öffentlich spricht: die geballte Gewalt des sprachzerstörten und sprachzerstörerischen Geschwätzes, das in den Fabriken der Kulturindustrie rund um die Uhr vom Meinungsmüll- und Wortschuttfließband produziert wird; wir alle, sage ich, die wir uns mit Gedichten herumschlagen, haben das Glück, in diesen Tagen einen Rat reicher zu sein. Die Schriftstellerin Ulla Hahn, die dank unbestreitbarem Talent zu hohen kunsthandwerklichen Standards genügenden Verseschmiedarbeiten, dank etikettesicherem Knicksen vorm auch poetisch restaurativen Zeitgeist und vor allem dank unermüdlichem, selbsttätigen Kuppeln des Frankfurter Schaltknüppels des westdeutschen Literaturbetriebs zur im Moment vielleicht meistgelesenen Lyrikerin der Bundesrepublik aufgestiegen worden ist, Ulla Hahn empfiehlt uns auf der letzten Seite ihres neuen Gedichtbands Unerhörte Nähe, Gedichte doch einfach so zu lesen, wie wir Äpfel essen: „Dem einen schmeckt es, und er ißt’s zufrieden. Der andere sucht zu ergründen, warum und woher der Geschmack kommt. Ein guter, schöner und wahrer Apfel hält dem genußvollen Biß des liebenden Lesers wie der Analyse des Kritikers stand.“
Wer, diesen Rat im Ohr, offenmäulig, in der Absicht, herzhaft hineinzubeißen, den Texten und Kommentaren des Buchs Kastanienallee sich nähert, für das die in diesem Jahr erstmals amtierende neue Jury Elke Erb aus der DDR mit dem Peter-Huchel-Preis 1988 auszuzeichnen sich entschlossen hat, der stellt schnell fest, daß ihn vor dieser Dichtung die zu schnellem, genuß- und speichelintensivem Verzehr einladende Pommesdites-Poetik Ulla Hahns schmählich im Stich läßt; ja, daß ihn, seinen Kulturgutschlingtrieb jäh blockierend, vor diesen Gebilden eine unwillkürliche Beißhemmung befällt. Das liegt zum einen daran, daß Elke Erb, anders als die urgesunde poetische Apfelbäckchen präsentierende Ulla Hahn, durchaus von Zweifeln angekränkelt ist, ob denn am Baum ihrer Dichtung, ja am Baum moderner Dichtung Überhaupt, Früchte noch reifen können (oder auch nur: sollten), die auf dem Markt, im Ästhetikwaren-Basar mit gutem Gewissen unterm Drei-auf-einen-Streich-Etikett des „Gutenschönenwahren“ sich anpreisen lassen. An einer zentralen Stelle des Buchs, die freilich, wie so viele andere Stellen, mehrdeutig, überdeterminiert ist, artikuliert Elke Erb als glückhafte Erfahrung die jenes Augenblicks, in dem sich ihr die Poesie „aus dem Schönen, Guten und Wahren“ (in Klammern heißt es erläuternd: „des Daseins als Text“) gerade emanzipiert. Zum anderen hängt die hemmende Wirkung, die von Elke Erbs Gedichten auf unsere ästhetische Beiß- und Freßlust ausgeht, vermutlich damit zusammen, daß diese Gedichte in sich selber, in ihrer Gestalt reflektieren, daß sie, wenn denn als Früchte, dann aber nur als bereits angebissene dürfen (auf)gelesen werden. In dem Gedicht „EIN SCHULDGEFÜHL“ wird dieser Befund im Hinblick auf die während Jahrhunderten von den Lyrikern angebissene Himmelsfrucht Mond nicht „ohne Umschweife“, sondern als emblematischer Um-Schweif, als aus den angebissenen Wörtern des Gedichttexts selber geformte Mondsichel (= angebissener Mond) ausgesprochen und sichtbar gemacht. Indem ich Ihnen diesen Text mündlich zitiere, muß ich zwangsläufig schummeln und Ihnen die zweite – flächige – Dimension schuldig bleiben: Behalten Sie also im Auge, daß dieses Gedicht ein Stück visueller Poesie ist, das schon durch diese seine äußere Form – und ganz im Sinne seines Inhalts – allen Versuchen erfolgreich Widerstand leistet, es in den Mund zu nehmen, es anzubeißen.
EIN SCHULDGEFÜHL
NUR WEIL DIE SCHULD
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAN DEN TAG TRITT
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMan
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahat de
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan Mond
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangebiss
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaen. Er h
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaängt am
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHimmel. V
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaielleicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasieht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaes
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaein
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaer. V
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaielleicht
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahalten sie ihn
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafür una
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangebissen –
DA IST
„EIN SCHULDGEFÜHL“ – das ist der Titel; „NUR WEIL DIE SCHULD AN DEN TAG TRITT“ – das ist der Buchstabenhimmel, an dem der Mond. hängt; „DA IST“ – das ist der schmale Boden, das Resultat, zu dem in siebzehn Kürzestzeilen die Textsichel übers Blatt sich herabkrümmt: denn wenn der Text sich realisiert hat, dann „IST“ die Schuld in der Tat an den Tag getreten, dann „IST“ sie „DA“, dann steht, nein hängt sie als angebissener, unanbeißbarer Mond aus Wortbrüchen auf dem Papier: „Man – hat de / n Mond / angebiss / en. Er h / ängt am / Himmel. V / ielleicht / sieht / es / k / ein / er. V / ielleicht / halten sie / ihn für una / ngebissen“ – wobei wir in denen, die den Mond vielleicht für unangebissen halten (obwohl doch jedes Kind „sieht“ und jeder kunstphilosophisch Aufgeklärte „weiß“, daß „man“ ihn angebissen hat), unschwer jene erkennen, die in schlechter Naivität die historische Deformation der pomoiden Gegenstände und Ausdruckformen der Literatur im Allgemeinen und der Lyrik im Besonderen nicht wahrhaben wollen. Als optisches Wahrzeichen aber des Sachverhalts, daß der angebissene Mond zwar wie das Naturphänomen erscheint, dem er nachgebildet wurde, tatsächlich aber ein Phänomen geschichtlich-gesellschaftlich vermittelter zweiter Natur ist, ist dem Gedicht „EIN SCHULDGEFÜHL“ neben dem ersten Biß, der den Mond zur Sichel reduziert, ein zweiter, in der Natur nicht vorgebildeter eingeschrieben, der die Sichel von hinten angreift und an ihrem schwächsten Punkt, dort wo sie nur ein kleines k dick ist – „sieht / es / k / ein / er“ – fast, nur fast, durchbeißt.
Daß eine kindliche Wahrnehmungsweise und Wunschmomente hegerisch-hegelisch aufhebende Grundeinstellung zur Welt und eine avancierteste poetische Reflexions- und Aktionsformen erprobende künstlerische Intellektualität untergründig zusammenwirken; daß der poetischen Aktion aus noch nicht verschütteten Quellen kindlicher Rezeptivität ebenso Kraft zufließt, wie ihr andererseits strengste, disziplinierteste Reflexivität zuarbeitet – das ist ein durchgehender Zug im lyrischen Werk Elke Erbs. Nur dürfen wir uns dieses Zusammenwirken nicht als ein friedliches, gar harmonisches vorstellen. Eher nimmt es die Form des – nicht selten gewaltsamen – Konflikts an. Dessen Ursprung läßt sich zurückverfolgen in Elke Erbs Biographie. In einem Gespräch mit Christa Wolf, das in Elke Erbs zweitem Buch Der Faden der Geduld abgedruckt ist, gibt die Autorin unter anderem Auskunft über Herkunft und Werdegang: „Um mich zu kennen und zu verstehen, ist es vielleicht wichtig, daß ich dir sage, ich bin, bis ich elf war, auf dem Land aufgewachsen, in der Eifel, und zwar ohne Verwandte. Drei Kinder, die Mutter. Der Vater war im Krieg. Gegenüber drei Bauernhäuser, ganz andere Leute. Ich habe sehr viel Bildung, sehr viel Erfahrung nicht mitbekommen, die der städtische Bürger hat, der mit den Mitbürgern aufwächst und in der Verwandtenclique. Heckenrosen können das niemals ersetzen. – Mit zwölf Jahren kam ich hierher, nach Halle, in die Schule. Da war die Hauptsache die logische Ausbildung in den Naturwissenschaften. Ich war für diese Erziehung ein dankbares Objekt, frei von dem Widerstand einer sinnlichen Begabung (zur Malerei, zur Musik).“
Das plötzliche Herausreißen des jungen Mädchens aus der Landschaft seiner Kindheit, aus Landschaft und Kindheit, aus der eigenen inneren und äußeren Natur (die Elke Erb später gleichwohl nie regressiv idealisiert hat: sie verdankt aber vielleicht der kargen Landschaft der Eifel ihren Begriff einer zurückhaltenden, unidyllischen, strengen Natur); das Hereinreißen des Kinds in die fast lückenlos durchorganisierte Welt von Stadt, Schule, Stundenplan, Logik, Rationalität kann bei aller späteren Bereitschaft der Heranwachsenden, was als Unterwerfung begann, heroisch zur eigenen Sache umzuerklären, zunächst nur ein traumatischer Schock gewesen sein. Die Gegenreaktion, die er auslöst, enthält in nuce bereits das Aktionsprogramm von Elke Erbs Poesie. In ihrem ersten Buch Gutachten erinnert sie sich an die gedanklichen Manöver, mit denen sie damals zum Gegenangriff antrat. „Ich versuchte“, heißt es da in dem kurzen Prosastück „Gezänk, die steinerne Öde zu überwinden, grübelnd Zündschnüre, Sprengladungen anzusetzen an diesen Koloß der Notwendigkeiten, dem wir uns gegenübersahen, der sich in einen Zaubergarten der Erfüllung auftun, ja verwandeln mußte und der nur so lange stehenblieb, bis man ihn zu Ende durchgrübelt und das Lösungswort gefunden hatte.“ Versuche, den steinernen Koloß, der für alle versteinerten Verhältnisse, für alle privaten und gesellschaftlichen Zwänge, für jedweden Stillstand steht, mit Wörtern in die Luft zu jagen Lyrik als Sprengversuch, als subversive Aktion. Versuche, den Fels von Entfremdung und Verdinglichung mit im Spannungsfeld von Gedanke und Bild, von Abstraktion und Assoziation sich vorwärtsgrabenden Wörtern kleinzugrübeln, zu erodieren – Lyrik als unablässige Arbeit und Anstrengung der Reflexion. Versuche, das Lösungswort, das Zauberwort zu finden, das man nur aussprechen müßte und schon wäre der Alb – womöglich doch gewaltfrei, wie im Märchen, wie von allein – in einen Garten verwandelt – Lyrik als die Kinderutopie von der Wirksamkeit der Wünsche in sich bergende Magie. Drei unvereinbare Impulse vielleicht. Aber vielleicht entstehen große Werke, solche, die Widersprüche nicht wegreden, sondern erscheinen lassen, in actu zeigen, Überhaupt nur dort, wo Unvereinbares sich trifft.
Der dritte oder eher: erste, aus der ältesten, untersten Schicht stammende dieser Impulse, der kindlich-magische, hat sich in der Prosa-Miniatur Trost unverstellt Ausdruck verschafft. Sie hat dem Auswahlband mit Texten von Elke Erb den Titel gegeben, den Sarah Kirsch 1982 zusammengestellt hat, und sie findet sich auch in Elke Erbs drittem in der DDR erschienenen Buch Vexierbild: „Als das Kind, die Ellenbogen stemmt es auf den Tisch, vor seine Augen wirft es sich die Fäuste, heftig aufweint, spricht von fern die Puppe: ‚Weine nicht, ich bin nicht weg, ich liege auf dem Waldweg. Wo die Bank steht oben vor dem wilden Apfelbaum, an dessen Wurzeln du hinaufsteigst immer auf dem Weg nach Neukirch, lieg ich unten, und meine blauen Augen starren in den Himmel.‘ Lautlos spricht die Puppe, zeigt sich. Das Kind hört gleich zu weinen auf und holt sie.“
So müßte es sein, nicht wahr, im Leben, und so ist es manchmal, wenn sie Glück hat, in der Lyrik: daß wir nicht suchen müssen, sondern gleich finden; daß das Verlorene von allein sich zurückmeldet, selber zu sprechen anfängt und uns den Weg weist. Das gleiche Motiv einer märchenhaft-automatischen, in Freudschen terms: primärprozessual-traumhaften Wunscherfüllung findet sich, und damit kehren wir in unsere Kastanienallee zurück, in dem Gedicht „REKAPITULATION oder ICH ZÄHLE BIS 3“. Das Gedicht steht gleich hinter dem Mond, dem angebissenen, und es gibt dem Motiv eine fast unmerkliche, unheimliche Schärfe, indem es ein nicht ganz geheures Messer ins Spiel bringt.
REKAPITULATION oder ICH ZÄHLE BIS 3
1
Sieben Töchter zwischen den Kriegen:
Habt ihr keine Strümpfe zu stopfen
fragte mein Vater
immer wenn wir Karten spielten
oder lasen
2
Seit eh und je ja steht
das Klavier vor der Wand,
eine Streckbank
NIMMERSTIRB seine Stirn,
nimmersatt sein Gebiß,
dem nichts je hilft,
sich zu runden.
3
Meine besten alten Filme waren:
Da kommt Brot von allein auf den Tisch.
Da kommt Wurst von allein auf den Tisch.
Und ein Messer kommt
und zerschneidet das alles.
„Ich zähle bis 3“ – sprechen wir’s aus: Dieses Gedicht springt, spielt den dialektischen Dreischritt nach, auf dem thematischen Feld „Leben und Kunst“. Strophe 1 (These): das Reich der Notwendigkeit, in dem Krieg, Mangel und der Zwang zur materiellen Selbsterhaltung herrschen. Kartenspielen oder Lesen erscheinen hier nicht als produktiver Widerspruch, sondern als unverantwortliche, unnütze, kindische Tätigkeit: inane Äußerungsformen fauler Existenz. Strophe 2 (Antithese): das Reich der Kunst, das dem Reich der Notwendigkeit, dem Leben gegenüber in starrer Selbständigkeit sich etabliert hat und, weit entfernt davon, erlösen zu können, vielmehr aus seiner schlechten Unendlichkeit selbst der Erlösung bedürfte. Strophe 3 (Synthese und zugleich deren Selbstaufhebung ad absurdum): das Film-, Traum-, Märchenreich, in dem die Bedürfnisse des wirklichen Lebens mit den Mitteln einer anderen, nicht mehr in sich selber abgeschlossenen Kunst befriedigt werden – oder befriedigt würden, wenn jenes Messer, das da kommt, nicht ein böses Bißchen mehr täte, als Brot und Wurst mundfertig zu machen: Es „zerschneidet das alles“; der zum bloß vermeintlich freundlichen Märchensubjekt beförderte Gebrauchsgegenstand verselbständigt sich wieder (wie das Klavier); der Wunscherfül1er entpuppt sich als Alleszerstörer; auch das Messer ist statt ein Hilfsmittel, um Sattheit herzustellen, ein nimmersatter Automat, dem „nichts je hilft“ innezuhalten.
Bleiben wir noch einen Augenblick bei dieser zweiten Strophe. Sie führt ins lebendige Zentrum von Elke Erbs Buch. Daß die Tastatur des Klaviers an Zahnreihen erinnert, ist, kindliche Perzeptionsfähigkeit vorausgesetzt, so selbstverständlich, wie daß der Mond angebissen ist. (Im übrigen wird dem Elefanten der Stoff für die Tasten ja höchst real aus dem Maul gerissen.) Die Klaviatur ist ein Gebiß, aber eins, dem die organische Rundung ausgetrieben wurde, ein gestrecktes, in die tote Gerade gezwungenes Gebiß, das so in keinen lebendigen Mund mehr paßt. Deshalb klingt es, wenn Klavier gespielt, wenn Kunst gemacht wird, nicht „wie wenn da ein Mensch spricht“. Was gestreckt wurde, taugt selber nur zum Strecken, zur „Streckbank“, denn, wie es in dem Gedicht „GROBE FÄNGE“ heißt: „Immer derselbe Mechanismus / erbricht / immer den gleichen / Mechanismus.“
„Daß, wenn ein Mensch spricht, / es nicht so ist, / wie wenn da ein Mensch spricht“: das ist eine präzise Definition des kommunikationsverweigernden, ganz in sich selber sich verschließenden, hermetischen Gedichts – und seines Unrechts. Manche, durchaus nicht alle Gedichte von Elke Erb sind hermetisch; daß sie unverständlich sei, wird gerade dieser Autorin immer wieder (und zunehmend) vorgeworfen. Aber wenn Elke Erb hermetisch ist, dann ist das alles andere als ein selbstzufrieden auf die fensterlose Schulter sich klopfender Hermetismus, der etwa sanft auf dem Kissen seines guten Gewissens ruhte. Es ist vielmehr ein gegen sich den Prozeß anstrengender Hermetismus, der Öffnung einklagt und dessen Parole nicht Selbstperpetuierung auf „NIMMERSTIRB“, sondern Selbstaufhebung, Selbstentgradigung, Wiederrundwerdung ist.
In diesem Zusammenhang einer Selbstkritik des Hermetismus müssen wir den außerordentlichen Versuch sehen, den Elke Erb in ihrer Kastanienallee unternommen hat: den Versuch, einen ganzen Lyrikband hindurch ihre Texte selber zu kommentieren. Das ist nun in der Tat einmal „ein besonders bemerkenswerter Beitrag zur Entwicklung der deutschsprachigen Lyrik“, wie ihn die Jury des Peter- Huchel-Preises ja jährlich auszuzeichnen gehalten ist. Denn diese Kommentare sind durchaus nicht den Texten womöglich in pädagogischer Absicht beigegebene, etwa zum Ausräumen von Verständnisschwierigkeiten bestimmte Lese- und Entschlüsselungshilfen für die selbständige Lese- und Entschlüsselungsarbeit scheuende Leser. Die Kommentare vereinfachen die Lektüre von Elke Erbs Lyrik nicht.
Durch sie ist deren Gehalt nicht wohlfeiler zu haben. Ich gestehe gern, daß es Gedichte gibt, die mir durch den Kommentar der Autorin erst wieder unverständlich – vorläufig unverständlich, sage ich unbeirrt zuversichtlich – geworden sind.
Elke Erb schwebt vor, in ihren Kommentaren den „Denkprozeß zu erfassen, dessen Ausdruck das Reden und Schweigen der Texte ist“. Der Kommentar setzt die Arbeit am Gedicht fort, erweitert es über seine Grenzen hinaus. Das Produkt wird rückübersetzt in den Prozeß, dem es seine Entstehung verdankt. Die in ihrem Resultat verschwundene vermittelnde Bewegung wird wieder sichtbar gemacht.
Nicht mehr der ausschließliche Text, allein auf weißer Wüste,
aaaaaaaaaasein autistisch behinderter Alleinvertretungsanspruch,
aaaaaaaaaaumgeben von Unaussprechlichem
aaaaa: das Haus steht nicht im Himmel
aaaaaadas Haus steht auf seinem Grund.
Nicht mehr die vom Himmel herabgrüßende Zinnen- oder Zahn-
lücken-Reihe!
Nicht mehr, dürfen wir assoziieren, das gestreckte Gebiß der Klaviatur, „sondern, seinem Wort (…) wiedergegeben“, der runde Mund selber, der spricht.
Das ist die eine Seite der Sache; sie betrifft das Gedicht. Die Kommentare haben aber auch einen anderen Aspekt, der den Autor selber, Pardon: die Autorin ins Spiel bringt. Lassen Sie mich, um diesen Aspekt zu beleuchten, das Titel- und Einleitungsgedicht unseres Buchs zitieren:
KASTANIENALLEE, bewohnt
Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags
um halb fünf roch es flüchtig
nach toten, s e l b s t v e r g e s s e n e n Mäusen.
Die Irritation, die dieses – am 1. Januar 1981 notierte – kurze Gedicht auslöst, geht von dem einen Wort „selbstvergessenen“ aus. Es ist die Stelle, an der Subjekt und Objekt, Außen- und Innenwelt einander berühren, spiegeln, die Plätze tauschen. Das Gedicht, erfahren wir aus dem Kommentar, entsteht in dem lebensgeschichtlichen Augenblick, in dem die Autorin, die ihr letztes Buch gerade abgeschlossen hat, eine Erfahrung der Ich-Flucht, der Depersonalisation macht, die ihr an diesem Neujahrsnachmittag in diesem Treppenhaus mit diesem flüchtigen Geruch nach toten Mäusen plötzlich von außen ins Bewußtsein schießt. Das sind die Schocks, von denen der Lyriker lebt. Für Elke Erb aber, für die – ich kenne keinen anderen Lyriker, keine andere Lyrikerin, für die das in irgend vergleichbarem Maße zutrifft – jedes Gedicht, das sie geschrieben hat, zum ästhetisch-moralischen Imperativ im Sinne von Rilkes „Du mußt dein Leben ändern“ wird, für Elke Erb ist es bezeichnend, daß gerade dieses Kurzprotokoll einer Sturzflucht durch die Selbstvergessenheit zur Keimzelle einer Gegenbewegung, der Idee nämlich wird, im neuen Buch „die Sache selbst in die Hand zu nehmen“, bei den Texten „selbst gegenwärtig“ zu sein – in den Kommentaren, die bestimmt sind, „dem Band, dem zum Buch die Vollendung (Abrundung / Einheit) fehlt, beizustehen“.
Nichts Geringeres nimmt Elke Erb in diesen Kommentaren sich vor, als in all den „heterogenen, divergierenden“ Texten, wie sie selber sie nennt, das Schreib-Ich, das in ihnen, dem Lebens-Ich davonlaufend, vorauslaufend sich vergegenständlicht hat, einzuholen und mit dem Lebens-Ich wieder zu vereinigen. Nicht als Zwangszusammenschluß notabene ist diese Wiedervereinigung vorzustellen; nicht so, als sollte das Entflohene, Entsprungene wieder eingefangen, zurückgeholt, hinter den sicheren Mauern der Person neuerlich in Gewahrsam genommen, das heißt auf gut-deutsch-bürgerliche Art abermals eingesperrt werden. Sondern diese Mauern selber, die Grenzen des Ichs, sollen verrückt, erweitert, so weit vorgeschoben werden, daß das aus den Gedichten mit fremd glänzenden Augen das Lebens-Ich anschauende Schreib-Ich darin sich selber als ohne Zwang Aufgehobenes, bei sich Angekommenes wiedererkennen kann. Eine Bewegung ist das, die ohne tief verstörende Unruhe gar nicht gedacht werden kann: „Wahr ist, daß ich schon, wenn ich die zeitlich ja auseinanderliegenden Texte zusammenrücken sehe, in Furcht geraten kann, das Ich dieser Texte zu sein. Und doch hält sie, von der aus der eigenen Sprache ihr zuströmenden und in die eigene Sprache zurückfließenden Idee beseelt, die Reihe der Texte (…) als Teile eines Ichs zu sehen, an dem zutiefst aufklärerischen und selbstaufklärerischen Projekt fest, die Schizogrammatik des Sichselberfremdwerdens im Schreiben nicht als die ultima ratio des ästhetischen Prozesses anzuerkennen, sondern noch die Abspaltungen, in denen sie Sprachgestalt annimmt, sich mit dem – oft schönen – Schein der Notwendigkeit realisiert, praktisch-kritisch, schreibend, einzuholen und rückgängig oder – viel, viel besser – vor-gängig zu machen. Eine Schlüsselerfahrung in diesem Prozeß ist, daß die Autorin dabei, wie es in dem Kommentar zu „EIN STUNDENPLAN KOMMT SELTEN ALLEIN“, heißt, „das Ich nicht vorauszusetzen (…) sondern Ort für Ort zu erkunden“ hat: Die Gedichte von Elke Erb und das Ich, dessen – das Ganze erst produzierende – Teile diese Gedichte sind, operieren mit keinem anderen Schutz als dem des Schritt für Schritt landgreifenden sprachlichen Weges.
Hier, jetzt, nachdem es uns – vielleicht – gelungen ist, ein paar Voraussetzungen von Elke Erbs lyrischer Arbeit ein wenig zu erhellen, könnte, müßte das „genaue“ Loben dieser Arbeit, das Loben en détail, am Text, draußen auf dem sprachlichen Feld, das sie nicht usurpatorisch, nicht kolonisatorisch bestellt, sich angeeignet, für uns fruchtbar gemacht hat, recht eigentlich erst beginnen. Wir müßten Elke Erb auf dieses weite Feld folgen, ihr nachgehen in ihre „offenen“ und „geschlossenen“ Gedichte hinein. Wir müßten ihre „Prozeßgedichte“ rühmen, die, die Denk- und Ausdrucksbarrieren wegräumend, durch die der Lauf des linearen Schreibens reglementiert ist, die ganze Fläche der Buchseite sich erobern. Wir müßten ihre Sprünge preisen: Jubel-Sprünge aus dem Bedeutenden heraus, wie in dem „Nichts auf Nichts“ setzenden, „froh-lockend: auf Nichts“ setzenden Gedicht „SIE HAT BRAUNE AUGEN“ – und Schmerzens-Sprünge in das Bedeutende zurück – wie in dem Gedicht „WALDRAND“, das mit unwiderstehlicher, sanfter Gewalt, die jeder versöhnlichen Enträtselung auf den Tod traurig zu spotten scheint, „auf dem erstickten Hals“ uns hockt, als wollte in diesen vierzehn Zeilen das nie abzugeltende Grauen, das über die Natur gekommen ist, laut und stumm werden zugleich:
WALDRAND
Das Reh trug davon die Lücke der linken
Schulter unter dem Waldrand.
Wo hing sie künftig? im blauen
Gips. Über das Gelände hin ereilte
aber was das Auge des gelüfteten
Flaschendeckels, Unschuld, hockend
auf dem erstickten Hals?
Fledermausbälle
Leichter Sitz. Da lagen die Steine jetzt
rosa von angenommener Dauer.
Solange die Ziege die Disteln frißt,
zieht das Reh rechtsschultrig weiter quer
die Flanke des entlassenen, herausgeschnittenen Bachs
im Osten der Inneren Mission eines Topfgrunds durch.
Wer solche Verse schreibt, darf sich nicht wundern, wenn ihm eines schönen Morgens am Telefon gesagt wird, daß er den Peter-Huchel-Preis bekommt. Ich danke Ihnen, liebe Elke Erb, im Namen der Jury für Ihre Gedichte und Ihnen, verehrte Damen und Herren, für Ihre Geduld.
Urs Allemann, Laudatio auf Elke Erb, 1988
Mit zwei Gesichtern / und einer Feder
In Peter Huchels 1933 nicht veröffentlichter Gedichtsammlung Der Knabenteich lese ich:
Und an Strick und Balken
sauer hüpft die Angst,
hängt dein Herz am Galgen,
bis du stumm verbangst.
Die Welt ist nicht das, was wir meinen, wenn wir sagen „ein Heim“. Die Außenwelt nicht, die Innenwelt nicht. Von innen her reden wir von dem Außen. Klagen wir es an? Nein, wir berufen uns auf es. Sprechen ist veröffentlichen. Wir rufen das Außen zum Zeugen auf, so wie die Außenwelt uns, die in ihr Aufkeimenden, zum Zeugen gerufen hat, wie sie uns rief und rief, uns aufrief zur Mündigkeit. Haben wir uns nicht ein Denkmal dieses Rufens geschaffen, als wir die uns immer flehend entgegengestreckten Arme ans Kreuz nagelten, wie wenn wir ihrer gewiß wären und davongehen könnten?
Veröffentlichen will ich hier mein letztes Gedicht:
MUTTER UND KIND
Aus Schutt und Asche, pyramidal
der Turm, ich weiß ihn gipfeln.
Niemand aber, der mich erblickt,
obwohl der Kosmos, die Kuppel,
Auge an Auge von tausenden
reglosen Blicken glänzt.
Das ist wohl mein Kopf?
das ist wohl unleugbar mein von mir
mir unter die Arme errichteter
eigener Turm?
Ein Turm bin ich: vor dem Kind!
Wenigstens hat das Kind seine Mutter.
Wenigstens sprach zu ihm. Wenigstens wendete
sich an es. Wenigstens hagelte
Schimpfreden, vergebliche.
Wenigstens konnte es elend werden.
Ganz unfähig. Wenigstens auffahren.
Wenigstens Mauerwerk. Aufs neue.
Wenigstens wettern.
Legt sich nicht die Aufzeichnung
das süße Zügeldreieck eines Meineids
auf den Sinn an?
Ich habe Peter Huchel nur einmal gesehen, 1968, zu Erich Arendts fünfundsechzigstem Geburtstag. Ich versuche mich daran zu erinnern, warum ich ihn nicht in Wilhelmshorst besucht habe. Ich wußte von einem, der ihn oft auf dem Motorrad und mit vielen selbstverfaßten Gedichten besuchte. Ich kannte den nicht, aber ich dachte: Das gehört sich nicht. Mir war nicht bewußt, daß Huchel über Isolation klagte. Und selbst dann, wenn es mir bewußt gewesen wäre: Hätte ich sie lindern können? Wer war ich denn? Ich stellte mir auch nicht vor, wie es wäre, wenn zu SINN UND FORM zu gehen, bedeutet hätte, zu Peter Huchel zu gehen. Es überwog, daß es ihn gab. Und daß es ihn gab, schwieg – für mich. Es war so etwas wie ein Unterpfand. Eine unfreiwillig heimliche Gewähr für den Grund des Schreibens. Und nicht ein in die von Peter Huchel berufene Natur projiziertes Heil gab mir die Gewähr, sondern sie lag in der Stimme, die sagte:
… nur vom Sprung der Fische laut… oder Oktober und die letzte Honigbirne…
Einmal, von Halle aus, in der Wohnung meiner Schüler- und Studentenjahre, halluzinierte ich mir, ich ginge zu ihm. Jemand dort käme an ein Gartentor, er – und dann? Welch ein Wunder hätten alle guten Geister an den Tag bringen müssen, daß die Verständigung hätte laut und zu Worten werden können? Seine Stimme traf in meine Stille. Meine Stimme war nicht meine Stille. Meine unmündige Stimme hatte keinen Ton, um mit jener zu reden, die sagen konnte:
Hinter den ergrauten Schleusen,
nur vom Sprung der Fische laut…
Ich wußte nicht – und weiß es beim Schreiben auch heute nicht – daß die Seele, wenn sie in der Innen- und Außenwelt zu bilden beginnt, sich das Gesetz gibt, für beide zu reifen. In unserem von Vernichtung geprägten und mit Vernichtung drohenden europäischen Jahrhundert ist Peter Huchels Gedichtwerk – und so habe ich es in den letzten Wochen gelesen −, ein ergreifendes Zeugnis für die Treue zu diesem Gesetz.
UNTER DER BLANKEN HACKE DES MONDS
werde ich sterben,
ohne das Alphabet der Blitze
gelernt zu haben.
Im Wasserzeichen der Nacht,
die Kindheit der Mythen,
nicht zu entziffern.
Unwissend
stürz’ ich hinab,
zu den Knochen der Füchse geworfen.
Reifen ist mehr als Heilen. Heilen ließe der Dichtung nur ein Gesicht, das psychologische, das caritative; es ließe die Wunde nicht leben. Ich habe kein besseres Wort. Der aus dem Gedicht „HAVELNACHT“ zitierte Vers: „nur vom Sprung der Fische laut“ verbirgt unter der kernreifen Mündigkeit seiner Stimme ein Zeichen für das Wirken des Gesetzes; nackter, stimmloser tritt das Zeichen in einem anderen Vers aus dem Gedicht „OKTOBERLICHT“ hervor: der Garten, nur von ihrem Pflücken windig. Ich werde erinnert an Friedrich Hebbels fernes „HERBSTBILD“:
o stört sie nicht, die Feier der Natur!
aaaaaDieß ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute lös’t sich von den Zweigen nur,
aaaaaWas vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
„Stört sie nicht“, unser Alphabet – sagt Peter Huchel – „reicht nicht aus / Antwort zu geben / der wehrlosen Schrift“. Peter Huchel:
DIE WASSERAMSEL
Könnte ich stürzen
heller hinab
ins fließende Dunkel
um mir ein Wort zu fischen,
wie diese Wasseramsel
durch Erlenzweige,
die ihre Nahrung
vom steinigen Grund des Flusses holt.
Goldwäscher, Fischer,
stellt eure Geräte fort.
Der scheue Vogel
will seine Arbeit lautlos verrichten.
Ein Zeugnis aus meiner, ungetauften, eigenen Generation ist Karl Mickels
LINDENFORUM
Gelbes Laub, den Zweigen nicht verhaftet
In höchster Höhe schwebt an Ast und Ästlein
So gesättigt ist die Luft mit Regen
Die Luft so stille, daß der Linden Leiber
Leisen Wortes Hauch, Gedankens Atem
Entkleidete. Ich wage nicht zu denken
Übersetze ich das Wort „ungestört“ in das Wort „unbekümmert“, lese ich auch Huchels letztes Gedicht in seinem letzten Band DIE NEUNTE STUNDE noch in dem gleichen Sinn:
Jahreszeiten, Mißgeschicke, Nekrologe −
unbekümmert geht der Fremde davon.
Hat er nicht selbst Resignation in dieses Wort übersetzt? Und blickt nicht „Eine Haselnuß im Geröll“ dem Entbundenen „mit weißem Auge nach“?
Verwandt – und erst in der Verwandtschaft entgegengesetzt – ist dem entbindenden Zeichen des Reifens ein anderes, eines, das das Leben bindet, nährend bindet – an das Minimum, an das kleinste, an seinem Rande aufgesuchte und dort die Seele bewegende Maß. Im Namen des Urteils spricht es die Seele frei von dem Maß des Vorurteils. Ich erkannte es wieder in Peter Huchels Gedicht „KINDER IM HERBST“, dem wohl entspanntesten seiner Erinnerungsgedichte über die Kindheit in dem Band CHAUSSEEN, CHAUSSEEN:
die Kinderplanschen durch die Güsse.
Sie hörn den ödesten der Laute,
das trübe Sickern in der Brache. Es ist das Maß, das Zeichen der mütterlichen Präzision.
Als Peter Huchel in dem Alter war, in dem ein Kind willig die Sprache, sogar die Fremdsprache erlernt, verschwand seine Mutter aus seiner Welt.
Nachts hing tot der Bruder im Gebälk.
Fremder Mann, pochst du ans Tor?
Ach, wie war im Schlaf die Mutter welk.
Vater schrak in Nacht empor.
„Die Kindheit war für mich doch der Urgrund“, sagte Huchel 1971 in einem Interview: „Da meine Mutter lungenkrank war, hat eine Magd mich großgezogen. Meine Welt war ‚heil‘. So wurde ich ein Märker.“ Die Kindheit, die der Urgrund war, begann nicht mit der Geburt und in Berlin-Lichterfelde, sondern in der Mark und mit jener Zeit, da den Vierjährigen die Mutter und Fremdsprache des großväterlichen Anwesens in Alt-Langerwisch umgab, eine Sprache, die mit allen ihren Gegebenheiten und Vorgängen gegen seine Verlassenheit zeugte und ihm sagte: Du lebst und wirst leben wie wir. Die „heile“ märkische Welt lag, wie das Gedicht „DER GLÜCKLICHE GARTEN“ sagt, „vor dem Haus“, und sogar „vor dem Tor“. Ein Garten, ein umfriedeter Raum, war sie als Sprache:
vor welchem Haus,
wo wir die kindliche Stimme sparten
für Gras und Amsel, Kamille und Strauß
Der Abend gab die mütterliche Umhüllung zurück:
Und wenn dann die Mägde uns holen kamen
umfing uns das Tuch, in dem man gleich schlief.
Die Mutter hieß – aber ehe sie hieß, war sie – Magd und Tuch. Die Mutter des verlassenen Kindes, die Mutter an Mutters statt, die Mutter in der Welt draußen ist die vom Richter des Kreidekreises ernannte Mutter. Der Student in Wien oder der Wanderer und Landarbeiter in Südfrankreich schrieb 1926:
Die Magd ist mehr als Mutter noch.
Sie kocht mir Brei im Kachelloch.
Wenn sie mich kämmt, den Brei durchsiebt,
die Kruke heiß ins Bett mir schiebt,
schlägt laut mein Herz und ist bewohnt
ganz von der Magd im vollen Mond.
War die Seele in die Außenwelt gewandert, so kam die Außenwelt in die Seele und wurde zur Sprache der Seele. Mit dem Gedicht „IM GLÜCKLICHEN GARTEN“ bezeugte Peter Huchel den Gründungsbrief seiner Dichterwerkstatt, jener Stätte, für die das Gesetz einer zweigesichtigen Reife galt. Eines ihrer Wahrzeichen war der Mond, jenes zweite Gesicht am Himmel, welches, wie ich einmal entdeckte, in den Gedichten erscheint, weil wir, wenn wir aus dem Eigenen zu sprechen beginnen, uns unbewußt aus der Sprache, der wir entgegnen, ein Gegenüber formen, mit dem wir über unser Menschenbild sprechen. Als ich ein Wort suchte für dieses Gegenüber, bei dessen Entdeckung sich mein Gewissen erholte von dem Bild, das das Unheil, mit dem wir es zu tun haben, auf uns zurückwirft, wie wenn wir kein eigenes hätten: „Unglück, mein Bruder“ – als ich nach einem Wort Ausschau hielt für jenes unbewußt gebildete Gegenüber, jenes dem menschlichen vorgeformte Gesicht, erschien statt des Wortes unerwartet die runde Scheibe des Monds. Als Zeichen der Verständigung über das zugleich bezeugende und befremdende Wesen, das Sprache heißt, habe ich nun auch alle Monde Peter Huchels lesen können. In dem Gedicht „DIE PAPPELN“ traf die Mondlegende mit einer anderen, der Legende des Steins zusammen, so daß sie eins wurden.
Ein weißer Stein ertrank.
War es der Mond, das Auge der Ödnis?
In einer Vorfassung (von 1951) hieß es noch:
War es der Mond? Oder das Auge der Ödnis?
Von dem verschlossenen harten Stein in der Innen- und Außenwelt sagt das Gedicht „VERONA“:
Dieser Stein
Lebt groß in seiner Stille.
Und in der Mitte der Dinge
Die Trauer.
Odysseus dann, in dem Band GEZÄHLTE TAGE, ist auf dem Wege, der lockere Ziegel in der Mauer zu sein, wenn er in dem großen Stein-Gedicht „ODYSSEUS UND DIE CIRCE“ berichtet:
Ausgesetzt der hallenden Öde,
hörte ich die Mittagsstimme:
Wenn du im Herzen
die Wahrheit bewegst,
die Lüge bewegst,
die List,
erschlagen dich die Steine.
Gehen wir zurück in den „glücklichen Garten“:
Da saßen wir abends auf einer Schwelle,
ich weiß nicht mehr, vor welchem Tor,
und sahn wir im Mond die mondweißen Felle
der Katzen und Hunde traten hervor.
Wir riefen sie alle damals beim Namen,
ich weiß nicht mehr, wie ich sie rief
Und wenn dann die Mägde uns holen kamen,
umfing uns das Tuch, in dem man gleich schlief
Träumst du von weißen Tieren, sagt ein Traumdeuter, dann wächst deine Seele. Die Seele wächst. Sie entwächst dem Traum, der Fremde, der Gefangenschaft, der Starre, dem unkenntlichen Mord. Sie wächst in den Traum, die Gefangenschaft, die Starre, in den unkenntlichen Mord, sie reift in die Fremde. Gehen wir zurück auf den „Urgrund“ der Dichtung Huchels, sehen wir ihre Meinung und die in ihr geborgene und bis zum Ende ihres Lebens „in allen Lüften“ bewahrte Stimme gegründet auf den Mut eines vierjährigen Kindes!
Ein unerwartetes Glück durchfuhr mich bei dieser Entdeckung in den Wochen der bewegenden Wiederbegegnung mit Peter Huchel, zu der mich Ihr schöner Preis geführt hat, ein Glück von solcher Art, daß man es nicht für sich behalten kann und es gleich allen mitteilen möchte. Ich danke Ihnen für den Preis und wünsche Ihnen, uns, daß es uns mit dem Dichter bleibt.
Elke Erb, Dankesrede, 1988
Beiträge zum Peter-Huchel-Preis:
Alexander von Bormann: Elke Erbs experimentelles Schreiben
Neue Zürcher Zeitung, 30.3.1988
Reinhard Stumm: Lyrik, was immer dagegen spricht
Basler Zeitung, 7.4.1988
Gregor Laschen: Was ich lebe, das schreibe ich auch. Kleine Collage zur Dichtung der Elke Erb
Südwestfunk Journal, Heft 4, 1988
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1988
Gedichtverdachte: Zum Werk Elke Erbs. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung In den Vordergrund sprechen Hendrik Jackson, Steffen Popp, Monika Rinck und Saskia Warzecha über Elke Erbs Werk.
Franz Hofner: Hinter der Scheibe. Notizen zu Elke Erb
Elke Erb: Die irdische Seele (Ein schriftlich geführtes Interview)
Elke Erbs Dankesrede zur Verleihung des Roswitha-Preises 2012.
Im Juni 1997 trafen sich in der Literaturwerkstatt Berlin zwei der bedeutendsten Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik: Elke Erb und Friederike Mayröcker.
Klassiker der Gegenwartslyrik: Elke Erb liest und diskutiert am 19.11.2013 in der literaturWERKstatt berlin mit Steffen Popp.
Lesung von Elke Erb zur Buchmesse 2014
Zum 70. Geburtstag von Elke Erb:
Steffen Popp: Elke Erb zum Siebzigsten Geburtstag
literaturkritik.de
Zum 80. Geburtstag von Elke Erb:
Waltraud Schwab: Mit den Gedanken fliegen
taz, 10.2.2018
Olga Martynova: Kastanienallee 30, nachmittags halb fünf
Süddeutsche Zeitung, 15.2.2018
Michael Braun: Da kamen Kram-Gedanken
Badische Zeitung, 17.2.2018
Michael Braun: Die Königin des poetischen Eigensinns
Die Zeit, 18.2.2018
Karin Großmann: Und ich sitze und halte still
Sächsische Zeitung, 17.2.2018
Christian Eger: Dichterin aus Halle – Wie Literatur und Sprache Lebensimpulse für Elke Erb wurden
Mitteldeutsche Zeitung, 17.2.2018
Ilma Rakusa: Mensch sein, im Wort sein
Neue Zürcher Zeitung, 18.2.2018
Oleg Jurjew: Elke Erb: Bis die Sprache ihr Okay gibt
Die Furche, 8.3.2018
Annett Gröschner: Gebt Elke Erb endlich den Georg-Büchner-Preis!
piqd.de, 27.6.2017
Zum Georg-Büchner-Preis an Elke Erb: FR 1 & 2 + MOZ + StZ + SZ +
Echo + Welt + WAZ + BR24 + TTB + MAZ + FAZ 1 & 2 + TS + DP +
rbb +taz 1 & 2 + NZZ +mdr 1 & 2 + Zeit + JW + SZ 1 & 2 +
Zur Georg-Büchner-Preis-Verleihung an Elke Erb: BaZ + BZ + StZ +
AZ + FAZ + SZ
Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2020 an Elke Erb am 31.10.2020 im Staatstheater Darmstadt.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + PIA + weiteres 1, 2 & 3 +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Galerie Foto Gezett 1, 2 & 3 +
deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Elke Erb: FAZ ✝︎ BZ 1 + 2 ✝︎ Tagesspiegel 1 +2 ✝︎ taz ✝︎ MZ ✝︎
nd ✝︎ SZ ✝︎ Die Zeit ✝︎ signaturen ✝︎ Facebook 1, 2 + 3 ✝︎ literaturkritik ✝︎
mdr ✝︎ LiteraturLand ✝︎ junge Welt ✝︎ faustkultur ✝︎ tagtigall ✝︎
Volksbühne ✝︎ Bundespräsident ✝︎ Sinn und Form ✝︎
Im Universum von Elke Erb. Beitrag aus dem JUNIVERS-Kollektiv für die Gedenkmatinée in der Volksbühne am 25.2.2024 mit: Verica Tričković, Carmen Gómez García, Shane Anderson, Riikka Johanna Uhlig, Gonzalo Vélez, Dong Li, Namita Khare, Nicholas Grindell, Shane Anderson, Aurélie Maurin, Bela Chekurishvili, Iryna Herasimovich, Brane Čop, Douglas Pompeu. Film/Schnitt: Christian Filips
Zur Erinnerung an Elke Erb und Helga Paris. Lesung mit Steffen Popp, Brigitte Struzyk, Joachim Hildebrandt und Peter Wawerzinek am 6.7.2024 im Salon von Ekke Maaß, Berlin. Martin Schmidt: Improvisationen am Klavier
Elke Erb liest auf dem XVII. International Poetry Festival von Medellín 2007.
Elke Erb liest bei OST meets WEST – Festival der freien Künste, 6.11.2009.



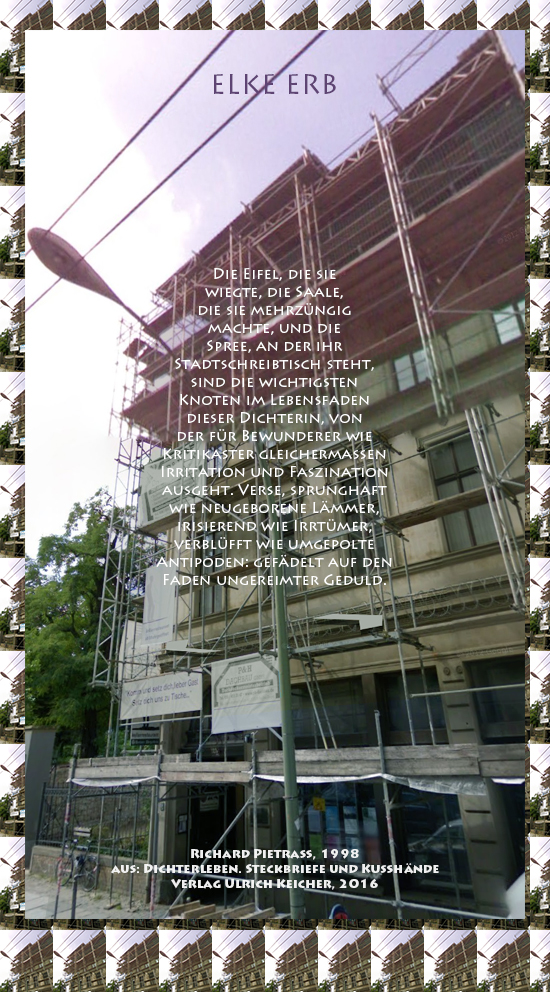












Schreibe einen Kommentar