Peter-Huchel-Preis 1990: Ernst Jandl
aus der dichtung großem glück
langsam zieh ich mich zurück
oder tue einen schritt
der mein dichtersein zertritt
nur den lesern bleibe ich
noch ein weilchen dichterlich
Die Sprache verhören
hohe gegenstände
werte gegenstände
geehrte gegenstände
verehrte gegenstände
erlauchte gegenstände
sehrgeehrte gegenstände
sehrverehrte gegenstände
hochzuverehrende gegenstände
− trifft Sie, fragen Sie sich, der Blitz, sind Sie, fragen Sie sich, Gegenstände, haben Sie sich, fragen Sie sich, verhört, das ist möglich, alles ist möglich, wenn es um Wörter geht, wenn es um Sprache geht, wenn es um Sprechen geht, wenn es um Hören geht, es ist möglich, daß einem beim Hören unversehens Hören und Sehen vergeht, es ist möglich, daß einem beim Verhören unverhörens Versehen und Verhören vergeht, beim Verhören, beim Sichverhören, beim Diespracheverhören, es ist möglich, daß einer, der sich verhört, einer ist, der die Sprache verhört, und wenn das so ist, dann ist es möglich, einen Schluß daraus zu ziehen, einen schönen, lasziven Schluß, denn die Logik ist etwas, das schön und lasziv in den Köpfen herumliegt, wie „spucken“ in der „franz hochedlinger-gasse“ in Wien, nämlich den Schluß: wenn einer, der sich verhört, einer ist, der die Sprache verhört, dann ist er die Sprache, eine Erkenntnis, die Ihnen sofort weiterhilft, wenn Sie sich zum Beispiel vergegenwärtigen, daß in nicht allzu ferner Vergangenheit, es war Mitte der sechziger Jahre, ein berühmter Frankfurter Verleger, sein Name tut nichts zur Sache, über einen damals noch nicht so berühmten österreichischen Autor, sein Name: Ernst Jandl, um ihn, diesen Jandl, nicht verlegen zu müssen, folgendes sagte: er, dieser Jandl, „sei der traurige Fall eines Lyrikers ohne eigene Sprache“, womit er, dieser traurige Fall eines Verlegers ohne, ja: ohne was?, ohne Jandl jedenfalls, zweifellos recht hatte, denn da dieser Jandl einer ist, der, dauernd sich verhörend, dauernd die Sprache verhört und demzufolge dauernd die Sprache ist, da also dieser Jandl uns durchaus nicht zu dauern braucht, da er ja als Sprache dauert, kann er aber, dieser Jandl, nicht auch noch eine eigene Sprache haben, denn was einer ist, das hat er nicht, und was einer hat, das ist er nicht, und das ist nicht bloß laszive Logik, sondern schöne, laszive Ontologik oder -gie, denn die Ontologik oder -gie ist etwas, das schön und lasziv in den Mäulern herumliegt, wie „wursten von hunden“ in der „franz hochedlinger-gasse“ in Wien, und Sie können das wunderbar an sich selber ausprobieren, Sie alle sind doch, ich geb es doch zu, keine Gegenstände, sondern, doch davon später, aber woran erkennt einer denn, daß er kein Gegenstand ist, doch daran, daß er einen Gegenstand hat, mehr als einen meistens, keiner von Ihnen ist ein Gegenstand, weil jeder von Ihnen, und das unterscheidet Sie zum Beispiel von Gedichten von Ernst Jandl, viele Gegenstände hat, sogar die aus dem noch DDR heißenden Teil von Deutschland angereisten Literaturfreunde haben viele Gegenstände, haben sogar erstaunlich viel Gegenstand, und nur, wer gar keinen Gegenstand hätte, wäre womöglich selber ein Gegenstand, ein Gedicht von Ernst Jandl zum Beispiel, doch davon später, wir wollen noch einen Augenblick bei jener traurigen Verlautbarung jenes Frankfurter Verlegers bleiben und bei dem, was Ernst Jandl ihm geantwortet hat, als er Jahre später, im Wintersemester 1984/85, in Frankfurt seine fünf Poetik-Vorlesungen Das Öffnen und Schließen des Mundes hielt, Ja, sagte Ernst Jandl da, „ja, ich bin ein Lyriker ohne eigene Sprache, denn diese Sprache, die deutsche, wie jede andere übrigens, und also gilt es, wie ich es sehe, für den Dichter jeglicher Zunge, gehört nicht dem Lyriker, nicht dem Dichter, nicht dem Schriftsteller sondern allen, die in dieser und jener, jeglicher, Sprache leben, d.h. in ihr, mit ihr und durch sie Menschen, menschliche Wesen sind. Die Sprache gehört mir nicht, diese meine deutsche Sprache gehört mir nicht. Sie gehört allen“, sagte Ernst Jandl damals, wir aber können hier und jetzt zu einer weiteren schönen, lasziven Wahrheit fortschreiten, die Wahrheit nämlich liegt schön und lasziv in der Sprache herum, wie „saufenkotz“ in der „franz hochedlinger-gasse“ in Wien, denn, wenn wahr ist, daß Ernst Jandl die Sprache ist, und wenn wahr ist, daß die Sprache allen gehört, dann ist auch wahr, daß Ernst Jandl allen gehört, und so ist es in der Tat, Ernst Jandl ist einer der ganz wenigen Dichter, einer der wenigstens heute ganz wenigen Dichter, die allen gehören, zwar, auch er, Sie hören es ja, gehört den Juroren, den Laudatoren, den Kommentatoren und all den Toren, denen Autoren heute gehoren, aber Ernst Jandl gehört nicht nur den sturen Auguren mit Professuren und Sinekuren, denen die puren Literaturen samt Auturen heute gehuren, nein, Ernst Jandl gehört allen, er gehört auch den Kindern, er gehört auch den Greisen, er gehört den ganz Normalen und den ganz und gar Anormalen, wobei gottseidank niemand weiß, was normal, was anormal ist, er gehört den schon Verrückten, er gehört den noch Verrückbaren, er gehört den Arbeitern, ja, ich behaupte ganz entschieden, daß Ernst Jandl auch den Arbeitern und sogar den, haben Sie sich, fragen Sie sich, verhört, Bauern gehört, und wenn es nicht dummerweise so wäre, aber es ist so, daß das Wort „Volk“, kaum in den Mund genommen, bestialisch, pestilenzialisch zu stinken beginnt, würde ich nicht zögern zu sagen, daß Ernst Jandl ein VED, ein volkseigener Dichter ist, was natürlich übertrieben wäre, so ist es nicht, aber so könnte es sein, so müßte es sein, und das Werk von Ernst Jandl ist eines der ganz wenigen Werke, der wenigstens heute ganz wenigen Werke, die die Erinnerung wachhalten daran, daß wie die Sprache so auch die Dichtung eigentlich Eigentum aller ist, das Werk von Ernst Jandl hält den Traum fest, hält ohne faule Kompromisse mit Populismen den Traum fest von einer nichtelitären avantgardistischen Kunst, von einer experimentellen Kunst, an deren Experimenten nicht nur einige wenige Poesielaboranten, Sprachspezialisten, sondern alle teilhaben könnten, von einer Kunst auf der Höhe der Zeit, wenn Höhe nicht eh der falsche Ausdruck wäre, und zugleich auf Bodenhöhe oder nur so weit über dem Boden wie die sich öffnenden, wie die sich schließenden Münder aller, „phallus klebt allus“, wer bitte sähe, durchs Gedicht sehend gemacht, das nicht, „manche meinen / lechts und rinks / kann man nicht / velwechsern. / werch ein illtum.“, wen bitte, deI graubte, die Lichtung sei kral, blächten diese Velse nicht dulcheinandl, „nein / nein / nein / nein / nein / nein / nein / (beantwortung von sieben nicht gestellten fragen)“, welchem Neinsager bitte, wenn er das hört, versiebenfachte nicht die Kraft zum Neinsagen sich und welchem Jasager führen da nicht sieben Wortknüppel zwischen die Beine, zwischen die zum Jasagen sich untertänig spreizenden Kiefer, das Werk von Ernst Jandl ist ein demokratisches, ein politisches, ein kritisches Werk, nur daß den, der durchs Werk von Ernst Jandl gewitzt ist, wenn er die Wörter wählt, um das Werk von Ernst Jandl zu preisen, plötzlich der Blitz trifft, der Blitz der Erkenntnis, daß noch die Wörter, die er da wählt („kritisch, demokratisch, politisch“) ihm wie Sprechblasen platzen werden, womit wir, demblitzseidank, glücklich wieder am Anfang wären, trifft Sie, hatte ich Sie sich fragen lassen, der Blitz, sind Sie, hatte ich Sie sich fragen lassen, Gegenstände, nein, hatten wir zusammen geschlußfolgert, nein, das nicht, ja, aber was dann, fragen Sie sich seither verzweifelt, wenn keine Gegenstände, was dann, nun, es hilft nichts, wir müssen die „hörprobe“ machen:
1
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
höherhören
2
höhere hören
und daumen
höhere daumen
und hören
höhere hören
und höhere daumen
meine höheren daumen
meine höheren hören
3
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
kennen sie mich herren
meine damen und herren
− nun ist es heraus, Sie sind keine Gegenstände, Sie sind Damen und Herren, die einen Damen, die andern Herren, bis auf weiteres jedenfalls, und Sie haben natürlich ganz recht, wenn Sie erwarten, daß Ihnen das am Anfang einer anständigen Rede nochmal gesagt wird, so was behält man ja nicht so leicht, Sie sind „sehrgeehrte, sehrverehrte, hochzuverehrende“ Damen und Herren, und auch ich hätte gewiß nicht gezaudert, es Ihnen zu sagen, daß Sie es sind, wenn man nicht, als ich, um auf diese Rede mich vorzubereiten, noch einmal die alten Bücher von Ernst Jandl las, wenn mich da nicht der Blitz getroffen hätte, das Gedicht „der blitz“ nämlich, in dem der Blitz hohe, werte, geehrte, verehrte undsoweiter Gegenstände trifft, es steht in dem ersten Gedichtband von Jandl, nein, nicht in dem allerersten, der heißt Andere Augen und ist 1956 erschienen in Wien, aber in dem ersten, der den unberühmten Jandl berühmt gemacht hat, in dem ersten, der Lautgedichte, Sprechgedichte, visuelle Gedichte, experimentelle Gedichte von Ernst Jandl versammelte, der Titel verrät es bereits, Laut und Luise heißt das 1966 endlich von Otto F. Walter und Helmut Heissenbüttel in der Reihe Walter-Drucke herausgegebene Buch, Laut und Luiiise, weil die Mutter von Ernst Jandl, sie dichtete auch schon, freilich katholisch, Luise hieß, aber natürlich auch Laut und lujse, weil von laut leise das Gegenteil ist, in diesem Band also fährt „der blitz“ nieder, von dem Helmut Heissenbüttel im Nachwort schreibt, er sei „ein größeres Lehrgedicht“, und in der Tat, mich hat der „blitz“, und mich hat auch die „hörprobe“ aus den „sprechblasen“ von 1968 was gelehrt, nämlich zum Beispiel, daß es unmöglich und eine Beleidigung und lächerlich wäre, auf Ernst Jandl eine Rede zu halten, die mit der Floskel von den „sehr verehrten Damen und Herren“ anfangen würde, ganz einfach deshalb, weil es just diese so unverdächtig, so unschuldig wirkenden Floskeln sind, diese so harmlos konventionell klingenden, in Wirklichkeit aber gleich zu Beginn eines Texts den falschen Ton fest etablierenden und dann von innen her strikt regulierenden Festrederequisiten, denen die ganze aufklärerische Verhörungs-, Verhöhnungs-, Zerstörungsarbeit des Dichters Ernst Jandl gilt, denn was bekämpft diese Lyrik, wenn nicht den Festton, den Feiertagston, den Kranzton, den Glanzton, den Lorbeerton, den Huldigungston, den Heldenton, den hohen Ton, den tiefen Ton, den großen Ton, den geschwollenen Ton, den Blähton, den Blaaton, den Platon, den Ideeton, den Teeton, den Kulturton, den Urton, nein, all das ist Ernst Jandl ein Greuel, und wenn ich mal einen Augenblick lang ein bißchen moralisieren darf, dann möchte ich sagen: wir alle wären gut beraten und das Menschengeschlecht käme, wer weiß, einen kapitalen Ruck voran, wenn wir jeweils, bevor wir zu tönen beginnen, bevor wir mündlich oder schriftlich vor uns hinzutönen oder einander anzutönen beginnen, uns darauf besännen, so nicht zu tönen, daß Ernst Jandl stöhnen, unser Tönen verhöhnen, mit gewaltigem Sprachzorn dröhnen, uns unser Tönen um die Ohren hauen müßte, eine Utopie, bedienen Sie sich, lassen Sie es bleiben, wer spricht, entgeht dem Sprachzorn Jandls nicht, aber ich spüre, daß eine ganz andere Frage Sie quält, ich sehs, ich hörs, wies Ihnen die Hälse hoch zu den Lippen kriecht, huch, hör ichs fragen, huch, huch, Huchel, war hier nicht, fragen Sie sich, der Peter-Huchel-Preis zu vergeben, was hat denn, fragen Sie sich, Ernst Jandl mit Peter Huchel zu tun, eine berechtigte Frage, ich möchte sie Ihnen ganz knapp beantworten: nichts, gar nichts hat Ernst Jandl mit Peter Huchel zu tun, außer, jetzt kommt die Einschränkung, die entscheidende Einschränkung, denn dies ist kein Affront gegen Peter Huchel, kein Affront gegen die Stifter des Peter-Huchel-Preises, kein Affront der und kein Affront gegen die Jury des Peter-Huchel-Preises, die Ernst Jandl diesen Preis zuerkannt hat, obwohl Ernst Jandl mit Peter Huchel nichts zu tun hat, außer daß Peter Huchel ein großer Dichter ist, und das ist Ernst Jandl auch, und das ist ein seltener Glücksfall, und es gibt keine bessere Art, keine dem Eigenleben der Poesie, ihrer Autonomie gemäßere Art, die Erinnerung an einen großen Dichter, Peter Huchel zum Beispiel, wachzuhalten, als am Geburtstag dieses Dichters den Preis, der seinen Namen trägt, einem anderen Dichter zu geben, der, außer daß er auch ein großer Dichter ist, gar nichts mit ihm zu tun hat, denn nichts wäre umgekehrt so borniert, so provinziell, so sehr dem Eigenleben der Poesie, ihrer Autonomie, zuwiderlaufend wie jeder Versuch, das Neue, das Andere einer Dichtung zu prämieren nach dem Maß seines Anklangs an ein Altes, schon Gewesenes, zu prämieren also ein Maß an Übereinstimmung mit einer Richtung, einer Schule, einer Tradition, einem Tonfall, einer Bilderwelt, einem Themenkatalog, einer durch ein existierendes Werk festgeschriebenen Weitsicht, zu prämieren also, statt der der Dichtung innewohnenden Schubkraft in Richtung Freiheit, vielmehr die von der Dichtung noch mitgeschleppte, noch nicht abgeschüttelte Bürde der Unfreiheit, siebenmal nein sagen wir da mit Ernst Jandl, denn stellen Sie sich nur einmal vor, es würde einmal, und so wird es kommen, ein Ernst-Jandl-Preis gestiftet und den würde dann der bekommen, der am linientreusten, am zeilentreusten jandelte, entsetzlich, nein, keine Nachjandler, Mitjandler, Mithuchler, Nachhuchler sind gesucht, sondern Dichter, Dichtungen, und das haben die Stifter des Peter-Huchel-Preises wohl bedacht und haben es weise, sehr weise in die Satzung geschrieben, daß mit dem Peter-Huchel-Preis ein Autor oder eine Autorin ausgezeichnet werden soll, „der oder die durch ein im zurückliegenden Jahr erstmals in Druckform erschienenes Werk einen besonders bemerkenswerten Beitrag zur Entwicklung der deutschsprachigen Lyrik geleistet hat“, da haben Sies, nicht von einem besonders bemerkenswerten Beitrag zur Tradierung des Huchel-Tons in der Lyrik ist die Rede, sondern von der Entwicklung der deutschsprachigen Lyrik, und dazu ist nun in der Tat der neue Gedichtband von Ernst Jandl, idyllen heißt er irritierenderweise, doch davon später, ein höchst bemerkenswerter Beitrag, ein attraktiver, ein grauenhafter, ein unheimlicher Beitrag, obwohl dieser Band ganz ungrauenhaft, fast idyllisch zu beginnen scheint, mit seinen ersten zwölf Zeilen natürlich, die natürlich „die ersten zwölf zeilen“ heißen:
die zeile, die vor mir steht still
und eine zweite zeile will
ich habe diese ihr erfunden
und schon zwei weitre dran gebunden
ein ende ist noch nicht in sicht
ich mag sie bisher alle nicht
weil jede schamlos nur enthüllt
mein denken als von nichts erfüllt
nichts andrem nämlich als dem schreiben
von zeilen, welche zählbar bleiben
für den, der an zwei mehr noch glaubt
als ihm der finger zahl erlaubt.
− fast idyllisch, nicht wahr, diese Evozierung, noch einmal, des Glücks am Gebilde, das sich selber genug ist, am Gedicht, das sich sein eigener, einziger Gegenstand ist, das nur ist, was es sagt, und nur sagt, was es ist, immer wieder kehrt sie in diesem Gedichtband, die Erinnerung an das Glück am konkreten Gedicht, das keinen Gegenstand außer sich hat, das sich bescheiden und selig und maßvoll darin erschöpft, in seiner Sprache das zu vollziehen, selber, wovon es spricht, „man will gedichte rasch herunterschreiben / gedanken müssen nicht dran hängen bleiben, im Gegenteil, im Gegenteil, die zeile will die zeile sein / hier muß nicht erst noch sinn hinein / mit sinn die sprache ist beladen / und dreckig, also laßt sie baden“, das war es doch, das Glück am Bad, das Glück an dem Bedeutungsschmutz, dem Sinndreck wegspülenden Bad der Sprache in der Sprache, was für ein Aufatmen, welche Befreiung, glückliche Tage, sie sind vorbei, es brach etwas ein in die Wörterwelt der schönen Scheinlosigkeit, sie bekam Risse, durch die etwas eindrang, eindringt von draußen, nämlich „nichts“, das ist das Grauenhafte, das sich ankündigt in der sechsten bis achten der „ersten zwölf zeilen: ich mag sie bisher alle nicht / weil jede schamlos nur enthüllt / mein denken als von nichts erfüllt, von nichts, nichts ist das Wort, schamlos“ ist das Wort, das konkrete Gedicht wird seiner Nacktheit inne, mit Überdruß, mit Ekel, mit Selbsthaß, es schämt sich nicht, o nein, aber es fröstelt, ihm ist kalt, es merkt: es ist allein auf der Welt, es ist ja die Welt, die freigeräumte, leergeräumte Welt, Tabula rasa, der nackte Gedichtkörper wird seiner Nacktheit inne, und da schwankt er, und da schlägt er lang hin, hören Sie:
schade um dieses gedicht
o gott wie schade großer
gott wie schade wie schade
verdammte scheiße schade o schade o
… so schade vielleicht auch wieder nicht
− es ist schade um die Menschen, heißt es bei Strindberg, es ist schade ums Gedicht, heißt es bei Jandl, aber „so schade vielleicht auch wieder nicht“, und schon ist der Absturz des Gedichts selbst ein Gedicht, ein Absturz-Gedicht, denn es gibt Dichter des lyrischen Aufschwungs, aber Ernst Jandl ist der Dichter des lyrischen Absturzes, „flugschlüsse“ sollte ursprünglich der Band heißen, in dem unsre „hörprobe“ steht und der dann doch als sprechblasen erschien, „flugschlüsse“, weil, so Ernst Jandl 1978 im Nachwort zur Reclam-Ausgabe des Buchs, „mit jedem einzelnen Gedicht, und schließlich allen insgesamt, ein Fliegen zu Ende geht, hart oder weich, oder mit Aufprall und Zerschellen“, eher mit Aufprall und Zerschellen heute, in den idyllen, und man kann es kaum falscher ausdrücken als der Rezensent, der in der Zeit über die idyllen schrieb, „es sei ein kleines Wunder, wie Jandl es versteht, die Gedichte … immer wieder eine Handbreit über dem Boden eines ernüchternden Alltags schweben zu lassen“, nein, diese Gedichte schweben nicht, sie stürzen ab, sie sind der Absturz, von dem sie sprechen, sie machen hörbar ihren Aufprall, ihr Zerschellen auf dem harten Boden der frei geräumten, leergeräumten Welt, ihren Aufprall, ihr Zerschellen, dem sie oft am Schluß mit einer kleinen, höhnischen Beschwichtigungszeile noch das Recht auf den Trost des eigenen Aufprallundzerschellpathos absprechen: ich bins ja bloß, weiter nichts, das stürzt, sagt das stürzend von seinem Sturz sprechende Gedicht Jandls zum Schluß, zum Beispiel „dieses gedicht“:
es ist noch nicht gut
und du mußt daran noch arbeiten
aber es stürzt nicht die welt ein
wenn du es dabei beläßt
es stürzt nicht einmal das haus ein
− nein, aber das Gedicht stürzt ein, und das Gedicht ist doch das Haus, das Gedicht ist doch die Welt, wir erfuhrens doch in der achten bis zehnten der „ersten zwölf zeilen“, daß schamloserweise das Denken des Dichters „von nichts erfüllt ist als dem schreiben / von zeilen“, und das, wovon das Denken ausschließlich erfüllt ist, das ist die Welt, dazu schrumpfte die Welt, dazu zog die Welt sich zusammen, zu dieser kahlen, fahlen, freigeräumten, leergeräumten Bühnenkugel, denn
das stück, darin
ich keine rolle spiele
ist meines.
ohne glück und trauer
geht es, den abend lang, dahin.
die bühne ist
nach keiner seite offen
kein publikum zu fürchten, zu erhoffen.
− das ist sie, die Guckkastenweltbühnenkugel Gedicht, in der es, auf der es nichts zu gucken gibt, sie ist in sich abgeschlossen, zeigt jedoch Risse, gleich wird sie in sich zusammenstürzen, und in ihr, auf ihr steht Ernst Jandl, inmitten von „tous ceux qui tombent“, von allen, die da fallen, allein, und rafft sich auf zu einem Sturz, der Hinsetzen heißt:
also jetzt setz ich mich hin
also jetzt sitz ich da
da sitz ich jetzt also
− nämlich allein im Gedicht, allein auf der Welt, „und wieder Dunkel, ungeheuer / im leeren Raum, um Welt und Ich“, so drückte sich, in einem Augenblick, in dem er vielleicht Vergleichbares spürte, Gottfried Benn aus, nur daß er, Benn, es auch in diesem Augenblick nicht lassen konnte, kräftig die lyrische Blaatonpumpe zu bedienen, um das Gedicht aufzublasen, damit hat Jandl nichts im Sinn, er beschränkt sich auf den nüchtern fluchenden Dreizeilenhinsetzsturzrapport, das ists, sagt der Fluch, mehr ist nicht, sagt der Fluch, mehr ist nicht übriggeblieben von der Welt als dieser Sturz, als die grauenhafte Faktizität dieses Sturzes des Jandl-Körpers aus dem Stehen ins Sitzen, ein Alltagsgedicht, ein Weltalltagsgedicht, ein Gedicht aus dem Weltalltag des allein auf der Bühne zurückgebliebenen Jandl-Körpers, den es, kaum stürzte er, hochreißt:
es hat mich umgeschmissen
mein leben ist zerrissen
ich will von nichts mehr wissen
da meldet sich das pissen
und zerrt mich aus den kissen
− es, das Pissen, ergreift Besitz vom allein auf der Bühne zurückgebliebenen zusammenbrechenden Jandl-Körper, der Besitz ergreift vom Risse zeigenden, zusammenbrechenden konkreten Gedicht, in das er hineinscheißt, in das er hineinbrunzt, in das hinein er seinen Alterssamen sickern läßt, dieser uralte, so hören wir, stinkende, sabbernde Körper, dies inkontinente, impotente Fleisch, auf das der weibliche Teil des „älternden paars“ im „oratorium“ seinen Liebesfluch flucht:
„du alter arsch“, sagt sie
„du wirklich alter arsch
total verkalkt dein hirn
total verkalkt
du schwein dem seine pisse tropft
vom hosenbein und merkt es nicht
und sitzt im dünnschiß auf der beiselbank
wegrücken alle, ich nur, im gestank, bleib neben ihm“
− ein Schock sind diese Verse, diese drastischen, obszönen, sich nicht und uns nicht schonenden Verse, Manifeste einer so nie gehörten Altersradikalität, in denen, in jeder Silbe hören Sie es, etwas Paradoxes und Grandioses sich zuträgt: die Resurrektion des stürzenden, von der Zeit geschundenen, heruntergerissenen Körpers, des, wie es doch scheint, im Prozeß des erbärmlichsten, widerlichsten Verfalls gezeigten Körpers in der Sprache, es ist nicht anders: das Fleisch, das, wie es doch scheint, am lebendigen Leib zu faulen beginnt, in höhnischer Autonomie vor sich hinzustinken beginnt, wenn wir nämlich hören, was gesagt wird, das Fleisch aufersteht triumphal in der Sprache, wenn wir nämlich hören, wie es gesagt wird, diesen „idyllen“ von Ernst Jandl eignet eine stupende Körperlichkeit, eine überwältigende, libidinösest und freilich auch destrudinösest und autodestrudinösest besetzte Körperlichkeit, auf den splitterenden Knochen des konkreten Gedichts wuchs im Augenblick seines Sturzes ein konkretes Körperfleisch, wo sonst ist Physis in Lyrik so präsent wie hier, wo überhaupt sonst ist ein Sprachliches, Geistiges so durchdrugen von Physis, wie es der Fall ist in diesen „idyllen“ von Ernst Jandl, die in diesem ästhetisch präzisen Sinn sehr zurecht „idyllen“ heißen, so extrem gegenidyllisch zunächst auch der ins Gedicht brechende Gegenstand dargestellt scheint, denn wenn die Idylle die „Form der Wiederherstellung einer verlorengegangenen Einheit von Natur und Geist“ ist, wie der ehrwürdige Gero von Wilpert, den ehrwürdigen Schiller zusammenfassend, in seinem „Sachwörterbuch der Literatur“ weiß, dann bittschön läßt sich Idyllischeres als das Jandl-Gedicht nicht denken, nur daß sich die Wiedervereinigung von Natur und Geist, von Körper und Sprache hier allerdings nicht friedlich, harmonisch, wohltemperiert, in Schäferundhirtenmanier, sondern gewaltsam, gefräßig, brutal, mit – aber voluptuösem – Getöse vollzieht, ein wollüstiges Sprachstampfen erschüttert die poetische Weltbühnenkugel, auf der, in der ein Lehrspektakel unseren Ohren demonstriert: am Ende ist das Fleisch, und das Fleisch wird Wort – was wir so aber nicht stehen lassen wollen, so wär das womöglich ein bißchen blasphemisch und mystifizierte womöglich den Sachverhalt auch, den wir dagegen entmystifizieren, sobald wir endlich den Motor nennen, das Vehikel, die Kraft, die das alles bewirkt: es ist die Stimme, die Jandl-Stimme, die im „ersten sonett“ von sich selber spricht, wenn es heißt: „in uns kracht / ohrenbetäubend tag und nacht / donner der sprache, heult und lacht“, denn dieses Sprachdonnern, Sprachheulen, Sprachlachen, das mit einer keinem Prozeß des Altems unterworfenen physischen Wucht sich entlädt, bedarf, um sich entladen zu können, der Jandl-Stimme als ihres Sprachheul-, Sprachlach-, Sprachdonnerrohrs, der Jandl-Stimme, die, vor Potenz strotzend, über Inkontinenz und Impotenz spricht, der Jandl-Stimme, durch die dem immateriell-zeichenhaften Text des Gedichts ein irreduzibel Materielles eingeschrieben ist, eingeschrieben, ja, denn es gilt beides: die Stimme artikuliert das Gedicht, aber das Gedicht, sozusagen, artikuliert auch die Stimme, Jandl komponierte die Jandl-Stimme in das Gedicht als ihre Resonanzquelle und ihren Resonanzraum hinein, oder anders: so unwiderstehlich Jandl Jandl vorträgt, es bedarf zuletzt, um den Jandl-Ton zu tragen, der Tonträger Schallplatte, Tonband, Jandl-Mund überhaupt nicht, der Träger des Jandl-Tons, der das Jandl-Gedicht trägt, ist das Jandl-Gedicht, und wenn es stürzt und wenn es aufprallt und zerschellt in unseren Schädeln, dann setzt es in ihnen die Jandl-Stimme frei, Lektüre heißt der rätselhafte Vorgang, durch den ein jeder sich die Jandl-Stimme einverleiben und zu einem krachenden, donnernden, heulenden, lachenden Teil seiner selbst machen kann, die Jandl-Stimme, diesen Fleischwolf, der aus dem Materiellen und Immateriellen, das er faschiert (Welt, Körper, Laute, Erinnerungen, Fetzen „abgestürzter, heruntergekommener“ Sprache), sich selbst, den materiell-immateriellen Fleischwolf Stimme hervorbringt, weltfressende, weltzeugende Stimme, mund geborene, mundfressende, mundgebärende Stimme, allen gehörende Jandl-Stimme, die, alle Sprachsteinstatuen mit einer mächtigen Schallwelle vom Kultursockel stürzend und zu Sprachstaub pulverisierend, sich selber ein unsteinernes, aus Kotze und Fleisch und Wörtern geformtes, lebendiges Denkmal schuf, ein „Bildchen“ ihrer selbst, eine Stimmkunstmetapher, ein Vierzeilenidyll, für mich das enormste dieser enormen Gedichte, mit ihm möchte ich schließen, es heißt der „langsam gehende mensch“ und klingt
so also ob die kotze den mund
gefunden nicht hätte, statt dessen
eingesickert wäre in das kinn und die wangen
und in die zunge, die immer ein stück heraussteht
Urs Allemann, Laudatio auf Ernst Jandl, 1990
Dank
weit, sehr weit
ist mir entfernt
Peter Huchel
In seinem namen
erhalte ich einen preis
für mein buch idyllen
mir überreicht in staufen
während ich in wien
im krankenhaus liege
die knochen meiner beine
halten nicht mehr
das gewicht meines körpers aus
ich: ausruhen und vergessen sein
am besten unter einem stein
den niemand hebt, kein kind
das schaut ob würmer und asseln sind
unter dem stein den es im wald
ein wenig anhebt und wegrollt
Er: Hebe den Stein nicht auf,
Den Speicher der Stille.
Unter ihm
Verschläft der Tausendfüßler
Die Zeit.
Ich bedanke mich für diesen Preis.
Ernst Jandl, Danksagung, 1990
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1990
Wie man den Jandl trifft. Eine Begegnung mit Ernst Jandl, eine Erinnerung von Wolf Wondratschek.
Ernst Jandl im Gespräch mit Lisa Fritsch: Ein Weniges ein wenig anders machen.
Eine üble Vorstellung. Ernst Jandl über das harte Los des Lyrikers.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + ÖM + Archiv 1, 2 & 3 + Internet Archive + Kalliope +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + weiteres 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Ernst Jandl: Der Spiegel ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Die Welt ✝ Die Zeit ✝ der Freitag ✝ Der Standart ✝ Schreibheft ✝
graswurzelrevolution
Weitere Nachrufe:
André Bucher: „ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“
Neue Zürcher Zeitung, 13.6.2000
Martin Halter: Der Lyriker als Popstar
Badische Zeitung, 13.6.2000
Norbert Hummelt: Ein aufregend neuer Ton
Kölner Stadt-Anzeiger, 13.6.2000
Karl Riha: „ich werde hinter keinem her sein“
Frankfurter Rundschau, 13.6.2000
Thomas Steinfeld: Aus dem Vers in den Abgrund gepoltert
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2000
Christian Seiler: Avantgarde, direkt in den Volksmund gelegt
Die Weltwoche, 15.6.2000
Klaus Nüchtern: Im Anfang war der Mund
Falter, Wien, 16.6.2000
Bettina Steiner: Him hanfang war das Wort
Die Presse, Wien, 24.6.2000
Jan Kuhlbrodt: Von der Anwesenheit
signaturen-magazin.de
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Karl Riha: „als ich anderschdehn mange lanquidsch“
neue deutsche literatur, Heft 502, Juli/August 1995
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Zum 20. Todestag des Autors:
Gedanken für den Tag: Cornelius Hell über Ernst Jandl
ORF, 3.6.2020
Markus Fischer: „werch ein illtum!“
Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, 28.6.2020
Peter Wawerzinek parodiert Ernst Jandl.
Ernst Jandl – Das Öffnen und Schließen des Mundes – Frankfurter Poetikvorlesungen 1984/1985.
Ernst Jandl … entschuldigen sie wenn ich jandle.


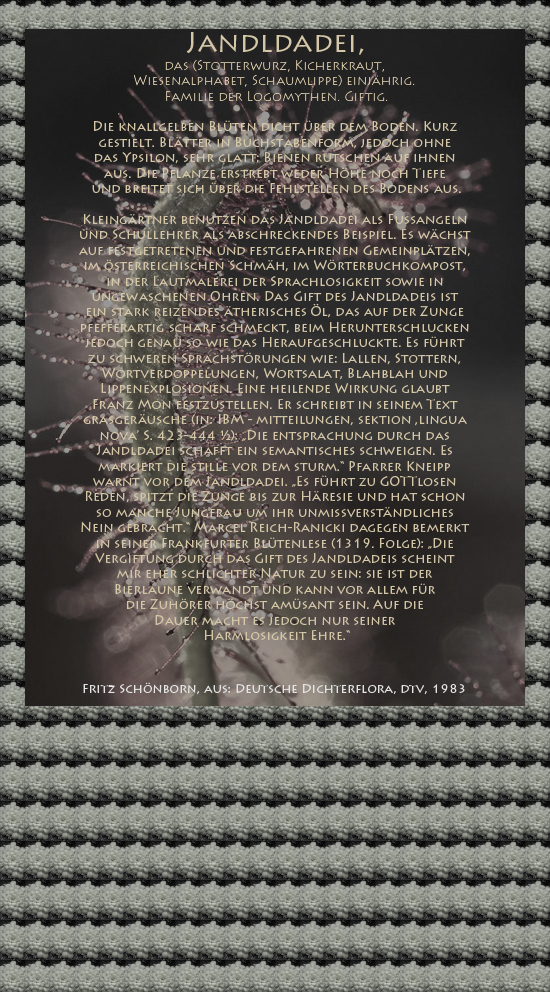












Schreibe einen Kommentar