Peter Waterhouse: Blumen
Das schönste Mädchen im Land heißt:
die Blume des Landes.
Der Liebhaber flattert von einer Halle zur anderen.
Die Taschenlampengöttin
Martin Kubaczek fragt.
Peter Waterhouse antwortet.
Martin Kubaczek: Im Blumen-Gedicht finden sich zwei Zitate aus Kawabatas Erzählung „Oshinjizo“. Welche Beziehung gibt es zu diesem Text?
Peter Waterhouse: Die Grundstruktur von Blumen ist wiederholt im Text über die Knie des Mädchens und den Fuji-Berg. Bei Kawabata wechselt der Blick hin und zurück, hin und zurück, vom Mädchen zum Berg. Und so blickt das Blumen-Gedicht hin und her, von den Hallen zu den Blumen und wieder zu den Hallen.
Kubaczek: Der Begriff Landschaft spielt eine große Rolle. Was bedeutet Landschaft für dich?
Waterhouse: Die Landschaft ist der Ort der Verlustlosigkeit, der Gleichzeitigkeit, der Anwesenheit von allem und Gegensätzen, Paradies.
Kubaczek: Welche Landschaft wird hier beschrieben?
Waterhouse: Das Wiener Becken. Die Landschaft beginnt am südlichen Hang der Stadt und entwickelt sich in Fertigungshallen, Parkplätzen, Werbeplakaten, Baustellen, Schnellstraßen. Es gibt viele Gestrüppflächen und nur selten Kinder. Zigeuner fehlen, Hausierer, Scherenschleifer und Straßenverkäufer.
Kubaczek: Also ein Niemandsland, eine Zone der Ungewißheit?
Waterhouse: Eine Stadtrandebene, die es bei jeder Stadt geben kann, bei jeder großen Stadt, und die meinem Gefühl nach besonders charakteristisch wird in der Dämmerung, weil da ihre Blumen-Qualität deutlich wird – aus den neonstrahlenden Tankstellen und aus den von Scheinwerferbatterien angeleuchteten Hallen und aus großen Schriftzügen, aus Verkehrsströmen, Parkplätzen, Gestrüppflächen, Autofriedhöfen, Containerflächen, ruhigen Naturzonen, Landwirtschaften, Dörfern. Ich würde es als praktische Landschaft beschreiben: eine, wo die entgegengesetzten Dinge gleichzeitig möglich sind, eine, in der es keine übergeordneten oder untergeordneten Strukturen geben könnte.
Kubaczek: Ich habe diese Art von Landschaft immer als schmerzlich empfunden – als Zone ohne Identität, ohne Bestimmung. Du siehst das offenbar in einer ganz anderen Qualität?
Waterhouse: Ein Phänomen, vielleicht als Beispiel: Da habe ich einen sogenannten Häuslbauer besucht. Der hat sich von einem Wiener Architekten ein Metallhaus aufstellen lassen in einer riesigen Einfamilienhaussiedlung; und sein Haus steht am Rand eines Truppenübungsplatzes. Und auf die Frage, warum er sich sein Haus am Rand einer solchen Ödnis, mit vorbeiziehendem Kriegsmaterial gebaut hat, hat er geantwortet: Da kann ihm niemand den Blick verbauen. Das heißt, die geraden Nachbarhäuser empfand er als bedrohlicher als die übenden Soldaten.
Kubaczek: Das Blumen-Gedicht ist in einer Art Montage-Form geschrieben. Es verbindet eigene Erfahrungen und Anschauungen mit Zitaten aus der Literatur, also vermittelter Erfahrung.
Waterhouse: Ich suche, sehr oft im Wörterbuch der Brüder Grimm, nach Hilfe, in literarischen Zitaten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Hilfe zur Wahrnehmungsgeduld und Langsamkeit; Geduld zur Beachtung des Nebensächlichen, Kleinen, Unwichtigen, Geduld für die kleinen Regungen. So kann ich, mit Hilfe der älteren Literatur, meine Erfahrungen präzisieren und meine Sprache präzisieren.
Kubaczek: Eine uns vorangegangene Generation von Schriftstellern mißtraute der Sprache – du läßt dich von ihr leiten, der Text arbeitet mit Assoziationen, Assonanzen, spielt mit dem Lautcharakter der Zeichen.
Waterhouse: Die Sprache ist eine Vertrauensstruktur, weil sie mit ihren Klängen Ähnlichkeiten herbeiführt. Die Sprache reimt immer, verbindet, lockert das Getrennte, das in seiner Identität verharrt.
Kubaczek: Ein Beispiel, das sich schwer übersetzen läßt, wäre das Spiel von Blumen zu Lumen. Was klingt in diesen Worttrennungen an?
Waterhouse: Die Auffassung der Sprache ist eine, die ihre Bezüglichkeit akzeptiert. Der lautliche Korpus ist da vor allem wichtig. Ein Wort wie Lumen steht aus lautlichen Gründen in Verbindung mit Blumen. Und so können fernstehende Dinge in ein Beziehungsspiel eingeführt werden – weil die Worte keine Oppositionsstruktur und keine identitätsstiftende Struktur erzeugen, sondern eine Vergleichsstruktur – also Sprache als Ana-Logos; wobei die Analogien optisch sein können – wie in dem Fall von Blumen („in den Lichtern Blumen zu erkennen“), aber vor allem lautlich, und dann vielleicht auch grammatikalisch.
Violare, das ist Latein, es heißt verletzen, Gewalt ausüben. Viola, das ist auch Latein, das ist eine Blume, ein Veilchen. Der Klang des Wortes Veilchen hier neben den Klang der Verletzung gestellt, vielleicht im Namen von Nemesis, ausgleichender Gerechtigkeit.
Kubaczek: Es kommen im Text aber auch Wörter vor, die man in keinem Wörterbuch findet, wie etwa félibrige.
Waterhouse: Félibrige ist ein Dichterkreis. Im Blumen-Gedicht gibt es die Hoffnung, daß sich alles zu einem – fremdsprachigen, unbekanntsprachigen – Dichterkreis runden läßt. Alle Dinge als Dichter, und die Dichter einander zugehörig wie einst der provenzalische Dichterkreis félibrige (felix – glücklich?).
Kubaczek: Das Spiel mit der mehrfachen Bedeutung – oder Deutbarkeit – von Wörtern verweist auf eine Ebene, auf der die Phänomene der Wirklichkeit verbunden scheinen. Ist das eine ästhetische oder eine emotionelle?
Heißt das: Ich liebe eine Blume?
Ob ich in Blumen verliebt bin?
Ich bin eine Blume.
Waterhouse: Das ergibt sich aus dem Versuch, den Umgang mit Dingen wieder vergleichbar zu machen: technische Produkte zu handhaben wie ein Naturding, einen Stein; Umgang, Handhabung, Berührung der technischen Dinge wieder aus dem Funktionszusammenhang zu lösen.
Kubaczek: Blumen ist für mich ein provokativer Text. Zwei Welten werden hier in Beziehung gesetzt, die sonst als unvergleichbar gelten. In der abendländischen Geschichte konkurrierte seit jeher Technik – die Schöpfung des sich emanzipierenden Menschen – mit der Natur, der Schöpfung eines Gottes.
Waterhouse: Die Hallen stehen in Wiesen. Sie legen in traumhafter Form den Zusammenhang nahe. Sie sind farbenfroh angemalt. Und diese Farbenfreude scheint über die Funktionalität hinauszuschießen. Sie schlagen vor, daß man diesen Konflikt vermitteln kann. Andererseits steht die Technik als das aggressive Potential da – die Autobahn und die gegen jede topographische Gegebenheit hingewürfelten Hallen.
Kubaczek: Besteht nicht aber gerade in einem solchen Zugang zu den Dingen über die ästhetische Form die Gefahr einer Verharmlosung des aggressiven Potentials?
Waterhouse: Die Wucht des Gegenstandes der Technik wird gemildert durch eine Verrückung der Wahrnehmung des Gegenstands. Man dichtet ihm eine Qualität an, um die Aggressivität der Situation zu verheilen. Wenn mich die Scheinwerfergehäuse und Kotflügel berühren würden mit der dem Gegenstand Auto gegebenen Geschwindigkeit, würde das mich auslöschen. Um dieser Auslöschung zu entgegnen, gibt man dem Gegenstand eine sanftere Kraft.
Man sieht eine Landschaft anders, wenn man ein Besitzender ist oder ein Besitzloser. Landschaften anzuschauen als mehr oder weniger Besitzloser ist erschreckend. Ich meine nicht reine Naturlandschaften, sondern besitzdefinierte Landschaften, in denen kein Quadratmeter frei ist.
Es findet ein ununterbrochener Transfer von Geldern statt, die man fast nicht mehr sieht. Es gibt nur noch wenige Punkte, wo jemand ein Münze hinlegt. Das Geld scheint unterirdisch zu fließen. Das Tanken zum Beispiel erfolgt schon ohne Bargeld. Und dieses Gefühl, daß das Geld unterirdisch fließt, kann die Gewißheit erzeugen, daß man auf einer brodelnden Substanz steht; auf einem unheimatlichen Grund.
Kubaczek: Nachdem ich das Blumen-Gedicht gelesen hatte, bin ich einmal durch die Ginza gegangen mit all ihren Neonreklamen am Abend, die blinken und strahlen, und plötzlich habe ich verstanden, was der Satz meint „Wir sind Bienen“: Die Signale als die technischen Blumen, die uns anzuziehen suchen, die uns locken. Sie sind nur für uns gemacht. Plötzlich habe ich mich als der gefühlt, der ins Zentrum all dieser Aufmerksamkeit gesetzt ist, um dessen Wahrnehmung die Zeichen buhlen.
Waterhouse: Als die ersten tschechoslowakischen Besucher in die Shopping-City-Süd kamen, konnten sie nur mit den Augen aufnehmen – als ob sie in die Erinnerung aufnähmen −, ihr Geld war ja nicht wertvoll genug. Sie kamen mit vielen Bussen und sind nur hindurchgegangen. Die Passagen waren voll von Tschechoslowaken, so voll waren die Geschäfte überhaupt noch nie. Das war die große Defunktionalisierung, daß tausende Leute in die Shopping-Mall gehen und dort keinen Gegenstand anrühren und nichts mitnehmen. Der Kaufhausmanager hat das schließlich verboten. Er hat die Zufahrt von Bussen auf das Gelände untersagt. Das war die einzige rechtliche Möglichkeit, die er hatte. Die Leute sind aber trotzdem weiter gekommen. Die Busse haben einfach weiter weg in der Landschaft geparkt, und die Leute sind dann in langen dünnen Kolonnen über die Geleise und durch die Felder herangekommen.
Kubaczek: Wie ist dieser Text entstanden?
Was ist die poetische Vorgehensweise in diesem Text?
Waterhouse: Ein Idyllisierungsimpuls: In diesen starken Phänomenen eine wirklichere und sanftere Kraft noch zu erkennen, und sei es auch nur in der Bezeichnung. Nach einem Sommer von Spaziergängen ist er entstanden als Erinnerungsversuch – etwas anderes zu erinnern, als was die Lichter zu sagen scheinen. Etwas, was ich für grundsätzlich kindlicher halte. Kindlicher und vertraulicher. Erinnerung als Erinnerung an Nichtbrutalität.
Kubaczek: Ist dann das Schreiben ein Tröstungsvorgang?
Waterhouse: Ich würde es eher als Wahrnehmungsversuch bezeichnen. Was ist das Trösten? Wenn ich es buchstäblich übersetze ins Englische – to trust vielleicht −, so wird es Vertrauen. Also ist das Schreiben nicht ein Tröstungsvorgang, sondern ein Vertrauensprozeß. Wie: „Ich gebe mein Wort.“
Kubaczek: Du versuchst in diesem Text nicht aufklärerisch zu desillusionieren – wie böse die Technik sei −, sondern du stellst eine Beziehung her. Zugleich hinterläßt der Text häufig ein schwankendes Gefühl in mir, in welche Richtung deine Wertung geht.
Waterhouse: Es gibt ja mehrere Stimmen im Text. Das Gedicht kommentiert nicht, was zum Beispiel die Frau in ihrer Offizin sagt, sondern berichtet. Ein fiktionaler Bericht ist diese Passage. Und es berichtet vielleicht deswegen, weil es nach einem sinnvollen Satz sucht, den diese Frau sprechen könnte. In dem, was die Direktorin sagt, steckt die Aufforderung, die Urteile außer Kraft zu setzen und der eigenen Moral nicht zu trauen. Ihre Rede ist, die Dinge in eine neue Welt zu bringen.
Kubaczek: Das heißt, in eine modifizierte Form? Demnach wäre Technik hier aufgefaßt als eine Transfiguration der Natur, ein anderer Aggregatzustand (Verdichtungsprozeß) im Wandel zum Neuen?
Waterhouse: In diesem Magma von Lärm, wie er in der Diskoszene beschrieben wird, ist immer noch der Ton der Amsel zu hören. Wie aus dem Urknall tönt hier der Amsellaut. Die auf die Spitze getriebene Technik ist wie ein Zeugungsmoment, eine Technikekstase, aus der ein Qualitätssprung zu gewinnen wäre. Diejenigen, die die saubere Natur wollen, die eindeutige, christliche, ohne Fremdelemente, streben nach einer unheilvollen Konzentrationsnatur. Die Natur, von der aber hier die Rede ist, ist keine, die aus Blut und Boden besteht. Vielleicht eine neue Natur; die Frau aus der Offizin geht nach Hause und empfindet den gekrümmten Fernsehschirm wie einen monochromen Himmel. Bei Hölderlin heißt der Himmel die Halle.
Kubaczek: Technik wird hier gesehen als Fortsetzung, Modifikation und Erweiterung der Natur. Sie wird rückgeführt auf diese. Die Bogenlampen biegen sich in der Form einer Blume über die Autobahn, die Halle wird in der Zeit errichtet, die eine Apfelblüte braucht von der Knospung bis zum Aufblühen. Alles Technische fließt, heißt es einmal, unter Erweiterung eines Heraklit-Zitats.
Waterhouse: Ich denke, das Gedicht schwankt in einer Haltung der Anschauung der Natur als idyllische – der kindliche Blick −, und einer anderen Haltung, die sagt: Die Natur muß schmutzig sein dürfen. Das Zurückschrecken vor dem barbarischen; und in einer zweiten Haltung das Zulassen des Schmutzigen, Barbarischen. Das Anlehnen, die zuhörenden Straßen, wie es einmal heißt, hier wird nicht die Natur beseelt, sondern die Technik. Die technischen Dinge sind wie sekundäre Naturdinge, und die Haltung der Menschen kann der Technik gegenüber wie die von romantischen Dichtern sein. Ein Spaziergänger kann sich hier hindurchbewegen wie ein Romantiker. Heute lehnen wir uns gegen Laternenmasten, nein Bogenlampen, wie jene gegen den Baum.
Am Ende läuft es auf ein Lob der Unentschiedenheit hinaus, rosenfingriges Eos, die Ablehnung des Prometheischen als des Eindeutigkeit schaffenden. Prometheus ist ja der Vorgänger der Technik. Aus der Domäne des Prometheus, der Halle, kommt dann Eos heraus, in Gestalt eines Taschenlampenlichts. Es schlüpft wieder die Göttin aus dem Technischen, eine kleine Taschenlampengöttin.
Vom Gedanken her könnte die Taschenlampengöttin bei Basho stehen, in „Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland“. Er scheint ja auch so etwas Offenes zu suchen: Eos – das ist ja der Zustand, wo noch alles unentschieden ist – die Morgenröte – eine Göttin der Schamhaftigkeit.
Kubaczek: Ich habe ein Zitat von Mircea Eliade in Erinnerung, das mir mit dem Blumen-Text in Zusammenhang zu stehen scheint. Er schreibt hier von einer früheren (und froheren) Auffassung, einer iranischen Mythologie, nach der zu jedem Element in dieser Welt eine Entsprechung in einer zweiten, überirdischen Welt existiert, eine Verdoppelung sozusagen: Zu jeder Wirklichkeit existiert, auf anderer Ebene, sozusagen ein Negativ, eine Matrix. Das heißt, daß nichts verloren gehen kann.
Waterhouse: Das Anerkennen der Transzendenz hat für mich bei Biagio Marin in der Übersetzung seiner Gedichte begonnen. In den Gedichten von Marin gibt es den ständigen Schreibimpuls, daß es den Verlust nicht gibt. Marin hat in der Woche nach dem Tod Pasolinis – der ja in den Blumen auch vorkommt – einen Gedichtzyklus geschrieben – „Der Schrei des zerschmetterten Körpers“; der Titel spricht die Brutalität des Todes an. Aber in diesen dreizehn Gedichten ist der Schrei nirgends zu hören. Sondern in den Gedichten, da ist die friulanische Landschaft, und diese Landschaft mit ihren Bächen und Menschen und Bäumen und Lichtreflexen ist der Beleg für den Nicht-Verlust. Im Ton des Wassers, im Rauschen der Blätter, im Amsellaut ist Pasolini für ihn anwesend. Vielleicht ist der Tote sogar in seiner erleichterten Form anwesend. Er ist verwandelt in seine Hauchform und in Erinnerung.
Kubaczek: Das klingt schon nach deutscher Mystik, nach Vor-Aufklärung.
Waterhouse: Ich glaube, daß zwischen Aufklärung und Nicht-Aufklärung ein Bereich dazwischen liegt. Das Blumen-Gedicht speist sich von beiden Seiten, eine synthetische Haltung, es ist weiter als beide Haltungen, umfaßt sie. Es spricht auch einen Zustand an, wo es keine Weiterentwicklung gibt, sondern Zeitstillstand, wo alle Dinge einander vermittelt sind – multidimensional, nichtlinear.
Kubaczek: Den Absatz zu Pasolinis Tod verstehe ich nicht ganz.
Waterhouse: Der Tod von Pasolini ist in einer Landschaft geschehen, die mit jener des Blumen-Gedichts sehr gut vergleichbar ist. Im Pasolini-Absatz wird der mörderische Charakter der Stadtrand-Landschaft angeschaut. Und es wird nach einem Ja zu diesem gefährlichen dunklen Aspekt der Landschaft gesucht. Nur Ja schützt, Nein schützt nicht.
Peter Waterhouse hat den Gedichtband Blumen
anlässlich seiner einmonatigen Lesereise durch Japan, den japanischen Gepflogenheiten der Freundschaft folgend, als Gastgeschenk mitgebracht. Der Autor spricht das Spannungsverhältnis von Natur und Technik poetisch an: „Die Steinchen im Straßenasphalt blühen. Winzig, quarzig, reflektorisch. Und die blühende Wiese ist eine weitere Reflektorfläche. Die Reflektoren der Straßenmarkierungen sind dem Asphaltglitzer und den Sommerwiesen abgeschaut. Vermehrung der Unruhe der Welt. Alles soll Blume werden, wir immer unruhiger. Die Städte sind Blumenmeere.“
Folio Verlag, Ankündigung, 1993
Grundton und Peripherie: Matsuo Basho, Peter Waterhouse
Auch der Lyriker Peter Waterhouse hat die Kurzform der japanischen Haikudichtung für ein längeres Buchprojekt adaptiert, sich angeeignet, ohne aber silbenzählend vorzugehen, sondern ganz auf Raum und Kürze hin konzentriert in einer Form von Notaten, stichwortartigen Wahrnehmungen, die bewusst auf Schlichtheit hin angelegt sind und fast satzlos eine weitgehend grammatikfreie große Erzählung schreiben, meist aus drei haikuartigen Kurzgedichten, wo so reduktiv verfahren wird, dass sie oft nur aus einem Wort bestehen; aber das Wort gewinnt dadurch Raum, entfaltet sich, strömt über und strahlt aus, was es an Essenz bereithält.
Bei Waterhouse ging es von Anfang an um ein herrschaftsloses Schauen, um einen dezentralen Blick, da war die nicht-hierarchische, zentrumslose Landschaft der Peripherie, das Nicht-Sensationelle und die Versöhnung der Konflikte Technik-Natur, Schuld und Geschichte. Programmtisch lautet der Titel des ersten Erzählbandes Besitzlosigkeit Verzögerung Schweigen Anarchie (1985) – Das sind Begriffe, die sich nur erklären und verstehen lassen aus der Gegensetzung, damit aber auch einer Verhaftung zu jenen Paradigmen, unter denen die mediale Wirklichkeit als schreierisch, apokalyptisch und apodiktisch erfahren wird. Vom englischen Vater, der im Krieg wegen seiner Sprachkenntnisse zum Secret Service, dem vielsprachig Stummen, der die Aussage und Aufklärung verweigert und damit unbewußt eine ganz andere, tiefere Verbindung mit dem Sohn schafft, heißt es in einem frühen Gedicht von Waterhouse „der Vater trifft den Grundton der Welt“.
Dieser Grundton und Grundtonus der Welt ist es, was in der poetischen Sprache im Wie des Sprechens zur Sprache kommt. Es geht um eine Poetik des Staunens, des offenen Schauens, des kindlichen Fragens, der nicht-instrumentellen Neugier, es geht um ein Zurücktreten „vor“ die Lösungsmodelle einer binären Welt, es geht um Selbst-Widerspruch und Nicht-Entscheidung. „Vielleicht war das Schönste für das Kind, gelassen zu werden, nicht den Verliererweg und nicht den Gewinnerweg gehen zu sollen.“ Was aber heißt das anderes, als dem Kind unbegrenztes Vertrauen entgegenzubringen? Ihm jede Art der Entscheidung zuzugestehen, und sei es eine gegen Entscheidung? Hier geht es nicht um angeberische Diskurse, sondern um Heimat- und Besitzlosigkeit, anarchisches Gedankenspiel, heiteren Verzicht auf das triviale Urteil. Das hat Elemente einer romantischen Poesie, ist aber nüchterner und witziger als diese, pragmatisch, was die Entbehrungen betrifft, aber nie von jener Froststarre, in der die Schubert’sche Winterreise klirrt. Die Fremdheit in der Welt wird hier aufgehoben durch das Vertrauen auf das Hinsehen und die Unmittelbarkeit in der Anschauung. Hingabe, Schalk und Schelmisches, Gleichmut sind hier möglich.
Nachts
leuchtet
alles
Und
Atem
ist Licht
Waterhouse setzt minimalistische Elemente in die Fläche, oft bloße Einzelworte, lässt sie so ihre Wirkung entfalten. Das Haiku in seinem Band Prosperos Land ist eher gedanklich als formal aufgefasst, schlichte Reduktion, fast schon winzig und doch so konkret als möglich. Ein Zurücktreten hinter das Sehen prägen diese Texte, die durch die Autonomie ihres Blicks überzeugen, deren Kurzschließungen mit dem entgrenzten Raum immer wieder Thema werden. Im Grund eine kosmische Schaltung, kosmische Verbundenheit, so teilt auch Waterhouse diesen Blick hinaus aus einer prinzipiellen Ausgesetztheit:
Nächsten Nachbars Leiter
lehnt im Birnbaum
Richtung Jupiter
Um das
Kind am Fuhrweg
drehen die Planeten
Diese Ent-Dimensionierung bedeutet letztlich eine Kurzschließung und Aufhebung aller Vektoren, der Schwerkraftverhältnisse und der Vermessungen, sie unterminiert unablässig das naturwissenschaftlich festgefahrene Weltbild, stellt in Frage: salopp, amüsant, ironisch vergnügt oder heiter und zärtlich, erkennt im Kleinsten das Größte, und umgekehrt:
Und im Salat
sind Töne
mondförmiger Salat tönt
(…)
Ins
salatblatt-leise
Universum?
Um in ihrem Schatten den Herbstmond zu betrachten, hat ein japanischer Dichter einst eine Bananenstaude angepflanzt, nach der er sich fortan Basho nennen wird: Ich sitze im Schatten der Blätter der Bananenstaude und liebe ihre bloße Zerbrechlichkeit in Regen und Wind, nur ein Frosch springt da kurz in den Teich:
furu ike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto
Und der Ton schwebt, bricht die Stille. Der Moment ist das, was die größere, quasi stehende Zeit unterbricht, und so ist die Aktion, der Sprung, das, was Zeit enthält, sich den Zeitraum schafft, in dem – und indem – es abläuft: linear, geradlinig. So ist das Leben ein Kürzel, eine Geste, ein zurückgeworfener Arm – und vorbei. Der Teich aber ist jene Tiefenzeit, von der Mircea Eliade sprach: Dass jede zyklische Natur, jedes zyklische Geschichtsmodell, immer wieder an seinen Ursprung zurückkehrt, sich überlappend löscht und neu schreibt, wogegen sich die westliche Zeit- und Geschichtsauffassung linear steigert, von der Schöpfung bis zum Jüngsten Gericht, und dabei wie in einem großen Crescendo anschwillt, sich immer weiter vom Ursprung fortschreibend bis ans prognostizierte Ende der Zeiten. Die Poesie von Peter Waterhouse aber verweigert dieses apokalyptische Diorama, bleibt im Kleinräumig sozialen: Kind, du, Dorf, Feld, Baum, schließt es kurz mit einer kosmischen wie akustischen Dimension:
Aus den
Tönen
des Dorfs wächst ein Baum
Simple Linienführung bei gleichzeitiger Souveränität der Schlichtheit machen die Präzision der Beobachtung sichtbar. Da ist es möglich, dass eine haikuartige Dichtung auch bloß aus vier Silben besteht. Das ist Vertrauen, Nähe, Versöhnung, Leidens-Minderung, das ist quasi-buddhistische Arbeit am Nicht-Sein oder So-Sein, am Mangel und Fehlen von etwas, das vielleicht mit Verzeihen und Vergebung zu tun hat, angesichts der slowenischen, italienischen und kärntner Landschaften, durch die Waterhouse hier geht: Isonzotal, vier Jahre Stellungskrieg, unter anderem mit Giftgaseinsatz durch die Österreicher, hier hat Wittgenstein im Fronteinsatz und der Gefangenschaft jene Tagebücher verfasst, aus denen sein Tractatus hervorgegangen ist. Die andere Landschaft, diesseits der Grenze, beschreibt das Kärntner Jauntal mit seiner Geschichte von Partisanen, Widerstand und Abwehrkampf.
„Und im Weltkrieg
Waren wir damals
Nicht unbewaffnet“ (im Original in Anführungszeichen)
Zum Vergleich ein Haiku von Basho, Referenz auf ein berühmtes Schlachtfelder, wo sich ein Jahrhundert, bevor der Dichter vorüberkam, Tausende hingemetzelt hatten:
Sommergras
Von all den stolzen Kriegern
Die Reste eines Traums
Sitzt, sinnt und überlegt Dodel im Gedicht, so geht, erzählt und probiert Waterhouse; wo bei Dodel ein suchendes Wissen arbeitet, ist es bei Waterhouse ein probierendes Sprechen, das absichtsvoll unwissend formuliert, um zu sehen, was herauskommt dabei, und das ist reichlich komisch, spielt mit Kalkül mit Unsinn, Naivität und abweichenden Formaten, manchmal bis hin zum schlichten Konstatieren – das aber plötzlich zur Gleichung wird (man könnte Gleichungszeichen einfügen: das Dorf ist genau dieses Dorf und steht nur für sich, nicht für irgendeine metaphorische, allgemeine, symbolische, höhere Bedeutung dahinter).
Die Dörfer die Dörfer
Fenster Fenster
Die Gesichter Gesichter
Waterhouse hat das Sehen bei Basho begleitet, er hat darauf in Poetik-Vorlesungen reflektiert, in ihm einen Vertrauten und Vorläufer gefunden, einen, der den Weg wusste und gewandert ist in der „Halle aus Licht“, wie es bei Hölderlin heißt (der Ausdruck findet sich auch in Ponges Notizbuch vom Kiefernwald wieder), in Anspielung an das in der Antike interpretierte Himmelsdach, das Bühne war und Projektionsfläche für eine ganze Mythologie. Bei Waterhouse findet sich die Formulierung vom Himmel als Halle u.a. im Text Blumen, in dem die Peripherie um Wien, eine zerkreuzte und durchschnittene Landschaft mit ihrem Konglomerat aus Bebauung, Industrie und Brachland thematisiert wird. Waterhouse poetisches Schauen blickt hier in das Weite und Nahe, das Vertraute und Unerreichbare, an dem die Gefahr des jederzeitigen Verlusts erst bewusst wird, sieht und erkennt darin, gegen jeden Verlust, noch immer Licht, Stofflichkeit und Gestalt.
Von der Regenzeit
Blieb doch unangetastet
Die Halle des Lichts
Martin Kubaczek, aus: Kleine Lotsen
Blumen blühen auch elektrisch
Es gab früher in Japan eine Methode des Wahrsagens, die „Tsujiura“ genannt wurde: Man stellte sich an eine Straßenkreuzung und versuchte, aus dem ersten Wort, das man dort zufällig hörte, die Zukunft herauszulesen. Dieser Art des Wahrsagens liegt die Annahme zugrunde, daß eine Straßenkreuzung ein magischer Ort sein kann. Auch Straßenkünstler, Wahnsinnige oder Mörder standen gerne an Kreuzungen. Die moderne Statistik zeigt, daß an Kreuzungen eine höhere Kriminalitätsrate registriert wird als an einfachen Straßen. Nicht nur Verbrecher, sondern auch Gespenster bevorzugen Kreuzungen. Das liegt vielleicht daran, daß dort eine Veränderung der Wahrnehmung stattfindet. Eine geradlinig verlaufende Gedankenbewegung wird durch eine Querstraße unterbrochen, und so entsteht ein Raum, in dem plötzlich etwas Unbekanntes sichtbar wird.
„Das blinkende Licht, wo die Straße das Gleis überquert. Diese Blume scheint im Wind bewegt, unstet zwischen Schatten und Lichtreflex.“ Mit diesen Zeilen beginnt der erste Abschnitt von Peter Waterhouses Buch BLUMEN. Ein Licht wird hier wie eine Blume wahrgenommen, und diese Wahrnehmung geschieht an einer Kreuzung. Ein Bahnübergang ist eine heterogene Kreuzung, insofern der Weg der Schienenfahrzeuge sich mit dem der Automobile kreuzt. Erstere haben drei leuchtende Augen, letztere zwei. Zwischen den Fahrzeugen wird eine Art Lichtsprache ausgetauscht: „Das blinkende Licht“ kündigt den Zug an, das Auto reagiert darauf, indem es bremst und dabei auch Lichter produziert: „Die zwei roten Rücklichter des bremsenden Wagens.“ Es folgt erneutes Licht des Zuges: „Viel Licht aus einem vorüberfahrenden Zug“. Die Augen des Textes suchen zuerst nur nach Lichtern, so, wie eine Biene nach strahlenden Blumen sucht. „(…) wir sind Bienen“, heißt es entsprechend im Text, aber hier hat die Blumenjagd etwas außergewöhnliches: Alle Blumen leuchten elektrisch wie zum Beispiel eine „Neonlampe“, ein „Licht über der Eingangstür“, das Licht eines „Zigarettenautomat(en)“, ein „Blinklicht auf dem Kran“ oder „Bogenlampen die Ausfahrtstraße entlang“.
Was sind aber diese Blumen? Um die Frage zu beantworten, ist es hilfreich, einen Blick auf den Umschlag des zweisprachigen Buches zu werfen, dem die Zitate entstammen. Man findet dort das japanische Schriftzeichen für das Wort Blume. Es wird zusammengesetzt aus einem oberen Teil, der „die Pflanzen im allgemeinen bedeutet, und einem unteren Teil, der „Verwandlung“ bedeutet. Der Logik dieses Schriftzeichens folgend, kann man die Blume als den sich stets verwandelnden Teil der Pflanze verstehen. Vom Zustand der Knospe bis zur Reife der Frucht verändert sich ihre Gestalt. Weil sie zwischen wuchernder Schönheit und Vergänglichkeit schwebt und keine ,feste‘ Form hat, wird die Blume auch als Metapher für eine geblümte, umschreibende Sprache verwendet: Durch die Blume sprechen. Man assoziiert diese Redewendung spätestens dann, wenn es im Text heißt: „Durch das Haus sprechen.“ Ist ein Haus keine Blume? „Häuser, Hallen. Langsam werden sie Natur.“ Auch Gebäude können in diesem Buch als ,Blumen‘ betrachtet werden, denn sie verwandeln sich. Sie sind keine störenden Fremdkörper in der Naturlandschaft, sondern ,unreife‘ Elemente der Natur, die sich noch weiterentwickeln werden, bis sie ein Teil der Natur sind.„Alles soll Blume werden, wir immer unruhiger. Die Städte sind Blumenmeere.“ Die Verwandlung der Dinge vollzieht sich vor allem über die Sprache. Die poetische Sprache rückt die Hallen durch einen Vergleich in die Nähe der Natur, so etwa in den Sätzen: „Die Errichtung der Industriehalle geschieht mit der Geschwindigkeit einer Apfelblüte (…)“, „Die Halle ist schön wie die Rundung der Nesselblüte“ und „Warum stehen in der Landschaft die Hallen wie Eßpilze (…)“.
Eine Naturlandschaft ist ein künstliches Produkt. Wenn die Kombination von Blumen, die auf einer Wiese wachsen, mit Bäumen und Gebirgen im Hintergrund uns natürlich und harmonisch vorkommt, so liegt das daran, daß man in einem Gemälde oder in einem Gedicht schon einmal einer ähnlichen Landschaft begegnet ist. Man kann durch Literatur neue Landschaften schaffen und dadurch zum Beispiel eine Halle, die in einer Landschaft steht und deren organischen Körper gewaltsam zu stören scheint, integrieren. Ähnlich verfährt der Text mit den elektrischen Lichtern: Zuerst leuchten sie verlassen und vereinzelt in einer Landschaft. Der Text sammelt sie und verbindet sie miteinander.
Die Bogenlampen aus ihrer Einzelgängerei anschließen an eine Gattung und Familie, aus ihrem Glitzern an ein Licht, aus ihrem Stückwert wieder an ein Medium. ,Du bist ein ganzer Mensch.‘
Hier wird, ausgehend von den Lampen, eine organische Einheit hergestellt, wie ein ,ganzer‘ Mensch, dessen Natur auch ein Kunstprodukt ist. Der Text weist ausdrücklich auf die Gefahr hin, an die Natürlichkeit der ,Natur‘ zu glauben:
Vor siebzig Jahren standen Forderungen in den Zeitungen, die lauteten wie: In die christliche Natur kein jüdisches Haus!
Es gibt im Text einen Blick, der Dinge oder Landschaften staunend anschaut und eine stille Korrespondenz zwischen den Dingen entdeckt. In diesem Blick zeigen sich Berührungspunkte zwischen den elektrischen Lichtern und der Natur:
Zart, noch nicht unterstützt von der Sprache, berührt die Natur die Bogenlampe und die Bogenlampe die Natur.
Einige Korrespondenzen wurden noch nicht von der Sprache unterstützt, andre wiederum zeigen sich erst in der Sprache:
Mit einer Glühbirne in der Hand: ein Gärtner.
Der staunende Blick auf die technischen Gegenstände wird oft dann möglich, wenn deren Funktionen vergessen werden. Zigarettenautomaten, Fahrzeuge, Tankstellen oder Häuser fangen in diesem Vergessen an zu blühen. Die Funktionalisierung eines Gegenstandes hingegen ist von Macht und Besitz gekennzeichnet. Im Text wird von ausländischen Touristen erzählt, die die Halle des Supermarktes besuchen, um sich die Waren anzuschauen und sie zu bewundern. Sie kaufen aber nichts, weil sie nicht genug Geld haben. Immer mehr Besucher betreten die Halle wie ein Museum, wodurch sie defunktionalisiert wird. Der Direktor des Marktes will diese Touristen nicht mehr hereinlassen.
Ein Verbrecher, der Direktor eines Markts, sitzt mit einem Waldgesicht und Brombeeraugen und spricht, daß er sich keine ausländischen Gäste in seiner Halle wünsche, schauende, schauende, bewundernde, aber mit zu wenig Geld in den Händen und Taschen. Will nicht die Biene auch nur den Honig? Die Inländer aber glänzen und leuchten und funkeln wie goldener Honig.
Der Besitzer kämpft gegen die Fremden nicht nur, weil sie ihm keinen wirtschaftlichen Gewinn bringen. Vielmehr fürchtet er sich vor der Zweckentfremdung der Kaufhalle, weil die Kaufhalle seine Identität bestimmt. Wenn die Halle sich in einen Gegenstand der Betrachtung in der Natur verwandeln würde, dann würde auch der Direktor ein Teil der Wiese werden, eine Pflanze unter anderen, Das ist er vielleicht auch schon, denn er hat ein „Waldgesicht“ und „Brombeeraugen“. Diese Darstellung vertuscht nicht etwa die hierarchischen Unterschiede im wirtschaftlichen Machtkampf, aber weder die Halle noch ihr Besitzer werden einfach als Feinde der Natur beschrieben. Die Halle des Supermarktes mitsamt ihrer wirtschaftlichen Funktion kann sich in etwas anderes verwandeln, wenn ihre Besucher sie anders wahrnehmen.
Der Erzähler der BLUMEN fährt mit dem Auto durch Landschaften:
Verkehrstafel für die Autobahn: die Himmeldotterblume. Je schneller das Reisen, desto mehr gilt der Himmel. Bei bedecktem Himmel langsamer, blauem Himmel schneller. „War deine Reise gut und schnell?“ „Ja, sie war ein Vergißmeinnicht. Die ganze Verwandlung, das Viele, das Unterschiedene endlich versöhnt. Immer durch Vergißmeinnichtfelder.“
Nicht etwa die nachdenklichen langsamen Schritte eines Flaneurs, sondern die Geschwindigkeit eines Autofahrers bindet – ähnlich dem Verfahren des Films – die einzelnen Bilder zusammen und macht daraus eine Bewegung, Die Geschwindigkeit hat nichts mit dem schnellen Vergessen des Gewesenen zu tun. Im Gegenteil: die Gedanken fahren immer wieder auch durch Erinnerungen, und der Name einer Blume wiederholt sich dabei: „Vergißmeinnicht“.
Yoko Tawada, in: TEXT + KRITIK – Peter Waterhouse Heft 137, edition text + kritik, Januar 1998.
Die Blumen und das bunte Schnaufpack
– Neue Dichtungen von Peter Waterhouse. –
Peter Waterhouse ist der Erfinder unter den deutschen Dichtern. Die klassischen Merkmale von Gedichten: Rhythmus und Metrum, Klang und Reim, Vers und Strophe findet man bei ihm so gut wie gar nicht. Dafür hingestreute, mit dem Schriftbild spielende, Wörter und Sätze, lustvolle Begriffe und Definitionen und so etwas wie metaphorische Felder und (in der Tendenz: weltumspannende) Großfelder, die alles schlucken, was man sich denken kann oder was einst gedichtet wurde.
So mag es auf den ersten, irritierten Blick scheinen. Aber schon bald hat man seine helle Freude an dem klingenden Reichtum dieser Poesie, die ich, in Anlehnung an Thomas Kuhns Wissenschaftstheorie, eine Paradigmenpoesie nennen möchte, d.h. eine Dichtung, die sich als Muster begreift, die Passage ist zu einer neuen schönen Ordnung, nach dem Motto: So könnte es sein, so sollten wir dichten!
Wie einst Hölderlin, so dichtet Waterhouse mit philosophischem Impetus und aus einer originären Systemlust heraus. Das Sprachgerüst selbst, die Grammatik, das verschobene und probierte Wort- und sogar Buchstabenmaterial, ja noch graphische Signale, soll zum Klingen gebracht werden. „Ich will Erkenntnis anstatt Moral. Deklination anstatt Urteile.“ sagt er, und, mit Anklang an Hölderlin und seine Hälfte des Lebens:
Ich gehe da mit matten Schritten, ordnungslos. Und antworte dem trockenen Klirren der Fahnenmaste mit einer unerwarteten Melodie.
Diese Melodien sind freilich keine Schlager (obwohl sie von großer Schlagfertigkeit sind). Man kann sie nicht gleich mit- und weitersummen und zum Gassenhauer machen. Erst muß man lyrische Konventionen und philosophische Kategorien (wie Innen und Außen, Abstrakt und Konkret) leicht nehmen, dann kommt man mit den Gedichten ingang.
Das ist ganz parterre gemeint. Denn anders als in seinem fulminanten Gedichtbuch passim von 1986 (das zu den epochalen deutschen Gedichtbänden der Moderne gehört) ist das Referenzsystem nun nicht mehr Text, sondern Landschaft. Waterhouse liest und dekliniert die Welt als Landschaft, auch und gerade dort, wo wir sie als Müll von uns weisen. Alles ist inzwischen Landschaft, leuchtende Landschaft. In ihr ist die poetische Erfahrung als Mustererkundung unterwegs. „Ich blicke in eine Landschaft der Sieger. Aber ich bin gekleidet wie eine stumme Blume.“
Um nun in solcher Siegerlandschaft nicht klagend unterzugehen, hat sich Waterhouse, in Zitaten, Gesten und zartem Rollenspiel, Hilfe von Yasunari Kawabatas Sensualismus geholt, der lehrt, dankbar wahrzunehmen, zu akzeptieren. Denn Sprache, und erst recht: der heute Sprechende, ist in einem Dilemma – eigentlich in genau dem Dilemma, in dem sich schon Gott, der Erfinder der ersten Ordnung, befand.
Wer das erste Wort sagt hat alles verloren.
Wer ist Gott? Gott hat alles verloren. Gott hat die Welt verloren. Darum ist er.
Verloren ohne Rettung, der Titel spricht es, wohl auch in Erinnerung an Hölderlins Rettendes, in der übertreibenden Doppelung („Das Übertreibungskünstlerische überall und das Übertreibungsmenschliche“) an, aber (noch) nicht aus, scheint der einzelne (nur) in der Welt-Landschaft zu sein. Waterhouse ist dem als Spaziergänger, und gerade in den gefährlich leuchtenden Markt- und Müllwiesen, nachgegangen und hat Sprache, viel Sprache daraus gemacht („Ach, ich überschütte Sie.“).
Wie Jean-Marie Straub in seinen Filmen läßt er den Leser durch eine schmerzhafte Lehr-Entfremdung gehen. Opakes wird mit Formen der Rede und der Szene in endlose Beisetzungen und Gleichungen gesetzt – und doch ist dies nicht zum Verzagen oder Abschreiben (des Autors), denn in der (treu aus der Landschaft übersetzten) Welt aus Füllseln kommen Seite für Seite großartige Funde und Findungen vor: Wortprägungen, Sätze und Passagen reiner Poesie. So wenn Waterhouse die Jogger unterwegs „das bunte Schnaufpack“ nennt oder diesen Jahrhundert-Dialog aufführt:
g: Sind die Armenküchen noch immer gut?
h: Hervorragend.
Fast so viele Armenküchen wie Moscheen.
Das alles ist, in einer Art Streifkunst, gleichrangige Rekapitulation in angebrochenen Formen, „subobskur“. Gerade nicht auf den wohlfeilen Nenner der Kommunikation gebracht. Denn: „Gelobt sei eine Gemeinschaft ohne Diskurs“. Gleichwohl unentschieden und, das letzte Wort: „Beilagen“ verrät es, von der Neigung versehrt, selbst abzuwerten. „Das Bessere“ (als der Diskurs) wäre „:Das Singen“. Nicht nur aus dem Wust als Singen aufzutauchen, sondern das Singen und nur das Singen zu sein.
Dies Singen ist Waterhouse in dem kleinen Bändchen Blumen (auf einem Niveau mit passim) gelungen. Hier ist die Kunst nicht hoffnungslos unverhofft, sondern neu gefunden, gestiftet. Ausgehend von dem Zitat „Wir sind Bienen.“ werden die Objekte des Wir zu „Blumen“: schöne Ziele, die wir für unsern „Honig“ nutzen. In einem umspannenden metaphorischen Feld werden Impressionistisch-sensualistisch Sätze nicht nur möglich, sondern notwendig, die alte kategoriale Grenzen ignorieren und zu Lockmitteln zu den „Blumen“ werden, Partituren für Erlebnis- und Zeiträume bieten. „Mit einer Glühbirne in der Hand: ein Gärtner.“ „Vermehrung der Unruhe der Welt. Alles soll Blume werden, wir immer unruhiger. Die Städte sind Blumenmeere.“
Im Medium der Metapher ist Altes wie Neues möglich. Die Welt wird Teil des metaphorischen Spektrums, bis sie in knappsten Notizen erfaßt und als Dichtung erfüllt ist. „Durch das Haus sprechen“: „dir blüht etwas“, gar in Kalauern der Grenze „violare, volare, viola“ „Lumen. Blumen“. Eos, die Göttin der Morgenröte, verbindet sich einer Taschenlampengöttin. „Du hast mich eingeschaltet, ich bin Priester.“
Die Gedicht-Sätze sind gleich ins Japanische übertragen (ein Gruß an Kawabata und die Blumenschrift?); das anschließende Gespräch mit Martin Kubaczek ist mit einem japanischen Glossar zu Begriffen versehen, die Waterhouse gebraucht – und die seine produktive Theorie-Lust signalisiert. Der letzte Satz lautet: „Nur Ja schützt, Nein schützt nicht.“ Und diese Formel wird durch die nachgetragenen, unübersetzten Verse gestützt:
Rotkehlchen fliegt
Wienerwald kippt
Ich bin
Das ist stark, fast ein bißchen zu stark und braucht also, wie das für diese Blumen abgesaugte Beilagen-Werk, ein Weiterdichten.
Hugo Dittberner, die horen, Heft 173, 1. Quartal 1994
Blumen
Im Gedichtzyklus Blumen, legt Peter Waterhouse wieder einmal die Honigrute aus, damit darauf die falschen Lesererwartungen kleben bleiben. – Bei den Blumen geht es um eine Landschaft südlich von Wien, in der die Stadt aufhört, aber die Natur noch nicht endgültig zum Zuge gekommen ist.
Wir alle kennen jene Landschaften, in denen die Jugend-Banden im realistischen Film Krieg spielen. Die Sträucher geben erste Tarnung im gerade noch nicht asphaltierten Land, aber anderseits wächst das Gras über die letzten Asphaltflecken einer früheren Nutzung.
Peter Waterhouse stellt nun diese Landschaft auf den Kopf, nichts läßt sich berühren. Wenn man gerade schaut, verschwinden die Dinge, so daß man sie schräg von unten betrachten muß.
Ein Kran blinkt, aber es fehlt ihm der akustische Ausdruck. Der Tacho eines Taxis flunkert, aber eigentlich ist das Ticken der abgefahrenen Zeit stärker. In einer Fabrik huschen gelbe Arbeitsmäntel herum, die sich aber als Dotterblumen herausstellen.
Plötzlich wird die Landschaft zum Sterbeplatz Pier Paolo Pasolinis:
Die Ermordung Pier Paolo Pasolinis, vor der Stadt, auf flachem Land, einem einfachen Fußballfeld, unweit dem Meer, in einer Landschaft der Sträucher und Pinien, Hütten und Hochhäuser, Schnellstraßen, indem jemand mit dem Automobil über den Körper fuhr und einschlug auf den Körper mit Holz (…). ( S. 24)
Wie in einer ausweglosen Schachpartie werden die Elemente des Brachlands zueinander in eine letzte Beziehung gesetzt, und gibt es ein besser genutztes Schachbrett als jene Landschaft zwischen Stadt und Land?
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. I, 1982–1998, Sisyphus, 2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Charitas Jenny-Ebeling: „Spiel dich, Proteus“
Neue Zürcher Zeitung, 12.1.1993
Gm: Gastgeschenk
FF, 23.9.1993
Hugo Dittberner: Landschaft der Sieger
Frankfurter Rundschau, 6.10.1993
Michael Braun: Die schöne Blume Zigarettenautomat
Die Zeit, 8.10.1993
Brigitte Espenlaub: Der Dinge Trost oder: „Nur Ja schützt, Nein schützt nicht“
Das Goetheanum, 10.10.1993
Nina Schröder: Blumen für Japan
Südtiroler Profil, 18.10.1993
Cornelia Staudacher: Es kraut & greuselt. Lesung von Oskar Pastior, Peter Waterhouse und Kito Lorenc im Orplid
Der Tagesspiegel, 14.4.1994
A(nton) th(uswaldner): Unscheinbar verborgene Welt. Internationale Ferienkurse: Peter Waterhouse las Prosa
Salzburger Nachrichten, 11.8.1994
Benedikt Erenz: Blühende Tankstellen. Gewerbegebiete – kein Thema für die Literatur?
Die Zeit, 6.10.1995
Mario Fitterer: Peter Waterhouse: „Blumen“
Vierteljahresschrift der Deutschen Haiku-Gesellschaft e.V. 10, Heft 36, 1997
Ilma Rakusa: Laudatio anlässlich der Verleihung des Erich Fried Preises an Peter Waterhouse am Sonntag, 25. November 2007, im Literaturhaus in Wien.
Literarische Selbstgespräche … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer – Von und mit Peter Waterhouse
PETER WATERHOUSE
Rotation
dachrot wellenrot rote ampeln
an roter abzweigung rotgesichtige blühen
rotschnee im rotdorf rothände in der faust
rotregen rotmark rotlippe rotbuch rot dorf
rotlicht rothaus rottod rotall
Peter Wawerzinek
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA + IMAGO +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.


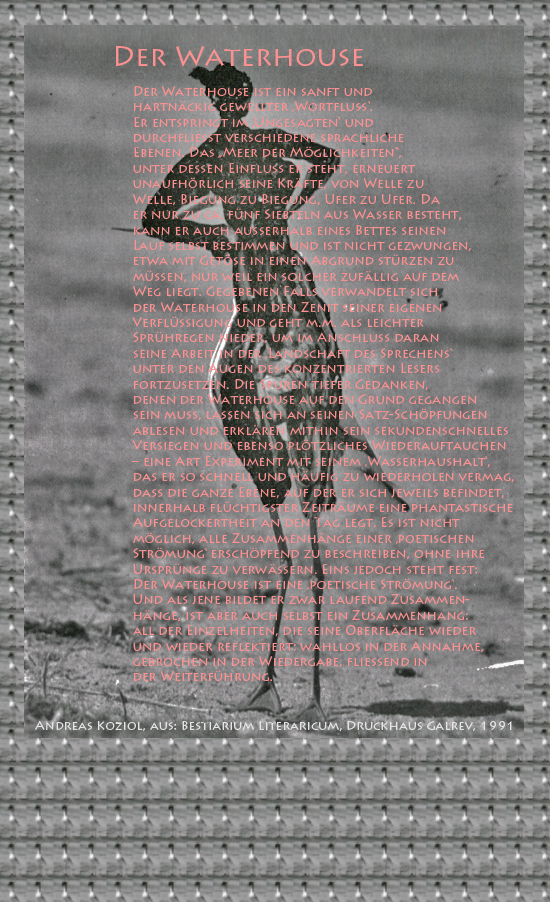













Schreibe einen Kommentar