Peter Waterhouse: passim
DIE EIGENE QUERE
Es ist da. Es ist da, indem du fortgehst. Man
hat einen Namen. Das muß jetzt gesagt werden.
aaaaaFliegen
die Aeroplane. Das Herz schlägt
durch den Himmel. Im Auge der Planet
aszendiert. Die fernsten Bäume sind
gute Nachbarn. Der Kuß
gehört zu einem Mond. Es ist da. Schwarz
schwimmt durch schwarz. Eine Sonne, die wir lieben
hat eine gute Hand und streicht durch das Haar. Die Fahrgäste
winken unaufhörlich, ein Muster gerufener Namen
ist schön entstanden. Ein fröhlicher Schatten
ist bei den Schatten. Die langen Flüsse
sind kurz an jeder Stelle. Wir sind Vögel
wenn die Vögel fliegen. Man wird sich wohl längst vergessen haben.
Es ist da. Die Schuhe sind in ihrer Weise rot. Der Hals
ist ein sanfter Turm Es gibt keine Hoffnung. Die Tage
sind außergewöhnlich hell. Die meisten Zungen
leben in anderen Mündern. Die Türen schwingen, dagegen
schwingt das feste als Mauer. Es gibt einen langsamen Rhythmus. Ein Name
ist ein Sturm der anderen Namen. Die Feuerwehrschläuche
warten auf Wasser für bessere Feuer. Manches wird Kieselstein
manches hat seine tropische Kälte, manches sind wir. Wir grüßen
schnell und sind auch sprachlos. Die Pole rutschen
eine Fläche von Polen fährt in die eigene Quere. Nichts kommt
die Augen sind blau, die Tische stehen umgekehrt zur Welt. Ja
ein australisches Mausloch ist die Hauptstadt der Menschen. Die Sessel
sind gute Pferde. Der verjagte Gedanke
trabt aufrecht wieder vorüber, das ganze zieht quasi mit
wir fallen als große Kleinigkeiten zurück. So weit
ist alles gekommen, es sind hohe Himmel
wo keine hohen Himmel sind. Als Fortgang
ist da, wie wir brechen oder ausbrechen. Indem du fortgehst
brichst du aus oder ein, dagegen
schwingen die Flächen. Es gibt da viele Pendel. Darüber
stehen keine Uhren. Etwas schief ist jedes Teil geworden. Zum Beispiel
meine Nase ist schief. Genauso
laufen querfeldein die Pferde. Die gelben Blumen
haben grüne Körper. Es ist da. Man hat einen schiefen Namen.
Der Planet legt sich schräg. Die Augen
sind manchmal sehr traurig. Die Liebe zu dir
verschweige ich nicht.
Der Name der Sprache
„Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“, versichert Gertrude Stein. Und wir fügen hinzu: Ein Name ist ein Name ist ein Name. Aber in den Gedichten des 1956 in Berlin geborenen, in Wien lebenden Peter Waterhouse ist nicht der Name der Rose gefragt, sondern „Der Name der Sprache“. Dieser programmatisch klingende Titel eines Gedichts könnte darauf hinweisen, daß Waterhouse nicht mehr den alten Nominalismusstreit aufwärmen und erneut fragen will, ob die Namen motiviert sind oder arbiträr; ihm kommt es offenbar auf eine Frage an, die noch dahinter liegt, die nicht mehr das Verhältnis der Dinge zu ihren Namen thematisiert, sondern nur noch die Namen beziehungsweise die Sprache selbst. „Glauben Sie mir das Wort Blume?“, fragt er an einer Stelle, und wir müssen leider antworten: „Nein, Ihnen nicht. Wir haben nicht den Eindruck, daß mit Ihrem Programm viel erkannt werden könnte.“ „Der Name der Sprache heißt: Abwesenheit. Man sagt zum Beispiel / in diesem Namen: Tisch. Der Tisch ist ein hartes Gebilde / vor uns. Wir sind ein hartes Gebilde / vor dem Tisch. Wir wandeln uns ab und / nennen uns Tischler.“ Und wir fahren fort: Das Gehirn ist ein weiches Gebilde in unserem Kopf. / Wir können froh sein, wenn wir keine Anwandlung bekommen und uns „Heidegger“ nennen. Nein, Waterhouse und die Sprache von Meßkirch passen nicht zusammen. Aber der plötzlich auftauchende Verdacht, daß uns hier ein Satiriker, der von Heidegger bis Wittgenstein alles Wichtige über Sprache gelesen hat, mit lyrischen Philosophie-Parodien leimen will, ist angesichts des taubenblauen, postmodernen Umschlags von Klaus Detjen, der höchste Seriosität verspricht, schnell wieder vom Tisch. Wir glauben vielmehr, daß sich hier ein „echter Lyriker“, nämlich einer, dem es in seinem Dichten um dieses Dichten selbst geht, verstiegen hat. Wir glauben, daß die Erkenntnisse der Sprachphilosophie (und bezüglich Heidegger: der Existentialontologie) unseren Autor behindern, ihn nicht zu sich selbst kommen lassen. Peter Waterhouse hat jene Erkenntnisse, die allen nahezulegen sind, denen Sprache mehr bedeutet als nur ein bloßes Vehikel zur Vermittlung von Weltentwürfen, nicht positiv umzusetzen vermocht, sondern die Wörter vielfach unvermittelt stehen gelassen, so daß manche Texte „ein wenig planlos“ und andere sinnlos erscheinen:
Nachtbar.
Nachbar. Meine Glatze. Meine Katze. Pfote. Das Pfortenpferd.
Sachertorte. Sachertote.
Diese Spracharbeit beläßt das „Gedicht im Materialstadium“, „das wozu-Sprache“ bleibt unbeantwortet, der Erkenntnisprozeß führt nicht über das längst Bekannte hinaus und läßt das Können des jungen Autors nicht erkennen. So darf auch diese Rezension nur als erste Reaktion auf seine Gedichte gelesen werden; es kann nicht darum gehen, Peter Waterhouse jegliche Begabung überhaupt abzusprechen.
Lutz Hagestedt, Süddeutsche Zeitung, 21./22.2.1987
Guten Tag: Gedicht
(…)
Peter Waterhouse
„Passim“ (lat.): „zerstreut, rings umher, überallhin“, aber auch „durcheinander, ohne Unterschied.“ Passim ist der Titel des zweiten Gedichtbandes von Peter Waterhouse, der 1956 in Berlin geboren wurde, in Wien und Los Angeles studierte, eine Dissertation über Paul Celan schrieb und gegenwärtig in Wien lebt. Sein Gedichtband teilt davon nichts mit, die üblichen Klappentextangaben fehlen, Biographisches bleibt ausgespart – auch im lyrischen Text: „Ein nüchterner Selbstrest trägt Krawatte“, heißt es. Oder:
Wer muß ich unter dem Pullover sein, der jetzt blau ist?
Und bei der scherzhaften Frage „Warum macht die Sonne meine Nase rot?“ verweist ein Sternchen auf die Anmerkung: „* Autobiographisch“ – selbst das vermutlich eine falsche Spur. Was besagt schon eine gerötete Nase?
Daß ein junger Lyriker so ostentativ auf die Ausbeutung seines biographischen Fundus verzichtet, ist für sich schon bemerkenswert genug. Aber das heißt nicht, daß Waterhouse so etwas wie persönlicher Ton und jugendlicher Charme fehlten. Er gibt sich auf freilich vertrackte Weise kommunikativ, munter, aufgeräumt. Er ist immerhin derjenige, der sein Metier apostrophiert „Guten Tag Kunst“ und der sich und seinesgleichen als „begrüßenswerte Künstler des Spaziergangs“ bezeichnet:
Spaziergang als Himmelskunst.
Ein junger Heißenbüttel, aber mit der Attitüde eines methodischen Luftikus. Seine Exerzitien machen ihm augenscheinlich Spaß, und der trägt den Leser auch über die Strecken methodischen Leerlaufs hinweg, die bei Waterhouse nicht fehlen.
„Wo sind wir jetzt?“ fragt der erste Teil von Passim. Hier gibt der Autor seine Prämissen bekannt. „Der Name der Sprache heißt: Abwesenheit!“, „Die Sprache heißt heute: Keiner“ – aber auch:
Alles klingt schwierig
es ist alles nicht schwierig.
Also Negativität und Anonymität als Voraussetzungen des Sprachspiels. Es ist tatsächlich Spiel und kein stures Exerzieren. Waterhouse verzichtet auf Dogmatisches, auf eindeutige Thesen. Er liebt Zweifel, Ambivalenz; jene „Übergange“, die „im Grüßen“ sichtbar bleiben:
Es gibt nur Übergänge, die gute Welt ist ein einziges Sagen:
Guten Tag.
Die gute Welt, sagt er; ist die Welt gut? Waterhouse hat Wittgensteins Sprachskepsis in eine Heiterkeit à la Arp gewendet. Die „gute Welt“ kann er freilich nur sagen, weil soviel Welt draußen bleibt: „Wollte ich etwas sagen? Nein.“
Dennoch entscheiden nicht poetologische Prämissen über die Qualität von Texten, sondern ihre Komplexität, die alle Vorgaben übersteigt. Oder mit einem von Waterhouse’ Titeln: „Konstruktives Verfahren und süße Bestimmung“, der Charme der Fügungen und gleitenden Assoziationen, die Evokation heiterer irrealer Welten. Die Texte sind künstliche Objekte, besser: künstliche Abläufe, mit all ihren Tricks und Überraschungen. Waterhouse beginnt gern mit Setzungen, denen man ihre Beliebigkeit, ihren Charakter als Gag durchaus ansieht:
Wir beginnen manchmal so: Sessel.
Sessel.
Bald macht der Beginn einen weiten Sprung, der Sprung lautet wörtlich:
Bitte nehmen Sie Platz auf dem Sessel.
Das ist auch der Platz des Lesers, freilich ein unsicherer, nicht geheuerer. Der Anfang wird hin und her gewendet, befragt, fallengelassen und wieder aufgenommen. Der anfangs gesetzte Wort-Gegenstand wird verwandelt oder in seiner Identität so lang apostrophiert, bis es zu emphatischen Tautologien kommt. „Im Grunde / ist jetzt alles gesagt“, heißt es einmal ziemlich zu Beginn; und natürlich demonstriert Waterhouse im Folgenden, was alles noch gesagt werden kann:
mit so wenig ist noch keiner ausgekommen, die Preisrede ist unser bestes
alles wird mitgerissen, wir sind hingerissen, das geht so fort.
Die Texte führen selber ihre Verfahrensweise vor, kommentieren sie, ja sind manchmal nur Kommentare zu Gedichten, die in den Texten stecken. Gedichte über Gedichte – oder mit dem Wort Oskar Pastiors „Gedichtgedichte“.
Die lyrischen Texte in Passim sind worthaltig, nicht welthaltig. Celan hatte einst geschrieben:
Blume – ein Blindenwort.
Waterhouse respondiert:
Glauben Sie mir das Wort Blume?
Das Wort glauben wir ihm wohl, auch seine anderen schön und witzig verstreuten Wörter und künstlichen Sätze.
Nur an wenigen Stellen, so scheint mir, tritt Waterhouse für einen Moment aus seiner linguistischen Innenwelt heraus, geht er, so der Titel eines Gedichts, „Ins Innere hinaus“:
Die Welt öffnet vielleicht die Augen.
Welche Augen? Die geliebten.
Ich respektiere, daß Waterhouse vor dem Affirmativen zurückscheut, daß er – noch – beim Disparaten der Wörter verharrt. „Passim“ heißt ja auch „durcheinander, ohne Unterschied“. Er hat noch einiges vor sich: das Unterscheiden und das Zusammensehen:
Denk mich zusammen
du Sagmirein, Schweigenhaus Stadtpartikel, Erschießungstrupp Tür
Nichtgesagtstraßekeinwort, Hierfließtmeingutersinn
komm du Narr.
Harald Hartung, Merkur, Heft 456, Februar 1987
Peter Waterhouse: passim
Der zweite Gedichtband des in Wien lebenden Peter Waterhouse bestätigt den außerordentlichen Rang dieses Poeten, dessen Gedichte sich sowohl als „liebevolle Gespräche“ wie als „ein Toben um Sprache“ charakterisieren lassen. Es ist eine Poesie der Übergänge, der stärkste Widerspruch zum Typus des ,statischen Gedichts‘, der sich denken läßt. Nach Benn, der sich für eine monologische Lyrik aussprach, soll das Gedicht für den „Rückzug auf Maß und Form“ einstehen, für die gelungene Balance zwischen Innenwelt und Außenwelt. Bei Waterhouse wird die gestört, wird sie als Selbstbetrug wie als Langeweile erfahrbar:
Ein Rutschen mit uns, an uns
wird gerutscht; wir ja, wir nein
Nicht nur gehen seine Gedichte von einem Subjektbegriff aus, der nicht mehr der selbstgewisse der klassischen Philosophie (und Dichtung) ist, sondern der die Erfahrung der sprachlichen Vermittlung (Sozialisation) des Subjekts mitenthält; auch die Erkenntnisproblematik ist anspruchsvoller gedacht, als daß ein traditioneller prädikativer Gestus noch durchkäme – Namen und Dinge vertauschen sich, werden ein Reigen, in den man sich einfügen, aus dem man ausscheiden, den man stören oder ablenken kann. Das Gedicht „Der Name der Sprache“ beginnt:
Der Name der Sprache heißt: Abwesenheit. Man sagt zum Beispiel
in diesem Namen: Tisch. Der Tisch ist ein hartes Gebilde
vor uns. Wir sind ein hartes Gebilde
vor dem Tisch. Wir wandeln uns ab und
nennen uns Tischler. Die Tischler (in Zusammenhang mit uns)
sagen: Wir Tischler. Oder: Wir Gesesselten.
Wir will hier heißen: Wir gibt es nicht, wir
ist fern, wir als nicht.
Was in der Lyriktheorie von Julia Kristeva (Revolution der poetischen Sprache, dt. Frankfurt/Suhrkamp) noch mit einer gewissen Angstspannung besetzt ist, die Verstörung der (gesellschaftlich gesetzten) Ordnung des Symbols durch die ,unordentliche‘ Sprache der Lyrik, löst sich in den Gedichten von Peter Waterhouse zu heiter-überraschendem Spiel mit frappierenden Pointen und freigebigem Überschuß. Man nehme einen solchen unausdenkbaren Gedichtanfang:
In den Straßen der Stadt spiegelt sich unsere afrikanische Haut: Wir
sind das weiße Wetter in anderen Augen
Die Motive werden stets wieder aufgenommen, hier also schwarz/weiß. Im Fortgang des Gedichts heißt es dann: „Wir sind die weißen Schwarzen / morgen“, oder auch: „Das halbe Zebra der Zukunft“. Im selben Gedicht versichert uns Waterhouse:
Alles klingt schwierig
es ist alles nicht schwierig
Und recht hat er.
Im ersten Gedichtband, Menz (Graz: Droschl Verlag 1984, 2. Auflage 1986), hatte es geheißen:
Die Vergleiche sind durchsichtig geworden. Wir nicht
So heißt es hier:
Im Grundlosen liegt der Vergleich
Dichterisches Vergleichen setzt traditionell abgrenzbare Realitätsbereiche voraus, der Poet ordnet sie kraft seines Wortes einander zu, was auf den Bild-Typ der Metapher führt, die vom fast allmächtigen Subjekt zeugt, das sich in dieser produktiven Leistung seiner vergewissert. Wenn nun aber Subjekt und Sprache so ineinander verschränkt gedacht werden, daß keines von beiden, jedenfalls nicht das Subjekt als vorgängig zu isolieren ist, ergeben sich jene künstlichen Übergänge, jenes Shiften der Wortbilder, wodurch sich die Lyrik von Peter Waterhouse hervorhebt. Ein Gedicht mit dem anspruchsvollen Titel „Die Erweiterung der Geschichte“ beginnt mit der Überlegung vom Obstgarten, der Erfahrung des Süßen, dem Reiz des Zögerns, des Verzögerns, dann heißt es:
O, wie schön ist es
sprachlos den Sommer in den Herbst
zu schieben
Die folgenden Zeilen greifen diese Bewegung als Wort auf und tragen die Gegen-Erfahrung nach:
Wie schieben wir weiter? Wer schiebt uns?
Sprachmuster, das wissen wir heute aus den methodologischen Reflexionen der Historiographie, verfügen Wirklichkeit und Erfahrung; sie aufzuschreiben und ,flottieren‘ zu lassen, heißt denn auch, unsere Erfahrungsmöglichkeiten neu zu begründen, jedenfalls zu erweitern, wie das die Gedichte von Peter Waterhouse, jedes für sich, auf sehr besondere Weise leisten. Das zitierte Gedicht endet:
Einer sagt: Uns schiebt die Nacht in den Tag. Leider
schieben die Tage auch. Die Bewegung heißt bald Herbst
es kommen senkrecht die süßen Zeichen herab: Wir
beißen hinein. In diesem Augenblick macht
die süße Geschichte einen sprachlosen Schritt. Der Schritt heißt:
Kein Schritt. Wir einigen uns auf den Zusammenhang und
nennen ihn zögernd: Obstgarten. Wir schweigen draußen.
Das Innere heißt: Stiller Wurm
in der Nacht eines Apfels.
Wir warten. Wir warten den Wurm ab. Danach lautet der Garten
Feld, Wald, Tal, Welt. In den Zentren
bleiben die Würmer zurück. Der Wartende denkt:
Es könnte werden die Erweiterung der Geschichte.
Alexander von Bormann, Deutsche Bücher, Heft 1, 1988
passim
Die Gedichte in passim bestehen aus einfachen, grammatisch korrekten Prosasätzen, die wieder sehr kurz und parataktisch gefügt sind. Auch Ein-Wort-Sätze und Klammern, das monologische ,Fragen‘ und ,Sagen‘ sowie die Wortspiele sind weiterhin häufig. Die Aussagen sind zum Teil durch einen Begriff miteinander verbunden, zum Teil an einem unsichtbaren ,roten‘ Faden aufgefädelt. Die Freude des Sprechenden an überraschenden Kombinationen und an der Selbstironie ist spürbar und wieder kollidiert ein surrealistisch klingender Ton mit der Lehrsatzhaftigkeit von Äußerungen, die aus einem Handbuch für Logik stammen könnten: „Ein Kilo Äpfel ist so orangenfrei“; „Die Nacht ist ein Tag ohne zwingenden Grund für Licht“; „Die Mütze ist eine Hose für den Kopf“1 Hinter den Sätzen scheint auch Ernst auf:
In der Umarmung sind wir immer noch zwei2
Das „Hinübergeraten“ aus den letzten Gedichten des Bandes MENZ steigert sich in passim: In diesem Band ist alles in einem Wechsel begriffen, nichts ist stabil – „nichts hält zusammen / passim muß ich sagen“.3 Der Bandtitel, „passim“, bedeutet soviel wie ringsumher, überallhin, zerstreut, durcheinander, ohne Unterschied, allenthalben; in Bezug auf ein Buch bedeutet ,passim‘: an verschiedenen Stellen im angegebenen Werk, durch das ganze Buch hindurch. Der Titel wird dem Band in seinen beiden Bedeutungen gerecht. Dieselben Motive, Bilder und Wörter werden in zahlreichen Gedichten aufgegriffen und es ergeben sich Korrespondenzen zwischen den meisten Texten. Der haltlose, zerstreute Charakter der vielfältigen Bezüge ist ebenfalls ein Merkmal. ,Dinge‘, Gedanken und Wörter werden gewendet und gehen in andere über. Zugleich wird dies in den Gedichten reflektiert; dort zeigen etliche Begriffe eine Positionsveränderung an. Wie das Taumeln der Kirschenpflücker in MENZ betonen diese Begriffe, dass es gesicherte Standpunkte nicht geben kann. Solche Wörter sind: „Rutschen“, „Gleiten“, „Schieben“ und „Verschiebung“,4 „Rotation“, „Permutation“, „Verwandlung“, „Übergang“, „Rollen“, „Springen“ oder „Sprung“,5 „Schwung“, „Drehen“ oder „Strömen“.6 „Stillstand ist auch ein Taumel“, heißt es gar.7/footnote] Diese Begriffe beziehen sich auf räumliche Vorgänge; sie haben aber auch einen rein sprachreferenziellen Bezug, wie das Eingangsgedicht des Bandes zeigt:
Wo sind wir jetzt?
O ja: O nein. Warum nein? Warum nein? (Ein Rutschen mit uns, an uns
wird gerutscht; wir ja, wir nein. Man hält sich oftmals
ungezählt auf zwischen Bäumen. Bewegung zwischen den Bäumen:
Es sind wir, mit Bewegungsrichtung. Weit und breit
kein Baum: Wo sind wir jetzt? Die Bäume erinnern sich:
Wir waren einmal Menschen. Jetzt fächern wir uns schweigend hinauf oder
verhalten im Winter uns schwarz. Der Winter ist weiß
wir nicht. Wir sind der Winter. Alles
ist alles.
Ein Käfer öffnet den Mund und ißt: Alles. Minimales knackendes Geräusch
die Welt knistert winzig. Was macht die Welt in solchem Mund?
Sie macht alles, man weiß es nicht. Der fröhliche Käfer denkt:
Ich genieße einen Ausschnitt, der Ausschnitt enthält alles. Käfer
denken nicht. O ja, o nein. Warum nein? Wo
sind wir jetzt?
Kein Käfer öffnet keinen Mund: Nichts. Großes Knacken
riesige Welt. Es gibt noch Zwischenräume, es gibt
noch keine Zwischenräume, es gibt keine Zwischenräume, noch uns
noch nicht uns, nicht uns. Liebevolle Gespräche lassen sich
führen. Der Dialog lautet:
Wo bist du? Wo bist du?
Wo bist du jetzt?
Baum. Baum.
Noch. Noch nicht. Nicht.) Es ist ein
Toben um Sprache.[footnote]passim, S. 7[/footnote]
„O ja: O nein. Warum nein? Warum nein? […] Es ist ein Toben um Sprache.“ In diese Aussage ist eine Klammer eingelassen, die den gesamten übrigen Text enthält. Im Rahmen wird ein Gegenteil kurzgeschlossen – „O ja: O nein.“ – und die wiederholte Frage nach einem Grund oder Sinn wird zum Schluss beantwortet:
Es ist ein
Toben um Sprache.
Die Standortsuche des lyrischen Ich, die Frage „Wo sind wir jetzt?“, ist eine Suche nach Sprache. Es weiß nicht, wo es ist, und zusätzlich wird seine Position von außen in einem Ungleichgewicht gehalten:
Ein Rutschen mit uns, an uns
wird gerutscht
Das Rutschen wird erlitten. „Gerutscht“ wird am ,Wir‘ und an den Bausteinen des Gedichts. Die Aufmerksamkeit verlagert sich innerhalb der Klammer in Form eines Bogens, der wieder zum Ausgangspunkt zurück gezogen wird: Vom Standort des Sprechenden, vom Dazwischensein und von Bäumen ist zu Beginn die Rede; nach einer Verschiebung über die Wörter „Winter“, „Käfer“, „Welt“ und „Ausschnitt“ kehrt das Gedicht zu den Anfangsbegriffen zurück; „Zwischenräume“, „Wo bist du?“ (Standortsuche) und „Baum“ lauten dazu die Stichworte. Noch auffallender als das „Rutschen“ ist ein Umschlagen der Begriffe und Bedeutungen in ihr Gegenteil. „O ja: O nein“ und „wir ja, wir nein“ leiten das Schema des gesamten Textes ein. „Bewegung zwischen den Bäumen“ – „Weit und breit / kein Baum“ und „Der Winter ist weiß / wir nicht. Wir sind der Winter“ sind derartige paradoxe Aussagen. An mehreren Stellen scheinen zwei Gegenpole sprachlich nicht so abrupt verbunden zu sein, eine Bedeutung scheint langsam in ihre Negation hinein zu gleiten, wobei inhaltlich doch eine direkte Umkehrung erfolgt, nämlich von ,noch [immer]‘ zu ,noch nicht‘:
Es gibt noch Zwischenräume, es gibt
noch keine Zwischenräume, es gibt keine Zwischenräume, noch uns
noch nicht uns, nicht uns.
[…]
Noch.Noch nicht. Nicht.
Das Gedicht testet, was mit Sprachpartikeln geschieht, die wie in einer Stufenleiter nebeneinander gelegt werden. Dabei verhält sich „Noch. Noch nicht. Nicht.“ logisch anders als etwa die Skala ,blau, blau-grün, grün‘. Das ,Kippen‘ vermittelt auch den Eindruck, es handle sich bei den gegensätzlichen Aussagen jeweils um fast notwendige Entsprechungen im Sinne des tautologischen letzten Satzes der ersten ,Strophe‘:
Alles
ist alles.
Im dritten Abschnitt werden logische Operationen an Sätzen des zweiten Abschnitts ausgeführt:
Ein Käfer öffnet den Mund und ißt: Alles. Minimales knackendes Geräusch
die Welt knistert winzig
[…]
Kein Käfer öffnet keinen Mund: Nichts. Großes Knacken
riesige Welt.
Wie Kafkas zum Insekt gewordener Gregor Samsa befindet sich der anthropomorphe Käfer in einer Welt, in der Verwandlungen wie etwas Selbstverständliches geschehen. Anders als dort sind diese hier vor allem sprachbezogen. Eine Erklärung des Geschehens liegt in den Gedanken, die der Käfer hat und die er, wieder auf seinen Tiercharakter zurückdefiniert („Käfer / denken nicht“), gar nicht haben kann: Als der Käfer „die Welt“ – „alles“ – isst, handelt es sich dabei um „einen Ausschnitt“, der alles „enthält“. Zu denken ist an einen Textausschnitt, der die Welt einfangen soll. Gespielt wird mit dem Versuch der Logik, universelle Strukturen als Grundlage für wahre Aussagen zu definieren. „Ausschnitt“ liest sich daneben wie ein Pendant zu „Zwischenräume“ und die Entsprechung von Mikro- und Makrokosmos erinnert an die Monadenlehre von Leibniz, der zufolge ,jede Monade in ihrem Modus ein Spiegel des Universums ist“.[footnote]Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie und andere metaphysische Schriften; französisch – deutsch = Discours de métaphysique, Monadologie, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Hrsg., übers., mit Einl., Anm. und Registern vers. von Ulrich Johannes Schneider. Hamburg: Meiner, 2002, S. 137 (§ 63). Die beiden Abschnitte der Monadologie, die diese Entsprechung am deutlichsten erklären und auf die sich Waterhouses Gedicht beziehen lässt sind folgende: § 56: „Nun bewirkt diese Verbindung oder diese Anpassung aller geschaffenen Dinge untereinander und eines jeden mit allen anderen, daß jede einfache Substanz Bezüge hat, welche alle anderen ausdrücken, und daß sie also ein lebendiger, immerwährender Spiegel des Universums ist.“ (S. 133) § 67: „Und jeder Anteil der Materie kann als ein Garten voller Pflanzen und wie ein Teich voller Fische begriffen werden. Jeder Zweig der Pflanze, jedes Glied des Lebewesens, jeder Tropfen seiner Säfte ist jedoch wiederum ein solcher Garten oder ein solcher Teich.“ (S. 139) Bekräftigt wird diese Assoziation durch die Nennung des Namens „Leibniz“ in anderen Gedichten des Bandes.8 Der Verweis auf eine solche Welterklärung wird aber ironisch gebrochen. Der „fröhliche“ Käfer, der unbekümmert und anarchistisch mit dem Aufessen der Welt beschäftigt ist, kontrastiert mit dem beharrlichen Fragen nach dem Ort des ,Wir‘ in der Welt:
Wo sind wir jetzt?
Das gleichzeitige Vermitteln und Zurücknehmen von sinnvollem Zusammenhang schafft einen ernsthaft-belustigten Ton. In der paradoxen Welt jenseits des Sinns und des logozentrischen Diskurses ist jede Aussage widerrufbar. Dadurch erhalten manche Wörter eine gewisse Autonomie; sie scheinen vorrangig um des sprachlichen Ausdrucks willen ausgesprochen zu werden, wie die durch mehrere typografische Leerstellen getrennten Zeichen für das Wort ,Baum‘ in der drittletzten Zeile. Inhaltlich motivierte Wortwahl ist jedoch auch stark sichtbar. Die meisten Aussagen folgen einer strukturellen Komposition; thematische Bezüge leiten das „Rutschen“. Das ständige Auftauchen derselben Mechanismen – Verschiebung und (negative) Entsprechung – erweckt dabei sogar den Eindruck, selbst die nicht sinnverwandten Wörter würden aufeinander verweisen.
Ein neues Thema im Vergleich zu MENZ ist in passim die Liebe. Über den ganzen Band verstreut, „passim“ also, tauchen Sätze über Liebe auf; einige entwerfen die Beschreibung eines allumfassenden Lebensgefühls:
Man hat einen schiefen Namen.
Der Planet legt sich schräg. Die Augen
sind manchmal sehr traurig. Die Liebe zu dir
verschweige ich nicht.9
Ich will nicht sterben so früh, obgleich das nicht hierher gehört.
Ich trage eine Jacke
liebe dich sehr10
Die meisten dieser Sätze sind zugleich sprachreflexiv und dadurch an die anderen Äußerungen in den betreffenden Gedichten gebunden. Aus der Perspektive der Aussageinstanz liegt Beziehung im Ansprechen eines Gegenübers – „Du / ist eine gute Sprache“11 –, ohne dass sie mit Sprache erklärt werden könnte:
Aber
ich liebe dich doch
[…]
wir haben nichts, das ist ein guter Anhaltspunkt, das Sprechen ist ein Loch im Gesicht
also haben wir mit den Worten ein Gesicht, aber
ich liebe dich doch, so bist du.
[…]
Aber ich liebe dich doch
das klingt sehr dumm und ist ohne Anspruch.12
Ratlos erklärt die Sprecherinstanz:
Unser leisestes Wort heißt: Jetzt. Jetzt wissen wir
nicht weiter. Wenn wir wissen nicht weiter
heißt unsere Rede: Jetzt liebe ich dich13
Wie in MENZ bleibt die Sprache durch andere Themen hindurch Hauptthema der Gedichte und wie in MENZ wird die Frage nach dem Menschen gestellt und vornehmlich als ein Fragen nach der Sprache vorgeführt. Drei Abschnitte aus dem Gedicht „Der gemeinte Mensch“, das sechs nummerierte Teile umfasst, veranschaulichen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieses Sprechens im Vergleich zu MENZ.
3
Autobus: Alles sieht nach Schütteln aus. Das Schreien hier
heißt: Der Lenker beschleunigt den gemeinten Menschen.
Zunächst wird gebogen, gedreht, gebremst, also:
Die Bestimmungen werden städtisch ineinandergeschoben, aus
dem großen Geräusch blickt unbeschreibbar
der gemeinte Mensch, Samstag 27. April, nach dem Ausstieg
meint das gesamte Gehen: Achtung Weltende
Achtung Weltende. Zunächst geht
der gemeinte Mensch unter.
4
Der gemeinte Mensch dreht eine Achse und geht auf. Einmal
legt der gemeinte Mensch sich auf eine rote Lippe. Einmal
geht eine Tür auf, und unter dem Hut steht schon wieder
der gemeinte Mensch. Einmal sieht er etwas und
er nennt es irrtümlicherweise Achse der Seele und
freut sich lange. Alles ist für die lange Zeit
unbestreitbar. Zunächst geht der, der sich freut
durch den Stadtteil, der dies alles nicht verspricht, und
der gemeinte Mensch dreht sich, und
das Drehen heißt manchmal Tanzen.
5
Suppe essend, großes Marktpanorama, Tomate liegt im Detail
man hört den gemeinten Menschen zu sich sagen: Marktplatz nenne ich:
Hier ist die Welt eßbar. Das große Verzweiflungsvolle
dreht sich in einer neuen Rotation. Ich esse, und
Kirschen und Trauer kommen zunächst zusammen. So
wird die gemeinte Sehnsucht gedreht und gedreht.14
„Der gemeinte Mensch“ ist ein spezifischer Mensch, der hier gemeint ist oder wird. Zugleich klingt der „gemeinte Mensch“ wie der ,gemeine‘ und ,der allgemeine Mensch‘. Ähnlich wie in MENZ wird Allgemeines und Einzelnes vermischt. „Der gemeinte Mensch“ ist der, den die lyrische Aussageinstanz bei ihren Äußerungen im Sinn hat. Sie operiert explizit auf mehreren Stufen, indem sie das Beschriebene kommentiert, noch einmal erklärt, was es „heißt“ oder „meint“, und die Worte wiedergibt, die „der gemeinte Mensch“ ausspricht. Der Sprecher weiß dabei einerseits mehr als der „gemeinte Mensch“: Er urteilt, dieser nenne etwas „irrtümlicherweise Achse der Seele“. Andererseits gesteht er seine sprachlichen Grenzen ein: „unbeschreibbar“.
Das Marionettenhafte des MENZ-Menschen (,die Stehenden‘, ,die Abgewinkelten‘ usw.) ist hier vorhanden: Im Autobus lässt der gemeinte Mensch brüske Bewegungen über sich ergehen und erscheint nach dem Aussteigen in einer auch vom Gedicht nicht ernst genommenen Weltuntergangsstimmung:
Achtung Weltende
Achtung Weltende. Zunächst geht
der gemeinte Mensch unter.
In der vierten Strophe kommen nach einer rapiden Erholung persönlichere Erfahrungen zur Sprache. Sie werden aus einer Mischung von Nähe und Distanz heraus mitgeteilt, so dass das Persönliche zum Teil wieder verloren geht. Eine Liebesbeziehung wird als „sich auf eine rote Lippe“ legen umschrieben. Neben dem Pars pro toto der Lippe als Frau evoziert dieses Bild die Lippe als Liege; so denkt man an das rote Lippen-Sofa in Salvador Dalís Gesicht der Mae West, das als surrealistische Wohnung benutzt werden kann und an sein konkretes Pendant.15 Ein beglückender Versuch des gemeinten Menschen, sich und die Welt zu verstehen, wird destruiert:
Einmal sieht er etwas und
er nennt es irrtümlicherweise Achse der Seele und
freut sich lange.
Ihm werden im Gegensatz zum MENZ-Menschen eigene Erkenntnisse und Empfindungen zugesprochen, selbst wenn seine Freude dabei als naiv bloßgestellt wird. Das ständig erwähnte Drehen „heißt“ in diesem Gedichtteil „manchmal Tanzen“ und macht aus der Spielpuppe einen Menschen, bei dem der Körper auch „manchmal“ mit Gefühlen verbunden ist.
Das Wort „manchmal“ gehört zu den zahlreichen irritierenden, da logisch unpassend erscheinenden Zeitangaben: „Einmal […] Einmal […] schon wieder […] einmal […] lange […] für die lange Zeit […] Zunächst […] manchmal“. Die gewöhnlichen Ereignisse, wie das Öffnen einer Tür, bilden einen Kontrast zum wiederholten Wort „einmal“. Erneut werden logische Prinzipien verzerrt.
Außerdem werden bekannte Sätze verfremdet: „Tomate liegt im Detail“ erklärt, dass auf dem Markt Tomaten im Detail, im Einzelverkauf, angeboten werden, und spielt dabei mit der Wendung ,der Teufel liegt im Detail‘.16 An die Parallelsetzung von Mikro- und Makrokosmos im Gedicht „Wo sind wir jetzt?“ erinnern im fünften Teil auf auffällige Weise die Wortfolgen „großes Marktpanorama“ und „Tomate liegt im Detail“, sowie „Suppe essend“ und „hier ist die Welt eßbar“. Auch im wiederholten ,Drehen‘ liegt eine Parallele zu den ständigen Bedeutungsveränderungen in der Geschichte des Käfers aus „Wo sind wir jetzt?“. Beim Versuch, sprachlich die Welt zu erfassen, „rutscht“ alles, es „dreht sich“, bedeutet zugleich etwas anderes oder sogar das Gegenteil. Das „Toben um Sprache“, der letzte Vers, wird mit ernsthaftem Impetus und zugleich amüsiert ausgesprochen. Die Welt der passim-Gedichte besteht aus einem knappen Grundrepertoire von Alltagsgegenständen, Gestalten, Handlungen, Farben und Naturelementen. Verbunden mit dem Logik-Satzbau und der Sprachreflexion vermittelt sie ein Staunen. Der wissende Ernst bei gleichzeitiger spielerischer Offenheit klingt, als müssten die Wörter und ihre logischen Verbindungen in der Sprache vom lyrischen Ich durch sein Sprechen erst noch entdeckt und gelernt werden.
Indra Noël, in Indra Noël: Sprachreflexion in der deutschsprachigen Lyrik 1985–2005. Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2007
passim
Normalerweise gibt es zwei Arten von Lyrik: die lustige, vierzeilige, die gerne bei Adventkränzchen und halboffiziellen Feiern vorgetragen wird, und die tiefernste, humorlose, die gerne auf Seminaren zerlegt wird. Beiden Sorten gemeinsam ist, daß darin gerne ein Vogel vorkommt. Peter Waterhouse hat in den letzten Jahren die Lyrik ganz schön weitergebracht. Bei ihm weiß man nie genau: Ist der Scherz eine Lyrik oder die Lyrik ein Scherz? Natürlich wimmelt es bei ihm auch von Vögeln, von pathetischen Gedanken und spöttischen Seufzern. Aber seine Lyrik ist wie eine Münze in Rotation: Kopf und Adler sind zwar kurz zu sehen, aber die Münze fällt nie um.
Bei vielen Lyrikern ist die Mehrdeutigkeit der Gedichte ein Programm. Neu bei Waterhouse ist, daß der Sinn der Lyrik überhaupt nicht mehr eindeutig ist.
Der Titel des Gedichtbandes passim, kann als Programm für eine neue Lyrik aufgefaßt werden. Da und dort zerstreut und allenthalben finden sich kleine lyrische Stellen. Wenn man einmal begriffen hat, daß die Lyrik vielleicht etwas ganz Hundsgewöhnliches mit verschmitzten Augen ist, kann man mit Waterhouse schon eine Menge anfangen.
Oswald quasi ohne Oswald. Darüber
wird vogellos geflogen.
Wer ist Oswald? Wir sind es. Wir sind so schnell, daß
keiner Oswald sieht. Das ist traurig. Wir nicht. (S. 45/46)
So ist die Waterhouse-Lyrik. Wunderbar. – Wir nicht.
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. I, 1982–1998, Sisyphus, 2015
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Alexander von Bormann: Peter Waterhouse: passim
Deutsche Bücher, 1987
Michael Braun: Poetischer Anarchismus
Frankfurter Rundschau, 13.1.1987
Annette Brockhoff: Das Betreten des Horizonts oder Konstruktives Verfahren und süße Bestimmung:
44 passim
Sender Freies Berlin, 29.6.87
Klaus Peter Dencker: Die Brücken der Poesie
Nürnberger Nachrichten, 8.1.1987
Arno Dusini: „Gruppenweise gleichen wir Schnittlauch“
Sturzflüge, Heft 18, 1986
Lutz Hagestedt: Über Literatur kann man (nicht) streiten. Prinzipien der Literaturkritik, dargestellt am Beispiel einer schiefgelaufenen Talkshow.
Gegengift, Heft 1, 1991
Lutz Hagestedt: Der Name der Sprache
Süddeutsche Zeitung, 21./22.2.1987
Harald Hartung: Guten Tag Gedicht
Merkur, Heft 2, 1987
Siegmund Kastner: Konstruktionskunst
Kleine Zeitung, Klagenfurt, 24.1.87
Peter Pessl: Beunruhigende Schönheit
Neue Zeit, 13.12.1986
Wendelin Schmidt-Dengler: Wege des Denkens
Falter, 27.2.1987
Wendelin Schmidt-Dengler: Die freundliche Kunst des Grüßens und Spazierens
Lesezirkel, Nr. 23/1987
Thomas Zenke: Nichts hält zusammen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.2.1987
Jedes Wort eine Sprache
− Über den Lyriker Peter Waterhouse. −
„Guten Tag Kunst: So muß man beginnen.“
So beginnt eines der dichterischen, spielerischen Exerzitien des Peter Waterhouse. Aber: Was sind das für Zeiten – für ein Gedicht. Trostlose gewiß, wenn vom Gedicht, von Verszeilen nur trostspendend Sinnsuche erwartet wird oder der unbekümmert tönende Wohlklang schönen Scheins. Schön ist das Falsche. So lernt man gehen.“ – Und vielleicht Gedichte schreiben.
Mit hermetisch wirkender Widerständigkeit empfangen die von sprachlicher Konvention gelösten, Prosa und Poesie umspielenden Wortbewegungen, die rätselhaften Sprachgehäuse, Sprachebenen und Sprachfelder des Peter Waterhouse den Leser – und den ,lyrischen Betrieb‘ unserer Rezensionstribunale, denen das „Schweigen undenkbar“, aber deren oft unverständige Ignoranz auf ihre Weise beredt wird.
Wer den Gedichten, wer der Prosa des Waterhouse erstmals begegnet, stößt auf eine eigensinnig entfesselte Sprachemphase, hymnisch und spröde, von weit her und doch ganz gegenwärtig nah. „Es ist ein Toben um Sprache“, „ein Stürzen durch die Bedeutungen“ in seiner Poesie, seiner Prosa:
Wir reisen
durch das Meer der Bestimmungen
in Penelopes Gestalt
Wer sich darauf einläßt, dem beständig wachsenden deutschsprachigen Werk dieses Autors mit dem irritierenden englischen Namen zu folgen, trifft auf Markierungen und Maskierungen der Biographie – und nur einmal, in einem Œuvre, das mehrere hundert Gedicht- und Erzählseiten umspannt, wird die Verschwiegenheit durchbrochen: „Ich war Sohn eines englischen Offiziers. Ich war Sohn des nach dem Ende des Weltkriegs im Ausland heiratenden Offiziers.“ Geboren in Berlin (1956), gewohnt in Wien, studiert dort und in Kalifornien, gelebt in Rom – und nun in Wien, nah dem Ring.
Also: Biographische Bewegungen über Sprachgrenzen, Sprachverflüssigungen. Jeder Sprache ihr Wort, aber auch und vielmehr: „Jedes Wort eine Sprache.“ – Anzeichen, des Dichters. Aber soll notwendig sein für den nicht einzig die Sprache, alles andere nur biographisch – unterhaltsam, interessant −? Hat der Dichter sich nicht entschieden, die Welt allererst als Sprache zu sehen? Weltwirklichkeit als Sprache, für sich, für uns, Wort- und Welthaltigkeit in einem.
Peter Waterhouse ist ein Dichter – von weit her und doch ganz gegenwärtig nah. So, als ob seine Dichtung von ihm selbst mehr wüsste als er von ihr. Eine Dichtung, vorangetrieben in Sprachanläufen, die mit Sprache gegen Sprache sprechen, eine Dichtung, die voller Zweifel die Möglichkeit eines Erschließens jener Weltwirklichkeit durch Sprache befragt. Paradoxes Sprachschweigen, anarchisch – und im fern nahen Hintergrund erinnert Paul Celan uns daran, daß das Gedicht sich am Rande seiner selbst behaupte.
Bei Waterhouse stehen die Zeilen: „Indem wir uns nähern, in der schönsten Weise / entfernen wir uns.“ Nähern wir uns.
Zitat eins: „Ich saß als Zuhörer des öffentlichen Vertrags. Der Vortragende sprach von der Kunst als der Teilnehmerin an der falschen Gesellschaft. Der Vortragende sprach von der Wirkungslosigkeit der Kunst.“
Zitat zwei: „Am Ende des Vertrags war das nicht Sprachliche fort. Am Ende des Vortrags war das Schweigende undenkbar.“
Widerständige Wörter – „passim“, so programmatisch benannte Peter Waterhouse nicht nur ein vor vier Jahren erschienenes taubenblau auffälliges Gedichtbuch – nach dem Gedichtband Menz von 1984 und dem Prosaband Besitzlosigkeit. Verzögerung. Schweigen. Anarchie von 1985 – sein drittes Buch. Es versammelt rund 80 erschriebene Gedanken-Gedichte.
„Zerstreut“ und „durcheinander“ – passim – soll lyrisches Sprechen sprachverrückend werden, „hier und da“ und „allenthalben“ – passim – vor dem entthront-entmachtet zersplitterten Ich. Bildlichkeit und Bedeutung, Grammatik und Gesetze des Sprechens sind aufgehoben, Signifikanten tanzen und Signifikate sind verschwunden. Sprach- und Schreibakt als Sabotage an Sinn- und Satzzusammenhang. Verwerfungen, Verschiebungen, Verwandlungen. „Voraus“, so lauten Gedichtzeilen, „voraus heißt sozusagen den Bedeutungen voraus. Man blickt zurück / in die Sprache.“
Und staunen wir, aber sprachlos, nicht oft genug im Angesicht einer von Namen, Wörtern und Bedeutungen zugestellten, zugemüllten – uns enteigneten Welt?
Die Poesie des Poetologen Waterhouse ist rückhaltlos. Sein dichterisches Sprechen, das Formen seiner Dichtkunst-Objekte geschieht im Wissen eines Maurice Blanchot, daß „Benennen die Gewalt ist, die das Benannte absondert, um es in der bequemen Form des Namens zu besitzen“.
„Der Name der Sprache“ – heißt es im gleichnamigen Gedicht, „der Name der Sprache heißt: Abwesenheit“ – und so lesen wir weiter:
Ungarn. Donau. Pisa.
Maria. Apfelkern. Uns steht ziemlich vieles zur Verfügung.
Alles flieht. Wir bilden einen Vordergrund. Wir bilden
einen Grund. Unser Lob heißt: Wir haben gute Gründe
Welche?
Das „knallende Gelächter“ dessen, dem das Ich der lyrischen Tradition, dieses archimedische Ich längst nur noch „wilder Begriff“ sein konnte, das Gelächter dessen, der radikalisierte sprachskeptische Tradition mit Sprachwitz und Heiterkeit paart, hallt im Leserkopf bei der Lektüre von Menz noch lange nach – jenem ersten Gedichtband des damals achtundzwanzigjährigen Peter Waterhouse.
„Wo ich in der Dichtung eine Schlüssigkeit gefunden habe, habe ich aufgehört zu lesen“: eine schlüssige Selbstauskunft. Nichts ,Festgebautes‘ bleibt belassen, das Gedicht ist Bewegung in semantischen Zwischenräumen, es geht ins „Ungewisse“ und es überlebt nur, wo das poetische Wort „unverfestigtes Etwas“ ist. Frei bewegt in unverankerter Sprache, ohne Dominanzverhältnisse, ohne Bedeutungshierarchie. Kontinuierliche Sprachabfolgen in dichtend-erzählendem Beschreiben oder Gebote einer Entweder-oder-Logik zu suchen ist hier vergeblich: Denn „alles war Mittelpunkt“. Ihm gleich nah wollen die Worte und Sätze sein.
Sprache. Tod. Nacht. Außen – ein Gedicht. Roman im Ineinander von Poesie und Prosa – nennt Waterhouse sein bislang letztes, im Jahr 1989 erschienenes Buch. Eine Sprach-, Entwicklungs- und Erinnerungsreise durch Städte, durch Landschaften, durch gegenwärtiges und vergangenes, durch Erfahrungen und Gefühle. Eine Sprachreise mit topographischen und literarischen Wegmarken. Denn sein eigenes Dichten bespricht Peter Waterhouse in lesender Exegese exemplarischer Gedichte, das Lesen anderer erlaubt das eigene Wollen besser zu verstehen.
Waterhouse gehört zu jenen, es sind so viele nicht, die mit ihren Gedichten denken, die spielerische Sprache zum Bewußtsein ihrer selbst führen wollen, die – so versteht er das Wort: experimentell – die Schlüssigkeit von Sprache abtasten wollen. Waterhouse gehört zu jener kleinen Gruppe junger Autoren, die poetologisch denken und poetisch schreiben.
An anderem Ort notiert er, „die größte Bewegtheit habe ich empfunden bei an die Verschwiegenheit grenzenden Büchern, bei 33. Petrarca-Gedicht von Pastior“ oder – wie wir in jenem Gedicht. Roman Sprache. Tod. Nacht. Außen lesen – beim Gedicht „Yaddo“ von Carl Rakosi, bei „Stimmen“ von Celan und bei „Silenzium, Kohlenstoff, Kastelle“ von Andrea Zanzotto, den Waterhouse auch mit ins Deutsche übersetzt hat.
Überhaupt: Die Bücher von Waterhouse durchziehen staunenswerte Echos, Anverwandlungen und Resonanzen, der späte Hölderlin, Trakl, Eich, die Wiener Gruppe. „Kennt aber mehr / als die Anfänge seiner?“
„Es könnte werden die Erweiterung der Geschichte“ – lautet eine Zeile bei Waterhouse. Es könnte werden die Erweiterung des Gedichts, die Erkundung seiner „Rückseite“, die diesen Dichter in Hölderlinie an die Randzonen unserer eingeebneten und einebnenden Sprechweisen und Schreibformen führt. Gedichte, dunkel jenen, die die Alltagssprache hell finden; verschlossen jenen, die das Mallarmé-Diktum vergessen haben, daß ein Gedicht nicht ohne die Suggestion vorstellbar ist, die dem Ungesagten entstammt.
Es könnte werden eine Erweiterung bis an den Rand der Sprache, bis an jene Grenze, deren andere Seite Wittgenstein, den Waterhouse gut studiert hat, das „Mystische“ nannte. Eine Grenze, an der alles Schreiben von Peter Waterhouse spielerisch tastend sich entlang bewegt, diesseits – und jenseits, wo das Schweigen zur Antwort der Dinge werden muß.
Guten Tag Kunst. Wo sind wir? Wir sind weit oben und
weitgezogen. Wir sind nicht weit oben genug, aber
wir sind das Brennen, das Rauschen, der schwarze Atem
im guten Übergang. Gehen heißt: Grundlage, Europa, weite Verwandlung und
Himmel in eins
wir sind begrüßenswerte Künstler des Spaziergangs.
Christian Döring, Neue Rundschau, Heft 3, 1991
„Mit keinem Wort ein Wissen“
− Die kurzen Gedichte von Peter Waterhouse. −
1
In einem doppelten Sinne bedarf es wohl einer Erklärung, ,kurze Gedichte‘ ausgerechnet bei Peter Waterhouse als eigenes Genre auszusondern. Erstens durchkreuzen dessen sprachexperimentelle poetische Reflexionen vielfach jede pointierte Zuspitzung des Textes auf wenige Verse, indem sie ad infinitum das eben Gesagte in einen unbestimmten Schwebezustand zurückführen und zu immer neuen Formulierungsversuchen ansetzen. Zweitens bestätigen schon die Gedichtbände MENZ und passim die aktuelle Tendenz zu zyklischen Gedichtreihen und langen, panoramaartigen Poemen. Und doch: Techniken der Aussparung und lakonischen Kürze gehören seit passim nicht nur zum poetischen Repertoire, sondern können zuweilen, wie Waterhouses Haiku-Experimenre in der Schweizer Korrektur zeigen, textkonstitutiv sein.
Um Mißverständnissen vorzubeugen: Es geht keineswegs um eine innerhalb des Werkes neu ausgetragene Wiederauflage des müßigen Streits um kurze und lange Gedichte, auch nicht um poetologische Abgrenzungen und Definitionsversuche. Die Unterscheidung von kurzen und langen Gedichten hat eine provisorische, heuristische Funktion. Sie grenzt Gedichte voneinander ab, die, wie „Das innerste Herz“, „Zwischenspiel im sachlich-ungeheuren Ton“ und „Darübergeflogen“, die Konturen ihrer Gegenstände über mehrere Seiten hinweg in einem von Abbrüchen, Neuansätzen, Präzisierungen und Variationen rhythmisierten Artikulationsvorgang entfalten, und solche, die jenen sprachlichen Prozeß auf wenige Verse konzentrieren. Im Gedichtband passim gehören dazu Texte wie „Was man wissen sollte“, „Als Blume…“, „Schweigen, Zärtlichkeit, Augenblick“ und „Jetzt“.
Waterhouses kurze Gedichte entfalten den im Vers Wort für Wort sich artikulierenden Sprachprozeß ebenso assoziativ und sperrig wie die längeren Gedichte. Je kürzer die Gedichte jedoch sind, desto mehr schiebt sich das Gebilde aus Einfällen, Wortspielen, Satzumstellungen, Inversionen, Paradoxien und Fragen in- und übereinander. So löst sich im Gedicht „Was man wissen sollte“ noch im einzelnen Vers die gedankliche und thematische Kontiguität wieder auf:
Wer hat die Welt versprochen? Welt.
Wie heißen wir? Heißen. Wir.
Es ist nicht Tag. Es ist nicht Nacht. Ist es also unwiederholbar? Nicht. Also.
Wo lebt die Sprache? Hält etwas den Atem an
und ich kenne es nicht? Atem.
Das, was „man wissen sollte“, verliert sich im leeren Echo, verfängt sich im Widersprüchen, wird von einzelnen Partikeln unterbrochen („Nicht. Also.“) und läßt sich durch kein poetisches Subjekt mehr benennen. „Nichts hält zusammen“, ist Thomas Lenkes Besprechung des Gedichtbandes passim überschrieben. Aber dieses Urteil ist in dem Maße voreilig, wie es nur die disparate Oberfläche der Wort-, Satz- und Verseinheiten registriert und ihnen einen dissoziativen Sprecher unterstellt:
Ist das Ich in Waterhouse’ Gedichten mehr als eine bloße Vokabel? Es splittert sich auf. Das Zentrum ist verlassen, das etwas zusammenhalten könnte. (…) Es gibt keinen Archimedischen Punkt.
Zwar fügt in der Tat keine Instanz mehr die Abfolge von Denkbewegung und -unterbrechung zusammen, läßt sich kein „Zentrum“ ermitteln, das den in Gang gesetzten Sprach- / Denkprozeß auf ein Empfindungs- und Erlebnis-Ich hin perspektiviert. Aber dadurch verlieren die Verse noch nicht ihren Zusammenhalt. Im Gedicht „Was man wissen sollte“ ist das Ich als ein fragendes Ich keineswegs konturenlos. So evident es ist, daß das Gedicht keine Antworten bereit hält, so offenkundig ist auch die Emphase, mit der gleich dreifach Sprache und Wissen, Sprechen und Benennen zum Thema gemacht werden: „Wer hat die Welt versprochen?“, „Wie heißen wir?“, „Wo lebt die Sprache?“ Daher sind auch die kargen ,Ein-Wort-Antworten‘ nicht bloß echoartige Wiederholung, sondern ebenso rhetorische wie spielerische Hervorhebung.
Das Gedicht als Sprachphilosophie in Versen? Es gibt durchaus gute Gründe, diesen Konnex herzustellen und Waterhouse beispielsweise mit Wittgenstein in Verbindung zu bringen, wie überhaupt die experimentelle Technik des Autors, sein Sprachdenken und seine anspielungsreichen Verse Literaturkritiker zur Spekulation über Vorläufer, Gewährsmänner, Einredner und Idole eingeladen haben.? Jedoch sollte nicht übersehen werden, daß – wie im Gedicht „Was man wissen sollte“ – das Auflösen von Gewißheiten und das Fragen selbst im Mittelpunkt stehen, und zwar als ein Prozeß ohne erkennbare Resultate, ohne greifbare Ergebnisse. Ohnehin gehört es zum Kalkül Waterhousescher Poetik, daß er gerade auch in seinen kurzen Gedichten mit ironischen und selbstironischen Signalen arbeitet. So ist das aus einem einzigen Vers bestehende Gedicht „Sprache (2)“ mit der den Leser direkt ansprechenden Frage „Glauben Sie mir das Wort Blume?“, die manchem Kritiker prompt die Antwort ,Nein‘ entlockt hat, kein Bekenntnis zu mittelalterlichem Nominalismus, sondern eine in der Poetik der kurzen Gedichte auf die Spitze getriebene Pointierung metasprachlicher Reflexion. Der Autor liefert kein Blumengedicht ab, sondern geht gleichsam auf die Materialebene poetischen Sprechens („das Wort Blume“) zurück und verknüpft diesen Bezug mit einer im Vers offengelegten Anspielung auf eine Komponente literarischer Kommunikation, den Dialog mit dem Leser („Glauben Sie mir (…)?“). Das Gedicht, an seiner entsprechenden Stelle im Kontext der Gedichte von passim gelesen, wirkt wie eine im Vers formulierte Unterbrechung des Schreibvorgang. Es ist ein Einfall, eine Laune, ein Spiel zwischen Autor und Leser, auch eines zwischen Autor-Ich und Gedicht-Ich, nicht zuletzt auch eines zwischen den Gedichten des „Sprache“-Komplexes innerhalb des Gedichtbuchs.
Ein erstes Fazit läßt sich ziehen: In passim sind Gedichte zu lesen, keine sprachphilosophischen Thesen. Daran läßt auch das „Gebet an Rene Descartes“ keinen Zweifel, obwohl es zunächst einen Gewährsmann, einen der philosophischen Säulenheiligen des Subjektivismus, beim Namen nennt und dessen Aura beschwört. Das Gedicht hebt schon im ersten Satz des ersten Verses die für Waterhouse konstitutive Erkenntnis hervor: „Mit keinem Wort ein Wissen.“ Der Satz, an den Anfang, nicht an den Schluß gestellt, paraphrasiert nun keineswegs solipsistischen Agnostizismus, so als gelte es, eine philosophische Maxime poetisch zu wiederholen. Schon der nächste Satz („Was ich alles weiß.“) wirkt wie der ironisierende Auftakt zu anderen Assoziationen zum Thema. „Mit keinem Wort ein Wissen“: Die Formel wird zum Gegenstand weiterer Reflexionen, freilich so, daß deren sprachphilosophische Basis, der Dissens zwischen „Wort“ und „Wissen“, bestehen bleibt und nicht etwa Vers für Vers hinweggeredet wird. Das Gedicht fragt, indem es eine für Waterhouse unhintergehbare Bedingung gleich an den Anfang setzt („Mit keinem Wort ein Wissen“), nach den noch verbleibenden Möglichkeiten von Sprache, Sprechen und Poesie, und es finden sich überraschende Einsichten. Waterhouses Gedichte lösen sich nicht in monotonisierendes Murmeln auf. Ein dialogisches Grundelement ist ihnen eigen. So heißt es im Descartes-„Gebet“:
Du
ist eine gute Sprache.
Ein Gedicht – gleich welcher Länge – ist bei Waterhouse ein Sprechen über Sprache, eine in Poesie transformierte und zugleich ironisierte Metasprache, die – im Gegensatz zu metasprachlichen Äußerungen in Wissenschaft und Philosophie – keine sprachlichen Sachverhalte auf analytischem Wege bezeichnet, sondern diese in einem andauernden, von Zufällen und Assoziationen durchsetzten Umformungsprozeß zerlegt und in neuen Kombinationen wieder zusammenfügt. Die Verse geben daher keine vorfabrizierten Gedanken und Statements wieder; sondern sind auf den Denkvorgang, auf ,Sprachdenken‘ in actu gerichtet, das sie mit seinen jeweiligen Unterbrechungen und Abschweifungen, Richtungswechseln und Rückbezügen im alternierenden Prozeß zwischen Sprachfluß und erneutem Formulierungsanlauf dokumentieren. Vor allem in passim wirken sie unfügig, ja widerborstig und machen dem Gedichtbandtitel alle Ehre; denn sie lesen sich so ,ohne Unterschied‘ wie ,zerstreut‘ und ,durcheinander‘, ohne auf manierierte Weise virtuose Sprachspielerei zu sein. Harald Hartung hat diesen Zusammenhang treffend zusammengefaßt: „Waterhouse hat Wittgensteins Sprachskepsis in eine Heiterkeit à la Arp gewendet.“
In den kurzen Gedichten wird das spielerische Element vor allem in jenen schon skizzierten Einzeilern deutlich. So heißt es lapidar in „Sprache 8 / Kreuzgang“:
Kreisgang zum Narren. Komm her du Narr.
Die nächste Seite nimmt ein Motiv des Gedichts „Sprache 7“ wieder auf: „Fortsetzung des Sausens“ – weiter bleibt die Seite leer. Solche gestalterischen Rückverweise und Zurücknahmen, welche die Buchseite als semantisches Element in den Text einbeziehen, sind Beispiele für die Durchlässigkeit und Unabgeschlossenheit von Gedichten. Waterhouses knappe Rekurse wirken so, als ob der Autor als sein eigener Leser sich selbst unterbricht, zuweilen auch korrigiert oder in Widersprüche verwickelt und solche Lektüre-Revisionen als Unterbrechungszeichen im erneuten Schreibvorgang festhält. Christian Döring hat die Funktion des Spielerischen als Modus des ,Sprachdenkens‘ charakterisiert: „Waterhouse gehört zu jenen, und es sind so viele nicht, die mit ihren eigenen Gedichten denken, die spielerisch Sprache zum Bewußtsein ihrer selbst führen wollen.“
Gerade das Prinzip der Wiederaufnahme, des spielerisch-experimentellen Umgangs mit Selbstzitaten, aber auch mit Themen, Motiven, ja mit einzelnen Wörtern schafft neue, überraschende Momente des Zusammenhangs, also Kohärenzen und Kontiguitäten, die innerhalb der einzelnen Texte ausgespart werden und manchem den Eindruck vermitteln, die Wörter stünden reichlich planlos da. Es lassen sich sogar kräftig wuchernde Wort- und Motivgeflechte nachweisen, die Verse einzelner Gedichte miteinander verbinden, und zwar zu neuen, in den Gedichten verborgenen, durch eine Art ,Querlesen‘ und durch Rückblättern und Kombinieren entstehenden ,Subtexten‘ des Lesers. Spätestens an dieser Stelle sollte der Eingangsvers des Gedichts „Jetzt“ zitiert werden: „Vielleicht sollte man nicht sagen Gedicht“. Es enthält (neben dieser poetologischen Ankündigung und dem Schlußvers: „Jetzt kommt die Zeit, und man sagt besser vielleicht Gedicht“) auch die kaum aufzulösende Frage:
Wo ist der Hut, wenn die Frage schon anders endet?
Nicht Wittgenstein und Heidegger, Celan und Rilke stehen hier Pate, eher noch jene tiefgründige „Heiterkeit à la Arp“; aber wer sich auf das Spiel der Frage einläßt, findet die Einsicht bestätigt:
Alles ist schwierig
es ist alles nicht schwierig.
Und deshalb gibt es in passim Subtexte über Hüte, Mützen, Ohren, Augen, Nasen, Sessel, Spaziergänger, Blumen, Narren – neben solchen über Wörter, Sätze und Welt. Am recht banal erscheinenden Beispiel des Hut-,Diskurses‘ läßt sich ein solcher Subtext konstruieren: „Der Hut ist bald / der Hut noch immer, aber es gehen große Verschiebungen vor. / Die Nacht ist ein Hut für den Tag. Die Sonne geht auf / über einem kahlen Kopf.“ „Zu erkennen / gibt es an uns sehr wenig. Darum tragen wir Hüte / die wir mittags wieder ablegen. (…) / Auf der Hauptstraße fragen wir uns: / Wo ist der Hut? Der Hut ist am Kopf. So lernt man gehen.“ „Etwas kommt durch die Stadt, das als Mantel, Hose, Schuh / vermutlich nicht die Stadt ist, (…) / und schweigend sind die Häuser / oder Redner oder Radfahrer oder große Hüte / darunter Briefträger mit Beinen kommen.“ „Als Hut geht der Hut.“ „Noch etwas dümmer möchte ich werden / damit mir mein Hut paßt.“ „Hut auf, Hut ab / was war gefragt (…) und was und was / damit es heißt: jetzt.“ Vor dem Hintergrund solcher die Grenzen des einzelnen Gedichts übersteigenden Sprachspiele, die eine Korrespondenz zwischen sich verselbständigenden Wörtern unterschiedlichster Texte bewirken, löst sich poetologisch das traditionelle Prinzip der ,Werkeinheit‘ auf, der Begriff des Textes als eines geschlossenen sprachlichen Ganzen erfährt seine Einschränkung. Das einzelne Gedicht verliert seine Aura der Unverletzlichkeit und Autonomie. So erfährt ein poetologischer Vers wie „Vielleicht sollte man nicht sagen Gedicht“ am Ende doch seine überraschende Bestätigung. Daß es „im Gedicht keine Bewegung des Setzens“ gibt, hat Waterhouse in seinem Poesie, Poetologie und Erzählkunst verknüpfenden Buch SPRACHE TOD NACHT AUSSEN. GEDICHT. Roman anschaulich hervorgehoben:
Alles im Gedicht war Übergang. Nichts im Gedicht war bei sich. (…) Das Gedicht stand da ohne Fundament, ohne Verabredung, ohne Gewißheit. (…) Es gab im Gedicht keine Bewegung des Setzens. Es gab im Gedicht die Bewegung des Ersetzens. (…) Das Gedicht ging von Übergang zu Übergang in kein Endgültiges.
2
Die Unabgeschlossenheit der Waterhouseschen Gedichte wird auch in der 1996 unter dem Titel E 71 erschienenen „Mitschrift aus Bihać und Krajina“ deutlich, jenen kargen Versfragmenten, die entstehungsgeschichtlich eine Reise in die Kriegsgebiete Bosniens entlang der Europastraße 71 dokumentieren: als Spur fast vollständiger Sprachlosigkeit, die den Aufschreibprozeß immer wieder ad absurdum führt. Der Autor hat auf dem Rückumschlag seiner (unpaginierten) schmalen „Mitschrift“ Anlaß und Kontext in einem skeptischen Resümee erläutert: „Was hatten wir da zu suchen, nach dem ,Gewittersturm‘ Anfang August 1995, ausnützend für diese Reise die noch ordnungslose Ordnung der neuen Macht und die Euphorie der ,Sicherheitskräfte‘? Vereinbart war zwischen uns: um zwei oder drei Gespräche im so lange belagerten Bihać zu bitten, aber dabei fast nur zuzuhören – unsere Sprache eine Zuhörersprache und Mitschriftsprache (im Lande der Gespräche und Sprachen). In der Krajina, dem Saumland, freilich hat es keine Aussicht mehr gegeben auf solche Gespräche.“ Schon dieses Schreibprojekt deutet auf seine Grenzen hin. Die Technik der „Mitschrift“ kann unter solchen Umständen nur eine provisorische sein; sie muß schon im Ansatz unvollständig und skizzenhaft bleiben. So ist es keineswegs ein manieriertes typografisches Gestaltungsmittel, daß die einzelnen Seiten in E 71 nicht nur spärlich bedruckt sind, sondern daß auch zwischen den zwei bis drei Zeilen am oberen und am unteren Seitenrand vor allem der Weißraum ins Auge sticht. Er unterbricht die gesamten zwei Druckbogen lang den spärlichen Textrest und macht dessen fragmentarische Form optisch sichtbar. Verstärkt wird dieser Eindruck noch dadurch, daß manche Zeilen statt eines Gesprächsfetzens, eines Satzes oder eines einzelnen Wortes nur noch einen Gedankenstrich als eine Art Auslassungszeichen aufbieten: Markierungen von Stellen, an denen die „Zuhörersprache und Mitschriftsprache“ scheitert und auch innerhalb des literarischen Fragments die fragmentarische Textstruktur dominiert.
Waterhouses Poetik des Fragmentarischen, die für seine kurzen Gedichte von Anfang an charakteristisch ist, wird in E 71 noch konsequenter als bisher entfaltet. War, wie im Gedichtband passim, das nur aus dem Titel bestehende Gedicht „An die ferne Geliebte (2)“ ein Spiel mit den Lesern, die gleichsam ihre eigenen Assoziationen auf die leere Seite projizieren konnten, so führt nun der Weißraum auf den Druckblättern in ein unauflösbares Dilemma. Die „Mitschriftsprache“ beispielsweise registriert zunächst nur eine einzige Zeile, den assoziationsreichen, am oberen Rand der Seite notierten Satz „Das Schlimmste ist die Nacht“. Dann folgt der Weißraum, und es schließt sich daran, als eine Art ,Abschluß‘ der Gesprächsnotiz, der am unteren Seitenrand fixierte Satzfetzen „Die Gewalt gegen Bücher“ (E.) an. Mehr Zeilen enthält die Seite nicht. So evident es ist, daß jenes „Schlimmste“ sicher nicht die „Gewalt gegen Bücher“ bezeichnet, so deutlich wird auch, daß jene beiden einzigen Zeilen auf ebendieser Seite das „Schlimmste“ nicht zu benennen vermögen: Weißraum markiert das, was sich der Sprache entzieht, was also weder in einer „Zuhörer-“ noch einer „Mitschriftsprache“ formuliert werden kann.
Nun ist, spätestens seit Celan, das ,Unsagbare‘ gerade vor dem zeitgeschichtlichen wie aktuellen Horizont von Krieg und Gewalt keine Waterhousesche Entdeckung, sondern eher ein Zitat, das eine lyrische Tradition erinnert. Diese ins Gedächtnis zu rufen, heißt zugleich die immer noch medienwirksame, spektakuläre Form der Kriegsberichterstattung und des Kriegskommentars zu konterkarieren. Waterhouses weithin fragmentarisierte „Mitschrift“ destruiert den Jargon der Fernsehbilder und Nachrichten. Selbst die „Zuhörsprache“ bedarf eines Übersetzers, der seine Grenzen formuliert, so daß nicht einmal die Stimmen einen Anspruch auf Authentizität einlösen können: „Der Übersetzer sagt: / Die Nuancen der Sprache- / zu fein“ (E.). Die fast leeren Seiten stellen einen deutlichen Kontrast zu den mit Geschichten, Sensationen und Schrecken aufgeladenen Medienbildern dar. Von dem vor die Kamera geholten Augenzeugen bleiben in E 71 nur noch Stimmenreste übrig. Gleich die erste „Mitschrift“-Sequenz beginnt mit einem Vorbehalt: „,Manchmal ist es schwierig für uns / Antworten auf die einfachsten Fragen / zu geben‘“ bevor dann jene lakonischen Mitteilungen folgen, immer wieder von Weißraum unterbrochen und über vier Seiten zerstreut: „Die Dörfer um Bihać / praktisch zerstört // Heute mittag / zum ersten Mal / ein Stück Fleisch // Ein Sack Mehl / Ende Juli: 1000 DM / heute: 40 DM // Wochenlang Kukuruz // Und geschwächt / von Kukuruz // Kinder“ (E.). Wo eine an hochdramatischen Ereignissen und plastisch erzählten Einzelschicksalen interessierte Berichterstattung üblicherweise erst beginnt, da fehlt selbst den wenigen narrativen Fragmenten von E 71 jeglicher Ansatz zu erzählen. Eine Seite der „Mitschrift“ beginnt mit der stereotypen Interviewfrage „Was erwarten Sie sich?“, die Augenzeugen und Opfern gestellt wird; die Antwort indes macht die Unangemessenheit der Frage und deren klischiertes Muster offenbar:
Was erwarten Sie sich?
„−
−
−
Schwer zu sagen
(Gibt es eine Logik in
der Welt?)
Der Krieg ist zuende“ (E.)
Die Aussparungstechnik dieses kurzen Textes erübrigt zunächst weitere Fragen nach dem ,Interviewer‘ wie nach der Person des Antwortenden, des ,Opfers‘. Ruft die Frage „Was erwarten Sie sich?“ noch die Illusion eines Lebensentwurfes hervor, verweigern die Zeilen „Schwer zu sagen“ und „Der Krieg ist zuende“ nicht nur die Auskunft, sondern lassen auch die gesamte Kommunikationssituation als eine höchst fragwürdige erscheinen, Die „Mitschrift“ hält daher keine wie auch immer fragmentarisierten Augenzeugenerlebnisse fest, sie protokolliert vielmehr einen Scheindialog des Kriegsberichterstatters mit seinem Erzählprotagonisten. Und auch dort, wo offenbar der Protokollierende spärliche Beobachtungen notiert, zerfallen seine Eindrücke in atomisierte Erzähl- und Stimmenspuren:
Schüsse
Was ist das?
„Eine Zelebration
Auf Wiedersehen“
Um vier Uhr
ist eine Hochzeit (E.)
Ein solcher Text ist, vor dem Hintergrund der inzwischen umfangreichen deutschsprachigen und internationalen Literatur zum Bürgerkrieg im vormaligen Jugoslawien gelesen, weder spektakulär noch publikumswirksam. Gemessen an der Selbstdarstellung des Serbienreisenden Peter Handke und den von seinem auktorialen Erzählbericht ausgelösten Aufgeregtheit hat Waterhouse von vornherein keine Chance, sich in den öffentlichen Meinungskampf einzuschalten. Die naheliegende Antithese zu Handkes auf Authentizität und Unabhängigkeit pochende Augenzeugenschaft kommentierte Hans Haider in der frontsprachenerprobten Wiener „Presse“ unter der Überschrift „Nur einer kam durch“: „Zwei österreichische Dichter auf dem Weg zum Unbeschreibbaren: Der eine, gewiß der Stärkere, ist ,durchgekommen‘, zum Leser, in die Debatte, der andere hat ein Kunstziel erreicht.“ Diese Zuweisung von E 71 ins ästhetische Ghetto, in die Bedeutungslosigkeit, ebnet zwar die Widerständigkeit der Textfragmente ein, indem sie die Veröffentlichung mit dem Etikett ,Vorsicht Kunst‘ versieht. Und doch enthält sie, unbeabsichtigt, ein Quentchen Wahrheit. Der in E 71 zusammengetragene Stimmenrest hat keine politisch-moralische Appellfunktion, keinen Bezug zur Medien-„Debatte“. Dafür liefert der Text ein Paradigma für das fragmentarische, ferne Echo des Krieges in der Sprache der Literatur. Daß er fast ganz sprachlos macht, daran läßt E 71 keinen Zweifel. Hermann Wallmann hat daher recht, wenn er schreibt, E 71 bleibe bei Waterhause „kein geographischer Begriff mehr, sondern ein allegorischer“. Wenn es gegen Ende zum Stichwort E 71 heißt, „Menschen / Die Menschen sind nicht mehr“ (E.), dann ist diese epigrammatische Inschrift ein lakonisches Erinnerungszeichen, das im Lärm der Kommentare untergeht, Das Gedicht hat daran freilich den geringsten Anteil.
3
Es wäre voreilig, die fragmentarisch-unabgeschlossene, durchlässige Form der Waterhouseschen Gedichte in die Nähe autonom-hermetischer Nachkriegspoesie zu bringen. Schon passim war eher ein „poetischer Anarchismus“, ein Wörter, Sätze und Textkomplexe aufwirbelnder, ironisch-heiterer Gedichtband. Mit Paul Celan und (zuweilen mehr noch) mit Ernst Meister verbindet Waterhouse zwar sein offenkundiges Interesse an der Sprache und an der Sprachlichkeit der Poesie als Gegenstand von Lyrik. Aber wie seine Gedichte allenfalls Annäherungen an ihr Thema sind: oft ironisch zurückgenommen und (wie die Gedichtschlüsse) in Widersprüchen verharrend, so ist für seine Poetik die Formel charakteristisch, die er seinem Poetik-Kapitel in der Schweizer Korrektur vorangestellt hat: „Gedichte und Teillösungen“. Der Herausgeber des Buches, Urs Engeler, hat eine Lyrikerin, Brigitte Oleschinski, und zwei Lyriker (Durs Grünbein und Waterhouse) zu Wort kommen lassen, einmal als Verfasser eines poetologischen Essays, ein andermal als Kommentatoren dieser Essays, so daß, typographisch parallel gesetzt, auf einer Doppelseite ein Stück Poetik vom jeweils anderen eine Anmerkung, eine Bestätigung und auch eine „Korrektur“ erfahren kann. Während Grünbein zu einem dezidierten, fulminanten Entwurf aktueller Poetik ansetzt, geschrieben in einer Mischung aus Vorlesungs- und Bekenntnisstil, zugleich aber mit einer Präzision und einem Problembewußtsein, das in den achtziger Jahren kein deutschsprachiger Lyriker annähernd erreicht hat, nimmt zunächst nur OIeschinski die Möglichkeit diskursiver Kommentierungen wahr. Waterhouse indes – Kritiker haben ihm dies besonders übel genommen – entzieht sich der Diskursivität der Poetik-Reflexion und liefert statt dessen Seite für Seite Dreizeiler, bis er zuletzt mit „Gedichten und Teillösungen“ einen auf Erfahrungen und Wahrnehmungen gerichteten Bericht schreibt, der sich poetologischer Maximen fast ganz enthält.
Waterhouses Dreizeiler, unschwer dem Genre Haiku zuzuordnen, sind derart durchlässige Textfragmente, daß in ihnen stets die auf Empfindung gerichtete Subjektivität und ästhetische Sensibilität der Haiku-Tradition sich aufzulösen droht. Übrig bleiben zufällige Notate wie „Der Reif auf dem Steg / Reif auf dem Lastwagendach / Reif auf dem Haus“, „Der wenige Schnee / der nichts hinzugibt / der etwas wegnimmt“ und „Großes Vertrauen / Eine Lawine ging nieder / in der Nacht“. Die für passim noch konstitutive Technik des kurzschrittigen Wechsels von abrupter Unterbrechung und Wiederaufnahme ist einer fast impressionistischen Leichtigkeit gewichen, War in passim die Spontaneität eine Sache der plötzlichen Einfälle und Richtungsschwankungen, so ist sie nun ein Mittel der Pointierung von Gedanken auf knappstem Raum. In doppeltem Sinne haben die Waterhouseschen Haikus eine durchlässige Struktur. Sie reagieren einerseits aufeinander, nehmen Gedanken und Motive wieder auf und kreisen ihre Gegenstände von verschiedenen Seiten ein. Andererseits zielen sie auf den Dialog mit den poetologischen Essays von Grünbein und Oleschinksi. Schon der erste Haiku – „Über die Schwelle / gehen: falsch! / Kriechen“ nimmt jenen bei Grünbein an den Anfang gestellten Zusammenhang wieder auf und nimmt zugleich in der Differenz von „gehen“ und „Kriechen“ die bei Grünbein schon von Beginn an charakteristische Emphase zurück: „Gedichte? Nein, man erhält nicht zuerst einen Gegenstand, einen Stil, eine eigene Bilderwelt, man wird, wenn die Stimme sich ihren Weg bahnt, zuerst mit einer Gehirnhelligkeit konfrontiert, mit der strahlenden Idiosynkrasie eines Menschen, der die Dinge nicht anders sehen kann als er sie sieht, den die Dinge nicht anders ansehen als in dieser besonderen Anordnung.“ Dem Dreizeiler von Waterhouse ist ein Aspekt der „Korrektur“ eigen, und insofern ist der Titel des Buches durchaus stimmig gewählt. Spricht Grünbein von der „strahlenden Idiosynkrasie eines Menschen“, so richtet Waterhouse den Blick buchstäblich nach unten, bevor im nächsten Dreizeiler ein neues Element hinzu kommt, das „Wunder des Kriechens“.
Auch bei Oleschinski setzt Waterhouse jeweils Seite für Seite mit einem Haiku seinen Kontrapunkt. Die Lyrikerin, die in ihrem Poetik-Essay reflektiert die Emphase und das Pathos Grünbeinscher Autoren-Poetik auflöst, nimmt das Motiv des Über-die-Schwelle-Gehens wieder auf: „Gedichte das wäre eine mögliche Beschreibung – gehen über Grenzen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie überqueren kann. Manche dieser Grenzen liegen ganz nah; es sind die zufälligen und veränderlichen Grenzen meiner Person, meiner Biographie, meiner Erfahrungen. Andere Grenzen sind sehr viel ferner, schwerer zu bestimmen und schwerer zu erreichen:
eine Spur von Schnee auf dem Dach eines japanischen Hauses, der offene Beinstumpf eines russischen Soldaten in Grosnyj, die Songlines der australischen Aborigines.
Waterhouse nun setzt beim Aspekt der fernen Grenzen an:
Nicht die Einschlaglöcher von Karlovac
sondern der Mann, die Leiter
da auf der Februarerde
Dieser Dreizeiler wird zum Ausgangspunkt eines Zyklus, der nicht nur thematisch an E 71 erinnert, sondern auch in seiner fragmentarisch-unabgeschlossenen Verfahrensweise, die noch einmal die Stärke der kurzen Waterhouseschen Gedichte demonstriert. Es wird – auf derselben Seite – über Poesie und Poetik gesprochen, ein Binnendiskurs, ein Autorendialog, freilich einer, den Lyrik selbst unterbricht, in diesem Falle als Verknüpfung des gemeinsamen Gesprächs mit jenen Wirklichkeiten und Wirklichkeitskonzepten, über deren Valenz und deren Poesie-Bezug in den Essays angestrengt nachgedacht wird.
In „Gedichte und Teillösungen“ hat Waterhouse noch einmal auf die Bedingung jenes Dialoges aufmerksam gemacht: „Das Zuhören muß nicht zu einem Resultat kommen.“ Diese Prämisse ist zuletzt ein poetologisches Grundaxiom des Autors, das sich auch im Begriff der „Teillösungen“ aufspüren läßt. „Ich sitze mit Teillösungen am Tisch. Und draußen der größere Baum, eine Pappel, singt einen leisen Teil.“ Dann folgt ein Dreizeiler: „Haselstrauch / der gestikuliert / vielbeschäftigt“: Paradigma jener ,Teillösung‘, die Poesie ist. In seinem Essay „Das Wort“ hat Waterhouse am Beispiel des japanischen Dichters Bashô (dem er offenbar ein besonderes Interesse an Haikus verdankt) auf die Überlegenheit der Teile gegenüber dem Ganzen, dem Fertigen, aufmerksam gemacht: „Nicht ganze Gedichte, nur Verse oder Teile von Versen schreibt Bashô aus der Erinnerung auf. Er zitiert nie vollständig, er umgibt die erinnerten Verse mit Ungesprochenem, er gibt ihnen ,eine Neigung zu Winzigkeit und Nichtexistenz‘. (…) Das Zitat in seiner Verkürzung richtet sich auf das Wenigbedeutende, Geheimnislose, denn von dort aus nur kann einer des Ganzen und des Kontinuums gewahr werden, in einem Aufgehen aus unbedeutender Selbstvergessenheit.“ Vor solchem Horizont korrespondiert die radikale Position des Waterhouseschen Sprachdenkens, jener Gestus des Verses „Mit keinem Wort ein Wissen“, einer ständig neu erfahrenen Schreibsituation: „Jedes Gedicht, das ich sage und schrieb oder schreiben wollte, kam aus einem: Ich kann nicht sprechen ich habe keine Wörter. Und immer wieder einmal war diese Schwelle mit Rhythmus zu überbrücken.“ Solche „Teillösungen“ stellen die Haikus der Schweizer Korrektur dar, ebenso – bei aller Verschiedenheit – die kurzen Gedichte in passim und in E 71. Sie folgen einer Poesie der „gebrochenen und verstümmelten Laute“, zu der sich Waterhouse in seinem Essay „Das Wort“ bekennt: „Die Heimatlosigkeit und die gebrochenen und verstümmelten Laute sind das Ganze.“ Von hier aus, nicht von zitierter oder selbst ersonnener Sprachphilosophie in Versen, gewinnt Peter Waterhouse eigene Konturen im Schattenriß aktueller Lyrik.
Hermann Korte, in: TEXT + KRITIK – Peter Waterhouse Heft 137, edition text + kritik, Januar 1998.
Jedes Wort eine Sprache
– Zu Peter Waterhouse. –
Begegnet bin ich ihm vor unseren Tagen in Siena nicht. Nur seinen Gedichten, seiner Prosa – einer eigensinnig entfesselten Sprachemphase, hymnisch und spröde, von weit her und doch ganz gegenwärtig nah.
„Es ist ein Toben um Sprache“, „ein Stürzen durch die Bedeutungen“ in seiner Poesie, seiner Prosa:
Wir reisen
durch das Meer der Bestimmungen
in Penelopes Gestalt.
Kennenlernen konnte ich vor unseren Siena-Tagen diesen Autor mit dem englischen Namen nicht. Nur Markierungen und Maskierungen der Biographie – und nur einmal, in einem Werk, das mehrere hundert Gedicht- und Erzählseiten umspannt, wird die Verschwiegenheit durchbrochen:
Ich war Sohn eines englischen Offiziers. Ich war Sohn des nach dem Ende des Weltkriegs im Ausland heiratenden Offiziers.
Geboren in Berlin (1956), gewohnt in Wien, studiert dort und in Kalifornien, gelebt in Rom, aus Wien hierher gekommen.
Also: Biographische Bewegungen über Sprachgrenzen, Sprachverflüssigungen. Jeder Sprache ihr Wort, aber auch und vielmehr:
Jedes Wort eine Sprache.
– Anzeichen des Dichters.
Aber soll notwendig sein für den nicht einzig die Sprache, alles andere nur biographisch – unterhaltsam, interessant –? Hat der Dichter sich nicht entschieden, die Welt zuallererst als Sprache zu sehen? Weltwirklichkeit als Sprache, für sich, für uns, Wort- und Welthaltigkeit in einem.
Peter Waterhouse ist ein Dichter – von weither und doch ganz gegenwärtig nah. So, als ob seine Dichtung von ihm selbst mehr wüßte als er von ihr. Eine Dichtung, vorangetrieben in Sprachanläufen, die mit Sprache gegen Sprache sprechen, eine Dichtung, die voller Zweifel die Möglichkeit eines Erschließens jener Weltwirklichkeit durch Sprache befragt. Paradoxes Sprachschweigen, anarchisch – und im fern-nahen Hintergrund erinnert Paul Celan uns daran, daß das Gedicht sich am Rande seiner selbst behaupte.
Hier in Siena nun bin ich Peter Waterhouse begegnet, spreche lobredend von ihm, wissend, von der Kunst ist ,gut reden‘ vom Gedicht, vom „Gestaltaugenblick“ nur schwer; kommentiere „voll Eifer, ohne Maß und mit viel Übertreibung“, um auch einmal unseren Schutzpatron Petrarca zu zitieren.
In Siena habe ich Peter Waterhouse kennengelernt, und schon vorher hatte ich bei ihm gelesen:
Indem wir uns nähern, in der schönsten Weise
entfernen wir uns.
Nun – ich will mich Peter Waterhouse noch einmal nähern.
Zitat Eins:
Ich saß als Zuhörer des öffentlichen Vortrags. Der Vortragende sprach von der Kunst als der Teilnehmerin an der falschen Gesellschaft. Der Vortragende sprach von der Wirkungslosigkeit der Kunst.
Zitat Zwei:
Am Ende des Vortrags war das Nichtsprachliche fort. Am Ende des Vortrags war das Schweigende undenkbar.
„Guten Tag Kunst: So muß man beginnen.“ – So beginnt eines der dichterischen und spielerischen, aber immer um Erkenntnis bemühten Exerzitien des Peter Waterhouse. Aber: Was sind das für Zeiten für ein Gedicht. Trostlose gewiß, wenn vom Gedicht, von Verszeilen nur trostspendend Sinnsuche erwartet wird oder der unbekümmert tönende Wohlklang schönen Scheins. „Schön ist das falsche. So lernt man gehen.“ – Und vielleicht Gedichte schreiben.
Mit hermetisch wirkender Widerständigkeit empfangen die von sprachlicher Konvention gelösten, Prosa und Poesie umspielenden Wortbewegungen, die rätselhaften Sprachgehäuse, Sprachebenen und Sprachfelder des Peter Waterhouse den Leser – und den ,lyrischen Betrieb‘ unserer Rezensionstribunale, denen das „Schweigen undenkbar“, aber deren oft unverständige Ignoranz auf ihre Weise beredt wird. Noch ein Motiv, den Autor Peter Waterhouse mit dem Preis zu ehren, der nach Nicolas Born benannt ist, in dessen Gedicht „Kind“ wir die Zeilen lesen:
du wirst sehen, daß die Ordnung
aus lauter Unordnung besteht
und an einigen Wörtern (entschuldige) wirst du dir den Kopf stoßen.
Widerständige Wörter – passim, so programmatisch benannte Peter Waterhouse nicht nur ein vor vier Jahren erschienenes taubenblau auffälliges Gedichtbuch – nach dem Gedichtband Menz von 1984 und dem Prosaband Besitzlosigkeit. Verzögerung. Schweigen. Anarchie von 1985 sein drittes Buch. Es versammelt rund 80 erschriebene Gedanken – Gedichte.
„Passim“ – so heißt es in dem Gedicht „Darübergeflogen“:
Schnell ist es gesagt: Es flog die Namenlosigkeit über
mich und uns. Das sage ich langsam. So
darf man eine Zeit mitfliegen und heißen
wie welcher nicht heißt wie wir
mit dem schnellen Tunnel, wo einer nicht weiß
mit dem Wald, der nie so hieß, schwarz und schwarzlos
mit dem weißen Vogel, der sich zerreißt zu werden
mit dem Ende im Ende im Ende
mit dem o, mit dem ich, mit dem wir
mit noch weniger, mit den vielen Worten
über uns, über die Welt, nichts hält zusammen
passim muß ich sagen, es ist alles gesagt, nichts
ein Atem, ein Name, wo sind wir jetzt
Kein Name, die Finger, die Hose, der Sessel
ein Flug: Das ist bald gesagt.
„Zerstreut“ und „durcheinander“ – passim – soll lyrisches Sprechen sprachverrückend werden, „hier und da“ und „allenthalben“ – passim – vor dem entmachtet-zersplitterten Ich des lyrischen Sprechens. Bildlichkeit und Bedeutung, Grammatik und Gesetze des Sprechens sind aufgehoben, Zeichen und Bezeichnetes zersetzt. Sprach- und Schreibakt als Sabotage an Sinn- und Satzzusammenhang: Verwerfungen, Verschiebungen, Verwandlungen. „Voraus“, so lauten Gedichtzeilen, „voraus heißt sozusagen den Bedeutungen voraus. Man blickt zurück / in die Sprache.“ Und staunen wir, aber sprachlos, nicht oft genug im Angesicht einer von Namen, entblößten Wörtern und sinnlosen Bedeutungen verstellten, zugemüllten – uns enteigneten Welt?
Die Poesie des Poetologen Peter Waterhouse ist rückhaltlos. Sein dichterisches Sprechen, das Formen seiner Dichtkunst-Objekte geschieht im Wissen eines Maurice Blanchot, daß „Benennen die Gewalt ist, die das Benannte absondert, um es in der bequemen Form des Namens zu besitzen“.
„Der Name der Sprache“ – heißt es im gleichnamigen Gedicht: „Der Name der Sprache heißt: Abwesenheit“ – und so lesen wir weiter:
Ungarn. Donau. Pisa.
Maria. Apfelkern. Uns steht ziemlich vieles zur Verfügung.
Alles flieht. Wir bilden einen Vordergrund. Wir bilden
einen Grund. Unser Lob heißt: Wir haben gute Gründe.
Welche?
Daß „knallende Gelächter“ dessen, dem das Ich der lyrischen Tradition, dieses archimedische Ich, längst nur noch „wilder Begriff“ sein konnte, das Gelächter dessen, der radikalisierte sprachskeptische Tradition mit Sprachwitz und Heiterkeit paart, hallt im Leserkopf bei der Lektüre von Menz noch lange nach – jenem ersten Gedichtband des damals 28jährigen Peter Waterhouse. Assoziieren wir: Menz, Lenz, Büchner.
In einem Gedicht, das Peter Waterhouse „unperspektivisch“ nennt, ist zu lesen:
… Einzeln: Von allen Blickwinkeln betrachtet
sind wir so. Jeder ändert die Richtung und sagt: Der Einzelne. Und
sagt auch: Wir. Wir verstehen uns, so entsteht dieses oft benannte
Gebiet. Wir entzogen ihm gerne die Namen, das
macht es offen, auch uns. Wir lassen fallen
die Schritte: gehend kommen wir voran. Manchmal
stehen alle, als sei in Bewegung gekommen alles, also ein Wirbeln plus
von uns hineingeblasene Sprache. Zu den Bläsern sagt die Landschaft:
Ich bin die Landschaft. Ihr müßt wieder von neuem
beginnen. Ich bin das Große (das große Ich). Wer seid
ihr? Wir lachen nur. Oft weinen
wir…
Dem Satz folgt der Gegensatz, dem Anruf ein Widerruf, Verneinung, Form ist Frage.
„Wo ich in der Dichtung eine Schlüssigkeit gefunden habe, habe ich. aufgehört, zu lesen“: eine schlüssige Selbstauskunft. Nichts ,Festgebautes‘ bleibt belassen, das Gedicht als „Lebendigkeitsformel“ ist Bewegung in semantischen Zwischenräumen; es geht ins „Ungewisse“, und es überlebt nur, wo das poetische Wort „diskreter Punkt, unverfestigtes Etwas“ ist. Frei bewegt in unverankerter Sprache, ohne Dominanzverhältnisse, ohne Bedeutungshierarchie.
Kontinuierliche Sprachabfolgen in dichtend-erzählendem Beschreiben oder Gebote einer Entweder-oder-Logik zu suchen ist hier vergeblich: Denn „alles war Mittelpunkt“. Ihm gleich nah wollen die Worte und Sätze sein.
Sprache. Tod. Nacht. Außen – ein „Gedicht. Roman“ im Ineinander von Poesie und Prosa – nennt Peter Waterhouse sein bislang letztes, im vergangenen Jahr erschienenes Buch. Eine Sprach-, Entwicklungs- und Erinnerungsreise durch Städte, durch Landschaften, durch Gegenwärtiges und Vergangenes, durch Erfahrungen und Gefühle. Eine Sprachreise mit topographischen und literarischen Wegmarken.
Denn sein eigenes Dichten bespricht Peter Waterhouse in lesender Exegese exemplarischer Gedichte, das Lesen anderer erlaubt, das eigene Wollen besser zu verstehen.
Peter Waterhouse gehört zu jenen, und es sind so viele nicht, die mit ihren Gedichten denken, die spielerisch Sprache zum Bewußtsein ihrer selbst führen wollen, die – so versteht er das Wort: experimentell – die Schlüssigkeit von Sprache abtasten wollen. Peter Waterhouse gehört zu jener kleinen Gruppe junger Autoren, die poetologisch denken und poetisch schreiben.
An anderem Ort notiert er, „die größte Bewegtheit habe ich empfunden bei an die Verschwiegenheit grenzenden Büchern, beim 33. Petrarca-Gedicht von Pastior“ oder – wie wir in jenem Gedicht. Roman Sprache. Tod. Nacht. Außen lesen – beim Gedicht „Yaddo“ von Carl Rakosi, bei „Stimmen“ von Paul Celan und bei „Silizium, Kohlenstoff, Kastelle“ von Andrea Zanzotto – Zanzotto, den Peter Waterhouse auch mit ins Deutsche übersetzt hat.
Überhaupt: Die Bücher von Peter Waterhouse durchziehen staunenswerte Echos, Anverwandlungen und Resonanzen, der späte Hölderlin, Trakl, Eich, die Wiener Gruppe.
Kennt aber mehr
als die Anfänge einer?
„Es könnte werden die Erweiterung der Geschichte“ – lautet eine Zeile bei Peter Waterhouse. Es könnte werden die Erweiterung des Gedichts, die Erkundung seiner „Rückseite“, die diesen Dichter in Hölderlinie an die Randzonen unserer eingeebneten und einebnenden Sprechweisen und Schreibformen führt.
Gedichte, dunkel jenen, die die Alltagssprache hell finden; verschlossen jenen, die das Mallarmé-Diktum vergessen haben, daß ein Gedicht nicht ohne die Suggestion vorstellbar ist, die dem Ungesagten entstammt.
Es könnte werden eine Erweiterung bis an den abgründigen Rand der Sprache, bis an jene Grenze, deren andere Seite der Sprachlogiker Ludwig Wittgenstein, den Peter Waterhouse gut studiert hat, das „Unaussprechliche, das Mystische“ nannte. Eine Grenze, an der alles Schreiben von Peter Waterhouse spielerisch tastend sich entlang bewegt, diesseits – und jenseits, wo der Suche das Schweigen antwortet als andere Form der Wirklichkeit.
Vielleicht höre ich auf
(in Gedichten langsam aufhören)
ich glaube dieses Gedicht ist nicht zu gebrauchen
ich glaube dieses Gedicht ist wirklich für mich.
Ich habe aufgehört: mit einem Gedicht des Nicolas Born, dem ich nie begegnet bin, den ich nie kennengelernt habe. Aber während der Tage hier in Siena Peter Waterhouse, dem wir, die neue Jury, Rainer Goetz, Wolfgang Hilbig, Uwe Kolbe und ich, den Nicolas-Born-Preis verliehen haben.
Christian Döring, Laudatio zur Verleihung des Nicolas-Born-Preises 1990 an Peter Waterhouse, erschienen in Petrarca-Preis / Petrarca-Übersetzer-Preis / Nicolas-Born-Preis, Band 4 1989–1991, Edition Petrarca
Literarische Selbstgespräche … keine Fragen stellte Astrid Nischkauer – Von und mit Peter Waterhouse
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Peter Waterhouse liest beim Tanz um das goldene Nilpferd am 10.3.2012 im Klagenfurter Ensemble.


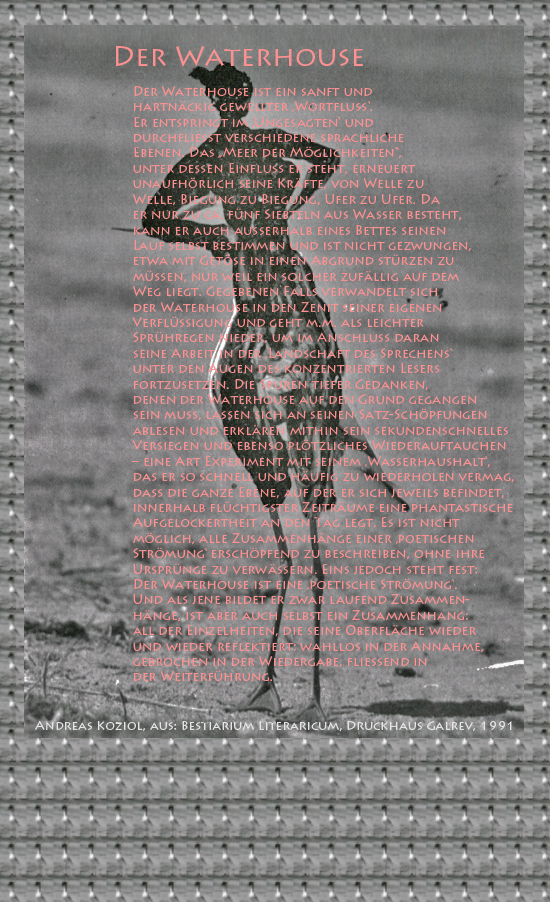













Schreibe einen Kommentar