Reiner Kunze: Brief mit blauem Siegel
PUSCHKINS MICHAILOWSKOJE
aaaaa„Die front ging hier
aaaaadurch den garten“
Beklommen, doch
ohne schuldgefühl
Verzeiht
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
„Nichts währt ewig“
– Reiner Kunze darf in der DDR wieder publizieren. Ein Text von 1973. Ein Fundstück nach genau 40 Jahren? –
In diesen Tagen wird vom Leipziger Reclam Verlag ein Gedichtband von Reiner Kunze für die DDR ausgeliefert. Sein Titel: Brief mit blauem Siegel. Die Auflage beträgt 15.000 und soll bereits, wie in Leipzig zu hören war, an die Buchhändler verkauft sein. Reiner Kunze kann in der DDR also wieder veröffentlichen. Als der Ost-Berliner Sonntag am 28. Januar vier Kunze-Gedichte aus dem neuen Band abdruckte, schien es bereits sicher, daß der in der DDR nach 1968 scharf kritisierte und unterdrückte Autor wieder würde publizieren können.
Kunze stellte mit dem Leipziger Reclam Verlag eine Auswahl aus den beiden in der Bundesrepublik erschienenen Gedichtbänden Zimmerlautstärke (S. Fischer 1972) und Sensible Wege (Rowohlt 1969) zusammen, ergänzt durch vier neue, noch unveröffentlichte Arbeiten wie das Gedicht „Vierzehnjährige“ aus dem Jahre 1972.
Man wird nun im Westen mit der Lupe untersuchen, welche Gedichte Kunzes nicht in dem DDR-Bändchen vertreten sind. Daß Widmungsgedichte für Biermann und Solschenizyn fehlen, mag man bei uns kritisieren. Bemerkenswert in jedem Fall, daß Kunzes Siebenzeiler „Dorf in Mähren“ (1967) präsent ist mit der wörtlichen Stelle: (für Peter Huchel). Wie überhaupt das tschechische Element, also die Gedichte, die über die ČSSR handeln – Eindrücke bei Besuchen tschechischer Kollegen etwa – relativ stark ausgeprägt ist.
In dem Gedicht „besuch in Mähren bis nach mitternacht“ (1967) heißt es:
Bei Halas am grabstein, erbarmungslos
wie die wahrheit, welkte sie
bevor wir gingen.
Halas, das muss man wissen, geriet kurz vor seinem Tod 1949 über die Politik der Kommunistischen Partei in selbstzerstörerische Zweifel. In dem Gedicht bei „E. in Vřesice“ werden die heute in der ČSSR unterdrückten Lyriker Jan Skácel und Ludvík Kundera zu Handlungsträgern.
Man sollte im Westen Kunzes für die DDR neuen Lyrikband nicht so sehr danach beurteilen, was alles fehlt, sondern zunächst ausschließlich danach, wie der Band sich einem DDR-Leser präsentiert. Und da stellt diese Edition sicherlich einige Ansprüche an den, der mit Kunze-Versen, ihrer hintergründigen Verschlüsselung, ihren Mehrfachanspielungen und -bedeutungen nicht so vertraut ist.
Aus den „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“ (1966/67) fehlen die Gedichte, die das schwierige Ost-West-Verhältnis etwa bei der Kommunikation durch den Postweg reflektieren. Zoll und Zensur eingeschlossen. Es fragt sich, ob die weggebliebenen Passagen tatsächlich eine Selbstkritik Kunzes darstellen, ob nicht vielmehr heute, kurz vor dem 7. DDR-Schriftstellerkongreß, eine ganz andere DDR-Wirklichkeit (als damals) existiert, in der die Post einen intellektuellen Empfänger in der DDR gewöhnlich erreicht. Mit der Formel Nachholbedarf mag man im Westen meinetwegen operieren.
Kunze will seine Manuskripte in Zukunft zuerst Verlagen in der DDR anbieten. Sein jetzt bei Reclam in Leipzig erschienenes 133-Seiten-Bändchen (es kostet 1,50 Mark) ist ein erfreulicher Neuanfang für den Autor. Sinnigerweise darf Kunzes DDR-Veröffentlichung nicht in den Westen geliefert werden. Gegen die gesamte Leipziger Reclam-Produktion hat der Stuttgarter Reclam-Verlag in der Vergangenheit sein Veto bei den bundesdeutschen Justizbehörden eingelegt.
Brief mit blauem Siegel, der Titel des Kunze-Bandes, bezieht sich übrigens auf das Stephan Hermlin zugeeignete Gedicht „Fast ein frühlingsgedicht“:
Vögel, postillione, wenn
ihr anhebt kommt der brief
mit dem blauen Siegel, der dessen briefmarken
aufblühn dessen text
heißt:
Nichts
währt
ewig.
Das gesamte Buch widmete Kunze „meiner Frau, meinen freunden“.
A.W. Mytze, Berliner Liberale Zeitung, 15.9.1973
Die DDR-Auswahlbände Poesiealbum 11 (1968)
und Brief mit blauem Siegel (1973)
Öffentlichkeit in der DDR, das hieß für Reiner Kunze in den Jahren zwischen 1962, als er sich als freier Schriftsteller in Greiz niederließ, und 1977, als er gezwungenermaßen in die Bundesrepublik übersiedelte, Öffentlichkeit trotz Publikationsverbot, Rezeptionsbehinderung und zunehmender Überwachung durch den Staatssicherheitsdienst.
Schließlich sind Kunze-Werke auch auf andere Weise in der DDR verbreitet – allerdings nicht im Buchhandel. Wie in der Sowjetunion die Samisdat-Literatur, so hat sich in der DDR die handgefertigte Abschrift verbotener Bücher bewährt: Kunze-Werke und Biermann-Texte kursieren im ganzen Land.
Zwei Auswahlbände mit Gedichten Reiner Kunzes, die 1968 und 1973 in der DDR erscheinen konnten, sind Ausnahmen von der Regel jahrelanger Publikationsverhinderung.
(…)
Erst 1973 wurde dem Vierzigjährigen ermöglicht, nach Jahren der Publikations- und Rezeptionsverhinderung und nach der verunglimpfenden Kritik von Max Walter Schulz in der DDR eine zweite Gedichtauswahl zu veröffentlichen. Maßgebend dafür waren weniger die guten persönlichen Kontakte Kunzes zu Hubert Witt, dem damaligen Lektor des Leipziger Reclam Verlages, als vielmehr die veränderten kulturpolitischen Bedingungen in der DDR, die einen zuvor diffamierten und isolierten Autor mit einer 93 Gedichte umfassenden, preisgünstigen und auflagenstarken Ausgabe vielen Lesern nachdrücklich vorzustellen erlaubten. Die kulturpolitische Liberalisierung stellt Zipser zu Recht in einen größeren Zusammenhang innen- und außenpolitischer Veränderungen:
Die einsetzende Auflockerung war Folge einer globalen Entspannungsphase, die auch den kulturellen Bereich erfaßte. Der XXIV. Parteitag der KPdSU, der Anfang 1971 in Moskau stattfand, konstatierte eine Festigung des sozialistischen Weltsystems, das trotz aller Gegensätze zur westlichen Welt eine Politik der friedlichen Koexistenz gestattete. Ulbricht, der dieser neuen Entwicklung entgegenstand, trat im Mai 1971 als Erster Sekretär des ZK der SED zurück und wurde von Erich Honecker ersetzt. Im Rahmen der ,détente‘ zwischen den Großmächten verbesserte sich auch das Klima zwischen den beiden deutschen Staaten. Die de-facto-Anerkennung der DDR in Bundeskanzler Willy Brandts Regierungserklärung vom 28.10.1969, die beiden Treffen zwischen BRD-Kanzler Brandt und DDR-Ministerpräsident Willi Stoph in Erfurt und Kassel im Frühjahr 1970 und der Vertrag von Moskau am 12.8.1970, in dem sich die BRD verpflichtete, die heutigen Grenzen in Europa zu achten, waren Schritte auf dem Wege zum Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der BRD, der am 21.12.1972 unterzeichnet wurde.
In der offiziellen Geschichte der SED von 1978 heißt es zu der anfangs von Zipser konstatierten in den siebziger Jahren zu beobachtenden kulturpolitischen Liberalisierung:
Den Schriftstellern und Künstlern erwuchs daraus die Aufgabe, die ganze Breite und Vielfalt des Lebens zu erfassen und noch mehr Werte zu schaffen, die durch ihre Wirklichkeitsnähe, Volksverbundenheit und Parteilichkeit zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten beitragen. Das Zentralkomitee wies darauf hin, daß die sozialistische Nationalkultur alle fortschrittlichen Traditionen der deutschen wie der Weltliteratur bewahrt und weiterführt.
In dieser von Sprachregelungen bestimmten Geschichtsschreibung der SED läßt sich heute kaum noch die Veränderung der Kulturpolitik erahnen, die auf der VI. Tagung des ZK der SED im Juni 1972 eingeleitet wurde. Kurt Hager, einer der führenden Kulturpolitiker der Partei, formulierte auf dieser Tagung das neue Realismusverständnis, indem er die Künstler und Schriftsteller aufforderte, „eine reiche Vielfalt der Themen, Inhalte, Stile, Formen und Gestaltungsweisen“ zu erschließen, und er erklärte, von der nivellierenden Kulturpolitik der Ulbricht-Ära dezidiert abweichend: „Konfliktlosigkeit steht der sozialistischen Kunst nicht zu Gesicht, sie ist ein Verstoß gegen die Lebenswahrheit in unserer Kunst, es gibt sie weder im gesellschaftlichen noch im persönlichen Leben.“
Eine zweite große Lyrik-Debatte löste eine Rezension des Buches Verse, Dichter, Wirklichkeiten des Jenenser Literaturwissenschaftlers Hans Richter aus, in der Adolf Endler der DDR-Germanistik vorwarf, der Lyrik der DDR, insbesondere den Gedichten der Generation Volker Brauns gegenüber, versagt zu haben. Dieser Lyrik-Debatte folgte 1972 in der damals noch von Wilhelm Girnus redigierten Zeitschrift Sinn und Form eine lang andauernde, kontrovers geführte Diskussion um Ulrich Plenzdorfs Stück Die neuen Leiden des jungen W., dessen Drehbuchfassung in der Märznummer derselben Zeitschrift abgedruckt worden war.
Die auf dem VII. Schriftstellerkongreß der DDR im November 1973 bestätigte Distanzierung vom Programm des Bitterfelder Weges und die Bekräftigung der von Honecker initiierten Erneuerung der Kulturpolitik manifestierte sich auch in der Veröffentlichung zweier von Reiner Kunze hochgeschätzter Bücher, den tagebuchartigen Aufzeichnungen 22 Tage oder die Hälfte des Lebens von Franz Fühmann und dem Essayband Lektüre von Stephan Hermlin. Rolf Schneider sieht in diesen 1973 erschienenen Büchern von Fühmann und Hermlin das neue Literaturverständnis in der DDR der siebziger Jahre exemplarisch formuliert:
Es ist das Programm einer skeptischen, sich zu Intellektualität, Sensibilität, Weltoffenheit und einer auch problematischen Weltliteratur und Tradition bekennenden Poetik.
Schneiders Kennzeichnung ist auch für Kunzes Auswahlband Brief mit blauem Siegel zutreffend, der 1973 in einer für einen Lyrikband erstaunlichen Auflage von 15.000 Exemplaren erschien und der 1974 eine Nachauflage in derselben Höhe erlebte.
Die Bedeutung dieses Bandes für die Rezeption Kunzes in der ehemaligen DDR ist vor allem deswegen so groß, weil es Kunzes letzte Buchpublikation in der DDR war und weil es in einem Zeitraum von 27 Jahren (1962-1989) die einzige Buchveröffentlichung dieses Autors in der DDR war, in der seine Themen, Motive und ästhetischen Möglichkeiten annähernd repräsentiert sind.
Die bis auf die Aufnahme einiger vom Verlag vorgeschlagener älterer Texte von Kunze selbst besorgte Auswahl enthält Gedichte aus den Jahren 1954 bis 1972. Bis auf vier Gedichte sind alle Texte – wenn auch mit kleineren Textvarianten – bereits in den Bänden Vögel über dem Tau, Widmungen, Sensible Wege und Zimmerlautstärke veröffentlicht worden. Das Titelgedicht „Fast ein Frühlingsgedicht“ hat Kunze ostentativ Stephan Hermlin gewidmet, dem Entdecker und Förderer vieler Autoren der Generation Volker Brauns, der sich stets, wie sein Essayband Lektüre unter Beweis stellt, für eine Rezeption der literarischen Moderne in der DDR eingesetzt und der sich nie vorbehaltlos mit dem orthodoxen sozialistischen Realismus identifiziert hat.
Der Publikumszuspruch für Kunzes Auswahlband Brief mit blauem Siegel war auch für DDR-Verhältnisse außerordentlich, was sich nicht nur an der innerhalb weniger Tage verkauften hohen Erstauflage zeigte, sondern auch durch Briefe an den Autor evident wird:
„Ihr Brief mit blauem Siegel […] war hier weg in den Geschäften wie in den Hungerjahren das Brot.“ – „Montag kam Brief mit blauem Siegel an […] Mittwoch waren sie ausverkauft! Das ist bisher mit keinem Band dieser Reihe geschehen! (Bei Braun nicht, bei Wiens nicht, selbst bei Kunert nicht.)“ – „Ich kenne nicht wenige, die mit dem Brief mit blauem Siegel wie mit einem Brevier umgehen.“
In den wenigen literaturkritischen DDR-Artikeln zu Kunzes Auswahlband ist der Tenor vorherrschend, Kunzes frühe Gedichte aus den Bänden Vögel über dem Tau und Widmungen seien aus inhaltlichen und ästhetischen Gründen den späteren Texten der Bände Sensible Wege und Zimmerlautstärke grundsätzlich vorzuziehen. Eveline Rolands etwa schreibt im FDJ-Organ Junge Welt, indem sie dezidiert auf diese frühen Gedichte eingeht, der Auswahlband gebe Hoffnung auf einen Dichter, der der DDR und nicht dem Klassenfeind nützlich sei. Hinter dieser Feststellung verbirgt sich noch der 1969 von Max Walter Schulz erhobene Vorwurf, Kunzes Gedichte im Band Sensible Wege seien eine „böswillige Verzerrung des DDR-Bildes“. Schulz hatte Kunze zudem des Individualismus bezichtigt, und auch diese Abqualifizierung eines um Rehabilitierung des Ich bemühten Lyrikers findet sich in einer DDR-Rezension des Bandes Brief mit blauem Siegel wieder. Lothar Creutz, der in seiner im Satire-Magazin Eulenspiegel publizierten Buchkritik am Maßstab der Verständlichkeit festhält und Gedichte fordert, die „für den Professor wie für die Laborantin oder für jeden lesenden Arbeiter“ nachvollziehbar wären, schreibt:
Ganz abgesehen davon, daß Kunzes Rückzug auf die eigene Individualität in vielen Gedichten der späteren sechziger und siebziger Jahre schon in Eigenbrötelei ausartet, hat seine lyrisch dokumentierte Selbstisolierung auch zu einer stofflichen und formalen Verarmung geführt, in der Sprachkunst zur Chiffrierkunst wird. Mit allem elitären Hochmut übrigens gegen jene, die in der Kunst des Dechiffrierens unbewandert sind oder weder Lust noch Zeit dazu haben.
Neben dem großen Leserzuspruch, der geringen Beachtung und klischeehaften Zurückweisung durch die DDR-Literaturkritik ist noch die Einschätzung des Auswahlbandes durch Schriftstellerkollegen aus der DDR beachtenswert, zeigt sie doch aufs neue Kunzes Außenseiterposition innerhalb der Gruppe namhafter und im westlichen Ausland stark rezipierter DDR-Autoren. In seiner aufschlußreichen dreibändigen Dokumentation zur Literatur der DDR hat der amerikanische Literaturwissenschaftler Richard A. Zipser in Interviews mit 45 renommierten DDR-Schriftstellern auch die Frage nach den wichtigsten und wegweisenden Werken in der DDR-Literatur der siebziger Jahr gestellt. Als einziger von den befragten Autoren nennt Bernd Jentzsch die Gedichte Reiner Kunzes. Niemand sonst erwähnt dessen Namen oder einen seiner Gedichtbände, wobei zu berücksichtigen ist, daß Wolf Biermann, dessen Solidarität mit Kunze in jenen Jahren mehrfach nachzuweisen ist, nicht zu den von Zipser Interviewten zählte.
In der Bundesrepublik, wo der Auswahlband Brief mit blauem Siegel nie in den Buchhandel gelangt ist, wurde sein Erscheinen von vielen Rezensenten als Indiz jener liberaleren Kulturpolitik unter Honecker gewertet. Überdies sahen die meisten bundesdeutschen Literaturkritiker in dem Band einen „reichen“ und „repräsentativen“ Querschnitt durch das lyrische Werk Kunzes. Manfred Jäger betont den Kompromißcharakter dieses Bandes, während Jörg Bernhard Bilke sogar von einer Auswahl spricht, „die politisch entschärft und somit kulturpolitisch verfügbar gemacht“ worden sei. Reiner Kunze selbst hat in seiner Dankrede anläßlich der Verleihung des Literaturpreises der Bayerischen Akademie der Schönen Künste im Juli 1973 in der ihm eigenen Apodiktik formuliert, daß es für ihn in der Kunst, im Kunstwerk keine Kompromisse gebe, und sich dagegen verwahrt, primär als oppositioneller und politischer Schriftsteller verstanden zu werden:
Meine Damen und Herren, die es angeht: diese Gedichte entstehen nicht, weil ich – wie es des öfteren heißt – ein Oppositioneller bin, sondern sie entstehen, weil ich ein Schriftsteller bin oder mich zumindest bemühe, im Rahmen meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten das zu tun, was nach meiner Meinung ein Schriftsteller tun sollte.
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Bandes Brief mit blauem Siegel sind Kunzes Äußerungen neu zu interpretieren. Seine Intention zu Anfang der siebzig er Jahre, „in erster Linie in der DDR ein verlegerisches Zuhause zu finden“, manifestiert sich bei aller Kompromißlosigkeit in der Literatur doch in augenscheinlicher Kompromißbereitschaft bei der Zusammenstellung eines in der DDR publizierbaren Auswahlbandes seiner Gedichte. Das in der Dankrede artikulierte existentielle Selbstverständnis Kunzes ist wenige Wochen vor dem Erscheinungstermin von Brief mit blauem Siegel bereits Kennzeichen einer Auswahl, die namentlich auf einige der dezidiert politischen Gedichtet verzichtet. Insofern ist Kunzes Selbsteinschätzung der Auswahl zu korrigieren, denn gerade jene Gedichte, die der Auswahlband von 1973 nicht berücksichtigt und an denen Kunze 1986 in einer anderen Gedichtauswahl festgehalten hat, sind für das Auswahlprinzip aufschlußreich. In einem 1973 geführten Gespräch mit Hubert Witt vom Leipziger Reclam Verlag nennt Reiner Kunze einige Intentionen der Auswahl:
Vielleicht wird auch etwas von dem Spektrum sichtbar, das zwischen den großen Farben Schwarz und Weiß liegt. Zwischen Gedichten von physisch-existentieller Bedrängnis wie den „Nocturnes“ und so heiteren, fast übermütigen Gedichten wie „Bei E. in Vřesice“ oder „Die kunstbeflissenen Hähne von Leiningen“ gibt es Gedichte von den unterschiedlichsten Farbwerten. Und schließlich glaube ich, daß die Proportionen in bezug auf die Themen stimmen, für die wir uns in dieser Auswahl entschieden haben, so daß sie in sich ausgewogen sein und innerhalb des gewählten Rahmens ein scharfes Bild zeigen dürfte.
Bei genauerer Untersuchung der Zusammenstellung der Auswahl aber ist eher eine Unausgewogenheit festzustellen, von der vor allem Gedichte betroffen sind, die in ihrer direkten, unverschlüsselten Benennung politischer Fakten und Ereignisse sowie durch Nennung von Namen in der DDR von kulturpolitischer Brisanz waren. So fehlen in der quantitativ beachtlichen Sammlung fast alle Gedichte über den Prager Frühling und dessen gewaltsame Beendigung im August 1968, in denen Kunze als politisch engagierter Schriftsteller in Opposition zu seinem Staat tritt. Das Fehlen von Gedichten wie „Rückkehr aus Prag“ (WEGE), „wie die Dinge aus Ton“ (ZIMMER) und „Der Weg zu euch“ (ZIMMER) kann durch folgendes, die Ereignisse des 21. August durch Naturmetaphern vermittelnde Gedicht nicht aufgewogen werden:
FELDWEG BEI KUNŠTÁT
Mittags, die kornblumen standen
wie preußen im feld, verbarg sich
die wegwarte
Was war ihr die
im schatten einer wolke kränkelt ergraut im glas
über nacht (wie ein sensibler
in der zelle)
Gegen abend
schlug der hagel zu
Die Namen von Jan Skácel, František Halas, Milan und Ludvík Kundera deuten zwar in den aufgenommenen Gedichten Kunzes starke Rezeption der modernen tschechischen Poesie an, aber ein so entschiedenes poetologisches Gedicht wie „Horizonte“, das die Abkehr Kunzes von der Engführung eines sozialistischen Realismus darstellt, fehlt. Der Name Alexander Puschkins wird im Auswahlband genannt, nicht aber Alexander Solschenizyn, dem mehrere Hommage-Gedichte Kunzes gelten.
Das in Brief mit blauem Siegel aufgenommene Gedicht „Dorf in Mähren“ trägt zwar bemerkenswerterweise die Widmung „für Peter Huchel“ (WEGE), aber Kunzes bedeutenderes Gedicht „Gebildete Nation“ über und für diesen in der ehemaligen DDR nie ernsthaft rehabilitierten Dichter von internationalem Rang bleibt ausgeschieden. Auch Kunzes Gedichte über und für Wolf Biermann fehlen, so daß die Verteidigung der Poesie in Form der Apologie genannter Poeten in dieser Auswahl in auffälliger Weise verkürzt erscheint. Reiner Kunze versuchte allerdings außerhalb der Dichtung, eine Rehabilitierung Wolf Biermanns in der DDR zu unterstützen, indem er die Veröffentlichung des Bandes Brief mit blauem Siegel von der Zusicherung des Leipziger Verlages abhängig machte, eine Biermann-Auswahl vorzubereiten. 1973 machte Kunze seine Zukunft als DDR-Schriftsteller ausdrücklich von der Zukunft Biermanns abhängig, als er in einem Interview erklärte:
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es, wenn es keine Biermann-Auswahl geben wird, auf die Dauer einen in der DDR publizierenden Kunze geben wird.
Auch Gedichte wie „Dreiblick“ (WEGE), „Dezember“ (ZIMMER) oder „Zimmerlautstärke“ (ZIMMER), die Kunzes eigene Situation als zensierter und isolierter Schriftsteller in der DDR sichtbar machen und die von der Ohnmacht des Dichters gegenüber realer politischer Macht handeln, bleiben im Auswahlband ausgespart. Schließlich ist auch das Fehlen jener Texte zu konstatieren, die das Thema der deutschen Teilung – eines der zentralen Themen im Werk Kunzes – aufgreifen, indem sie Schmerz, Trauer und Empörung über die innerdeutsche Grenze und das geteilte Land zeigen. Neben den Gedichten „Der Vogel Schmerz“ (WIDMUNGEN) und „Grenzkontrolle“ (ZIMMER) sind es namentlich einige Post-Variationen, deren Fehlen zur Unausgewogenheit der Sammlung beiträgt. Auch wenn man dem DDR-Publikum beim Entschlüsseln lyrischer Texte eine außerordentliche Kompetenz konzedierte, bleibt als Faktum, daß der Auswahlband Brief mit blauem Siegel ihm zwar ein breites Spektrum der Themen und ästhetischen Realisationen Kunzes geboten, daß er ihm aber den engagierten politischen Lyriker, der durch entlarvendes Zitieren und direktes Benennen Gesellschaftskritik übt, in starkem Maße und nicht zuletzt mit seinen besonders gelungenen Arbeiten vorenthalten hat. Auch Kunzes poetologische Notizen zu dem Bild „Wintereisenbahnerhochzeit“ von Jan Balet, die den Auswahlband beschließen, halten einem Vergleich mit den drei poetologischen Nachbemerkungen im Band Zimmerlautstärke nicht stand.
So bleibt es eine Tatsache, daß dem DDR-Publikum von den Autoren der Generation Volker Brauns neben Wolf Biermann auch Reiner Kunze bis zum Ende der DDR in keiner repräsentativen Auswahl zugänglich gemacht worden ist. Angesichts dieser Rezeptionsverhinderung war es nur konsequent, daß die DDR-Kultusbürokratie bei der vermeintlichen „Heimholung der Verfemten“ und bei ihren Rehabilitierungsversuchen der infolge der Biermann-Ausbürgerung ausgereisten Autoren niemals von Biermann selbst oder von Reiner Kunze sprach, wohl aber von Sarah Kirsch, Günter Kunert, Jurek Becker und Thomas Brasch.
Der Band Brief mit blauem Siegel mag im Jahre 1973 für den DDR-Autor Reiner Kunze, wie Kunert es ausdrückte, das „Maximum des Möglichen“ gewesen sein, nichtsdestoweniger ist die Selektivität dieser Auswahl eine Bestätigung folgender Feststellung Manfred Jägers über die liberale Kulturpolitik der DDR Anfang der siebziger Jahre:
Kurzum, die Literaten und Künstler hielten, was die neue Kulturpolitik versprach, erst für den Anfang, während die SED-Führung darin schon das Äußerste erblickte, was sie zu tolerieren bereit war. In dieser unterschiedlichen Interessenlage steckt der letztlich nicht überbrückbare Gegensatz der wechselseitigen Erwartungen. Es mußten freilich ungünstige äußere Umstände hinzutreten, ehe diese innere Widersprüchlichkeit das ganze Konzept spektakulär in die Krise führte.
Heiner Feldkamp: Poesie als Dialog. Grundlinien im Werk Reiner Kunzes, S. Roderer Verlag, 1994
Das aktuelle Interview
Lektor (Hubert Witt): Reiner Kunze, in einer ganzen Reihe von Reclam-Bänden haben sozialistische Autoren der DDR versucht, eine Art Bestandsaufnahme ihres lyrischen Werkes zu geben: Becher, der seinen Band noch selbst zusammenstellte, Brecht, der damals die Auswahl sanktionierte, Maurer, Hermlin, Kunert u.a., zuletzt Braun und Wiens. Ihre Auswahl brief mit blauem siegel (RUB Band 553) ist eine Zwischenbilanz. Was kann sie nach Ihrer Meinung leisten?
Reiner Kunze: Ich hoffe, in ihr kommt die Daseinsbejahung zum Ausdruck, die meinem Naturell entspricht, der Internationalismus, für den ich mich engagiere, und mein Bedürfnis, mich an der Suche nach Glücksmöglichkeiten für die Menschen zu beteiligen, was stets mit der Suche nach sprachlichen Möglichkeiten verknüpft ist. Vielleicht wird auch etwas von dem Spektrum sichtbar, das zwischen den großen Farben Schwarz und Weiß liegt. Zwischen Gedichten von physisch-existentieller Bedrängnis wie den „Nocturnes“ und so heiteren, fast übermütigen Gedichten wie „Bei E. in Vřesice“ oder „Die kunstbeflissenen Hähne von Leiningen“ gibt es Gedichte von den unterschiedlichsten Farbwerten. Und schließlich glaube ich, daß die Proportionen in bezug auf die Themen stimmen, für die wir uns in dieser Auswahl entschieden haben, so daß sie in sich ausgewogen sein und innerhalb des gewählten Rahmens ein scharfes Bild zeigen dürfte.
Lektor: Sohn eines verdienten Bergmanns, Studium der Philosophie und Journalistik in Leipzig, wissenschaftlicher Assistent an der Karl-Marx-Universität, dazwischen Arbeit in der Landwirtschaft und im Schwermaschinenbau, seit 1959 freischaffender Schriftsteller… Eine schwere Herzerkrankung… Ihre bisherige Entwicklung verlief nicht ohne Krisen, und Volker Braun schrieb dazu in einem seiner Gedichte:
Er ist kein Krieger, kein Lohnsklave, kein Konzernschreiber
Und doch kennt er den Kampf und Not und Qual
Er lebt unter uns…
Darf auch nur ein Mensch
Verlorengehn?
Hier?
Reiner Kunze, wir freuen uns, daß Sie nicht verlorengegangen sind.
Kunze: Ich werde mich auch hüten verlorenzugehen. Ich gehöre hierher, in dieses Land, in diese Gesellschaft. Im Gedicht ist der Dichter den anderen Menschen am nächsten. Ich möchte vor allem hier den anderen Menschen am nächsten sein.
Lektor: Was selbstverständlich zu einem Engagement für die Menschen in Vietnam nicht im Gegensatz steht.
Kunze: Keinesfalls. Nur resultiert diese solidarische Nähe – von Ausnahmen abgesehen – nicht aus der Kommunikation durch Gedichte. Hier muß der Dichter aus der Dichtung heraustreten, wie die fortschrittlichen Künstler immer auch außerhalb ihrer Kunst gegen die Barbarei aufgetreten sind, ich denke zum Beispiel an die Proteste, die der Überfall auf die Sowjetunion 1941 unter Dichtern, Malern und Komponisten von Weltrang hervorgerufen hatte.
Lektor: Sie schließen aber nicht aus, daß solche solidarische Nähe auch aus Kommunikation durch Gedichte entsteht. Sie selbst haben ja dafür ein Beispiel gegeben: Ihr Gedicht „Puschkins Michailowskoje“ hat, wie wir erfuhren, bei sowjetischen Kollegen einen tiefen Eindruck hinterlassen.
aaaaaaaaaa„Die front ging hier
aaaaaaaaaadurch den garten“
Beklommen, doch
ohne schuldgefühl
Verzeiht
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum
gegner hätten sie
mich…
Kunze: Dafür, daß ein Gedicht entsteht, durch das jene spezifische menschliche Kommunikation, jene Verringerung der inneren Entfernungen möglich wird, bedarf es einer poetischen Bildinspiration. Ein poetisches Bild ist nicht konstruierbar. Doch auch größte Erschütterungen müssen nicht oder nicht in dem Augenblick, in dem es aus außerkünstlerischen Gründen wünschenswert wäre, zu einem poetischen Bild inspirieren. Außerdem ist nicht jede Erschütterung geeignet, jeden Dichter zu inspirieren. Insofern meine ich, daß der Künstler gegebenenfalls auch außerhalb der Kunst wirksam werden muß.
Wenn also – wie geschehen – ein nicht unbedeutender amerikanischer Politiker es wagte, den Vietnamesen mit einem Atomschlag zu drohen, so werde ich meiner Stimme dadurch Gewicht zu geben versuchen, daß ich sie den vielen Millionen Stimmen hinzufüge, die diesen ungeheuerlichen Gedanken anprangern. Solch ein Gedanke darf niemals und nirgendwo auf der Erde verwirklicht werden können. Er sollte nicht einmal gedacht werden können! Wir müssen uns jeder imperialistischen Aggression entgegenstellen. Ich wünschte, daß dazu auch alle Gedichte beitrügen, indem sie der Abstumpfung durch Gewöhnung entgegenwirken.
In: Das Reclam Buch, Frühjahr 1973
Der Vater mit Rissen im Rücken
Die Gedichte in dem Band Brief mit blauem Siegel sind meistens neueren Datums, obwohl auch bis 1954 zurückgegriffen wird. Es ist gut, daß Kunze sich an seine Herkunft erinnert: der Vater noch im Schacht, mit Rissen im Rücken, Narben von niedergegangenem Gestein – der Sohn aber schon Dichter, der eben wegen seines Vaters von der Liebe singt. Wir sagen das, weil Kunze nicht immer sich dieser verpflichtenden Herkunft bewußt war in vergangenen Zeiten – wir hätten sonst nicht über den Umweg von Westberlin und der BRD Kenntnis von seinen Gedichten haben müssen.
Der Reclam Band gibt Hoffnung auf einen Dichter Kunze, der uns, und nicht dem Klassengegner nützlich ist. Sehr schön die Liebesgedichte, nachdenklich Verse über Krieg und Frieden („Der Himmel, blutleer, sank ins meer / Drei gänse keilten sich ins grau / Die stunden schwappten an die pfähle“), treffend viele Beobachtungen, die in der ČSSR und in der Greizer Heimat gemacht werden („Von einem brunnen weiß ich im süden mährens, / der einschläft / das moos unterm arm“). Manches allerdings geht noch zu sensible Wege.
Eveline Rolands, Junge Welt, 7.9.1973
„Sensible Wege“
– Kunze in der DDR rezensiert. –
Das FDJ-Organ Junge Welt hat in einer 36zeiligen Besprechung Reiner Kunzes neuen in der DDR erschienenen Gedichtband Brief mit blauem Siegel vorgestellt. Das im Leipziger Reclam Verlag herausgekommene Büchlein soll in einer Auflage von 15.000 verbreitet werden; es kostet 1 Mark 50. Die von Eveline Rolands gezeichnete Rezension bemerkt, daß es gut sei, „daß Kunze sich an seine Herkunft erinnert“: es wird der „Vater noch im Schacht, mit Rissen im Rücken“ als Kronzeuge einer „verpflichtenden“ Herkunft bemüht, deren sich Kunze – nach der Intention der Rezensentin – in vergangenen Zeiten nicht immer bewußt gewesen sei. „Wir hätten sonst nicht über den Umweg von West-Berlin und der BRD Kenntnis von seinen Gedichten haben müssen.“ Hier spielt die Rezensentin offenbar auf die beiden Gedichtbände Sensible Wege (Rowohlt 1969) und Zimmerlautstärke (S. Fischer 1972) an; Kunze hatte in dieser Zeit absolutes Publikationsverbot in der DDR. Kunzes Kommentar zu der Besprechung: „Diese Logik ist von einem nicht zu überbietenden Charme.“ Weiter notiert Eveline Rolands in der Jungen Welt, daß der Reclam-Band Hoffnung gebe auf einen Dichter Kunze, „der uns, und nicht dem Klassengegner, nützlich, ist“. „Sehr schön“ findet die Rezensentin Kunzes Liebesgedichte, „nachdenklich“ Verse über Krieg und Frieden. Manches allerdings gehe noch zu „sensible Wege“.
awm, FAZ, 24.9.1973
Neue Angriffe auf Reiner Kunze
Der Gedichtband Brief mit blauem Siegel, den, wie gemeldet, der DDR-Schriftsteller Reiner Kunze nach fünfjährigem erzwungenem Schweigen Anfang September im Leipziger Reclam-Verlag in fünfzehntausend Exemplaren veröffentlichen konnte, ist bereits vergriffen. Während das Buch mit den brisanten Texten des kritischen Sozialisten Kunze nun bereits zu Schwarzmarktpreisen gehandelt wird, scheint man in der mittleren und unteren Schicht der Kulturfunktionäre wenig Verständnis für die von staatlichen Stellen geförderte kulturpolitische Liberalisierung zu haben. So hat das SED-Zentralorgan Neues Deutschland Kunzes Buch bislang nicht einmal in der Rubrik „Neuerscheinungen“ seiner Literaturbeilage erwähnt. Ausser einem kurzen Hinweis in der FDJ-Zeitung Junge Welt brachte die DDR-Presse bisher erst eine ausführliche Rezension: In der Zeitschrift Eulenspiegel beschuldigt Lothar Creutz den Lyriker in hämisch-polemischem Ton des „elitären Hochmuts“, der „Eigenbrötelei“ und der „Selbstisolierung“. Diese Behauptungen, die der Wahrheit widersprechen – nicht Kunze hat sich isoliert, vielmehr wurde ihm jahrelang jede Publikationsmöglichkeit genommen –, sind nicht literarische Polemik, sondern politische Angriffe, die für Kunze gefährlich werden könnten. Dass der Kritiker des Eulenspiegel nicht allein steht mit seiner Furcht vor einem kulturpolitischen Tauwetter beweist die Tatsache, dass Reiner Kunze nicht am 7. DDR-Schriftstellerkongress teilnehmen darf, der vom 14. bis 16. November in Ost-Berlin stattfinden wird. Gerhard Henninger, 1. Sekretär des DDR-Schriftstellerverbandes, hatte sich direkt gegen die Teilnahme Kunzes ausgesprochen. Offenbar verübelt man Kunze noch immer seine Solidarität mit Solschenizyn und sein Eintreten für bedrängte Kollegen in der ČSSR. Henniger war es auch, der durch seinen Einspruch verhindert hatte, dass Reiner Kunze und Bernd Jentzsch aus der DDR kürzlich zur 2. Internationalen Schriftstellerkonferenz nach Mölle in Schweden ausreisen durften, obwohl das Kulturministerium der DDR bereits die Genehmigung erteilt hatte. Auf den Protest der Schriftstellerkonferenz hin teilt Claus Wolf, Kulturattaché bei der DDR-Botschaft in Stockholm, u.a. mit, die Einladung an Kunze und Jentzsch habe die Souveränität der DDR verletzt, weil in ihr von der Teilnahme von Autoren aus „Deutschland (BRD / – / DDR )“ die Rede gewesen sei, statt nur von BRD und DDR. Soeben ist in Schweden, wo man Kunze in Abwesenheit den Preis der 2. Internationalen Schriftstellerkonferenz Mölle zuerkannt hatte, im Verlag des schwedischen Schriftstellerverbandes Eremit-Press ein Band mit Uebersetzungen Reiner Kunzes erschienen unter dem Titel „Oever alla gränser“ – Ueber alle Grenzen.
J. P. W., Die Tat, 3.11.1973
Kunzes unerwünschter Auftritt
– Ost-Berlin: Der DDR-Autor im Haus der Ungarischen Kultur. –
Vor überfülltem Auditorium las der DDR-Lyriker Reiner Kunze im Haus der Ungarischen Kultur in der Ostberliner Liebknechtstraße. Es war dies der erste Auftritt Kunzes in der Hauptstadt der DDR überhaupt; gleichzeitig war es das erstemal, daß der in der DDR lange Zeit unterdrückte Autor wieder öffentlich und nach vorheriger Ankündigung auftreten konnte – nach dem 21. August 1968.
In gewissem Sinn fand die Veranstaltung auf exterritorialem Gebiet statt, da das ungarische Kulturzentrum nicht (direkt) vom DDR-Kulturministerium abhängig ist. Dies zu betonen scheint wichtig, da bereits Mitte Oktober eine vom Leipziger Reclam Verlag fest geplante Dichterlesung mit Reiner Kunze in dessen Heimatstadt Greiz durch die zentrale Ostberliner Kulturbehörde unmöglich gemacht wurde.
Reiner Kunze ist also nach dem Erscheinen seines Bändchens Brief mit blauem Siegel in der DDR noch längst nicht voll rehabilitiert. Mit um so größerer Aufmerksamkeit dürften die Ostberliner Kulturfunktionäre Kunzes jüngsten Alleingang im Haus der Ungarischen Kultur verfolgt haben.
Zunächst erwies Kunze seine Reverenz einigen von ihm nachgedichteten ungarischen Autoren, u.a. Gyula Illés. Dann schob er als Motto des Abends zwei Sätze aus Stephan Hermlins „Lektüre“ ein, in denen der Name des italienischen Sozialisten Antonio Gramsci fiel. Anschließend las Kunze aus seinen in Leipzig, Reinbek und Frankfurt/M. erschienenen Gedichtbänden. Starken Beifall erhielten seine Gedichte „Die Bringer Beethovens“ und „Das Ende der Kunst“. Kunze mischte sehr intelligent politisch Brisantes mit lustigen, grotesken Gedichten.
Das Stephan Hermlin gewidmete „Fast ein Frühlingsgedicht“ beschloß den ersten Teil des Abends. Vor den zweiten Teil fügte Kunze – aus aktuellem Anlaß , zwei Sätze Pablo Nerudas über den Dichter ein. Es folgten u.a. die noch unveröffentlichten Gedichte „Abbitte nach der Reise“, „Junge Hähne“. „Sommer in L.“ und „Möglichkeit einen Sinn zu finden“ (geschrieben, im Sommer dieses Jahres, für das Jahrbuch der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 1974).
Langanhaltender Applaus nötigte Kunze zu einer Zugabe: die noch unveröffentlichte Prosa „Fünfzehn“ beginnt: „Sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben: jedes Wort wäre zu lang.“
A.W.M., Saarbrücker Zeitung, 6.11.1973
Das neue Gedicht
– Vorgestellt von Paul Wiens. –
REINER KUNZE: Der Dichter bedarf keiner Vorstellung, doch vielleicht die folgenden Gedichte. Nehmt sie bei jedem ihrer Worte, nehmt sie aufmerksam auf, sie verdienen es. Orte des Dichters, Orte in der Dichtung orientieren nicht nur geographisch.
Reiner Kunzes Reise in die Sowjetunion, seine Teilnahme an der traditionellen Puschkin-Ehrung gaben den Anlaß zu mehreren Gedichten. WEISSE NACHT bezieht sich auf Leningrad. die drei letzten Zeilen – das kann nur wissen, wer in der Newa-Stadt war – auf eins ihrer Wahrzeichen, auf die „Nadel“ der alten Admiralität, DIE BRÜCKEN VON BUDAPEST und DÜSSELDORFER IMPROMPTU sprechen für sich. DIE KUNSTBEFLISSENEN HÄHNE VON LEININGEN, die Hähne singen für sich, die Hennen helfen dem Dichter.
Die vier Arbeiten stammen aus dem Manuskript BRIEF MIT BLAUEM SIEGEL. einer neuen Auswahl von Reiner Kunze, die der Reclam-Verlag vorbereitet.
(…)
Paul Wiens, Sonntag, 28.1.1973
Der Name ist nicht abgebrannt
– Zu Reiner Kunzes neuem Lyrikband. –
Was im Frühjahr noch eine vage Nachricht war, hat sich nun bestätigt: Der seit 1968 in der DDR totgeschwiegene thüringische Lyriker Reiner Kunze kann drüben wieder veröffentlichen. Im Leipziger Reclam-Verlag erschien ein Gedichtband brief mit blauem siegel. Er enthält 93 Gedichte aus den Jahren 1956 bis 1972; 38 Texte waren bereits Im Band sensible wege und 21 in zimmerlautstärke publiziert. Kunze gab beide Bücher, da er in der DDR keine Chancen mehr hatte, 1969 und 1972 in der Bundesrepublik heraus (vgl. Wallmanns Beitrag in den Horen 90).
Daß diese überwiegend kritischen Gedichte, die dem Gegensatz zwischen Individuum und programmierter Gesellschaft bis in die psychischen Bereiche der Angst und der Verzweiflung nachgehen, jetzt in der DDR erscheinen konnten, darf bei aller Skepsis als hoffnungsvolles Anzeichen einer Lockerung der DDR-Kulturpolitik gewertet werden, die sich möglicherweise positiv auf das gesamte Leben jenseits der Grenzzäune auswirken mag.
Kunzes Band, der im Westen nicht zu erwerben ist, wurde in der für unsere Verhältnisse kaum vorstellbaren Zahl von 15.000 Exemplaren gedruckt. Daß dem Verlangen nach neuer Literatur, das in der DDR viel stärker als bei uns herrscht, in dieser Weise Rechnung getragen wurde, ist ebenfalls ein günstiges Zeichen. Wird doch mit einem Lyriker, der seine künstlerische Bedeutung seit vielen Jahren durch die im Westen erschienenen Veröffentlichungen dokumentierte, nun auch in seiner Heimat der ihm zukommende Platz eingeräumt.
Zu berichten ist also von jenen Gedichten des Bandes, die, weil in den West-Publikationen nicht enthalten, dem hiesigen Leser nicht zugänglich sind. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um frühere, vor und nach 1960 entstandene Verse, Gedichte der Liebe über den geliebten Menschen, Gedichte über die Tschechoslowakei, die Kunze zur zweiten Heimat wurde:
Einer
wird mit dem bleistift an den mond klopfen
und sagen:
… Wohin fahren Sie?
Und ich werde sagen:
zu einem brunnen im süden Mährens,
der einschläft,
das moos unterm arm
Und er
wird salutieren, als hätte Ich
die tschechoslowakische hymne gesungen
(„ankunft in meiner stadt“, 1961).
Aber auch In den frühen Gedichten Ist schon der unverwechselbare Ton kritischer Distanzierung und der Ahnung einer heraufziehenden Bedrohung hörbar.
So heißt es 1960 im Gedicht „der blitz in unserem namen“:
Wirklich, zum erstenmal sahen wir
in unserem namen
den blitz
Wann hatte er eingeschlagen?
Sicher, als wir nicht zuhause waren
Ein glück –
der name ist nicht abgebrannt
Nein, Kunzes Name ist nicht abgebrannt! Sein Durchhalten hat sich gelohnt, der neue Band beweist es. Mögen jene, die drüben die politische Verantwortung tragen, hinfort nicht vergessen, was für ein Glücksfall der hochbegabte, kritische und furchtlose Reiner Kunze für die Literatur der DDR ist!
Walter Neumann, die horen, Heft 92, Winter 1973
Reiner Kunze in Bonn
Der DDR-Lyriker Reiner Kunze las im Rheinischen Landesmuseum in Bonn aus eigenen und fremden Gedichten. Veranstalter dieses bemerkenswerten Abends war das Lyrische Studio Bonn (Leitung: Nani von Schweinitz). Vor einem aufmerksamen Publikum begann Kunze mit vier Nachdichtungen des tschechischen Lyrikers Vladimír Holan. Danach schob er eine kurze Ansprache ans Publikum ein, in der Kunze darum bat, auf ein Gespräch nach der Lesung verzichten zu wollen. Allein die notgedrungen bruchstückhafte Berichterstattung über ein solches Gespräch berge, so Kunze, „Gefahren in sich – von Mißverständnissen und bewußten Akzentverschiebungen ganz zu schweigen und in Fällen, in denen die relative Macht des literarischen Wortes und das Wort der Macht in dieselbe Richtung zu wirken begonnen haben, sollte man alles vermeiden, was auch nur potentiell dazu dienen könnte; daß im Sinne geistiger Provinz wieder einzig die Verbindung Machtwort Macht wird“.
Anschließend las Kunze aus seinen in der Bundesrepublik erschienenen (bei den Verlagen vergriffenen) Gedichtbänden Sensible Wege und Zimmerlautstärke. Außerdem las der DDR-Autor noch Auszüge aus Antworten zu Fragen der Universität Basel über das Schreiben heute, über die Tradition, der sich Kunze verpflichtet fühle, und über die Leserschaft. Wie schon bei seinem letzten Auftreten in Ostberlin (im Haus der Ungarischen Kultur) zitierte Reiner Kunze auch in Bonn – als Reverenz – den chilenischen Dichter Pablo Neruda.
Daß die DDR-Behörden Kunze das wiederholte Auftreten in der Bundesrepublik ermöglicht haben (Kunze nahm erst im Sommer dieses Jahres in München den Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste entgegen), kann als ein äußerst konstruktiver Beitrag im deutsch-deutschen Kulturaustausch gewertet werden. – Inzwischen geht die Teilrehabilitierung Kunzes in der DDR (die nur mühsam vorankommt) offenbar weiter. Die Zeitschrift des Ostberliner Verlags Volk und Welt, der bücherkarren, hat in ihrer letzten Nummer eine Nachdichtung Kunzes abgedruckt: das Gedicht „Schlafende Frau“ des ungarischen Lyrikers Guyla Illyés. Illyés soll demnächst bei Volk und Welt mit dem Gedichtband Mein Fisch und mein Netz herauskommen.
AWM, der literat, Januar 1974
Kunze darf in der DDR wieder publizieren
– Nach vierjährigem Verbot ist ein neuer Lyrik-Band erschienen. –
Dieser Tage wird vom Leipziger Reclam-Verlag ein Gedichtband von Reiner Kunze für die DDR ausgeliefert. Sein Titel: Brief mit blauem Siegel. Die Auflage beträgt 15.000 und soll bereits, wie zu hören war, an die Buchhändler verkauft sein. Reiner Kunze kann in der DDR also wieder veröffentlichen. Als der Ostberliner Sonntag am 28. Januar 1973 vier Kunze-Gedichte aus dem neuen Band vorabdruckte, schien es sicher, dass der in der DDR nach 1968 scharf kritisierte und unterdrückte Autor wieder würde publizieren können. Kunze stellte mit dem Leipziger Reclam-Verlag eine Auswahl aus den beiden in der Bundesrepublik erschienenen Gedichtbänden Zimmerlautstärke (S. Fischer 1972) und Sensible Wege (Rowohlt 1969) zusammen, ergänzt durch vier neue, noch unveröffentlichte Arbeiten wie z.B. das Gedicht „Vierzehnjährige“ aus dem Jahr 1972.
Was fehlt und was vorhanden ist
Man wird nun im Westen mit der Lupe untersuchen, welche Gedichte Kunzes nicht in dem DDR-Bändchen vertreten sind. Dass Widmungsgedichte für Biermann und Solschenizyn fehlen, mag man bei uns kritisieren. Bemerkenswert in jedem Fall, dass Kunzes Siebenzeiler „Dorf in Mähren“ (1937) präsent ist mit der wörtlichen Stelle: „(für Peter Huchel)“. Wie überhaupt das tschechische Element, also die Gedichte, die über die ČSSR handeln – Eindrucke bei Besuchen tschechischer Kollegen etwa –, relativ stark ausgeprägt ist.
In dem Gedicht „besuch in Mähren bis nach mitternacht“ (1967) heisst es: „Bei Halas am grabstein, erbarmungslos / wie die wahrheit, welkte sie / bevor wir gingen.“ Halas, muss man wissen, geriet kurz vor seinem Tod 1949 über die Politik der Kommunistischen Partei in selbstzerstörerische Zweifel. In dem Gedicht „bei E. in Vresice“ werden die heute in der ČSSR unterdrückten Lyriker Jan Skácel und Ludvík Kundera zu Handlungsträgern.
Man sollte im Westen Kunzes für die DDR neuen Lyrikband nicht so sehr danach beurteilen, was alles fehlt, sondern zunächst ausschliesslich danach, wie der Band sich einem DDR-Leser präsentiert. Und da stellt diese Edition sicherlich einige Ansprüche an den, der mit Kunze-Versen, ihrer hintergründigen Verschlüsselung, ihren Mehrfachanspielungen und -bedeutungen nicht so vertraut ist.
Aus den „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“ (1966/67) fehlen die Gedichte, die das schwierige Ost-West-Verhältnis etwa bei der Kommunikation über den Postweg reflektieren, Zoll und Zensur eingeschlossen. Es fragt sich, wie die weggebliebenen Passagen politisch zu erklären sind. Offenbar steuerte Kunze einen Weg des Kompromisses an, um überhaupt dem Leser in der DDR ein Minimum an künstlerisch-politischer Aussage bieten zu können.
Die neue Kunze-Edition ist dennoch ein höchst bemerkenswertes Ereignis, vor allem wenn man bedenkt, dass der von Max Walter Schulz auf dem 6. DDR-Schriftstellerkongress 1969 ziemlich instinktlos angegriffene Autor in den letzten vier Jahren absolutes Veröffentlichungsverbot hatte, was auch für Kunzes Tätigkeit als Übersetzer und Nachdichter galt.
Kunze will seine Manuskripte in Zukunft zuerst Verlagen in der DDR anbieten. Sein jetzt bei Reclam in Leipzig erschienenes 133-Seiten-Bändchen (es kostet 1 Mark 50) ist ein erfreulicher Neuanfang für den Autor. Sinnigerweise darf Kunzes DDR-Veröffentlichung nicht in den Westen geliefert werden. Gegen die gesamte Leipziger Reclam-Produktion hat der Stuttgarter Reclam-Verlag in der Vergangenheit sein Veto bei den bundesdeutschen Justizbehörden eingelegt.
Brief mit blauem Siegel, der Titel des Kunze-Bandes, bezieht sich auf das Stephan Hermlin zugeeignete Gedicht „fast ein frühlingsgedicht“:
Vögel, postillione, wenn
ihr anhebt, kommt der brief
mit dem blauen Siegel, der dessen Briefmarken
aufblühn dessen text
heisst:
Nichts
währt
ewig.
Das gesamte Buch widmete Kunze „seiner Frau, meinen Freunden“.
Andreas W. Mytze, Tages-Anzeiger, 12.10.1973
LYRIK-EULE
(…) Im Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, sind als Band 553 der Universal-Bibliothek jetzt Gedichte von Reiner Kunze unter dem Titel Brief mit blauem Siegel erschienen. Der Band enthält Poesien Kunzes, die in der BRD erschienen sind als in der DDR, und war verständlicherweise, wie ich meine. Ich weiß nicht, ob das 1966 verdichtete Werk „morgen in Marienbad“ auch zu den hierorts bisher kaum bekannten Dichtungen Kunzes gehört. Immerhin ist es als unfreiwillige Selbstparodie des Dichters recht charakteristisch. Die Überschrift wage ich zunächst so zu deuten, dass „morgen“ keineswegs den morgigen Tag, sondern den Morgen eines Tages bedeutet, während zu Marienbad „Meyers Neues Lexikon“ bemerkt: „ s. Mariánske Lázne“. Nun aber das Gedicht:
Parkrasen geschoren wie
gräberkissen
– – –
Am sanften seil des quells
läutet die galle
Am stärksten wird natürlich die Phantasie durch die drei Gedankenstriche angesprochen. Und doch ist es nicht dieses Gedicht, weswegen Lesern wie mir bei diesem Buch die Glocke überlaufen könnte. Eher schon könnte derlei passieren bei „blickpunkt“ (1968) oder bei „zweites gedicht über das fensterputzen“ (1967) und bei vielen anderen, die auf eine elegische beziehungsweise wehleidiger Art „politisc“h sind.
Hier erklärt einer immer wieder, dass die historische Notwendigkeit ihn mehrfach enttäuscht habe, weshalb er ihr denn auch mit dem Ausdruck tiefsten Bedauerns die Einsicht verweigern müsse. Das ist seiner Lyrik aber gar nicht gut bekommen.
Ganz abgesehen davon, dass Kunzes Rückzug auf die eigene Individualität in vielen Gedichten der späteren sechziger und der siebziger Jahre schon in Eigenbrötelei ausartet, hat seine lyrisch dokumentierte Selbstisolierung auch zu einer stofflichen und formalen Verarmung geführt, in der Sprachkunst zur Chiffrierkunst wird. Mit allem elitären Hochmut übrigens gegen jene, die in der Kunst des Dechiffrieren unbewandert sind oder weder Lust noch Zeit dazu haben.
Je nun – zum Glück sind in den Band auch frühere Gedichte von Reiner Kunze enthalten, die nichts Duckmäuserisches an sich haben; und auch Gedichte jüngeren Datums gibt es etliche, aus denen sich der großen Begabung dieses Dichters eine positive Prognose stellen lässt.
Lothar Creutz, Eulenspiegel, 2. Oktober Heft, 1973
Für ein Publikum, das zwischen den Zeilen liest
Das Poesiealbum Nr. 11, ein Heftchen von dreißig Seiten, das im Sommer 1968 in der populären Lyrikreihe des Verlags Neues Leben erschienen war, sollte für lange Zeit die letzte Publikation Reiner Kunzes in der DDR bleiben. Beinahe ein halbes Jahrzehnt versuchten die verantwortlichen Bürokraten das von ihnen über den unbotmäßigen Autor erhängte Urteil zu vollstrecken. Er ließ sich nicht durch grobe Beschimpfungen einschüchtern. Er solidarisierte sich auch in den schweren Zeiten nach dem August 1968 mit seinen tschechischen und slowakischen Freunden. Er veröffentlichte neben einigen Kinderbüchern die Gedichtbände Sensible Wege (Rowohlt, 1969) und Zimmerlautstärke (S. Fischer, 1972) – in der Bundesrepublik. Die Antwort der Mächtigen, die sich gern ihres längeren Armes bedienen, wenn es (nur?) um den Kopf geht, hieß totschweigen!
Einer der willfährigsten Wortführer vor und hinter den Kulissen war der Vizepräsident des DDR-Schriftstellerverbandes, Max Walter Schulz, der vor einiger Zeit den Lesern des Sterns weismachen wollte, es sei eine Legende, daß Kunze mundtot gemacht worden sei. Reiner Kunze sieht in dieser Tatsachenverdrehung den bewußt oder unbewußt unternommenen Versuch, das Aufkommen einer ehrlicheren, günstigeren Atmosphäre für die Kunst zu hintertreiben. Er empfahl dem Kulturfunktionär öffentlich – in einem westdeutschen Rundfunkinterview – die Lektüre des Mitscherlich-Buchs Die Unfähigkeit zu trauern.
Die zwischen Vorwärtsverteidigung und Rückzugsgefechten hin- und hergerissenen Exponenten des repressiven Kurses mußten sich an eine Situation anpassen, in der jene vernünftigen Kräfte sich durchsetzten, die den „Fall Kunze“ bereinigen wollten. Der im thüringischen Greiz beheimatete Lyriker durfte die DDR auf einem Schriftstellertreffen in Budapest vertreten, es wurde nicht gegen die Verleihung eines angesehenen westdeutschen Literaturpreises polemisiert, Kunze durfte sogar die Auszeichnung in München entgegennehmen und dort eine Dankrede halten, deren Text die DDR-Behörden nicht zur vorherigen Genehmigung vorzulegen verlangt hatten.
In diesen Wochen wird die veränderte Lage nun endlich auch in einer Veröffentlichung sichtbar. Der Verlag Reclam in Leipzig liefert den als Nr. 553 von Reclams Universal-Bibliothek angekündigten Auswahlband Brief mit blauem Siegel aus. Der Titel entstammt dem als verhalten optimistisch deutbaren Text „fast ein frühlingsgedicht“. Jener angedeutete Brief enthält die in der Bedrängnis Mut machende Mitteilung: „Nichts / währt / ewig“. Das so herausgehobene Gedicht aus dem Jahr 1968 ist Stephan Hermlin gewidmet, der seine Autorität immer wieder für authentische neue Kunst abseits der bequemen, eingefahrenen Wege eingesetzt hat. Von den 93 Gedichten, die in fünf Abteilungen, aber nicht chronologisch geordnet wurden, sind mehr als die Hälfte in der DDR bisher nicht gedruckt worden. Die Auswahl stammt vom Autor, der einem Wunsch des Verlags, zusätzlich einige ältere Arbeiten aufzunehmen, entsprach.
Ohne Zweifel stellt die hier möglich gewordene Zusammenstellung einen Kompromiß dar. Leicht hätte Kunze, wenn er auf dem Abdruck einiger brisanter Stücke politischen Klartexts hätte bestehen wollen, etwa der Solidaritätsbekundungen für Solschenizyn und Biermann oder mancher epigrammatischer Zuspitzungen des Bändchens Zimmerlautstärke, das Projekt zu Fall bringen können. Er hat aber mehrfach betont, daß er, um Kunst unter die Leute zu bringen – und die Leserschaft in der DDR ist ihm am wichtigsten –, zu Kompromissen bereit sei, wenn sie nicht an die Substanz gingen. Sein Realitätssinn ist stark genug entwickelt, um einschätzen zu können, was erreichbar ist. Laute Demonstrationen nach dem Motto „alles oder nichts!“ sind seine Sache nicht.
Hierin unterscheidet er sich von Wolf Biermann, von dem er sagt, er wolle „immer sein gesamtes geistiges Lebendgewicht in die Waagschale werfen“. Gewiß respektiert Kunze Biermanns Haltung, den die Sorgen derer nicht kümmern, die ängstlich fragen, ob die Waage das aushält. Aber für sich hat Kunze unter den hier und heute gegebenen Umständen anders entschieden, wobei freilich betont werden muß, daß er sich nicht von einem einzigen der zwischen 1968 und 1971 entstandenen Gedichte distanziert, die nicht aufgenommen werden konnten.
Brief mit blauem Siegel zeigt im gegebenen Rahmen einen reichen Querschnitt durch Themen und Ausdrucksweisen des Lyrikers Reiner Kunze. Was er an Fragen zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft aufwirft, was er über die Erziehung der Kinder in Schule und Elternhaus ins nachdenkliche Bewußtsein ruft, was er den Hurra-Optimisten entgegensetzt, wird einem Publikum sehr wichtig sein, das gelernt hat, zwischen, neben und hinter den Zeilen zu lesen.
Die Verteidigung der Poesie durchdringt alle Arbeiten Kunzes. Diesem großen Thema hat er auch die menschheitsgefährdende Bedrohung durch Barbarei und Krieg zugeordnet. Sein Gedicht „Puschkins Michailowskoje“ geht von einer Bemerkung des Museumsführers aus, die Frontlinie des 2. Weltkrieges sei hier mitten durch den Garten verlaufen:
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
Die Metaphorik der Schutzlosen: die Gärten der Dichter sind offen. Aber wer ohne Festung und Schutzwall lebt, muß doch standhaft bleiben gegenüber dem Eingriff, der Einschüchterung, dem Verbot. Das Erscheinen des Briefs mit blauem Siegel ist ein Zeichen der Hoffnung – aber vieles steht noch aus. Von den einundzwanzig „variationen über das thema ,die post‘“ lagen in der DDR bisher elf gedruckt vor; jetzt sind zwei weitere hinzugekommen. Nach den fehlenden acht Stücken wird man drüben weiter zu fragen haben. Ein Gedichtband von 133 Seiten, gedruckt in einer Auflage von 15.000 Exemplaren, in der DDR zu haben für eine Mark fünfzig, ermöglicht Entscheidungen in einem unentschiedenen kulturpolitischen Prozeß. Ein Boykott ist zu Ende. Wird man in eine sachliche literarische und literaturkritische Diskussion eintreten oder in die sattsam bekannten Tiraden zurückfallen, es sei ein schwerer politischer Fehler gewesen, ein solches Buch zu publizieren?
Manfred Jäger, Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, 2.9.1973
Reiner Kunze: Brief mit blauem Siegel
Das besondere Interesse des Rezensenten an der jüngeren DDR-Lyrik beruht nicht allein auf seiner subjektiven Überzeugung, daß die Leistungen ihrer bedeutendsten Vertreter zum Besten gehören, was die deutsche Lyrik in den letzten Jahren hervorgebracht hat, sondern auch auf einigen Gemeinsamkeiten mit der jüngeren rumäniendeutschen Lyrik, denn mindestens zwei Faktoren, die immerhin wesensbestimmend wirken, sind den beiden Literaturen gemeinsam, nämlich: die Sprache und das Gesellschaftssystem. Dialektisch betrachtet, läßt sich aber leicht erkennen, daß in diesen zwei Faktoren nicht nur das Gemeinsame, sondern auch ein Unterscheidendes liegt. Denn das gleiche Gesellschaftssystem beinhaltet auch verschiedene Realitäten, aus denen es selbst erwachsen ist und die es seinerseits gezeitigt hat. Und ebenso liegen in der gleichen Sprache in gewissem Maße auch verschiedene Traditionen aufgespeichert, die ihrerseits geschichtsbedingt sind. Wenn sich nun dem Rezensenten bei Betrachtungen über DDR-Lyrik Parallelen zu unserer Lyrik geradezu aufdrängen (auf die dann letztlich doch nur angespielt wird), so kommt das nicht gerade von ungefähr, sondern eben von diesen Gemeinsamkeiten, die durch Sprache und Gesellschaftssystem gegeben sind und die viel mehr als bloß eine Möglichkeit komparatistischer Überlegungen bieten. Die Ähnlichkeiten in der Verschiedenheit und die Verschiedenheiten in der Ähnlichkeit der DDR- zur rumäniendeutschen Lyrik sind, unserer Meinung nach, das ergiebigste Bezugsystem überhaupt für die Beurteilung der DDR-Lyrik hier und heute.
Der entschiedene und entscheidende Einfluß Brechts auf die deutsche Lyrik wurde von der jüngeren Lyrikergeneration in der DDR dialektisch neu verarbeitet und zu einer ihr unverkennbar eigenen Ausdrucksweise weiterentwickelt. In dieser schöpferischen Assimilation und Weiterführung der durch Brecht eröffneten Möglichkeiten in der lyrischen Sagweise lassen sich grundsätzlich zwei Tendenzen aktivisierender Lyrik – selbstverständlich mit noch unzähligen Spielarten – erkennen, deren Hauptvertreter einerseits Kunert und andererseits Kunze sind.
Kunert verwertet den aphoristischen Zug, die Distanz zum Objekt, vor allem aber das Prinzip der Gegensätzlichkeit aus Brechts Lyrik für sich und verarbeitet dieses im Gedicht zu unverkennbar prägnanter Wortakrobatik und Denkgymnastik, zu dialektischen Purzelbäumen („… und kein Tod / holt den Widerspruch, dessen Unsterblichkeit / der Tod beweist“, NDL 6/73), die er mit einer äußerst nüchternen, unterkühlten Metaphorik mixt.
Kunze hingegen übernimmt einerseits die schlichte Ausdrucksweise Brechts, die auch bei ihm durch ihre Treffsicherheit einfach verblüffend wirkt, und andererseits den melancholisch-bitteren Unterton vieler früher und einiger späterer großer Gedichte des Meisters und verschmilzt diese mit einer ebenfalls unverwechselbaren, aber sensibilisierten metaphorischen Sprechweise (die zuweilen an Huchel erinnert) die sich jedoch – und das sei besonders betont, man weiß schon warum – in keinerlei spekulative Metaphysik einläßt.
Hat der eine also aus den Dur-Akkorden, so hat der andere aus den Moll-Akkorden Brechts gelernt, und was bei Kunert aggressiv, mit Verfremdungseffekten vermittelt wird, wird bei Kunze verhalten, aber unmittelbarer vorgetragen. Was aber beiden, und auch vielen andern jungen DDR-Lyrikern, ob sie sich nun in die eine oder andere Tendenz oder in Interferenzzonen hineinschreiben, gemeinsam ist, das ist das besonders ausgeprägte Bewußtsein ihrer Verantwortung vor der Zeit, aber auch vor der Zeit danach. Alle beschäftigt – wie Brecht es schon treffend benannt hat – das Einfache, das schwer zu machen ist. (Dabei wird dies oder jenes befürwortet, das eine oder andere beanstandet, so oder so gesagt – doch wird Stellung genommen, Evasion gibt es nicht.)
Zu den in den letzten Jahren vom Reclam Verlag herausgebrachten Auswahlbänden von Vertretern der jüngeren DDR-Lyrik, die sich zu wahren geistigen Erlebnissen für den Leser gestalteten, kann man neben denen von Günter Kunert und Volker Braun nun auch den von Reiner Kunze zählen. Die bewährte Universal-Bibliothek-Reihe bietet in diesem Band erstmals anhand einer Auswahl von 81 Gedichten eine reichere Übersicht über die lyrische Produktion dieses eigenwilligen Dichters.
Einen wesentlichen Teil des Bandes machen die Landschaftsgedichte aus, denen auch im gesamten Schaffen des Dichters eine erstrangige Bedeutung zukommt. Die Landschaften in Kunzes Gedichten sind nicht allgemeine Naturentwürfe, sondern konkret lokalisierte Landschaftsbilder, auch dann, wenn sie als Zeichen für geistige oder seelische Vorgänge oder Zustände stehen. Die Landschaftselemente werden nicht aus ihren konkreten geographischen, geschichtlichen, zivilisatorischen Zusammenhängen herausgelöst und zu Allerortslandschaften zurechtstilisiert, sondern, im Gegenteil, Kunze ist bemüht, die eigene Physiognomie einer erlebten Landschaft in den Besonderheiten ihrer Details festzuhalten: „Noch nie war der fuß des felsens golden, / zwischen dessen zehen die bierfässer ruhen / im gasthof Tisá…“ („Trinkgeld“); „… // Die Margareteninsel, / entbunden des keuschheitsgelübdes, spreizt / die schenkel ihrer brücke, der himmel / ein männerauge // Zwischen ferse und schulter / ein einziger bogen, erinnert ans lieben / die brücke der brücken // mit deinem namen“ („Die brücken von Budapest, für Elisabeth“); „Kronstadt, angeschmiedet / an den fuß der Karpaten…“ („Kleine reisesonate, Adagio“); „Bei Mělnik lädt die Moldau / ihr stück himmel in die Elbe ab…“ („Nach einem regen in Mělnik“); „Die zeit / fällt aus den fichten als / reine zeit // Die losung des wildes ist / die einzige“ („Kottenheide“).
Es geht Kunze nicht um spekulative Reflexion über gewisse Probleme schlechthin, sondern um ihre exakte Beleuchtung aus konkreten historischen Gegebenheiten und Bedingtheiten heraus, ein Problem wird nicht abstrakt, zu einem Ewigkeitswert stilisiert abgehandelt, sondern in seinen spezifischen Formen, die es jeweils durch die bestimmten Gesellschafts- und Zeitumstände annimmt, untersucht. Und dadurch, daß allgemeine Allerortslandschaften links liegengelassen werden, werden erfolgreich auch „allgemeine“ und „ewige“ Probleme oder Allerweltweisheiten vermieden. Und durch die Konkretheit und das Spezifische einer Landschaft werden suggestiv auch ihre konkreten und spezifischen Probleme artikuliert, die Einmaligkeit der Aussage liegt in der Einmaligkeit der Landschaft:
Häuserhänge wie
von naiven gemalt, längs
der dächer führen straßen schornsteine stehn
wie kilometersteine
Am schloßturm
fahnen, ausgehängt nach
ost und west, zwei
taube ohren
Der kirchturm, eine schusterale
für die schuhe gottes
Wälder wälder, auszuschweigen
das wort
(„Erinnerung an Greiz“).
Die Landschaftsgedichte Kunzes sind aber keine Naturlyrik im herkömmlichen Sinn, die Landschaft wird zur dynamischen Umwelt des Menschen verlebendigt und läßt sowohl die geistigen und moralischen als auch physischen Determinationsfaktoren durchblicken, von denen die Existenz des Menschen in dem betreffenden geschichtlichen und geographischen Raum bedingt und bestimmt wird. Und darin sehen wir den vielleicht bedeutendsten zeitgemäßen Zug von Kunzes Lyrik, daß der Dichter eben nicht nur auf die Beschaffenheit menschlicher Existenz, sondern auch auf deren Bedingtheiten eingeht. Und so sind die typischen Landschaften letztlich lyrische Vorwände für das Aufgreifen typischer Problematik.
Der Einfluß Brechts macht sich vielleicht am deutlichsten bemerkbar in den Liebesgedichten. Die Liebe wird bei Kunze nicht zum Anlaß spielerisch-zweideutigen Augenzwinkerns, wie etwa bei Kunert, sie wird aber auch nicht verklärt, in abstrakten „ewigen“ Modellen versinnbildlicht, sondern schlicht, in den gewöhnlichen Erscheinungsformen des Alltags gestaltet:
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue komma das
sinn gibt
(„Auf dich im blauen mantel, für Elisabeth“).
Gerade die Schlichtheit in Sprache und Bild und die geradezu verblüffende Selbstverständlichkeit in Ton und Geste machen die Tiefe dieses Gedichtes aus. Ohne zuerst ein entsprechendes, Stimmung schaffendes Dekor zurechtzuzimmern, wird hier ungekünstelt eine Liebesbegegnung geradewegs von der Straße weg und ins Gedicht geholt. Die Echtheit des Erlebnisses wirkt überzeugend gerade durch den Schein des Alltäglichen, der der Liebesbegegnung gegeben wird.
Wie bei Brecht liegt auch bei Kunze die ungewöhnlich tiefe Wirkung, die Überzeugungskraft und Echtheit der Liebeserlebnisse darin, daß sie mitten in den Alltag gestellt und nicht aus dem Alltag in irreale Räume herausgehoben werden. Und ebenso wie bei Brecht wird auch bei Kunze die Liebe nicht mehr ver-, sondern entgöttert und endgültig vermenschlicht:
An der Thaya, sagst du, überkomme dich
undefinierbare sehnsucht
Gehn wir in den fluß,
die sehnsucht definieren
(„Philosophie, für Elisabeth“).
Der schlichte Ton der Liebeslyrik wird auch in Gedichten, die Märchenmotive oder Legenden aufnehmen, angeklungen und zuweilen mit dem der Volksdichtung synchronisiert. Ebenfalls, um die direkte Wirkung und Lebendigkeit zu steigern, wird aus der Volksdichtung oft auch die Anrede übernommen. Dadurch, daß im Gedicht ein fiktives (wenn reell auch wahres) Gegenüber angesprochen wird, gewinnen die Texte außerordentlich an Unmittelbarkeit:
O ist
die marke schön: der wolf und
die sieben geißlein und
seine pfote ist
ganz weiß… Wer
hat den brief geschrieben?
Vielleicht
die sieben geißlein
vielleicht
der wolf
… der wolf ist tot!
Im märchen, tochter, nur
im märchen
(aus: „variationen über das thema ,die post‘“, 4).
Bekannte Gestalten aus der Märchentierwelt werden zu Objekten lehrhafter Demonstrationen in parabelartigen Gedichten, die zwar einen betont moralisierenden Charakter haben, doch nicht in höherem Maße, als Fabeln oder Parabeln allgemein moralisierend zu sein haben. Es gelingt Kunze ausgezeichnet, der Gefahr des Didaktizismus auszuweichen. Der Tod der Fabel in der modernen Lyrik wird paradoxerweise gerade in einer Fabel deklariert, was nun nicht für ihren Tod, sondern gegen ihre eigene Aussage für die Möglichkeit ihrer Existenz spricht:
Es war einmal ein fuchs…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der fuchs die fabel
wird er ihn holen
Es war einmal ein bauer…
beginnt der hahn
eine fabel zu dichten
Da merkt er
so geht’s nicht
denn hört der bauer die fabel
wird er ihn schlachten
Es war einmal…
Schau hin schau her
Nun gibt’s keine fabeln mehr
(„Das ende der fabeln“).
Als Verfasser von Fabelgedichten, deren Funktion auch bei ihm dieselbe ist wie eh und je, steht Kunze eigentlich einzig und eigenartig in der modernen deutschen Lyrik da. Doch ist die Neigung Kunzes zum Fabelgedicht, eine beliebte Gattung vor allem der Aufklärung, nicht so zufällig und unerklärlich, entspricht sie doch einem gewissen Hang Kunzes zu einer Art Aufklärertum:
Du darfst nicht, sagte die eule zum auerhahn,
du darfst nicht die sonne besingen
Die sonne ist nicht wichtig
Der auerhahn nahm
die sonne aus seinem gedicht
Du bist ein künstler,
sagte die eule zum auerhahn
Und es war schön finster
(„Das ende der kunst“).
Die wahre Kunst, als Sonne verbildlicht, bietet eine Möglichkeit der Bewahrung vor Obskurantismus, und ihre Preisgabe bedeutet zugleich auch die Preisgabe der Welt überhaupt. Auf die fernere oder nähere Vergangenheit bezogen, gestaltet Kunze im Fabelgedicht „Gespräch mit der amsel“ die Absurdität, in die die Kunst durch Parolen getrieben wurde, wobei die Verlagerung dieser Problematik in die Tierwelt dem Dichter das Groteske der Lage nur noch mehr zu unterstreichen ermöglicht:
Ich klopfe an bei der amsel
Sie
zuckt zusammen
Du? fragt sie
Ich sage: es ist still
Die bäume loben die lieder der raupen, sagt sie
Ich sage: … der raupen?
Raupen können nicht singen
Das macht nichts, sagt sie
aber sie sind grün
Für die Wahrung der Kunst als menschliches Sensibilisierungs- und Kommunikationsmittel und gegen jedwelche Mißbrauchversuche ihrer Funktion spricht das Gedicht „Puschkins Michailowskoje“:
„Die front ging hier
durch den garten“
Beklommen, doch
ohne schuldgefühl
verzeiht
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter.
Die Frage des gegenseitigen Vertrauens, die bis in ihre feinsten Implikationen und Komplikationen verästelt wie ein rotes Gewebe durch Kunzes Lyrik leuchtet, gehört zweifellos zu den bedeutendsten Problemen der Kunzeschen Dichtung wie auch der Menschlichkeit überhaupt:
Den rahmen säubern
von der möglichkeit des gitters, den wirbel
von der möglichkeit des galgens, den sims
von der möglichkeit des letzten schritts
Die scheiben putzen, nichts
trübe den blick
Atem
den frieden der fenster die
nachts nicht verschweigen müssen
ihr Licht.
Die Bewahrung des Vertrauens unbegründeter Vorbehalte gegenüber erfordert aber eine gründliche Abrechnung mit allen Reminiszenzen bürgerlicher, vorurteilsbeladener Denkweise, die sich auch – dann allerdings schwerer erkennbar – in einer ungemäßen Rezeption des Marxismus-Leninismus selbst äußern können:
1. D., schüler der siebenten klasse, hatte
versehen mit brille und dichtem haupthaar
das bildnis Lenins
Öffentlich
So
in gefährliche nähe geraten
der feinde der arbeiterklasse, der imperialisten ihr
handlanger fast, mußte er stehn
in der mitte des schulhofs
Strafe:
tadel, eingetragen in den schülerbogen der
ihn begleiten werde
sein leben lang
2. Du fragst warum
sein leben lang
Lenin kann ihm nicht mehr helfen, tochter
Um das gerechte Mißtrauen von dem ungerechtfertigten richtig zu trennen, dazu gehört schon ein allergrößter Aufwand an Menschlichkeit, und dafür plädiert und setzt sich Kunze mit all seinen schöpferischen Kräften ein.
Franz Hodjak, Neue Literatur, Heft 5, Juli 1974
Wohl das Maximum des Möglichen
– Reiner Kunzes Brief mit blauem Siegel. –
Versuch der Integration
Am 15. März 1972 erhielt die Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel (HV) beim Ministerium für Kultur einen Anruf. Am Apparat war Erich Honecker. Honecker erkundigte sich, warum trotz seiner Befürwortung die Übersetzungsgenehmigung für R. Kunze nicht erteilt worden ist.1 Die Genehmigung sei hiermit erteilt und Reiner Kunze sowie „Gen. Hoffmann (ZK-Abt. Kultur) über die Erledigung der Angelegenheit ebenfalls“ bitte zu informieren. Dieser Anruf markiert nicht nur eine Zäsur in der ostdeutschen Kultur- und Verlagspolitik der ersten Hälfte der siebziger Jahre, sondern führt zugleich für das Erscheinen des Gedichtbandes Brief mit blauem Siegel die wichtigsten Akteure in das Geschehen ein.
Erich Honecker, seit 3. Mai 1971 als Nachfolger Ulbrichts Erster Sekretär (ab 1976 Generalsekretär) des Zentralkomitees der SED, war der mächtigste Mann im Staate. Hans-Joachim Hoffmann, 1971 bis 1973 Leiter der Abteilung Kultur beim ZK der SED, wurde im Februar 1973 Nachfolger von Klaus Gysi als Minister für Kultur. Auf Hoffmann geht maßgeblich die Ausarbeitung des Konzepts „Weite und Vielfalt“2 zurück, das für die frühen siebziger Jahre kulturpolitische Richtschnur wurde und in Ost und West als Symbol einer vorübergehenden Liberalisierung galt. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch Kurt Löffler, unter Hoffmann stellvertretender Leiter der Abteilung Kultur beim ZK der SED und seit Februar 1973 dessen Staatssekretär im Ministerium für Kultur.
Und Reiner Kunze? Von Reiner Kunze war zuletzt 1968 in der DDR ein Poesiealbum erschienen. 1968 hatte er einen Vertrag für ein Reclam-Projekt und ein Konvolut mit Rohübersetzungen zurückgegeben. Ob es sich dabei um eine Sammlung tschechischer Dichtung handelte – „Protagonisten, Leitfiguren, Stichwortgeber des Prager Frühlings“ – lässt sich nicht abschließend beantworten.3 Nach dem Austritt aus der SED, mit dem Kunze wegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei protestierte, war über ihn ein mehr oder minder durchgehendes Publikations- und Auftrittsverbot verhängt und die bestehenden Verlagsverbindungen gekappt worden. Der Gedichtband Sensible Wege erschien 1969 bei Rowohlt und das Kinderbuch Der Löwe Leopold. Fast Märchen, fast Geschichten 1970 bei S. Fischer. Sein Gedichtband Zimmerlautstärke sollte im Herbst 1972 ebenfalls bei S. Fischer herauskommen. In der DDR lebend, war Reiner Kunze auf dem besten Wege, im Westen ein erfolgreicher und vielbeachteter Schriftsteller zu werden.4 Damit stellte Kunze die auf internationale Reputation bedachte neue Staatsführung vor ein Problem, vor allem nach dem VIII. Parteitag, auf dem eine relative kulturpolitische Öffnung beschlossen worden war. Wie auch der Schriftsteller Stefan Heym, dessen letzte DDR-Veröffentlichung noch länger zurücklag (Casimir und Cymbelinchen. Zwei Märchen, Kinderbuchverlag Berlin 1966). Oder Wolf Biermann, der nach dem 11. Plenum des ZK der SED vom Dezember 1965 in der DDR nicht mehr auftreten oder veröffentlichen konnte.
Offensichtlich hatte man sich im März 1972 dazu entschieden, einige Baustellen bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten im Vorfeld des (am 21.12.1972 geschlossenen) Grundlagenvertrages zu beräumen. Auch mit Blick auf die Verhandlungen über die UNO-Mitgliedschaft der DDR konnte eine Lösung nur von Vorteil sein. Seit Reiner Kunze nicht mehr publizieren durfte, erfolgte dessen Kontrolle und Überwachung in einem Operativvorgang der Staatssicherheit.5 Auch bei der Stasi änderte sich von nun an vieles. In einer Dienstberatung der für Opposition und Kultur zuständigen Hauptabteilung XX der Staatssicherheit in Berlin war es zweckmäßig erschienen, „den Abschluß dieses Operativvorgangs entsprechend der Orientierung des Genossen Minister auf der letzten Dienstberatung (Juli 1972) vorzunehmen.“6 Hervorhebenswert ist dabei die Teilnahme des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke und damit die Fallhöhe, auf der Möglichkeiten der Reintegration Reiner Kunzes in das kulturelle Leben der DDR erörtert wurden. Die Partei legte fest, „den Greizer Lyriker Reiner Kunze […] aus der Isolierung herauszuführen und für eine Zusammenarbeit mit den Verlagen der DDR zu gewinnen.“7
Udo Scheer, Kunzes Biograf, hält des Weiteren fest, dass Reiner Kunze in Greiz, seinem Wohnort, vom Staatssekretär für Kultur Kurt Löffler aufgesucht und mit Überlegungen, ihn als Autor wieder in das literarische Leben der DDR zu integrieren, bekannt gemacht wurde. Löffler, seit Februar 1973 im Amt, hatte bereits in seiner Eigenschaft als Stellvertretender Leiter der Abteilung Kultur im ZK der SED die Fäden (mit-)gezogen. Reiner Kunze erinnert sich:
Löffler kam zu uns nach Greiz und sagte, „Herr Kunze, wir haben Fehler gemacht, die Partei hat Fehler gemacht. Wir wollen die Partei attraktiver machen. Wir möchten ein anderes Verhältnis zu den Künstlern und Schriftstellern haben. Helfen Sie uns!“ Der Tonfall überraschte uns. Wer hat 1973 daran gedacht, dass es 1989 keine DDR mehr geben würde. Alle Bestrebungen, die auf eine Erleichterung hinzuwirken schienen, musste man unterstützen.8
Außerdem sagte er:
„Wir wollen von Ihnen einen Gedichtband in der DDR herausbringen. Machen Sie eine Auswahl.“ Hier lag für mich das ganz große Problem. Ich durfte in die Auswahl nichts aufnehmen, was Leuten wie Löffler in dieser Situation irgendwie schaden konnte. Ich verzichtete auf 50 Gedichte, die in der Bundesrepublik schon publiziert waren, von denen ich wusste, nur eine Zeile davon und der Mann ist nicht mehr stellvertretender Kulturminister. Ich habe aber auch 50 Gedichte durchsetzen können, die bis dahin undruckbar waren.
Es war also kein Band des Übersetzers Reiner Kunze geplant, sondern ein Gedichtband des Autors. An dieser Stelle kommen zwei weitere Akteure ins Spiel: Klaus Höpcke und Hans Marquardt. Höpcke hatte sich im selben Jahr wie Kunze an der Fakultät für Publizistik und Zeitungswissenschaft (der späteren Sektion Journalistik) immatrikuliert. So ist davon auszugehen, dass beide am 22. September 1952 die öffentliche Zeugnisübergabe an Hans Marquardt anlässlich der Eröffnung der „Roten Villa“, auch „Rotes Kloster“ genannt, in der Leipziger Tieckstraße miterlebten.9 Marquardt hatte 1949 zunächst das Studium der Kulturpolitik und Staatenkunde an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Leipzig aufgenommen, bevor er 1951/52 am Institut für Publizistik und Zeitungswissenschaft ein Studium der Journalistik fortsetzte und abschloss. Biografische und persönliche Anknüpfungspunkte waren damit gegeben. Da Klaus Höpcke als stellvertretender Kulturminister (Nachfolger von Bruno Haid) und Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel zur Leipziger Buchmesse (11.–18.3.1973) im März 1973 bereits aktiv war, zeichnete er für Brief mit blauem Siegel (mit-)verantwortlich.
1972 war mit Haid zunächst zu klären, in welchem Verlag der DDR der Band erscheinen könnte, da Kunze zwar in Westdeutschland publizierte, aber in der DDR nicht über einen Hausverlag verfügte. Nach Abwägung aller Aspekte einigte man sich auf den Reclam Verlag Leipzig, denn bereits im Umfeld der Buchmesse im Herbst 1972 kam es zwischen dem Verlagsleiter Marquardt und Reiner Kunze zu einem Gespräch. In einer Zusammenfassung der MfS-Hauptabteilung vom 28. März 1973 heißt es rückblickend:
Im Ergebnis einer Reihe von Aussprachen mit Funktionären der Partei und des zentralen Staatsapparates bekundete Kunze seine Bereitschaft, auf der Grundlage eines völligen Neubeginns mit den Verlagen u.a. gesellschaftlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. […] Während der Leipziger Herbstmesse 1972 erneuerte Kunze seine Bereitschaft. Er wählte den ReclamVerlag Leipzig als seinen DDR-Verlag aus und führte noch während der Messe erste Gespräche mit Verlagsleiter Marquardt. Die dem Verlag von Kunze vorgelegte Auswahl von Gedichten wird nach eingehender Beratung noch im März 1973 druckgenehmigt und Mitte 1973 in der Reihe der „Reclam-Universal-Bibliothek“ (Band 553) unter dem Titel Brief mit blauem Siegel erscheinen.10
Was sprach für den Reclam Verlag? Reclam Leipzig war kein Autorenverlag, sondern ein Taschenbuchverlag, der Einzeltitel herausbrachte. Sollte es mit Reiner Kunze bei nur einem Band bleiben, wäre dies mit der verlegerischen Praxis des Hauses zu begründen.
Zum anderen gab es bereits mit Stephan Hermlin einen Autor, der nur bei Reclam Leipzig unter Vertrag stand. Damit lag ein Modell vor, an dem man sich gegebenenfalls orientieren konnte. Der wichtigste Grund der Entscheidung für Reclam Leipzig lag wohl darin, dass Reiner Kunze bereits für den Verlag als Herausgeber und Nachdichter tätig geworden und, neben dem Verlagsleiter, auch mit dem Lektor bekannt war. Hubert Witt, seit November 1959 im Verlag, war ein Absolvent der Leipziger Germanistik und hatte von 1953 bis 1957 unter anderem bei Hans Mayer studiert.11 Reiner Kunze, 1951 bis 1955 Student der Leipziger Journalistik und am dortigen Institut bis 1959 Assistent, hatte ebenfalls Vorlesungen von Hans Mayer und Ernst Bloch gehört. Nachdem Kunze 1959 wegen angeblicher konterrevolutionärer Verbindungen zum Kreis um Walter Janka entlassen und ihm die Promotion verwehrt wurde, war es Hubert Witt, der die Verbindung mit Reiner Kunze im Frühjahr 1960 herstellte und ihn mit einem ersten größeren Auftrag bedachte.12 Im Jahr des Mauerbaus brachte Kunze mit der Anthologie Mein Wort ein weißer Vogel. Junge deutsche Lyrik bei Reclam einen aktuellen Überblick ostdeutscher Poesie heraus, in dem auch Adolf Endler und erstmals Christa Reinig einer größeren Öffentlichkeit in der DDR vorgestellt wurden.
In der Dienstberatung des Reclam Verlages vom 14. September 1972, an der unter anderem Verlagsleiter Marquardt und Cheflektor Jürgen Teller teilnahmen, wurde zunächst über die Möglichkeit einer erneuten übersetzerischen Arbeitsbeziehung mit Reiner Kunze informiert.13 Aus dem Protokoll der genannten Beratung wird deutlich, dass eine Herausgabe Kunzes von höchster Stelle gewünscht und von der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel und dessen Leiter Bruno Haid ausdrücklich „unterstützt“ wurde: „Durch 6. Plenum gesellschaftlicher Auftrag!“ Als Herausgeber war zuerst Stephan Hermlin im Gespräch. Bereits in den beiden folgenden Dienstberatungen Oktober 1972 wurde über Treffen der Verlagsleitung mit Reiner Kunze in Greiz informiert.14 Dabei hatte sich Marquardt anfangs „nicht sonderlich begeistert“ gezeigt, käme doch mit Kunze „möglicherweise etwas auf ihn zu, was er nicht bewältigen könne.“15 Auch gegenüber dem Stellvertretenden Kulturminister und HV-Leiter Bruno Haid, machte er deutlich, „daß er für die Zusammenarbeit mit Kunze ,den Segen‘ und die Unterstützung vom Gen. Haid und von der Genn. Pflug (Abt. Wissenschaften beim ZK der SED) erhalten“ müsse. Ohne dem wolle er sich auf nichts einlassen, denn er habe keine Lust, sich später eventuell dafür „verhauen“ zu lassen.
Schwierigkeiten mit dem Text
Kunze hat aus seiner Haltung zur Niederschlagung des Prager Frühlings zu keiner Zeit einen Hehl gemacht und die freundschaftlichen Verbindungen zu Autoren, die im Nachbarland mit Berufsverbot belegt waren, Ludvík Kundera oder der Chefredakteur der Kulturzeitschrift Host do domu Jan Skácel, noch verstärkt, wie zahlreiche Widmungsgedichte und Nachdichtungen zeigen. Welche Texte von Kunze konnte man in der DDR veröffentlichen? Welchen Autor wollte man präsentieren? Zudem war für den Verlag noch nicht zu überblicken, wie weit man gehen konnte und welche Spielräume Reclam Leipzig zugebilligt wurden. Außerdem war nicht abzusehen, wie sich das Verhältnis zwischen Kunze und der literarischen Öffentlichkeit Westdeutschlands entwickeln und wie das Feuilleton auf den für den Herbst 1972 bei S. Fischer angezeigten Band Zimmerlautstärke reagieren würde. Damit gestalteten sich die Voraussetzungen weitaus schwieriger als bei Stefan Heym, den man zur gleichen Zeit ebenfalls zurückzugewinnen suchte. Heyms Roman über den 17. Juni Fünf Tage im Juni sollte erst 1974 herauskommen.
Nach der Leipziger Herbstmesse 1972 wurde im Verlag ein Strategiepapier erarbeitet, das im Wesentlichen die Handschrift von Hubert Witt trägt. Diese „Selbstverständigung“ hebt das Besondere, ja das Außerordentliche des Vorgangs hervor. Dort heißt es:
Vorausgegangen war, in höheren Instanzen, eine Klärung der Grundsatzfrage: kann und soll man bei Reiner Kunze, mit ihm gemeinsam, einen Schlußstrich unter Vergangenes ziehen und ein neues, produktiveres Verhältnis anstreben? So war unter anderem bei einer Aussprache, die Genossen der Kulturabteilung des ZK mit Kunze geführt hatten, sogar vereinbart worden, auch den letzten, bei S. Fischer erschienenen Gedichtband Zimmerlautstärke als vergangen anzusehen (damit auch die Welle von westlichen Presserezensionen, die vorauszusehen war).16
Zimmerlautstärke setzte sich ungeschminkt mit dem Alltag in der DDR auseinander, mit den Erlebnissen und Erfahrungen der Tochter in der Schule, mit den Themen Reisefreiheit und Zensur und mit totgeschwiegenen Autoren wie Wolf Biermann oder Peter Huchel. Neu und zugleich aufsehenerregend war Kunzes Parteinahme für den in Abwesenheit mit dem Nobelpreis (8.10.1970) ausgezeichneten Alexander Solschenizyn. Vor diesem Hintergrund war allen Beteiligten bewusst, dass es sich bei den Wendungen „Schlußstrich“ und „neues produktiveres Verhältnis“ eher um strategische Kommunikations-Codes handelte, die eine möglichst reibungslose Verlagsarbeit gewährleisten sollten, andernfalls hätte man von Reiner Kunze verlangen müssen, sich von dem soeben erschienenen Band zu distanzieren:
Als Reiner Kunze während der letzten Herbstmesse, von unserem Verlagsleiter Hans Marquardt in eine Diskussion gezogen, mit dem Vorschlag an uns herantrat, die Herausgabe eines Lyrikbandes in Angriff zu nehmen, berief er sich dabei u.a. auf eine Empfehlung des Büros für Urheberrechte, sich an einen Verlag der DDR zu wenden. Nach einem Gespräch des Gen. Marquardt mit dem Leiter der Hauptverwaltung Genosse Bruno Haid haben wir, ohne die möglichen Schwierigkeiten und Risiken einer solchen Zusammenarbeit zu verkennen, den gesellschaftlichen Auftrag akzeptiert, bei äußerster kritischer Wachheit und Erwägung aller Zusammenhänge bei einer fruchtbaren Lösung des gegenwärtigen, vom Westen eifrig mißbrauchten Spannungsverhältnisses mitzuwirken.
Wie auch immer, das Erscheinen Kunzes in der DDR war und blieb politisch gewollt. Ein Dokument des Schriftstellerverbandes verdeutlicht zudem die übergeordneten Gründe, die in dieser Zeit das kulturpolitische Denken bestimmten. Ende 1972 gab es im Verband Bestrebungen, eine wöchentlich erscheinende Literaturzeitung zu gründen. In der Konzeption dazu hieß es: Wichtig sei die Zeitung „für die Präsenz der DDR“ im internationalen Rahmen, „[d]ie weltweite diplomatische Anerkennung der DDR macht auch in bezug auf die Resonanz der internationalen Literatur in den Publikationen der DDR neue Überlegungen notwendig.“17 Eine Literatur ohne Autoren wie Reiner Kunze oder Stefan Heym war als Synonym für die Endphase der Ulbricht-Ära denkbar, nicht aber als Ausweis einer Politik, die auf internationale Reputation, völkerrechtliche Anerkennung und auf die Schaffung eines Status quo mit dem anderen Teil Deutschlands drängte.
Hubert Witt plante einen Überblick über Kunzes bisheriges Schaffen, schließlich wurde der Autor zum ersten Mal umfassend in der DDR vorgestellt. Reiner Kunze legte dafür zunächst eine chronologische Auswahl vor. Vom Lektor wurde das Manuskript thematisch geordnet, vor allem, um sich von den westdeutschen Ausgaben abzugrenzen und „unwillkürliche Ballungen und thematische Spannungszentren“ aufzulösen; außerdem sei es bei den Reclam-Ausgaben üblich, „dem Material möglichst durch Auswahl und Anordnung neue Aspekte abzugewinnen.“18 Wie kompromissbereit Kunze war, verdeutlicht die Bemerkung, dass er in dem Manuskript
[v]on sich aus auf mehr als fünfzig (50) Gedichte verzichtet [habe], die bisher im Zentrum der [in Westdeutschland erschienenen, d. Verf.] Ausgaben und der Aufmerksamkeit gestanden haben. Auf unsere Argumentationen hin hat er weitere Texte aus dem Manuskript herausgenommen und Gedichte, die früher in der DDR erschienen waren, zusätzlich aufgenommen, um die Proportionen aufzubessern.
Reiner Kunze sei „gern und mit Interesse darauf eingegangen, eine völlig andere Zusammenstellung nach thematischen Komplexen zu erarbeiten und mit uns abzustimmen.“ Von den aufgenommenen Texten wäre ein knappes Zweidrittel bereits in der DDR erschienen, hält Hubert Witt weiter fest. Fazit:
Es bleiben sehr wenige Texte übrig, die nicht bereits in der DDR vorlagen und zu Diskussionen Anlaß geben.
Zugleich entspann sich Ende 1972 ein intensiver Schriftwechsel zwischen der HV und der Abteilung Kultur beim ZK der SED. So wies Bruno Haid am 7. Dezember darauf hin, dass Bedenken entstanden seien aufgrund des Bandes, der im S. Fischer Verlag im Herbst erschien und einer Publikation des Hamburger Stern vom 24. September 1972:
Ich kann mich […] bei dieser Haltung Kunzes zur Sowjetunion nicht zu einer Herausgabe beim Reclam-Verlag entschließen, wenn nicht vorher eine eindeutige prosowjetische Stellungnahme Kunzes in der Öffentlichkeit erfolgt ist. Der Verlag hat ihn, auf Grund unserer Hinweise versucht, dazu zu ermuntern. Sein Vorschlag aber, sein Puschkingedicht zu diesem Zweck in den Band zu nehmen, kann nicht als ernsthaft angesehen werden, da in diesem Gedicht die Zerstörung des Puschkin-Hauses während des Krieges nur Einleitung ist, alle anzuprangern, „die in des Dichters Garten eindringen“.19
Haid bezog sich dabei auf eine Besprechung des Gedichtbandes Zimmerlautstärke von Manfred Leier, die er auch Marquardt zukommen ließ,20 und nahm diese zum Anlass, die Wertschätzung, die Kunze Solschenizyn entgegenbrachte, vorauseilend zu problematisieren.21 Denn eine nicht zu unterschätzende Hürde stellte die sowjetische Botschaft in der DDR dar, die sich vorbehielt, jede Veröffentlichung, die das Thema Sowjetunion berührte, zu kontrollieren und gegebenenfalls zu untersagen.22 Während sich die Genossen Haid (Leiter HV), Gysi (Noch-Kulturminister) und Hörnig (Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED) abstimmten, einigten sich auch Verlag und HV auf eine längere Selbstvorstellung Kunzes per Interview im Verlagsbulletin Das Reclam-Buch.23
Sollte diese Frage vorher auch Wolf Biermann gestellt werden, wäre ich – unabhängig von seiner Entscheidung – selbstverständlich damit einverstanden.
Berger reagierte gereizt:
Sie werden es sich selbst zuschreiben müssen, wenn Sie in der Anthologie fehlen. Die Anthologie wird keinen Schaden nehmen.
Nach einem Gespräch zwischen Marquardt und Kunze konnte am 17. Januar 1973 der Streit beigelegt werden: Eine Veröffentlichung von Biermann stelle keine Bedingung mehr für die Aufnahme Kunzes in die von Berger und Deicke geplante Anthologie dar. Vgl. RAL, Akte 195, Bl. 77–79: Hans Marquardt an Bruno Haid, 17.1.1973; Hans Marquardt an Günter Caspar, 17.1.1973. Vgl. auch Zybura: Braun und Kunze, S. 65–67.
Bevor Das Reclam-Buch mit dem Interview erschien, meldete sich schon der Schriftstellerverband in Person von Paul Wiens mit einer – zentral festgelegten – ersten Presseankündigung des Bandes zu Wort. Damit war die Linie zum Thema Sowjetunion vorgegeben:
Reiner Kunzes Reise in die Sowjetunion, seine Teilnahme an der traditionellen Puschkin-Ehrung gaben den Anlaß zu mehreren Gedichten. „Weiße Nacht“ bezieht sich auf Leningrad, die drei letzten Zeilen – das kann nur wissen, wer in der Newa-Stadt war – auf eins ihrer Wahrzeichen, auf die „Nadel“ der alten Admiralität, „Die Brücken von Budapest“ und „Düsseldorfer Impromptu“ sprechen für sich. „Die kunstbeflissenen Hähne von Leiningen“, die Hähne singen für sich, die Hennen helfen dem Dichter. Die vier Arbeiten stammen aus dem Manuskript Brief mit blauem Siegel, einer neuen Auswahl von Reiner Kunze, die der Reclam-Verlag vorbereitet.24 – Reiner Kunze, wir freuen uns, daß Sie nicht verlorengegangen sind[,][/footnote]
Auf Witts vorstellende Worte im Interview, das rechtzeitig zur Buchmesse vorlag:
Sohn eines verdienten Bergmanns, Studium der Philosophie und Journalistik in Leipzig, wissenschaftlicher Assistent an der Karl-Marx-Universität, dazwischen Arbeit in der Landwirtschaft und im Schwermaschinenbau, seit 1959 freischaffender Schriftsteller… Eine schwere Herzerkrankung… Ihre bisherige Entwicklung verlief nicht ohne Krisen, und Volker Braun schrieb dazu in einem seiner Gedichte:
Er ist kein Krieger, kein Lohnsklave, kein Konzernschreiber
Und doch kennt er den Kampf und Not und Qual
Er lebt unter uns…
Darf auch nur ein Mensch
Verlorengehen?
Hier?25
antwortete Kunze:
Ich werde mich auch hüten verlorenzugehen. Ich gehöre hierher, in dieses Land, in diese Gesellschaft. Im Gedicht ist der Dichter den anderen Menschen am nächsten. Ich möchte vor allem hier den anderen Menschen am nächsten sein.
Ohne weitere Umschweife kam Witt auch auf Kunzes Beziehung zu den sowjetischen Kollegen zu sprechen. Seine indirekte Frage bettete er in einen größeren historischen Kontext ein, um auf das von Haid beanstandete Gedicht „Puschkins Michailowskoje“ zu verweisen, das, „wie wir erfuhren, bei sowjetischen Kollegen einen tiefen Eindruck hinterlassen“ hat.
Seine Sowjetunionreise hatte Kunze 1968 auch zu Puschkins Landsitz, 1824–1826 zugleich Verbannungsort, geführt. Hier sei erneut an Kunzes Sowjetunionreise 1968 erinnert, dem Jahr, in dem auch eine von Solschenizyn rekonstruierte Fassung des 1965 beschlagnahmten Romans Der erste Kreis (in deutscher Übersetzung Der erste Kreis der Hölle) erschienen war, der Solschenizyns Erfahrungen in der „Saraschka“, einem Spezialgefängnis für Wissenschaftler, thematisierte. Das Gut und Puschkins Grab im nahe gelegenen Swjatogorski-Kloster war von der Wehrmacht im 2. Weltkrieg schwer beschädigt worden:
aaaaaaaaaaaa„Die front ging hier
aaaaaaaaaaaadurch den garten“
Beklommen, doch
ohne Schuldgefühl
Verzeiht
Wer immer
die angreifer wären hier jetzt zum gegner hätten sie
mich… („Puschkins Michailowskoje“)
Kunze antwortet nicht auf Witt, sondern versucht mit seiner Antwort, Kriterien für das politische Engagement eines Autors zu entwickeln:
Doch auch größte Erschütterungen müssen nicht oder nicht in dem Augenblick, in dem es aus außerkünstlerischen Gründen wünschenswert wäre, zu einem poetischen Bild inspirieren. Außerdem ist nicht jede Erschütterung geeignet, jeden Dichter zu inspirieren. Insofern meine ich, daß der Künstler gegebenenfalls auch außerhalb der Kunst wirksam werden muß.
Mit Blick auf den (noch) tobenden Vietnamkrieg fügte Kunze hinzu:
Wir müssen uns jeder imperialistischen Aggression entgegenstellen. Ich wünschte, daß dazu auch alle Gedichte beitrügen, indem sie der Abstumpfung durch Gewöhnung entgegenwirken.
Dass es in der HV Auseinandersetzungen um den Kunze-Band gab, macht ein Auszug aus einem Gutachten deutlich, der im Verlagsarchiv abgelegt ist:
Der Band erfüllt die Vorstellungen, die nach Lage der Dinge eine Zusammenstellung von Kunzes Gedichten erfüllen kann. Er enthält weder Verse, die es sich in der DDR zu drucken verbietet, noch wird in einer Weise geglättet, daß die Problematik der Dichterexistenz Kunze verlorenginge. Der Band empfiehlt sich also zur DG [Druckgenehmigung].26
Zur Leipziger Frühjahrsbuchmesse (11.–18. März) 1973 sollten sich Verlag und HV in einer bis dahin beispiellosen Schnelligkeit abstimmen und handeln: Antrag auf Druckgenehmigung 7. März, Eingang desselben 8. März, Erteilung der Druckgenehmigung 13. März (Unterschriften Thews, Horn, Beer und Teller [sic]) sowie 15. März (Horn) – vor Ort in Leipzig. Es steht zweifelsfrei fest, dass der Amtswechsel von Haid zu Höpcke an der Spitze der HV dazu genutzt wurde, die neue kulturpolitische Weichenstellung mit einem schnellen Erfolg zu krönen. Mit Ulrich Plenzdorfs Die Leiden des jungen W. war dies schon wegen der grundsätzlich ablehnenden Haltung von Bruno Haid nicht möglich, wie Christine Horn, Leiterin Sektor Literatur in der HV, berichtet.27 Nach der Messe beglaubigte Höpcke die Druckgenehmigung noch einmal und erteilte sie de facto zum dritten Mal:
Nach Einverständnis mit Gen. Höpcke Druckgen. erteilt. an Verlag am 22.3.73.28
Beantragt war vom Verlagsleiter eine durchschnittliche Auflage von 10.000 Exemplaren. In seltenen Fällen haben Auflagenhöhen der UB-Bände darunter gelegen: 1961 etwa bei Reiner Kunze Mein Wort – ein weißer Vogel mit 5.000 oder bei einem Musikbuch mit 3.000. Doch bei diesem Band lag der Fall anders. Die HV genehmigte dem Verlag am 3. April 1973 nachträglich eine Zusatzauflage von 5.000 Exemplaren, sodass sowohl die Erstauflage 1973 als auch die Nachauflage 1974 mit jeweils 15.000 Exemplaren herauskam. Darüber hinaus wurde das Honorar von 10 auf 15 Prozent des Ladenpreises angehoben, „was sonst“, so Marquardt, in der Universal-Bibliothek „nicht üblich ist“.29
Kunze in der DDR
Die Kunde von der bevorstehenden Veröffentlichung verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Ost und West. In der Leitung des Bezirksschriftstellerverbandes Erfurt-Gera stieß dies auf Widerstand, aber auch am Wohnort verursachte Kunzes Aufwertung bei altgedienten Genossen Unwillen. Nicht zuletzt rief der im März 1973 zuerkannte Große Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, den Kunze in München persönlich entgegennehmen konnte, Neid und Missgunst auf den Plan. Schon im Oktober 1972 hatte man auf der Stasi-Bezirksebene konsterniert festgestellt, dass man nicht mehr Herr des Verfahrens sei und „daß alle Maßnahmen im ,Fall Kunze‘ von staatlicher Seite ,zentral‘ durchgeführt werden“.30
Auch in der für Kultur und Verlage zuständigen Stasi-Hauptabteilung XX/7 in Berlin war man sich der Fragilität und des Experimentalcharakters der Herausgabe durchaus bewusst, ein „bescheidener Anfangserfolg“31 eben:
Seitens des Reclam Verlages wird eingeschätzt, daß die Grundlagen für ein Vertrauensverhältnis zu Kunze geschaffen sind. Aber nur ein ständiger Kontakt, ein sich Mühen und eine ständige Bereitschaft, auf Fragen und Probleme des Autors Kunze konsequent, sachlich, aber mit Feingefühl einzugehen, wird den Gewinnungsprozeß Kunzes vorantreiben. Je stärker Kunze zu spüren bekommt, daß die DDR eine ehrliche, aufrichtige Zusammenarbeit wünscht, um so eher wird er sich mit unserem Staat fester verbinden und von den westlichen Vertretern abwenden.
Obwohl Hans Marquardt am 21. August 1973 die Signalexemplare an Reiner Kunze senden konnte, wurde Brief mit blauem Siegel erst im Oktober 1973 ausgeliefert: „Allgemein ist zu sagen, daß der Lyrikband Brief mit blauem Siegel fast mit dem Tag des Erscheinens vergriffen gewesen ist […]“,32 heißt es dann in einer ersten Reaktion, die stellvertretend für zahlreiche andere stehen kann. Nach der vergleichsweise euphorischen Ankündigung von Paul Wiens im Januar 1973 fielen die drei nachfolgenden Pressereaktionen in der DDR durchwachsen bis abwartend distanziert aus. Es sei gut, so in Junge Welt:
[d]aß Kunze sich an seine Herkunft erinnert: der Vater noch im Schacht, mit Rissen im Rücken, Narben von niedergegangenem Gestein – der Sohn aber schon Dichter, der eben wegen seines Vaters von der Liebe singt. Wir sagen das, weil Kunze nicht immer sich dieser verpflichtenden Herkunft bewußt war in vergangenen Zeiten – wir hätten sonst nicht über den Umweg von Westberlin und der BRD Kenntnis von seinen Gedichten haben müssen. Der Reclam Band gibt Hoffnung auf einen Dichter Kunze, der uns, und nicht dem Klassengegner nützlich ist.33
Offenbar war man letztlich weder vom Erfolg der kulturpolitischen Öffnung nach dem VIII. Parteitag überzeugt, noch davon, Autoren, die wie Reiner Kunze fast ausschließlich im Westen veröffentlichten, doch im Kulturbetrieb der DDR integrieren zu können. Die im Neuen Deutschland erschienene Sammelrezension liest sich wie eine Vorwegnahme der sich spätestens seit Anfang 1974 anbahnenden Schlechtwetterlage: „Ich gestehe, dass ich Gedichte selten hintereinander lesen kann“, räumte Richard Christ ein, „[a]us Reiner Kunzes Brief mit blauem Siegel vielleicht „Mein fünfundzwanzigster Geburtstag“ oder „Erster Frühlingstag“, das andere aufgeschoben auf ein andermal, wenn Stimmung dafür ist.“34 Christ weiß mit Kunze nichts anzufangen. Der von ihm hervorgehobene Text „Mein fünfundzwanzigster Geburtstag“ stammt aus dem Jahr 1958. Im Eulenspiegel gibt man der Polemik freien Lauf:
Am stärksten wird natürlich die Fantasie durch die drei Gedankenstriche angesprochen.
Unverhohlen ist von Wut die Rede über Texte, „die auf eine elegische beziehungsweise wehleidige Art ,politisch‘ sind“, Resümee: „lyrisch dokumentierte Selbstisolierung“, die „auch zu einer stofflichen und formalen Verarmung geführt“ hat.35
Demgegenüber verweist Franz Hodjak in der rumäniendeutschen Zeitschrift Neue Literatur mit einer umfangreichen Besprechung auf die poetologischen Leistungen des Bandes, auf Einflüsse Brechts und auch auf Kunzes Abkehr von Brecht. Vor allem aber hebt Hodjak hervor, dass Kunze als einer der wenigen ostdeutschen Dichter die Zwänge und Determinationen thematisiert, denen ein Autor im realen Sozialismus begegnet, eine Erfahrung, die dem rumänischen Alltag sehr verwandt sei:
Die Landschaftsgedichte Kunzes sind aber keine Naturlyrik im herkömmlichen Sinn, die Landschaft wird zur dynamischen Umwelt des Menschen verlebendigt und läßt sowohl die geistigen und moralischen als auch physischen Determinationsfaktoren durchblicken, von denen die Existenz des Menschen in dem betreffenden geschichtlichen und geographischen Raum bedingt und bestimmt wird. Und darin sehen wir den vielleicht bedeutendsten zeitgemäßen Zug von Kunzes Lyrik, daß der Dichter eben nicht nur auf die Beschaffenheit menschlicher Existenz, sondern auch auf deren Bedingtheiten eingeht.36
Manfred Jäger wiederum geht in einer so einfühlenden wie taktisch klugen Rezension auf den Signalcharakter des Bandes für die DDR ein und stellt dessen Kompromisscharakter heraus:
In diesen Wochen wird die veränderte Lage nun endlich auch in einer Veröffentlichung sichtbar […] Ohne Zweifel stellt die hier möglich gewordene Zusammenstellung einen Kompromiß dar. Leicht hätte Kunze, wenn er auf dem Abdruck einiger brisanter Stücke politischen Klartexts hätte bestehen wollen, etwa der Solidaritätsbekundungen für Solschenizyn und Biermann oder mancher epigrammatischer Zuspitzungen des Bändchens Zimmerlautstärke das Projekt zu Fall bringen können. Er hat aber mehrfach betont, daß er, um Kunst unter die Leute zu bringen – und die Leserschaft in der DDR ist ihm am wichtigsten –, zu Kompromissen bereit sei, wenn sie nicht an die Substanz gingen. Sein Realitätssinn ist stark genug entwickelt, um einschätzen zu können, was erreichbar ist. Laute Demonstrationen nach dem Motto „alles oder nichts!“ sind seine Sache nicht.37
Noch vor Erscheinen des Bandes hatte Reiner Kunze den Verlag gebeten, das Manuskript an Friedemann Berger, Lektor im Gustav Kiepenheuer Verlag Weimar, zu senden. Berger sei „beauftragt worden, für den kommenden Schriftstellerkongreß ,die Analyse auf dem Sektor Lyrik‘ anzufertigen (Thüringen). Er kann im Falle K. nur von unserem Reclam-Band ausgehen.“38 Ob Berger die gewünschte Auswertung erarbeitet hat und ob sie für das Eingangsreferat von Hermann Kant bestimmt war, ist nicht überliefert.39 Die Dokumentation des vom 14. bis 16. November 1973 tagenden Schriftstellerkongresses weist jedenfalls keinen selbstständigen Beitrag über die bis dahin erschienene Lyrikproduktion aus. Aber eine Polemik Harry Thürks gegen Kollegen, die der Manipulation des Klassengegners erliegen:
Wer es hingegen vorzieht, seine Probleme nicht mit unserer Hilfe zu lösen und dafür den fragwürdigen Weg wählt, sie unseren erklärten Gegnern vorzutragen, um damit zu erreichen, daß wir durch deren publizistische „Amtshilfe“ gewissermaßen unter Druck gesetzt werden, der wird sich gefallen lassen müssen, daß wir ihn darauf aufmerksam machen, daß er sich freiwillig in das strategische Konzept der imperialistischen Meinungsmanipulation einbeziehen läßt.40
Auch wenn Reiner Kunze von Thürk nicht explizit genannt wird, ist seine Offensive strategisch geschickt platziert. Sie eröffnet nicht nur den Kampf der Kollegen gegen Kunze, sondern auch den Kampf der Hardliner gegen die Reformer nach dem Machtantritt Honeckers. In einem Interview während der Leipziger Frühjahrsmesse im März 1974 kam Kunze auf Thürk zu sprechen. Der habe „keine Zweifel aufkommen lassen, wen er meint. Aber solche Geräusche waren zu erwarten gewesen. Eben weil bestimmte Tatsachen möglich geworden sind, an deren Verwirklichung man vor einem Jahr kaum zu glauben gewagt hatte, werden manche Leute nervös.“41
Mitte Januar 1974 informierte Kunze den Reclam-Verlagsleiter über Schikanen, denen seine Tochter seit dem Herbst 1973 als Schülerin der Erweiterten Oberschule Greiz ausgesetzt war und legte entsprechende Briefe bei.42 Er bat darum, auch Jürgen Teller und Hubert Witt zu unterrichten. Nach den auf dem Schreiben befindlichen Kürzeln zu urteilen, kam Hans Marquardt der Bitte nach. Die Erfahrungen der Tochter und ihres Freundeskreises und vergleichbare Erlebnisse, über die Kunze auch nach Lesungen informiert wurde, können im Nachhinein als Impuls für die literarische Dokumentation des DDR-Alltagslebens Die wunderbaren Jahre gelten und erklären, weshalb Kunze einer Bitte Hans Benders, dem Herausgeber der Akzente, mit dem Kunze seit längerem in postalischem Kontakt stand, um neue Texte nicht nachkam. Welche Gründe könnte es für Kunzes Zurückhaltung noch gegeben haben? Zum einen entsprach Kunze damit der Übereinkunft mit dem Verlag und Staatssekretär Löffler, möglichst keine Westveröffentlichungen während der ersten und zweiten Auflage des Reclam-Bandes vorzunehmen und auf Interviews zu verzichten, die sich kritisch mit der DDR auseinandersetzen. Ausschlaggebend mochte aber ein anderer Grund gewesen sein: Reiner Kunze hatte mit der Arbeit an Die wunderbaren Jahre begonnen und wollte sie nicht gefährden.
Auflehnung des Individuums
Aus Anlass der Leipziger Frühjahrsmesse 1974 und im Vorgriff auf die zweite Auflage von Brief mit blauem Siegel lud der Reclam Verlag am 11. März 1974 erstmals zur „Stunde des Reclam-Verlags“ ein. Mit dieser Lesungsreihe wollte man Autoren aus Ost und West zusammenführen und auf der inzwischen zur „international“ erklärten Buchmesse überregionale Aufmerksamkeit erregen.43 Einlass wurde zunächst nur geladenem Publikum gewährt.44 Der Andrang war aber so überwältigend, dass man auch die Nebenräume für das nicht geladene Publikum, vor allem Schüler, Studenten und Lehrlinge,45 öffnete. Anwesend waren zahlreiche auf der Leipziger Messe akkreditierte westdeutsche Journalisten und Vertreter der ost- wie westdeutschen Verlagswelt.
Woher kam dieses außergewöhnliche Interesse an einer Lesung mit Reiner Kunze? Einen knappen Monat zuvor war Alexander Solschenizyn verhaftet und aus der Sowjetunion ausgebürgert worden, nachdem der erste Teil des Manuskripts des Archipel Gulag entdeckt worden war, ein Vorgang, der eine Zäsur im Umgang eines sozialistischen Staates mit kritischen Autoren darstellte.46 Ausbürgerungen verband man im mitteleuropäischen Raum bisher nur mit der Nazidiktatur. Wenn sich das Ausbürgern nach dem Vorbild der Sowjetunion auch in der DDR einzubürgern drohte, um an ein Bonmot Stefan Heyms zu erinnern, wen würde dieses politische Instrument als nächstes treffen? Robert Havemann, Wolf Biermann, Stefan Heym oder Reiner Kunze? Und wie würde Reiner Kunze in der Lesung auf die Ausbürgerung Solschenizyns reagieren?
Da auf Wunsch des Verlagsleiters Mitschnitte der Veranstaltung unterblieben, ist man auf die Berichte und Erinnerungen Anwesender angewiesen. Nach einer Einführung Marquardts habe Kunze das Wort ergriffen und kommentarlos mitgeteilt, „daß er zum ersten Mal seit 15 Jahren von einem Verlag zu einer Lesung eingeladen worden ist“47 und „nur das lese; was der Verlagsleiter genehmigt habe.“48 Dabei überrascht im Nachhinein die Bandbreite der vorgestellten Texte und die Freiheit, mit der er seine Themen behandelte. Glaubt man den Berichten, las Kunze nicht nur aus seinem Band Brief mit blauem Siegel, sondern auch neuere Arbeiten, Widmungstexte auf Jan Skácel, Ludvík Kundera und Stefan Heym.49 Er ging auf die Situation von Jugendlichen in der DDR ein, thematisierte die Bildungssituation sowie das Verhältnis von Lehrern und Schülern.50 Mit einem poetischen Bild über „Angler und Schriftsteller“ forderte Kunze schließlich doch den Widerspruch Marquardts heraus.
Über die Aussage, daß Fische in der Regel getötet werden und Verse manchmal zu leben beginnen, kommt er [Kunze] zu dem Schluß, daß beide Tätigkeiten den Menschen nicht ernähren können.51
Darauf entgegnete Marquardt, „daß nicht nur durch Hemingway bewiesen sei, daß Angeln und Dichten einen Menschen ernähren können – wenn sich Kunze mit qualitätsvoller Lyrik und Prosa um Wirklichkeitsbezogenheit bemüht, wird der Verlagsleiter alles in seiner Kraft stehende [sic] tun, um den Autor zu fördern.“52 Vorausgesetzt, dass die Abstimmung mit Marquardt keine Schutzbehauptung war, so lag diesem offensichtlich daran, mit Kunze etwas zu bewegen und ein Signal nach innen und außen zu setzen. Die Ausbürgerung Solschenizyns wurde nach den vorliegenden Informationen nicht kommentiert. Dennoch scheint die aufgeladene Situation auf deutsch-deutscher Bühne vor dem sich verschärfenden Ost-West-Konflikt Spuren hinterlassen zu haben.
Verlagsintern wurde festgehalten: „Reiner-Kunze-Veranstaltung kann im allgemeinen als ,gelungen‘ betrachtet werden […]. Einzelheiten klärt der VL [Verlagsleiter] mit R. K. noch in einem persönlichen Gespräch.“53 Ein solches Gespräch Marquardts mit Reiner Kunze ist nicht überliefert. Stattdessen ging Kunze auf Distanz:
Lieber Hans, ich möchte mich nochmals bei allen Mitarbeitern des Verlags bedanken, die an der Vorbereitung der Lesung beteiligt waren. Aus gesundheitlichen Gründen möchte ich Dich jedoch bitten, in diesem Jahr von evtln. weiteren Veranstaltungen (Du sprachst von Rostock) absehen zu wollen.54
Die Lesung scheint aus heutiger Sicht nicht nur das Ende des Stillhalteabkommens (gegenüber westlichen Medien) einzuleiten, sondern auch einen konzeptionellen Neuansatz zu markieren. Zur Frühjahrsmesse 1974 gab Kunze in umfangreichen Interviews Auskunft über sein philosophisches Denken, in dessen Zentrum Albert Camus rückt. Von Ekkehart Rudolph für die Süddeutsche Zeitung befragt, ob er noch Marxist sei, entgegnete er:
Auge in Auge mit dem Nichts zu leben und im Bewußtsein der Absurdität dieses Daseins Mensch sein zu wollen, sich als Mensch zu erweisen – das ist es, weshalb ich mich auf Camus berufe. […] Während Sartre das politische Engagement betont, „Geschichte machen“ will, bescheidet sich Camus damit, im einzelnen zu helfen, im Kleinen wie im Großen kein Unrecht unwidersprochen hinzunehmen, auch nicht, wenn seine Aufdeckung das heroischere „Geschichte machen“ kompliziert. (Und es hat sich ja erwiesen, was für eine unsichere Geschichte es ist, Geschichte zu machen, ohne die Geschichte bewältigt zu haben.) […] Camus leitet drei Schlußfolgerungen vom Absurden ab: die Auflehnung des Individuums gegen das Absurde, seine Freiheit und seine Leidenschaft. Damit kann ich mich absolut identifizieren.55
Kunze spielte also auch auf Camus’ Grundsatzstreit mit Jean-Paul Sartre an. Sartre, aktives Mitglied der KPF und Verfechter moskautreuer Positionen, war im Unterschied zu Camus zu keinem Zeitpunkt in der Resistance tätig gewesen. Sartre hatte sogar die moralische und politische Legitimität von Camus’ Engagement gegen die Besetzung in Frage gestellt. Zum anderen hatte Camus sehr zum Ärger Sartres auf einem Gewerkschaftskongress zur Unterstützung des Volksaufstands vom 17. Juni 1953 in der DDR aufgerufen und den Aufstand in einem ontologischen Sinn als Beleg für den nicht zu bändigenden Freiheitsdrang des Individuums und für sein in Der Mensch in der Revolte niedergelegtes philosophisches Credo verstanden.56 Camus habe formuliert:
was mir als Nichtphilosoph zu formulieren nicht gegeben ist, nämlich daß ich in diesem Dasein Auge in Auge mit dem Nichts leben und angesichts dieses Nichts versuchen muß, mein Menschsein zu begreifen; daß ich verantwortlich bin, daß ich Verantwortung habe für andere und anderes.57
Das kulturpolitische Klima kippt
Die Ausbürgerung Solschenizyns am 14. Februar 1974 markiert auch in der DDR einen kulturpolitischen Bruch. Künstlerverbände begrüßten diese Entscheidung ebenso wie Kultureinrichtungen und maßgebliche Autoren. Nach Bekanntwerden der Ausweisung Solschenizyns erklärte der Vizepräsident des Schriftstellerverbands Fritz Selbmann, „ich halte das für die beste Lösung. Nur hätte man diese Lösung vielleicht schon etwas früher finden können. Solchenizyn [sic] hat den Weg des offenen Verrats beschritten.“58 Wolfgang Joho, bis 1966 Chefredakteur des Verbandsblattes NDL und abgelöst wegen des Vorabdrucks von Wolfgang Bräunigs Rummelplatz, empfahl:
Vielleicht sollte man in der DDR überlegen, ob man nicht auch Herrn Biermann aber in erster Linie Herrn Kunze auf diese Weise los wird.59
Auch Hans Marquardt ließ wissen, „daß es für ihn ein Gefühl der Befreiung sei und er sich nach wie vor voll und ganz hinter die SU stellt“.60 Es war nicht mehr zu ignorieren, dass die Liberalisierungs- und Integrationsbestrebungen, die nach dem Machtantritt Honeckers verkündet worden waren und die Einzelne in den Partei- und Staatsorganen nach dem Machtantritt Honeckers umzusetzen suchten, Vergangenheit waren. In der Dienstbesprechung vom 23. April 1974 informierte Marquardt „über die für den Verlag wichtigsten Punkte der Beratung bei Min. Höpcke“. Zu Reiner Kunze heißt es:
Karte in der HV zurückziehen, aus Plandiskussion.61
Offensichtlich war in Berlin die Direktive ausgegeben worden, weitere Vorhaben mit Reiner Kunze auf Eis zu legen.
Aus einem Maßnahmeplan der Hauptverwaltung XX/7 der Staatssicherheit in Berlin vom Juli 1974 lässt sich ebenfalls ein verändertes Vorgehen gegenüber Kunze ablesen:
Die Bearbeitungsmethode bei K. [Kunze] soll analog der Arbeitsmethode, die bei Biermann angewendet wird, erfolgen.62
Im Zentralkomitee, so heißt es weiter, werde zu Biermann voraussichtlich im IV. Quartal 1974 eine Entscheidung fallen:
In absehbarer Zeit ist in dieser Beziehung etwas mit B. im ZK geplant. Vom Ausgang dieser Sache hängt es ab wie mit den anderen Schriftstellern gearbeitet wird u.a. mit K.
Als sichtbarstes Zeichen für den politischen Wandel kann die Verabschiedung der neuen Verfassung der DDR gelten, die am 7. Oktober 1974 in Kraft trat. Darin waren sämtliche Hinweise auf die deutsche Nation und gesamtdeutsche Bindungen getilgt. Auf der nach den Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag der DDR stattfindenden 13. Tagung des ZK der SED (12.–14.12.1974) stellte Honecker in seinem Bericht ausdrücklich die Absage an jegliche Annäherung zwischen beiden deutschen Staaten heraus und warnte vor „Deutschtümelei“, die in „unserem sozialistischen deutschen Staat“ selbstverständlich keinen Platz habe. Diese würde „gewollt oder ungewollt jenen in die Hände arbeiten, die für die reaktionärste Variante deutscher Politik die Tore offen halten wollen.“63 Wer wollte und die Schrift an der Wand zu interpretieren verstand, konnte dies auch als Handlungsanweisung im Umgang mit Autoren wie Reiner Kunze verstehen.
Eine zentrale Entscheidung über den Umgang mit Biermann und damit auch über die Zukunft Heyms, Havemanns, Kunzes und anderer kritischer Autoren wurde aber noch um zwei Jahre verschoben. 1974 und 1975 achtete man darauf, die außenpolitische Reputation der DDR nicht zu gefährden. Vor allem war die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) zu berücksichtigen, deren Schlussakte am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichnet wurde. Bis Ende 1975 war der auslaufende zinslose Überziehungskredit mit Westdeutschland neu zu verhandeln. Rücksicht genommen werden musste außerdem auf die Konferenz von 29 kommunistischen- und Arbeiterparteien Europas, die vom 29. bis 30. Juni 1976 in Ost-Berlin tagte.
Finale
Nachdem im September 1976 im S. Fischer Verlag Die wunderbaren Jahre, „Prosa“ über den Alltag in der DDR, erschienen war, wurde Reiner Kunze am 29. Oktober 1976 aus dem Schriftstellerverband Erfurt/Gera ausgeschlossen. Das Präsidium des Zentralverbandes bestätigte den Ausschluss am 3. November,64 die Presse berichtete zwei Tage später.65 Gerhard Henniger, 1. Verbandssekretär, erklärte, dass er bei der „Bestätigung […] mit keinerlei Schwierigkeiten rechnet, da Hermann Kant und auch Erwin Strittmatter der Ansicht sind, daß […] es Zeit wäre, Kunze aus der DDR auszuweisen“.66 Gegen den Ausschluss protestierten unter anderem Stephan Hermlin und Stefan Heym, während das Präsidium und der Vorstand des Verbands, in letzterem waren die Leitungen der Bezirksverbände vertreten, die Entscheidung einhellig als längst überfällig begrüßten. Harry Thürk, Vorsitzender des Schriftstellerbezirksverbands Erfurt/Gera hatte bereits im Juli 1973 den Verbandsausschluss Kunzes gefordert und sich mit seiner Forderung letztlich durchgesetzt.67 Noch vor dem Ausschluss hatte Fred Rodrian, Leiter des Kinderbuchverlages, die gedruckte und zur Auslieferung bereitstehende Auflage des Kinderbuches Der Löwe Leopold einstampfen lassen:
Sehr geehrter Herr Kunze, Ich habe Ihr Buch Die wunderbaren Jahre gelesen. Die Herausgabe dieses verleumderischen Buches in der BRD und die Herausgabe des Buches des gleichen Autors im Kinderbuchverlag schließen einander aus.68
Hans Marquardt dagegen bemühte sich wohl noch einmal, seinen Einfluss und seine Möglichkeiten geltend zu machen, um den „Fall Kunze“ zu befrieden. Er wollte Reiner Kunze nach Leipzig holen und ihn durch den Wohnungswechsel zumindest partiell au der Schusslinie der thüringischen Kollegen und des Geraer Sicherheitsapparates nehmen. Offensichtlich hatte er sich deshalb auch an Dietmar Keller gewandt, worauf ein Brief Kellers an Marquardt vom 31. Oktober 1996 schließen lässt. Keller, von November 1989 bis März 1990 Kulturminister der DDR, war in jenen Jahren Sekretär für Wissenschaft, Volksbildung und Kultur der SED-Bezirksleitung Leipzig. Keller erinnert sich:
Was ich auch unternahm, ich stieß wie auf eine Betonwand. Bezirksarzt und Bezirkskrankenhaus St. Georg sahen keine Möglichkeit Frau Kunze einzustellen. Literaturinstitut und Kulturabteilung des Rates des Bezirkes verschleppten die Antwort und ich verlor sie etwas aus den Augen und dann war R. Kunze plötzlich in der Bundesrepublik. Heute weiß ich, warum ich damals hingehalten wurde […].69
Der kulturelle und politische Riss, der nach der Ausbürgerung Biermanns im November 1976 die Literatur Ostdeutschlands spaltete, ließ sich durch lokale Interventionen nicht mehr lösen. Am 7. April 1977 stellte Kunze einen Antrag auf Ausreise, dem binnen weniger Tage entsprochen wurde. Während bei Reclam im Jahr 1977 noch seine Übersetzung eines Langgedichts des tschechischen kommunistischen Kult-Dichters Jiří Wolker „Ballade von den Augen des Heizers“ erschien,70 kommentierte Hermann Kant die am 13. April erfolgte Ausreise Kunzes:
[K]ommt Zeit, vergeht Unrat. 71
Zehn Jahre später war man sich dieser Gewissheit indessen nicht mehr so sicher. Auf dem X. Schriftstellerkongress im November 1987 versuchte es Kant mit einer Kehrtwende:
Was wir damals beschlossen haben, den Abschied von einer Reihe von Kollegen, ihren Ausschluß, das muß ja nicht für alle Ewigkeit gelten.72
Es seien keine Beschlüsse gefaßt worden, „die uns auf Dauer trennen müssen.“
Marcel Reich-Ranicki brachte es in einem Kommentar auf die bündige Formel:
Der Täter verzeiht den Opfern.73
Und auch Erich Loest kommt in einem Schreiben an Kulturmister Hoffmann im Juli 1989 noch einmal auf die Erfahrung von Ausgrenzung und Ausreise zurück:
Wir können noch nicht einmal die letzten zehn Jahre auslöschen. Das ganze Gerede: Kehrt doch zurück, wir wollen alle so tun, als wäre nichts gewesen! ist ein Schmarrn und für die Katz.74
Nach dem Fall der Mauer wird Reiner Kunze nicht mehr zu Reclam Leipzig zurückkehren. Aber es erscheinen hier wieder einzelne Arbeiten. In der von Peter Geist herausgegebenen Anthologie Ein Molotow-Cocktail auf fremder Bettkante. Lyrik der siebziger, achtziger Jahre von Dichtern aus der DDR75 finden sich vier Kunze-Texte, drei aus dem Band Zimmerlautstärke und ein Text aus Brief mit blauem Siegel. 1993 kam zudem eine Neuauflage der 1987 von Ludvík Kundera herausgegebenen Sammlung Sonnenuhr. Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten mit einigen, seinerzeit eliminierten Übersetzungen Kunzes heraus, so von Miruslav Holub und Jan Skácel.
Reiner Kunze wurde 1981 gefragt, ob er ein politischer Dichter sei. Kunze antwortete:
Ich bin kein politischer Autor, kein Autor, der schreibt, um Politik zu machen.76
Wulf Kirsten fügt 20 Jahre später hinzu:
Wohl aber einer, mit dem Politik gemacht wurde wegen seiner Geradlinigkeit und Kompromißlosigkeit. Er wurde zum Politikum erhoben und als abschreckendes Beispiel eines Staatserschütterers vorgeführt. Öffentlich wie heimlich bis unheimlich.
So war der 1973 im Reclam Verlag erschienene Band Brief mit blauem Siegel, wie Günter Kunert schrieb, tatsächlich „wohl das Maximum des Möglichen“.77Zitiert nach Scheer: Kunze, S. 124[/footnote]
Klaus Michael, in Ingrid Sonntag (Hrsg.): An den Grenzen des Mögliche. Reclam-Leipzig 1945–1991, Ch. Links Verlag, November 2016
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jörg Bernhard Bilke: Fünf Jahre Schweigen
Rheinischer Merkur, 23.11.1973
Andreas M. Reinhard: Reiner Kunze
Rudolf Wolff (Hrsg.): Schriftenreihe DIALOG, 1981
Jürgen P. Wallmann: Ein Prüfstein für die Kulturpolitik der DDR
Deutschland Archiv, Heft 9, 1973
Auch in: Die Tat, 25.8.1973
Unter dem Titel: 15000 mal Reiner Kunze
Der Tagesspiegel, 7.9.1973
Heinz Klunker
Die Weltwoche, 12.9.1973
Jürgen Engler
Ich schreibe, Heft 2, 1974
Interview im Hessischen Rundfunk
Redakteur: Herr Kunze, seit vielen Jahren ist dies Ihre erste Reise in den Westen. Worauf führen Sie es zurück daß Sie nach München kommen konnten!
Reiner Kunze: Erstens darauf, daß ich in den Jahren, in denen ich nicht nach dem Westen reisen durfte, einflußreiche Verleger, hervorragende Lektoren, ausgezeichnete Übersetzer und viele Freunde hatte, denen ich die Ehre verdanke, heute den Mitgliedern der Bayerischen Akademie der Schönen Künste bekannt zu sein.
Zweitens darauf, daß die Öffentlichkeit eine Instanz ist, die unter bestimmten Umständen nicht auf die Dauer ignoriert werden kann. Drittens darauf, daß solche Umstände nicht nur Ergebnisse weltpolitischer Konstellationen sind, also Folgen von Sach- oder Machtzwängen, sondern auch von Menschen geschaffen oder gefördert werden. Ich weiß in der DDR neuerdings Menschen, die gewiß nicht nur aus Zugzwang, sondern mit aufrichtigem Engagement das ihnen Mögliche tun, um eine für die Kunst günstigere Atmosphäre zu schaffen, und in der Kompetenz dieser Menschen hatte es gelegen, unsere Reise nach München zu genehmigen.
Redakteur: Sie sagen „günstigere Atmosphäre“. Beziehen Sie das „günstiger“ nur auf die Vergangenheit oder ist es eine Relativierung an sich?
Kunze: Es ist auch eine Relativierung an sich. Eine Atmosphäre ist ebensowenig nur von administrativen Entscheidungen abhängig, wie sie nur von der Intensität des Bedürfnisses nach geistiger Offenheit, Sensibilität, Mut, Ehrlichkeit usw. abhängig ist. Da gibt es viele Bedenken. Befürchtungen, Verdächtigungen, Mißverständnisse und Ängste – vom Mangel an Kunstverstand ganz zu schweigen, und es gibt den mehr oder weniger geschickt getarnten Widerstand derer, die wissen, daß ihre Stunde als Künstler geschlagen hat, wenn die Stunde der Kunst schlägt.
Redakteur: Der Vizepräsident des Deutschen Schriftstellerverbandes der DDR, Professor Max Walter Schulz, sagte in einem Interview mit der Illustrierten STERN, es sei „Legende“, daß man Sie nach dem Schriftstellerkongreß 1969 in der DDR mundtot gemacht habe.
Kunze: Auch eine Möglichkeit, bewußt oder unbewußt den Versuch zu unterhöhlen, eine günstigere, also auch ehrlicherer Atmosphäre zu schaffen. Ich würde Max Walter Schulz das Buch empfehlen Die Unfähigkeit zu trauern.
Redakteur: Mußten Sie den Text der Ansprache, die Sie bei der Entgegennahme des Literaturpreises gehalten haben, Ihren behördlichen Stellen zur Genehmigung vorlegen, bevor Sie in die BRD reisen durften!
Kunze: Hätte ich den Text genehmigen lassen müssen, hätte ich es vorgezogen, nicht zu reisen.
Redakteur: Wie erklären Sie es sich, daß vorerst nur von Ihnen eine Auswahl Gedichte in der DDR erscheinen wird und nicht auch von Wolf Biermann?
Kunze: Ich habe Wolf Biermann seit anderthalb Jahren nicht gesprochen, weiß aber, daß er ein Mensch ist, der immer sein gesamtes Lebendgewicht in die Waagschale werfen möchte. Man fürchtet wohl vorerst noch um die Waage. – Und ich eben glaube, daß unter Umständen auch eine Publikation, an der sich das spezifische Gewicht ablesen läßt, schon einen Wert haben kann.
Redakteur: Von Ihnen gibt es die Gedichte „Lied vom Biermann“ und „Wolf Biermann singt“, und von Wolf Biermann gibt es das Gedicht „Selbstporträt für Reiner Kunze“. Wie ist es zu verstehen, daß Sie einander anderthalb Jahre nicht gesprochen haben?
Kunze: Wenn zwei noch so verschiedene Vögel Morgenarbeiter sind, und sie sitzen beieinander, rufen alle Eulen sofort nach der Nacht.
Redakteur: Wer hat die Gedichte ausgewählt, die in Ihrem Buch bei Reclam, Leipzig, erscheinen werden, und wann ist mit dem Band zu rechnen?
Kunze: Die Gedichte habe größtenteils ich selbst ausgewählt. Der Verlag hatte es für angezeigt gehalten, zusätzlich einige ältere Gedichte aufzunehmen, womit ich mich einverstanden erklären konnte. Im übrigen haben sich mein Lektor, Herr Hubert Witt, dessen Erfahrungen und Ideen bei der Zusammenstellung des Buches mir besonders wertvoll waren, und die Verlagsleitung in achtenswerter Weise für das Zustandekommen dieses Bandes eingesetzt. Die Auswahl wird unter dem Titel Brief mit blauem Siegel als 553. Band der Universalbibliothek im September dieses Jahres erscheinen.
Redakteur: Es gibt von Ihnen sechs eigenständige Buchpublikationen mit Lyrikübertragungen aus dem Tschechischen. Sie erhielten den Übersetzerpreis des Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes 1968; bereits 1964 erschien ein Band Ihrer Gedichte in tschechischer Übersetzung. Wie geht es den Dichtern, die von Ihnen ins Deutsche oder von denen Sie in Tschechische übersetzt worden sind, heute?
Kunze: Auf einer Postkarte vom 15.6.1973 wurde mir mitgeteilt, daß in der Tschechoslowakei der 7. Band der Werke Bertolt Brechts mit dem Vermerk erschienen ist: „Übersetzt nach den deutschen Originaltexten.“ Nicht genannt wird der Autor, der die Prosa übertragen hat. Nicht genannt wird der Nachdichter der Verse und Verfasser des Nachwortes. Beides sind die autorisierten Editoren des Gesamtwerkes von Bertolt Brecht für die Tschechoslowakei, doch auch in dieser Eigenschaft werden sie nicht erwähnt. Ihre Namen und Geburtsdaten sind gelöscht worden. Wie ich weiß – und ich nenne die Namen bewußt, damit sie im Bewußtsein bleiben – handelt es sich um den Übersetzer Rudolf Vápenik, der bis 1969 Direktor des Hauses der Tschechoslowakischen Kultur in Berlin war, und um den Dichter Ludvík Kundera. Das Streichen von lebenden Menschen aus dem Register der Lebenden empfinde ich als einen Alp.
Redakteur: Haben Autoren, die in ihrem eigenen Land nicht gedruckt werden, die Möglichkeit, in einem anderen sozialistischen Land zu publizieren, vorausgesetzt, daß sie einen Übersetzer finden?
Kunze: In seiner Eigenschaft als Autor ist dann für einen solchen Dichter das gesamte sozialistische Lager ein Riesengrab. Wenn nicht irgendwo ein Wunder der Auferstehung geschieht, bevor es entdeckt wird (ein solches Wunder kann durch Unkenntnis oder durch den Salto mortale eines Zeitschriftenredakteurs bzw. – wenn auch wesentlich seltener – Verlagsdirektors geschehen). Das Wort „Riesengrab“ wird mir nicht nur von denen, die nicht zu Ende denken wollen, können oder dürfen, verübelt werden, sondern möglicherweise auch von denen, die sehr wohl zu Ende denken und deshalb wissen, daß sich nichts Hals über Kopf ändern läßt – eine Einsicht, die ich weitgehend teile. In diesem Fall geht es aber um Hälse und Köpfe – wenn auch nicht in physischer Hinsicht (zumindest nicht mehr in physischer Hinsicht oder nur insofern, als es sich dann um nicht durch Obduktion nachweisbare Folgen des lebendig Begrabenseins handelt). Ich habe in diesem Riesengrab gelegen und werde – auch auf die Gefahr hin, wegen vermeintlichen Mangels an Geduld wieder hineingelegt zu werden – zu dieser Art sozialistischer Kooperation nicht schweigen. Jede sozialistische Regierung sollte so souverän sein, sich von den Dichtern, Übersetzern und Verlegern ihres Landes beraten zu lassen, welchen Schaden die eigene Literatur nimmt, wenn das Werk eines bedeutenden fremden Dichters nicht übersetzt und rezipiert wird, und Druck auf diplomatischer Ebene, der andere sozialistische Regierungen nötigt, ihrerseits auch eine Schaufel Schweigen auf einen Dichter zu werfen, weil dieser in seiner Heimat momentan gewisse Schwierigkeiten hat, sollte der Vergangenheit angehören. Denn unter dieser Praxis leiden ja nicht nur Dichter, sondern auch die Literaturen der Völker. Ich möchte, um ihn genannt zu haben, nur Jan Skácel nennen, einen der besten zeitgenössischen tschechischen Dichter. Einer Literatur, in deren Sprache die Gedichte Jan Skácels fehlen, fehlt ein Stück menschlichen Horizontes. Ich bedauere, daß wir in München, also im Westen, auf diese Problematik zu sprechen kommen. Ich hätte lieber in Leipzig oder in Greiz darüber gesprochen, um zusätzliche Mißverständnisse zu vermeiden. Aber ich bin gefragt worden, und man wird von mir nicht verlangen können, daß auch ich noch eine Handvoll Schweigen auf meine Freunde werfe. – Ich sage Ihnen aber genauso offen: Wenn für die Beteiligung an obengenannter Kooperation ein Geschäft winkt, beerdigt mancher westliche Verleger skrupellos mit.
Redakteur: Welche Erwartungen setzen Sie in die Kulturpolitik der DDR für die nächste Zukunft?
Kunze: Ich weiß nicht, was morgen sein wird, ich weiß nur, was heute ist (zum Teil folgere ich die Zusammenhänge auch nur aus einzelnen mir bekannten Tatsachen). Das aber, was ist oder zu sein scheint, ist ermutigend. In den vergangenen Monaten habe ich Gespräche geführt, die nach meinen Erfahrungen in den letzten zehn Jahren undenkbar gewesen wären. Undenkbar insofern, als es auf der Ebene, um die es sich hier handelt, Gespräche gar nicht gegeben hat, sondern nur Aussprachen. In einer Aussprache sind diejenigen, die mit Ihnen sprechen, Subjekt, und Sie sind Objekt. Ich fühle mich heute erstmals als Bürger geachtet, und in den erwähnten Gesprächen gewann ich den Eindruck, daß man wünschte, dieses Gefühl wäre bereits eine begründete Selbstverständlichkeit was sich nicht nur auf meine Person bezieht. Und unter solchen Voraussetzungen könnte möglicherweise genügend Stabilität gewonnen werden, kulturpolitisch weittragendere Bögen zu spannen.
Redakteur: Um den Spieß umzudrehen: Was darf die neu akzentuierte Kulturpolitik der DDR von Ihnen erwarten? Werden Sie Ihre Bücher nun so schreiben, daß sie in Verlagen der DDR erscheinen können?
Kunze: In der Kunst gelten – substantiell und formal nur künstlerische Kriterien. Ich kann also nur wiederholen, was ich in meiner Dankrede bei der Entgegennahme des Preises, gesagt habe: Für mich gibt es in der Kunst, im Kunstwerk, keine Kompromisse. – Selbstverständlich werde ich unter den neuen Bedingungen mein nächstes Buch, wenn es in zwei, drei Jahren fertig sein sollte, zuerst einem Verlag der DDR anbieten, und zwar nicht nur, um dem geltenden Urheberrecht zu genügen, sondern weil ich das Bedürfnis habe, auch und in erster Linie in der DDR ein verlegerisches Zuhause zu finden. Außerdem wäre ich bereit – selbst bei dem Opfer, daß ein Buch weniger entsteht –, in Lesungen, Vorträgen über Poesie und Diskussionen zu versuchen, mein Teil zur Verbesserung der Atmosphäre beizutragen. In den letzten Jahren war mir das fast ausschließlich nur intern unter dem Doppeldach der Kirchen, also in Studentengemeinden usw., möglich gewesen. Vielleicht läßt sich noch etwas mehr tun.
Deutschland Archiv, August 1973
Kunze Nachtrag
In der letzten Sendung habe ich an dieser Stelle über den neuen Lyrikband von Reiner Kunze brief mit blauem siegel gesprochen, der im Leipziger Reclam Verlag erscheint. Inzwischen habe ich noch einmal in Leipzig recherchiert und erfahren müssen, daß mir vom Verlag falsche Informationen gegeben wurden, die ich in meinem Beitrag verwendet habe, weil sie mir glaubwürdig schienen. Ich habe jetzt den Verdacht, daß mir der Leipziger Reclam Verlag gezielte Desinformationen zukommen ließ mit der Absicht, Reiner Kunzes Glaubwürdigkeit im Westen zu diskreditieren.
1. Der Leipziger Reclam Verlag hat behauptet der tschechische Lyriker Jan Skácel würde zur Herausgabe in der DDR vorbereitet; Kunzes Aussage in einem westlichen Interview, Skácel liege in einem gesamtsozialistischen Riesengrab, sei, so Reclam, bereits überholt gewesen. Tatsache ist, daß man in Leipzig erwogen hat, den heute in der ČSSR unterdrückten Skácel in der DDR zu publizieren, zusammen mit dem Lyriker Vladimir Holan. Als das Veto aus Prag im Ostberliner Kulturministerium eintraf, wurde Skácel auch zur persona non grata in der DDR erklärt. Kunze wurde daraufhin nahegelegt, auf Skácel zu verzichten und nur Holan-Übersetzungen zu publizieren. Kunzes entschiedene Antwort: entweder beide oder keiner.
2. Der Leipziger Reclam Verlag hatte verlauten lassen, wenigstens eine Stelle in dem Interview, das Reiner Kunze in München dem Hessischen Rundfunk gab, sei verfälscht worden. Auch diese Information ist falsch. Man mag den Gründen nachforschen, warum man in der DDR ein Interesse daran hat, Kunzes Position zu untergraben.
3. Reiner Kunze hatte nach dem Angriff von Max Walter Schulz auf seine Person 1969 absolutes Publikationsverbot. Dem Autor wurden sogar Übersetzungen und Nachdichtungen fremdsprachiger Lyriker wie Illyes, Nagy und Novomesky, ein Freund Husáks übrigens, verboten. Eine Reihe von DDR-Verlagen wurde vertragsbrüchig. Daß 1971 die Kunze-Übertragung eine Jiri-Wolker-Ballade in der DDR erscheinen konnte, ist, dem Mut eines einzelnen zu verdanken, der den Kunze-Boykott auf eigene Faust durchbrach.
An der Glaubwürdigkeit und moralischen Integrität Kunzes kann kein Zweifel bestehen, auch wenn Kunze in seinem für die DDR neuen Lyrikband möglicherweise einen Weg des Kompromisses ging, der sich darin ausdrückt, daß Kunze etwa aus dem Gedichtzyklus „einundzwanzig variationen über das thema ,die post‘“ einige Gedichte weggelassen hat. Wenn Günter Kunert zu dem in Leipzig erschienenen Kunze-Band schreibt, er sei „wohl das Maximum des Möglichen“, dann ist dieser gewichtigen Formulierung Kunerts nichts mehr hinzuzufügen.
A.W. Mytze, Rias 12.9.1973
Warnung vor geistigem Provinzialismus
– Interview mit dem DDR-Lyriker Reiner Kunze. –
Der in Greiz/Thüringen lebende Lyriker Reiner Kunze gab während der Leipziger Buchmesse Dr. Karl Corino vom Hessischen Rundfunk aus der Bundesrepublik das folgende Interview.
Karl Corino: Als ich Sie während der Leipziger Frühjahrsmesse 1973 um Ihre Meinung zur kulturpolitischen Entwicklung in der DDR bat, antworteten Sie, es sei noch zu früh, etwas zu sagen, in einem Jahr wisse man mehr. Darüber, daß man heute mehr weiß, besteht kein Zweifel. Allein wenn wir uns an Ihre Person halten: Der Reclam-Band, an dessen Erscheinen man damals kaum zu glauben gewagt hatte, liegt auf dem Tisch. Sie haben nach München reisen dürfen, um den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste entgegenzunehmen. Sie waren zu einer öffentlichen Lesung in Bonn. Andererseits sind Sie nicht zum Schriftstellerkongreß der DDR delegiert worden und in Delegiertenkreisen wird der Diskussionsbeitrag, den Harry Thürk auf dem Kongreß gehalten hat, als Versuch gewertet, Sie erneut politisch zu denunzieren – wenn diesmal auch ohne Namensnennung. Wie lassen sich diese Tatsachen miteinander vereinbaren?
Reiner Kunze: Thürks Trommelwirbel gegen jene Kollegen, die im Westen publizieren, kenne ich bereits aus einer Rede, die er als Vorsitzender der Bezirksverbände Erfurt-Gera zur Vorbereitung des Kongresses in Weimar gehalten hat, und in ihr hat er keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wen er meint. Aber solche Geräusche, waren zu erwarten gewesen. Eben weil bestimmte Tatsachen möglich geworden sind, an deren Verwirklichung man vor einem Jahr kaum zu glauben gewagt hatte, werden manche Leute nervös.
Corino: Man scheint auf diese Leute jedoch ziemlich viel Rücksicht zu nehmen. Nach Schweden durften Sie beispielsweise nicht mehr fahren, um den Preis entgegenzunehmen, der Ihnen vom Internationalen Autorenprogressiv verliehen worden ist. Auch haben Sie Einladungen an die Universität Cambridge und zum Poetry-International-Festival in London nicht annehmen können, obwohl andere DDR-Autoren nach Schweden, England oder in die USA reisen dürfen.
Kunze: Ich kann die Richtigkeit Ihrer Vermutung, daß man auf Leute wie Thürk Rücksicht nimmt, nicht ausschließen. Die Provinz ist gegenüber Vernunft nicht gerade anfällig. Wobei ich unter Provinz nicht etwas geographisch Eingrenzbares verstehe. Die Provinz, die ich meine, hat leider nur geistige Grenzen; was die Sache so kompliziert macht.
Corino: Dennoch hat der Reclam-Verlag die zweite Auflage Ihres Buchs Brief mit blauem Siegel angekündigt, und zwar das 16. bis 30. Tausend. Zu einer so hohen Nachauflage hat sich der Verlag doch nicht nur aus reiner Liebe Ihnen gegenüber entschieden.
Kunze: Aus reiner Liebe handle ich eigentlich auch nur gegenüber meiner Frau. Die Notwendigkeit, ein Buch mit der Hand abzuschreiben, um es besitzen zu können, ist für den Betreffenden nicht nur nicht erfreulich, sondern ausgesprochen ärgerlich, wenn es dieses Buch bereits für eine Mark fünfzig zu kaufen gegeben hat. Und wie ich aus Briefen erfahren konnte, existieren schon wieder Abschriften. Abgesehen davon deute ich die Ankündigung der zweiten Auflage jedoch als Hinweis darauf, daß man bestrebt ist, die begonnene Kulturpolitik konsequent fortzusetzen.
Corino: Auf der Pressekonferenz des Leipziger Börsenvereins am 11. März sagte Erik Neutsch als einer der Herausgeber der Anthologie Chile – Gesang und Bericht, auch Wolf Biermanns Lied vom Tod des schwedischen Kameramanns in Santiago werde in dieses zum Jahresende erscheinende Buch aufgenommen, wenn der Autor den Text offiziell einreiche. Schließen Sie daraus, daß nun auch Biermann in diese Kulturpolitik einbezogen werden wird?
Kunze: Der Dichter Biermann ist unteilbar. Sollte diese Aufforderung mit der prinzipiellen Bereitschaft verbunden sein, in der DDR auch eine Auswahl seiner Gedichte und Lieder herauszubringen, in der Biermann als Biermann kenntlich wird, dann wäre meines Erachtens tatsächlich die Möglichkeit eines Aufeinanderzugehens gegeben. Denn Biermann hat seinerseits bereits erklärt, daß er zu vertretbaren Kompromissen bereit ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es, wenn es keine Biermann-Auswahl geben würde, auf die Dauer einen in der DDR publizierenden Kunze geben könnte.
Corino: Auf der erwähnten Pressekonferenz wurde auch erklärt, Biermann sei in einer Anthologie des Schweizer Benziger-Verlags mit Lyrik aus der DDR deswegen nicht vertreten, weil sich die übrigen Autoren von ihm brüskiert fühlten und im Falle seiner Aufnahme den Abdruck ihrer Gedichte verweigert hätten.
Kunze: Wahrscheinlich bezieht man sich auf die Biermann-Strophe – ich zitiere aus dem Kopf:
Die Dichter mit der feuchten Hand,
sie dichten zugrund das Vaterland,
das Ungereimte reimen sie,
die Wahrheitssucher leimen sie,
die hab’ ich satt
Ich habe mich durch diese Strophe nie brüskiert gefühlt, weil ich nicht an Handschweiß leide.
Corino: Dabei stimmen Sie nicht in allem mit Biermann überein, wie Sie an anderer Stelle zu verstehen gegeben haben.
Kunze: Durchaus nicht. Seine Zukunftsvisionen halte ich beispielsweise für politische Fata Morganen. Das ändert aber nichts daran, daß er Lieder geschrieben hat, von denen ich uns eine Schallplatte wünschte von einer Million Auflage.
Corino: Der Ton, in dem auf der Pressekonferenz geantwortet wurde, läßt hoffen, daß Ihr Eintreten für Biermann richtig verstanden wird, so daß das Erscheinen der 2. Auflage Ihres Buches dadurch, nicht gefährdet ist.
Kunze: Wenn sie nur unter der Voraussetzung möglich wäre, daß ich mich auf einem Auge blind stelle, würden auch vielleicht die Leser, auf die es mir ankommt, das Buch lieber abschreiben als es in dem Bewußtsein käuflich zu erwerben, daß sein Autor käuflich ist.
Deutschland Archiv, April 1974
Gespräch mit Reiner Kunze
Ekkehart Rudolph: Reiner Kunze, vielleicht erzählen Sie zuerst, woher sie kommen, wo Sie geboren wurden, wer Ihre Eltern sind.
Reiner Kunze: Ich wurde 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge, im Steinkohlenrevier geboren. Mein Vater war Bergarbeiter, und auch die Vorfahren meines Vaters sind alle Bergarbeiter gewesen. Meine Mutter war Heimarbeiterin, Kettlerin in der Strumpfindustrie. Sie kommt aus einem künstlerisch-bürgerlichen Milieu, ihr Vater war Steinbildhauer.
Rudolph: Ihre Eltern waren beide Arbeiter. Das hat ganz sicher Ihre persönliche Entwicklung beeinflußt.
Kunze: Das kann man wohl sagen. Ich kann mich zwar nicht entsinnen, daß ich als Kind unser Dasein jemals politisch interpretiert bekommen hätte, aber ich bin neben der Kettelmaschine aufgewachsen, die am Fenster stand, und in dieser Hinsicht habe ich das Arbeiterdasein existentiell ziemlich bewußt mitgelebt.
Rudolph: Sicher war es für Ihre Familie ungewöhnlich, daß Sie sich für einen akademischen Beruf entschieden haben. Wie ist das gekommen? Wie war Ihre Entwicklung bis zu Beginn des Studiums?
Kunze: Der Gedanke an den Besuch einer höheren Schule hatte außerhalb unseres familiären Koordinatensystems gelegen. Ich hatte Schuhmacher werden sollen, und mein Schemel war mir bei meinem zukünftigen Meister schon sicher gewesen. Aber nach Kriegsende wurden für Arbeiterkinder auf den Oberschulen sogenannte Aufbauklassen (9. bis 12. Schuljahr) eingerichtet, und ich kam in eine solche Klasse. Der Lehrer hatte allerdings alle Mühe, meinen Vater davon zu überzeugen, daß der Weg über die Oberschule die Möglichkeit nicht ausschloß, einen ordentlichen Beruf zu erlernen.
Rudolph: Ihr Vater wollte also, daß Sie Handwerker oder Arbeiter werden?
Kunze: Ja. Doch für mich war das Ganze märchenhaft, ein Wunder. Ich begann, mich für alles zu engagieren, was zu diesem Wunder geführt hatte oder geführt zu haben schien.
Rudolph: Für was haben Sie sich engagiert? Für politische Ideen?
Kunze: Für politische Ideen.
Rudolph: Für den Sozialismus?
Kunze: Ich weiß nicht, ob ich damals an Sozialismus gedacht habe. Aber die Beseitigung der sozialen Unterschiede, die für mich und für viele andere begonnen hatte, lief einher mit der Beseitigung des Furchtbaren, was in Deutschland oder durch Deutsche geschehen war, und mit sechzehn Jahren in die Partei einzutreten, die jetzt alles veränderte oder verändern würde, war nahezu selbstverständlich. In dieser Grundhaltung, die durch jahrelange Isolierung im Internat kaum Anfechtungen ausgesetzt war, machte ich mein Abitur und ging an die Universität.
Rudolph: Sie haben also als Schüler bereits über Ihren Zustand nachgedacht. Haben Sie da eigentlich schon geschrieben?
Kunze: Ich habe schon geschrieben. Ich hatte bereits mit zehn Jahren ein kleines Buch mit eigenen Versen verfaßt, die natürlich mit Gedichten nichts oder nur ganz wenig zu tun hatten. Bis kurz vor dem Abitur war ich mir jedoch nicht im klaren darüber, ob ich mich für die Literatur oder für die Malerei entscheiden sollte. Vor der Qual, in diese Wahl auch noch die Musik einbeziehen zu müssen, bewahrte mich mein zweiter Geigenlehrer. Abgesehen von seiner Methode, mit dem Geigenbogen in den Nacken zu schlagen, hatte er recht. Für mich ist zwar auch heute noch die Musik die Kunst der Künste, aber das will nichts über das Maß musikalischen Talents besagen, das mir in dieser unglücklichen Liebe zu Gebote steht. Ich habe also während der Oberschulzeit ebenso intensiv gemalt wie geschrieben. Mit der Zeit spürte ich aber, daß mir das Schreiben mehr Möglichkeiten bot, das, was mich beschäftigte, umzusetzen. Ich litt am Statischen in der Malerei, was ich natürlich erst retrospektiv durchschaue, aber ich habe damals schon ständig versucht, dieses Statische der Malerei zu überwinden, indem ich Abläufe, Handlungen zu malen versuchte – und sogar Metaphern. Meine Entscheidung für die Literatur war also eine bewußte Entscheidung, rein das Medium betreffend und frei von jeder politischen oder anderen außermedialen Überlegung. Und ich bereue diese Entscheidung nicht. Was ich bereue, ist, nicht eine ausgefallene Sprache studiert zu haben, sondern Journalistik, was unter den damaligen Umständen, von deren tatsächlichem Charakter ich zum Zeitpunkt meiner Entscheidung keinerlei Vorstellung hatte, das Sinnloseste war, was ich hatte tun können – wobei ich, das möchte ich betonen, sehr zurückhaltend bin in meiner Formulierung.
Rudolph: Wieso war das Studium der Journalistik das Sinnloseste, was Sie tun konnten?
Kunze: Weil unter den damals herrschenden Umständen die Journalistik von der Literatur, vom Schöpferischen, wegführte.
Rudolph: Sie hatten das Studium aber gewählt, weil Sie schreiben wollten, und während des Studiums werden Sie wohl auch geschrieben haben – wahrscheinlich Verse. Sie sagten, Sie hätten die literarische Ausdrucksform gewählt, um sich mit dem auseinandersetzen zu können, was Sie bewegte. Was hat Sie während Ihres Studiums bewegt?
Kunze: Der Wert des Studiums lag für mich nicht bei der Journalistik, sondern auf dem Gebiet der Ästhetik – ich habe unter anderem Literaturgeschichte, Musikgeschichte und Kunstgeschichte gehört und in diesen Fächern auch Examen gemacht. Während des Studiums und der darauf folgenden vierjährigen Assistentenzeit, in der ich einen Lehrauftrag hatte und Vorlesungen über literarische Genres hielt, die in der Publizistik von Bedeutung sind, also über das Feuilleton in all seinen Spielarten, über die Kurzgeschichte usw., in diesen fünfziger Jahren begann für mich die große politische Desillusionierung, das furchtbare Erkennen, hintergangen und betrogen worden zu sein, der Zusammenbruch des inneren Wertsystems, dem als Ergebnis einer jahrelangen politischen Treibjagd ein physischer Zusammenbruch folgte. Ich bin kurz vor der Promotion von der Universität abgegangen, das war 1959 – und habe als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau gearbeitet. Nicht, daß damit der Prozeß des Umdenkens für mich beendet gewesen wäre, im Gegenteil, er begann erst. Das Jahr 1959 war in meinem Leben die Stunde Null.
Rudolph: Was hat zu dieser Desillusionierung geführt? Wovon war es eine Desillusionierung?
Kunze: Wenn eine herrschende Ideologie auf dem Quadrat beruht, können Sie der Erfinder des Rades sein, Sie werden gerädert werden. Und ich war Zeuge, wie man ideologisch gerädert und Menschen zerbrochen hat, nur damit die Lehre vom Quadrat als Grundlage aller Fortbewegung unangetastet blieb.
Rudolph: Kann man Ihre Entwicklung mit wenigen Worten so charakterisieren: Das Erlebnis, als Arbeitersohn auf eine Oberschule zu kommen, führte zur Identifizierung mit dem Staat, der Ihnen das ermöglicht hat. Dann kam das Studium und damit der Überblick über größere Zusammenhänge. Daraus ergeben sich neue Erkenntnisse. Sie und die, die diese Erkenntnisse bestätigenden persönlichen bitteren Erfahrungen, bringen Enttäuschung und Desillusionierung, so daß Sie sich schließlich mit dem Staat, dem Sie die akademische Ausbildung verdanken, nicht mehr identifizieren können.
Kunze: Ja, und ich würde nicht einmal den Begriff Staat verwenden, sondern es waren Systemfragen, Methoden der Menschenbehandlung und die ideologische Indoktrination, die mich haben hellsichtiger werden lassen.
Rudolph: Haben Sie in der Zeit Ihrer politischen Desillusionierung Gedichte geschrieben?
Kunze: Ich habe immer geschrieben, und man könnte rückblickend vielleicht sagen: leider auch publiziert. Aber ich gehöre nicht zu denen, die Gewesenes nicht wahrhaben wollen. Auch wenn man heute nicht mehr dazu stehen kann, ist es etwas Gewachsenes, ein Stück Entwicklung. Ich habe 1955 den Band Die Zukunft sitzt am Tische herausgegeben (gemeinsam mit Egon Günther) und 1959 Vögel über dem Tau. Und ich möchte noch eine Publikation nennen, weil auch sie vorwiegend Texte aus den fünfziger Jahren enthält: Aber die Nachtigall jubelt 1962. Abgesehen von den wenigen Gedichten, die ich aus diesen früheren Publikationen in die 1973 erschienene Reclam-Auswahl Brief mit blauem Siegel aufgenommen habe, stehe ich nicht mehr hinter diesen Texten.
Rudolph: Was waren das für Texte?
Kunze: Es sind Produkte eines poetologisch, philosophisch und ideologisch Irregeführten. Womit ich den Anteil meines eigenen Versagens nicht verkleinern will. Ich war damals mehr als naiv, und in meinem Elternhaus hatten auch die Erfahrungen und Wissensvoraussetzungen dafür gefehlt, mir den Abwehrstoff Skepsis zu inokulieren. Für meinen Intellekt hatte es offenbar einer Krisis solchen Ausmaßes bedurft, um diesen Abwehrstoff zu produzieren. Ich hoffe, er reicht für das weitere Leben. – Was mich tröstet, ist, daß damals dennoch einige Gedichte entstanden sind, hinter denen ich heute, nach zwanzig Jahren, noch stehen kann, daß also das ideologische Eisen das poetische Denken nicht völlig hat erdrücken können, daß das poetisch strukturierte Unterbewußtsein in Ausnahmen doch stärker war als das objektiv poesiefeindlich programmierte Bewußtsein.
Rudolph: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie sich damals entschlossen, die wissenschaftliche Laufbahn aufzugeben und Schriftsteller zu werden. War das ein schmerzlicher Ablösungsprozeß, der da weg von der Universität führte, weg vom ,ordentlichen‘ Beruf, wie Ihre Eltern es nannten?
Kunze: Ich habe die Universität nicht von mir aus verlassen. Eine Reihe Umstände zwangen mich dazu.
Rudolph: Sind Sie von der Universität entfernt worden?
Kunze: Man hat versucht, mich zu entfernen, aber die Anschuldigungen, die zu einer Entfernung hätten führen können, erwiesen sich als nicht stichhaltig. Ich bin dann aber gegangen, weil ich in diesem Milieu, in dieser Atmosphäre nicht mehr leben wollte, nicht mehr denken konnte. Sie sprachen vom Aufgeben des ordentlichen Berufs. Darüber dürfte ich mir damals kaum Gedanken gemacht haben. Was mich sehr schmerzlich berührt hatte, war das Aufgeben der mit diesem Beruf verbundenen Lehrtätigkeit. Ich habe an die zehn Jahre gebraucht, um damit fertig zu werden. Deshalb waren die vielen Vorträge über Poesie, Kunstverständnis usw. und die Lesungen aus meinen eigenen Büchern, die ich in den letzten Jahren vor allem im Rahmen der evangelischen und katholischen Studentengemeinden gehalten habe, von so großer Bedeutung für mich. Es ist wichtig, mit Menschen zusammenzusein, die einen ständig zur Selbstüberprüfung zwingen, die noch das absolute Gehör für Ehrlichkeit besitzen.
Rudolph: Viele Ihrer Gedichte, die in den Jahren 1960/61 entstanden sind, verweisen auf die Tschechoslowakei. Wie sind Sie zu diesem Land, in dieses Land gekommen?
Kunze: Auf einer Postkarte, die an den Leipziger Rundfunk gerichtet war, bat eines Tages eine Dame aus Ustí nad Labem (Aussig an der Elbe) um ein Gedicht von einem gewissen Kunz, das sie in einer Sendung gehört hatte. Ich dachte, es sei eine ältere Deutsche, vielleicht eine Germanistin, denn die Karte war in tadellosem Deutsch geschrieben. Ich schickte das Gedicht und bekam einen Vierseitenbrief. Die Dame war so alt wie ich, Tschechin, Ärztin. Es entspann sich ein Briefwechsel, der die sagenhafte Zahl von 400 Briefen annehmen sollte, darunter Briefe bis zu 25 Seiten. Wir sandten einander auch eine Fotografie, und meine Briefpartnerin – typisch menschlich – schickte mir ein Foto, auf dem sie siebzehn war, und das Foto ist wohl das unvorteilhafteste Bild von ihr, das man sich vorstellen kann. Mir aber war es gleich, wie diese Frau aussah. Ohne sie je gesehen zu haben, denn damals war es nicht möglich, als Privatreisender über die Grenze zu fahren, rief ich sie eines Nachts an und fragte sie, ob sie meine Frau werden wolle. Und sie bejahte bedenkenlos. Als es mir dann gelungen war, mit einer Reisegruppe für drei Tage nach Prag zu fliegen, stand ich einer ausgesprochen schönen und charmanten Frau gegenüber, während sie mir später gestand, sie habe mich an dem altmodischen langen Mantel erkannt, den ich auf dem Foto getragen hatte. Ich habe also in die Tschechoslowakei eingeheiratet oder sie mir angeheiratet.
Da wir anfangs aber nicht heiraten konnten, weil damals ein tschechoslowakischer Staatsbürger einen Ausländer nur mit persönlicher Genehmigung des Innenministers ehelichen durfte, die wir trotz aller Anstrengungen nicht erhielten – wir hatten alle möglichen Stellen eingeschaltet bis zu Otto Grotewohl persönlich –, lebte ich dann einige Zeit in der Tschechoslowakei, wozu es ausgefallener Tricks bedurfte (man mußte ja das Visum immer wieder verlängert bekommen). In dieser Zeit begann ich, tschechische Poesie nachzudichten. Die erste Sammlung, die unter dem Titel Der Wind mit Namen Jaromír 1961 im Verlag Volk und Welt, Berlin, erschien, sandte ich an den Tschechoslowakischen Schriftstellerverband mit einem Brief, in dem ich darlegte, was wir alles vergebens unternommen hatten, um heiraten zu können, heiraten zu dürfen.
Der Schriftstellerverband witterte für die Zukunft einen Nachdichter tschechischer Poesie, mobilisierte alle nationalen Argumente und verschaffte uns die Heiratserlaubnis. Meine Frau war also mein erster und zugleich kostbarster Literaturpreis.
Rudolph: Die Verbindung mit der Tschechoslowakei hatte also für Sie eine tiefe persönliche Bedeutung – und das wirkte sich auch auf Ihre weitere Entwicklung aus. Dabei spielte aber nicht nur die Tatsache, daß Sie nun Ehemann geworden waren, eine Rolle.
Kunze: Was ich der Tschechoslowakei alles verdanke, kann ich vielleicht gar nicht ermessen. Sie bedeutete damals für mich eine Art menschlicher Auferstehung. Milan Kunden schrieb 1964 in den Literární noviny, ich sei der slawischste Deutsche, den er kenne. Was immer er damit gemeint haben mag, ich bin es in der Tschechoslowakei erst geworden. Sie bedeutete für mich Heilung. Wie ich schon sagte, hatten die Erlebnisse an der Universität auch einen physischen Zusammenbruch zur Folge gehabt. Die Tschechoslowakei war für mich für fast ein Jahrzehnt geistiges Asyl und literarische Heimat. Die meisten Gedichte, die 1969 in meinem Rowohlt-Band Sensible Wege erschienen sind, waren vorher in tschechischer Übertragung publiziert worden. Ich war ständiger Mitarbeiter literarischer Zeitschriften in der Tschechoslowakei.
Rudolph: Sie sprechen inzwischen Tschechisch?
Kunze: Ich will nicht übertreiben. Ich spreche so, daß ich ein tschechisches Gedicht, das ich übertrage, in Tschechisch im Kopf habe und auch vom Klang her ganz genau nachvollziehen kann. Ich weiß es im Original auswendig. – Wenn ich also von meiner wunderbaren Frau absehe – das ist etwas nicht zu Vergleichendes –, ist das Bedeutendste, was ich der Tschechoslowakei verdanke, der Einfluß ihrer Dichtung. In der Tschechoslowakei habe ich zum erstenmal begriffen, was das ist, Poesie. Mein Opus I entstand. Was vor dem liegt, hat gewissermaßen keine Opuszahlen. Es entstanden die Gedichte, die 1963 in dem Band Widmungen im Hohwacht-Verlag, Bad Godesberg, erschienen sind.
Rudolph: Wir sollten vielleicht noch nachtragen: Nachdem Sie Ihre tschechische Frau geheiratet hatten, sind Sie im Jahre 1962 in die DDR zurückgekehrt, nach Greiz, aber die innere Verbindung zur Tschechoslowakei blieb natürlich bestehen. Dann kam im Jahre 1968 der sogenannte Prager Frühling, der am 21. August sein Ende fand. Wie haben Sie darauf reagiert?
Kunze: Ich habe innerlich so darauf reagiert, daß ich dafür hier im Augenblick keine Worte finden kann. Ich habe darüber manches geschrieben.
Rudolph: Sie haben eine ganze Reihe Gedichte darüber geschrieben…
Kunze: … in denen ich mich artikuliert habe. Aber ich habe auch so darauf reagiert, daß ich 1968 im August den Austritt aus der Partei formell vollzogen habe, und unter den gegebenen Umständen war dieser Vollzug alles andere als etwas Formelles.
Rudolph: Daraufhin und natürlich auch aufgrund Ihrer Gedichte wurden Sie dann für Jahre in der DDR zur persona non grata erklärt.
Kunze: Ich war auch vordem nicht gerade persona grata gewesen. Aber es hatte einige literarische Bereiche gegeben, zum Beispiel das Gebiet der Übersetzungen, die mir noch nicht verschlossen gewesen waren. Auch hatten Freunde mit Zivilcourage dieses oder jenes für mich durchsetzen können. Nun aber wurde der Boykott total.
Rudolph: Dennoch erschienen Bücher von Ihnen, allerdings nicht in der DDR, sondern in der Bundesrepublik: Lyrik, Übersetzungen und Kinderprosa. Ihre Bücher wurden in mehr als zehn Sprachen übersetzt. In der Tschechoslowakei, in England und in Schweden kamen sie heraus. Die Kinderprosa erschien sogar in Japan. Und Sie haben in der Tschechoslowakei, in der Bundesrepublik und in Schweden auch Literaturpreise bekommen. Diese Tatsachen werden – so denke ich mir das jedenfalls – sicher mit dazu beigetragen haben, daß nun auch in der DDR der Boykott gegen Sie aufgehoben wurde. 1973 erschien erstmals seit Jahren wieder eine Lyrikauswahl von Ihnen: Brief mit blauem Siegel in Reclams Universalbibliothek in Leipzig. Doch lassen Sie uns nun einmal auf das geistige Profil des Menschen Reiner Kunze zu sprechen kommen. Die Frage danach ergibt sich für mich aus Ihrer Entwicklung, aus Ihrem Lebensweg, den wir bisher nachgezeichnet haben. Wie sehen, verstehen und interpretieren Sie die Welt heute? Um mich genauer auszudrücken: Sind Sie Marxist?
Kunze: Wenn man allein die Bedeutungen in Betracht zieht, in denen zum Beispiel Kolakowski diesen Begriff verwendet sieht, würde es einer sehr ins Detail gehenden definitorischen Vorarbeit bedürfen, um sagen zu können, inwiefern sich einer als Marxist begreift. Es müßte dann dargestellt werden, was an Marxschen Erkenntnissen, an Marxscher Betrachtungsweise in bezug auf die Analyse der Gesellschaft und an ethischen Postulaten von Marx in die Position jenes Menschen eingegangen ist. Direkt und indirekt, denn auch nach Marx lebten und leben Philosophen, die ihn nicht nur gelesen haben. Vielleicht läßt sich die eigene Position eher abstecken, auch hinsichtlich des Marxschen Anteils, wenn man sich auf einen dieser jüngeren Philosophen beruft.
Rudolph: Auf wen berufen Sie sich?
Kunze: Auf Albert Camus. Auge in Auge mit dem Nichts zu leben und im Bewußtsein der Absurdität dieses Daseins Mensch sein zu wollen, sich als Mensch zu erweisen – das ist es, weshalb ich mich auf Camus berufe. In der Pest sagt der Arzt Bernard Rieux: „Was mich interessiert, ist, ein Mensch zu sein.“ Und er versteht darunter erstens, zu wissen, ob zwei und zwei vier ist, und nicht, welche Belohnung oder Bestrafung auf dieses Wissen steht, und zweitens, solidarisch zu handeln. Während Sartre das politische Engagement betont, ,Geschichte machen‘ will, bescheidet sich Camus damit, im einzelnen zu helfen, im Kleinen wie im Großen kein Unrecht unwidersprochen hinzunehmen, auch nicht, wenn seine Aufdeckung das heroischere ,Geschichte machen‘ kompliziert. (Und es hat sich ja erwiesen, was für eine unsichere Geschichte es ist, Geschichte zu machen, ohne die Geschichte bewältigt zu haben.) „Der absurde Mensch sagt ja und hört nicht auf, sich anzustrengen.“
Rudolph: Dieser Satz trifft auf Sie zu. In dem Existentialismus Camus’ steckt etwas, was auch für Sie charakteristisch ist: dieses Trotzdem.
Kunze: Camus leitet drei Schlußfolgerungen vom Absurden ab: die Auflehnung des Individuums gegen das Absurde, seine Freiheit und seine Leidenschaft. Damit kann ich mich absolut identifizieren.
Rudolph: Das läßt sich deutlich aus Ihren Gedichten herauslesen. Vielleicht könnten Sie Ihre schriftstellerische Position, Ihr Programm, wenn Sie so wollen, einmal zu definieren versuchen.
Kunze: Ich würde es vorziehen, von einer Position zu sprechen, nicht von einem Programm. Das Eindringen in die dichterische und philosophische Welt, für die mir die tschechische Poesie das Tor war, bewirkte erst einmal, daß ich mit der Zeit wieder zu mir selbst fand, bewirkte das Einswerden als Schreibender und Seiender. Um das genau erklären und damit zu einer Positionsbestimmung kommen zu können, müßte ich ein Wort dazu sagen, was das typisch Tschechische ist an der tschechischen Poesie des 20. Jahrhunderts, die mich so beeindruckt hatte und beeindruckt. Es ist meines Erachtens die moderne Metapher, in der ein Kinderherz schlägt – um es metaphorisch zu sagen. Es ist die Metapher der westeuropäischen Moderne, die Metapher, wie sie u.a. von Lorca und Apollinaire für unser Jahrhundert zugeritten wurde. „Eiffelturm Hirt der Brücken hör wie sie blökt heute früh deine Herde“ – Apollinaire. Es ist zugleich die Metapher der barocken tschechischen Volkspoesie, und zwar u.a. insofern, als durch die Verknüpfung der entgegengesetzten Welten viel menschliche Wärme freigesetzt wird. Um die Positionsbestimmung abzurunden: Apollinaire sagt:
Die Dichter sind nicht nur die Männer des Schönen. Sie sind auch und vor allem die Männer des Wahren, soweit es das Eindringen ins Unbekannte erlaubt.
Und Lorca spricht von „Dichtung, um sich für die anderen die Adern zu öffnen“. Beides könnte von Camus sein.
Rudolph: Aus dem, was Sie eben gesagt haben, ergibt sich eine weitere Frage, eine Frage, zu der mich auch etwas veranlaßt, was Sie zu Anfang dieses Gesprächs gesagt haben, als Sie erwähnten, daß es Ihnen schwergefallen sei, den Lehrerberuf an der Universität aufzugeben. Wer schreibt, will sich anderen mitteilen. Nicht, daß er sie belehren will, aber er will ihnen etwas sagen. Was wollen Sie Ihren Lesern sagen? Warum schreiben Sie?
Kunze: Auf die Frage, warum ich schreibe, kann ich eher antworten. Weil ich keine Wahl habe. Was immer ich beruflich gearbeitet habe, alles, was mich betroffen machte – ein Hauch oder eine existentielle Erschütterung –, jede innere Spannung konnte sich plötzlich als Bild im Bewußtsein entladen, und manches Bild läßt einen dann nicht los. Ich schreibe, um innere Situationen zu bewältigen, die ich anders nicht bewältigen kann, um Haltungen zu gewinnen, um Flüchtigem ein wenig Dauer zu verleihen. Ich schreibe, um mein Leben zu intensivieren und – und damit komme ich auf anderem Wege zu Ihrer Mitfrage – um innere Entfernungen zu Menschen zu verringern, die ich nicht kenne (indem ich versuche, so ehrlich wie möglich zu sein). Ich schreibe also in bezug auf andere Menschen, aber nicht, weil ich anderen Menschen etwas sagen will.
3.5.1974 aus: Ekkehart Rudolph: Aussage zur Person. Zwölf Schriftsteller im Gespräch, Horst Erdmann Verlag, 1977
Antworten auf Fragen des deutschen Seminars
der Universität Basel
StudentInnen: Sie schreiben heute: Bedingt das für Sie bestimmte Forderungen und/oder Einschränkungen in bezug auf Stoff, Form, Sprache eines Textes?
Reiner Kunze: Ich wähle meine Stoffe nicht, die Stoffe wählen mich (eine Frage des Ergriffenseins, das als poetisches Bild oder als poetisch strukturierte Gedanken ins Bewußtsein tritt.) Die Intensität des Ergriffenseins durch die Wirklichkeit und die Intensität des Ergriffenseins durch das poetische Bild, also durch die eigene Inspiration, sind ausschlaggebend dafür, inwieweit ich die ,Wahl‘ als zwingend empfinde und die entdeckerischen Dimensionen des Bildes oder der poetischen Gedanken auszuleuchten beginne (was den Beginn der Arbeit an einem Text bedeuten kann).
Ich bemühe mich, das, was ich zu sagen habe, so genau wie möglich zu sagen. Unter ,so genau wie möglich‘ verstehe ich, nicht einfacher, als es mir die Kenntnis der Kompliziertheit meines Gegenstands, meine Bild-Denkstruktur und mein sprachliches Ausdrucksvermögen zu sagen erlauben. Dabei wird es jeweils vom Umfang meines Wissens, vom Grad an Präzision, mit dem ich denke und fühle, und von der Intensität meines Bemühens um Aufrichtigkeit abhängen, inwieweit ich so genau sein werde wie in meiner Zeit möglich.
StudentInnen: Woher beziehen Sie Ihre Stoffe? In welchem Ausmaß verwenden Sie eigene Erfahrungen als Grundlage Ihres Schaffens? Wie sehen Sie das Verhältnis von Fiktion und Realität?
Kunze: Meine Stoffe ergeben sich aus dem unmittelbaren oder mittelbaren Erleben, und insofern liegen meiner Arbeit oft eigene Erfahrungen zugrunde. Das schließt das Erschaffen von fiktiven Welten (im Sinne von künstlerischen, in der Realität möglichen und auch nicht möglichen Wirklichkeiten) nicht nur nicht aus, sondern ein.
StudentInnen: Wie sehen Sie das Verhältnis von Form und Inhalt? Behindert (oder fördert) Sie die bewußte Beschäftigung mit solchen theoretischen Fragen bei Ihrer Arbeit?
Kunze: Der erste Teil der Frage ist so global, daß die Antwort m. E. eine definitorische Vorarbeit voraussetzt, die möglicherweise nicht einmal in einer Vorlesungsreihe zu bewältigen ist, geschweige im Rahmen dieser Umfrage. (Was ist Inhalt? Was ist Form? Ist beispielsweise die Fabel ein Element des Inhalts oder – und – der Form? Was verstehe ich unter Fabel? Wirkt sie strukturbestimmend ? Was ist Struktur? Welche Stoffelemente gehen in den Inhalt ein? Was verstehe ich unter Stoff? Usw. usf.)
Zum zweiten Teil der Frage: Die bewußte Beschäftigung mit solcher theoretischer Problematik fördert in jedem Fall mein kritisches Denken und dient der gedanklichen Durchdringung des Handwerks, die Fehlinvestitionen an Kraft und Zeit zu vermeiden und – zumindest im nachhinein – eine gewisse Distanz zu gewinnen hilft.
StudentInnen: Sehen Sie sich in einer bestimmten Tradition? Haben Sie bestimmte Vorbilder? Wenn ja, empfinden Sie diese als befruchtend oder als belastend?
Kunze: Ich sehe mich in der Tradition des poetischen Bildes, wie es von Lorca definiert wurde. Die nachhaltigsten literarischen Impulse verdanke ich der modernen tschechischen Poesie, vor allem den Gedichten von Jan Skácel. Aber auch die ironische Metaphorik Heines und die poetische Analyse Brechts (sein Denken in paradoxen gedanklichen Verknüpfungen) haben meine Denkweise beeinflußt. Ich empfinde diese Einflüsse als befruchtend.
StudentInnen: Welche Vorstellungen haben Sie von der Leserschaft? Schreiben Sie gezielt für ein bestimmtes Publikum?
Kunze: Ich schreibe, um mein Leben zu intensivieren, um Situationen zu bewältigen, die ich anders nicht bewältigen kann, um Haltungen zu gewinnen und um innere Entfernungen zu Menschen, die ich nicht kenne, zu verringern. Die Texte suchen sich ihre Leser oder werden von ihnen gesucht (ohne daß die Suchenden von der Existenz der Texte wissen). Diese Menschen bilden meine potentielle Leserschaft, während ich zu meiner tatsächlichen Leserschaft jeden zähle, der etwas liest, was ich geschrieben habe (wie auch ich ständig zur potentiellen Leserschaft von Texten und Autoren gehöre, von deren Existenz ich noch nichts weiß, und zur tatsächlichen Leserschaft eines jeden, dessen Arbeiten ich lese). Diejenigen Leser schließlich, die, eben weil sie zu meiner tatsächlichen Leserschaft gehören, die potentiellen Leser meiner Texte bleiben oder werden, würde ich als meine eigentliche Leserschaft bezeichnen (wie auch ich mich wiederum zur eigentlichen Leserschaft bestimmter Autoren zählen würde).
StudentInnen: Wie weit geht Ihre Unabhängigheit?
Kunze: Da wir, meine Frau und ich, über genügend Lebenswerte verfügen, die, wenn der Lebensunterhalt gesichert ist, nicht oder nur in bescheidenem Maße von finanziellen Voraussetzungen tangiert werden, bin ich zur Zeit ökonomisch weitgehend unabhängig: Das Gehalt meiner Frau als Ärztin (1200 Mark netto) sichert unseren Lebensunterhalt, und es spielt für uns keine Rolle, durch wessen Arbeit er gesichert wird, weil wir uns unser Leben ohne die Arbeit des anderen, ohne die durch sie gegebenen Ein- und Ausblicke in bezug auf das menschliche Leben und ohne die Glücksmomente, die sie ermöglicht, nicht vorstellen könnten. Obwohl ich beispielsweise 1972 nach eigener, steueramtlich noch nicht bestätigter Berechnung in der DDR nur ein monatliches Arbeitseinkommen von 170 Mark erreichte, ist unter den augenblicklichen Umständen meine Unabhängigkeit als Schriftsteller materiell abgesichert.
StudentInnen: Üben Sie neben dem Schreiben noch eine andere Tätigkeit aus?
Kunze: Zur Zeit übe ich keine andere (berufliche) Tätigkeit aus. In der Vergangenheit habe ich jedoch viele Jahre eine andere Tätigkeit ausgeübt (Lehrtätigkeit an der Universität, Arbeit als Hilfsschlosser im Schwermaschinenbau., freie Mitarbeit an der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin usw.), und ich würde sofort wieder eine (auch manuelle Tätigkeit aufnehmen, wenn unser Lebensunterhalt und damit meine ökonomisch-politische Unabhängigkeit als Schriftsteller gefährdet wären.
StudentInnen: Arbeiten Sie als Schriftsteller auch für die Massenmedien? Inwiefern wird dadurch Ihre Arbeitsweise beeinflußt?
Kunze: Meine Arbeit für die Massenmedien ist seit Jahren gezwungenermaßen so minimal, daß durch sie meine Arbeitsweise nicht beeinflußt werden kann (für eine Wochenzeitung unter Pseudonymen 22-Zeilen-Rezensionen über Lyrik- und Prosaveröffentlichungen aus der klassischen Weltliteratur, Musikerbiografien, Bildbände usw.).
StudentInnen: Wie sind Sie zu Ihrem ersten Verleger gekommen?
Kunze: Bei einer öffentlichen Veranstaltung, auf der ich einige Gedichte vorlas, war ein Verlagslektor anwesend, der mich seinem Verleger vorstellte.
StudentInnen: Sehen Sie Ihre Produktion dem Nachfrage/Angebot-Gesetz unterworfen?
Kunze: Nein.
StudentInnen: Haben die Erwartungen oder Forderungen des Verlags und des Büchermarkts auf Sie einen Einfluß?
Kunze: Die Erwartungen oder ein Auftrag des Verlags können stimulierenden Einfluß haben. (Ohne die Einladung des S. Fischer Verlags, mich an der Anthologie Leporello fällt aus der Rolle zu beteiligen, wäre der Text „Was ist aus Schneewittchens Stiefmutter geworden“ wahrscheinlich nicht entstanden. Er wäre aber auch trotz des ,äußeren Auftrags‘ nicht entstanden, wenn dieser nicht mit einem ,inneren Auftrag‘ korrespondiert hätte.)
StudentInnen: Hatten Sie schon Auseinandersetzungen mit Verlagen und deren Lektoren; wenn ja, welcher Art?
Kunze: Entweder besteht zwischen dem Verlag und mir soviel Übereinstimmung, daß eine schöpferische Zusammenarbeit möglich ist und es für Auseinandersetzungen, die diese Zusammenarbeit belasten könnten, kaum Grund gibt, oder das notwendige Maß an Übereinstimmung fehlt oder geht verloren (beispielsweise durch das Ausscheiden des Cheflektors oder zuständigen Lektors), und es wird nicht oder nicht mehr zu einer Zusammenarbeit mit dem betreffenden Verlag kommen können. Deshalb mußte ich in der Bundesrepublik den Verlag wechseln, und deshalb war es mir jahrelang nicht möglich, in einem Verlag der DDR zu publizieren (hier ist, was das Maß an Übereinstimmung betrifft, nicht der einzelne Verlag ausschlaggebend, sondern die für die Erteilung der Druckgenehmigung zuständige zentrale staatliche Institution). Aber ich hatte bisher kaum ,Auseinandersetzungen‘.
StudentInnen: Birgt die Vormachtstellung einiger Verlage nicht auch die Gefahr der Beherrschung/Steuerung der geistigen Produktionsmittel in sich?
Kunze: Eine Frage, die ich nicht aus eigener Erfahrung beantworten kann, die sicherlich aber bejaht werden muß, und die für einen Autor, der in einem gesellschaftlichen System lebt, in dem alle Publikationsmittel vom Staat beherrscht und gesteuert werden, insofern von unmittelbarem Interesse ist, als seine Existenz als Schriftsteller auch durch jede potentielle Beschränkung seiner Publikationsmöglichkeiten außerhalb dieses Staates gefährdet wird.
Aus: Auskunft München, 1974
Clemens Podewils Ansprache an Reiner Kunze
– In der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ostberlin wurde dem DDR-Lyriker Reiner Kunze im November 1974 die Mitglieds-Urkunde der Bayerischen Akademie der Schönen Künste überreicht. Der Generalsekretär der Akademie hielt dabei folgende Ansprache. –
1973, im Juli, wurde Ihnen in München der Literaturpreis der Akademie verliehen. Sie haben geantwortet:
Hier nimmt nicht ein Oppositioneller den Preis für Opposition entgegen, sondern ich habe die große Freude, als Schriftsteller den Preis, so wie er gemeint ist, entgegenzunehmen, und ich danke mit der Bewegtheit des Herzens.
Bewegtheit des Herzens: Das war nicht eine Floskel der Höflichkeit, war auch nicht in vorübergehender Aufwallung des Gefühls gesagt, sondern Sie nannten die Kraft beim Namen, der Ihre Gedichte entspringen, und zugleich den Grund, warum sie den Leser ergreifen. Ohne Überschwang der Worte kommen sie zu ihm, in den allerknappsten Fügungen einer an sich haltenden Sprache und mit der Genauigkeit von Bildern, deren symbolischer Sinn vor dem düsteren Hintergrund der Zeitumstände abzulesen ist. Das ist die Weise, in der Ihre Verbundenheit mit aller Kreatur und die Hinneigung zu den Menschen sich ausspricht, spontan, unmittelbar und nicht auf ideologische Rechtfertigung angewiesen.
Eines solchen Offenseins bedarf es, aber auch der Meisterschaft des Sagens, um die in der Winterstarre heutiger Literatur eingefrorene Kraft der Empfindung wieder zum Wort zu erwecken. Starre – Vereinsamung – Entfremdung. Fremde: Ferne, die bis in die Worte dringt und sie voneinander trennt. Davon spricht eines Ihrer letzten Gedichte, das mit der nüchternen Überschrift beginnt:
Gründe, das Auto zu pflegen
aaaaaSchon wieder in der Garage!
aaaaa(die tochter beim anblick des
aaaaaverlassenen schreibtischs)
Wegen
der großen entfernungen, tochter
Wegen der entfernungen
von einem wort zum andern
Und so soll, wie Sie im Gespräch geäußert haben, das ungesprochene Reimwort „wandern“ wie ein geheimer Widerhall nachschwingen. Das andere, zu erwandernde. Die Fremde, zurückgebracht in die Nähe des Eigenen. Die Schleier der Trennung, die sich auflösen im Licht der Anwesenheit. Wie eh und je ist es dem mühevoll-mühelosen Wort des Gedichts vorbehalten, solches zu bewirken. „… und die Liebsten nahe sind, ermattend auf getrenntesten Gipfeln.“ Diesem Weither – Zusammenholen der Dinge und der Worte, der Dinge in den Worten, als dem „innigen“, dem – im Sinne Hölderlins – einenden Tun der Dichter stehen keine Grenzen im Weg, schon gar nicht die vom Starrsinn der Menschen errichteten. Denn es vollzieht sich nicht im Raum, sondern in der Bewegung rhythmischer Sprache.
Als Übersetzer hat Günter Eich das Hin und Zurück zwischen den Erscheinungen der Welt und dem Dichter zu verstehen versucht. Der Elsternflug, das Wippen der Bachstelze, bald befragt es den Dichter, bald fliegt es als Antwort auf, und die Frage rührt sich im Ohr. Immer ist es das lautende Wort, das wir, auch lesend und schreibend, nicht umhin können zu vernehmen. In einer späten Aufzeichnung empfindet Ludwig Wittgenstein das Staunen: „Ein Wort in dieser Bedeutung hören, wie seltsam, daß es so etwas gibt.“
Wenn der Dichtende antwortet, so doch nie mit abschließender Feststellung, sondern im Ton der Frage, die er, jedoch heller umrissen, als Sprachgestalt zurückgibt an die Dinge. Einmal aber in Zuflucht noch hinter der Zuflucht haben Sie es gewagt, den in Wahrheit Antwortenden zu nennen, in den letzten Zeilen des Gedichts, welches lautet:
Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor
Hier
ruft nur gott an
Unzählige leitungen läßt er legen
vom himmel zur erde
Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl
Was machst du fragt gott
Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun
Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster
Clemens Podewils, Süddeutsche Zeitung, 14./15.12.1974
Preisverleihung
Erstmals ist einem in der DDR lebenden Künstler in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ost-Berlin eine von einer westdeutschen Institution verliehene Auszeichnung überreicht worden. In Anwesenheit von Staatssekretär Günter Gaus übergab Clemens Graf Podewils, Generalsekretär der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, dem in Greiz (Thüringen) lebenden Lyriker Reiner Kunze die Urkunde über Kunzes Aufnahme als ordentliches Mitglied in die Akademie.
Kunze war bereits im Juni in die Akademie gewählt worden und hatte die Wahl auch angenommen. Jedoch hatten es ihm die DDR-Behörden nicht gestattet, zur offiziellen Verleihung der Mitgliedschaft im Juli nach München zu reisen. Daß der formelle Akt der Aufnahme auch offiziell vollzogen wurde, war für Kunze insofern wichtig, als sich verschiedene DDR-Institutionen auf den Standpunkt stellten, solange die Urkunde nicht überreicht sei, könne sich Kunze nicht als Akademie-Mitglied betrachten.
Bei der kleinen, nichtöffentlichen Feier in der Ost-Berliner Vertretung der Bundesrepublik erklärte Staatssekretär Gaus, dies sei kein Staatsakt, sondern eher ein „Familienfest“. Ohne auf die Tatsache einzugehen, daß mit diesem Akt immerhin ein Präzedenzfall geschaffen wurde, meinte Gaus, eine solche Veranstaltung sei als etwas Normales, nicht als Sensation oder Provokation anzusehen. Auch deswegen werde diese Feier in der nüchternen Atmosphäre seines Arbeitszimmers begangen und nicht in einem Festsaal. Gaus, der – so wurde in den anschließenden Gesprächen deutlich – durchaus mehr als nur eine oberflächliche Kenntnis vom Werk Reiner Kunzes hat, gab seiner Freude darüber Ausdruck, in seinem Hause die Möglichkeit zur Ehrung dieses Dichters bieten zu können.
Nachdem Graf Podewils in kurzen Worten die Lyrik des neuen Akademie-Mitglieds gewürdigt hatte, erklärte Reiner Kunze wörtlich:
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, ich danke Ihnen, daß Sie mir die Urkunde über die Wahl zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste bis Preußen entgegengebracht haben, und ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, daß ich das Dokument in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Berlin entgegennehmen darf. Ich freue mich. Bitte, haben Sie Verständnis, wenn ich es beim Ausdruck dieser Freude belasse. Ich möchte sie möglichst untrübbar mit an den Schreibtisch nehmen. Freude, wissen wir, beflügelt.
Anzumerken bleibt noch, daß diese Ehrung des in der DDR noch immer beargwöhnten Schriftstellers wenn nicht mit Zustimmung, so doch mit Duldung der Ost-Berliner Behörden erfolgte. Daß es der von der DDR so nachdrücklich geforderten Normalität der Beziehungen mehr entsprochen hätte, wenn man Kunze die besuchsweise Ausreise nach München gestattet hätte, steht auf einem anderen Blatt. Immerhin könnte es ein Anzeichen für eine Klimaverbesserung sein, daß Kunze seine Akademie-Mitgliedschaft wenigstens in der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik entgegennehmen durfte – in jenem Neubau in der Hannoverschen Straße, von dem aus man direkt in die Wohnung des mit Kunze befreundeten Liederdichters Wolf Biermann sehen kann. In einem Reiner Kunze gewidmeten Lied hatte Biermann kürzlich seine eigene und Kunzes schwierige Lage kommentiert: „Ach, du, ach das ist dumm – wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um“.
Jürgen P. Wallmann, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.11.1974
Kunze in England
Erstmals ist dem heute 41 Jahre alten Schriftsteller Reiner Kunze, der in Greiz in der DDR lebt, von den Behörden seines Landes eine Reise ins westliche Ausland genehmigt worden (lediglich München und Bonn hatte er 1973 besuchen dürfen). Kunze, der seit seinem Protest gegen den Einmarsch in die ČSSR vom 21. August 1968 jahrelang Publikationsverbot hatte und sich auch heute noch mancherlei Repressalien ausgesetzt sieht, hielt sich vom 18. April bis zum 6. Mai in England auf.
Reiner Kunze; dessen künstlerische und politisch-moralische Kompromißlosigkeit auch im Ausland nicht unbekannt geblieben ist, hatte nach Überwindung verschiedenster Hindernisse als Privatmann nach England reisen können, also ohne Auftrag oder Unterstützung staatlicher Stellen. Eingeladen hatte ihn die German Society der Universität von Cambridge. Während seines Englandaufenthaltes las Kunze in verschiedenen Veranstaltungen u.a. in den Universitäten von Cambridge, London und Sussex und diskutierte mit Studenten und Dozenten, denen der Lyriker bereits durch seinen 1973 in London erschienenen zweisprachigen Gedichtband With The Volume Turned Down (Zimmerlautstärke) bekannt war. Außerdem nahm Kunze am internationalen Cambridge Poetry Festival teil.
Sowohl beim Poetry Festival, wo Michael Hamburger und Ewald Osers die Übersetzungen der Gedichte Kunzes lasen, als auch bei den Lesungen in Universitäten und in einem literarischen Klub in London-Hampstead wurden Kunzes Gedichte mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Der Erfolg der stets überfüllten Veranstaltungen wurde von den englischen Gastgebern als außergewöhnlich bezeichnet. Der Korrespondent der Stuttgarter Zeitung berichtete am 12. Mai 1975, die „täuschend einfachen“ Gedichte Kunzes seien von den englischen Zuhörern in ihrer Doppelbödigkeit erkannt worden, und man habe Kunze verstanden als einen Dichter, der wie Wolf Biermann und Peter Huchel darauf bestehe, „sich auf alles einen eigenen Vers zu machen“. Daß es sogar in der DDR möglich sei, danach zu leben und auf die Dauer aktiv zu überleben, habe von den dreien bisher nur Reiner Kunze fertiggebracht „und gerade auch durch seine triumphale Lesereise durch England bewiesen“.
Während seines Englandaufenthaltes machte Kunze u.a. auch Fernsehaufnahmen im Studio der Universität von Norwich und gab Interviews über seinen Standort als Dichter. Zum Abschluß seiner Reise, deren Genehmigung durch die Ostberliner Behörden von Kennern der kulturpolitischen Szene in der DDR als ein Sieg der Vernunft gewertet wird, las Kunze Gedichte für die in England bekannte Institution Dial a poem (Wähle ein Gedicht). Dieser Lyrik-Telefonservice sendete vom 6. Mai an eine Woche lang eine Dreiminutenlesung von Gedichten Reiner Kunzes, dazu die englische Übersetzung.
Während Reiner Kunze im Ausland inzwischen als einer der wichtigsten Repräsentanten der DDR-Literatur gilt – weitere Bücher mit Übersetzungen seiner Gedichte werden demnächst in Griechenland und Frankreich erscheinen –, hat man sich in der DDR noch immer nicht entschließen können, Kunzes Bedeutung anzuerkennen. So war er beispielsweise nicht zu der großen Dichterlesung Mitte April in der Berliner Kongreßhalle eingeladen, die der Schriftstellerverband der DDR aus Anlaß des 30. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus veranstaltet hatte. Und sein Lyrikband Brief mit blauem Siegel, der 1973 im Leipziger Reclam Verlag erschienen war, ist nie in einer größeren Zeitung oder Zeitschrift der DDR rezensiert worden (was ja wohl nahegelegen hätte bei einem Lyrikband, dessen insgesamt dreißigtausend Exemplare der ersten und zweiten Auflage in kürzester Zeit vergriffen waren).
Mehr Aufmerksamkeit dagegen schenkte man Reiner Kunze in anderen sozialistischen Ländern, so in Rumänien. Nachdem dort im vergangenen Jahr die deutschsprachige Zeitschrift Neue Literatur eine ausführliche und zustimmende Rezension zu Brief mit blauem Siegel veröffentlicht hatte, brachte die ebenfalls deutschsprachige Karpatenrundschau am 28. Februar 1975 einen Artikel von Bernd Kolf, der unter dem Titel Erinnerung an Greiz über einen Besuch bei Reiner Kunze berichtet. In jenem Beitrag ist auch, jedenfalls in Andeutungen, von einigen der Schwierigkeiten die Rede, mit denen Kunze in der DDR zu kämpfen hat. Der Verfasser zieht nach dem Besuch bei Reiner Kunze das Resümee:
Alles, was in seinen Gedichten steht, denke ich, ist wahr: die große, echte Freundlichkeit und menschliche Anteilnahme, die Ehrlichkeit, die Trauer, daß „Gedichte mißbrauchbar sind. Wie die Macht.“
Reiner Kunze, der augenblicklich an einem Prosabuch arbeitet – erste Auszüge erschienen 1974 in der Anthologie Ensemble 5 im Münchner Verlag Langen-Müller –, hat in den letzten Monaten nur wenig veröffentlicht. In der DDR erschien Anfang 1975 in kleinster Auflage ein bibliophiler Druck mit Gedichten, die der in Moritzburg bei Dresden lebende Hans G. Annies in Holz geschnitten hat; die wenigen Exemplare dieser Edition wurden über die Dresdner Ladengalerie Kunst und Zeit vertrieben. Im Westen wurde soeben ein Beitrag Kunzes in der im Verlag S. Fischer (Frankfurt a.M.) erschienenen Schrift Thomas Mann – Wirkung und Gegenwart veröffentlicht, in der namhafte Schriftsteller aus West und Ost aus Anlaß des hundertsten Geburtstages von Thomas Mann am 6. Juni 1975 auf die Frage antworten, was ihnen Thomas Mann heute bedeute. Kunze, der, wie bekannt, der Tschechoslowakei besonders eng verbunden ist, weist in seinem Beitrag auf Manns 1937 geschriebenen Nachruf auf Thomas Masaryk hin, und er zitiert ein Wort des tschechischen Staatsgründers, der in einem Gespräch mit Karel Čapek geäußert hatte: „Die Wahrheit, die redliche Wahrheit, die wirkliche Erkenntnis kann niemals Schaden stiften.“
Peter Wallmann, Deutschland Archiv, 6/1975
Kunzes Gedichte in Griechenland
Unter dem Titel San ta pragmata apo pilo (Wie die Dinge aus Ton) ist soeben in Griechenland ein zweisprachiger Auswahlband mit Gedichten des in der DDR lebenden Reiner Kunze erschienen. Der im Verlag Egnatia (Thessaloniki) vorliegende Band, den Hannelore Ochs zusammengestellt und übertragen hat, ist mit 160 Seiten ungewöhnlich umfangreich. Er enthält ausser Gedichten aus den Jahren zwischen 1956 und 1974 einen Einführungsessay, bio-bibliographische Angaben, Zitate aus Kritiken sowie im Anhang eine Reihe unveröffentlichter Photos; eins von Ihnen zeigt Kunze, der 1959 nach schweren politischen Angriffen auf ihn seine Lehrtätigkeit an der Universität Leipzig hatte aufgeben müssen, als Hilfsarbeiter im Schwermaschinenbau. Das Buch – übrigens eine der ersten selbständigen Veröffentlichungen eines DDR-Autors in Griechenland – war bereits vor zwei Jahren konzipiert worden, als in Athen noch die Obristen herrschten. Hannelore Ochs betont in ihrem Vorwort, dass die Gedichte Reiner Kunzes, der sich in der DDR auch heute noch Pressionen ausgesetzt sieht, eine Absage an jegliche Diktatur sind, und dass es einem freien Menschen überall unmöglich sei, sich einem Zwangsregime anzupassen. Und sie zitiert als Motto aus Kunzes Gedicht „Puschkins Michailowskoje“:
Wer immer einfallen wird
in die offenen gärten der dichter
… zum gegner hätten sie
mich
J. P. W., Die Tat, 31.7.1975
Lesung in Bonn
Reiner Kunze in Bonn, in der Bundeshauptstadt, noch vor Abschluß eines Kulturvertrages, offiziell eingeladen, offiziell ausgereist: sind da die Grenzen der Abgrenzung bereits überschritten? Zunächst will es so scheinen. Dies um so mehr, als sich der Erste Sekretär des Schriftstellerverbandes der DDR, Gerhard Henniger, noch unlängst gegen eine Teilnahme des Kollegen Kunze beim siebenten Schriftstellerkongreß in Ostberlin ausgesprochen hatte. Überdies war im Oktober eine vom Leipziger Reclam-Verlag geplante Lesung Kunzes in seiner thüringischen Heimatstadt Greiz von der Ostberliner Kulturbehörde untersagt worden, ebenso seine Teilnahme am Internationalen Schriftstellerkongreß im schwedischen Mölle.
Freilich geht auch die DDR-Kulturpolitik, mit Kunzes Gedichtband zu reden, auf ihre Weise „sensible Wege“: Anfang November durfte Reiner Kunze erstmals wieder, nach dem 21. August 1968, öffentlich in der DDR auftreten, in Ostberlin, im Haus der Ungarischen Kultur. Erstmals auch, nach Jahren, wurden Gedichte Kunzes wieder in der DDR-Presse gedruckt und besprochen. Sein jüngster Lyrikband, Brief mit blauem Siegel, bei Reclam in Leipzig in einer Auflage von 15.000 erschienen und sogleich vergriffen, veranlaßte die satirische Wochenzeitung Eulenspiegel dazu, Kunze „Selbstisolierung“ vorzuwerfen, während derselbe Band dem FDJ-Organ Junge Welt die Hoffnung anzeigte auf einen Dichter Kunze, „der uns und nicht dem Klassengegner nützlich ist“.
Unter solche Gesichtspunkten ist diese neuerliche Reise Kunzes in die Bundesrepublik sicher nicht zuletzt der DDR-Kulturpolitik „nützlich“ und eine willkommene Gelegenheit, unmittelbar nach dem Schriftstellerkongreß die proklamierte gesteigerte Wertschätzung der Autoren in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft weithin sichtbar unter Beweis und Erprobung zu stellen. Das „Risiko“ scheint in der Tat gering. Hatte Reiner Kunze doch vor nicht ganz einem halben Jahr den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München mit einer kritischen Dankrede in Empfang genommen und in einem Interview offen von dem „Riesengrab“ gesprochen, in dem er gelegen habe.
Reiner Kunze also in Bonn. Ein karger, kurzer, konzentrierter Auftritt. Keine Dichterlesungsblumen auf der Bühne des „Lyrischen Studios“ im Rheinischen Landesmuseum, keine einführenden Worte, auch nicht von ihm selbst, keine Diskussion. „Um am Ende des Abends einen literarischen Text stehen zu haben und keine Erklärung“, sagte Kunze, „möchte ich Sie im vorhinein bitten, auf ein Gespräch nach der Lesung verzichten zu wollen.“ Zur Begründung verwies er auf die „notgedrungen bruchstückhafte Berichterstattung“, auf die Gefahr von Mißverständnissen, die um so mehr zu vermeiden seien in Fällen, in denen „die relative Macht des literarischen Wortes und das Wort der Macht in dieselbe Richtung zu wirken begonnen haben“. Unmißverständlich und eine Erklärung eigener, poetischer Art war gleich das erste Gedicht, das er las, in tschechischer Sprache zunächst, Verse von Vladimir Holan, der – wie Kunze sagte fünfzehn Jahre schweigen mußte und dieses Gedicht schrieb, nachdem er zum ersten Mal wieder zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen war und ihm einige Fragen gestellt wurden, „die ihn sehr betroffen gemacht haben“. Dies Gedicht heißt „Die Mauer“:
Warum so schwer dein flug?
Warum so verspätet?
Weil ich fünfzehn jahre ertrug
gegen die mauer geredet
und aus meiner hölle
nun die mauer trage
damit sie vor eurer stelle
alles sage.
Kunze sagte alles, was und wie er es als Lyriker zu sagen hatte: mit der Genauigkeit der Verschlüsselung, die im selben Bild-Gedanken Schloß und Schlüssel mit sich führt. „Dabei wird es jeweils vom Umfang meines Wissens, vom Grad an Präzision, mit dem ich denke und fühle, und von der Intensität meines Bemühens um Aufrichtigkeit abhängen, inwieweit ich so genau sein werde, wie in meiner Zeit möglich.“ Diese Erläuterung verlas Kunze aus seiner noch unveröffentlichten Antwort auf Fragen der Universität Basel. Sein Verhältnis zur Tradition umriß er mit einem Bekenntnis zur modernen tschechischen Poesie, vor allem Jan Skácels, zur ironischen Metaphorik Heines und zur poetisch-paradoxen Analyse Brechts.
Ich schreibe, um mein Leben zu intensivieren, um Situationen zu bewältigen, die ich anders nicht bewältigen kann, um Haltungen zu gewinnen und um innere Entfernungen zu Menschen, die ich nicht kenne, zu verringern.
Mit nuancierter, gemessener Diktion, intensiv ohne Pathos, ernst und doch heiter, in angespannter Gelöstheit, oft und gerne aufschauend zum Publikum, so las Reiner Kunze. Das Gedicht auf die „Michailowskoje“, wo Puschkin in der Verbannung lebte, das Gedicht „Zuflucht noch hinter der Zuflucht“ für Peter Huchel, vier unveröffentlichte Gedichte und die Kindergeschichte „Vom entlaufenen Dis“, dem Ton, der sich selbständig macht, den keiner haben will in der Partitur, bis er im Lied eines Mädchens wieder seinen Platz findet in der Gemeinschaft der Töne. Das Gedicht „Nocturne“ aus dem im letzten Jahr in der Bundesrepublik erschienenen Band Zimmerlautstärke war das einzige, von dem Kunze sagte: „Dieses Gedicht möchte ich zweimal sprechen“:
Schlaf du kommst nicht
Auch du
hast angst
In meinen gedanken erblickst du
den traum deinen
mörder
Am Ende, nach Dichterlesungsbrauch, signierte Reiner Kunze fröhlich seine Bücher. Beschämende Schlußbemerkung: Zu Erwin Strittmatter, so wurde gelegentlich des Schriftstellerkongresses berichtet, kämen die Leute in der DDR mit Bussen angereist. In der Universitäts- und Bundeshauptstadt Bonn, zu Reiner Kunze, kamen knapp hundert in einen nur zur Hälfte gefüllten Saal.
Peter Sager, Stuttgarter Zeitung, 6.12.1973
Vom Angeln in verbotenen Gewässern
Die Frage, ob dieser Bericht überhaupt niedergeschrieben werden soll, bewegt mich sehr; denn zu viele Mißverständnisse könnten entstehen, wenn ein bundesdeutscher Journalist über den DDR-Lyriker Reiner Kunze schreibt, wenn er dessen Lesung während der Leipziger Buchmesse schildert. Denn Reiner Kunze hat es schwer in seinem Lande, und Verleger dort haben es schwer mit ihm. Seine Poesie ist in letzter Zeit nur noch im Westen erschienen. Als nun kürzlich aber doch wieder eine stattliche Reihe seiner Gedichte in Leipzig herauskam, unter dem Titel Brief mit blauem Siegel, als Bändchen 553 von Reclams Universal-Bibliothek, da empfanden das nicht nur seine Anhänger zu Recht als Sensation. Das 136 Seiten starke Büchlein für 1,50 Mark war schon ein paar Stunden nach seinem Erscheinen in keiner Leipziger Buchhandlung mehr zu haben.
In der dicken, zweibändigen Sondernummer des Leipziger Börsenblatts zur Frühjahrsmesse ist Kunzes Brief mit blauem Siegel als Nachauflage wieder angekündigt. Und der Leipziger Verlag Philipp Reclam (nicht zu verwechseln mit dem Stuttgarter Reclam-Verlag, dem rechtmäßigen Nachfolger des traditionsreichen Hauses) hat seinen Autor zu einer Lyrik-Lesung während der Messe eingeladen. Sie fand im Gohliser Schlößchen statt, dessen Intimität einer solchen Veranstaltung sehr wohl ansteht. Nur – der Saal hätte wohl zehnmal so groß sein können, und er hätte noch nicht alle Menschen gefaßt, die Reiner Kunze gern hören und sehen wollten. Wenn hier nun doch ein Bericht über diesen Abend niedergeschrieben wird, so keineswegs, um diese Angelegenheit hochzuspielen, sondern nur deshalb, weil einer, der nicht nur von Berufs wegen, sondern gerne schreibt, das starke Erlebnis dieser Stunde einfach loswerden muß. Daher will er versuchen, ganz objektiv zu bleiben.
Vom Hauptbahnhof sind es mit der Straßenbahnlinie zwanzig nur zehn, fünfzehn Minuten bis nach Gohlis. Das Schlößchen, das heute das Johann-Sebastian-Bach-Archiv beherbergt, erreicht man dann zu Fuß über eine dicht bewohnte, mit gemütlichen alten Gaslaternen beleuchtete Straße. Vor dem Portal drängt sich eine dichte Traube junger Menschen, die hoffen, auch ohne Einladungskarten noch Einlaß zu finden. Es gibt erst dann eine beängstigende „Schlacht“, als gemeldet wird, nur fünfundzwanzig Personen könnten noch in Nebenräumen Platz finden.
Drinnen dann will der prasselnde Begrüßungsapplaus für Reiner Kunze nicht aufhören. Der Verlagsdirektor hat es schwer, zu Wort zu kommen, den Lyriker willkommen zu heißen und die Buchhändler auch, die insbesondere zu diesem Abend geladen sind. Im übrigen beherrschte die Jugend die drei ineinander übergehenden Räume. Kunze selber, schmal, korrekt dunkel gekleidet, penibel frisiert, nimmt nicht am kleinen Lesetischchen Platz, sondern bleibt davor, auf dem kleinen Podium stehen, neben dem Flügel. Er spricht nicht laut, in eher sanftem Tonfall, doch sehr prononciert. Er schaut, von seinem Reclam-Bändchen oder neueren Manuskripten aufblickend, gern in die Runde, mit leuchtenden Augen, in heiteren Gedichten auch mit sehr verschmitztem Gesichtsausdruck. Der Einundvierzigjährige, der in Greiz lebt und der vor Jahren durch seine Übersetzungen aus dem Tschechischen bekannt wurde, ist in diesem Augenblick innerlich sichtbar erregt.
Er spricht einleitend ein paar freie Worte. „Es ist seit etwa fünfzehn Jahren die erste Lesung, zu der mich einer unserer Verlage eingeladen hat. Das ist ein Augenblick für mich – fast so selten wie die eigene Hochzeit.“ Er habe viele Jahre nachgedacht, Lebenseinsichten gewonnen und zwar als Autor und als Angler. Durchgehalten habe er nur als Autor, resigniert aber als Angler – nicht aus mangelnder Geduld, sondern weil er jedes Jahr zwölf Versammlungen des Anglerverbands der DDR hätte besuchen müssen, um seine Angelberechtigung zu behalten. In seinem Wesen aber sei er Angler geblieben.
Und dann las er als erstes seine elf Thesen vor, Titel: „Dichter und Angler“. Verborgene Geheimnisse seien sie beide, der Fisch und der Vers. Und wörtlich: „Für den Angler gibt es verbotene Gewässer.“ Beide, der Dichter und der Angler, müßten warten können. Und: „Weder vom Dichten noch vom Angeln kann man leben.“ Dann folgten Gedichte, Gedichte… Die Freude der Kenner im Publikum über dieses und jenes selbst schon oft Gelesene war groß, die Reaktion auf jede Nuance geradezu körperlich spürbar, der Beifall nach bestimmten Stücken frenetisch, viel zu laut für die Stille dieser Poesie. Wer verstünde sie nicht, die Klatscher, etwa nach dem Gedicht „Das Ende der Kunst“:
Du darfst nicht, sagte die eule zum auerhahn
du darfst nicht die sonne besingen
Die sonne ist nicht wichtig
Der auerhahn nahm
die sonne aus seinem gedicht
Du bist ein künstler,
sagte die eule zum auerhahn
Und es war schön finster
Kunze ist ein großer Parabel-Künstler. Den Einfall in die „offenen Gärten der Dichter“ handelt er am Falle Puschkins ab. Und dann unterbricht er plötzlich die Lesung seiner Lyrik und spricht über die Situation der Dichter im heutigen Griechenland. Über ihr Schweigen, das die Machthaber beunruhigt, und Reiner Kunze liest ein Stück Prosa von Alexandros Skytis: „Gedanken zur Freiheit der Künste“, in denen davon die Rede ist, wie sehr Tyrannen die Teilhabe des Publikums an der Freiheit erschreckt.
Reiner Kunze liest auch eigene Gedichte, die in der DDR noch nicht veröffentlicht wurden, etwa den „Hymnus auf eine Frau beim Verhör“. Schließlich erweist sich der Lyriker auch als ein großartiger, prägnanter und höchst witziger Erzähler. Unter den vom Beifall erzwungenen Dreingaben waren auch fünf kleine Stücke Prosa, deren Helden die fünfzehnjährige Tochter des Autors ist, brillant pointierte Beschreibungen ihrer Protesthaltung in puncto Kleidung, in puncto Unordnung, in puncto auch der ersehnten Nickelbrille. „Der Draht“ heißt dieses letzte Stück. Bewundert wird der Freund in der Schulklasse, der eine Nickelbrille trägt. Doch vom Lehrer erhält er einen Verweis, denn Nickelbrillen tragen die dekadenten langhaarigen Jünglinge im Westen, was der Lehrer mit Bildern aus Illustrierten belegt. Die Tochter sehnt sich dennoch nach einer solchen Brille, stolz würde sie dann damit in die Schule gehen, alte Fotos bei sich tragend, vom Urgroßvater und vom Großvater: Beide trugen sie Nickelbrillen, beide waren – Bergarbeiter.
Reiner Kunze ist ein stiller Beobachter, ein Lebensphilosoph, ein Wahrheitssucher – beileibe kein Provokateur, erst recht natürlich kein Konformist. Sein Verleger kam am Schluß der Lesung in den Dankworten noch einmal auf den Dichter und Angler zurück und versprach, sein Möglichstes zu tun, daß Kunze – wenn nicht vom Angeln – so doch vom Dichten leben könne.
Diese mutigen Verlegerworte bewunderte später, in der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn, ein bärtiger junger Intellektueller (so nennt man ja nicht nur bei uns die etwas mehr als üblich Nachdenkenden), ein angehender Regisseur, der zu dieser Lesung von weither, aus einem anderen Winkel der DDR angereist war. „Als angekündigt wurde, von Reiner Kunze werde bei Reclam wieder etwas erscheinen“, sagte er, „da habe ich das einfach nicht geglaubt.“ Daß nun aber Reiner Kunzes Brief mit blauem Siegel herausgekommen ist, sollte als hoffnungsvolles Zeichen gewertet werden. Erst recht diese Lyriklesung mitten im offiziellen Programm der Buchmesse. Sie mitzuerleben, zu erfahren, wie stark Poesie bewegen kann, war allein schon die Reise in die alte Messestadt Leipzig wert. Glücklich ein Land, das solche Dichter hat.
Wolfram Schwinger, Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 13.3.1974
Kunze in England
Daß der Aufenthalt des ostdeutschen Lyrikers Reiner Kunze in diesem Land mehr war als ein literarisches Ereignis, spürten alle, die Kunzes Lebensumstände kennen, auch alle, die seine Lesungen auf dem Cambridge-Poetry-Festival, in den Universitäten von Sussex und East Anglia oder im Hampstead Pub, dem Treffpunkt der Lyrikgruppe Pentameter, besuchten und die das Gewicht der Erfahrung hinter seinen kargen und subtilen Gedichten spürten.
Daß er die Erlaubnis erhielt, England als Privatmann zu besuchen, gereicht der Regierung seines Landes zur Ehre, eines Landes, das Literatur nie als Privatangelegenheit angesehen hat. Daß er sich selbst nach einem ernsten körperlichen Zusammenbruch direkt aus dem Krankenhaus zu kommen entschloß, spricht für seinen außerordentlichen Mut, einen Mut, den er während seines ganzen schriftstellerischen Lebens bewiesen hat.
Kunze ist 1933 in Sachsen geboren. Sein Vater ist gelernter Klempner, arbeitete aber, wenn er nicht arbeitslos war, als Bergmann. Reiner war das einzige von drei Geschwistern, das die Kindheit überlebte – und auch er überstand nur eben eine Hautkrankheit, die eine Folge von Unterernährung war und ein halbes Jahr lang Milchbäder erforderte.
Er studierte Philosophie und Journalistik an der Universität in Leipzig und lehrte dort vier Jahre, bis er nach „ernsten politischen Auseinandersetzungen“, wie er es bezeichnet, die Universität verlassen und als ungelernter Schlosser in einer Fabrik arbeiten mußte. Zwei frühe Gedichtbände erschienen in der DDR vor 1961. Seine späteren Bücher – seit 1963 insgesamt zehn, seine Übersetzungen aus dem Tschechischen mitgerechnet – kamen nur in Westdeutschland heraus, bis dann in Reclams Universalbibliothek (Leipzig), einer weitgehend klassischen Texten vorbehaltenen Reihe, eine Auswahl seiner Gedichte vorgelegt wurde. Die dreißigtausend Exemplare dieser ostdeutschen Auswahl Brief mit blauem Siegel waren innerhalb weniger Tage vergriffen.
Reiner Kunze ist mit einer tschechischen Ärztin verheiratet, die er nur schriftlich kennengelernt hatte, und er lebt seit 1962 als Autor in Greiz in Thüringen. Sein Werk, das auch Geschichten für Kinder umfaßt, ist in viele Sprachen übersetzt. Weder der außerordentliche Druck, dem er seit 1963 ausgesetzt ist, noch sein kritischer Gesundheitszustand – schon in seinen Zwanzigern hatte er an einer langwierigen Herzkrankheit gelitten – haben ihn verbittert. Nach seinem Aufenthalt in England und dem Erfolg seines Gedichtbandes in der DDR gefragt, meinte er:
Sie müssen die Bedeutung des VIII. Parteitages von 1972 verstehen. Er hat zu Entwicklungen geführt, die eine Erweiterung des geistigen Horizonts und des Spektrums der Kunst ermöglicht haben – Entwicklungen, die möglicherweise nicht mehr rückgängig zu machen sind.
Auf den Einwand, diese Entwicklung scheine seine eigene Situation als Autor in seinem eigenen Land aber doch nicht radikal verbessert zu haben, zuckte er die Schultern und erläuterte seine Position mit den Worten:
Ein Schriftsteller kann kein Konformist oder Mitläufer sein, denn es geht ihm um Wahrheit. Er kann nur ein Mitstreiter sein, und wenn er die Betonung auf die Vorsilbe ,Mit‘ legen will, muß er das Wort ,Streiter‘ betonen. Bedauerlicherweise verstehen viele Leute diese vertrackte Dialektik nicht.
Wie seine frühen Gedichte, besonders seine Liebesgedichte beweisen, ist er eigentlich ein sensibel wahrnehmender Lyriker, nicht der satirische, polemische Dichter, der er notwendig werden mußte, als sein Recht auf diese Wahrnehmungen infragegestellt oder ihm verweigert wurde. Das spürte wohl jeder, der ihn lesen hörte mit ruhiger Genauigkeit, die nicht überredet, sondern jedes Wort und jedes Bild in seine richtige Beziehung zu all den anderen bringt, wobei „all die anderen“ das unentbehrliche Minimum von Worten und Bildern meint. Über die ungewöhnliche Kürze der meisten seiner späteren Gedichte sagt Kunze:
Mein Ehrgeiz richtet sich nicht auf lange Gedichte – was nicht heißen soll, daß ich nicht lange nachdächte. Im Gegenteil: Oft besteht zwischen der Kürze eines Gedichts und der Zeit, die ich darüber nachgedacht habe, ein umgekehrtes Verhältnis. Und das hängt auf besondere Weise mit den Umständen zusammen, unter denen die Gedichte geschrieben worden sind.
Wenn manche dieser kurzen Gedichte sich selbst auszulöschen scheinen, dann deshalb, weil Kunze seine Selbstdarstellung der Vorführung einer besonderen Wahrheit geopfert hat. In einer weitgehend kollektiven Gesellschaft ist es unwahrscheinlich, daß diese Wahrheit nur für ein Individuum gilt, auch da, wo der Dichter selbst mit seiner Frau oder seinen Kindern spricht. Wahrheit in Gedichten ist unteilbar. Was immer auch sein Thema ist – Kunze hat sich stets mehr um andere als um sich gekümmert. In diesem Sinne, und nur in diesem, ist er ein engagierter Schriftsteller.
Kein offizieller Gesandter hätte mehr für das Ansehen der DDR in unserem Land tun können als dieser aufrechte und nur seiner Sache verschriebene Dichter. Ich fragte ihn, ob seine Anwesenheit hier und die Tatsache, daß er in seinem Land veröffentlichen kann, bedeute, daß er von jetzt an nicht mehr in der Sorge leben müsse, bei jeder Publikation eines neuen Buches in Schwierigkeiten zu geraten, Schwierigkeiten, die in der Vergangenheit auch seine Familie trafen. Seine Antwort war ein beliebtes Zitat eines englischen Dichters, Sir Thomas Wyatt:
Und richten sie recht oder unrecht mich,
ich bin der, der ich bin
und so schreibe ich.
Michael Hamburger, The Guardian, 8.5.1975
Deutsch von Katharina Wallmann
Versuch einer Erinnerung
Wann und wie lernte ich den Greizer Dichter eigentlich kennen? Eine Frage im Jahre 1998. Fünfundzwanzig Jahre zuvor stellte AWM eine noch merkwürdigere Frage – nämlich für das zweite Heft seiner 1973 in Berlin gegründeten Zeitschrift europäische ideen: Wie viele deutsche Literaturen gibt es?
Heft 1 (Exil 1973) brachte u.a. Texte von T.G. Masaryk, Huchel, Havemann und Kantorowicz. Und auch dieses 2. frühe Heft war stark „DDR-belastet“ – wir nennen nur Harich und Neubert, den ndl-Chef.
Kunzes kleine Perle las sich so:
Die Sorge der Theoretiker: Wie viele deutsche Literaturen es gibt. Die Sorge der deutschsprachigen Praktiker (in Österreich, der Schweiz, der BRD, der DDR, im rumänischen Siebenbürgen usw.): in deutscher Sprache ein Gedicht, einen Roman, ein Bühnenstück, einen Essay zu schreiben. Möglichst von Rang. So hat jeder seine Sorge.
Die Sorgen wuchsen, obwohl wir noch nicht das Schicksalsjahr 1976 schrieben. Reiner Kunze sind wir wohl, trügt die Erinnerung nicht, im September 1973 zum ersten Mal begegnet (An einem Brunnen in Leipzig? Von der Stasi beschattet?): Kunze hatte „guten Grund“, diesen Westjournalisten zu treffen, der seit einigen Jahren (Ulbricht warf gerade das Handtuch…) in dieses exotische, fremde Land reiste, das von einem Volker Braun in so ein merkwürdig verklärt-sozialistisches Utopia getaucht wurde.
„Ich danke Ihnen für Ihre faire und sachliche Richtigstellung. Sie ist im Augenblick für mich von großer Bedeutung. Ebenso danke ich demjenigen, der sie ermöglicht hat“, schrieb uns Kunze am 14.9.1973 aus L. – Was war denn geschehen? AWM hatte sich nach Leipzig aufgemacht, zum Reclam-Verlag, weil er von einem sagenumwobenen Titel gehört hatte: Brief mit blauem Siegel. Und er versprach sich wohl (dissidentische) news, die er dann auch – vom Verlagsleiter Hans Marquardt ,höchstpersönlich‘ – bekam. Ein Report über dieses „schwierige Buch“ folgte im RIAS; plötzlich meldete sich Kunze: er würde gerne einiges richtigstellen. Nicht am Telefon freilich. Im Klartext: Stasi-Mitarbeiter Marquardt hatte AWM (äußerst geschickt) desinformiert und der (zunehmend isolierte) Autor wehrte sich nun dagegen. Eine Woche später sendete AWM (wieder im RIAS) die Berichtigung. Der DDR-Verleger war also (zurecht) blamiert.
Zu diesem Zeitpunkt war jener Reclam-Band (M. schenkte uns immerhin, wenn auch zögerlich, ein Exemplar) „noch immer nicht ausgeliefert, was aber, wie gesagt, noch nichts besagen will“ (R. K. 14.9.1973), und ein paar Tage zuvor berichtete Kunze uns von einem Schreiben Günter Kunerts zum Brief mit blauem Siegel: es sei wohl das „Maximum des Möglichen“, meinte Kunert und Kunze maß diesem weisen Kollegensatz uns gegenüber ein ganz „besonderes Gewicht“ bei.
Die Brief-Freundschaft zu Reiner Kunze (durch jene Indiskretion zementiert) nahm also ihren Lauf – mit zahlreichen weiteren späteren Stasi-Verquickungen, wobei die Rufmord-Variante nur eine von diversen ,operativen‘ Möglichkeiten darstellte. Ließ man zwar einige DDR-Autoren (mit Stasi-Nähe, wie wir später sahen) bei uns gewähren, erhielt Kunze ein generelles Publikationsverbot für die europäischen ideen.
Am 6.10.1974 schrieb er uns aus Greiz:
Ich bin von staatlicher Stelle offiziell davon in Kenntnis gesetzt worden, daß es sich bei den europäischen ideen um eine Einrichtung des amerikanischen Geheimdienstes handle. Wörtlich (aber aus dem Gedächtnis aufgezeichnet): „Sie haben in dieser Zeitschrift nichts zu suchen…“
Das konnte seine Wirkung schwer verfehlen und unsere weiteren (DDR-)Kontakte zu Kunze waren dann wohl – durchaus ,folgerichtig‘ – bis 1977 irgendwie von diesem staatlichen Bannstrahl gezeichnet.
Ähnlich muß es auch anderen DDR-Autoren ergangen sein, die in den europäischen ideen publizierten (bzw. die Absicht dazu rasch wieder aufgaben). Im übrigen kochte ja gerade in dieser Zeit – 1976/77 – die MfS-Gerüchteküche ständig über; ein Faktum – nebenbei – das einmal untersucht werden müßte, da sich seinerzeit auch diverse West-IMs vom MfS einspannen ließen, um (West)Kollegen zu denunzieren, zu bespitzeln oder gar „nur“ zu beeinflussen. Während die meisten DDR-Autoren eingeschüchtert schienen, waren offenbar andere wiederum „delegiert“, den Kontakt zum Westberliner Klassenfeind/ Mytze zu halten. Belege dazu finden sich (heute) im Gauck-Museum.
Händedruck, lieber Reiner Kunze!
Andreas W. Mytze, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Erinnerung an Greiz
Ich hatte telefonisch mit Reiner Kunze gesprochen und mich angemeldet und war jetzt überzeugt, daß nichts mehr zwischen mir und Greiz liegt als eine Autofahrt. Wir haben die Autobahn, aus Halle kommend, verlassen und fahren durch den Südosten der DDR. Der Tag dämmert unter einem regenschweren Himmel, der Herbst ist vergangen, und es will nicht Winter werden. Ich weiß noch immer nicht sicher, ob ich eine Reisebeschreibung lese oder ihr Hauptheld bin: der freundschaftliche Empfang bei der Wochenpost, Schulpforta, Naumburg, Weimar, Jena, Eisenach, Erfurt, Leipzig, Halle. Ich habe oft darüber gelesen. Aber die Orte, durch die wir kommen, erhalten in der künstlich anmutenden Vormittagsbeleuchtung etwas beinahe Wirkliches. Viele Wege, die wir nicht fahren, laufen in der gleichen Richtung; als gäbe es keine Hindernisse und Pannen, führen alle Wege nach Greiz. Viele Wege, über Wälder und Felder aufgerollt, denen sie nicht gleichen, „sensible Wege“, denke ich, „wie viele Bäume werden gefällt, wie viele Wurzeln gerodet in uns“. Jeder Ort kann Greiz sein, aber wir fahren erst gegen Mittag in einer Stadt dieses Namens ein, die viel größer ist, als ich erwartet habe. „Die Häuserhänge“ sind „wie von Naiven gemalt, längs der Dächer führn Straßen Schornsteine stehn wie Kilometersteine“. Greiz hat eine entwickelte Textilindustrie und hatte früher über achtzig Millionäre, jetzt lebt hier Reiner Kunze. Ein serpentinenartig gewundener Weg führt einen Hang hinauf, Franz-Feustel-Straße 10, von wo die Stadt wie „ein Märchenfisch“ aussieht. „Das Schloß trägt er wie eine Krone.“
Es war viel und wenig, was ich von Reiner Kunze kannte und auf dem Weg nach Greiz zusammengezählt hatte: den Reclam-Band Brief mit blauem Siegel und dazu die Rezension von Franz Hodjak in der Neuen Literatur, ein Gedicht von Volker Braun, eine unseriöse Zehnzeilen-Anzeige seines Bandes, einige Notizen von hie und da und den Satz:
Hier nimmt kein Oppositioneller einen Preis für Opposition entgegen, sondern ich habe die große Freude, als Schriftsteller den Literaturpreis der Bayrischen Akademie der Schönen Künste entgegennehmen zu dürfen, so, wie er gemeint ist, und ich danke mit einer Bewegtheit des Herzens, der zumindest die Internisten beider deutscher Staaten ihre Zustimmung nicht versagen können.
Ich kannte ihn aus Anthologien. Aber man weiß, Anthologien sind oft den Jahreszeiten ausgeliefert: Als gälte es nicht, im strengen Winter Frühlingsgedichte zu schreiben, um die Menschen zu erinnern: „Nichts währt ewig“. Oft lassen sich aber Herausgeber verführen, ihre Sammlungen auf Jahreszeiten abzustimmen: dabei fehlen dann Dichter und Herausgeber. Man kann einen Dichter (wie Kafka einmal an Felice Bauer schrieb) durch Wort und Schweigen kennen, aber was ist das schon im Vergleich zu persönlicher Bekanntschaft?
Reiner Kunze öffnet die Tür. Seine selbstverständliche Freundlichkeit und die vielen Bekannten in den Bücherregalen lassen keine Verlegenheit aufkommen. Zu sprechen gibt es sehr viel, „im Mittelpunkt steht der Mensch / Nicht der einzelne“ und „Das Gedicht als äußerster Punkt möglichen Entgegenkommens des Dichters, als der Punkt, in dem auf seiner Seite die innere Entfernung auf ein Nichts zusammenschrumpft. Das Gedicht als Bemühung, die Erde um die Winzigkeit dieser Annäherung bewohnbarer zu machen.“
Aus Halle, begleitet von einem Musikkritiker, ist ein Komponist angereist, er will der Uraufführung eines seiner Werke beiwohnen und Kunzes „Variationen auf das Thema ,die Post‘“ vertonen. Der Komponist stellt sich über ein Tonband vor, und wir trinken dabei Jasmintee. Während sich ein Gespräch unter Fachleuten abwickelt, darf ich schweigen und lese Sensible Wege, den bislang wohl besten Gedichtband Kunzes. „Das Gedicht als Stabilisator, als Orientierungspunkt eines Ichs. Das Gedicht als Akt der Gewinnung von Freiheitsgraden nach innen und außen.“ Man darf aber nicht nur schweigen beim Jasmintee, man kann auch sprechen. Über alles und von der Seele herunter.
Am Nachmittag kommt Elisabeth Kunze aus der Klinik, wo sie arbeitet. Sie trägt einen „blauen Mantel. Irgendwann im Jahre 59… hört eine tschechische Ärztin eine Sendung von Versen aus Kunzes erstem Gedichtband… und die Gedichte beeindrucken sie so sehr, daß sie dem Dichter schreibt. Sie wird für ihn Rettung, Erlösung, Bastion, Hoffnung (später auch seine Frau), und Kunze überträgt dieses Verhältnis zu ihr auch auf ihre Heimat. Böhmen ist für ihn also kein touristisches, sondern wirklich schicksalhaftes Erlebnis, das in der Mythologie seines Lebens Trost, Harmonie, Stärkung und Verständnis symbolisiert… Vor allem aber inspiriert die Tschechoslowakei Kunze zu eigenem Schaffen und bedeutet in seiner Entwicklung einen außerordentlichen Schritt nach vorn“, schreibt der tschechische Schriftsteller Milan Kundera. Über 400 Briefe bis zu 25 Seiten und ein telefonischer – akzeptierter – Heiratsantrag, bevor man sich je gesehen hatte, erzählen eine moderne Version von Romeo und Julia und beweise ,daß das Leben nicht nur schrecklicher, sondern auch schöner sein kann als Literatur: die „feindlichen Familien“ versöhnten sich, und mit Hilfe des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes, der den jungen Übersetzer sehr schätzt, kam die Heirat zustande. So kann Reiner Kunze sagen, daß seine Frau sein erster Literaturpreis ist.
Am Anfang war das Gedicht!
Am Abend sitzen wir im Hotel und trinken Erlauer Stierblut. Die Gespräche werden nach Sperrstunde des Restaurants im Hotelzimmer fortgesetzt und dauern bis spät in die Nacht. Als Reiner Kunze nach Hause geht, regnet es. Alles, was in seinen Gedichten steht, denke ich, ist wahr: die große, echte Freundlichkeit und menschliche Anteilnahme, die Ehrlichkeit, die Trauer, daß „Gedichte mißbrauchbar sind. Wie die Macht.“ Aber eigentlich ist Reiner Kunze ein fröhlicher Mensch, der viel und gerne lacht und manchmal sogar etwas Lausbubenhaftes an sich hat. Kaum schlafe ich ein, läutet das Telefon. Mein Zug nach Halle geht um 7 Uhr und 8.
Die Fahrt nach Greiz hatte ich noch zuhause beschlossen und versucht, mit Reiner Kunze brieflich ein Zusammentreffen auszumachen. Der Brief mit dem blauen Siegel (eine weiße Laus, die Post ist ein Kamm) für mich ist noch immer auf dem Weg, während ich schon längst wieder zuhause bin.
Bernd Kolf, Karpatenrundschau, 28.2.1975
Gespräch mit Reiner Kunze
Bernd Kolf: Was bewog Sie, an den Beruf des Schriftstellers zu glauben?
Reiner Kunze: Der, dessen Denken so strukturiert ist, daß ihn innere Erschütterungen – und zwar die kaum merklichen wie die verheerenden – zu poetischen Bildern inspirieren, ist dieser Denkweise auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er hat keine Wahl, die Bilder lassen ihn nicht los – er muß schreiben, und er gewinnt dabei eine innere Haltung zu dem, was ihn bewegt; schreibend bewältigt er. Das heißt nicht, daß Gedichteschreiben eine Art bewußter Infarktprophylaxe ist. Erstens kann man ein Gedicht nicht bewußt wollen, ehe das Unterbewußtsein es nicht bereits signalisiert hat, und zweitens rufen Gedichte, die den Druck über dem Herzen nehmen, in der Umwelt oft Reaktionen hervor, die das Gegenteil bewirken. Abgesehen davon, daß auch und besonders Glücksmomente bewältigt sein wollen. Indem Gedichte aber Versuche sind, Wirklichkeit zu bewältigen und Haltungen zu gewinnen, besteht die Möglichkeit, daß sie auch jenen, die sie nachvollziehen, helfen, zu sich selbst zu finden und sich im Leben zu orientieren.
Kolf: Ein zentrales Thema Ihrer Dichtung ist die Post, ist der Brief als Kommunikationsmittel zwischen Menschen (ein Thema, das auch aus Ihren zahlreichen Nachdichtungen hervorgeht), als ,tür zur welt‘, wie es in einer der „variationen über das thema ,die post‘“ heißt. Sie versuchen also, durch Abbau innerer Entfernungen zwischen den Menschen die Erde bewohnbarer zu machen…
Kunze: Die Bewohnbarkeit der Erde ist die Voraussetzung menschlichen Glücks. Ob Dichter, Politiker oder Maurer – sie taugen in dem Maße nichts, in dem sie die Erde nicht bewohnbarer machen.
Kolf: In einem Ihrer Bände stellen Sie einem Kapitel den Satz von Jean Améry voran: „Ohne das Gefühl der Zugehörigkeit zu den Bedrohten wäre ich ein sich selbst aufgebender Flüchtling vor der Wirklichkeit.“ Auch Landschaften sind heute bedroht (und insofern wiederum Menschen). Welche Rolle spielt die Landschaft in Ihren Gedichten?
Kunze: Die Rolle, die sie in meinem Leben spielt. Und auf meiner inneren Wertskala rangiert die Landschaft hoch oben – bei den Wundern.
Kolf: Und die Schwesterkünste der Literatur – Musik, Malerei…?
Kunze: Die Musik ist meine Favoritin unter den Künsten. Nur ganz selten lotet eine Metapher in der Tiefe, in der mich Beethovens letzte Streichquartette oder Gustav Mahlers „Lieder eines fahrenden Gesellen“ erreichen. Aber – das möchte ich wiederholen – auch eine Metapher kann in dieser Tiefe loten. Da ich mich beinahe selbst den bildenden Künsten verschrieben hätte, ist meine Beziehung zu ihnen schon erblich determiniert. Wenn ich einen Namen nennen darf – ich wähle diesen Namen auch, aber nicht nur, weil Sie aus Rumänien kommen –: Brâncusi.
Kolf: Künstler, die mit ihrer Kunst am Ende sind, sprechen gern vom Ende der Kunst. Sie verweisen auf die Wissenschaft, die die Kunst ersetzen soll. Gibt es nach Ihrer Meinung einen spezifischen Bereich der Poesie?
Kunze: Wenn sich im Menschen Spannungen in dichterischen Bildern ,entladen‘, wenn das Unterbewußtsein weit auseinanderliegende Realitäten miteinander verknüpft und diese Verknüpfungen ans Bewußtsein weiterleitet, so ist das ein Zeichen dafür, daß es einen spezifischen Bereich gibt, dessen sich der Mensch nur durch die Poesie optimal vergewissern kann: nämlich bestimmte Momente seiner jeweiligen konkreten inneren Situation (und damit indirekt bestimmte Momente der jeweiligen konkreten äußeren, also auch gesellschaftlichen Situation in ihren Auswirkungen auf den inneren Zustand des Menschen). Eine Denkweise, eine spezifische Art, sich die Welt anzueignen, ist kein Luxus der Natur, auf den gegebenenfalls, verzichtet werden könnte, sondern eine existentielle Notwendigkeit. Man könnte entgegnen: Wenn es einen spezifischen Bereich der Poesie gäbe, müßten sich alle Menschen dieses Bereichs in poetischen Bildern vergewissern. Sie tun’s, die meisten nur nicht originär-schöpferisch, sondern rezipierend-schöpferisch. Oder sie begnügen sich mit Pseudopoesie (also einer Pseudovergewisserung) oder mit Poesieersatz (der Poesie natürlich nicht ersetzen kann, wenn es sich um die ihr spezifischen Lebensdimensionen handelt). Das Ende der Kunst kann nur mit dem Ende der Menschheit zusammenfallen, niemals aber mit dem Ende eines Künstlers als Künstler.
Kolf: Vieles, was in der Vergangenheit geschehen ist, und viel Wahn, den es in der Welt noch gibt, müssen bewältigt werden. Denken wir an die beiden Weltkriege: Vergangenheit, wenn sie wiederkommen sollte, könnte die Zukunft kosten. Wo liegt in Ihren Gedichten der Akzent bei der Bewältigung dessen, was Holthusen als „die Dunkelheiten, die zwischen den Trümmern dieser Welt liegen“ bezeichnet?
Kunze: In der Bewältigung von Gegenwärtigem, in dem noch Vergangenes steckt, das die Zukunft kosten könnte. Wir haben mit der Vergangenheit ,abgerechnet‘. Doch ,abrechnen‘ ist ein Terminus aus der Buchhaltung, ,bewältigen‘ dagegen ein Begriff aus der Psychologie.
Kolf: Ihr jüngster Band Brief mit blauem Siegel – dessen zweite Auflage ebenso schnell vergriffen war wie die erste – trägt schon im Titel den Hinweis auf Hoffnung. Was, konkret, meint diese Hoffnung?
Kunze: Die hervorstechendsten Eigenschaften meiner Mutter sind Vitalität und eine heitere Natur. Sie hat in ihrem Leben viel Schweres und Schwerstes durchgemacht und würde sehr alt werden, wenn jedes Nichtaufgeben mit Lebenszeit belohnt werden würde. Mein Vater ist bei der Arbeit von einer fast göttlichen Ausdauer. Das heißt – ,göttlich‘ ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Gottes Arbeit währte sechs Tage, die des Menschen währt sein Leben lang. Mein Vater würde sehr, sehr alt werden, wenn er so lange leben dürfte, wie ihm Ausdauer bei der Arbeit gegeben ist. Ich glaube, ich habe ein wenig von der heiteren Natur meiner Mutter und von der Ausdauer meines Vaters geerbt, und das läßt mich hoffen. Denn ab und zu gelingt es uns doch, der Zeit fest in die Augen zu blicken und sie für einen Bruchteil ihrer selbst zu verunsichern. Und diesen Bruchteil nützen wir dann aus.
Neue Literatur, Heft 4, April 1975
„Hier dürfen Sie schweigen“
In meinem zwölften Lebensjahr starb der größte Mensch aller Zeiten.
Exzellenter Philosoph, genialer Staatsmann, hohe Koryphäe der Wissenschaft, Schöpfer der Großbauten des Kommunismus, streng, doch allgütig, allwissend und nahezu allmächtig, stand er dem Kind in der weißen Generalissimus-Uniform vor Augen, in der er sich so gern fotografieren und malen ließ. Heilsbringer und Götter werden zur Zeit der Wintersonnenwende geboren: Am 21. Dezember feierten alle befreiten Lande den Geburtstag des ruhmreichen Feldherrn. Nach dem fünften März 1953 wurde meine Schulklasse in die Aula geführt. Stalin stünde uns viel zu nahe, als daß wir aus unserer Ameisenperspektive seine volle Größe erkennen könnten, hieß es in der Fest- und Gedenkstunde. Ich fühlte, daß etwas Bedeutendes geschehen sei, doch ich begriff die hysterische Trauer nicht, die sich in Wort-Tränen über den halben Erdball ergoß. Daß Stalins Herz nicht mehr schlug, rührte nicht an sein Wesen. Er war ja unsterblich. Wer konnte zweifeln, daß wir fortan am 21. Dezember den Tag seiner Wiedergeburt begehen würden:
Dein Name ist im Weltall eingetragen
wie der Gestirne Schein und Widerschein,
dichtete der gewaltige Staatspoet und Kulturminisier Johannes R. Becher.
Der tiefsinnige Denker Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili hatte im Kratkij kurs die berühmte Abhandlung „über dialektischen und historischen Materialismus“ verfaßt, die einer Generation von Sowjetmenschen zelebriert wurde. Darauf spielt Reiner Kunzes Gedicht „Kurzer Lehrgang“ an:
Dialektik
Unwissende damit ihr
unwissend bleibt
werden wir euch
schulen…
Treffender konnten die dialektischen Grundgesetze, die uns sieben mal siebzigmal eingehämmert wurden, nicht gedeutet und verdichtet werden. „Einheit und Kampf der Gegensätze“ trieben ihr ewiges von unendlichen Schulungen gefördertes Wechselspiel in Kunzes Versen. Der erbitterte Streit zwischen Unwissenheit und Erkenntnis endete in deren umfassender Versöhnung, jedoch nicht für immer, denn die Bewegung, eine fundamentale Eigenschaft der Materie und des von ihr erzeugten Denkens, formte die wissend Unwissenden in keineswegs kurzen Lehrgängen zu unwissend Wissenden. Auch beschrieb Kunze den Umschlag einer gehäuften Quantität von Wissen in eine neue Qualität: die Unwissenheit, ja selbst die Negation der Negation wurde sichtbar: die Unkenntnis erreichte durch eine zweifache Verneinung über eine angestrengte Wissensvermittlung eine höhere Stufe der Unwissenheit. Ein solcher Prozeß vollzog sich in räumlichen Spiralen, und zweifellos hatte die Unwissenheit über den Marxismus-Leninismus, als die DDR dahinging, ihren höchsten Stand erreicht. Zu diesem Zeitpunkt aber gehörte Reiner Kunze schon längst nicht mehr zu den Geschulten.
Sein mir durch staatsöffentliche Mißbilligung vertrauter Name gewann einen besonderen Klang im Mund Peter Huchels. Der in Wilhelmshorst Geächtete sah mit Freude, wie einer aus der quasi-intellektuellen Phalanx der Gläubigen, Halbgläubigen und zerknirschten Zweifler ausbrach. So kam ich zu Reiner Kunze. Die Kämme von Thüringer Wald und Thüringischem Schiefergebirge auf gewundenen Wegen überquerend, fuhr ich mehrmals mit dem Motorrad nach Greiz und wurde zu einer Tasse Jasmintee geladen. Nachdenklich, hell, beflügelnd: ich genoß sein Aroma, das sich aus der Oberfläche emporkräuselte und so flüchtig war wie der erfüllte Augenblick. So trank ich zugleich den Tee und das mir liebste Kunze-Gedicht, erfahrend, daß er seine Verse nicht nur schreibt, sondern auch lebt, ja, daß er nichts schreiben kann, was er nicht lebt.
Einladung zu einer Tasse Jasmintee
Treten Sie ein, legen Sie Ihre
traurigkeit ab, hier
dürfen Sie schweigen
Wir schwiegen nicht. Wenn zwei sich nicht in die Enge des Staatskanons einfesseln ließen, hatten sie viel miteinander zu reden. Bestärkt ummaßen sie die Ackerhufen einer gemeinsamen Gegnerschaft, auch wenn ihre ästhetischen Gedanken nicht immer in die gleiche Richtung wiesen. Damals galt mir die Imagination als höchste, als intensivste Form von Wirklichkeit, während Kunze auf der dinglichen Realität seiner Herkunft, seines Lebens, seiner Gegenwart bestand.
Ein paar Jahre vergingen. Die brudervölkischen Heere zogen 1968 nach Prag, den Sozialismus zu retten. Kunze sah ihn als unrettbar verloren an und verließ die Partei: niemals hat er sich zweifelnd oder gar reumütig dorthin zurückgewendet: Daß die Abgefallenen die reifsten seien, hat er uns gelehrt. Sein Ruhm wuchs. Nach der Zeit der Verfemung begann ein leichtes, von frostharten Nächten begleitetes Tauwetter. Der Brief mit blauem Siegel erschien im Leipziger Reclam-Verlag in einer sehr hohen, doch viel zu geringen Auflage. Der Name Kunze war in aller Munde. Er hatte zur rechten Stunde das Rechte gesagt. Er sprach aus, worauf so viele, ohne es benennen zu können, gewartet hatten. Ihm gelang es, etwas auf das Wort und zu Wort zu bringen, was zwar unverborgen, jedoch in jenem Halbdunkel lag, das für den DDR-Alltag so charakteristisch war: Man nahm es hin, entlastete sich, verweigerte sich selbst die Rechenschaft, weil nachzudenken zu nichts oder – in den späteren Jahren – aus dem Halbland DDR führte.
Doch je größer die Anerkennung und Anhängerschaft wurden, desto stärker trat das Werk zurück. Vielen kam es weit mehr als auf die Texte auf das Symbol Kunze an. Er wurde ein Leitbild, ja ein Idol wie nach ihm nur Christa Wolf. Das Gemeinsame und das Gegensätzliche in bei der Wirkgeschichte aufzuzeigen, wäre eine ebenso reizvolle wie schwierige Aufgabe.
Kunze hätte sich damit begnügen und seine Kraft darauf richten können, die Balance zwischen Kritik und scheinbarer Staatsbejahung (eine Technik, die einige DDR-Autoren virtuos beherrschten) zu halten. Er tat es nicht: Mehr als die Wirkung galt ihm die Wahrheit. Die wunderbaren Jahre zerstörten die Schranke, vor der einer noch als staatsfördernder Autor gelten konnte. Die Honecker und Hager begriffen, daß sie den Zeitgeist nicht durch Nachsicht lenken, und meinten, daß sie ihn durch Härte prägen könnten. Da sie Biermann aussperrten, mußten sie auch Kunze hinausweisen.
Der Zufall wollte, daß ich vier Jahre nach seiner Vertreibung aus dieser vogtländischen Stadt nach Greiz zog. Meine Fenster sahen zur Hügelhöhe, auf der er gewohnt hatte. Menschen, Häuser, Begebenheiten erinnerten an ihn. Ich versuchte nicht, sein Erbe zu sein. Keiner hätte an seine Stelle treten können, denn Kunze war, vor allem in Greiz, nicht nur ein Mensch und ein Name, sondern weit mehr ein Mythos und eine Institution.
Weil er das Wort für viele, die wortlos blieben, wog, wurde er für sie zu einer Instanz, deren Existenz wichtiger war als ihr Wort. Auch das ist Dialektik, wie sie das Leben erfunden hat, ein Leben, das nimmt, indem es erfüllt, und erfüllt, indem es sich verweigert.
Wir wußten Kunze in seiner Obernzeller Ferne hinter einer Grenze, die sowohl für uns als auch für ihn unüberschreitbar war. Dann und wann schrieben wir und erhielten als Antwort einen Brief mit dem unverwechselbaren blauen Siegel. Als die Mauer fiel, sahen wir uns wieder – in Greiz. Wo sonst? Sein Einzug glich einem Triumph. Er mißtraute Triumphen. Er wußte, eine solche Begeisterung wahrte nicht das rechte Maß für ein leises, vom Schweigen ertrotztes Wort. Denn Dialektik findet kein Ende. Im geeinten Deutschland wächst die durch vieles Wissen bereicherte Unwissenheit – ohne Schulung, auf natürlichem Wege.
Reiner Kunze wird 65 Jahre alt. Ich möchte wieder eine Tasse Jasmintee mit ihm trinken, meine Traurigkeit ablegen – und schweigen.
Uwe Grüning, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Eine Beschämung
Und hinter der herzwand,
geballt,
diese Jahre
Reiner Kunze
So war das also. Nach dem 14. April 1977 also, nachdem Reiner Kunze gegangen war, gehen mußte, nicht mehr hatte bleiben können unter den gegebenen Verhältnissen, kurz danach muß es gewesen sein. Wir blieben noch ein weniges länger hocken in der DDR. In meinem Fall zehn Jahre, um genau zu sein. Wir waren jung. An den Türen unserer Noch-Kinderzimmer oder über den Matratzen, die uns als Betten dienten in den ersten eigenen Buden, klebte der Zettel mit der „Einladung zu einer Tasse Jasmintee“. Dahinter oder darunter saßen wir, schwiegen selten, formulierten im Kreis herum immer neu dasselbe, unsere Situation, von der Reiner Kunze etwas gewußt haben muß.
1977 also saßen wir vor den Fernsehgeräten, vor dem eigentlich ausgedienten Staßfurt-Gerät oder dem sowjetischen Kofferfernseher, so oder so eine Überlassenschaft älterer Verwandter oder Freunde. Reiner Kunze auf der Mattscheibe mit einem Gesprächspartner, den wir alle vom flüchtigen Hinsehen kannten und selbstverständlich verabscheuten, in jener Sendung, die wir nur als das westdeutsche Gegenstück zum „Schwarzen Kanal“ kannten. Das unangenehme Flackern einer unangenehmen Schallkurve auf unangenehm drängender Musik diente ihr zum Vorspann. Das, was nun kam, war ,rechts‘, konnte nur ,rechts‘ sein, aus unserer Perspektive politisch ebenso fragwürdig wie die Lügen des Neuen Deutschland. In dieser Sendung also sahen wir Reiner Kunze wieder oder zum erstenmal sein Gesicht, den Dichter der geliebten gelb blühenden Eisblumen, den Schöpfer der Szenen wunderbarer Jahre, die wir als soundsovielte Abschrift ohne Absender in unseren Briefkästen gefunden hatten. Auf dem falschen Stuhl, im falschen Studio, mit dem falschen Journalisten. Oder trügt meine Erinnerung?
Doch nicht genug mit diesem Bild, das wir ohne Worte sahen, auf dessen Worte wir nicht hören konnten, weil unser politisches Weltbild schwarz-weiß blieb wie der Bildschirm der Fernsehgeräte. Wer hatte uns eigentlich gesteckt bzw. woher nahmen wir die „Information“, Reiner Kunze hätte ein Haus in Bayern von der CSU geschenkt bekommen? Die Nachricht war da. Wir sagten sie einander weiter. Wir sahen den Erzfeind Franz-Josef Strauß vor uns – mehr als Lederhosen und den kannten wir weder von Bayern noch von der dort regierenden Partei –, von dem Reiner Kunze sich also hatte kaufen lassen. Von der Reaktion.
Wahrscheinlich haben wir zu unserer Zeit nicht mehr dieses Wort gedacht, wahrscheinlich haben wir den naheliegenden Ausdruck mit einem anderen, mit unserem eigenen politischen Klischee-Wort kaschiert, doch meinten wir sicher dasselbe. Hinter der Mauer blühten diese perfekt staatskonformen Urteile, ungetrübt von eigener Anschauung, und standen unverrückbarer als manch anderes schöngeistiges Gut. Hier saßen wir, angehende Dichter, Künstler dem Selbstverständnis nach und dachten: Den kannst du jetzt vergessen. Reiner Kunze? Abgeschminkt. Und schauten traurig zurück auf die Gedichte des einzigen in der DDR erschienenen Bandes Brief mit blauem Siegel, kurze Gedichte, die im selben Moment in unseren Augen ein verdächtiges Stück kleiner wurden. Der Autor ein Verräter an unserer gemeinsamen Sache, die selbstverständlich die ,linke‘ war und bis zum Ende der DDR weitgehend blieb.
Oder übertreibe ich? Wie war es dann? In einschlägigen Protokollen und Briefen lesen wir, daß der große Schriftsteller Franz Fühmann gegenüber einem Herrn, dessen Anwesenheit an seinem Grab er sich später sogar testamentarisch verbitten sollte, im Schriftstellerverband der DDR allzu deutlich wurde, was seine Abneigung gegenüber Reiner Kunze betraf. Der Grund scheint der nämliche gewesen zu sein, wenn er auch ästhetische Bedenken in den Vordergrund stellte. 1982 nahm Fühmann den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München in Anwesenheit von Franz-Josef Strauß entgegen. Er kehrte mit relativierten Vorbehalten in die DDR zurück. Eine Mitteilung am Rande.
Die Erinnerung an die eigene Fehlleistung ist hier nur mit Beschämung zu notieren. Genug nachgelassene Unterlagen bestätigen den Stand unseres Bewußtseins damals. Unsere Klischees und unser allzeit wasserdicht historisch begründbarer Starrsinn haben es den Köchen von dieser Art Gerücht leicht gemacht. Es wurde von uns nicht nur hingenommen, sondern bereitwillig breitgetreten. Das Gerücht paßte in unser Weltbild. Worauf soll ich verweisen? Daß ich 1968 noch ein Kind war? Auf einen mehr oder minder zufälligen innerstaatlichen Frühling bei Honeckers Machtantritt Anfang der siebziger Jahre? Daß nur wenige von uns involviert waren in die Konsequenzen der Biermannausbürgerung bzw. daß diese oft anders als erwartet aussahen? Führte dieser Einschnitt in das geistige Leben des Ländchens nicht gerade bei einigen von uns zu einer deutlichen Entpolitisierung?
Wir im Osten waren ja auch nicht allein mit der tief verinnerlichten Maxime „Sozialismus oder Barbarei“. Gehörige Teile der westdeutschen Elite standen gleichauf mit uns. Das Stasi-Kalkül nach Kunzes Ausreise, „IM auszuwählen“ – in der Bundesrepublik! –, „die in der Lage sind…, in westlichen Massenmedien über Kunze zu publizieren und seine Äußerungen zur DDR in Zweifel zu ziehen“, es war in dieser Form vielleicht gar nicht nötig. Ganz offiziell, ganz freiwillig, ohne geheimdienstlichen Auftrag mußte es vielen Mitgliedern z.B. des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) ein Bedürfnis sein, sich von Kunze zu distanzieren.
In die geistige Landschaft der Bundesrepublik paßte der Dissident insbesondere nicht, wenn er aus der DDR kam. Wenn er wirklich einer war, verriet er ja die gemeinsame Utopie des dritten Weges zwischen den beiden ,real existierenden‘ Systemen. In den meisten Köpfen aber lag dieses Dritte bedeutend näher an der breiten Schneise einer Stalinallee als an der mühseligen Straße der bürgerlichen Demokratie.
Von heutigen Auseinandersetzungen ist hier nicht die Rede. Von aktuellen politischen Konstellationen auch nicht. Ich wollte nur eine Erinnerung nachtragen, die Reiner Kunze gewidmet ist als eine persönliche Entschuldigung. Und ich sage ihm Dank für seine zarte Poesie.
Kleiner Nachtrag: Nach einer öffentlichen Lesung in einem Ostberliner Jugendclub Ende der siebziger Jahre brachte mir jemand eine dampfende Tasse mit einer hellen Flüssigkeit darin und sagte „einen schönen Gruß von Reiner Kunze“ dazu. Es war die erste Tasse Jasmintee, die ich in meinem Leben getrunken habe. Ich erspare es mir, wegen des genauen Datums den Spitzelbericht herauszusuchen.
Uwe Kolbe, aus: Marek Zybura (Hrsg.): Mit dem wort am leben hängen… Reiner Kunze zum 65. Geburtstag, Universitätsverlag C. Winter, 1998
Böhmische Dörfer
– Poesie in politischer Landschaft: Sieben Variationen über den Dichter Reiner Kunze. –
Ein Vers, und ein Leben verläßt seine Bahn, um auf eine andre, gegenläufige, zu springen? – Ach. – Entwicklungen sind unwiederholbar; und wenn sie geschehen sind, wie sie geschehen sind, scheint ein „was wäre wenn?“ nur müßig; allein die Frage ist nun einmal gestellt.
Franz Fühmann: Vor Feuerschlünden, 1984
1 Der Wald
Reiner Kunze ist ein Dichter, über den jeder deutsche Literaturbetriebler sofort ein Urteil, garantiert zwei Sottisen und mindestens drei Gerüchte zu bieten hat – im Regelfall alles auf einmal. Ein Brei von Wertungen schiebt sich fort, der nicht verschwinden will, nachdem das politische Töpfchen, dem er entsprang, zu kochen aufhörte. Wer sich vornimmt, über das Werk Reiner Kunzes zu sprechen, gerät mithin in ein Dilemma: Noch bevor er betrachtet, soll er sich entscheiden müssen: ästhetisch, politisch – nicht für oder gegen Reiner Kunzes Dichtung, sondern für oder gegen den Dichter.
Diese Zumutung hat Folgen: Es ist über Reiner Kunze nicht zu reden, wird der im Fall dieses Dichters einst so reibungsarm kompatible Ost-West-Kulturbetrieb nicht mitverhandelt. Erst dort, wo das Kalkül und das Ressentiment nicht sind, wird der Lyriker sichtbar und ein Werk, das Variationen zu einem Thema bietet: Dichtung in politischer Landschaft. Diese Landschaft ist eine Landschaft der Kränkungen; die kritischen Wälder rauschen, gemischte Gefühle gehen um.
2 Der Osten
Reiner Kunze, 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geboren, gehört zur sogenannten „Dritten Generation“ der DDR-Lyriker. Die Generation, die auf Becher und Brecht, geboren um 1900, und auf Hermlin und Bobrowski, die Jahrgänge 1910 bis 1925, folgt, versammelt die in den 30er Jahren geborenen Schriftsteller. Angefangen bei Günter Kunert, Jahrgang 1929, finden sich hier Autoren wie Rainer und Sarah Kirsch, Karl Mickel und Richard Leising, Volker Braun und Heinz Czechowski, Kurt Bartsch und Bernd Jentzsch, Wolf Biermann – 1953 von West nach Ost gelaufen – nicht zu vergessen. Es werden diese Autoren sein, die der Lyrik der DDR ihre goldenen, ja recht eigentlich klassischen Jahre bescheren, samt „Sächsischer Dichterschule“ und „Lyrikwelle“, die von 1962 an über die Bezirksstädte schwappt. Die „Dritte Generation“ feiert ihr poetisches Klassentreffen in der Lyrik-Anthologie In diesem besseren Land, 1966 herausgegeben von Adolf Endler und Karl Mickel. In dieser Anthologie ist Reiner Kunze nicht zu finden. Wie noch so oft: Kunze paßt nicht. Zu kleine, zu schlichte, zu herznahe Gegenstände, lautet das Urteil, kurzum: zu lapidar. Diese Anthologie zielt auf anderes: auf große Dinge in großer Form; auf Weltall, Erde, Mensch; hier gehen vor Selbstbewußtsein torkelnde Stürmer und Dränger ans Werk:
Jung, nicht von Kriegen entstellt, Herrn ihres meßbaren Tags (Rainer Kirsch).
Dabei hatte einst alles so ideologisch lupenrein begonnen. Reiner Kunze wächst als Sohn eines Bergmannes und einer Heimarbeiterin auf, in den Augen der Ostberliner Staatslenker eine quasi heilige Familie. Der Vater Ernst Kunze, Jahrgang 1907, stillt sein Schönheitsbedürfnis im Schmücken des Weihnachtsbaumes; Bücher sind im Haushalt nicht zu finden. In der Landschaft der Halden und Schlammgruben ist Reiner Kunze ein Ausscherer, ein musischer Eskapist, der lieber Bücher statt Kohlen „liest“, der von früh an zeichnet und Violine spielt. Sollte es zutreffen, daß Landschaft auf die seelische Verfaßtheit eines Menschen durchschlägt, bringt Reiner Kunze aus seiner Kindheit mit: eine Sehnsucht, die weniger auf Verwandlung als auf Erlösung zielt, einen hohen empfindsamen Ernst, eine Genauigkeit, die zur Strenge neigt und ein wie dem Schweigen abgerungenes Sprechen.
Das Erzgebirge wird für Reiner Kunze eine poetisch weithin unbeackerte Landschaft bleiben. Eine kleine Zahl von Prosaminiaturen ruft die Gestalt des Großvaters Richard auf, veröffentlicht im 1992er Tagebuch Am Sonnenhang. Es gibt das Gedicht „nachtmahl auf dem acker“ von 1997, das das Kind zur Nacht auf dem Felde in Betrachtung des Mondes zeigt:
Ich war noch nicht Adam
und großvater ähnelte gott
Damals, als ich noch vom himmel aß
Das in den 50er Jahren entstandene Gedicht „antwort“ beschwört die Herkunft, um den Dichter zu verteidigen:
Mein vater, sagt ihr,
mein vater im schacht
habe risse im rücken,
narben,
grindige spuren niedergegangenen gesteins,
ich aber, ich
sänge die liebe
Ich sage:
eben deshalb
Kunze geht den Weg durch die Institutionen. Der Schüler besucht jene Aufbauklassen, die – nach Kriegsende in der Sowjetischen Besatzungszone eingerichtet – den Arbeiterkindern eine höhere Bildung versprechen. Mit 16 tritt Reiner Kunze in die SED ein, er ist Internatsschüler im erzgebirgischen Stollberg. Dem Abitur folgt das Studium der Philosophie und Publizistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Das Institut für Publizistik, 1954 umgewidmet in Fakultät für Journalistik, trägt den Spottnamen „Rotes Kloster“. Der Hilfsassistent Reiner Kunze ist, allen inneren Kämpfen zum Trotz, nach außen hin ganz ein Mann des Apparates; daß es so gewesen ist, bereitet Reiner Kunze hochnotpeinliche Erinnerungen bis heute.
Erste Gedichte erscheinen 1953, die tragen Titel wie „Unsere Straße“ und „Mohr“, der Kosename von Karl Marx. Kunzes frühe Verse sind beispielhafter Agitprop: einfache Sprache, kurze Diktion, originelle Idee, kritischer Gestus, der zur frischfromm – fröhlichen Selbstanpassung überreden soll. 1955 absolviert Kunze das Staatsexamen, verbleibt als Wissenschaftlicher Assistent in Leipzig, hält Vorlesungen zu Fragen des Feuilletons. Kunze dient mit dem Ziel der Promotion – dazu soll es nicht kommen. 1959 wird dem linkssentimentalischen Sprosser der innerbetriebliche Prozeß gemacht: In seinen Liebesgedichten fehle der Klassenstandpunkt, heißt es, wer so schreibt „entpolitisiere“ die Studenten. Für den Dozenten Reiner Kunze geht es ein letztes Mal um alles und Kunze geht ab – als Hilfsschlosser „in die Produktion“.
Über die Hintergründe dieses Abgangs hat Reiner Kunze in zahlreichen Gesprächen berichtet. Den in der Edition Toni Pongratz veröffentlichten Interviews eignet der Charakter geistiger Übungen: Jedes Wort ist gesetzt, jede Wertung durchlitten, literarische Motti stehen als Themen-Anzeiger vorab. Kunze nimmt ernst, er nimmt sich ernst und er trägt nach, was sonst nicht auf den Tisch kommt; so trägt er Probleme ab, die manchem Kollegen entweder ein Schulterzucken oder rückwirkend die Vergoldung als Material wert sind.
1987 fragt der Journalist Andre Müller den Dramatiker Heiner Müller: „Glauben Sie, daß Leidensfähigkeit eine Berufsqualität des Genies ist?“ „Nein, um Gottes willen“, antwortet der Schriftsteller, „davon halte ich überhaupt nichts. Darüber müßten sie mit Reiner Kunze ein Interview machen. Ich glaube, der leidet. Bei mir sind die Probleme das Material meiner Arbeit. Also habe ich keine. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich je depressiv war.“
Reiner Kunze sucht das Leiden nicht; allein es ist ihm unmöglich, aus Qual Lust zu schlagen: Er setzt die Lust gegen das Qualvolle, auch gegen das zuweilen Selbstquälende. Über das Jahr 1956 hinaus lockern sich seine marxistischen Welt-Halterungen; 1959 reißen sie abrupt. Noch einmal beschwört Reiner Kunze Herkunft als Verpflichtung:
ausgesperrt aus büchern
ausgesperrt aus zeitungen
ausgesperrt aus sälen
eingesperrt in dieses land
das ich wieder und wieder wählen werde
(„dreiblick“, 1965)
gemeint ist hier, sagt Reiner Kunze, die Landschaft, nicht der Staat. Als 1968 dessen Öffentlichkeit für Reiner Kunze keinen Raum mehr bietet, liest der Schriftsteller fortan fast nur noch in Kirchen; Veranstaltungen religiösen Charakters müssen nicht genehmigt werden. Für die künftige Pointierung, daß Reiner Kunze eher eine „Gemeinde“ als ein Publikum um sich schare, ist auch hier eine Ursache zu finden. Der Vorwurf der politischen Gruppenbildung schlägt bald als Polemik ins Ästhetische um. Immer nachdrücklicher findet Kunze den Weg zu Texten von ungewöhnlicher Kürze, aufgeladen mit dem Doppelsinn der Sprache des Samisdat. Der Dichter entdeckt Camus, der in bejahender „Klarheit“ auf die Erfahrung des Absurden zu antworten sucht. In der Haltlosigkeit der Verhältnisse zählt allein die Haltung des Einzelnen.
Ist Reiner Kunze überhaupt ein „DDR-Schrifsteller“ gewesen? Er selbst empfindet sich in der DDR, wie übrigens auch seine Generationsgenossen aus „diesem besseren Land“, als ein deutscher, nicht als ein ostdeutscher Dichter. Die Bücher seiner juvenil-marxistischen Phase zur Seite geschoben, gelangt (abgesehen vom Poesiealbum 1968) von den zwischen 1963 und 1978 in Greiz entstandenen sieben Büchern eines an das Licht der DDR-Öffentlichkeit – die nicht beworbene Anthologie Brief mit blauem Siegel von 1973.
Kunzes Mitgliedschaft im DDR-Schriftstellerverband, die im Oktober 1976 mit dem Rauswurf endet, hat allein arbeits- und steuerrechtliche Gründe. Weder ist Kunze in den Ost-West-Zirkeln der Hauptstadt zu finden, noch – wie sich bei der Biermann-Petition zeigt – in den Verteilern der literarischen DDR-Elite. Von Greiz aus spannt dieser Autor sein Netz – auf dem Postweg, über drei hart erstrittene Westreisen, über ein Lesevolk, das mit Schlafsäcken bis in des Dichters Wohnung vorrückt. Trotzdem schafft es Reiner Kunze, einer der populärsten Schriftsteller in den Grenzen der DDR zu werden; so „populäääär“ wie Wolf Biermann, dem er in herzlicher Solidarität verbunden ist, auch wenn sich Biermann, „der systemimmanente Kumpel“ (Hans Egon Holthusen), an der besseren Umsetzung einer Ideologie abarbeitet, die Kunze für sich selbst längst verabschiedet hat.
Biermanns „Zukunftsvisionen“, erklärt Reiner Kunze 1974 in der Süddeutschen Zeitung, halte er für „politische Fata Morganen“, was aber – im Blick auf die DDR – nichts daran ändere, „daß er Lieder geschrieben hat, von denen ich uns eine Schallplatte wünschte von einer Million Auflage“. Biermann widmet dem befreundeten Nicht-Genossen jenes Lied, das mit dem schlagenden Refrain endet:
Ach du, ach, das ist dumm:
Wer sich nicht in Gefahr begibt
– der kommt drin um
Aber wer ist es, der sich hier nicht in Gefahr begibt? Der Song, der im Untertitel „Selbstportrait für Reiner Kunze“ heißt, wird als „Kunze-Lied“ populär.
Allein, es gibt in der DDR vor der DDR kein Entkommen; der Westen hat daran keine geringe Aktie. Der Status Quo West spiegelt sich im Provisorium Ost – und umgekehrt, beide Systeme ziehen aus einander ihre intellektuelle Legitimation. Dabei ist, aller punktuellen Heiterkeit zum Trotz, die ostdeutsche Selbstverständigung ohne eine Spur von Vergeblichkeit nicht zu haben; es war ja in der Tendenz über die DDR zu jedem Zeitpunkt eigentlich immer schon alles gesagt. Die Plattform der „Dritten Generation“ erweist sich als eine rasant rotierende Scheibe, die ihr Personal in alle Himmels- und Ideen-Richtungen schleudern soll.
Heinz Czechowski, Kunze-Kollege der „Dritten Generation“ und heute seßhaft in Frankfurt am Main, schreibt in der 70er-Jahre-DDR – wie um gegen den Verlust anzusteuern – das Gedicht „An Freund und Feind“. Czechowski zitiert die Welthaltung der Freunde Endler und Mickel, Sarah und Rainer Kirsch – und Reiner Kunze:
Wir schreiben uns
Briefe mit blauen Siegeln.
Wer aber
Soll das rezensieren?
Ja, wer? Interessanter ist diese Frage:
Wie wir das lesen
Ist unsere Sache:
Jeder gegen jeden, noch immer?
Nach 1989 und im Blick auf Reiner Kunzes Wirkung wird auch das zu lernen sein: Alle politischen Fragen sind im Kern Charakterfragen.
3 Böhmen
Läge Böhmen am Meer, der deutsche Dichter Reiner Kunze wäre ein Seemann, ein Alleinsegler, mit allen böhmischen Wassern gewaschen. Keine zweite Landschaft hat diesen Schriftsteller so nachhaltig umsponnen, erweckt und bewegt: Reiner Kunze, ein sächsischer Bohemien? Böhmen, das steht hier als Chiffre für die poetische, geistige und politische Landschaft der Tschechen; es steht für Weltoffenheit, Neugier, Liberalität. So ein kleines Volk sucht ja, weil es muß, seinen dritten Weg zwischen den politischen und ästhetischen Bastionen: in der Literatur der 20er Jahre als ein vom Surrealismus inspirierter Poetismus, in der Politik der 60er Jahre als „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“. „Ich hatte nichts bei mir außer / meinem hunger nach der welt“, schreibt Reiner Kunze, ein touristischer DDR-Flüchter von 33 Jahren, in seiner „kleinen reisesonate“, verfaßt 1966.
Wie der hahn durchs zaunloch,
geduckt, den schnabel fast
am boden, die flügel
angelegt, so
zwängte ich mich
unter dem schlagbaum hindurch
In Böhmen wird Kunze ein Mann jener dritten Wege, die ihre Richtung zwischen den jeweils gültigen Hauptstraßen suchen: ästhetisch, politisch und kulturell. Nicht um Prägungen geht es hier (die hat Kunze hinter sich), sondern um Ausprägungen; nicht um ein Neues, sondern um ein Anderes; es geht nicht um Haltungen, sondern um Farben, Gesten, Stoffe.
Böhmen liefert für Reiner Kunze den Vorschein einer neuen Existenz. Dieser Landschaft verdankt er sein Leben – ein Satz, ganz ohne Tremolo zu sprechen. Kunze findet Abstand zur eigenen, ideologiedurchwalkten Geschichte, er findet einen Selbstbegriff als Dichter und – eine neue Liebe, drehbuchreif. Eine junge Ärztin im tschechischen Aussig hört 1959 einige Verse Kunzes im Rundfunk der DDR. Die Frau bittet den Sender um die Zusendung eines Gedichtes. Die Karte, in tadellosem Deutsch verfaßt, erreicht den Autor und läßt einen Briefwechsel anheben, der auf über vierhundert Briefe anwachsen soll, teilweise fünfundzwanzig Seiten lang. Man kann einander nicht begegnen, die Grenzen sind geschlossen; nur ein Foto kennt der Dichter, das zeigt seine Herzdame im Alter von siebzehn Jahren. Am Telefon bejaht Elisabeth Littnerová den Heiratsantrag Kunzes. Eine Intervention des tschechischen Schriftstellerverbandes beim DDR-Kulturminister bringt die offizielle Erlaubnis auf den Weg. Geheiratet wird in Aussig im Juli 1961, im Jahr darauf zieht die Familie nach Thüringen.
In Greiz beginnt das zweite Leben Reiner Kunzes. Eine Sammlung von fliegenden, samisdatähnlich verteilten Versen und Prosastücken entsteht. Das sind in Folge: der Gedichtband widmungen, Kunzes „Opus eins“, 1963 erschienen im kleinen Bad Godesberger Hohwacht Verlag. Bernd Jentzsch gibt 1968 in Ostberlin das Poesiealbum 11 heraus. Es folgen drei Lyrikbände, die Literaturgeschichte schreiben sollen: sensible wege, 1969 bei Rowohlt in Reinbek, zimmerlautstärke, 1972 bei S. Fischer, Frankfurt am Main, und die Auswahl Brief mit blauem Siegel, 1973 im Leipziger Reclam Verlag. Das Kinderbuch Der Löwe Leopold. Fast Märchen, fast Geschichten erscheint 1970 bei S. Fischer, die Ausgabe des Ostberliner Kinderbuchverlages wird vor der Auslieferung eingestampft. Der Prosaband Die wunderbaren Jahre folgt 1976 bei S. Fischer, ein Skandalon mit Folgen. Und wie nebenbei etabliert sich Reiner Kunze als einer der wichtigsten und engagiertesten deutschen Nachdichter aus dem Tschechischen – neben Autoren wie Franz Fühmann, Uwe Grüning, Heinz Czechowski, Roland Erb. Kunze überträgt Gedichte von Vladimír Holan, Jan Skácel, Jaroslav Seifert, Dramen von Ludvík und Milan Kundera, Erzählungen für Kinder, Prosagedichte von Vít Obrtel.
In den politischen Zirkeln Böhmens findet Reiner Kunze das Beispiel einer pragmatischen Weltzuwendung, in der tschechischen und slowakischen Lyrik ein Gegenmittel zu einer Literatur, die auf den Sätteln der großen gesellschaftspolitischen Verkündigung davontrabt. Der Prager Poetismus wurzelt nicht allein in der barocken tschechischen Volkspoesie, sondern auch in der Bildwelt der spanischen und französischen Moderne. Dessen Metaphorik, sagt Kunze, sei „eher wehmütig, melancholisch und von großer menschlicher Wärme“.
Der Autor, der sich einst fast für ein Studium der Bildenden Kunst entschieden hätte, zeigt sich begeistert von einer Schriftkultur, in der „die Dichter immer mit den Malern zogen“ (František Halas). Spielfreude und Weltzauber in bejahender, nicht auftrumpfender Helligkeit, sind die Attribute dieser Dichtung – Kunze macht sie sich zu eigen. Im 1964er Vorwort zur tschechischen Ausgabe des Gedichtbandes Widmungen schreibt Milan Kundera, daß das poetische Denken Reiner Kunzes, „das bis dahin vielleicht zu rational-logisch war“, in Böhmen „mit Fleisch und Blut und Wärme“ gefüllt wurde.
Dabei ist es der Gegen-Poetist František Halas (1901–1949), der Kunze am nachhaltigsten beeinflussen soll: seine Anrufung des kostbaren Lebens, die bis zur Formelhaftigkeit verdichteten Verse. In der Tschechoslowakei erkennt Kunze seine literarische Heimat – keine Sächsische, sondern eine Böhmische Dichterschule. Im 1967er Gedicht „bei E. in Vřesice“ malt Reiner Kunze einen Nachmittag von „löwenzahnwein“-trunkener Heiterkeit:
Er nahm uns auf die töpferscheibe
und formte krüge aus uns
Skácel fiel barock aus
wie der zwiebelturm von Sulíkov
Kundera geriet auf eigenen wunsch
dreieckig (kunststück)
Unterm sanften druck der hände wurde ich
ein krug aus Mähren
In den 60er Jahren liest Kunze wieder holt in Aussig, Karlsbad und Prag, ist Gast der tschechischen und ungarischen Kulturhäuser in Ostberlin. Mit dem Niederwalzen des „Prager Frühlings“ fällt die Tür zur DDR-Nomenklatura ins Schloß. Reiner Kunze taucht im Haus des Pfarrers Hans-Joachim Wuth in Ponitz bei Meerane unter:
Wer da bedrängt ist findet
mauern, ein
dach und
muß nicht beten
(„pfarrhaus. Für pfarrer W.“)
Zurückgekehrt an den Schreibtisch, erscheint 1969 bei Rowohlt der Gedichtband sensible wege mit der Widmung „dem tschechischen volk, dem slowakischen volk“, diese Zueignung bleibt – und nicht allein, weil sie unter den Bedingungen der DDR geschrieben wurde – keine Kleinigkeit.
4 Das Herz
Daß nur der gut schreibt, der nicht mit dem Herzen malt, gilt als ein literaturkritisches Ressentiment: im Hoheitsgebiet dieses Vorurteils wird der Dichter Reiner Kunze gern öffentlich vorgeführt: Der Kitsch-Verdacht liegt nahe, der hohe Ton, das nur „Geschmackvolle“. Tatsächlich gibt es Diskretionszonen, die von einem fremden Du nicht berührt, nicht angeschwärmt werden wollen. Reiner Kunze ist ein Dichter, der sich von solcherart Ängstlichkeiten nicht in die Deckung treiben läßt. Er verteidigt den eigenen Herzton wie die Poesie, er sucht den reinen, nicht den hohen Ton. Reiner Kunze kann verehren und er scheut sich nicht, dieses Verehrenkönnen auszustellen. Das „Schöne“ gilt ihm nicht als eine Erfahrung, der ein abwertendes „nur“ voranzusetzen ist. Unbeirrt steht Kunze an der Herzlinie der populären deutschen Dichtung, kein naiver, sondern ein sentimentalischer Autor ist er; einer, der sein Handwerk zudem früh an literarischen Feuilletons erprobt hat: Auch hier findet das Spruchhafte, Pointierte, wie beiläufig Arrangierte eine Herkunft – das Anrühren durch kluge Gefühle.
Leuchtspurige Begriffe wie „Rose„ und „Brücke“, „Glocke„ und „Hahn“ durchblitzen die Verswelt Reiner Kunzes. Die Rose „schlägt ihre wurzeln in den augen“ („die liebe“), die Brücken überschlagen „wie die liebenden die nacht“ („die brücken von Budapest“), „das glöckchen klingt / als schmiede der mesner den Sonntag“ („das kirchlein St. Peter zu Pyrawang“) und die Hähne tragen „kleine stimmbrüche durch die wiese“ („junge hähne“). Das ist bestes volksliednahes Dekor, das sind handwarme Ornamente, die jeden Vers sofort hochgradig mit Poesie aufladen. Allesamt sind es muntere, appellhafte Chiffren für Schönheit und Jugend, Geselligkeit und Kunst, kurzum es sind Zielbegriffe der populären Läuterungs-Poetik Reiner Kunzes.
Wo nichts im Großen zu retten ist, rettet das Herz allein: das tiefe Gespräch, der große Gesang, der Einklang mit allen Dingen – und die Schönheit. Der junge ist in dieser Sache bereits ganz der Nach-59er-Kunze: Ein frühes, heiter agitierendes Gedicht beschreibt, wie der Mörtel an den Mantel des Dichters kam: „mein herz / hat ihn von der wand gepocht“. Im Nachwort seiner Anthologie Kreise ziehen (1974) zitiert der Ostberliner Feuilletonist Heinz Knobloch aus einer Leipziger Vorlesung Reiner Kunzes: der Dozent wehrt sich gegen die Vorschrift, eine Blume habe in einer Zeitung nichts zu suchen:
Hilft es uns vielleicht in unserem politischen Kampf vorwärts? Ja, wenn die Blume vor einem Landambulatorium blühen würde, wäre das natürlich etwas anderes.
Gesellschaftskritik, durch die Blaue Blume gesprochen.
Bereits in den 50er Jahren, aus denen heute gern Kunzes halbstarke Verse im Stile Majakowskis herbeizitiert werden, ist der Dichter Kunze recht eigentlich mehr ein Sänger als ein scharf tönender Trommler. Anfang der 60er Jahre wird Reiner Kunze, was heute weithin vergessen ist, vor allem als Verfasser von Liebeslyrik gefeiert. Nicht zufällig porträtiert Volker Braun in seinem Kunze-Gedicht „R.“ den Kollegen, in dem er dessen Herz beschreibt:
Er hat ein Herz, wie es die Liebenden malen (…) es pocht den vollen Bogen der Lust aus
Wo Politisches berührt wird, ist bei Braun nicht etwa von einem mündigen Renegaten die Rede, sondern von einem Naturburschen, dem das Herz übervoll ist. Braun fragt:
Darf auch nur ein Mensch
Allein treiben im Schiff seiner Lust?
Darf auch nur ein Mensch
Fliegen am Mast seiner Ungeduld?
Aber Kunze schlägt keine Laune aufs Herz, sondern das, was in der DDR offiziell als revolutionäre Geduld gilt: die hohle eiserne Langmut des Apparates. Volker Braun, deklamatorisch:
Und sein Herz litt Not, kämpfte, quälte sich
Mitten unter uns, sein Name war uns bekannt
Daß sein Name bekannt war, soll Kunze offiziell nichts nützen; er tritt zur Seite zurück in die Provinz, bevor er ganz aus dem Staat DDR austritt. Nach dem Kehraus der Ideologeme setzt Kunze weiter auf das weltnah Optimistische; mit allem gebotenen Ernst – lässiger Humor ist bei ihm nicht zu haben. Dieser Dichter ist altmodisch insofern, als er mit dem Entsetzen nicht Spott zu treiben vermag. Um die Wahrheit der Schönheit geht es fortan, um Notwendiges und Befreiendes; es geht um Halt und Haltung aus unterschiedlichen Motiven und Quellen. Sehr oft wird lebensführende Orientierung gesucht in Kunzes Versen – oder gegeben; dabei kann der Autor den Lehrer, der er nach eigenem Bekunden stets gerne gewesen ist, als Dichter nicht verleugnen. Im 1986er Gedichtband eines jeden einziges leben ist ein Motto des Kunze-Lehrers Camus zu finden:
Es herrscht das Absurde, und die Liebe rettet davor.
Hier schreibt einer Verse wie Konfessionen, Handreichungen für jedermann.
5 Die Post
Wenn die post
hinters fenster fährt blühn
die eisblumen gelb
So malt dieser Dichter, farbecht und versfest, leichthändig fast, ohne ein Leichthin: Das ist beste Reiner Kunzesche Poeterey. Die 1967 entstandenen 21 „variationen über das thema ,die post‘“ sind ein Evergreen des Kunze-Repertoires, schlanke Schlager für Lyrikleser. Strophe für Strophe bauen sich auf: ein Moment, ein Bild, eine Idee und die Welt, die das Wort-Gewebe zusammenhält. Von welchem Schiwago-Winter ist hier von welchem Ort aus die Rede? Von welchem Frost, den welche Nachricht zum Blühen bringen kann?
In diesen drei Verszeilen schon ist der Dichter Kunze ganz enthalten: seine Sucht nach Schönheit, seine Sehnsucht nach Abschottung, dieses scheue, dabei munter Signale klopfende Herz, die Diktion des Echtweltmalers und die des epigrammatischen Auf-den-Punkt-Bringers, die Liebe zur realen und zur phantasmagorischen Landschaft, zu der die böhmische Literatur unbedingt gehört. Nicht zufällig ist ein Anklang an ein Gedicht Jiri Wolkers (1900–1924) zu entdecken, des immerjungen Mannes der böhmischen Poesie von links. Das Gedicht heißt „Der Briefkasten“, seine erste Strophe lautet in der Übersetzung von Odwin Quast:
Der Briefkasten an der Straßenecke
ist nicht einfach irgendein Ding.
Er blüht blau,
und alle Leute sind ihm zugetan,
vertrauen sich ihm gänzlich an,
werfen Briefe hinein von zwei Seiten,
von der einen die traurigen, von der andern die heitren.
Briefe, lesbar von zwei Seiten: Reiner Kunzes Post-Variationen sind in der DDR wirkmächtige Kunststücke und zielgenaue Kassiber, deren Vortrag für spontanen Beifall sorgt: Das ist „Flüsterkunst“ (Peter Rühmkorf) allein in dem Sinne, in dem eine jede Lyrik „Flüsterkunst“ ist und eben keine Betriebsanweisung. Wie diese Lyrik wirkte, ist heute nachzulesen in einer Stasi-Notiz von 1971. Beschrieben wird eine Lesung in der Evangelischen Studentengemeinde in Halle an der Saale am 28. April. Der Spitzel, überfordert auch hier, gibt zu Protokoll:
Den Lyrikabend gestaltete Herr Kunze, ein Lyriker. Anwesend waren 400–500 Studenten (der große Saal der Stadtmission reichte nicht aus, es waren zusätzlich Stühle erforderlich)… Nach (der) Einführung las der Dichter… aus dem Zyklus „Einundzwanzig Variationen über das Thema – Die Post“. Diese Verse waren einigen Anwesenden schon von früheren Veranstaltungen her bekannt, so daß die Ankündigung mit lautem Beifall begrüßt wurde… Den Abschluß dieses Teiles bildete ein Vers folgenden Inhaltes: Eines Tages wird jemand bei mir klingeln und sagen: Ich bin der Briefträger… Ich werde jedoch die Verkleidung durchschauen und sagen: Warte, bis der richtige Briefträger… vorbei ist… Den Inhalt dieses Verses verstand ich nicht, und sprach deshalb nach Beendigung der Veranstaltung noch im Puschkin-Haus mit einem Studenten darüber und erhielt folgende Antwort: Jemand, der solche Sachen schreibt, weiß, daß es eines Tages klingelt und heißt: mitkommen! Das meint er.
Tatsächlich widmet Reiner Kunze die 21. Variation „Dem Tod“, wessen Auftauchen da aber auch gemeint sein könnte, begreifen die DDR-Kulturlenker sofort. Als 1973 die Gedichtauswahl Brief mit blauem Siegel (die wahrscheinlich erfolgreichste Lyrik-Edition in der DDR) in zwei nicht beworbenen, aber sofort vergriffenen Auflagen von jeweils 15.000 Exemplaren erscheint, gelangen von den 21 Variationen nur 13 zum Druck. Geschichten auch das, liegengeblieben im Nachlaß des „Leselandes“ DDR, das ein Auslese-Land war: die Guten ans (Ost-Fleisch-)Töpfchen, die Schlechten ins (West-)Kröpfchen oder – was in einem jeden Fall schwer zu erklären bleibt – mit einem Bein hier, dem anderen dort.
Reiner Kunzes Gedichte kommen vom Alltags-Erleben her, in dem er das buchstäblich Unerhörte freizulegen sucht:
(…) Doch als die wolke
die seilbahngondel einschließt, findet das staunen der mutter
zurück:
Wie wenn man einen kessel weißes wäscht und macht
die waschhaustür nicht auf
(„mit den eltern in den Alpen“)
Weder der oft strapazierte Hinweis auf japanische Stilmuster (die Kunze für sich erst nach zahlreichen Hinweisen nachschlägt), noch auf den Duktus der Brechtschen „Buckower Elegien“ führt hier weiter, und doch ist er berechtigt; auch Ungaretti wäre anzuführen, dessen Gedicht „Soldaten“ lautet:
So
wie im Herbst
am Baum
Blatt und Blatt
Wenn denn werk-biografische Linien gezogen werden sollen, führen sie in der Diktion zur epigrammatischen Lyrik bis hin zu Herder und Lessing, wenngleich ohne dessen Martialiät; im Blick auf Bilder und Farben zurück zur Volkspoesie, zur protestantischen Barocklyrik Böhmens, zum tschechischen Poetismus und – über diesen vermittelt – hin zum Bildgedicht der Prager und Pariser Surrealisten – alles das ist hier entfaltet auf dem Grundriß des in der Tendenz spruchhaften Gedichtes. „Die Poesie muß einfach sein“, sagt Reiner Kunze, „aber sie kann nicht einfacher sein, als es die Genauigkeit erlaubt.“ In dieser Formel findet Kunzes Dichtung ihr strukturelles Gesetz. Der Dichter bietet Stillleben und Standfotos, statische lichte Gedichte, aufgeladen mit hoher sozialer und emotionaler Energie.
Vor allem die den DDR-Alltag einfangenden Gedichte verfügen über soziale Tiefenschärfe; das gilt bis hin zu den nach 1977 im Westen veröffentlichten Bänden auf eigene hoffnung (1981) und eines jeden einziges leben (1986). Wer sprach denn sonst noch außer den abgegangenen Ostlern von Westen her Richtung Osten? „dezember“, entstanden 1966:
Stadt, fisch, reglos
stehst du in der tiefe
Zugefroren
der himmel über uns
(…)
Überwintern, das maul am grund
In solchen Versen überdauert die große graue DDR-Lähmung wie eisgekühlt; solche Verse konnten erden in der scheppernden Stille, als die der Staat den Leser umschloß. Kunze findet ein Publikum quer durch die sozialen Reihen; es ist keine Übertreibung (auch im Blick auf den Leserzulauf im Westen) von Reiner Kunze als einem Volksdichter zu sprechen. Verläßt Kunze den politisch-gesellschaftlichen Erlebnisraum, kommt er der Alltags-Dichtung des Jahrgangskollegen Uwe Greßmann (1933–1969) nahe.
Wie Greßmann ist Kunze ein Ding- und Welt-Sänger, wenn auch ohne Greßmanns zuweilen gern ins Unheimliche zielende Komik. Greßmanns Post-Gedicht zum Beispiel heißt „Reich des Todes“ und hebt an:
Und mancher, der postlagernd Briefe schicken ließ
Weil es zu Hause keiner wissen wollte,
Ging selber zur Post
Und wartete sein Leben
An den Schaltern.
(…)
Stephan Hermlin sagt über Greßmanns Gedichte „manche sind wundervoll“: so äußert er sich auch über Kunzes sensible wege. Auf dem politischen Pflaster werden andere Stimmen laut – und in einer anderen Tonart.
Wer im Osten den Dichter als Dichter abwerten will, ohne über die zerstörende Kraft des DDR-Literatursystems zu sprechen, nennt Reiner Kunze entweder einen Verfasser von „Kitsch“ – oder von „antikommunistischen“ Versen. Max Walter Schulz (1921–1991), 1969 Vize-Chef des DDR-Schriftstellerverbandes, holt auf dem Sechsten DDR-Schriftstellerkongreß zur wegweisenden Attacke gegen Kunze aus. Bei der Lektüre des Lyrikbandes sensible wege, erklärt Schulz, stelle sich ihm „der fatale lyrische Ort zwischen Innenweltschau und Antikommunismus in gestochener Schärfe“ dar. Das sei der „bei aller Sensibilität aktionslüsterne Individualismus“, der „mit der böswilligen Verzerrung des DDR-Bildes kollaboriert“.
Ein Klischee wird vorgeformt, das im Westen seine Entsprechung in der Erfindung des poetisierenden Privatiers findet oder im Wunschbild des reaktionären Preis-Lohndichters von christlich-sozialen Gnaden.
6 Der Westen
Dem Westen verdankt Reiner Kunze nicht weniger als seine öffentliche literarische Existenz, alle Nebenwirkungen inklusive. Im Bad Godesberger Hohwacht Verlag erscheint 1963 der Lyrikband widmungen. Das Buch verdankt sich einer Anfrage des Verlages, vom Autor freudig erwidert. So soll es bleiben: Kunze verlegt im Westen, nicht weil er im Westen verlegen will, sondern weil es allein der Westen ist, der den Dichter fragt, ob er denn etwas zu verlegen hat. Das Manuskript für den Gedichtband sensible wege liegt über zwei Jahre beim Ostberliner Aufbau Verlag, bis der es 1968 ohne Nennung von Gründen zurückreicht. Der Rowohlt Verlag fragt an, sagt Ja und läßt drucken; der Westen entdeckt den Dichter aus dem thüringischen Greiz – mit einigem Applaus.
Trotzdem wird Reiner Kunze im Blick auf seine ästhetischen und politischen Grundlegungen in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre ein Außenseiter bleiben – der Mann, der die Moden nicht teilt. Von ihm zugeneigten Journalisten als „Moralist“ gefeiert, steht Kunze neben dem intellektuellen Mainstream von links, der lieber weltanschaulich das Große Ganze verhandelt als lebensweltlich das kleine Gemeine. Kunze redet über die Zustände in der DDR, während der Westen sich angewöhnt, seine Ost-Wunschbilder als Realität zu nehmen.
Kunze setzt auf das kurze Gedicht, während der Westen beginnt, im „Langen Gedicht“ einem neuen gesellschaftlichen Selbstgefühl freie Bahn zu lassen; Walter Höllerer:
Der, der das lange Gedicht schreibt, gibt sich die Möglichkeit, die Welt auf liberalere Weise zu sehen (…) Er läßt die Republik spürbar werden, die Republik, die sich befreit.
Die Medien behandeln Kunze, wenn er denn nicht gerade einen Preis erhält, wie einen Patienten. Journalisten stellen ihm als Fragen präsentierte Diagnosen: Herr Kunze, sind Sie resigniert, haben Sie sich angepaßt, sind Sie ein Reaktionär?
Die politische offenbart sich als eine politisierte Landschaft: Politik setzt auf Lösungen, ihr Ort ist das Tatsächliche; Politisierung setzt auf Erregung, ihr Ort ist die Unterstellung – die Realität gerät aus dem Blick, die des Westens, die des Ostens. Wenn es denn auf den oberen Etagen des Meinungsgewerbes West ein Status-Risiko für den Einzelnen gegeben hat, dann war es das, die DDR-Verhältnisse ohne ideelle Weichzeichner abzubilden. Der Vorwurf des Notorischen ist sofort zur Stelle. Je mehr der Staat DDR sich zugrunde richtet, um so mehr wächst sein Ansehen in der politischen Klasse des Westens. Allein daß von der DDR aus „kein neuer Anfang für die Menschheit“ zu erwarten sei, erklärt Kunze in seinem ersten Interview nach der Ausreise im April 1977.
In einer Republik, deren Linke gerade erst definiert hatte, daß dieser Anfang von Westen aus erst recht nicht zu erwarten sei, macht Kunzes Position einsam; unter dem Strauß-Motto „ Freiheit statt Sozialismus“ hatte das Land einen hochgradig erhitzten Wahlkampf durchschritten. Kunzes Wort, daß manche Leute im Westen nicht wüßten, was sie haben, wird ihm nicht verziehen. So soll es bleiben: Man denkt an sich zuerst – und ist, wo das bedauert wird, nachhaltig verstimmt.
Das alles steht auf der Soll-Seite, auf der Haben-Seite stehen Freundschaften, Reisen und Preise, die Kunze bereits ab 1971 im Westen gewinnt. Das Jahr der Ausreise bietet eine Fülle von Ehrungen, die in der Summe einer Überforderung des Autors nahezukommen scheinen: zusammen mit Friederike Mayröcker der Trakl-Preis für Lyrik in Salzburg, Laudator: Ernst Jandl; Gryphius-Preis in Düsseldorf zusammen mit Rose Ausländer, im Oktober schließlich der Büchner-Preis, Laudator Heinrich Böll. Es zeigt sich im Rückblick, wie nah bei der Person, wie nah bei den Dingen Böll als Kritiker stets gewesen ist: in der Genauigkeit einfach, frei von intellektuellem Narzißmus, unbedingt unaufgeregt, unbedingt fair.
„Keine Blamage fürchtend“, sagt Böll in seiner Laudatio über den 76er Prosaband Die wunderbaren Jahre voraus, daß dieses Buch dem, „der zu lesen versteht, nicht nur zwischen den Zeilen, auch auf ihnen die Welten entdeckt, die sie tragen; der auch das kleinste Wort nicht übersieht, das Wimpernzucken der Sprache noch bemerkt, unbeirrt vom Gedröhn der Schlagzeilen – dem werden die Wunderbaren Jahre mehr Auskunft über Deutschland geben, mehr über das Schicksal der ČSSR als ganze Fluten von Propagandamaterial.“
Das galt noch bis zur Ausreise Reiner Kunzes als Konsens in der westdeutschen Literaturkritik; langsam beginnt die öffentliche Wertschätzung zu kippen, sie fällt endgültig, als die Verfilmung der Wunderbaren Jahre 1980 in die Kinos gelangt.
Es scheint in der Rückschau, schreibt die Journalistin Marianno Brandt 1980 über Kunzes Kritiker, „als hätten ihre Verfasser nicht einen Film zu beurteilen, sondern ein Bekenntnis abzulegen: gegen Kunze oder für Kunze“. Die Kritik an diesem allein filmästhetisch und dramaturgisch gescheiterten Streifen, avanciert zum Medium der ideologischen Abstrafung. Der Spiegel verlacht Kunze als „keuschen Joseph aus Thüringen“, die FAZ vermißt jede Ironie, empfindet die DDR-Darstellung als zu plakativ, frei von Differenzierungen; Wolf Biermann zerreißt sich rumpelstilzchenhaft öffentlich in zwei Teile: Ja, der Film habe ihn berührt, aber genervt, er „verhungere dabei mit einem Völlegefühl im Herzen“, denn dieser Film liefere ja nur die halbe Wahrheit – einerseits über die DDR, andererseits über Deutschland, denn ein für ein Westpublikum gedrehter Film über den Osten könne „ohne den gesamtdeutschen Zusammenhang“ nicht auskommen. Im Osten, schreibt Biermann, sei Kunze ein „veritabler Drachentöter“ gewesen, im Westen aber habe er sich von der Reaktion umarmen lassen; Biermann verläßt das Kino wie das „Begräbnis einer liegengebliebenen Freundschaft“. Das Mißfallen an Kunze, schreibt Marianno Brandt, „schafft sich mitunter alberne Beweisgründe“. An vorderster Stelle den, daß der Autor 1980 den Bayerischen Filmpreis für das beste Drehbuch aus der Hand des bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß entgegengenommen hat. Alles gelangt noch einmal neu in den Blick: die Tatsache, daß Kunze 1973 den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste empfangen hat, deren Mitglied er 1974 geworden ist; der Umstand, daß Kunze seinen Wohnsitz in Niederbayern wählte. Zudem wird Kunze 1984 einen Vortrag bei der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe in Wildbad Kreuth halten (1998 wird sich auch Wolf Biermann hier einstellen). Ein 1978 auf Einladung des SPD-Parteivorstandes erfolgtes Treffen mit Willy Brandt und Bundeskanzler Helmut Schmidt wird öffentlich nicht verhandelt. All das sind in der Rückschau haltlose Gründe, um einem Autor das Stigma des Reaktionären zu verpassen; allein es soll seine Wirkung entwickeln in der intellektuellen Szene in West und Ost und Westberlin. Kunze gilt fortan als der biedere Paria, der Mann, der aus dem Wald kommt, wohin er doch auch bitte wieder verschwinden soll, Kunze geht: 1982 verläßt er den Verband deutscher Schriftsteller, 1992 die Westberliner Akademie der Künste; an den – allein dem Namen nach – von Stephan Hermlin 1981 und 1983 angestoßenen Ost-West-Gesprächen unter dem Titel „Begegnungen zur Friedensförderung“ wird Reiner Kunze nicht teilnehmen; nicht etwa, weil ihn die DDR-Delegation nicht ertragen hätte, sondern weil er in der West-Abteilung nicht gelitten ist. Wer Elementares über die Zahnrädchen-genaue Kompatibilität des Ost-West-Literaturbetriebes erfahren will, der schlage in Hubertus Knabes Recherche Der diskrete Charme der DDR. Stasi und Westmedien (2001) das Kapitel „Der Fall Engelmann“ nach oder greife zu Hans Dieter Zimmermanns Studie Literaturbetrieb Ost/West. Die Spaltung der deutschen Literatur von 1948 bis 1998 (2000).
Nach vierzig Jahren Kunzescher West-Ost-Editionsgeschichte, nach zahllosen Angriffen und Rückzügen der Akteure von einst, darf man feststellen: Es gibt ein Thema, aber keinen „Fall“ Reiner Kunze. Diejenigen, die von einem Fall Kunze sprechen, sind sehr oft Teilhaber oder Zuträger eines kulturpolitischen Falles, den sie zu vertuschen suchen, in dem sie ihn zur Personalie des Betroffenen umwidmen. Es gibt keinen Fall Kunze, aber es gibt den Fall Deutsche Demokratische Republik, eines Zwangsstaates, den in kindischer Ermunterungsprosa zu verklären, Mode geworden ist.
Es gibt den Fall des bundesdeutschen Literaturbetriebes von links, dessen Lautsprecher in den 70er und frühen 80er Jahren auf dem Ost-Auge blind oder sentimentalisch beschlagen waren – Eisblumen auch hier. Es gibt den Fall einer Öffentlichkeit, der Kritik stets Mittel zum politisch geheiligten – also doch letztlich privaten – Zweck ist; deren prominentere Dickhäuter nach 1989 weder an einer Ost-Ost- noch an einer West-Ost-Debatte interessiert waren: die Vorurteile von einst sollen als Urteile weiterwesen. Man muß ja nicht, wie oft zu hören ist, behaupten, daß sich westliche Intellektualität darin bewies, wie sie sich zu den dissidentischen Strömungen des Ostens verhielt; es würde ja genügen, daß fortan derjenige, der eine Haut zu Markte tragen will, darauf achtet, daß es nur die eigene ist.
Das Unbehagen am Umgang mit Reiner Kunze verschafft sich erstmals 1993 während der Ersten Hiddenseer Gespräche selbstläuternd Kontur. Hellmuth Karasek, Jahrgang 1934, nennt den „Fall Kunze“ für sich als „ehemaligen Westdeutschen“ den „schwierigsten und unangenehmsten Fall“. Für Karasek ist Kunze der „reale, nicht fiktive Intellektuelle, der nach dem Einmarsch der Nationalen Volksarmee in die ČSSR 1968 protestierte und zwar nicht parabolisch verschlüsselt und auch nicht in ein heimliches Diarium geschrieben, dessen Veröffentlichung er auf einen günstigeren Zeitpunkt verschoben hätte, und dafür auch hart und unnachgiebig bestraft wurde“.
Karasek deckt seine Pein darüber auf, wie schnell Kunze „das Stigma des Kalten Kriegers“ verpaßt worden ist, wie „man ihm seine Nähe zur CSU gründlicher verübelte als seine Ferne zur SED“. Uwe Kolbe, Jahrgang 1957, trägt aus der Ost-Sicht bei, daß er den Kunze-Legenden „aufgesessen“ sei „und zwar perfekt“, zum Beispiel jener Schnurre, „der habe doch ein Haus von der CSU bekommen und was noch alles“. Kolbe:
Aber es war eben nicht nur eine Stasi-Falle, sondern es war eine, in die wir alle getappt sind. Kunze, den nehmen wir nicht mehr ernst. Das ist natürlich furchtbar. Doch es hat funktioniert.
7 Das Schöne
Der Ruf, als Dichter eine Art „Hohepriester seiner selbst“ (Hans-Jürgen Heise) zu sein, folgt Reiner Kunze seit Jahrzehnten auf dem Fuß. Der Ruf meint es nicht gut mit ihm, denn Hohe Priester gelten nicht als vorbildliche Demokraten. Allein das Haus der Poesie hat viele Kammern und die, die sie aufsuchen, suchen immer nach Verortung, Transzendenz oder etwas Abwehr-Zauber. Trotzdem ist der Hinweis interessant; er kommt nicht von ungefähr. Der Hinweis verdankt sich einem Grundgestus der Kunze-Lyrik und dem Umstand, daß hier ein Kleinschreiber in der selbst gewählten Enge kurze Gedichte verfaßt, auf daß sich ihr Gehalt in einem jeweils Einzelnen groß entfalte. Da geht Literatur in eine Art von Lektüre-Mystik über. Der Hinweis folgt einer gern direkt geführten Ansprache des Lesers oder eines textinternen Gegenübers, er verdankt sich dem Aufbau einer Erwartungshaltung – der des Dichters an sein Gedicht, der seines Publikums an den Dichter.
Im Gedicht „schreibtisch am fenster, und es schneit“ sagt es Kunze so:
Und wieder verharre ich
reglos
Euren tadel daß ich zeit vergeude
weise ich zurück
Stille häuft sich an um mich,
die erde fürs gedicht…
Kunzes Gedichte sind Zurüstungen für den Alltag, sehr oft Ansprachen über weite Distanzen hinweg („der weg zu euch“), die subtile Bündnisse stiften können. Tatsächlich findet Reiner Kunze sein Publikum im Osten heute dort, wo es sich im Haushalt der Freunde von einst fortpflanzte. Kunzes Ost-Popularität hat in Thüringen und Sachsen ihren Kern, sie reicht noch halbwegs bis Berlin. Das ist die soziale Seite der Medaille, die Kehrseite spiegelt in Kunzes Poetik zurück.
Reiner Kunze ist ein Heimatdichter in dem Sinne, daß er seinen Lesern Herbergen sichtbar machen will, Trostspeicher und Kraftfelder gegen die Zumutungen der Zeit. Dieser Dichter ist den Kollegen der Barockzeit näher als denen eines kraftvoll ausschreitenden Welterlebens. Zuflucht ist bei Kunze dort zu finden, wo sich die Lebenskraft erneuern kann, wo sich ein eigener Sinn setzen läßt. In der Musik:
Und das nichts mußt du nicht fürchten
Und bis dahin
reicht den kleinen finger uns
Chopin
(„nocturne in E.“)
in der Bildenden Kunst:
Schwebend
Und nur in der kunst
auf uns zu
(„Fritz Koenig: ohne titel, kohle“)
in der Liebe:
Von neuem lese ich von vorn
die häuserzeile suche
dich das blaue Komma das
sinn gibt
(„auf dich im blauen mantel“)
im Naturschönen:
Im schatten der anderen leuchten
(„silberdistel“)
Kunzes Religiosität sucht nicht Gott, sondern die Welt, die sich ihm in ihrer Schönheit offenbart. Hier ist Halt und Haltung zu finden:
Du betest den bach, die leere rosenkranzschnur
(„ein tag auf dieser erde“)
Von poetischer Weltfrömmigkeit zu sprechen, liegt hier nahe. Der Dichter versucht, den Menschen an das Diesseits zu binden. Das Medium dieser Bindung ist die Welt – als Selbsterfahrung, ihr Stimulans die Freude, ihr hellster Ort das Reich der Schönheit.
Immer tiefer dringt Reiner Kunze in dieses Reich der Schönheit vor, nach dem Abschütteln des politischen Geschirrs geradezu mit Vehemenz; Kunze schwimmt sich frei. Ein Dokument dieser Ästhetik der Selbstentfesselung ist der Bild-Text-Band Der Kuß der Koi, erschienen 2002. Er zeigt großformatige Porträts japanischer Farbkarpfen, der Koi – vom Autor im heimischen Teich fotografiert. Reiner Kunze nennt sein Bildwerk ein „Gegen-Buch, ein Buch gegen das Tonangeben des Häßlichen, des Ekelhaften, des Brutalen“, er empfiehlt es Lesern, deren Seele nicht in einem „Panzerhemd“ steckt.
So ein Hinweis ist Kunze-typisch; dieser Dichter unterstreicht gern, was eigentlich auf der Hand liegt. Reiner Kunze gibt den Karpfen Namen, spricht mit ihnen, erzählt von sich, schaut auf das eigene Leben zurück. So präsentiert sich der Koi-Band als ein poetisches und biografisches Evangelium des Diesseits: aufwendige, farbsatte Fotografien, kommentiert von Notaten, die wie hingetuscht den Wahrnehmungs-Kosmos des Dichters erhellen. Man mag das entweder sehr oder überhaupt nicht.
Allein der Ort der Schönheit ist ein einsamer Ort, denn Schönheit fordert den Betrachter ganz. Die Tendenz zur Weltabschottung ist dem, der sich der Schönheit ausliefert, immanent; der Geist des Entweder-Oder herrscht. Beim Nachdenken über Reiner Kunzes Werk und Wirkung gerät man so auf weitere Bahnen. Da ist der Ton der Reinheit, die Anrufung des Wahren, Guten, Schönen; man erinnert sich an Bechers Formel von der „Verteidigung der Poesie“ auch deshalb, weil Reiner Kunze selbst sehr oft etwas verteidigt oder derjenige, der über Kunze spricht, sich sofort auf altbekannten Für-und-Wider-Positionen findet; man denkt auch daran, daß Louis Fürnbergs Zeile „Die Partei hat immer recht“ einen Vorläufer hatte, notiert wurde sie von Friederike Kempner (1836–1904): „Die Poesie hat immer recht“.
Und schon sitzt man in der Kunze-Falle; das Werk des Autors wird immer wieder von seinen ideologischen Aufbrüchen her reflektiert: Ist die Poetik der Schönheit Ideologie? Zeigt sich Kunzes poetischer Rigorismus darin, daß er versucht, die Welt sinnlicher Schönheit mit einer Ordnung sittlicher Reinheit in Deckung zu bringen?
Tatsächlich gilt dem Dichter Reiner Kunze Schönheit als ein Ausweis von „Wahrheit“, und das meint nicht nur das Echte, sondern eben auch das Gute – als Spiegel der Selbstläuterung. So steht der Dichter vor den Fischen und fragt sich:
Wie oft im Leben habe ich es an Einfühlung fehlen lassen, weil ich begeistert war. Vor allem in der Jugend. Dabei war das, wofür ich mich begeisterte, die Begeisterung nicht immer wert, und unter Umständen war sie schuldhaft. Doch entstünde das Wenige, das einem im Leben gelingt, ohne Begeisterung?
Hier ist der alte wieder ganz der junge Dichter: Ein Feuilleton entsteht, blitzblank poliert, mit pädagogischer Pointe. Dieser Autor läßt sich nicht gehen, er ist es selbst, der Halt und Haltung sucht.
Im 1997 er Gedicht „Sanfter Schulterschlag“, dem Leipziger Freund Horst Drescher gewidmet, sagt Reiner Kunze:
Wir aber haben erlebt, daß das leben
auch recht geben kann
Und sonst: poesie ist außer wahrheit
vor allem poesie
Christian Eger, die horen, Heft 210, 2. Quartal 2003
Ja, wenn sich der Prager Frühling
ins Karpatenland Rumänien ausgeweitet hätte…
– Reiner Kunze vor vierzig Jahren. –
Fukuyama hatte sein berühmtes Buch über das Ende der Geschichte wohl noch nicht geschrieben, der Name Kojève aber tauchte in der Kantine des rumänischen Schriftstellerverbandes, wo man sich an den Mittagstischen vor allem die wichtigsten Neuigkeiten aus Paris und den anderen Kulturmetropolen der Welt unterhielt, da und dort schon mal auf, hatte sich der Kommunismus mittlerweile doch dermaßen „endgültig“ installiert, dass niemand mehr in der Lage war, Alternativvorstellungen zu entwickeln oder auch nur sein schlichtes Ende anzunehmen. Man lebte in diesem Teil der Welt längst in dumpfer Geschichtslosigkeit. Gleichwohl war der Übergang von den stalinistischen 1950er Jahren zu den Liberalisierungsträumen der 1960er – mit dem „Prager Frühling“ 1968 als Höhepunkt – eine vielschichtige Mutation im Lebensgefühl, gesellschaftlich wie auch individuell, und somit vorrangig erkennbar an den Künsten (und Künstlern).
Der Dichter Kunze, der über seine Frau Kontakte ins tschechoslowakische Künstlermilieu geknüpft hatte, wo die politische Entwicklung dissidentischen Neigungen und Ansätzen förderlicher war als in der DDR, trat 1968 aus Protest gegen die Invasion der Warschauer-Pakt-Staaten in der Tschechoslowakei aus der SED aus und bekam es folglich mit der Stasi zu tun. In Bukarest aber nahmen die Dinge ihren merkwürdigsten Lauf: da spielte der junge ehrgeizige poststalinistische Parteichef Nicolae C. selbst den Dissidenten und versagte Moskau die Gefolgschaft, ja kritisierte lauthals den Einmarsch in Prag. Da keimten dann natürlich schnell auch ein paar Hoffnungen auf einen rumänischen Frühling, doch nach zwei Wochen war es damit vorbei, und was stattdessen anstand war der bekannte maßlose Personenkult, das ganze Volk musste sich hinter den „geliebten Führer“ stellen, damit die Bruderländer nun nach Prag nicht vielleicht Bukarest stürmen.
Und dennoch: Kunst und Literatur folgten auch hier nicht samt und sonders dem vorgegebenen Trend, sondern fanden Wege, sich nicht zu verbiegen, ihre Eigenart zu entfalten, sich frei zu machen vom falschen politischen Druck.
Reiner Kunzes 1973 erschienener Auswahlband Brief mit blauem Siegel war auch in den Buchhandlungen Rumäniens zu kaufen, und in der Mai-Ausgabe 1974 der Bukarester deutschsprachigen Zeitschrift Neue Literatur findet sich eine eingehende Besprechung des Buches durch Franz Hodjak, der, ausgehend vom Einfluss Brechts auf die deutsche Lyrik, die unterschiedliche Art und Weise umreißt, wie sich der Brechtbezug bei Kunert und bei Kunze äußert, und da er übrigens feststellen muss, dass die jüngere rumäniendeutsche mit der jüngeren DDR-Lyrik in Sprache und Gesellschaftssystem mindestens zwei wesensbestimmende Gemeinsamkeiten haben, was die unübersehbaren Parallelen erklärt und ihn, den Rezensenten, den Schluss ziehen lässt, dass damit mehr als nur eine Möglichkeit komparatistischer Überlegungen gegeben ist. „Die Ähnlichkeiten in der Verschiedenheit und die Verschiedenheiten in der Ähnlichkeit der DDR- zur rumäniendeutschen Lyrik sind, unserer Meinung nach, das ergiebigste Bezugssystem überhaupt für die Beurteilung der DDR-Lyrik hier und heute.“ Ab Heft 3/1975 veröffentlicht die Neue Literatur nach und nach eine Reihe von Interviews, die ein anderer (dazumal noch rumäniendeutscher) Autor, Bernd Kolf, während einer DDR-Reise geführt und aufgezeichnet hat, stets garniert mit einer entsprechenden Textauswahl des jeweiligen Gesprächspartners.
Nun war die Neue Literatur eine Publikation mit geringer Auflage, die hauptsächlich innerhalb der in den deutschen Schulen Siebenbürgens und des Banats ihre Leser suchte und fand (in der Regel ohne großes Echo auszulösen), doch einige Exemplare gingen auch ins deutsche Ausland, und einmal kam ein begeisterter Leserbrief aus einer DDR-Schule, der in der Redaktion lange Zeit an der Wand aushing, weil man sich so sehr darüber freute. Und als Kolfs Interview mit Reiner Kunze zusammen mit „sechs neuen variationen über das thema ,die post‘“ erschienen war (in Heft 4/1975), jubelte sogar Free Europe darüber, dass – sieh an! – in Rumänien geht, was in der DDR nicht möglich ist, und darüber freuten sich gewiss auch die rumänischen Zuhörer (abgesehen von denen bei der Securitate).
Und im übrigen hat es in der Entwicklung der rumäniendeutschen Lyrik jener Jahre durchaus auch eine Linie hin zu jener lebendigen sprachlichen Unmittelbarkeit gegeben, die Hodjak in seiner Kunze-Besprechung zu Recht so hervorhebt. Man sprach ja damals von der rumäniendeutschen Literatur gern auch wie von einer „fünften“ deutschen Literatur (neben jener aus der BRD, der DDR, Österreich und der Schweiz), wozu die Gegebenheiten von heute kaum noch verleiten. Damals jedoch antwortete Bernd Kolf nach seiner Rückkehr auf die Frage, was die DDR-Schriftsteller über diese Literatur denn so wissen, sehr elegant und realistisch:
Sie wissen, dass sie, wenn sie mehr von uns wüssten, Interesse für uns haben könnten. Offen bleibt nur, ob sie wirklich mehr von uns wissen wollen.
Gerhardt Csejka, aus Matthias Buth und Günter Kunert (Hrsg.): Dichter dulden keine Diktatoren neben sich, Verlag Ralf Liebe, 2013
Richard A. Zipster: DDR-Literatur im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
POSTGEDICHT
als Reiner Kunzes Buch
brief mit blauem siegel kam
Die Post bringt
Gedichte über die Post,
Briefe in schwarzem
Umschlag, doch weiß
gerandet.
Ihr Vierstundenweg
dehnte sich aus
zu viermalvier Tagen.
Offen fuhren sie, offen
sprechen sie, wer sie
mit Nutzen las, unterwegs,
brauchte Zeit.
Schwarz ist ihr Siegel
und weiß,
Tag und Nacht
auf geglichener Waage.
Von Hoffnung
sprechen die Briefe.
Walter Neumann
Michael Wolffsohn: REINER KUNZE – der stille Deutsche
In Lesung und Gespräch: Reiner Kunze (Autor, Obernzell-Erlau), Moderation: Christian Eger (Kulturredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, Halle). Aufnahme vom 17.01.2012, Literaturwerkstatt Berlin. Klassiker der Gegenwartslyrik: Reiner Kunze. Wenn die post hinters fenster fährt blühn die eisblumen gelb.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Harald Hartung: Auf eigene Hoffnung
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.1993
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Katrin Hillgruber: Im Herzen barfuß
Der Tagesspiegel, Berlin, 16.8.2003
Lothar Schmidt-Mühlisch: Eine Stille, die den Kopf oben trägt
Die Welt, 16.8.2003
Beatrix Langner: Verbrüderung mit den Fischen
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.8.2003
Sabine Rohlf: Am Rande des Schweigens
Berliner Zeitung, 16./17.8.2003
Hans-Dieter Schütt: So leis so stark
Neues Deutschland, 16./17.8.2003
Cornelius Hell: Risse des Glaubens
Die Furche, 14.8.2003
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Michael Braun: Poesie mit großen Kinderaugen
Badische Zeitung, 16.8.2008
Christian Eger: Der Dichter errichtet ein Haus der Politik und Poesie
Mitteldeutsche Zeitung, 16.8.2008
Jörg Magenau: Deckname Lyrik
Der Tagesspiegel, 16.8.2008
Hans-Dieter Schütt: Blühen, abseits jedes Blicks
Neues Deutschland, 16./17.8.2008
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Jörg Bernhard Bilke: Der Mann mit dem klaren Blick: Begegnungen mit Reiner Kunze: Zum 80. Geburtstag am 16. August
Tabularasa, 18.7.2013
artour: Reiner Kunze wird 80
MDR Fernsehen, 8.8.2013
André Jahnke: Reiner Kunze wird 80 – Bespitzelter Lyriker sieht sich als Weltbürger
Osterländer Volkszeitung, 10.8.2013
Josef Bichler: Nachmittag am Sonnenhang
der standart, 9.8.2013
Thomas Bickelhaupt: Auf sensiblen Wegen
Sonntagsblatt, 11.8.2013
Günter Kunert: Dichter lesen hören ein Erlebnis
Nordwest Zeitung, 13.8.2013
Marko Martin: In Zimmerlautstärke
Die Welt, 15.8.2013
Peter Mohr: Die Aura der Wörter
lokalkompass.de, 15.8.2013
Arnold Vaatz: Der Einzelne und das Kartell
Der Tagesspiegel, 15.8.2013
Cornelia Geissler: Das Gedicht ist der Blindenstock des Dichters
Berliner Zeitung, 15.8.2013
Johannes Loy und André Jahnke: Eine Lebensader führt nach Münster
Westfälische Nachrichten, 15.8.2013
Michael Braun: Süchtig nach Schönem
Badische Zeitung, 16.8.2013
Jochen Kürten: Ein mutiger Dichter: Reiner Kunze
Deutsche Welle, 15.8.2013
Marcel Hilbert: Greiz: Ehrenbürger Reiner Kunze feiert heute 80. Geburtstag
Ostthüringer Zeitung, 16.8.13
Hans-Dieter Schütt: Rot in Weiß, Weiß in Rot
neues deutschland, 16.8.2013
Jörg Magenau: Der Blindenstock als Wünschelrute
Süddeutsche Zeitung, 16.8.2013
Friedrich Schorlemmer: Zimmerlautstärke
europäische ideen, Heft 155, 2013
Zum 85. Geburtstag des Autors:
LN: Sensible Zeitzeugenschaft
Lübecker Nachrichten, 15.8.2018
Barbara Stühlmeyer: Die Aura der Worte wahrnehmen
Die Tagespost, 14.8.2018
Peter Mohr: Die Erlösung des Planeten
titel-kulturmagazin.de, 16.8.2018
Udo Scheer: Reiner Kunze wird 85
Thüringer Allgemeine, 16.8.2018
Jochen Kürten: Sich mit Worten wehren: Der Dichter Reiner Kunze wird 85
dw.com, 16.8.2018
Zum 90. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Widerstand in Jeans
Süddeutsche Zeitung, 15.8.2023
Cornelia Geißler: Dichterfreund und Sprachverteidiger
Berliner Zeitung, 15.8.2023
Antje-Gesine Marsch: Greizer Ehrenbürger Reiner Kunze feiert 90. Geburtstag
Ostthüringische Zeitung, 16.8.2023
Ines Geipel: Nachwort. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
S. Fischer Verlag
Ines Geipel: Mit dem Wort am Leben hängen
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.8.2023
Gregor Dotzauer: Mit den Lippen Wörter schälen
Der Tagesspiegel, 15.8.2023
Hans-Dieter Schütt: Das feingesponnene Silber
nd, 15.8.2023
Stefan Stirnemann: Ausgerechnet eine Sendung über Liebesgedichte brachte Reiner Kunze in der DDR in Nöte – und mit seiner späteren Frau zusammen
Neue Zürcher Zeitung, 15.8.2023
Christian Eger: Herz und Gedächtnis
Mitteldeutsche Zeitung, 15.8.2023
Matthias Zwarg: Im Herzen barfuß
Freie Presse, 15.8.2023
Marko Martin: Nie mehr der Lüge den Ring küssen
Die Welt, 16.8.2023
Josef Kraus: Mutiger Lyriker, Essayist, Sprachschützer, DDR-Dissident, Patriot – Reiner Kunze zum 90. Geburtstag
tichyseinblick.de, 16.8.2023
Erich Garhammer: Das Gedicht hat einen Wohnort: entlang dem Staunen
feinschwarz.net, 16.8.2023
Volker Strebel: Ein deutsch-deutscher Dichter
faustkultur.de, 29.8.2023
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 +
Rede + Interview 1, 2 & 3
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Dirk Skiba Autorenporträts +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Reiner Kunze – Befragt von Peter Voss am 15.7.2013.


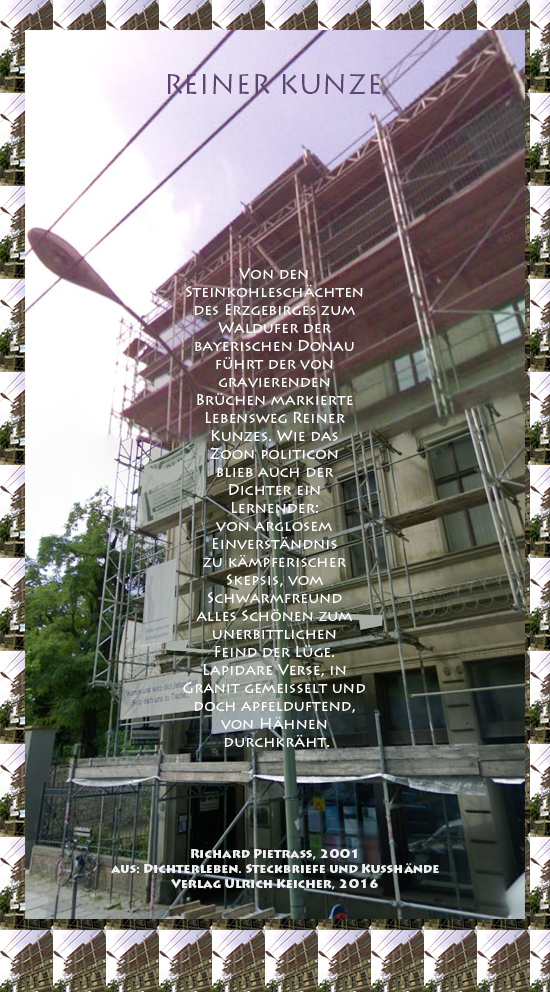












zum 80. siehe auch hier: http://signaturen-magazin.de/jayne-ann-igel–unversiegelte-botschaften.html