Robert Gernhardt: Gedichte 1954–1997
ENZENSBERGERS EXEGET
enzensbergers exeget hechelt
enzensberger: geh her exeget
enzensbergers exeget fleht
enzensberger: nee exeget nee
enzensbergers exeget kleckert
enzensberger: ekelerregend
enzensbergers exeget quengelt:
elender enzensbergerexegetenschelter
enzensberger: nervender esel
enzensbergers exeget flennt
enzensberger: hehehe
Gernhardt – der Wilhelm Busch des 21. Jahrhunderts
Wer Gernhardt gern hat, braucht diesen Band. In Deutschland ist Gernhardt wohl der meistzitierte Dichter neben Goethe. Nur eben viel komischer.
Er ist überhaupt der komischste Dichter, den wir haben. Und er wird wohl in Zukunft noch mehr zitiert werden, dank dieses handlichen Gernhardt-Gedichtbandes mit dem klassischen Titel: Robert Gernhardt. Gedichte 1954–1997. Gernhardts gereimtes Gut eignet sich als Studienobjekt für alle, die wissen wollen, wie komische Lyrik funktioniert.
Während andere ehrfürchtig die Altäre ihrer Kindheit umkreisen und dabei zu recht sentimentalen Romanergebnissen kommen, schöpft dieser Autor noch immer aus der offenbar nicht versiegenden Quelle seiner kindlichen Phantasie. Aus dem schieren Überfluß also.
Der Band versammelt viel Kluges und Schönes auf Versfüßen: Mehrere hundert Gedichte über Gott und Gernhardt, die Kunst und den Körper, den Dichter, das Schnabeltier und die schönen Frauen. Oder den Kormoran, denn wie schreibt Gernhardt:
Zur Nachtzeit faßt der Kormoran – zu gern die Kormoranin an – die dieses, wenn auch ungern, duldet – da sie ihm zwei Mark fünfzig schuldet.
Reiner Grißhammer, amazon.de, 24.3.2003
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Hans Christian Kosler: Ein diebisches Vergnügen
Neue Zürcher Zeitung, 3.12.1996
Hubert Spiegel: Das Singen wird es bringen. Die Wacht am Reim
FAZ, 3.12.1996
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 131–135
JL (Jörg Lau): Loben, trauern
die tageszeitung, 14./15.12.1996
Volker Hage: Da sprach der Knecht zum Herrn
Der Spiegel, 4.8.1997
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997, S. 142–145
Sowie in: Deutsche Literatur 1997. Jahresüberblick, 1998, S. 114–120
Lutz Hagestedt: Licht-, luft- und geistdurchlässig
Süddeutsche Zeitung, 13./14.12.1997
Zweite Unschuld
– Über den Lyriker Robert Gernhardt. –
Kann man nach zwei verlorenen Kriegen,
Nach all dem Schlachten, schrecklichen Siegen,
Nach all dem Morden, all dem Vernichten,
Kann man nach diesen Zeiten noch dichten?
Die Antwort kann nur folgende sein:
Dreimal NEIN!
Robert Gernhardts Gedicht heißt „Frage“. Die Antwort, die es gibt, ist widersprüchlich. Der Wortlaut sagt nein, die Form sagt ja. Denn Frage und Antwort reimen sich, sie ergeben ein Gedicht. In diesem Fall ist der Gedichtcharakter des Ganzen sogar ausschließlich durch den Reim festgestellt: Würden sich diese sechs Zeilen nicht dreimal reimen, dann wären sie kein Gedicht und die Antwort auf die einfache Frage – kann man nach den weltgeschichtlichen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts noch Gedichte schreiben – wäre ebenso einfach wie diese, und sie wäre eindeutig: Nein, man kann es nicht. Gernhardts Gedicht ist komisch, und es hat eine Pointe. Komisch ist es durch seine Schlichtheit. Es stellt eine überaus schwere Frage, die in denkbar großem Kontrast zur Simplizität der Paarreime steht, in die sie gefaßt ist. Dieses Mißverhältnis ist komisch. Die Pointe ist der performative Widerspruch von Aussage und Form. Selbst die anspruchslosesten Reime ergeben trotz allem noch ein Gedicht, auch nach allen Katastrophen des Jahrhunderts: Auch nach 1945 reimen sich im Lexikon der deutschen Sprache Kriege noch auf Siege, vor wie nach Auschwitz reimt sich dichten auf vernichten. Das Gedicht stellt eine Frage, und es beantwortet sie mit einem Experiment. Ein Experiment ist mehr als ein Aussagesatz: Es führt etwas anschaulich vor. Ein Experiment muß funktionieren, um die Zuschauer oder Zuhörer zu überzeugen. Gernhardts Experiment funktioniert. Weil Reim Reim ist, egal wann und wo und unter welchen Umständen.
Darin wiederum liegt nichts Geheimnisvolles. Es gibt in der Sprache wesentlich weniger Laute als Wörter. Deshalb klingen viele verschiedene Wörter einander so ähnlich, daß sie Reime ergeben. Der Reim zeugt nicht von einem tieferen Sinn, sondern nur von der Endlichkeit der Sprache und von der Willkürlichkeit der Zeichen. Der Reim ist zunächst etwas Physiologisches, etwas rein Äußerliches. Aber er funktioniert. Gernhardts Gedicht ist komisch, weil die schwere Frage und die schlichten Reime nicht zusammenzupassen scheinen; schwere Frage und schlichte Reime verzischen in einer Pointe wie zwei feindliche Substanzen, die der Chemielehrer in ein Reagenzglas schüttet und die sogleich in einer Stichflamme aufgehen. So gelingt das Experiment. Die Pointe, in der es verzischt, hat einen tieferen Sinn: Eine Frage, die sich mit einem so simplen Experiment sogar zweifach beantworten läßt, war vielleicht eine falsche Frage. Sie bringt zwei Dinge zusammen, die vielleicht weniger miteinander zu tun haben, als eine weitverbreitete Kulturkritik einmal glaubt: die Weltgeschichte und die Möglichkeit von Dichtung.
Die bisherigen Ausführungen mögen dazu dienen, den Irrglauben zu beseitigen, daß es sich bei Gernhardts Gedichten um eine einfache, widerstandslose oder sogar nette Sache handle. Diese schlichten sechs Zeilen werden ja noch problematischer, wenn man sich ihre Entstehungszeit klarmacht. Sie erschienen 1966 in dem Buch Die Wahrheit über Arnold Hau, und zwar im dritten Abschnitt „Der späte Hau“, dort in der Rubrik „Der kreative Mensch“. 1966 überschritt die Auflage von Hugo Friedrichs zuerst 1956 erschienenem Standardwerk Die Struktur der modernen Lyrik soeben das hundertste Tausend. Seit sechs Jahren lag Hans Magnus Enzensbergers großes Sammelwerk Museum der modernen Poesie vor. Friedrich wie Enzensberger gaben der modernen Lyrik eine über hundertjährige Vorgeschichte, die bis zu Baudelaires 1857 erschienenen Blumen des Bösen zurückreichen sollte, ja bis zu den ästhetischen Theorien der deutschen Romantik und des achtzehnten Jahrhunderts. Enzensberger konstruierte darüber hinaus – dabei Hugo Friedrichs Wahrnehmungen folgend – ein gemeinsames lyrisches Idiom, eine Weltsprache der Dichtung, die alle Unterschiede der Sprachen, Themen und Stile überspannte und dabei ein übergreifendes Epochenbewußtsein zum Ausdruck brachte, das sich in bestimmten formalen Errungenschaften ausprägte. Enzensberger zitierte, übrigens nicht ohne Ironie, bei Literaturwissenschaftlern gängige Begriffe wie Dunkelheit, Dissonanz, Formzertrümmerung, Montage- und Zitattechnik, Verweigerung kommunikativer Routine, absolute Metapher. Bei Hugo Friedrich erschienen diese Merkmale der modernen Lyrik als Erfüllungen eines immanenten Formgesetzes, Enzensberger historisierte sie: Für ihn waren Dunkelheit und Dissonanz des modernen Dichtens Korrelate der modernen Weltgeschichte seit der Französischen Revolution.
Aus solchen Erwägungen nahm Enzensbergers Museum keine Gedichte auf, die nach 1945 entstanden waren. „Ist es überflüssig, zu sagen“, fragte er in seinem Nachwort, „daß Auschwitz und Hiroshima auch für die Poesie Epoche gemacht haben? (…) Die großen historischen Brüche erreichen auch den Vers. Faschismus und Krieg, der Zerfall der Welt in feindselige Blöcke, die Rüstung zum Untergang: dies alles hat auch das Einverständnis der Poesie tief erschüttert. Ihre Weltsprache zeigt seit 1945 Spuren der Erschöpfung, des Alterns. Ihre großen Meister sind fast alle tot. Nur als konventionelles Spiel kann sie fortgesetzt werden, als gäbe es zu ihr keine historische Differenz.“
Enzensbergers Diagnose ist ein Echo des folgenreichsten literaturkritischen Satzes der Nachkriegszeit, jenes dialektischen Diktums, auf das Theodor W. Adorno 1951 seinen Aufsatz „Kulturkritik und Gesellschaft“ zulaufen ließ:
Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.
So lautet der Satz vollständig, von dem meist nur, die erste Hälfte durchdrang und wie ein Damoklesschwert über dem Dichten in der Nachkriegszeit hing. Ein Jahr vor seinem Nachwort zum Museum der modernen Poesie hatte Enzensberger in einer Preisrede auf Nelly Sachs der ersten Hälfte von Adornos Behauptung geantwortet:
Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einen Satz gesprochen, der zu den härtesten Urteilen gehört, die über unsere Zeit gefällt werden können: Nach Auschwitz sei es unmöglich, ein Gedicht zu schreiben; Wenn wir weiterleben wollen, muß dieser Satz widerlegt werden.
Für den jungen Enzensberger wurde er beispielhaft widerlegt in der biblischen, von Haß nicht verzerrten Sprache der Opfer, der alttestamentarisch geprägten Lyrik der Nelly Sachs. Trotzdem hat er keine Gedichte nach 1945 in sein Museum aufnehmen wollen, weder Verse von Nelly Sachs noch Poesien von Ingeborg Bachmann oder von Paul Celan. Dessen „Todesfuge“ würde zum prominentesten Beispiel einer Lyrik, die „nach Auschwitz“ bestehen durfte, erstens weil sie thematisch an Auschwitz erinnerte und zweitens weil ihre Sprache so dunkel und in ihrer Schönheit so erschreckend wirkte, daß niemand sie mit der abendländischen Schönschreiberei der unmittelbaren Nachkriegsjahre verwechseln konnte, gegen die Adornos harte Äußerung gerichtet war.
Denn Adornos Affekt richtete sich gewiß nicht gegen verrätselte Gebilde wie das Celans, sondern gegen die wiederauferstandene Kultur, die sich mit hohem, feinsinnig tragisierendem Ton im Mulmigen einrichtete, also gegen Nachkriegslesebuchdichter wie Hans Carossa oder Werner Bergengruen. Nun paßte allerdings Adornos Satz, Gedichte nach Auschwitz seien barbarisch, selbst nicht schlecht ins kulturkritische Reden der fünfziger Jahre, er konnte zur Not durchaus jene mulmige Innerlichkeit möblieren, gegen die seine Kritik an der restaurativen Kultur sich richtete. Daher die hellsichtige zweite Hälfte, die Adorno seinem Satz hinzufügte: Daß Gedichte nach Auschwitz zu schreiben barbarisch sei, fresse auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Mit dieser zweiten Hälfte hat Adorno, übrigens wenig erfolgreich, versucht, sein reißerisches Diktum vor der Klischeewerdung zu bewahren.
Es war also ein moralisch und ideologisch schwer vermintes Gelände, auf dem der junge Robert Gernhardt seine auf komplizierte Weise einfache Frage von 1966 stellte. Gernhardt griff Adornos tausendfach von Feuilletonistenmund zu Deutschlehrermund weitergetragenen Satz schon in einem Zustand beträchtlicher Abgenutztheit auf, als er nämlich selbst schon in jener Sphäre des Entschlossen-Schöngeistigen angelangt war, vor der Adorno selbst immer graute. Trotzdem kann man vermuten, daß jene „Frage“ damals wie eine Frivolität gewirkt habe, und ganz hat sie diese Wirkung auch heute nicht verloren, auch wenn sie in der „Wahrheit über Arnold Hau“ als Rollendichtung eines seltsam verwirrten Geistes daherkommt, dem die großen Gegenstände der Kultur durch ein eher trübes Hirn gehen.
Nun war im Jahre 1966 die in der Satire-Zeitschrift Pardon erscheinende Nonsense- oder Flachsinnspoesie des neunundzwanzigjährigen Robert Gernhardt weit davon entfernt, eine ernste Alternative zur damaligen Hochlyrik, deren Hauptnamen Celan und Bachmann im Zenit ihres Ruhmes standen, darzustellen. Zu isoliert stand diese kleine Kate des Witzes damals vor einem erhabenen lyrischen Erwartungshorizont, der dem Gedicht die Bewältigung der epochalen Katastrophen abverlangte. Immerhin hätte man schon damals manche Parallelen beim noch jungen Peter Rühmkorf finden können. Und wenn man größeren Abstand genommen hätte, dann hätte auffallen müssen, daß Bachmann und Celan auf der einen Seite ganz ähnlich auf Traditionen aus der Zeit vor 1933 zurückgriffen wie es zur selben Zeit auf der anderen Seite Rühmkorf und am satirischen Nebentisch der blutjunge Gernhardt taten. Ingeborg Bachmanns Lyrik lebt vom Nachhall des bildstarken und immer noch formstrengen Expressionismus eines Georg Trakl und seiner Zeitgenossen. Celans verrätselte, aber melodisch und metrisch erstaunlich eingängige Dichtkunst verdankt niemandem mehr als dem späten Rilke, dem Rilke der Duineser Elegien und der Sonette an Orpheus. Ganz ähnlich griffen Rühmkorf und eben auch der junge Gernhardt auf vergleichbar klassische Avantgardepositionen der Vorkriegszeit zurück, auf die surrealistische Nonsensepoesie von Morgenstern, auf Sinngedichte von Kurt Tucholsky und des jungen Brecht, auf Dichter also, die sich ein volkstümliches Formenrepertoire ironisch, humoristisch und satirisch angeeignet hatten. Daß Gernhardt darüber hinaus schon damals geradezu systematisch den lyrischen Hausschatz des deutschen Bildungsbürgertums plünderte, hatte er mit solchen Vorläufern gemein.
Aus heutigem Abstand wirken die formalen Errungenschaften gerade der sich angestrengt avantgardistisch gebenden deutschen Nachkriegslyrik bis hin zur Endstation der sogenannten konkreten Poesie nur noch wenig weltbewegend, zumal wenn man sie mit der formalen Virtuosität der Moderne in der Vorkriegszeit vergleicht – insofern hatte Enzensbergers Rede von Ermüdung ihren guten Grund. Adornos Satz wirkte in dieser Lage ideologischer als ihm selbst lieb sein konnte, und diese Wirkung ging ein in jene all herrschende Verbotsästhetik, mit der die ermüdete, programmatisch und akademisch gewordene Moderne in der Nachkriegszeit ihr Leben um mehrere Jahrzehnte verlängerte. Wenn man schon nicht wußte, wie es weitergehen sollte und daher das Verstummen oder die Verrätselung pries, so wußte man doch unfehlbar, was nicht mehr möglich sein sollte. In der Kunst war das die gegenständliche Malerei, in der Musik die Tonalität, im Roman die realistische Welterschließung, in der Lyrik die traditionellen Formen von Reim, Strophe, Metrum.
Es wäre ein eigenes großes Thema, die sachliche Berechtigung dieser Verbotsästhetik im allgemeinen zu erörtern. In der Lyrik führte sie jedenfalls dazu, daß die alteingeführten Technologien verbaler Suggestion – der Begriff stammt von Gernhardt –, also Klang und Rhythmus, Strophe und Reim sowie alle Figuren der Rhetorik eine Zeitlang völlig außer Gebrauch kamen (bezeichnenderweise übrigens vollständig erst in den späten sechziger und siebziger Jahren). Groß war daher bei Kritik und Publikum das Erstaunen, als sie in den achtziger Jahren wiederauftauchten, in jenem Vorgang, den Hans Magnus Enzensberger in die kongenialen Verse brachte:
In Frankfurt führt Frau Ulla Hahn
den Lyrik-Ulla-Hulla an.
Kritik und Publikum hätten sich weniger überraschen lassen müssen, wenn sie mehr zwischen den Sphären von Hoch und Niedrig, von Ernst und Spaß, von Seriös und Satirisch hin- und hergelesen hätten. Immerhin war schon 1976 von Robert Gernhardt und F.W. Bernstein der Band Besternte Ernte erschienen, 1981 dann von Gernhardt allein der schon im Titel Großes versprechende Band Wörtersee. Der älter, aber einstweilen nur allmählich reifer werdende Gernhardt und seine Mitstreiter haben in diesen Werken ein ganz neues Genre von Bild-, Bildgedicht- und Geschichtenbuch entwickelt, und vor allem Gernhardt hat dort praktisch das gesamte von der anerkannten und offiziösen Spätmoderne verabschiedete Formenrepertoire der deutschen Lyrikgeschichte weiter angewendet, gepflegt und aufpoliert.
Das klingt sehr hochgegriffen und verlangt nach einem Beleg. Dazu seien ganz kurz zwei Melodien eingespielt.
Trotz der Paradigmenstürze im Deutschunterricht dürften sich noch immer viele Leser an eines der einst berühmtesten Gedichte deutscher Sprache erinnern, einen wahren „Lyrikhammer“, wie Gernhardt es nennen würde, jedenfalls einen Ohrwurm von Rang. Die erste Strophe des Gedichts „Tristan“ von August von Platen lautet:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen
Ist dem Tode schon anheimgegeben
Wird für keinen Dienst auf Erden taugen
Und doch wird er vor dem Tode beben
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
Man höre vergleichend die erste Strophe von Gernhardts „Lied der Männer“ aus dem Wörtersee:
Die Trauer beim Betrachten großer Hecken
gleicht jener, die wir sonst nur dann empfinden
wenn wir den Lorbeer aus dem Haare winden,
weil es heißt „Fertigmachen zum Verrecken“ –
Die Trauer beim Betrachten großer Hecken.
Das Beispiel wurde bewußt nicht aus den Kapiteln „Vertraute Laute“ oder „Vorbild und Nachbild“ in Wörtersee genommen, sondern aus dem nicht parodistischen, sondern programmatisch komischen Abschnitt „Spaßmacher und Ernstmacher“. Gernhardts wie Platens Gedicht sind dreistophig in Rondoform aufgebaut, mit leicht voneinander abweichenden Reimschemata. Bei Gernhardt gibt es kein direktes Zitat, und es bleibt philologisch sogar ganz unsicher, ob er auf Platen anspielen wollte. Entscheidend ist, daß sich selbst in der Brechung des Nonsense und im Säurebad der Komik die klassische Form behauptet, ja daß sogar etwas von ihrem Geist überlebt. Das schreitende Metrum und die Strophenform des Rondos haben in beiden Anwendungen etwas von der strengen Melancholie eines französischen, nämlich stark beschnittenen und friedhofsartig regelmäßigen Gartens. Gernhardts Strophe enthält nicht nur einen Stilbruch – das Fertigmachen zum Verrecken – es ist insgesamt ein einziger Stilbruch, weil die Verwirrtheit seiner Aussage im Mißverhältnis steht zum Regelmaß seines Formschemas. Der Nonsense freilich läßt das Schema nackt dastehen, und siehe, es ist schön.
Man höre wenigstens noch die zweite Strophe des „Lieds der Männer“:
Das Frösteln beim Betasten kühler Eisen
wir kennen es, seitdem wir jene sahen.
die in den Zug einstiegen, der sein Nahen
nur unterbrach, um kurz drauf zu entgleisen
Das Frösteln beim Betasten kühler Eisen.
Im Jahre 1990, als die postmoderne Wiederentdeckung des traditionellen Formenkanons längst vor aller Augen stattfand, hat Robert Gernhardt sich noch einmal ausdrücklich und mit der Wucht des Endgültigen zu ihm bekannt:
Da haben also Jahrtausende eine Technologie verbaler Suggestion entwickelt und unendlich verfeinert – und kaum einer der heutigen Arbeiter am Wort interessiert sich für dieses Erbe. Statt dessen hausen die meisten im stillgelegten Maschinensaal wie weiland die Barbaren zwischen den römischen Ruinen.
Man dichte wie der erste Mensch, und verwende bestenfalls Fragmente des Überlieferten wie jene Barbaren den Marmor der Römer.
Das ist nicht kulturkonservativ, sondern zunächst nur kritisch gegenüber dem Hauptgötzen des entfesselten Kapitalismus, dem Fortschritt. Gernhardts zweite These zum Gedicht lautet nämlich, daß alle Gedichte komisch seien, und zwar eben aufgrund der von ihm so hochgehaltenen Formen. Diese Formen nämlich sind für Gernhardts ernüchterten und durchaus modernen Blick etwas ganz Äußerliches und Willkürliches, denn sie entspringen der Zufälligkeit des Lautens jener Wörter, mit denen wir Sinn kommunizieren. Der Gleichklang des Reimes produziert, wenn er mechanisch in Gang gesetzt wird, zunächst nur Unsinn, semantischen Schrott:
Der Advokat aß grad Salat, als ihm ein Schrat die Saat zertrat.
Erst der Dichter bändigt diese Willkür und suggeriert durch mühsames Auswählen jene Übereinstimmung von Sinn und Klang, die die Überzeugungskraft höherer Notwendigkeit erzielt und im Idealfall nicht nur einen Gedanken mitteilt, sondern eine Empfindung erzeugt.
Alle äußere Form aber behalt ihren Anteil am Komischen (als dem Willkürlichen und Zufälligen), und zwar gerade dann, wenn sie als Nur-Form wahrgenommen wird, und das geschieht, wie man Gernhardt fortsetzen kann, spätestens dann, wenn eine Form zum zweiten Mal verwendet wird. Form bedeutet fast augenblicklich Distanz, Ironie, Humor, Komik. Das macht es fast unmöglich, irgendwo auf Dauer einen hohen Ton ohne Krampf durchzuhalten. Der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen ist deshalb so klein; weil nun das Erhabene nur zweimal sagen muß, um seine Wirkung zu ruinieren. Sollten die Verrätselungs- und Verdunklungstechniken der epigonal gewordenen spätmodernen Lyrik am Ende bloß der Versuch sein, jede Form nur ein einziges Mal zu verwenden, um der unvermeidlichen zivilisatorischen Ironie der vorgeprägten Form zu entkommen? Um also nur ja keinen Schritt weitergehen zu müssen, weil jeder Schritt voran von der Klippe der Moderne in den Abgrund des Komischen führen müßte? Fragen eines lesenden Gernhardt-Bewunderers.
Unfreiwillige Komik ist das Schicksal der distanzlos und unkritisch gebrauchten Formen, absichtsvolle Komik rettet sie und haucht ihnen neuen Lebensatem ein. Gernhardt, der Komiker, hatte die klassischen Formen ja in der Tat nicht bei bester Gesundheit angetroffen. Ein Gedicht im perfekten Trakl-Ton, das der Abiturient 1954 verfaßt und erst jetzt publiziert hat, spricht von der Reproduzierbarkeit des Schulstoffs, und es läßt jene feinsinnige Glätte ahnen, die Adorno in dieser Zeit als barbarisch empfand. Robert Gernhardt schrieb also zwei Jahrzehnte lang fast ausschließlich komische Gedichte, allerdings mit einem abnehmenden Grad von Komik. Sein Formenrepertoire und seine Formbeherrschung wuchsen in dieser Zeit ins fast Wunderbare. Seit dem Wörtersee entwickelte Gernhardt immer virtuoser die Technik, Gedichte zu schreiben, die wie Zitate klangen und doch kein einziges fremdes Dichterwort enthielten. Dann geschah etwas noch Erstaunlicheres: die im Säurebad der Komik gereinigten und verjüngten Formen wurden mit einem Mal wieder zu Gefäßen für zeitgenössische Erfahrungen. Die im Wilhelm-Busch-Ton gehaltenen Paarreime des Gedichts „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ gehören inzwischen fast schon zum Bildungsgut:
Dich will ich loben: Häßliches
du hast so was Verläßliches
Das Schöne schwindet, scheidet, flieht –
fast tut es weh, wenn man es sieht.
Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit
und Zeit meint stets: Bald ist’s soweit.
Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer.
Das Häßliche erfreut durch Dauer.
Es sind die klassischen Verse über die alte Bundesrepublik. Hier haben wir unser Leben in der Zeit vor 1989, das einst so solide, das sich vor aller Empfindung des Todes ins Ausdruckslose, sauber Geschrubbte, beständig und unvergänglich Häßliche flüchtete, das, kurz gesagt, von Zeit nichts wissen wollte und sich vor der Geschichte fürchtete. Die Überzahl dessen, was nach 1945 in Deutschland gebaut wurde, ist nichtssagend, es erzählt keine Geschichte; das ist das Häßliche, das durch Dauer erfreut.
Den Menschen, der durch Metzlingen gegangen ist, hat Gernhardt im selben Gedichtband – Körper in Cafés von 1987 – auch nach Rom geschickt, wo alles schön ist und alles Geschichte, nämlich vielerlei Zeit. Das Sonett „Roma aeterna“ hat eine vornehme Ahnenreihe, deren wichtigste Glieder Conrad Ferdinand Meyers „Römischer Brunnen“ und Rilkes „Römische Fontäne“ sind. Wiederum wird nicht direkt zitiert, nicht einmal die Versformen stimmen überein (nur Rilkes, nicht Meyers Gedicht ist ein Sonett, und auf Rilkes „Römische Fontäne“ hat Gernhardt in dem Gedicht „Wortschwall“ viel direkteren formalen Bezug genommen). Gernhardts Rom-Sonett teilt mit seinen Vorläufern nur den Gestus der Überfülle, versinnlicht in der Technik des Enjambements, des Übergreifens der Sätze über die Versgrenzen.
Das Rom der Foren; Rom der Tempel
Das Rom der Kirchen, Rom der Villen
Das laute Rom und das der stillen
Entlegnen Plätze, wo der Stempel,
Verblichner Macht noch an Palästen
Von altem Prunk erzählt und Schrecken
Indes aus moosbegrünten Becken
Des Wassers Spiegel allem Festen
Den Wandel vorhält. So viele Städte
In einer einzigen. Als hätte
Ein Gott sonst sehr verstreuten Glanz
Hierhergelenkt, um alles Scheinen
Zu steingewordnem Sein zu einen:
Rom hat viel alte Bausubstanz.
Wieder sichert der moderne Komik-Zement, also der abstechende, von Metzingen her gesprochene Schlußsatz (nach dem halblächerlichen Klingklang der Zeilen davor: „…um alles Scheinen / Zu steingewordnem Sein zu einen“), dem ganzen Marmorgebäude das Fundament und dem Gedicht sein festes Stehen in der Gegenwart. Das Sonett zeigt wahrhaftig einen gelehrigen Barbaren in römischen Ruinen, aber der Barbar verleugnet sich nicht, und das läßt auch die von ihm verwendeten Spolien der Vorzeit in neuem Schimmer erglänzen.
Gernhardts Begriff von den lyrischen Formen ist gänzlich säkularisiert, nüchtern bis zum Äußersten. Keine Magie findet er hier; der Dichter ist kein Priester und Künder, sondern nur ein Profiteur im Zufälligen, das er für seine Zwecke arrangiert. Es ist dieses vollkommen ernüchterte Verständnis von Form, das Gernhardt so unbeeindruckt von aller geschichtsphilosophischen Verbotsästhetik bleiben ließ. Wenn Form nichts ist als geordneter Zufall und beherrschte Komik, dann spricht nichts dagegen, die alten Formen mit neuen Erfahrungen zu kombinieren. Als Prosaautor hat Gernhardt eine urälteste Form, das mosaische Gesetzbuch, auf Zumutungen der Gegenwart geblendet, in dem genialen Text „Du sollst nicht lärmen“. Hier haben wir denselben subversiven Mut, mit dem der Dichter Gernhardt als junger Mann Adornos moralisch so belastendes Diktum herausforderte.
In den zwei Jahrzehnten an der satirischen Front muß Gerhardt so etwas wie ein platonisches Formengedächtnis entwickelt haben. Die Formen stehen ihm zu Gebote wie eine absolute Musik aus Klang und Rhythmus, die abgezogen wurde aus einander hundertfach überlagernden konkreten Anwendungen. In dem Klassiker „Sonette find ich sowas von beschissen“ hat Gernhardt ein Gedicht geschaffen, das nur aus einem Tonfall – dem von alternativer Übellaunigkeit – und einem musikalischen Schema, dem schnurrenden Uhrwerk der klassischen Sonettform besteht. Das erste Quartett lautet:
Sonette find ich sowas von beschissen
so eng, rigide, irgendwie nicht gut;
es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen
daß wer Sonette schreibt. Daß wer den Mut
hat, heut noch so’n dumpfen Scheiß zu bauen usw.
Dieses platonische Formengedächtnis, die Reduktion der Formen zu durch tausendfachen Gebrauch und ätzende Komik entheiligten und ausgewaschenen Hohlformen, hat Gernhardt dann zunehmend in den Stand gesetzt, selbst als Formfinder oder -erfinder (je nachdem, welcher Version des Platonismus man anhängt) aufzutreten. Die vielerlei neuen Reimschemata, Strophenformen und rhetorischen Figuren bei Gernhardt zu katalogisieren und zu benennen, ergäbe mittlerweile schon reichen germanistischen Dissertationsstoff. Folgendes schöne Dialoggedicht aus dem Band Weiche Ziele, das „Zurück aus dem Odenwald“ heißt, ist formal ohne Vorbild:
Dieses viele Grün, dieses hohe Blau
und in der Ferne Worms
– Warum sagen Sie das?
Da war so viel Grün, und das Blau war so hoch
und in der Ferne Worms
– Wem sagen. Sie das?
Dem, dem das Grün etwas sagt und das Blau
und in der Ferne Worms
– Das sagen Sie mir?
Jawohl, falls Ihnen Grün etwas sagt
und in der Ferne Worms
– Nun haben Sie aber das Blau vergessen!
Ach – sagen Grün und Blau Ihnen was
Und in der Ferne Worms?
– Nicht daß ich wüßte. Können die denn reden?
Das Schöne bei den neuen Gernhardtschen Formen ist: Sie geben gleich zu erkennen, daß sie es sind. Schon beim ersten Mal treten sie auf wie alte Bekannte, die nur die neuen Kleider der Gegenwart angezogen haben und mit der gleichen leichten Befremdung tragen wie ihre klassischen Verwandten. Denn Gernhardt arbeitet auch bei der Neuerfindung mit vielerlei klassischen Mustern: rhetorischen Figuren wie Anaphern und Epiphern, Alliterationen, Parallelismen und eben Reim und Rhythmus.
Wenn nicht alles täuscht, wächst in den letzten Jahren der rhetorische Grundzug der Gernhardtschen Lyrik. Sie redet, sie parliert, doch parliert sie im Ebenmaß. Schon 1990 hat Gernhardt sich über den Mangel an Gedankenlyrik in der zeitgenössischen Dichtung beklagt, über das Fehlen des Epigrammatischen, der Tendenzrichtung und des erzählenden Gedichts.
Gernhardts jüngste Produktion besteht zu großen Teilen aus Sinngedichten, und der Ausdruck des achtzehnten Jahrhunderts ist nicht ohne Bedacht gewählt. Qualitäten und Ansprüche, die in der Lyrik jahrzehntelang verschwunden waren, Witz, Pointensicherheit, Beredsamkeit, Durchsichtigkeit, eben die aufklärerischen Stilideale von Helligkeit und Schnelligkeit, die das Gegenteil von romantisch-moderner Dunkelheit darstellen, sind bei Gernhardt in die Dichtung zurückgekommen. Es ist, als habe sich das Weltrad der Poesie nach zweihundert Jahren wieder weitergedreht: So wie die aufklärerische Sinndichtung der Zeit Lessings die spätbarocke Verzwicktheit und Verrätselung ablöste, so verläßt die deutsche Lyrik mit Gernhardt eine zweite Epoche von Schwermut und Dreißigjährigem Krieg.
Sie wird trocken, licht, geistvoll. Lichte Gedichte wird Gernhardts nächster Band heißen, und er wird unter anderem einen erzählerischen Zyklus über eine Herzoperation enthalten, eine Gedichtkette, deren einzelne Glieder Epigramme im Sinne des achtzehnten Jahrhunderts sind. Lessing hat die Form des Epigramms, die er von seinem Namen, der Inschrift auf einem Denkmal herleitete, durch die Abfolge von Erwartung und Aufschluß definiert. Die Erwartung entspricht dabei der sinnlichen Anschauung des Denkmals, der Aufschluß, der Information, die die Inschrift gibt. Der Aufschluß ist die Pointe, die im Epigramm auf den sinnlichen Eindruck folgt. Man lese unter diesem Gesichtspunkt Gernhardts Epigramm über den Wandschmuck in seinem Krankenzimmer:
Hie Boote und Dünen
und Brandung und Wolken
Hie Blumen und Blätter
und Gräser und Stauden.
Hie Grausen, hie Folter.
Hie Spott, hie – „Verstehe!
Der Herr läge gerne im Städel!“
Es ist unser Alltag, den Gernhardt mit diesen Mitteln durchsichtig macht, die Welt der Intercities und der Metzgereien, der Körper in Cafés, der Krankenhäuser und der Tennis-Stars – um nur ein paar Gedichtthemen zu zitieren. Seine große Kunstfertigkeit beweist Gernhardt dabei nicht nur im formalen Witz, sondern im anthropologischen Blick – auch er ist aufklärerisch – auf die großen Themen Liebe, Altern, Krankheit, Tod und – jeder Gernhardt-Leser weiß es – unser Verhältnis zur Kreatur, den Tieren, und zur Landschaft. Die Literaturkritik jault immer noch nach dem großen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik; doch wenn man einem ganz Fremden schnell erklären müßte, wie wir heute leben, könnte man ihm ohne weiteres Gernhardts Gedichte seit Körper in Cafés in die Hand drücken.
Robert Gernhardt hat im Nachwort zu einer Neuausgabe von Wörtersee mit berechtigtem Stolz aus einem Brief von Georg Stefan Troller zitiert, der ihm geschrieben hatte:
Sie haben mir den Glauben an die deutsche Sprache als Spielsprache wiedergegeben, und ihr eine Art vorhitlerische Unschuld.
Sehr wahr, mit einer Veränderung: Handelt es sich nicht doch um eine nachhitlerische Unschuld? Hat nicht auch Gernhardt seine Lektion aus der Geschichte des Jahrhunderts gezogen? Sie besteht in der Unterminierung von jeglichem Pathos, dem Ausweichen vor allen Priesterlügen, vor der falschen Feierlichkeit, den verführerischen großen Worten. Die aufklärerische Unschuld des trockenen, hellen, ironischen Tons kann doch bestenfalls eine zweite Unschuld sein, so wie man nach Gebrüll und Gestammel den Ton absichtsvoll dämpfen und zum zivilisierten Parlando zurückfinden muß. Ist Robert Gernhardt zum Dichter unserer Zeit geworden? Schön wäre es, doch wird das erst die Geschichte erweisen. In dem Band Lichte Gedichte gibt es auch ein politisches:
EINER SCHREIBT DER BERLINER
REPUBLIK ETWAS INS STAMMBUCH
Erstmals sind die Älteren
nicht per se schon Täter.
Erstmals heißt es: Macht erst mal
bilanziert wird später.
Erstmals sind die Jüngeren
nicht per se schon Richter.
Erstmals schreckt das Kainsmal nicht
älterer Gesichter.
Erstmals müssen alle ran,
Turnschuhe wie Krücken.
Glückt’s nicht, sind wir alle dran,
ergo muß es glücken.
Gustav Seibt, aus Gustav Seibt: Das Komma in der Erdnußbutter, Fischer Taschenbuch Verlag, 1997
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IMDb + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.


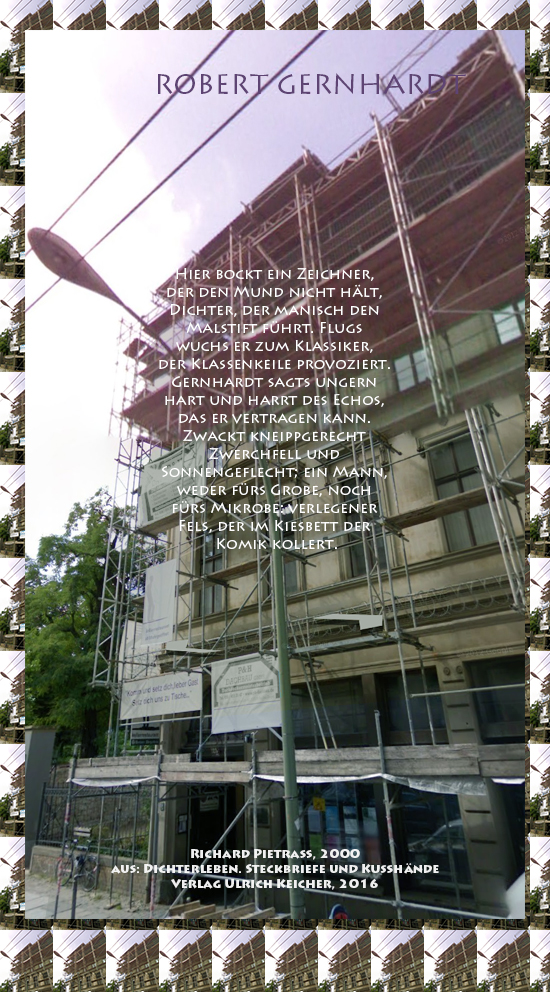












Ein sehr schöner und intelligenter Artikel. Und Robert Gernhardt ist eh unübertrefflich.