Robert Gernhardt: Im Glück und anderswo
BRUDER RILKE
Zur Zeit denk ich immer wieder an Rilke.
Zehn Jahre lang hat er als Dichter geschwiegen.
Und nun auch ich. Schon seit gut zehn Tagen.
„Bruder“ nenn ich im Geiste Rilke.
Zehn Jahre – zehn Tage: Das sei unvergleichbar?
Dagegen halt ich die einfache Wahrheit:
Auch Rilkes zehn Jahre begannen dereinst –
genau wie bei mir? – mit zehn Tagen. Stimmts,
aaaaaBruder?
Fünf Jahre nach Lichte Gedichte
erscheint nun Im Glück und anderswo der bislang umfangreichste Lyrikband des Dichters.
Robert Gernhardt liegt die Welt zu Füßen, hier und anderswo, im Licht wie im Schatten. Des Menschen Glück als Liebender, als Reisender, als Speisender, faßt er in seine Verse, des Menschen Unglück, als Alternder, als nur noch Begehrender und Verzehrender, bannt er in seine Strophen. Stets ist er im Bilde und macht sich dichtend eins, singt der Gegenwart ein neues Lied, kommt schnell in Fahrt und weiß doch wie tief im Leid man fallen kann. Er nimmt die Welt beim Wort und auch manch andern Dichter, um bei aller Lust am Reimen, bei allem Witz inmitten seiner Zeilen, den nötigen Ernst nicht zu vergessen. Robert Gernhardt ist ein Dichter, der mit allen Formen der Poesie meisterhaft spielt. Ob Sonett oder Blues, Ballade oder Parodie – Gernhardt überrascht stets durch seine Virtuosität. Mit Reim und freien Rhythmen, in klassischen Tönen und modernen Dissonanzen läßt er das Dasein neu erklingen. Welch Glück, daß ihm dies so sehr glückt.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 2002
Dschungelbuch mit sieben Siegeln
– Vom Dichten im Wörtersee: Robert Gernhardts barocke Lamentationen. –
Vor fünf Jahren, als die Zeitschrift Merkur der gegenwärtigen deutschen Lyrik eine Jubiläumsausgabe widmete, ließ sich ein sonderbares Schauspiel beobachten. Zwischen Mayröcker und Enzensberger, Rühmkorf und Kling stand da der Komiker Robert Gernhardt – nicht mehr demonstrativ, sondern in aller Selbstverständlichkeit, mit der er jetzt in diese Reihe gehörte. Wer sich aber, animiert durch die essayistischen Reflexionen über den erlösenden Spaßmacher in der ernsten Dichterwelt, dessen eigenen lyrischen Beiträgen zuwandte, fand sich überrascht. Zwar hatte Gernhardt schon früher die Komik mit „Trauer“-Gedichten kontrastiert. Nun aber zog er sich erstmals ausschließlich zurück auf „Vier Lamentationen“: Gedichte über das Siechtum seines Hundes, das Sterben seiner Katze, das Zypressensterben in der Toskana und, als Abschluß des traurigen Ringes, das Sterben des gleichfalls hundehaltenden Nachbarn. Nein, lustig ging es da nicht zu, höchstens lakonisch.
Nur beiläufig ließ der prosaische Duktus die Erinnerung an die Versformen anklingen, deren souveräne Beherrschung Gernhardt so oft demonstriert hatte. Auch von den alten Wortspielen war in diesen sachlichen Terzinen und reimlosen Daktylen nur ein karger Rest geblieben; im Bild von der „Schwindsucht“ der Bäume im „Land der Sehnsucht“ etwa oder im Kontrast von Goethe-Ton und „Schwächung der Immunsysteme“. Was den verblüfften Leser aus jedem Vers nackt und kalt ansah, war die Vergänglichkeit;
gefühllos
glotzt der Verfall. So sieht er aus allem
Vollkommnen dich an: Warte nur balde,
und ich beherrsche das Feld vollkommen.
Verfall, das war das Thema dieser nur mit einem dünnen Schleier lakonischer Ironie umhüllten Klagelieder.
Und nun schreibt derselbe Gernhardt sein Buch vom Glück. In Wahrheit aber geschieht hier dasselbe wie damals im Merkur, nur ist der Schleier jetzt dichter gewoben. „Wie übers Glück reden?“ lautet der erste Vers; die Antwort geht unter im Übermaß der Variationen von „glücklich“ und „Unglück“ über „Glücken“ bis „Mißglücken“ und „Nichtglücken“. Dreißigmal in siebenundzwanzig Versen klingelt die eine Silbe, maß- und witzlos. Vielleicht kann man so übers Glück reden. Aber man sollte es nicht tun – wenn man nicht den Abstand sichtbar machen will zwischen einer glücklichen Gegenwart und ihrer unablässig sehnsüchtigen Beschwörung. Eines der nächsten Glücks-Gedichte preist die Schönheiten der Stadt Krems, die in der Wachau liegt und als Glücksort gepriesen wird in einem „von jenen gesegneten Landstrichen“. Gesegnet, das ist diesmal das Kernwort, an das sich das weitere Gedicht wie von selbst anlagert: Gesegnet mit Fluß und Hügeln ist Krems, „gesegnet mit Orten, die Orte gesegnet / mit Toren und Türmen, gesegnet mit Plätzen“ auch, und noch weitere achtmal ist es derart „gesegnet“. Das aber ist zuviel des Segens, so viel jedenfalls, daß die Pointe, die all dies am Ende mit unserer Alltagswelt der „Verdammten“ kontrastiert, nicht mehr unerwartet kommt. Überdies avanciert sie nun ihrerseits zum Leitmotiv. Hundert Seiten später kommt dem Reisenden beim Blick aus dem Zugfenster der Gedanke:
Hier ackern oder säen nur Verdammte.
Und abermals hundert Seiten vergehen bis zu der aus einem vergeblichen Kneipenflirt abgeleiteten Lehre, daß „auch Verdammte verdammen“. Umgekehrt klingt auch das komplementäre Motiv viermal an, das Bild vom Sonnen-Untergang in „letztem Gold“ und „Schönheit grenzenlos“.
Dies ist ein Prinzip des deshalb so umfangreichen Buches: die gefährlich nahe Larmoyanz zu übertönen durch Redundanz. Barock ist das, in einem düster buchstäblichen Sinne. Anstelle jenes „Konzentrats an Geist, Gefühl und Sprache“, das Gernhardt in „Gedanken zum Gedicht“ von der Lyrik verlangt hat, entsteht nun eine schwarze Litanei, die nichts als die eine Grundeinsicht variiert. Vanitas hieß sie bei Gryphius; „Verfall“ heißt sie in Gernhardts Lamentationen. Unbarmherzig beharrt er auf dem Verfallsdatum des Glücks, dem allein die Dichtung standhalten soll.
Die Gefahren des Verfahrens liegen auf der Hand, und Gernhardt entgeht ihnen keineswegs. Den Rennfahrer Michael Schumacher beobachtet er beim Rennen in Luxemburg. Siebzehn Strophen lang entfaltet sich das vertraute Fernsehbild zum paulinischen Gleichnis vom Leben als einer Rennbahn; und als sei das nicht schon mehr als genug, folgt noch ein zweites Gedicht, diesmal über Schumacher beim Rennen in Kanada, fünfzehn Strophen lang, die wortreich auf dem schon Gewußten insistieren.
Was hier dekonstruiert und denunziert wird, ist nicht nur die Pointenseligkeit, sondern auch die Formsicherheit der früheren Verse. Zu den wiederholten Gründen des Gernhardt-Lobes gehört ja nicht erst seit jener Merkur-Ausgabe die spielfreudige Wiederentdeckung der poetischen Traditionen. Das längst kanonische Anti-Sonette-Sonett („Sonette find ich sowas von beschissen“) parodierte ja nicht die alte Form, sondern ihre nörgelnden Verächter. Das im Psychoslang kreisende Gelaber, die gereizte Frage nach dem Sinn der schönen Strenge wurden durch ebendiese strenge Schönheit aufgehoben; noch das dumpfe Ressentiment endete glanzvoll in fließenden Jamben – „ich tick nicht, was das Arschloch motiviert“. Nicht anders die Bände von Körper in Cafés bis Klappaltar. In fremden Zungen redend, fand Gernhardt den eigenen Ton; zwischen, mit seinen Worten, „Nonsens“ und „Megasense“ entdeckte er weitläufige lyrische Landstriche. Der in seiner klassischen Simplizität schon für sich genommen unvergeßliche Schlußvers „Rom hat viel alte Bausubstanz“ ermöglichte ihm ein Rom-Sonett von formvollendeter Eleganz. Oden und Elegien, Couplets und Balladen: Dank Komik und Kalauern wurden sie wieder leicht und lebendig.
Im neuen Band wird gerade diese Formbeherrschung zweideutig. Mehr denn je geht zwar alles leicht und schnell; noch immer kann Gernhardt Enjambements wie Rilke, Assonanzen wie Grünbein, kann er rühmen wie Handke und spotten wie Heine. Und noch immer sind ein paar Verse schön pointensicher, zum Beispiel die Eröffnung eines Naturgedichts mit der Feststellung: „Das ist der Nebel, aus dem Zombies steigen“ oder die in alter Frische funkelnden Frankfurter-Schule-Witze („Beim ersten Glas sprach Husserl: ,Nach diesem Glas ist Schlusserl‘“, so geht es bis Adorno weiter). Weil aber der Dichter seiner eigenen Heiterkeit nicht mehr traut, läßt er gerade die schönsten Wendungen abkippen in etwas, das von stiller Verzweiflung nicht weit entfernt ist.
Als ich
Baghira war, da war das Leben ein
Dschungelbuch mit sieben Siegeln.
Wie hübsch sind hier, am Schluß eines Kindheitsgedichts, Rührung und Komik ausbalanciert – und wie brüsk dann der prosaische Abbruch:
Ich
hätte keins von ihnen brechen sollen.
Eine einzige Form der Vollendung scheint in dieser Vanitas-Welt noch immer erlaubt, ja erwünscht. Es ist das, was Gernhardts Enkel Dirk von Petersdorff mit einem gleichfalls barocken Begriff „Embleme für flüchtige Zeiten“ genannt hat: alltägliche Bilder, die leichtfüßig auf die eine Grundeinsicht hinauslaufen. Die Tübinger Enten zum Beispiel, die lange gegen die Strömung des Neckars auf der Stelle geschwommen und dann, beim Wiederhinsehen, doch verschwunden sind:
Es ist auf dieser Welt kein Platz
für eine feste Stelle.
In tragfähigen Jamben wird die Sentenz, je nach Bildspender, den Band hindurch variiert: „Der Weltenwind weht durch die Welt, / nichts, das ihn treibt, nichts, das ihn hält“, sela, Psalmenende.
Aber was bleibt nach dem Ende? Der Psalm. Das ist das zweite Thema dieses trauervollen, glücksuchenden Buchs: daß in einer Welt, in der überall der Verfall glotzt, nur das Schreiben Dauer verheißt. Er schreibe, gesteht der Schreiber einmal ein, damit „was bleibt. / Ich meine: von mir. / Daher nütze ich jeden / Anlaß.“ Das ist nicht übertrieben. Häufiger als früher tragen die Gedichte Angaben zu Datum und Tageszeit, geben sich als Notizen im Zug oder Flugzeug aus. Und immer geht es um die Flüchtigkeit des Augenblicks und die Dauer der Wörter. Dem neuen Bewohner des alten Hauses fällt ein, daß er nur „ein Glied in der Kette von vielen Benutzern“ sei. Was heißt hier Benutzern? „Besitzern, Bewohnern, Verschmutzern“, fügt er hinzu. Was aber taten diese? Sie „verwohnten, verstarben, vergingen“. Was also sollte der neue Bewohner tun? Sie „kennen, bedenken, besingen, berühmen, benennen“. Beschwörend tönt die Litanei – bis zum letzten Nein und Amen. Denn weil nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein, läßt Gernhardt hier mit Gryphius selbst die Sehnsucht nach jenem Ruhm zuschanden werden, an den sich immer wieder die einzige und vergebliche Hoffnung des rühmenden Sängers klammert.
Es fragt sich der bekannte Mann:
Ab wann fängt die Berühmtheit an?
Die naturgemäß wieder siebenmal variierte Frage läuft auf die kalauernde Anti-Pointe hinaus, die Berühmtheit sei gar „nicht so berühmt“. Doch die ernsthafte Sehnsucht geht weiter. „Mein Buch ist mein Stolz / Und mein Buch ist mein Glück“ versichert ein anderes Gedicht – und fügt ebenso anrührend hinzu, in Wahrheit sei es nur Mittel zum Zweck, allberühmt und allgeliebt zu sein. Denn was nützen Bestsellerglück und Kritikerehren, wenn Gernhardts Friseurin nichts davon mitbekommt?
Was nützen mir Buch und Unsterblichkeitsscheiß
Wenn Marina nichts davon weiß?
Unsterblichkeitsscheiß, das ist das Schlüsselwort. Weil das Schöne nur Grund zur Trauer gibt, inszeniert Gernhardt das Öde und Blöde zugleich als plapperndes Übertönen des Schweigens und als Subversion dieses heiteren Scheins. Originalität entspringt nur mehr der Variation, Neuigkeit dem Selbstzitat. Noch die letzte Wendung des Bandes, auch sie ein Bild der Vanitas, ist eine Wiederholung. 1981 mündete der Wörtersee in eine Leerstelle: Im Schweigen sei er schon verschwunden, erklärte der Dichter in der letzten Strophe, und auf den Doppelpunkt folgte dann nichts mehr, Schweigen eben, der trockengefallene Wörtersee. In Lichte Gedichte hat Gernhardt das Verfahren wiederholt, als er das erwartete Reimwort „still“ aussparte, so daß nur die Stille des leeren Blattes blieb. Und nun, da (und weil) es keine Überraschung mehr ist, endet nach zweihundertsiebzig Seiten die forciert flotte Versicherung, nun lasse er „das Schreiben glatt bleiben“, abermals mit einem Doppelpunkt, dem nur noch das weiße Papier folgt. So beredt und so beharrlich verstummen kann nur Gernhardt, der dauernde Dichter unserer Vergänglichkeit.
Heinrich Detering, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.10.2002
Klein, hart und angepuhlt
Man muss ihn nicht neu erfinden, nicht über Gebühr loben – das ist alles mehrmals geschehen. Insbesondere, was die lustigen Reime betrifft. Robert Gernhardt ist legitimer Nachfolger von Christian Morgenstern, wenn er auch meist nicht mit dessen leichtfüßig stolpernder Eleganz, sondern eher mit Chaplinesker Plumpheit kokettiert. Wenn es jedoch etwas zu entdecken gäbe, dann weniger in seiner Lyrik als den sudelbuchartigen Prosafetzen und adretten Fragmenten, den Reisenotizen zumal. Zum Beispiel, was die indonesische Erdnuss betrifft. „Die indonesische Erdnuss“, schreibt Gernhardt, „ist eine Katastrophe. Klein, hart und angepuhlt schädigt sie die Zähne und den Ruf des Landes.“ Allerdings folgt dann der Gernhardt-typische Nachsatz:
Haben die noch nie etwas von richtigen Erdnüssen gehört?
Damit ist es dahin, das Understatement. Aber die meisten Leser lieben genau dies, diese unangemeldete kleine Frechheit am Ende, das leise Nachtreten mit der Unschuldsmiene des Clowns. Und das war nun einmal seine Rolle. Außerdem kam Gernhardt nicht aus Kensington, sondern aus Reval, Posen, Göttingen, Berlin, Arezzo und Frankfurt.
Helmut Mauró, Süddeutsche Zeitung, 14.10.2014
Leser im Glück (und nicht anderswo)
Gernhardt nicht nur im Glück; der Titel deutet’s ja schon an. Der nimmer ganz so junge Gernhardt dichtet immer noch, mindestens so gut wie ehedem. Eine Art Markenartikel sei er geworden, las ich mal irgendwo. Statt „Markenartikel“, denkt man im ersten Moment, könnte man auch „Schublade“ sagen. Wenn das mal kein Irrtum ist… Klar schreibt Gernhardt hier anders als in den 80ern, die Komik verhaltener, die Formen vielfältiger, die Pointen sanfter und schärfer zugleich. Manche Themen wirken wie Rückblicke, sind aber nie altersmilde verklärt im Erinnerungsnebel. Gernhardt ist immer noch hellwach, und die Pointen sitzen immer noch. Im Glück zündet wieder mal ein Feuerwerk, und wie gewohnt gibt der Meister zu denken (insofern also doch ein Markenartikel). Die Marke „Gernhardt“ liefert sein (damals, 2002) neustes Modell, und dieses neue Modell will gelesen werden, denn das lohnt sich. Aber die Schublade ist immer noch nicht gezimmert, in die er reinpasst; das wäre wohl die Quadratur des Kreises für die literaturkritische Schreinerzunft.
Bei Gernhardt gibt’s keine gefühlsschwangeren Ergüsse, die wohl nur dem Dichter selber was sagen und sich aller sinnvollen Interpretation (und damit auch Kritik) entziehen, sondern bei allem Ideenreichtum klare Form, die sich der Kritik stellt, weil sie sich das leisten kann. Gernhardt reizt hier so ziemlich alles aus, was sich mit Lyrik anstellen lässt: Lyrische Formen wie Sonett, Ballade, Terzine, Ode… kann er alles. Den Ton des deutschen Lyrik-Reservoirs und seine Flaggschiffe mal parodierend, mal ehrfürchtig treffend, von Brecht bis Klopstock, von Heine bis Kästner, von Goethe bis van Hoddis, von Mörike bis Max Frisch. Den vom Leser erwarteten Reim verweigert der Streiter für Form und Reim auch mal kichernd, und zwar ausgerechnet bei „My Generation“ — schon wieder eine fiese Pointe innerhalb der Pointe. Auch einem das Volk mahnenden Slogan („Kinder statt Inder“) fühlt er schon mal dichtend auf den kariösen Zahn:
Doch wer wird uns dann kochen?
Wer löst das zarte Lammfleisch vom Knochen?
Eigene frühere Gedichte sind ihm auch nicht heilig: „Erdgebet“ vs. sein „Gebet“ aus den 70ern, und „Steigerung“ vs. „Schön, schöner, am schönsten“ zum Beispiel. Die meisten findet man im letzten Zyklus „Im Ernst“. Nicht „im Licht“, auch nicht „Im Wort“. Spätestens hier wird der Leser stutzig, denn ein Könner wie Gernhardt stopft seine neusten Werke nicht einfach so ins Manuskript, wie er sie gerade in die Finger bekommt. Der denkt sich was dabei, und wie alle Meisterdichter lässt er nicht nur die Wörter sprechen, sondern auch die Form. Sonst hätte er das alles ja auch reim- und formlos hinschreiben können.
Wenn Gernhardt seine Gedichte in neun Gedichtzyklen gliedert, „Im Glück“, „im Licht“, „im Bild“, „Im Lied“… usw., dann wird er sich auch was dabei gedacht haben. Der bestimmt. Also nochmal gucken, was er da im Sinn haben könnte. Macht man ja nur zu gern beim Gernhardt; hätte man eh gemacht, auch freiwillig. Und tatsächlich, wenn man etwas genauer hinschaut, dann hat man die ein oder andere zugrunde liegende Idee am Kragen (oder auch nicht. Beim Gernhardt weiß man nie). Die Gedichte innerhalb eines Zyklus umkreisen Themen, zum Beispiel Glück mit Unglücksgrundierung, spielen einander die Bälle zu, kommentieren sich auch schonmal gegenseitig. Da gehört tatsächlich zusammen, was zusammengehört: „Im Bild“ liest man viele Momentaufnahmen, gewissermaßen eine repräsentative Durchsicht der Gegenwart en détail & en gros, vielleicht auch die Welt im lyrischen Spiegelkabinett. Heraus kommen u.a. die auch schon wieder berühmten „Familie“ („Die Tochter zeigt viel Bein“…) und „Tier im Glück“ („Wärse eine Ratte, diese Taube“…) — Möglichkeiten und harte Tatsachen unentwirrbar vereint in und zwischen den Gedichten.
In einigen Fällen ist das Prinzip offenkundiger als in anderen; „Im Wort“ z.B. variiert und parodiert Gernhardt den Kronschatz der deutschen Lyrik. Mit der Brechstange veräppelt freilich wird nichts; eher tritt ans Tageslicht, was da noch alles drinsteckt. Lachen darf man trotzdem und erstrecht und nachhaltig; nicht nur, wenn Klopstocks „Zürchersee“ in Gernhardt’scher (durchaus handfester) Lesart mit einem „Schon was vor für die Nacht?“ endet.
Gernhardt 2002 — nimmer ganz so jung, aber gut wie eh und je. Im Alter vielleicht, aber von mildem Alterswerk weit und breit nichts zu sehen. Freilich schlägt er hier einen anderen Ton an als vor 30 Jahren, aber das haben die Alterswerke solider Markenartikel so an sich, deren Verfassern es viel zu fad wär, nur noch die Lorbeeren plattzusitzen. Da haben die Leser wieder mal Glück gehabt.
Weiser111, amazon.de, 30.1.2009
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Lutz Hagestedt: Lebenskunst, Lesekunst
literaturkritik.de, Oktober 2002
Lutz Hagestedt: Erinnerung an Kurt beim Schneiden der Fußnägel
Tages-Anzeiger, 7.10.2002
Kristina Maidt-Zinke: Mit der Zeit wird alles heil, nur der Dichter hat sein Teil
Süddeutsche Zeitung, 5.9.2002
Michael Braun: Anbetend brech ich vor mir zusammen
Frankfurter Rundschau, 9.10.2002
Heinrich Detering: Das lyrische Hammerklavier. Notizen zur Lage der Poesie
Merkur, Heft 644, Dezember 2002
Viel Können. Viel Reife. Viel Glück.
– Konstanz und Varianz in Robert Gernhardts späten Gedichten. –
Der Lyriker und Romancier, Maler und Zeichner, Kritiker und Essayist Robert Gernhardt gilt als Meister der Form. Er bewegt sich in allen Gattungen – Lyrik, Epik, Dramatik – und hat zahllose kleinere Genres – darunter die Satire, die Fabel, die Anekdote – virtuos bereichert. Er, der fremde Zungen geläufig parodiert, der Text und Bild ideenreich kombiniert, der alle Tiere zeichnen kann und von Kunst ebensoviel versteht wie vom Können, ist längst selber ein moderner Klassiker. Seine Gedichte haben sich mit der Welt befreundet und sind Volksmund geworden, sie legen beredt Zeugnis ab vom lebhaften Fortbestand großer Dichtungstradition und sind doch vollkommen eigenständig und innovativ.
Manche seiner Gedichte entwerfen mit Worten Bilder, manche seiner Zeichnungen sind im Wort aufgehoben, seine Prosa neigt zum Patchwork, zum Mosaik aus vertrauten Formen in neuen Umgebungen, seine Auftrittskunst spricht, ebenso wie das vertonte Werk, von Musikalität, die Illustrationen zu Lichtenberg und die Legenden zu Halbritter sind kühne Interpretationen, seine Interpretationen von Erich Kästner bis F.W. Bernstein denken Dichtung weiter, und die Gedanken zum Gedicht orientieren sich an der Praxis, am Handwerk, am nachprüfbaren Ergebnis. Mit Begabung zur Theorie fordert Gernhardt die Wissenschaft heraus, und fordert Wissen, nicht Spekulation, wenn er seine Komikkritik beispielhaft unterfüttert, um unsere Geschmacksbildung weiter sowie höher zu führen.
Rückblick und Lebensreise
Im Glück und anderswo läßt sich als Lebensreise deuten, als Rückblick:
Nun aber Herbst und ich
im Zug nach Norden quer durch Zeit und Raum,
durch dunklen Raum und lichte Zeit (136).
Hier zieht ein Dichter Zwischenbilanz und schreitet die Wegmarken ab, die er selbst gesetzt hat. Wie in keinem anderen Gedichtband nimmt Gernhardt hier auf sein eigenes Werk Bezug, und er tut dies mit gewohnt leichter Hand, das heißt mehr oder weniger offensichtlich, niemals bemüht.
Der Aufbau des Bandes entspricht der schon aus Körper in Cafés (1987) oder Weiche Ziele (1994) bekannten Gliederung in einzelne Kapitel, denen die einzelnen Texte thematisch-strukturell zugeordnet sind. Diesmal sind es neun Gruppen, wie schon in Lichte Gedichte (1997), und ihre Abfolge und Benennung sollte bereits hellhörig machen. Sie lautet: „Im Glück“ – „Im Licht“ – „Im Bild“ – „Im Lied“ – „In Fahrt“ – „Im Fall“ – „Im Leid“ – „Im Wort“ – „Im Ernst“.1
„Im Glück“, das wäre die Kindheit mit ihren Verheißungen; „im Licht“, das wäre die frühe Italien-Begeisterung des Schülers und Kunststudenten; „im Bild“, das wäre die Zeit, in der er seine wahre Berufung als Maler gesehen hat; „im Lied“ würde seine poetische Tätigkeit bezeichnen, die in den 70er Jahren zunehmend gleichberechtigt neben die Malerei tritt; „in Fahrt“ bezöge sich auf die schier unerschöpfliche Produktivität der 8oer Jahre, als Gernhardt alle Register zieht und seine Akme, seinen Lebenshöhepunkt, erreicht: hier gelingt der Wechsel vom Zweitausendeins-Künstler zum arrivierten Schriftsteller, hier entstehen zwei große Prosawerke, zwei Gedichtbände, ein Theaterstück, hier wird die neue Gattung des Erzähl-Essays zur Vollendung geführt, hier erreicht Gernhardt mit Otto Waalkes ein Massenpublikum. Die in der Reihe herausgehobene Präposition „in“ könnte zugleich auf die bewegteste Periode in Gernhardts Leben deuten; „im Fall“ stünde dann für die Lebenskrise und den Tod der ersten Frau, der Malerin Almut Gernhardt, repräsentierte das Gefühl, plötzlich den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen; „im Leid“ bezöge sich auf das in Not geratene Herz und die Bypassoperation; „im Wort“ markierte dann den Abschied von der Malerei und die endgültige Besinnung auf die Dichtkunst, nicht zu vergessen die autorentheoretischen und produktionsästhetischen Überlegungen der 90er Jahre; und „im Ernst“ schließlich zielte auf die große Wortkunst, die Gernhardt repräsentiert: lustvoll ernst zu zeigen, was Komik und Poesie leisten können.
In anderen autorbiographischen Lesarten könnte „Im Bild“ für den „rundum informierten Zeitkünstler“2 stehen, der zu Beginn der 60er Jahre mit politisch-satirischer Publizistik aufwartet; „im Lied“ für die langsame Abkehr von Prosa, Drama und bildender Kunst, gleichbedeutend mit der Besinnung auf die eigentliche Domäne, die Lyrik; „im Fall“ wäre schlüssig lesbar als erst kokett, dann bitter besungene schwindende Lebenskraft; „im Wort“ stünde Gernhardt bei sich selber, bei den selbst gesetzten Maßstäben, die noch einmal zu erfüllen wären.
Derlei Kapiteleinteilungen haben eine korrelierende und Kohärenz stiftende Funktion; diese Funktion gilt jedoch den semantisch-strukturellen Aspekten der Texte und nicht den genetisch-psychologischen der Autorbiographie. Die Semantik der Kapitel und die Funktion der Texte für die Kapitel ist vom Autor prinzipiell unabhängig, und dies ist bei Gernhardt nicht anders. Vom Glück der Kindheit ist also im ersten Kapitel keine Rede, im Gegenteil, hier formuliert einer Lebensregeln und Wahrsprüche,3 dürfte also schon reichlich vom Schicksal gekostet haben. Angesichts des Reichtums an Tönen und Anklängen, über die Gernhardt verfügt, ließen sich die Kapitelüberschriften – in wiederum anderen Lesarten – auch mit lyrischen Sprechweisen, mit traditionellen poetischen Genres und Gegenstandsbereichen in Verbindung bringen: mit dem Lied, dem Bildgedicht, mit Zeitbildern und Reiseliedern, der Elegie. Aber auch eine solche Rechnung geht nicht auf. Die Themen und Formen der Texte jedenfalls sind gewohnt reich und vielfältig, schon im zweiten Kapitel: Es geht um schön und häßlich, Lärm und Stille, Mensch und Tier, Flora und Fauna. Gernhardt übt lyrische Architekturkritik („Er blickt auf Cavriglia“), und stellt sich, ähnlich wie Brecht, die Fragen eines lesenden Arbeiters („Neueste Zeitung Silvio Berlusconi betreffend“), Er ist zwar nicht Ter Borch („Vita da cani“), aber ein poetischer Genremaler, dessen „Abendgedicht“ wie mit Worten gemalt ist und der gekonnt eine „Sturmskizze“4 hinlegt, die gewiß auch einem Ter Borch Respekt abgenötigt hätte.
Den gut orientierten Zeitkünstler präsentiert das dritte Kapitel „Beim Italiener“, vor dem Fernseher („Er sieht die Tagesthemen vom 24. März 1999“) und in Reflexion der Terroranschläge vom 11. September 2001 („Sonett vom Ende der Spaßgesellschaft in diesem unserem Lande“). Das vierte bietet eine Reihe Couplets sowie ,neue Volkslieder‘. Das fünfte setzt die Serie Gernhardtscher Reisegedichte fort und endet wie mit einem Kommentar zu „Der letzte Zeichner“ („Gespräch vor einer schwarzfigurigen attischen Vase im New Yorker Metropolitan Museum“).5
Von Tod und Vergänglichkeit („My Generation“), der verlorenen Jugendzeit („Tempi passati“), von Stolz und Ängstlichkeit („Am Scheideweg“), von Torheit und Strafe („Im Herbst“), von Triumph und Niederlage („Alles Verlierer“) und von Norm und Normverstoß („Schlimmer Finger“) handelt das sechste Kapitel, während das siebte den Reigen der verlorenen Freunde fortsetzt („Frieder“, „Kurt“). Es wird der Toten gedacht („Die Vögel“), es geht ans Sterben: „Jede Katze stirbt anders“ („Der lange Abschied von Billie“). Selbst die Zypressen sind nicht „unbesiegbar“.6
Vor allem Parodien und Hommagen bietet das achte Kapitel („Im Wort“). Sie geben dem Autor Anlaß, die schon oft thematisierte und verlachte Dunkelheit der großen und kleinen Dichter erneut vorzuführen. Der Vorwurf, sich im Unverständlichen und Privaten zu erschöpfen, richtet sich dabei vor allem gegen eine sich modern drapierende Dichtungsauffassung.7 Neu ist jedoch, daß Gernhardt jetzt auch die Qualitäten des Dunklen würdigt und dabei erneut auf die ebenfalls schon häufig bemühte Morgensternsche Formel des „Hellen und Schnellen“, zurückkommt.8 Nichts gegen Dunkelheiten, so das programmatische Gedicht „Im Namen der Hellen und Schnellen“, wahre Dunkelheiten, „die auch die strahlendste Helligkeit nicht tilgen kann“, doch Spott für die Dunkelmänner und ihre Herolde, ihre Deuter.9 „Im Ernst“ schließlich, das letzte Teilbuch, läßt den anarchischen Witz des frühen Gernhardt aufleben („Theke – Antitheke – Syntheke“),10 spricht von dem Glück, das „programmierte“ Lebenslaufmodell des Künstlers unterlaufen zu haben („Biographie“)11 und endet mit einer Reminiszenz an Wörtersee.12 Die Poesie stellt sich die Frage nach der „Biographie“ und nach den Möglichkeiten, die dem Ich bleiben: Was ist angeboren, was ist erworben, was vorbestimmt, was selbstbestimmt, was bleibt gleich, was läßt sich ändern?
Interne Ordnungen, externe Bezüge
Gernhardts Buch ist demnach so organisiert, daß die Gedichtsammlung aus in sich verschiedenen, ,gebauten‘ Ordnungen besteht:
1. Die einfachste Ordnung ist die lineare Verkettung von Einzeltexten; eine solche thematische oder formale Verkettung erlaubt es in der Regel, Gedichte umzustellen und die Reihe zu erweitern oder zu reduzieren; ein Beispiel dafür wäre die Serie der Couplets im vierten Kapitel.
2. Die komplexere Ordnung ist die der Korpusbildung von Einzeltexten, welche innerhalb der linearen Abfolge nicht weiter versetzbar, umstellbar oder anders zu gruppieren sind; hierzu gehört die Gruppe der „Montaieser Mittagsgedichte“, deren Datierung die Reihenfolge vorgibt; dies gilt übrigens, teils aus anderen Gründen, auch für die beiden Montaio-Zyklen aus früheren Büchern.13
3. Die strikteste Ordnung wird durch eine zyklische Struktur repräsentiert, in der jeder Einzeltext die jeweils anderen Texte repräsentiert, interpretiert und zu ihrer Bedeutungskonstitution beiträgt; ein Beispiel dafür wäre der Zyklus „Unworte, Optisch“.14
4. Die den Band übersteigende Ordnung schließlich umfaßt den gesamten Anwendungsbereich poetischer Fertigkeiten und Techniken, das Formengedächtnis der abendländischen Dichtungstradition, einschließlich der konkreten Beispiele ihrer Manifestation in Gernhardts Werk.
Der Rezeption sind damit eine ganze Reihe von Fragen gestellt: Wie stehen Gedichte mit besonderem Status im Kapitel, was bedeutet die Bucheinteilung für die Sammlung, wie verhalten sich Korpus oder Zyklus zum gesamten Werk und wie sind sie ,kulturell‘ angebunden? Denn von eigener Relevanz ist beim Korpus wie beim Zyklus die Frage, wie sich beide Ordnungen zu der sie ,umgebenden‘ Ordnung verhalten: Dabei ist die lineare Verkettung der Kapitel (und der Gedichte) ebenso wichtig wie die logische oder zeitliche Ordnung der Texte. ,Linearität‘ ergibt sich oder wird imaginiert, weil sie ein dominantes kulturelles Orientierungsmodell ist: auch unsere Leserichtung ist linear. Unabhängig von der Textgenese und dem Autorwillen läßt sich Linearität für die Sammlung insgesamt, für jedes einzelne Kapitel oder Korpus und für alle Zyklen bestimmen. „In Fahrt“ zum Beispiel, das fünfte Kapitel, das den Scheitelpunkt des Bandes bildet, führt vom Winter über den Vorfrühling und Frühling zum Sommer, Herbst und Winter. Auch die Sonne vollzieht diese Bewegung mit: Vom „Schein / des späten Lichts“ im Januar („Rheinfahrt im Winter“), zum „gleißend Grün“ der „Vorfrühlingszeit“ führt ein Lichtbogen zum „hellen Licht“ der Aufklärung, zur „hellen Wolke über dem Zürcher Hechtplatz“ und erreicht seinen Scheitelpunkt im Sommer, „Hinter Würzburg“. Saisonale Eintrübungen bieten der aprilhafte Regenguß in Zürich-Altstetten und die Bewölkung am „Maienabend“. Das Gedicht „Von der Laufrichtung“ spricht dann schon vom Herbst, vom „düstern Walde“, später drohen „Hippe und Sanduhr“ auf dem Sebastiansfriedhof in Salzburg, „naß und braun“ liegt das Land nach der Aussaat da, „darüber Krähen“. So „geht’s dem Ende zu“, eine „Fahrt ins Dunkel“ folgt:
Wie dunkel rings die Dunkelheit
Wie blau das späte Blau
So schwarz der schwarze Horizont
so licht das letzte Licht.15
Die Figur, die ein kleiner Zyklus beschreibt, wenn er einen großen verdoppelt, ließe sich als Myse-en-Abyme beschreiben, als Spiegelung oder Abbildung des Großen im Kleinen; sie ist Teil einer komplexeren Struktur, einer generalisierenden und partikularisierenden Synekdoche, in der ein Gedicht einen ganzen Zyklus umgreifen kann oder sich ein Kapitel im Zyklus abbildet. Im fünften Kapitel beispielsweise schreitet eine poetische Trias („Drei Miniaturen“) im Kleinen jene umfassendere Lebenszeitstrecke ab, die der Zyklus im Größeren durchlaufen hat: Der dargestellte Dreischritt führt vom Sommer („Hinter Würzburg“) zum Herbst („Bei Konstanz“) und Winter („Vor Gelnhausen“).16
Das zweite Kapitel, „Im Licht“,17 schlägt und umgreift den Zeitbogen der nächst-kleineren Einheit, des Zyklus der „Montaieser Mittagsgedichte“;18 der Zyklus beschreibt die Lichtkurve in der Zeit vom 21. Mai bis zum 20. Juni, solange die Tage noch länger werden, die Zeit vor dem Scheitelpunkt also, dem 21. Juni als dem „längsten Tag des Jahres“.19 Das lebenssatte Frühlingsgrün ist schon im ersten Gedicht („Beredtes Grün“)20 der Topos. Solche Strukturen, in denen Zyklopoiesis eine Verdichtung semantischer Merkmale und formal-syntaktischer Komponenten bewirkt, finden sich in Gernhardts Gedichtband auf allen Niveaus der Betrachtung. So schließt „Hoffnung, Show“21 als einziges Gedicht des „Unworte. Optisch“-Zyklus anaphorisch an die vier voranstehenden Stanzen an und darf somit als Quintessenz der Formation gelesen werden.
Ein Fundus eigener und fremder Texte
Der einzelne Text schließlich kann, über das Kapitel hinaus, in dem er steht, auf den ganzen Band zielen, auf das Universum der Rede, so, wie auch der Gedichtband selbst in toto als Opusfantasie angelegt ist, welche das große, vielseitige Œuvre des Dichters Robert Gernhardt noch einmal in nuce enthält bzw. widerspiegelt. Ein solch einzelner Text wäre beispielsweise „Fahrt in die Nacht des Landes der Kindheit“, wo es zu Beginn heißt:
Das hatt’ ich aber heller in Erinnerung!
Als ich Baghira war, standen die Wälder
so laublos nicht, die Wiesen nicht so sumpfig.
Die Identifikation mit Baghira aus Rudyard Kiplings Klassiker Das Dschungelbuch liegt lange zurück, mehr als fünfzig Jahre, sie wird auf den „Sommer Fünfundvierzig“ datiert und ist autobiographisch konnotiert.22 Doch nun haben sich die Verhältnisse vielfach verkehrt: statt Sommer nun Herbst, statt endloser Sonne nun Nacht, statt Licht für immer nun dunkler Raum. Dazwischen liegen nicht nur zeitliche und räumliche Distanzen, nicht nur die Erinnerung, sondern, unausgesprochen, auch andere Lektüren und Lektionen – und das Wissen um die verlorene Unschuld, darum, daß das Licht der Kindheit nur den Anschein machte. Hatte das Dschungelbuch Tod und Jagd im Wald poetisch verklärt, kündet nun das Buch des Lebens von der Sterblichkeit.23
[…] als ich
Baghira war, da war das Leben ein
Dschungelbuch mit sieben Siegeln. Ich
hätte keins von ihnen brechen sollen.
Es ist geradezu Gernhardts Domäne, mit Fremdtexten und überpersönlichen Stimmen zu arbeiten. Hommagen, Paraphrasen oder Parodien finden sich gehäuft im Kapitel VIII („Im Wort“). „Mutter Natur“ variiert eine Zeile von Klopstock und greift zugleich ein Mittel der Komikproduktion auf, von dem Gernhardt bereits mehrfach Gebrauch gemacht hat: Fehlleistung bzw. Versprecher. Ferner wird hier ein Gedanke aus Gernhardts Erzählung „Tübingen oder belegte Seelen“ (1991) aufgegriffen, wo es heißt:
Noch den hehrsten Heiligen, noch den eiferndsten Sittenapostel hatte der Sohn nie als Instanzen empfunden, stets als Komplizen. Sie alle kannten die Versuchung und leiteten geradezu aus ihrer Verführbarkeit ihre potentielle Heiligkeit ab.24
„Mutter Natur“ formuliert diesen Gedanken als Wahrspruch:
Stark ist,
Mutter Natur,
nur der, dem bewußt ist,
daß, wer die Lust nicht kennt, nicht
Herr der Lust ist.25
„Das Attentat oder Ein Streich von Pat und Doris“ stellt eine „Max und Moritz“-Paraphrase nach Wilhelm Busch dar. Benn, Brecht, Huchel, Rilke, und Ror Wolf26 werden mit je einer Parodie gewürdigt.
Derlei Textreferenzen gehören bei Gernhardt quasi zur Grundausstattung und sind Motor seiner Produktivität. Ihr Nachweis wäre nichts weiter als eine philologische Pflichtübung, kämen hier nicht die auffälligen Selbstreferenzen hinzu. Die ,Lehrmeisterin Natur‘ beispielsweise, deren Zeichen und Hinweise vom Subjekt zu deuten sind, ist ein Topos sowohl der Naturlyrik wie auch des hier zu erörternden Œuvres. „Vom Efeu können wir viel lernen“, heißt es in Besternte Ernte (1976):
Das Grünsein lehrt er uns. Das rasche Ranken.
Den spitzen Auslauf und, um den Gedanken
noch abzurunden: auch das Haften bleiben.27
Hier wird die Deutung noch verweigert, denn was man sehen kann, ist schon Deutung genug. In späteren Gedichtbänden wird diese vordergründige Komik subtiler, werden ,echte‘ Interpretationen angeboten, sieht sich der Sprecher im Spiegel der Natur, zum Beispiel „Beim Anblick des Fregattvogels“ in Körper in Cafés. Der Fregattvogel, ein ausgezeichneter Segler, ist dort die Inkarnation des Vogels an sich.28 Er ist „zu reinem Flug“ geronnen, was sprachlich-bildlich einer Paronomasie entspricht, denn „gerinnen“ wäre „erstarren“. Hier aber ist „der Inbegriff des Schwebens“ Gestalt geworden und hat das ,Prinzip Guinness‘ der Gattung Mensch, das „Höher – Schneller – Weiter“, zur Vollkommenheit geführt, während der Betrachter seine Bodenhaftung nicht überwinden kann. Sein aufrechter Gang ist, gemessen am Fregattvogel, ein „Kariechen“.29
In Im Glück und anderswo legt das Gedicht vom Wiedehopf („Was wäre wenn“) eine allegorische Lesart nahe; vor allem der Ruf (aber auch der Flug und andere Merkmale des Vogels) werden in sprachliche Bilder gefaßt, die der Deuter wie auch der Leser des Gedichts auf sich beziehen müssen:
Fehlte der Wiedehopf,
fehlte noch mehr:
[…]
fehlte dies Ich bin ich
fehlte dies Sei wie ich
fehlte dies Ihr könnt mich
fehlte dies Du bleibst Du.30
Profane Allegoresen dieser Art kommen seit „WimS“ (1964ff.) und „Arnold Hau“ (1966) in allen nur denkbaren Spielarten vor und thematisieren die Grenzen oder Übergänge zwischen Sinn, Nichtsinn und Unsinn. „Deutung eines allegorischen Gemäldes“, ein Gedicht aus Wörtersee, sei hier als Beispiel genannt.31 Und was in den Gedichten als Vor- und Gegenbilder seitens der Lehrmeisterin Natur aufgeboten wird, hat eine Spannweite vom absurden Vergleich zum Zerrbild und zur innovativen Metapher.
Die Anspielungen auf Stimmen oder Texte fremder Provenienz verstehen sich als Mischform von Hommage und Parodie, erschöpfen sich aber nicht darin. Sie thematisieren auch den heutigen Stellenwert rhetorisch-poetischer Figuren wie Allegorie und Metapher oder kleiner Gattungen wie Merkvers und Sinnspruch. Sie wären ohne Komik, was sie sind: verbrauchte Formen, konventionalisierte Sprechweisen, strapazierte Bilder. Doch wo Komik spürbar wird, lassen sie sich sehr wohl noch einsetzen, wie zum Beispiel „Hinter Darmstadt“:
HINTER DARMSTADT
Sitzt der Mensch
im Bordrestaurant,
hat er ein Gegenüber.
Trinkt da im Spiegel
und ißt da wer:
„So siehst du aus, mein Lieber!“
Schaut der Mensch
zum Zugfenster raus,
sieht er da tote Kiefern.
Denkt er, es wäre doch
denkbar, daß sie
bald meinen Sarg beliefern.
Hat der Mensch
seinen Teller geleert,
rührt sich da Hunger nach Hoffen.
Hebt er das Glas
und prostet sich zu:
„Noch ist das Fahrtende offen!“32
Völlig ungerührt, dem Memento mori der Natur kaum einen Blick schenkend, setzt der Sprecher seine Lebensreise fort. Zweimal gönnt er sich den Blick in den Spiegel. Die toten Kiefern machen ihm seine eigene Lebendigkeit bewußt. Der Tod wird verlacht: Jeder Gedanke an ihn ist Verschwendung. „Hinter Darmstadt“ spielt auf „Denk es, o Seele!“ an, eines der bekanntesten Gedichte Eduard Mörikes; es ist in zahllosen Anthologien und Lesebüchern bis heute zu finden.33 Das Mörike-Gedicht zeigt das Ich und die Seele im Zwiegespräch. Es zeigt „die Gegenwart des Todes – mitten im Leben“ und in höchster Stilisierung.34 Bei Gernhardt folgt die Profanierung auf dem Fuße: An die Stelle der Seele tritt das Spiegelbild, an die Stelle der schwarzen Rösser, die dereinst den Leichenwagen ziehen werden, der D-Zug mit Bordrestaurant, an die Stelle der letzten Fragen der kleine Hunger zwischendurch. Ein abgeklärter Herr: Wer ihm mit dem Tod kommen will, darf nicht selber schon gestorben sein.
Konstanter Kanon, variable Bezüge
Wenn sich ein Œuvre in die Phalanx der Großen einreiht, dann will es sich kanonisieren. Das erscheint gerade dann notwendig, wenn die dafür eigentlich zuständigen Instanzen, Verlage, Literaturkritik, Literaturwissenschaft und Leser, ihrer Aufgabe nicht nachkommen. So hat es Gernhardt am eigenen Werk bis Wörtersee (1981) erfahren.35 Inzwischen aber tragen die Kanonisierungsbestrebungen erste Früchte, fand sein Œuvre Aufnahme in Schulen und Universitäten, in wichtige Lexika und einschlägige Anthologien, und damit hat auch das ,Zitat‘ einen anderen Stellenwert bekommen. Für den Autor bietet es sich daher an, auf das Eigene zurückzukommen, zumal wenn er selbst schon das Notwendige zum jeweiligen Thema gesagt hat.
Vor der Horizontlinie eines so stetig vermehrten Œuvres kommen dann fast zwangsläufig die eigenen Wegmarken in den Blick. Lebenslaufmetaphern beispielsweise stiften Verbindungen zwischen ganz verschiedenen Bildbereichen, indem sie immer wieder dasselbe Thema gestalten: Die Angst, sich im Leben festzulegen, sich selbst die Stäbe zu stecken, die am Ende den Käfig bilden und den letzten Fluchtweg verschließen. „Sie saßen doch selber in der Falle“, heißt es in Ich Ich Ich über die großen, erfolgreichen Maler der Moderne, die sich, „das Œuvre im Rücken“, die Villa schuldenfrei, in „hundertfach wiederholte[n] Spontaneitäten“ erschöpft haben. Dagegen begehrt der Sprecher auf:
Man wird doch nicht Künstler, um ein Leben lang Braque zu malen!36
Biographie, so ein Gedicht in Weiche Ziele, bedeute nicht Identität und Status quo, sondern fordere Beweglichkeit und Wandlungsfähigkeit:
Halte dich querfeldein.
Meide die Herden.
Pfeif auf ein eigenes Ich,
und du wirst gleichzeitig
Dachs bleiben, Windhund sein
und Löwe werden.37
Freilich muß auch der Bewegliche sich festlegen, muß auch der Individualist seinem Kind einen Namen geben, wie es in Gernhardts Dankesrede zur Ehrenpromotion heißt. Daher entkommt auch der noch so spontane Künstler dem „selbstgemauerten Kerker“ nicht, sei es ein Chagall, ein Matisse oder ein Proteus wie Picasso:
Man wähnte ihn ständig verwandelt.
Doch werden all diese Volten
durchweg als Picasso gehandelt.38
Dem Wunschbild, frei zu bleiben, entspricht das Bild des Künstlers als Gefangener. Biographie heißt auch, daß die Möglichkeiten schwinden, daß kein Weg zurückführt „ins helle, ins besonnte, / ins unvergeßne Glück“, als man „nichts war und konnte“.39 Wiederum böte sich hier an, auf das Gedicht von Baghira zu sprechen zu kommen, wo genau dieses Dilemma beschrieben wird: Die Hoffnung auf Unbestimmtheit einerseits, die Notwendigkeit andererseits, Zeichen zu setzen, Flagge zu zeigen, Räume zu besetzen, die sonst unbesetzt blieben oder von anderer Seite besetzt würden. Gernhardt hat nicht zuletzt deshalb eine eigene Autorentheorie und Produktionsästhetik elaboriert, weil mit der Selbstvergewisserung eine Qualitätssicherung auf eigenem Terrain verbunden werden konnte.
Das Ende steht fest
Jeder, der auf sich hält, braucht Wahlmöglichkeiten. Beweglich bleiben heißt virtuos werden. Der Weg zur Virtuosität führte bei Gernhardt über das große Formengedächtnis der abendländischen Dichtungstradition. Schon als Schüler hat er sich in fremde Klänge eingehört, den „hohen Ton“ der Gedichte von Albrecht Goes imitiert, schon zu Schulzeiten entsteht ein „Ezra-Pound-Echo“ und wird nach der Formel ,Parodieren geht über Studieren‘ der Deutschlehrer gefoppt:
Wer wird denn ein Gedicht auswendig lernen, wenn er selber eines zu dichten vermag? Daher beschloß ich, einen Trakl zu schreiben, mit allen Schikanen, dem trakl-typischen a-b-b-a ebenso wie mit einem ordentlichen Hauch von Verfall, und alles derart haarscharf an der Parodie entlangschrammend, daß der Schwindel nach menschlichem Ermessen nicht auffliegen konnte.40
Dem Vortrag, erinnert sich Gernhardt, schloß sich eine „einfühlsame, vielstimmige Interpretation“ an, ein Triumph des Nachdichters über den Nachbeter, zumal sein „Trakl“-Gedicht im direkten Vergleich mit einem Werk von Weinheber den Sieg davontrug.41
Wie groß erst wäre dieser Triumph im direkten Vergleich mit Trakl! Im Grunde will der Parodist ja, daß seine Parodie als solche erkannt wird. Anspielungen stiften eine Gemeinschaft der Wissenden, die Kenntnis des Angespielten als Vorbedingung vorausgesetzt. In einer Kultur mit Bildungseliten kann sich der Autor auf das kulturelle Wissen seiner Leserschaft einstellen und gezielt Bildungsversatzstücke einbauen. Anspielungen auf das eigene Werk setzen darüber hinaus eine spezifischere Leserbindung voraus und verstärken sie im lesenden und schreibenden Vollzug, so daß es zur Gemeindebildung kommt. Gernhardts Gemeinde ist zweifellos groß und expandierend, aber einem Autor mit so ausgewiesenem Sendungsbewußtsein dürfte der Status quo42 niemals genügen. Da aber Gernhardts Texte sowohl auf kanonische Texte der Weltliteratur als auch aufs eigene Werk anspielen, können sie recht heterogene Lesergruppen in ganz unterschiedlichen Milieus erreichen. Erzielt wird damit eine rückkoppelnde und die innere Einheit des Œuvres optimierende Form der Textreferenz, die zu lustbetonten Lektüren jederzeit einlädt und eine neue Form von Wissensgemeinschaft konstituiert, deren kulturelle Kompetenz mit der Anschlußfähigkeit seines Werkes ständig wächst.43
Mehrfachbezüge auf Texte fremder und eigener Provenienz sind eine besondere Leistung auch der späten Gedichte. „Von der Laufrichtung“ beispielsweise spielt zugleich auf Kafkas „Kleine Fabel“ und auf Gernhardts Roman Ich Ich Ich an, wo es im fünften Kapitel heißt:
„Du mußt nur die Laufrichtung ändern“, würde die Katze sagen (und die Maus fressen) – kein Satz Kafkas hatte sich G nachhaltiger eingeprägt.44
Die „Gottfried-Benn-Phantasie“ verweist zugleich auf Gernhardts Gedicht „Riesling“.45 Der Zyklus „Unworte. Optisch“ ist „Nach Motiven von Johann Wolfgang von Goethes Gedicht ,Urworte, Orphisch‘“ gestaltet und erinnert außerdem an Gernhardts Erzählung „Der Kampf in der Berghütte“ (1986), wo sich der Schriftsteller Rattinger das erste Gedicht des Zyklus („ΔΑΙΜΩΝ. Dämon“) als eigene, spontane Eingebung zurechnet.46
Gernhardts Zyklus „Unworte. Optisch“ ist weder Nachdichtung noch Parodie im engeren Sinne. Während es Goethe darum ging, einige Götterbilder oder Personifikationen „aus dem hellenischen Gott-Menschenkreise“47 redensartlich neu zu fassen und mit der eigenen „Erfahrungs-Lebendigkeit“48 zu konfrontieren, geht es Gernhardt um eine Kritik des Mediums Fernsehen. Die griechisch-deutschen Gedichtüberschriften bei Goethe, Ausdruck der Strategie, das „diffuse Altertum“ mit deutscher Aufklärung zu flankieren,49 werden bei Gernhardt durch eine Kombination von Deutsch und Englisch abgelöst: „Dämon, Trash“, „Das Zufällige, Talk“, „Liebe, Peep“, „Nötigung, Fun“, „Hoffnung, Show“. Während die griechischen „Urworte“ bei Goethe deutsch verjüngt und „aufgeklärt“ werden sollen,50 erfahren die deutschen Begriffe bei Gernhardt eine Übersetzung ins Profane: Das Englische steht hier für die Unterhaltungsindustrie westlich-amerikanischer Provenienz, wie sie bei uns per Privatfernsehen Einzug gehalten hat: Das grassierende Format ,Talkshow‘ („Das Zufällige, Talk“] auf allen Kanälen sowie die Werbung für Telefonsex („Liebe, Peep“) bei den Privaten wären zwei Beispiele für die angeprangerten Fehlentwicklungen. Im Formalen folgt Gernhardt der goetheschen Stanzenform, auch übernimmt er zum Teil Goethes Wortmaterial, zum Beispiel die Wörter „zerstückelt“ und „entwickelt“ und die Wortfolge „keine Zeit und keine Macht“ aus „Dämon, Trash“.51 Die Gedichte organisieren sich – bei Goethe stärker, bei Gernhardt schwächer – zum Zyklus dadurch, daß sie aufeinander Bezug nehmen und sich sogar – bei Goethe – in der gesetzten Reihenfolge fortschreiben.52 Bei Gernhardt kann das letzte Gedicht als Summe gelesen werden: Es beschreibt die Reaktion des mündigen Konsumenten, der den ungezügelten Unterhaltungsdreck des Fernsehens einfach abschaltet.
So hat jeder, „der auf sich sieht“,53 eine Wahlmöglichkeit.
Doch die „Änderung der Laufrichtung“ in Kafkas Gleichnis ist auch bei Gernhardt nicht wirklich eine Option, mit der das Du (die Maus) dem Schicksal (der Katze) auf lange Sicht entkäme. Ähnlich wie im „Lied vom Kriegen“54 steht das Ende fest, die Frage ist nur, wann es eintritt.55 Gernhardts Gedicht „Von der Laufrichtung“ treibt, wenn Kafkas berühmtes Vorbild ,inhaltlich‘ den Erwartungshorizont vorgibt, ein rhetorisches Spiel mit dem Opfer und der einseitig dominierten Beziehung – denn am Schicksal der Maus kann das noch so liebevoll-zärtliche Flöten nichts ändern:
Die Katze Schicksal findet dich,
du allerliebste Maus du56
Komik und Allegorie vereinigen sich hier zu einem gnadenlosen Text, und manch stimmiger Reim auf „windet sich“ findet sich. Das Gedicht reiht sich ein ins Genre der Katzengedichte und variiert zugleich bestimmte Sprechweisen und Tonfälle in Gernhardts Œuvre, mit denen moralische Haltungen vorgeführt werden. „Katz und Maus“ in Körper in Cafés 57 wäre ein Beispiel dafür, das berühmtere Gedicht „Vom Leben“ in Wörtersee58 ein anderes.
Das Werk Günter Eichs steht bei Gernhardt exemplarisch für die mehrfache Kodiertheit der eigenen Texte durch Textreferenz. „Ein Zwiegespräch“ beispielsweise paraphrasiert berühmte Verse aus Eichs Gedicht „Ende eines Sommers“, wo es heißt:
Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?
Wie gut, daß sie am Sterben teilhaben!59
Eichs Gedicht bildet aber auch den Genotext für „Zurück zur Unnatur“, ein Gedicht aus Lichte Gedichte, das mit den Versen endet:
Wer möchte leben
ohne den Trost der Hochhäuser!60
Die Konstellation der beiden Kategorien „Trost“ und „Sterben“, wie sie bei Eich vorgebildet ist, bedarf bei Gernhardts Gedicht „Ein Zwiegespräch“ der näheren Betrachtung. Hier kulminiert „der Trost des Baums“ in dessen Spruch „Sein geht vor Haben“; der Mensch dagegen spricht:
ich habe die Säge.61
Der Gegensatz ist klar, und das ganze Buch über spricht viel dafür, daß „im Glück“ bedeutet „am Leben“ zu sein – was die Frage nach dem Ende freilich nicht beantwortet. So auch in „Die Zypressen“:
Hätte nie gedacht, ich könnte einmal damit leben,
daß auch die Zypressen hinter unserm Hause
einmal sterben würden. Und nun tun sie’s.62
Es gibt keinen Trost, keine stimmige Formel, zu der man greifen kann, ob nun erst die Bäume sterben und dann die Menschheit untergeht oder ob zuerst das Individuum stirbt:
Erst stirbt der Mensch, dann – oder so ähnlich.63
Auch das wieder ein Bezug auf Körper in Cafés, wo im Rahmen der „Montaieser Elegie“ die in den achtziger Jahren oft gehörte Klageformel zitiert und verworfen wird:
Erst stirbt der Wald, dann stirbt der Mensch? Glaub ich nicht dran.64
Die lyrische Städtekritik Zürich-Altstettens im zentralen fünften Kapitel dürfte gleich zwei, wenn nicht sogar drei Eich-Gedichte zum Vorbild haben: Das nahezu gleichnamige „Vom Zuge aus“ (1933) sowie „D-Zug München-Frankfurt“, ein Gedicht von 1949, das in zwei Fassungen existiert, die beide – wie Gernhardts Gedicht – mit dem einsamen Wort „vorbei“ auf der letzten Zeile enden. Solche Anspielungen auf Fremdtexte, auf Hesses Gedicht „Stufen“65 etwa, finden sich in allen Kapiteln. Die Textreferenz hat dabei die Funktion, zusätzlich Bedeutung zu stiften und die Interpretierbarkeit zu erhöhen; außerdem schmuggelt sich Gernhardt auf diese Weise in den Kanon ein und bietet seinerseits Anschlußmöglichkeiten. Ein Beispiel dafür ist die von Klaus Stieglitz fortgeführte „Poesie-Staffette“, die ihren Ausgang von Ror Wolfs Zyklus „waldmanns abenteuer“ nahm, von Gernhardt in den „Dorlamm“-Gedichten fortgeführt wurde und bei Klaus Stieglitz ihren – sicher nur vorläufigen – Endpunkt fand.66
Der Rückbezug auf eigene Texte bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die innere Konsistenz des Œuvres zu steigern: „Was sich ab jetzt Zukunft nennt“67 und ungewisse Freuden, Leiden und Gefahren birgt, darf alles sein, nur nicht „nichtig“.68 Selbst das, was in der Rezeption als ,Nonsens‘ eingestuft wurde und wird, kann zur Sinn- und Kontinuitätsstiftung eingesetzt werden und hat dadurch mehr Sinn als jemals zuvor, auch in Bezug auf die Fluchtlinie des eigenen Lebens.
So spielt das oben zitierte Gedicht „Hinter Darmstadt“ auf mehrere Gedichte fremder und eigener Provenienz an. Der Genotext, der allen Varianten zugrunde liegt, ist „Denk es, o Seele!“, von Gernhardt mehrfach parodiert und paraphrasiert, zuerst in Besternte Ernte, dann in Wörtersee und jetzt in Im Glück und anderswo. „Dreh es, o Seele“, die Parodie von 1976, spricht ebenso wie „Zu einem Satz von Mörike“, die Parodie von 1981, von der Fluchtlinie der Zeit, der Vergänglichkeit.69 Die Poesie-Stafette führt hier von Mörike über zwei Etappen/Gedichtbände zur – vorläufig – letzten Station und ist einerseits offensichtlich, wenn man sich den direkten Bezug per Gedichttitel vor Augen hält, und andererseits vergleichsweise klandestin, wenn man nach textuellen Übereinstimmungen aller Gedichte fragt. Dabei fasziniert, wie sich ein Gedicht, das Gernhardt einmal Anlaß gab, parodiert zu werden, in seinem Werk immer neue Akzente setzt: Die Parodie in Besternte Ernte erfordert keine Auseinandersetzung mit der Vorlage und setzt auch die Kenntnis von Mörikes Gedicht nicht voraus; die Parodie in Wörtersee, die mit wörtlichen Übernahmen arbeitet, macht keinen ernsthaften Versuch, einen Gegengesang zu Mörike anzustimmen, sondern nimmt sich eine ganz und gar abwegige Lesart vor und treibt sie damit ins Absurde – zwei Formen anarchischer Komik, wie man sie mit der Neuen Frankfurter Schule verbindet. Die dritte Variante erst setzt sich eingehend mit dem stets mitzulesenden Genotext auseinander; ihre Komik ist dementsprechend verhaltener.
Der verweigerte Reim
Mag ihre Komik auch verhaltener sein, komisch sind sie allemal. Davon jedenfalls geht Gernhardts Dichtungstheorie aus, die das Gedicht als „sprachliche Mitteilung“ faßt, die sich „am Ende reimt“, und den Reim als per se komisch definiert.70 Die Komik des Gedichts teilt sich selbst dann noch mit, wenn das erwartbare Reimwort verweigert wird. „My Generation“ in der obigen Aufzählung ist ein Beispiel dafür:
MY GENERATION
Wir werden nicht schöner.
Wir werden nur böser.
Spielen nicht mehr Erobrer.
Hoffen nicht mehr auf Jünger.
Wir werden zwar klüger,
doch wir werden nicht weiser.
Werden älter und lauter
und uns fortwährend fremder.
Wir mögen vergessen,
doch niemals vergeben.
Uns eint eins: Ein Sterben.
Das ist unverzeihlich.
Hier steht „Erobrer“ (I, 3) statt Erlöser, „lauter“ (II, 3) statt leiser, „Sterben“ (III, 3) statt „Leben“. Mit schöner Regelmäßigkeit wird im dritten Vers einer jeden Strophe eine Erwartungshaltung unterlaufen und damit zugleich aufgebaut. „My Generation“ spielt damit subtil auf ein früheres Gedicht an, auf „Weder noch“ in Körper in Cafés, wo der hier verweigerte Reim „böser – Erlöser“ bereits gebildet worden ist:
WEDER NOCH
Ach nein, ich kann kein Schächer sein,
da müßt’ ich wilder, frecher sein,
wahrscheinlich auch viel böser;
und weil ich lau und feige bin,
nicht Bratsche und nicht Geige bin,
langt’s nicht mal zum Erlöser.71
„Schächer“ und „Erlöser“ konnotieren den Kreuzestod Christi, sind also kulturell hochgradig besetzt. Um so anstößiger fällt die Bewertung der beiden ,Rollen‘ aus: Für das „Ich“, welches sich eine kriminelle Karriere erträumt, ist es erstrebenswert Schächer zu sein, nicht aber Erlöser zu werden, was ihm auch verwehrt wäre, denn zum Erlöser, so will es die christliche Lehre, wird man geboren. Im übrigen war Christi Geburt mit einem göttlichen Gnadenakt verbunden, und den kann nur der reuige Sünder erhoffen, nicht aber der, der noch „viel böser“ werden will. Auch in „My Generation“ ist die Heilslehre mehrfach konnotiert, durch den verweigerten Reim „böser/Erlöser“ (I, 2–3) und durch die Lexeme „Jünger“ (1, 4) und „vergeben“ (III, 2). Denkbar ist es, die Rolle des Erlösers zu „spielen“ (wenn man schon nicht der Erlöser sein kann), man hat aber nicht den Erlöser, sondern den „Erobrer“ gegeben und Hoffnungen daran geknüpft. Doch selbst damit ist es jetzt vorbei: Alter, Entfremdung, Tod bilden den Erwartungshorizont der Generation.
Der Reim gehört zum internen Ordnungssystem des Gedichts, er erzeugt Komik. Er wählt, wenn er „Erlöser“ auf „böser“ reimt, die anstößigste aller Kombinationen und bleibt doch als Reim rein. Von der inhaltlichen Aussage, die sich mit ihm verknüpft, bleibt er gleichsam unberührt. Diese – wenn vielleicht auch nur zur Schau gestellte – ,Unschuld‘ des Reims verdankt sich seiner ,klappernden Mechanik‘, die auf Gleichklang aus ist und auf nichts sonst.72
Wo der Reim verweigert wird, da lenkt sich alle Aufmerksamkeit auf ihn zurück. Gernhardts Gedicht „Bekenntnis“ ist das vielleicht bekannteste Beispiel dafür.73 Die Störung des Gleichklangs aber verlangt nach Korrektur, nach Wiederherstellung des Reims, die dann – womöglich – erst recht Anstößiges produziert. „Mutter Natur“, eine Klopstock-Variation, mag dies veranschaulichen:
Was ich meine, ist,
Mutter Natur,
ich finde die Frauen,
die sich so gehenlassen, schon mal
per se zum Kotzen.74
In weiteren Strophen kombiniert Gernhardt „Lüste“ mit „Bräute“ oder „Gekröse“ mit „Madam“. Dieses Verfahren des verweigerten Reims hat er oft variiert, man vergleiche etwa in Wörtersee das Gedicht „Juniabend“75 oder in Körper in Cafés das Gedicht „Nacht der Nächte“.76 Es ist eine Technik, die die interne Ordnung des Gedichts durch ihre Negation fokussiert und die zu Gernhardts „Fundus bestens erprobter rhetorischer Haltungen, Figuren und Tricks“77 gehört.
Der Kreis schließt sich
Dieser Fundus umfaßt mittlerweile einen ganz eigenen Anspielungsraum mit einer Fülle externer Bezüge. Ein Netz entsteht und wird immer dichter geknüpft. Und während die poetischen Techniken in immer neuen Varianten erprobt werden, lassen sich die Textreferenzen in wenige Kategorien zusammenfassen: Die ,einfache Anspielung‘ referiert auf eigene oder fremde Texte und Stimmen; die ,doppelte Anspielung‘ nimmt sich dieselben Texte und Stimmen noch einmal vor, stimmt einen neuen Gegengesang an oder stellt sie in andere Umgebungen; sie deutet damit auf neue Interessen, wechselnde Perspektiven und vielleicht auch auf Aporien bisheriger Paraphrasen. Eine solche Aporie hat Gernhardt in seinem Band Was gibt’s denn da zu lachen? formuliert:
Frage der Fragen. Die Frage ist doch: Wann kriegen sie dich? (Ich, der 14jährige, auf dem Fahrrad, im Begriff, in die Innenstadt von Stuttgart hinunterzuradeln, bin plötzlich erfüllt von einem Vorsatz, einem Versprechen, ja fast einer Gewißheit: Sie sollen dich nicht kriegen!)78
Im „Lied vom Kriegen“ wird dieses Motiv aufgegriffen, das bisher zu solitär war, um gestaltet zu werden. Bisher wurde es thematisch immer nur ,angespielt‘, blieb ,dunkel‘ und halb unbewußt oder paßte in die biographische Reminiszenz nicht hinein, jetzt aber ist es plötzlich darstellbar und bekommt Gestalt.
Ein Gedicht aus dem zentralen fünften Kapitel, „Tübinger Feststellung“, malt das Bild zweier Enten auf dem „Fluß der Zeit“ und führt zugleich vor, wie sich ein Motiv entzieht:
Der Fluß zieht seinen Weg geschwind,
sie bleiben auf der Stelle.79
Der Sprecher und Schreiber greift zum Stift und blickt dann wieder flußwärts, um das Bild im Worte festzuhalten, jedoch:
Die Enten auf dem Neckar hats
vertrieben auf die Schnelle.80
Das Gedicht hat die gleiche Ausgangslage wie das 15 Jahre zuvor entstandene Gedicht „Tretboote auf dem Main“ in Körper in Cafés.81 Auch hier will der Betrachter in Worte fassen, was er sieht, bis plötzlich aller „Zauber“ endet. Die Darstellung des Schönen scheitert, aber die Darstellung des Versuchs der Darstellung des Schönen gelingt. Der Betrachter, der sich eben noch nach einer festen Stelle im Fluß der Zeit gesehnt hat, ist beweglich geblieben und hat sich neu positioniert. Was bleibt, ist – immer – ein Gedicht.82 Die Verse aber üben sich – in Situationen und Momenten, in Reim und Anklang, in Redensart und Spruch – ein in die Dynamik einer einfachen Wahrheit:
Es ist auf dieser Welt kein Platz
für eine feste Stelle.83
Ein Bild, ein Wort, Gleichmaß und Zauber. Das Bild ist weg – und dennoch glückt das Gedicht. In solchen Augenblicken erfährt der Betrachter Glück und schöpft Geglücktes aus seiner Wortkunst. Ihm „steht das Wort ja so was zu Gebot“,84 daß es besser gar nicht sein kann. Und dennoch muß die Frage nach dem Glück und dem Glücken immer wieder neu aufgeworfen werden:
Ihr glücklichen Tage!
Nur wen ihr beglückt,
der kennt glücklose Nächte.
Wir glücklichen Menschen!
Vor unserem Glück erst
erstrahlt hell euer Unglück.85
Eine Gegenstimme zu Goethes Türmer im Faust.86 Sie argumentiert mit dem Grundwort: „Der Wortstamm ist: Glücken“, heißt es nicht ganz korrekt, denn der Stamm wäre einfach nur „[g]lück“. Das Glück aber gibt die Perspektive vor, liefert die Grundierung für Unglück und Gegenglück. Andererseits das Unglück: Es bedarf des Glücks, weil es ohne Glück nicht erfahrbar wäre. Das Glück hingegen bedarf der „Folie des Unglücks“ nicht, es glückt ohnedies. Ein ganz neuer Gedanke, denn bislang galt es als ausgeschlossen, das Glück ohne „Unglücksgrundierung“ zu bestimmen. Jetzt plötzlich scheint die Möglichkeit greifbar nahe, vom reinen Glück zu sprechen:
Wie übers Glück reden?
Wenn das einmal glückte:
Wäre das nicht das Glück?87
Das wäre, wenn es gelänge, der Ausweg aus einer Aporie, die Gernhardt nicht zum ersten Male thematisiert: „Scheiß der Hund drauf, das Gelingen / läßt sich einfach nicht besingen“, heißt es beispielsweise in „Leiden und Leben und Lesen und Schreiben“ von 1987.88 Jetzt erfolgt ein neuer Versuch: Ganz sachlich spricht er, fast nur sprachlogisch argumentierend. Es geht darum, das Glück, ausgehend von der Erfahrung des Glücks, als Prinzip des Daseins zu bestimmen.
Schon das erste Gedicht also stimmt den Leser auf das Generalthema des ganzen Bandes ein. Natürlich mischen sich dann, wie es die Erfahrung lehrt, wieder auch andere Farben zu: Neben die Segnungen des Lebens tritt die Verdammnis89 und neben die Vollkommenheit der Makel.90 Unglück aber, „Mißglücken“ und „Nichtglücken“,91 können als Aspekte der dargestellten Welt das Glücken der Darstellung weder beeinträchtigen noch fördern. Nicht einmal das „Gegenglück“, wie die Pathosformel bei Gottfried Benn lautet, kann dem Glück entgegenstehen. Der Zeichner Gernhardt hat Benns Wortschöpfung 1981 in Wörtersee komisch ins Bild gesetzt, sich einen Frosch imaginierend:
Einsamer nie als im August […], dienst du dem Gegenglück, dem Geist.92
Und wer wollte behaupten, daß diese kongeniale Umsetzung Benns ins Bild nicht gelungen wäre. Gleichwohl hat sie der Autor 1987 in Körper in Cafés erneut aufgegriffen, diesmal mit Distanz zur Domäne des Dichters:
Aufs Gegenglück, den Geist,
ist doch gepfiffen,
der Herden Glück, das Fleisch,
ist angesagt:
ich will heut abend nicht allein,
ich will ein Teil der Herde sein.93
Der Kunst zu dienen ist das eine, das Leben ist das andere. Hier wie dort sind Glückssucher unterwegs und suchen nach Erlösung, sei es im Vollkommenen, sei es im Banalen. Die Rede vom Glück trifft da keine Vorentscheidung: Ihr kann alles glücken, wenn Glück den Urgrund aller Beschwörungen bildet.
Lutz Hagestedt, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, S. Fischer Verlag, 2002
Bewundert und nie ganz ernst genommen
– Es wäre unsinnig, ihn mit Benn und Brecht, Huchel, Eich, Celan, Jandl oder der Bachmann auf eine Stufe zu stellen. Aber: Er wurde unterschätzt. So wie sein Vorgänger, Erich Kästner. Marcel Reich-Ranicki über Robert Gernhardt. –
Eva Marie Knopf: Ist Robert Gernhardt, der im Dezember siebzig Jahre alt geworden wäre, einer der größten deutschen Lyriker?
Marcel Reich-Ranicki: Solche Superlativfragen sind sehr beliebt, doch in den meisten Fällen ergeben sie so gut wie nichts. Wer ist der wichtigste, der originellste Komponist der Welt? In meiner Jugend wurde Beethoven vorgeschlagen, heute eher Mozart – und gestern wie heute Bach. Wenn in einer Gesellschaft jemand lauthals erklärt, Shakespeare sei der bedeutendste Dramatiker aller Zeiten, meldet sich ein anderer mit einem leisen Widerspruch: Man solle doch bedenken, was Sophokles an Bühnenwerken vorgefunden hat, als er für das Theater zu schreiben begann. Dann werde man vielleicht Sophokles für den besten Stückeschreiber halten. Das kann ja sein. Nur interessieren mich derartige Befunde überhaupt nicht.
Aber da liegt die Frage nach Robert Gernhardt. Ist er nun einer der größten deutschen Lyriker? Nein, es wäre natürlich unsinnig, ihn zusammen mit Goethe, Hölderlin oder Heine zu nennen, mit Eichendorff, Brentano und Mörike. Das meint auch nicht die Briefschreiberin aus Berlin. Geht es ihr um das zwanzigste Jahrhundert? Da kommt wohl für den Platz 1 vor allem Brecht in Betracht. Doch sollte man nicht übersehen, dass manche Literaturkenner hier eher Benn ins Gespräch bringen würden.
Nach 1956 (in diesem Jahr starben Benn und Brecht) wird das Feld weniger übersichtlich. Man könnte an einige Namen erinnern: Peter Huchel, Günter Eich, Ernst Jandl, Ingeborg Bachmann, die alle nicht mehr leben, und noch einige andere. Und Robert Gernhardt?
1937 geboren, musste er auf den ihm zustehenden Erfolg lange warten. Erst auf dem letzten Abschnitt seines Lebens (er starb im Jahre 2006) wurde er anerkannt: als Satiriker und Humorist, als Poet und Zeichner.
Hat er die Preise erhalten, die er alle verdient hat? Davon kann keine Rede sein. Man nahm ihm das Leichte übel, seinen Witz, seine Originalität, seinen Humor. Er wurde so unterschätzt wie sein Vorgänger Erich Kästner. Er wurde bewundert und nie ganz ernst genommen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.9.2007
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IMDb + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + IMAGO
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.


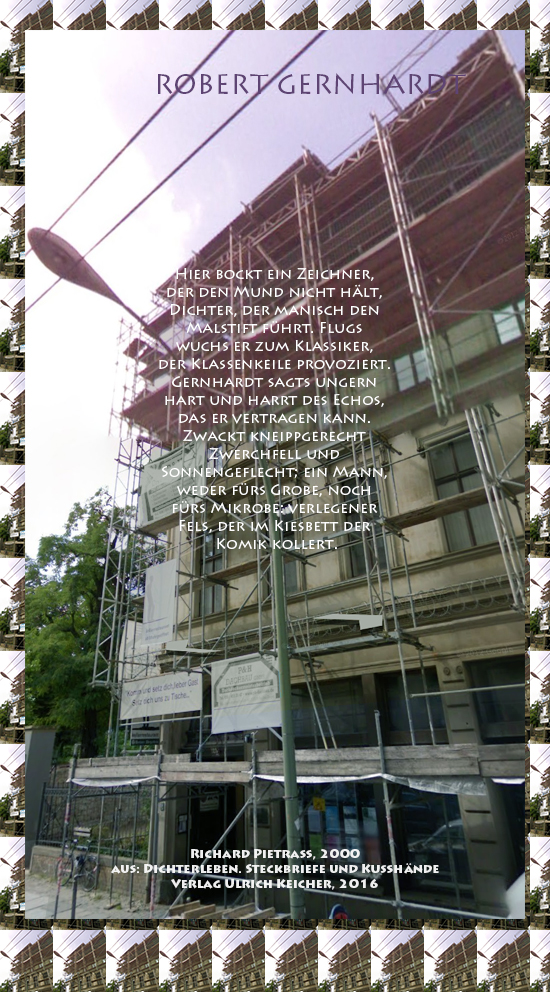












Schreibe einen Kommentar