Robert Gernhardt: Körper in Cafés
SPASSMACHER UND ERNSTMACHER
I
Seht: Alles Ernste ist alt. Die Bücher
Welche da reden von Gott und dem Anfang
Sind alt. Und das Alter des Ernstseins
Adelt auch den, der noch heute uns ernst kommt.
Aber der Spaßmacher! Hört wie die Menge
Ihm noch den trefflichsten Witz mit den Worten
„Der ist ja alt“ verwandelt in Asche,
Gestrigen Schnee und dauernde Schande.
II
Wenn um die Wiege sich sammeln des Winzigen
Die Ernsten, und wenn er sie ankräht, ja dann
Lachen auch sie. Doch welch seltsames Lachen
Wird ihm zuteil da! Voll Milde, voll Tücke.
Mild belächeln die Ernsten des Lustigen
Schuldlose Lust: Lach nur so weiter!
Tückisch verlachen sie ihn: Na warte!
Noch bist du nicht wie wir, doch du wirst so.
III
Nicht wird er froh seines Lebens, der Spaßmacher.
Immer ist unter jenen, die lachen,
Der, welcher nicht lacht. Versteinerter Miene
Folgt er den Späßen des Spaßenden. Immer
Dauert er ihn. Doch es dauert nicht lange,
Und er bedauert sein Los, lachen
Zu machen die Menge, in welcher doch immer
Einer nicht lacht: Sein Opfer, sein Richter.
IV
Hart ist das Ernstsein. Denn eiserne Knochen
Krankheit und Tod und ach! Leiden der Seele
Geben Gewicht ihm und Stütze. Nimmer
Kann selbst der bissigste Witz diesen Brocken,
Starrend von Blut, von Schweiß und von Tränen
Prall bis zum Bersten, voll Schmerz, voller Grausen,
Verschlingen. Noch kann er ihn – wie denn? – verdauen.
Kann also nichts? Nun: Er kann ihn verarschen.
V
Ach, daß man nicht ihn nennte, den Spaßenden,
Leichtfertig! Leicht nicht ist es, den Witz zu
Erhaschen. Flüchtig ist er und flink und verschlagen:
Fertig macht der Gejagte den Jäger.
Aber der Andre! Schwerfällig stapft er
Gemessenen Schritts durch den Garten des Lebens.
Leicht jedoch fällt ihm der Griff nach dem Ernsten:
Pralle Frucht vom Baum der Erkenntnis.
VI
Groß sind die Ernsten. Auf hohen Kothurnen
Schreiten sie streng. Doch es ehrt sie die Menschheit,
Weil sie so streng sind. Nur ernstestes Schreiten
Leitet den Menschen zum höchsten der Ziele,
Zum Sinn. Rattenhaft aber folgen die Spaßer
Und hurtig dem Zug, denn sie wittern begierig
Das, was seit alters bei jeglicher Suche
Nach Sinn für sie abfällt: Den Unsinn.
VII
Denkt jenes Reiters! Von Scholle zu Scholle
Trug ihn sein Pferd, doch es ward ihm am Ufer
Nicht Rettung beschieden, Erkennen und Tod nur.
So auch der Witzbold. Es dulden die Witze
Rast nicht noch Ruh. He! Weiter und weiter!
Kennen Sie den? Und da fällt mir noch der ein!
So geht’s in die Irre. Heimwärts aber,
Auf festester Straße, ziehet der Ernstbold.
VIII
Wenn der Dichter uns fragt: Immer spielt ihr und scherzt?
Und er fortfährt: Ihr müßt! O Freunde! Mir geht dies
In die Seele, denn dies – und so schließt er gewaltig:
Müssen Verzweifelte nur. – Wer wollte
Da widersprechen? Die Frage gar gegen
Den Fragenden richten: Du, der du niemals
Scherztest noch spieltest – warst du denn je glücklich? – ?
Die Verzweiflung ist groß. Sie hat Platz für uns alle.
IX
Lachen ist Lust, jede Lust aber endet.
Auch so ein Satz, der das Nicken der Köpfe
Hervorruft der Ernsten, welche das Leben
Ja kennen. Was aber wissen die Ernsten
Vom Leben? Wissen doch nur, daß ihr Feuer
Erloschen. Wissen doch nur, daß ihr Fluß
Versiegt ist. Wissen doch nicht, daß ihr
Wissen nur Lust macht, endlos zu lachen.
X
Sagt: Warum heißt man seit alters sie
Gegensätze? Das Tiefe, das Flache? Sind nicht
Verschwistert sie? Es gehet unmerklich
Das Flache ins Tiefe. Es spüret der Fuß kaum
Den schwindenden Boden des Schwimmers. Also
Mischt sich der Tiefsinn dem Flachsinn, und jene,
Welche da glauben, sie würden noch flachsen,
Wissen sie denn, ob sie längst nicht schon tiefsen?
XI
Wenn aber beide, der Ernste, der Spaßer
Nichts weiter wären als Seiten nur einer
Medaille? Jener, der Ernst, und jener, der
Spaß macht, machen nicht beide? Doch
Träge erwartet, daß man ihr mache
Das Bett, die Menge. Nur keinen Handgriff!
Laßt die nur machen! Uns doch egal
Obs Bett kratzt oder kitzelt!
XII
Wie aber wenn und es schalössen aus sich
Schapaß und das Ernste? Schaweres und Leichtes?
So, wie sich ausschaließt Feuer und Wasser,
Mensch und Schaweinsein, Gott und Schalange?
Es schawebt das Schawert über den Häuptern,
Es kommt zum Schawur für Schawache und Starke:
Was also wollt ihr? Den Leichtsinn? Schawermut?
Tarefft eure Wahl! Der Rest ist Schaweigen.
Die hundert hier versammelten Gedichte,
die 1987 erstmals publiziert wurden, zeigen wiederum die ganze Meisterschaft von Robert Gernhardt. Ungemein heiter, in trockener und lakonischer Sprache schreitet er den ganzen Kreis des Lebens aus: verblaßte Lust und Körperfrust, Heimatliebe und Toscanaglück, Dichterleid und Schicksalsmacht. Schelmisch umkreist Gernhardt die Unannehmlichkeiten des angenehmen Lebens und fügt mit ungeheurer Leichtigkeit Vers an Vers. So spielerisch die Gedichte auch daherkommen, Gernhardt weiß um die lyrische Tradition, in der er steht. Souverän bedient er sich zuweilen der klassischen Formen, um Pointe auf Pointe zu setzen und den hohen Ton genüßlich zu parodieren. Jedes einzelne Gedicht von Gernhardt belegt, daß beste Unterhaltung und geistreiches Dichten eben keine Gegensätze sein müssen. Immer ist sein unverwechselbarer Witz gepaart mit Hintersinn. „Das Tiefe, das Flache? Sind nicht verschwistert sie?“ fragt Gernhardt und fügt listig hinzu:
Welche da glauben, sie würden noch flachsen, wissen sie denn, ob sie längst nicht schon tiefsen?
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1987
Aber wo bleibt das Gelächter
Robert Gernhardt ist ein Profi des Leichten, das schwer zu machen ist. Die sogenannten ernsten Autoren dürfen auch mal ein Tief zeigen. Es kann ihnen immer noch als Scheitern hoch angerechnet werden. Der Spaßmacher dagegen muß immer in Form sein. Denn wenn Lächerlichkeit tötet, so am ehesten den, dem sein Witz mißlingt. Kein Wunder, daß sich nur wenige in der Branche halten. Wir fragen ja nicht, wie einer das über die Jahre hinkriegt, daß sein Salz nicht dumm wird. Wir erwarten einfach Bestform. Hier ist sie. Bei Gernhardt werden wir auch diesmal nicht enttäuscht.
Vielleicht liegt das schon daran, daß er das Problem des Spaßmachers, das eigene Problem, nicht bloß formuliert, sondern ernstnimmt:
Immer ist unter denen, die lachen,
Der, welcher nicht lacht.
Diesen einen möchte Gernhardt besiegen. Er ist ihm vermutlich der liebste, denn er verlangt ihm mehr ab als die Gemeinde, der Fan-Club. Es könnte ein Leser von Wörtersee sein, der sich wohl amüsierte, aber nun, von neuen Gedichten, mehr verlangt – Tiefsinn im Flachsinn. Der Zögernde und Widerspenstige, der zuletzt lacht, lacht der nicht am befreiendsten?
Aber gibt es überhaupt etwas zu lachen? Ich stelle mir einen eher mißmutigen, ja melancholischen Leser der Körper in Cafés vor. Schon aus dem Titelgedicht zieht er Nahrung. Was ist mit diesen Menschen, die ihre Lässigkeit in der Öffentlichkeit demonstrieren? Sie haben ihre Probleme, die gesellschaftliche Mechanik in die Intimität zu retten:
Aber dann in den vier Wänden
müssen Körper Flagge zeigen.
Voll hängt er in ihren Sielen
und die Hölle voller Geigen.
Eros als Leistungssport. Aber Gernhardt hütet sich, das Problem gesellschaftskritisch zu vertiefen, zu beschweren. Er hat aber Mitleid mit denen, die sich da plagen. Siege und Niederlagen sind ihm vom eigenen Metier her bekannt. Und so zeigt der Autor seine Flagge, die Flagge der Melancholie.
Er steckt sie – zwischenzeitlich – auch wieder weg und spielt selber den coolen, analytischen Typ, der das „Beziehungsgespräch“ kommentiert, das „immer dasselbe“ meint. Die Sache ist bekannt, da zeigt der Poet keinen Ehrgeiz, aber er bringt sie noch einmal auf den Punkt – etwa wie den in Haßliebe verstrickten Partnern das Wort zur Waffe wird „wie sooft schon, wenn vor dritten / Zwei an ihrem Einssein litten“. Der melancholische Befund gewinnt dennoch Heiterkeit – durch Reim und Zahlenspiel.
Aber mit dem Witz ist es wie mit der Lust:
Als dann die Lust kam, war ich nicht bereit.
Wie gerne möchte das lyrische Ich hedonistisch genießen! Aber dann steht es sozusagen neben seinem Genuß und muß zusehen, wie er etwas Fremdes und das ganze Mißverhältnis nur noch komisch wird. Komisch wird dann auch gleich das Pathos, in das der Betrogene sich flüchtet. Es klingt schon fast asketisch und kirchenväterlich, wenn gefragt wird:
Sag mir bitte dann, warum sich
ständig Fleisch dem Fleische gattet.
Wer spricht das überhaupt? Ich Ich Ich könnte der Autor mit dem Titel seines Romans antworten – aber dreimal „Ich ist weniger als einmal, auch wenn ein ganzes Kapitel des Gedichtbuchs „Ich“ überschrieben ist. Die „Revision im Spiegel“ ergibt wenig Erfreuliches:
Dann ein Blick aus meinen Augen –
und ich weiß, wieviel wir taugen.
Das Ich als Wir. Indem der Poet sich anschwärzt, uns mit anschwärzt, gewinnt er unsere Sympathie.
„Es gibt kein richtiges Leben im valschen“ – so (mit dem Titel eines Prosabändchens) läßt sich die Philosophie auch von Gernhardts Lyrik umschreiben: Frankfurter Schule im Verfallsstadium. Einen Jux will er sich machen, dieser Gernhardt. Er sieht die gesellschaftliche Misere, er kennt die literarische Tradition. Veränderung ist nicht mehr möglich. Nun will er spielen. Wie verbindet man Platens hochpathetischen „Tristan“ mit der Tristesse des modernen Wohnungsbaus? Ein Vierzeiler genügt:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
ist dem Tode schon anheimgegeben?
Jedenfalls wird er fürs weitre Leben
schlecht zum Mieter der Nordweststadt taugen.
Wo Gernhardt selbst offenbar nicht wohnt. Da er kein soziales Engagement heuchelt, muß er auch kein Privileg rechtfertigen. Er spricht von seinem Haus in der Toscana („Der Glückliche! Hätten wir auch gern!“) und kann zugleich von der Erfahrung sprechen, „Wie alles den Bach runtergeht“. Das mag man zynisch finden, verlogen ist es jedenfalls nicht. Und wo das moralische Argument nicht mehr greift, bleibt ohnehin nur der Rückgriff auf die Ästhetik. Da das Schöne nicht mehr „mit Augen“ zu schauen ist, muß es eine Ästhetik des Häßlichen sein. Sie ist prägnant formuliert und wirkt so komisch wie klassisch:
Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer.
Das Häßliche erfreut durch Dauer
Man solle doch von den Klassikern lernen, meint Gernhardt in einem anderen Gedicht scheinheilig. Und was könne man vom Manne Brecht lernen? Die Wahrheit, schlägt Gernhardt vor, wie es wirklich mit ihm und den vielen Frauen gewesen ist. Ließe Gernhardt sich festlegen, würde man vielleicht von materialistischer Melancholie reden. Doch ein Vers wie „Der Geist ist weich. Das Fleisch bleibt hart“ ist weder Bekenntnis noch Provokation. Gernhardt muß schon mit obszönen Motiven kommen, um das Frozzeln und Finassieren zu vergessen.
Aber wo bleibt das Gelächter ? Weiß der Teufel, wo es bleibt. „Lachen ist Lust“, weiß der Autor, „jede Lust aber endet.“ Und so wetterleuchtet das Lachen im Gesicht des Lesers, um selten einmal auszubrechen. Gernhardt ist mehr Satyr als Satiriker. Er versteht sich auf sein Spiel.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.11.1987
körper in cafés
ist für mich neben dem wörtersee gernhardts bester gedichtband, der die perfekte balance findet zwischen dem nonsens der frühen und dem (gelegentlich doch allzu prononciert vorgetragenen) tiefsinn der späten jahre. um sich davon zu überzeugen, genügt es, sich anzuschauen, wie gernhardt es schafft, das uralte (und eigentlich ja auch schon reichlich abgedroschene) thema „körper und geist“ in immer neuen varianten abzuwandeln – eine origineller und witziger als die andere – ohne banal oder albern zu werden. auch sein unvergleichliches talent, in fremden zungen zu reden, stellt er hier wieder unter beweis, u.a. in einer grandiosen rilke-parodie. wer sich fragt, wieso ausgerechnet ein „komischer“ autor zu den wenigen großen deutschen lyrikern des vergangenen jahrhunderts gezählt wird, der findet die antwort in diesem buch.
Christian Hock, amazon.de, 12.2.2010
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Klaus Modick: Reflektiertes Gelächter
Frankfurter Rundschau, 7.10.1987
Auch in: Der Rabe. Nr. 50, 1997. S. 64–66
Wolfgang Nagel: Vom Flachsen und Tiefsen
Die Zeit, 9.10.1987
Auch in: Der Rabe, Nr. 50, 1997, S. 66–68
Angela Schader: Alltag als Parnass
Neue Zürcher Zeitung, 20.11.1987
Jörg Drews: Aus diesen Jahren unseres Mißvergnügens
Süddeutsche Zeitung, 13./14.2.1988
Zweite Unschuld
– Über den Lyriker Robert Gernhardt. –
Kann man nach zwei verlorenen Kriegen,
Nach all dem Schlachten, schrecklichen Siegen,
Nach all dem Morden, all dem Vernichten,
Kann man nach diesen Zeiten noch dichten?
Die Antwort kann nur folgende sein:
Dreimal NEIN!
Gernhardts Gedicht heißt „Frage“. Die Antwort, die es gibt, ist widersprüchlich. Der Wortlaut sagt nein, die Form sagt ja. Denn Frage und Antwort reimen sich, sie ergeben ein Gedicht. In diesem Fall ist der Gedichtcharakter des Ganzen sogar ausschließlich durch den Reim festgestellt: Würden sich diese sechs Zeilen nicht dreimal reimen, dann wären sie kein Gedicht, und die Antwort auf die einfache Frage – kann man nach den weltgeschichtlichen Katastrophen des 20. Jahrhunderts noch Gedichte schreiben – wäre ebenso einfach wie die Frage, und sie wäre eindeutig: Nein, man kann es nicht. Gernhardts Gedicht ist komisch, und es hat eine Pointe. Komisch ist es durch seine Schlichtheit. Es stellt eine überaus schwere Frage, die in denkbar großem Kontrast zur Simplizität der Paarreime steht, in die sie gefaßt ist. Die Pointe ist der performative Widerspruch von Aussage und Form. Selbst die anspruchslosesten Reime ergeben noch ein Gedicht, auch nach allen Katastrophen des Jahrhunderts: Auch nach 1945 reimen sich im Lexikon der deutschen Sprache Kriege noch auf Siege, vor wie nach Auschwitz reimt sich dichten auf vernichten. Das Gedicht stellt eine Frage, und es beantwortet sie mit einem Experiment. Ein Experiment ist mehr als ein Aussagesatz: Es führt etwas anschaulich vor. Ein Experiment muß funktionieren, um die Zuschauer oder Zuhörer zu überzeugen. Gernhardts Experiment funktioniert. Weil Reim Reim ist, egal wann und wo und unter welchen Umständen.
Darin wiederum liegt nichts Geheimnisvolles. Da es in der Sprache unendlich viele Wörter und bloß wenige Laute gibt, klingen nur wenige Wörter so ähnlich, daß sie sich reimen. Der Reim ist zunächst etwas Phsysiologisches, etwas rein Äußerliches. Aber er funktioniert. Gernhardts Gedicht ist komisch, weil die schwere Frage und die schlichten Reime nicht zusammenzupassen scheinen; schwere Frage und schlichte Reime verzischen in einer Pointe wie zwei feindliche Substanzen, die der Chemielehrer in ein Reagenzglas schüttet und die sogleich in einer Stichflamme aufgehen. So gelingt das Experiment. Die Pointe, in der es verzischt, hat einen tieferen Sinn: Eine Frage, die sich mit einem so simplen Experiment sogar zweifach beantworten läßt, war vielleicht eine dumme Frage, mindestens eine falsche Frage. Sie bringt zwei Dinge zusammen, die vielleicht weniger miteinander zu tun haben, als eine weitverbreitete Kulturkritik einmal glaubte: die Weltgeschichte und die Möglichkeit von Dichtung.
So umständlich muß beginnen, wer den Irrglauben vermeiden will, daß es sich bei Gernhardts Gedichten um eine einfache Sache handle. Und diese schlichten sechs Zeilen werden noch problematischer, wenn wir auf ihre Entstehungszeit zurückblicken. Sie erschienen 1966 in dem Buch Die Wahrheit über Arnold Hau, im dritten Abschnitt „Der späte Hau“, dort in der Rubrik „Der kreative Mensch“. 1966 überschritt die Auflage von Hugo Friedrichs Standardwerk Die Struktur der modernen Lyrik (1956) das hundertste Tausend. Seit sechs Jahren lag Hans Magnus Enzensbergers großes Sammelwerk Museum der modernen Poesie vor. Friedrich wie Enzensberger gaben der modernen Lyrik eine über hundertjährige Vorgeschichte, die bis zu Charles Baudelaires Blumen des Bösen von 1857, ja bis zu den ästhetischen Theorien der deutschen Romantik und des 18. Jahrhunderts zurückreichen sollte. Enzensberger konstruierte darüber hinaus – dabei Friedrichs Beobachtungen folgend – ein gemeinsames lyrisches Idiom, eine Weltsprache der Dichtung, die alle Unterschiede der Sprachen, Themen und Stile überspannte und dabei ein übergreifendes Epochenbewußtsein zum Ausdruck brachte, das sich in bestimmten formalen Errungenschaften ausprägte. Enzensberger zitierte, übrigens nicht ohne Ironie, gängige literaturwissenschaftliche Begriffe wie Dunkelheit, Dissonanz, Formzertrümmerung, Montage- und Zitattechnik, Verweigerung kommunikativer Routine, absolute Metapher. Bei Friedrich erschienen diese Merkmale der modernen Lyrik als Erfüllungen eines immanenten Formgesetzes, Enzensberger historisierte sie: Für ihn waren Dunkelheit und Dissonanz des modernen Dichtens Korrelate der Weltgeschichte seit der Französischen Revolution.
Aus solchen Erwägungen nahm Enzensbergers Museum keine Gedichte von nach 1945. „Ist es überflüssig, zu sagen“, fragte er im Nachwort, „daß Auschwitz und Hiroshima auch für die Poesie Epoche gemacht haben? (…) Die großen historischen Brüche erreichen auch den Vers. Faschismus und Krieg, der Zerfall der Welt in feindselige Blöcke, die Rüstung zum Untergang: dies alles hat auch das Einverständnis der Poesie tief erschüttert. Ihre Weltsprache zeigt seit 1945 Spuren der Erschöpfung, des Alterns. Ihre großen Meister sind fast alle tot. Nur als konventionelles Spiel kann sie fortgesetzt werden, als gäbe es zu ihr keine historische Differenz.“
Diese Diagnose ist ein Echo auf den folgenreichsten literaturkritischen Satz der Nachkriegszeit, jenes dialektische Diktum, auf das Theodor W. Adorno 1951 seinen Aufsatz „Kulturkritik und Gesellschaft“ zulaufen ließ:
Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.
Ich zitiere den Satz vollständig, von dem meist nur die erste Hälfte durchdrang und wie ein Damoklesschwert über dem Dichten in der Nachkriegszeit hing. Ein Jahr vor seinem Nachwort hatte Enzensberger in einer Preisrede auf Nelly Sachs der ersten Hälfte von Adornos Behauptung geantwortet:
Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einen Satz gesprochen, der zu den härtesten Urteilen gehört, die über unsere Zeit gefällt werden können: Nach Auschwitz sei es unmöglich, ein Gedicht zu schreiben. Wenn wir weiterleben wollen, muß dieser Satz widerlegt werden.
Für den jungen Enzensberger wurde er beispielhaft widerlegt in der biblischen, von Haß nicht verzerrten Sprache der Opfer, der alttestamentarisch geprägten Lyrik der Nelly Sachs. Trotzdem hat er keine Gedichte von nach 1945 in sein Museum aufnehmen wollen, weder Verse von Nelly Sachs noch Poesie von Ingeborg Bachmann oder Paul Celan. Dessen „Todesfuge“ wurde zum prominentesten Beispiel einer Lyrik, die „nach Auschwitz“ bestehen durfte, erstens, weil sie thematisch an Auschwitz erinnerte, und zweitens, weil ihre Sprache so dunkel und in ihrer Schönheit so erschreckend wirkte, daß niemand sie mit der abendländischen Schönschreiberei verwechseln konnte, gegen die Adornos harte Äußerung gerichtet war.
Denn Adornos Affekt richtete sich ja gewiß nicht gegen verrätselte Gebilde wie das Celans, sondern gegen die wiederauferstandene Kultur, die sich mit hohem, feinsinnig tragisierendem Ton im Mulmigen einrichtete, also gegen Nachkriegslesebuchdichter wie Hans Carossa oder Werner Bergengruen. Nun paßte allerdings Adornos Satz, Gedichte nach Auschwitz seien barbarisch, selbst sehr genau ins kulturkritische Reden der fünfziger Jahre, er konnte zur Not durchaus jene mulmige Innerlichkeit möblieren, gegen die sich seine Kritik an der restaurativen Kultur richtete. Daher die hellsichtige zweite Hälfte des Satzes: Daß Gedichte nach Auschwitz zu schreiben barbarisch sei, fresse auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben. Damit hat Adorno, übrigens wenig erfolgreich, versucht, sein Diktum vor der Klischeewerdung zu bewahren.
Es war also ein ideologisch schwer vermintes Gelände, auf dem der junge Robert Gernhardt 1966 seine auf komplizierteste Weise einfache Frage stellte. Gernhardt griff Adornos tausendfach von Feuilletonistenmund zu Deutschlehrermund getragenen Satz schon in einem Zustand hochgradiger Abgenutztheit auf, als er nämlich selbst schon in jener Sphäre des Entschlossen-Schöngeistigen angelangt war, vor der Adorno selbst immer graute. Trotzdem kann man vermuten, daß jene „Frage“ damals wie eine Frivolität wirkte, und ganz hat sie diese Wirkung bis heute nicht verloren, auch wenn sie in der „Wahrheit über Arnold Hau“ als Rollendichtung eines seltsam verwirrten Geistes daherkommt, dem die großen Gegenstände der Kultur durch eine eher trübe Birne gehen. Nun war die 1966 in der Satirezeitschrift Pardon erscheinende Nonsens- oder Flachsinnspoesie des neunundzwanzigjährigen Gernhardt weit davon entfernt, eine ernste Alternative zur damaligen Hochlyrik darzustellen, deren Hauptnamen Celan und Bachmann im Zenit ihres Ruhms standen. Zu isoliert stand diese kleine Kate des Witzes damals vor einem erhabenen lyrischen Erwartungshorizont, der dem Gedicht die Bewältigung der epochalen Katastrophen abverlangte. Immerhin hätte man schon damals Parallelen beim jungen Peter Rühmkorf finden können. Und wenn man größeren Abstand genommen hätte, dann hätte auffallen müssen, daß Bachmann und Celan auf der einen Seite ganz ähnlich auf Traditionen aus der Zeit vor 1933 zurückgriffen, wie es auf der anderen Seite Rühmkorf und am satirischen Nebentisch der blutjunge Gernhardt taten. Ingeborg Bachmanns Lyrik lebt vom Nachhall des bildstarken und immer noch formstrengen Expressionismus eines Georg Trakl und seiner Zeitgenossen. Celans verrätselte, aber melodisch und metrisch erstaunlich eingängige Dichtkunst verdankt niemandem mehr als dem späten Rilke, dem Dichter der Duineser Elegien und der Sonette an Orpheus. Ganz ähnlich griffen Rühmkorf und eben auch der junge Gernhardt auf vergleichbar klassische Avantgardepositionen der Vorkriegszeit zurück, auf die Nonsenspoesie von Ringelnatz und Morgenstern, auf Sinngedichte Tucholskys und des jungen Brecht, auf Autoren also, die sich ein volkstümliches Formenrepertoire ironisch, humoristisch und satirisch angeeignet hatten.
Aus heutigem Abstand wirken die formalen Errungenschaften gerade der sich angestrengt avantgardistisch gebenden deutschen Nachkriegslyrik bis hin zur Endstation der sogenannten konkreten Poesie wenig weltbewegend, zumal wenn man sie mit der formalen Virtuosität der klassischen Moderne in der Vorkriegszeit vergleicht – insofern hatte Enzensbergers Rede von „Ermüdung“ ihren guten Grund. Adornos Satz wirkte in dieser Lage ideologischer, als ihm selbst lieb sein konnte, und diese Wirkung ging ein in jene allherrschende Verbotsästhetik, mit der die gealterte Moderne in der Nachkriegszeit ihr Leben um mehrere Jahrzehnte verlängerte. Wenn man schon nicht wußte, wie es weitergehen sollte und daher das Verstummen oder die Verrätselung pries, so wußte man doch unfehlbar, was nicht mehr möglich sein sollte. In der Kunst war das die gegenständliche Malerei, in der Musik die Tonalität, im Roman der Realismus, in der Lyrik die traditionellen Formen von Reim, Strophe, Metrum.
Ich will die sachliche Berechtigung dieser Verbotsästhetik hier im allgemeinen nicht erörtern. In der Lyrik führte sie jedenfalls dazu, daß die alteingeführten Technologien verbaler Suggestion – der Begriff stammt von Gernhardt –, also Klang und Rhythmus, Strophe und Reim sowie alle Figuren der Rhetorik, eine Zeitlang völlig außer Gebrauch kamen. Groß war daher bei Kritik und Publikum das Erstaunen, als sie in den frühen achtziger Jahren wiederauftauchten, in jenem Vorgang, den Hans Magnus Enzensberger in die kongenialen Verse brachte:
In Frankfurt führt Frau Ulla Hahn
den Lyrik-Ulla-Hulla an.
Kritik und Publikum hätten sich weniger überraschen lassen müssen, wenn sie mehr zwischen den Sphären von hoch und niedrig, von Ernst und Spaß, von seriös und satirisch hin- und hergelesen hätten. Immerhin war schon 1976 von Gernhardt und F.W. Bernstein der Band Besternte Ernte erschienen, 1981 dann von Gernhardt allein der schon im Titel Großes versprechende Band Wörtersee. Der älter, aber einstweilen nur allmählich reifer werdende Autor und seine Mitstreiter haben in diesen Werken ein ganz neues Genre von Bild-, Bildgedicht- und Geschichtenbuch entwickelt, und vor allem Gernhardt hat dort praktisch das gesamte von der anerkannten und offiziösen Spätmoderne verabschiedete Formenrepertoire der deutschen Lyrikgeschichte weiter angewendet, gepflegt und aufpoliert.
Viele werden sich trotz der Paradigmenstürze im Deutschunterricht vielleicht an eins der einst berühmtesten Gedichte deutscher Sprache erinnern, einen wahren „Lyrikhammer“, wie Gernhardt es nennen würde, jedenfalls einen Ohrwurm von Rang. Ich zitiere die erste Strophe des Gedichts „Tristan“ von August von Platen:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen
Ist dem Tode schon anheimgegeben
Wird für keinen Dienst auf Erden taugen
Und doch wird er vor dem Tode beben
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen!
Zum Vergleich dazu die erste Strophe von Gernhardts „Lied der Männer“ aus dem Wörtersee:
Die Trauer beim Betrachten großer Hecken
gleicht jener, die wir sonst nur dann empfinden
wenn wir den Lorbeer aus dem Haare winden,
weil es heißt „Fertigmachen zum Verrecken“ –
Die Trauer beim Betrachten großer Hecken.
Ich habe das Beispiel bewußt nicht aus den Kapiteln „Vertraute Laute“ oder „Vorbild und Nachbild“ im Wörtersee genommen, sondern aus dem nicht parodistischen, sondern programmatisch komischen Abschnitt „Spaßmacher und Ernstmacher“. Gernhardts wie Platens Gedicht sind dreistrophig in Rondoform aufgebaut, mit leicht voneinander abweichenden Reimschemata. Bei Gernhardt gibt es kein direktes Zitat, und es bleibt philologisch sogar ganz unsicher, ob er auf Platen anspielen wollte. Entscheidend ist, daß sich selbst in der Brechung des Nonsens und im Säurebad der Komik die klassische Form behauptet, ja daß sogar etwas von ihrem Geist überlebt. Das schreitende Metrum und die Strophenform des Rondos haben in beiden Anwendungen etwas von der strengen Melancholie eines französischen, nämlich stark beschnittenen und friedhofartig regelmäßigen Gartens. Gernhardts Strophe enthält nicht nur einen Stilbruch – das Fertigmachen zum Verrecken –, es ist insgesamt ein einziger Stilbruch, weil die Verwirrtheit seiner Aussage im Mißverhältnis steht zum Regelmaß seines Formschemas. Der Nonsens freilich läßt das Schema nackt dastehen, und siehe, es ist schön.
Nun die zweite Strophe des „Lieds der Männer“:
Das Frösteln beim Betasten kühler Eisen
wir kennen es, seitdem wir jene sahen
die in den Zug einstiegen, der sein Nahen
nur unterbrach, um kurz drauf zu entgleisen
Das Frösteln beim Betasten kühler Eisen.
1990, als die postmoderne Wiederentdeckung des traditionellen Formenkanons längst vor aller Augen stattfand, hat Gernhardt sich in seinen „Gedanken zum Gedicht“ noch einmal ausdrücklich und mit der Wucht des Endgültigen zu ihm bekannt:
Da haben also Jahrtausende eine Technologie verbaler Suggestion entwickelt und unendlich verfeinert – und kaum einer der heutigen Arbeiter am Wort interessiert sich für dieses Erbe. Statt dessen hausen die meisten im stillgelegten Maschinensaal wie weiland die Barbaren zwischen den römischen Ruinen.
Man dichte wie der erste Mensch, und verwende bestenfalls Fragmente des Überlieferten wie jene Barbaren den Marmor der Römer.
Das ist nicht kulturkonservativ, sondern zunächst nur kritisch gegenüber dem Hauptgötzen des entfesselten Kapitalismus, dem Fortschritt. Gernhardts zweite These zum Gedicht lautet nämlich, daß alle Gedichte komisch seien, und zwar eben aufgrund der von ihm so hochgehaltenen Formen. Diese Formen nämlich sind für seinen ernüchterten und durchaus modernen Blick etwas ganz Äußerliches und Willkürliches, denn sie entspringen der Zufälligkeit des Lautens jener Wörter, mit denen wir Sinn kommunizieren. Der Gleichklang des Reims produziert, wenn er mechanisch in Gang gesetzt wird, zunächst nur Unsinn, semantischen Schrott:
Der Advokat aß grad Salat, als ihm ein Schrat die Saat zertrat.
Erst der Dichter bändigt diese Willkür und suggeriert durch mühsames Auswählen jene Übereinstimmung von Sinn und Klang, die die Überzeugungskraft höherer Notwendigkeit erzielt und im Idealfall nicht nur einen Gedanken mitteilt, sondern eine Empfindung erzeugt.
Alle äußere Form aber behält ihren Anteil am Komischen (als dem Willkürlichen und Zufälligen), und zwar gerade dann, wenn sie als Nur-Form wahrgenommen wird, und das geschieht, wie ich Gernhardt fortsetzen möchte, spätestens dann, wenn eine Form zum zweiten Mal verwendet wird. Form bedeutet fast augenblicklich Distanz, Ironie, Humor, Komik. Das macht es fast unmöglich, irgendwo einen hohen Ton durchzuhalten. Der Schritt vom Erhabenen zum Lächerlichen ist deshalb so klein, weil man das Erhabene nur zweimal sagen muß, um seine Wirkung zu ruinieren. Sollten die Verrätselungs- und Verdunklungstechniken der modernen Lyrik am Ende bloß der Versuch sein, jede Form nur ein einziges Mal zu verwenden, um der unvermeidlichen zivilisatorischen Ironie der vorgeprägten Form zu entkommen? Um also nur ja keinen Schritt weitergehen zu müssen, weil jeder Schritt voran von der Klippe der Moderne in den Abgrund des Komischen führen müßte? Fragen eines lesenden Gernhardt-Bewunderers.
Unfreiwillige Komik ist das Schicksal der distanzlos und unkritisch gebrauchten Formen, absichtsvolle Komik rettet sie und haucht ihnen neuen Lebensatem ein. Gernhardt, der Komiker, hatte die klassischen Formen ja in der Tat nicht bei bester Gesundheit angetroffen. Ein Gedicht im perfekten Trakl-Ton, das der Abiturient 1954 verfaßt und erst jetzt publiziert hat, spricht von der Reproduzierbarkeit des Schulstoffs, und es läßt jene feinsinnige Glätte ahnen, die Adorno in dieser Zeit als barbarisch empfand. Gernhardt schrieb also zwei Jahrzehnte lang fast ausschließlich komische Gedichte, allerdings mit einem abnehmenden Grad von Komik. Sein Formenrepertoire und seine Formbeherrschung wuchsen in dieser Zeit ins fast Wunderbare. Seit dem Wörtersee entwickelte er immer virtuoser die Technik, Gedichte zu schreiben, die wie Zitate klangen und doch kein einziges fremdes Dichterwort enthielten. Dann geschah etwas noch Erstaunlicheres: Die durch Komik gereinigten und verjüngten Formen wurden mit einem Mal wieder zu Gefäßen für zeitgenössische Erfahrungen. Die im Wilhelm-Busch-Ton gehaltenen Paarreime des Gedichts „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ gehören inzwischen fast schon zum Bildungsgut:
Dich will ich loben: Häßliches
du hast sowas Verläßliches
Das Schöne schwindet, scheidet, flieht –
fast tut es weh, wenn man es sieht.
Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit und Zeit
meint stets: Bald ist’s soweit.
Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer.
Das Häßliche erfreut durch Dauer.
Es sind die klassischen Verse über die alte Bundesrepublik. Hier haben wir unser Leben in der Zeit vor 1989, das einst so solide, das sich vor aller Empfindung des Todes ins Ausdruckslose, sauber Geschrubbte, beständig und unvergänglich Häßliche flüchtete, das, kurz gesagt, von Zeit nichts wissen wollte und sich vor der Geschichte fürchtete. Die Überzahl dessen, was nach 1945 in Deutschland gebaut wurde, ist nichtssagend, es erzählt keine Geschichte; das ist das Häßliche, das durch Dauer erfreut.
Den Menschen, der durch Metzingen gegangen ist, hat Gernhardt 1987 im selben Gedichtband – Körper in Cafés – auch nach Rom geschickt, wo alles schön ist und alles Geschichte, nämlich vielerlei Zeit. Das Sonett „Roma aeterna“ hat eine vornehme Ahnenreihe, deren wichtigste Glieder Conrad Ferdinand Meyers „Römischer Brunnen“ und Rilkes „Römische Fontäne“ sind. Wiederum wird nicht direkt zitiert, nicht einmal die Versformen stimmen überein (nur Rilkes, nicht Meyers Gedicht ist ein Sonett), zumal Gernhardt auf die „Römische Fontäne“ in dem Gedicht „Wortschwall“ viel direkter Bezug genommen hat. Gernhardts Rom-Sonett teilt mit seinen Vorläufern nur den Gestus der Überfülle, formal versinnlicht im Enjambement, dem Übergreifen der Sätze über die Versgrenzen:
Das Rom der Foren, Rom der Tempel
Das Rom der Kirchen, Rom der Villen
Das laute Rom und das der stillen
Entlegnen Plätze, wo der Stempel
Verblichner Macht noch an Palästen
Von altem Prunk erzählt und Schrecken
Indes aus moosbegrünten Becken
Des Wassers Spiegel allem Festen
Den Wandel vorhält. So viele Städte
In einer einzigen. Als hätte
Ein Gott sonst sehr verstreuten Glanz
Hierhergelenkt, um alles Scheinen
Zu steingewordnem Sein zu einen:
Rom hat viel alte Bausubstanz.
Wieder sichert der moderne Komikzement, also der abstechende, von Metzingen her gesprochene Schlußsatz (nach dem halblächerlichen Klingklang der Zeilen davor: „… um alles Scheinen / Zu steingewordnem Sein zu einen“), dem ganzen Marmorgebäude das Fundament und dem Gedicht sein festes Stehen in der Gegenwart. Das Sonett zeigt wahrhaftig einen gelehrigen Barbaren in römischen Ruinen, aber der Barbar verleugnet sich nicht, und das läßt auch die von ihm verwendeten Spolien der Vorzeit in neuem Schimmer erglänzen. Gernhardts Begriff von den lyrischen Formen ist gänzlich säkularisiert, nüchtern bis zum äußersten. Keine Magie findet er hier; der Dichter ist kein Priester und Künder, sondern nur ein Profiteur im Zufälligen, das er für seine Zwecke arrangiert. Es ist dieses vollkommen ernüchterte Verständnis von Form, das ihn so unbeeindruckt von aller geschichtsphilosophischen Verbotsästhetik bleiben ließ. Wenn Form nichts ist als geordneter Zufall und beherrschte Komik, dann spricht nichts dagegen, die alten Formen mit neuen Erfahrungen zu kombinieren. Wenn ich über Gernhardt als Prosaautor sprechen müßte, dann könnte ich Ihnen zeigen, wie er eine uralte Form, das mosaische Gesetzbuch, auf Zumutungen der Gegenwart blendete, in dem genialen Text „Du sollst nicht lärmen“. Hier haben wir denselben subversiven Mut, mit dem der Dichter als junger Mann Adornos moralisch so belastendes Diktum herausforderte.
In den zwei Jahrzehnten an der satirischen Front muß Gernhardt so etwas wie ein platonisches Formengedächtnis entwickelt haben. Sie stehen ihm zu Gebote wie eine absolute Musik aus Klang und Rhythmus, die abgezogen wurde aus einander hundertfach überlagernden konkreten Anwendungen. In dem Klassiker „Sonette find ich sowas von beschissen“ hat er ein Gedicht geschaffen, das nur aus einem Tonfall – alternativer Übellaunigkeit – und einem musikalischen Schema – dem schnurrenden Uhrwerk der klassischen Sonettform – besteht. Hier das erste Quartett:
Sonette find ich sowas von beschissen
so eng, rigide, irgendwie nicht gut;
es macht mich ehrlich richtig krank zu wissen
daß wer Sonette schreibt. Daß wer den Mut
hat, heut noch so’n dumpfen Scheiß zu bauen usw.
Dieses platonische Formengedächtnis, die Reduktion der Formen zu durch tausendfachen Gebrauch und ätzende Komik entheiligten und ausgewaschenen Hohlformen, hat Gernhardt dann zunehmend in den Stand gesetzt, selbst als Formfinder oder -erfinder (je nachdem, welcher Version des Platonismus man anhängt) aufzutreten. Die vielerlei neuen Reimschemata, Strophenformen und rhetorischen Figuren bei Gernhardt zu katalogisieren und zu benennen ergäbe mittlerweile schon reichen germanistischen Dissertationsstoff. Ich jedenfalls kenne kein Vorbild für das schöne Dialoggedicht „Zurück aus dem Odenwald“ aus dem Band Weiche Ziele:
Dieses viele Grün, dieses hohe Blau
und in der Ferne Worms
– Warum sagen Sie das?
Das war so viel Grün, und das Blau war so hoch
und in der Ferne Worms
– Wem sagen Sie das?
Dem, dem das Grün etwas sagt und das Blau
und in der Ferne Worms
– Das sagen Sie mir?
Jawohl, falls Ihnen Grün etwas sagt
und in der Ferne Worms
– Nun haben Sie aber das Blau vergessen!
Ach – sagen Grün und Blau Ihnen was
Und in der Ferne Worms?
– Nicht daß ich wüßte. Können die denn reden?
Das Schöne bei den neuen Gernhardtschen Formen ist: Sie geben gleich zu erkennen, daß sie es sind. Schon beim ersten Mal treten sie auf wie alte Bekannte, die nur die neuen Kleider der Gegenwart angezogen haben und sie mit der gleichen leichten Befremdung tragen wie ihre klassischen Verwandten.
Denn auch bei der Neuerfindung arbeitet er mit vielerlei klassischen Mustern: rhetorischen Figuren wie Anaphern und Epiphern, Alliterationen, Parallelismen und eben Reim und Rhythmus.
Wenn nicht alles täuscht, wächst in den letzten Jahren der rhetorische Grundzug von Gernhardts Lyrik. Sie redet, sie parliert, doch parliert sie im Ebenmaß. Schon 1990 hat er sich über den Mangel an Gedankenlyrik in der zeitgenössischen Dichtung beklagt, über das Fehlen des Epigrammatischen, der Tendenzdichtung und des erzählenden Gedichts.
Seine jüngste Produktion besteht zu großen Teilen aus Sinngedichten, und ich verwende bewußt den Ausdruck des 18. Jahrhunderts. Qualitäten und Ansprüche, die in der Lyrik jahrzehntelang verschwunden waren, Witz, Pointensicherheit, Beredsamkeit, Durchsichtigkeit, eben die aufklärerischen Stilideale von Helligkeit und Schnelligkeit, die das Gegenteil von romantisch-moderner Dunkelheit darstellen, sind bei Gernhardt in die Dichtung zurückgekommen. Es ist, als habe sich das Weltrad der Poesie nach zweihundert Jahren wieder weitergedreht: So wie die aufklärerische Sinndichtung der Zeit Lessings die spätbarocke Verzwicktheit und Verrätselung ablöste, so verläßt die deutsche Lyrik mit Gernhardt eine zweite Epoche von Schwermut und Dreißigjährigem Krieg. Sie wird trocken, licht, geistvoll. Lichte Gedichte wird Gernhardts nächster Band heißen, und er wird unter anderem einen erzählerischen Zyklus über seine Herzoperation erhalten, eine Gedichtkette, deren einzelne Glieder Epigramme im Sinne des 18. Jahrhunderts sind. Lessing hat die Form des Epigramms, die er von seinem Namen, der Inschrift auf einem Denkmal herleitete, durch die Abfolge von Erwartung und Aufschluß definiert. Die Erwartung entspricht dabei der sinnlichen Anschauung des Denkmals, der Aufschluß der Information, die die Inschrift gibt. Der Aufschluß ist die Pointe, die im Epigramm auf den sinnlichen Eindruck folgt. Man lese unter diesem Gesichtspunkt das Epigramm über den Wandschmuck in seinem Krankenzimmer:
Hie Boote und Dünen
und Brandung und Wolken
Hie Blumen und Blätter
und Gräser und Stauden.
Hie Grausen, hie Folter.
Hie Spott, hie – „Verstehe!
Der Herr läge gerne im Städel!
Es ist unser Alltag, den Gernhardt mit diesen Mitteln durchsichtig macht, die Welt der Intercitys und der Metzgereien, der Körper in Cafés, der Krankenhäuser und der Tennisstars – um nur ein paar Gedichtthemen zu zitieren.
Seine große Kunstfertigkeit beweist er dabei nicht nur im formalen Witz, sondern im anthropologischen Blick – auch er ist aufklärerisch – auf die großen Themen Liebe, Altern, Krankheit, Tod und – jeder Gernhardt-Leser weiß es – unser Verhältnis zur Kreatur, den Tieren, und zur Landschaft. Die Literaturkritik jault immer noch nach dem großen Gesellschaftsroman der Bundesrepublik; doch wenn man einem ganz Fremden schnell erklären müßte, wie wir heute leben, könnte man ihm ohne weiteres Gernhardts Gedichte seit Körper in Cafés in die Hand drücken.
Im Nachwort zu einer Neuausgabe von Wörtersee hat er mit berechtigtem Stolz aus einem Brief von Georg Stefan Troller zitiert:
Sie haben mir den Glauben an die deutsche Sprache als Spielsprache wiedergegeben, und ihr eine Art vorhitlersche Unschuld.
Sehr wahr, mit einer Einschränkung: Handelt es sich nicht doch um eine nachhitlersche Unschuld? Hat nicht auch Gernhardt seine Lehre aus der Geschichte des Jahrhunderts gezogen? Sie besteht in der Unterminierung von jeglichem Pathos, dem Ausweichen vor allen Priesterlügen, vor der falschen Feierlichkeit, den verführerischen großen Worten. Die aufklärische Unschuld des trockenen, hellen, ironischen Tons kann doch bestenfalls eine zweite Unschuld sein, so wie man nach Gebrüll und Gestammel den Ton absichtsvoll dämpfen und zum zivilisierten Parlando zurückfinden muß. Ist Robert Gernhardt zum Dichter unserer Zeit geworden? Schön wäre es, doch wird das erst die Geschichte erweisen. Den politischen Moment trifft das Gedicht „Einer schreibt der Berliner Republik etwas ins Stammbuch“ (aus dem Band Lichte Gedichte):
Erstmals sind die Älteren
nicht per se schon Täter.
Erstmals heißt es: Macht erst mal
bilanziert wird später.
Erstmals sind die Jüngeren
nicht per se schon Richter.
Erstmals schreckt das Kainsmal nicht
älterer Gesichter
Erstmals müssen alle ran,
Turnschuhe wie Krücken.
Glückt’s nicht, sind wir alle dran,
ergo muß es glücken.
Gustav Seibt, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1997
Hier spricht der Denker
– Warum Robert Gernhardt schon lange einen akademischen Ehrendoktor verdient hat und ihn heute endlich bekommt. –
Meine Damen und Herren, lieber Ehrendoktor, liebe Gäste,
ich entschuldige mich zunächst für die kleinen Unbequemlichkeiten, die Sie auf sich nehmen müssen – aber ich bin nicht schuld daran, daß Robert Gernhardt so beliebt ist, selbst jenseits der Schweizer Sprachgrenze. Selbstredend nehme ich als Veranstalter alle Schuld auf mich – aber ich möchte Ihnen in meinem folgenden Plädoyer doch beweisen, daß ich eigentlich ganz unschuldig bin an dem heutigen Ereignis.
Eigentlich ist nämlich Heinz Schlaffer schuld. Der Stuttgarter Kollege, der seinen Ruhm als theoretischer Kopf der „Achtundsechziger Germanistik“ erworben hat, sagte mir schon vor 15 Jahren einmal:
Literaturtheorie mache ich nicht mehr. Alles, was es dazu zu sagen gibt, hat Robert Gernhardt in seinem Buch Glück Glanz Ruhm schon gesagt.
Neugierig las ich sofort nach und fand: Wie immer übertreibt Schlaffer natürlich wieder maßlos. Aber etwas ist schon dran an seiner These.
Denn nicht nur macht uns Gernhardt im dritten Teil seines Büchleins die zeitliche Begrenztheit und räumliche Relativität allen literarischen Ruhms bewußt – insbesondere am Beispiel jenes Weltruhms, den eine ungenannte Autorin in Darmstadt genießt; während man im Rest der Welt nicht einmal Darmstadt kennt, ganz zu schweigen von Gabriele Wohmann. – Nicht nur führt uns der Mittelteil des Bändchens in einer Art Lehrbrief von den „Zusammenhängen zwischen Kunst und Leben“1 anhand von Frankfurter Vorstadtlokalen vor Augen, wie unsere alltägliche Umwelt ihr bißchen Glanz, bis in biedere hessische Kneipen-Ausstattungen hinein, aus Bruchstücken der Geschichte europäischer Kunst und Literatur bezieht.
Vor allem jedoch – und daran dürfte Schlaffer gedacht haben – beantwortet das Buch in seinem ersten Teil erschöpfend die Titelfrage:
Hat die Literatur Folgen?
Sie hat, und wie! Denn:
Andererseits, was war das Leben? […] Mir hatte es Hemingway beigebracht […] und plötzlich wußte ich: Das ist das Glück, und ich wußte auch, warum ich das wußte […]: „Das ist hier jetzt genau wie in [Hemingways] Fiesta“.2
Im letzten Wintersemester haben wir in einem interdisziplinären Seminar der Universität Fribourg über „Literatur, Bildung, ästhetische Erziehung“ diesen Text von Gernhardt ausführlich herangezogen. Und das hat nicht nur exquisite studentische Seminararbeiten hervorgebracht, sondern deutlicher als alle Abhandlungen zur Erziehungswissenschaft und Literaturdidaktik bestätigt:
Wir werden, was wir lesen.3
Unsere eigene Lektüre-Biographie und besonders die Bücher unserer frühen Jahre prägen lebenslang unsere persönlichen Vorstellungen von Glück, von Leid und allen großen Gefühlen. – So ganz falsch wird Heinz Schlaffer also wohl doch nicht gelegen haben.
Eigentlich aber ist wohl Eberhard Lämmert schuld. Nach dem Fribourger Gastvortrag des großen Berliner Literaturforschers und Hochschul-Politikers vor etwa 12 Jahren kam beim Essen die Rede auf die aktuelle Comedy-Blödelwelle im allgemeinen und auf die Neue Frankfurter Schule im besonderen. Lämmert gab vieles zu, um schließlich doch energisch zu insistieren:
Aber Robert Gernhardt: das ist doch ein wirklich genialer Mann. Von dem kann man mehr über Literatur lernen als von den meisten Germanistik-Professoren!
Besonders unter anwesenden Germanistik-Professoren (und Professorinnen) breitete sich da peinliche Stille aus… Und dabei waren doch damals Gernhardts wichtigste poetologische Lehrschriften noch gar nicht erschienen: weder der Sammelband Gedanken zum Gedicht, noch der literarhistorische Klappaltar (mit den 3 Flügeln Goethe, Heine, Brecht), noch die zahlreichen Essays als Lyrikwart ohne Auftrag4 und als Übersetzungs-Kritiker im stillschweigenden Auftrag der übersetzten Autoren (wie zuletzt des Lyrikers Paul McCartney). Und noch kannten wir auch nicht Gernhardts überaus zweckdienliche Blätter zur Berufsberatung für künftige Dichter (unter dem Titel Wege zum Ruhm).
Eigentlich ist deshalb Peter Rühmkorf schuld. Denn der hat wohl als erster Gernhardts Ernst im Spaß, das ,Tiefsen im Flachsen‘ entdeckt – oder vielleicht nicht entdeckt, aber öffentlich auszusprechen und zum Druck zu bringen gewagt: zuerst in Aufsätzen über dessen satirische Gedichte und Parodien,5 1990 dann auch in einem ganzseitigen Zeit-Artikel über den Maler und Zeichner Robert Gernhardt wie über seine programmatischen Schriften zur Malerei.6
Vielleicht aber trägt Kurt Flasch noch mehr Schuld. Selbst an unserer Schweizer Universität, mit der dieser große Gelehrte ja seit langer Zeit eng verbunden ist, schon als Lehrer unseres verehrten Ruedi Imbach – selbst in Fribourg weiß wohl nicht jeder, daß Kurt Flasch zu den bekennenden Bewunderern nicht nur von Hugo Ball, sondern auch von Robert Gernhardt gehört. Seine Laudatio auf den Bertolt-Brecht-Preisträger 1998, den „Verdreher des ohnehin Verdrehten“, stellte Flasch unter die Titelfrage: „Ist der Lyriker, Zeichner, Geschichtenerzähler und Spaßmacher Robert Gernhardt ein ernsthafter Mensch?“7 – Nun, das wollen wir denn doch nicht hoffen, und das behauptet auch Kurt Flasch keineswegs – wohl aber, daß wir allen Grund haben, den tief- bis hintergründigen Humoristen Gernhardt ernst zu nehmen. Und wenn ein Kurt Flasch das sagt, dann ist das schon der halbe Ehrendoktor!
Oder ist, um bei Philosophen zu bleiben, vielleicht Gottfried Gabriel schuld? Der Herausgeber des Historischen Wörterbuchs der Philosophie (und unserer gemeinsamen Theorie-Reihe Explicatio bei Schöningh/Mentis) schickt mir als Gruß zum heutigen Anlaß gerade einen Sonderdruck mit dem ausdrücklichen Vermerk:
damit Du siehst, daß auch ich Gernhardt für einen [philosophischen] Klassiker halte!
Und Gabriels Beitrag über Kant (in einem von Julian Nida-Rümelin herausgegebenen Kongreß-Band) nimmt denn auch seinen Ausgangspunkt bei „Robert Gernhardts Philosophie-Geschichte“, die ich Ihnen trotz der vorgerückten Stunde ungekürzt vorlesen kann:8
Die Innen- und die Außenwelt,
die warn mal eine Einheit.
Das sah ein Philosoph, der drang
erregt auf Klar- und Reinheit.
Die Innenwelt, dadurch erschreckt,
versteckte sich in dem Subjekt.
Als dies die Außenwelt entdeckte,
verkroch sie sich in dem Objekte.
Der Philosoph sah dies erfreut:
indem er diesen Zwiespalt schuf,
erwarb er sich für alle Zeit
den Daseinszweck und den Beruf.
Aber mein Verdacht geht doch eher dahin zu glauben: Eigentlich ist Peter Köhler schuld. Der nämlich, inzwischen längst selber Reclam-Autor und Herausgeber zahlreicher Beiträge zur Literaturgeschichte des Humors, überraschte mich bereits 1980 als Göttinger Student mit dem Wunsch, eine Magisterarbeit und dann sogar eine Dissertation über Robert Gernhardt und die Gattungsgeschichte des literarischen Nonsens zu schreiben.
Noch immer denke ich: Das wissenschaftlich Gewichtigste an Köhlers Buch ist – der Anhang mit Robert Gernhardts erläuternden Briefen an den Autor. Eine Weile war ich sogar schon versucht zu glauben, daß diese klugen Antworten auf kluge Fragen meines Doktoranden überhaupt die erste literaturtheoretische Äußerung von Gernhardt im Buchdruck gewesen sein könnte – dann wäre ich ja womöglich doch an allem schuld?
Aber als getreuer Anhänger von Karl Poppers Falsifikationsprinzip habe ich jetzt lieber nachrecherchiert- und zu meiner Beschämung gefunden: Schon das allererste Buch, das unser Ehrendoktor, gemäß Sammelbestand der Deutschen Bibliothek zu Frankfurt, im Jahre 1965 herausbrachte – also noch nicht 30jährig und noch unter dem Autor-Namen Lützel Jeman – schon dieses Buch trug den Titel: Die Wahrheit über die Kunst! Und dem folgte ein Jahr später unter demselben Namen: Die Wahrheit über Arnold Hau – also über jene geheimnisvolle Künstlerpersönlichkeit, für deren Existenz einem heutige Internet-Suchmaschinen nicht weniger als 70 Belege auswerfen, die aber vor den philologischen und kunstgeschichtlichen Forschungsarbeiten von Robert Gernhardt noch völlig unbekannt war. Wir lernen daraus: Schon der ganz junge Gernhardt ist in Wirklichkeit bereits als ein fanatischer Wahrheitssucher angetreten und hat sich auf den Weg zur späten, aber nicht zu späten Anerkennung durch die akademische Forscher-Gemeinschaft begeben.
Daran wiederum ist nun eher André Chapuis schuld. Mein erster Unterassistent in Fribourg (und späterer Stegmüller-Preisträger für Logik) war nicht bloß der zweite, der bei mir über den Autor Gernhardt und die Gattung Nonsens Examen machen wollte (und dabei übrigens Peter Köhlers Theorien heftigst kritisierte!). Nonsens und Logik der Wissenschaft haben auch sonst mehr miteinander gemein, als beiden Seiten lieb sein dürfte. Nonsens ist ja nicht einfach Unsinn: Nonsens ist folgerichtiger Unsinn. Um Folgerichtigkeit geht es aber auch jeder wissenschaftlichen Arbeit von Wert. Wenn Wissenschaft aufhört, folgerichtig zu argumentieren, oder dieses Ziel gar postmodern für illusorisch erklärt, wird sie Unsinn. (Man kann das ja in unseren Tagen weltweit beobachten – mit rühmlicher Ausnahme Fribourgs, natürlich.)
Robert Gernhardt hingegen schreibt nicht nur als Dichter noch im schönsten Nonsens folgerichtig (und dies übrigens von Anfang an so konsequent, daß er nach meiner Langzeit-Beobachtung – im Gegensatz zu anderen Frankfurtern seiner Jahre – bis heute nichts Früheres abzustreiten oder zurückzunehmen hätte). Sondern: Gernhardt argumentiert auch als Denker – als Theoretiker der Komik, der Lyrik, der Malerei – stets so folgerichtig, daß sich manches akademisch daherkommende Werk ein Beispiel daran nehmen sollte. Mein Lieblingsbeleg ist sein frühes Flugblatt Was bleibt? Gedanken zur deutschsprachigen Literatur unserer Zeit, in dem diese nach 1989 nicht nur von Christa Wolf immer wieder, und immer erfolglos gestellte Frage einmal unerbittlich bis zum Ende gedacht wird: Vom Erbe unserer Dichtung wird bleiben – ihr Echo in den Daten deutscher Dichtung des Ehepaars Frenzel, ja selbst daraus nur ein Extrakt von Namen und Titeln. Und da diesen Extrakt sonst noch niemand veröffentlicht hat, bleibt von der ganzen deutschen Literatur nur ein einziger Text übrig. Nämlich dieses Flugblatt von Robert Gernhardt mit dem Titel Was bleibt.
Aber André Chapuis hat seinerzeit nicht nur Primärliteratur von Gernhardt beforscht, sondern auch den Postschrank unseres Seminars mit rezeptionsästhetischer Sekundärliteratur des Autors verschönert. Mehr als 10 Jahre lang hing dort, inzwischen völlig zerfranst und ausgeblichen, Gernhardts komplette Cartoon-Serie „Deutsche Leser“ von 1986.9 Darin finden wir so treffende Beiträge wie
Aber jetzt ist es Zeit, zu den Hauptschuldigen zu kommen. Eigentlich sind natürlich Rüdiger Zymner und seine akademischen Schüler schuld. Ich denke dabei nur am Rande daran, daß Robert Gernhardts Vorbild ja Pate gestanden hat für unser Fribourger literaturdidaktisches Modell „Parodieren geht über Studieren“,10 und daß er uns bereitwillig für unser gemeinsames Lehrbuch seine berühmten „Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs“ spendiert hat. (Übrigens, im Gegensatz zu anderen lebenden Autoren, ohne einen Pfennig Geld dafür zu verlangen.)
Wichtiger und prägender geworden für den germanistischen ,Esprit de Fribourg‘ ist Rüdiger Zymner aber, weit über seine Berufung nach Wuppertal hinaus, durch den von ihm eingeführten Gernhardtschen(?)11 Grundsatz „hell und schnell“. Weswegen man sich bei uns bis heute lieber mit Aphorismus, Parodie und Kabarett befaßt als mit dem Bürgerlichen Trauerspiel, lieber mit Kriminalromanen oder Experimentellen Hörspielen als mit Mysterienspielen; und lieber mit hellen und schnellen Autoren wie Fischart, Wittenwiler, Jean Paul, Heine, Thomas Mann & Arno Schmidt als beispielsweise mit Herder, Stifter oder Heinrich Böll.
Kurz: wo immer zwei oder drei von uns versammelt sind an diesem germanistischen Departement, da ist Robert Gernhardt im Geiste mitten unter ihnen.
Eigentlich gehören deshalb auch Peter Stocker und Angelika Salvisberg zu den Hauptschuldigen. Er als Theoretiker der Intertextualität, sie in der Erprobung an Robert Gernhardts intertextueller Komik (und natürlich immer sie beide zusammen) haben mit ihren Freiburger Universitäts-Schriften die geheimen Gesetze wie die kleinen Tricks in Gernhardts Schaffen genauer durchleuchtet als alle Vorgänger.
Und Ralph Müller – wie die beiden sitzt auch er hier auf der Anklagebank der Schuldigen – hat in seiner soeben eingereichten Dissertation Theorie der Pointe12 Robert Gernhardts Poetik der Hochkomik in ungeahnte Höhen der kognitivistischen Forschung geführt und so, vorwärtsgepeitscht durch Gernhardts wissenschaftliche Leitfrage „Was gibt’s denn da zu lachen?“,13 eine umfassendere Antwort gegeben als je ein anderer Humorforscher.
Trotzdem muß ich persönlich zugeben: Eigentlich ist Urs Meyer schuld. Der nämlich hat seinen hiesigen Kollegen wie seinem Chef eine CD-ROM mit Gernhardts ewigem Kalender geschenkt, aus dem einem nicht nur täglich beim Anstellen des Computers ein aufstellendes Gedicht für den Tag entgegenlacht, vom Autor höchstpersönlich rezitiert und natürlich illustriert – sondern in dem auch der Germanist stets an wichtige Gedenktage der Literaturgeschichte erinnert wird. So findet man beispielsweise unter dem 30. März den Hinweis auf den Todestag von Karl May – und dazu ein passendes lyrisches Epitaph, das ich noch vorletzte Woche als Einleitung zu meiner Vorlesung über den Abenteuerroman verwendet habe. Es heißt:
INDIANERGEDICHT
Als aber der Pferdehändler nicht abließ,
auf Winnetou einzuteufeln, bemerkte
dieser in seiner einsilbigen Art:
Mann, dein Pferd
ist nichts wert.
Hier: Das Bein
ist zu klein.
Dort: das Ohr
Steht nicht vor.
Da: Der Gaul
Hat kein Maul.
Schau: Der Schwanz
fehlt ihm ganz.
Und es trabt
nicht so recht,
denn das Pferd
ist ein – Specht!
Du viel dumm,
ich viel klug.
Hugh!
Damit aber genug vom Höhenkamm der Literatur und Literaturwissenschaft, hinüber zu den Schönheiten der bildenden Kunst und Kunstgeschichte. Eigentlich ist nämlich Elisabeth Stuck schuld. Sie zuerst machte mich im Rahmen unseres genannten Seminars über ästhetische Bildung aufmerksam auf Gernhardts neues Buch Der letzte Zeichner. Aufsätze zu Kunst und Karikatur, besonders weil sie ihre eigenen Alptraum-Erfahrungen in einer Vermeer-Ausstellung in Den Haag darin ausgedrückt fand.
Denn wo der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab Gernhardt ein Gott zu sagen, was Ausstellungs-Besucher leiden.
Ich selber aber fand, obwohl ich sonst als Musiker nur mit den Ohren sehe, aus dem dicken Buch gar nicht wieder heraus.
Nun haben unsere Kunsthistoriker heute ihren eigenen Ehrendoktor zu feiern. Und ich selber werde mich hüten, etwas Laienhaftes über dieses Gebiet zu sagen. Viel lieber lasse ich da den Autor selbst zu Wort kommen – gleich dann auch persönlich, aber erst durch das erwähnte Buch.
Der Denker Gernhardt spricht nämlich nicht nur im Buch, im kritischen Zeitungsartikel, im Essay (wie seiner schönen „Lobrede auf den poetischen Satz“), – sondern, in der alten Tradition Schillerschen Lehrgedichts und Goethischer Gedankenlyrik, denkt der Denker auch in Versen. Wie mir denn überhaupt langsam der Verdacht aufkeimt: Mit der Stimme Robert Gernhardts spricht gar nicht (a) ,der Dichter‘ – und andernorts spricht dann (b) ,der Denker‘. Sondern in beidem spricht immer: der Dichter und Denker! also jene Spezies, als deren Heimat einmal, vor unausdenklich langer Zeit, die deutschen Lande überhaupt galten, weil es dort so viele Dichter und Denker gab – und heute nur noch einen, aber eben wenigstens diesen.
Deshalb zum Schluß mein liebstes Gedankengedicht von Gernhardt, die „Ballade von der Lichtmalerei“14 Und der Autor muß es ertragen, daß ein anderer es ihm vorliest:
BALLADE VON DER LICHTMALEREI
Leg etwas in das Licht und schau,
was das Licht mit dem Etwas macht,
dann hast du den Tag über gut zu tun
und manchmal auch die Nacht:
Sobald du den Wandel nicht nur beschaust,
sondern trachtest, ihn festzuhalten,
reihst du dich ein in den Fackelzug
von Schatten und Lichtgestalten.
Die Fackel, sie geht von Hand zu Hand,
von van Eyck zu de Hooch und Vermeer.
Sie leuchtete Kersting und Eckersberg heim
und wurde auch Hopper zu schwer.
Denn die Fackel hält jeder nur kurze Zeit,
dann flackert sein Lebenslicht.
Doch senkt sich um ihn auch Dunkelheit,
die Fackel erlischt so rasch nicht.
Sie leuchtet, solange jemand was nimmt,
es ins Licht legt und es besieht,
und solange ein Mensch zu fixieren sucht,
was im Licht mit den Dingen geschieht.
Wer so etwas schreibt, lieber Robert Gernhardt, und wer es so zu schreiben versteht, der ist wirklich selber schuld, wenn er eines Tages zum Tragen eines Ehrendoktor-Hutes oder doch -Titels verdonnert wird.
Harald Fricke, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, Fischer Taschenbuch Verlag, 2002
Was einer ist, was einer war,
beim Scheiden wird es offenbar
– Dankesrede, gehalten in der Universität Fribourg bei der Entgegennahme der Ehrendoktorwürde am 15.11.2001. –
Warum überhaupt Theorie? Es war Prof. Harald Fricke, der mich fragte, ob ich mich am heutigen Ehrentage dieses ehrbaren Themas annehmen wolle, und ich antwortete mit gebotener Ehrlichkeit: Theoretisch ja. Allerdings mit einer Einschränkung: Nicht zur Theorie an sich möchte und kann ich etwas sagen, sondern lediglich zur Frage, warum jemand, der als Praktiker angetreten ist, zum Theoretiker – ja was nun? Aufsteigt? Mutiert? Herabsinkt?
Nach landläufiger Meinung: Herabsinkt. Sprichwörtlich ist das wenig ansprechende Bild geworden, das Goethes Mephistopheles von der Theorie malt: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie“, warnt er den Schüler; 15 Gern wird die Graue auch als trocken bezeichnet, als öde, als schwer nicht nur in geistiger, sondern geradezu physischer Hinsicht, man denke an das Doppelwort „theorielastig“. Hie die dumpfe Mühsal der Begriffsfindung, hie die schiere Lust der Bilderfindung – wer von denen da oben wollte sich freiwillig zu denen da unten gesellen? Und dennoch haben Künstler genau das getan, dennoch bin auch ich hinabgestiegen, sonst stände ich heute nicht hier – wie erklärt sich solcher Abstieg?
Als Antwort habe ich keine eindeutige Theorie anzubieten, sondern die vermischten Erfahrungen dessen, der sich im Laufe seines Lebens mit mehreren Künsten und Gattungen eingelassen hat, was nicht folgenlos blieb: Werke entstanden, Kunstwerke sowie anderswo beheimatete, und je mehr ich heckte, desto häufiger stand ich vor der Aufgabe, mir Gedanken über mein Tun zu machen. Aus ganz praktischen Gründen: Weil das Kind einen Namen haben mußte. Weil das Kind Gefahr lief, verwechselt zu werden. Weil es in der Beziehung der Eltern kriselte. Weil die Eltern sich trennten. Weil das Kind es einmal besser haben sollte, und weil sich angesichts solchen Beziehungswirrwarrs immer wieder die Frage stellte: Wes Geistes Kind bin ich eigentlich?
Wer darf wen wie taufen?
Seit der Gotik, so belehrt uns Kindlers Malerei-Lexikon, mußten Künstler erleben, daß ihr Tun – zunächst nur im nachhinein – von Nichtkünstlern mit Spitz-, Schmäh-, ja Schimpfnamen belegt wurde:
Alles, was nicht dem klassischen Renaissancekanon entsprach, wurde gotisch genannt. Maniera gotica, zunächst ein Schimpfname, wurde im Abstand der Zeit ein Stilname, am Anfang noch mit verächtlichem Unterton.16
Kunst, Künstler und Kunstwerke begleitet durch die Jahrhunderte die permanent pejorative Patenschaft der Kunstrichter vulgo Theoretiker, welche noch in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts letzte folgenschwere Taufakte zu verantworten haben. Zum Stichwort „Impressionismus“ lesen wir:
Die höhnende Bezeichnung, die der Kritiker Leroy zu einer Ausstellung von 165 Gemälden im Atelier des Fotografen Nadar im ,Charivari‘ vom 25. April 1874 formuliert hatte, wurde zum Namen einer Gruppe, einer Kunstrichtung und schließlich eines Malstils, dem ein Welterfolg ohnegleichen beschieden war.17
Dreißig Jahre später wiederholt sich der Vorgang der Hohntaufe einer ganzen Kunstrichtung durch einen unerbetenen Paten zum letzten Mal:
Als ,Fauves‘, als wilde Tiere, hatte der Pariser Kritiker Vauxcelles voller Empörung die Produzenten der knallbunten […] Leinwände bezeichnet, die in die gepflegte Linie der Salons d’Automne von 1905 eingebrochen waren. Matisse und die Gruppe um ihn nahmen diesen Schimpfnamen auf und machten daraus einen künstlerischen Markenartikel ersten Ranges.18
Es war das letzte Mal, daß Künstler aus der Not, von fremder Seite negativ definiert worden zu sein, eine Tugend machten. In der Folgezeit nämlich nahmen sie selber das Heft in die Hand, bestimmten sie selber den Namen des Bankerts, den sie in die Welt gesetzt hatten: Es waren Dresdner Maler, die ihre Künstlergruppe Die Brücke tauften, es waren Münchener Maler, die sich als Blauer Reiter begriffen. Es war der Dichter Apollinaire, der im Jahre 1919 den später vom Dichter Breton aufgegriffenen Begriff Surrealismus prägte. Es waren Literaten und Maler, die Dada und den Dadaismus erfanden, benannten und betrieben. Es war der russische Maler Malewitsch, der die Vorstellung von seiner Auserwähltheit als Maler in den seine Malerei definierenden Begriff „Suprematismus“ kleidete – und so fortan, bis zu jenen drei Frankfurter Literaten und Cartoonisten, die im Jahre 1983 vor der Frage standen, wie sie denn ihre gemeinsame Ausstellung in der Münchner Galerie Bartsch & Chariau betiteln sollten.
Das fixe Markenzeichen NFS
Die Namen der Drei – so viel stand fest – durften erst im Untertitel auftauchen; alles andere aber war in ihre Hände gelegt, da das, was sie allesamt bereits seit zwanzig Jahren und länger betrieben, noch von niemandem, auch keinem Außenstehenden auf den Begriff gebracht worden war. Wir nutzten diese Unfestgestelltheit, eine bewährte Technik der Namensfindung anzuwenden: Wie weiland das „Junge Deutschland“ und die „Neue Sachlichkeit“, wie etwa zeitgleich mit uns Frankfurtern die „Neuen Wilden“, griffen auch wir nach einem eingeführten, positiv besetzten Begriff, den Köder „Frankfurter Schule“, setzten ein „Neu“ davor und damit eine Bezeichnung in eine Welt, die darauf nur gewartet zu haben schien. Was als kurzfristiger Scherz gedacht gewesen war, entwickelte sich mittels der Medien zu einem Markenzeichen, das ganz eilige Kritiker und Kommentatoren nicht schlicht als „Neue Frankfurter Schule“, sondern unter dem Kürzel „NFS“ in ihre Texte einspeisen.
Wie wir gesehen haben, tun Künstler gut daran, ihre Kinder selber zu benennen, doch die Elternpflichten verlangen ihnen noch mehr ab. Daß das Kind einen Namen hat, hindert zerstreute Zeitgenossen, Kritiker zumal, keineswegs, das Blag andauernd mit auf den ersten Blick ähnlichen Blagen zu verwechseln. Also ist der Künstler ebenso häufig gefordert, auf der Einzigartigkeit oder doch Besonderheit seines Lieblings zu insistieren. Ich zitiere aus einem vorbeugenden Brief, den Christian Morgenstern an einen präsumtiven Kritiker seiner Galgenlieder gerichtet hat:
Ich habe nur eine Bitte: Sollte (was ja immerhin möglich wäre) in Ihrem Aufsatz das Wort Blödsinn oder Stumpfsinn, wenn auch noch so glänzend epithetiert, vorkommen, so ersetzen Sie es meinethalben durch Wahnwitz oder Tollheit oder dergleichen; da Sie es wahrlich begreifen werden, daß es auf die Dauer nicht angeht, einen Humor, dessen vielleicht einziger Vorzug gerade in einer gewissen Art von Geistigkeit, von Helligkeit und Schnelligkeit besteht, mit diesen zwei üblen deutschen Philister- und Bierbankausdrücken, in denen sich, wie Sie hieraus erraten, die Mehrzahl meiner ,Kritik‘ gefällt, abzustempeln.19
Der Hau-Geist
Ein vergleichbar besorgter Definitionsdrang hatte Bernstein, Waechter und mich beflügelt, als wir unser Buchprojekt Die Wahrheit über Arnold Hau im Jahre 1966 dem Verlag Bärmeier & Nikel mit den folgenden abgrenzenden Worten vorstellten:
Nach der Lektüre von sehr vielen Beiträgen, die für dieses Buch ausgewählt wurden, glauben wir so etwas wie einen typischen Hau-Geist gespürt zu haben. Ihn kennzeichnet das Direkte, das Private, das Sinnlose, das Unverhältnismäßig-Beziehungsreiche, das Banale, das Unerwartete, das Gerade-Erwartete, das Grobe, das Unverständlich-Feine.20
Neben der vorbeugenden oder vorauseilenden Definition des gerade laufenden oder des gerade abgeschlossenen eigenen Tuns steht die – in meiner Vita weit häufigere – Retrospektive. Das Kind ist dabei sich abzunabeln, hat sich gänzlich abgenabelt, schon ist es dem Vater ein wenig fremd, und halb gerührt, halb distanziert läßt er noch einmal die gemeinsam verbrachten Jahre Revue passieren.
„Was einer ist, was einer war, beim Scheiden wird es offenbar“, singt der Dichter Carossa,21 und solche Scheidemomente ziehen sich wie ein roter Faden durch mein Tun und Loslassen – wobei ich ausdrücklich auf den schönen Doppelsinn des Wortes „Scheiden“ hinweisen möchte, das ja nicht nur als „Abschiednehmen“, sondern auch als „Kritisieren“ begriffen werden kann: Erst wenn die emotionale Bindung an eine Mitteilungsform sich gelockert hat, ist es dem Mitteilenden möglich, mit halbwegs klarem Kopf darüber zu räsonieren, was ihn da jahrelang so bezaubert, begeistert und beschäftigt hat; erst wenn die Eule der Minerva zu ihrem Flug übers Abendfeld ansetzt – doch bevor der Metaphernsalat aus Kind, Geliebter und Nachtvogel völlig über mir zusammenbricht – wofern ein Salat dazu überhaupt in der Lage ist –, rasch zurück auf den Boden der Tatsachen.
Tränenlose Scheideblicke
1984 machte ich mir im Nachwort meines Sammelbandes Letzte Ölung Gedanken darüber, ob meine Satiren aus rund zwanzig Jahren irgend etwas bewirkt hätten, und ich beschloß den Band mit einem Scheidegruß, welcher den Titel trug „Warum ich nicht gern Satiriker bin und mich nur ungern als solchen bezeichnet sehe. Keine Satire.“22
1986 blickte ich anläßlich eines weiteren Sammelbandes auf Schnuffi zurück, eine Comic-Figur, die mich elf Jahre durchs Leben begleitet hatte, da ich von 1964 bis 1976 allmonatlich einen neuen Vierbilder-Strip ersinnen mußte. Zehn Jahre später nun winkte ich meinem Helden noch einmal zu und versuchte zugleich die jahrzehntelange Liaison mit dem Comic zu beschreiben, zu bewerten und zu begründen.23
Ende der 80er Jahre dann häufen sich solche Abschiede. 1988 versammelte ich im Bildband Innen und Außen gänzlich komikfreie Bilder und Grafiken aus den 70er und 80er Jahren, wohlwissend, daß sich da nichts in die 90er fortsetzen würde: Spätestens seit Mitte der 80er Jahre war ich kein Maler mehr, obwohl ich noch ab und an ein Bild malte; nun hatte ich aufgehört, mit diesem Schicksal zu hadern und Distanz genug, einen furcht- und tränenlosen Scheideblick auf diese über alles geliebte Kunst zu werfen. Im gleichen Jahr erschien ein weiteres Abnabelungsbuch mit dem Titel Was gibt’s denn da zu lachen?. Fast zehn Jahre lang hatte ich zusammen mit Freunden in der satirischen Zeitschrift Titanic eine Rubrik bedient, die sich „Humor-Kritik“ nannte – „Komik-Kritik“ wäre zutreffender gewesen –, nun hatte ich so viel über Komik und Komisches in Erfahrung gebracht, daß ich einen Schlußstrich unter die Kritik des Komischen zog und mir zugleich Gedanken darüber machte, wie es eigentlich um mich und die Komik stand. Jahrzehntelang waren wir vor der Welt ein Paar gewesen, doch nach Erscheinen des Gedichtbands Körper in Cafés von 1987 hatte es nicht an enttäuschten Stimmen gemangelt, die dem Dichter vorwarfen, er sei dabei, nach Art alternder Clowns weise, wertvoll und weinerlich zu werden – Grund genug für den Gescholtenen, in sich zu gehen und sich die Frage zu stellen, wer da eigentlich Grund habe, von wem enttäuscht zu sein: Die Komik von mir? Ich von der Komik? Der Leser vom Dichter? Der Dichter vom Leser?
Ein Selbstvergewisserungsprozeß, der sich 1990 im Nachwort von Reim und Zeit fortsetzte, einer Gedichtauswahl, die ich für den Reclam Verlag getroffen hatte. Bereits als Schüler hatte ich gedichtet, seit 1966 hatte ich Gedichte veröffentlicht, ohne mich doch als Dichter zu begreifen oder mich zum Gedicht zu äußern, nun, nach dem Abschied von der Malerei und dem Kriseln der Komikbeziehung war die Zeit des unschuldigen Beckens vorbei, mußte ich mich der Poesie erklären und unseren Status vor der Welt rechtfertigen:
Herr Gernhardt, warum schreiben Sie Gedichte? Das ist eine lange Geschichte.24
Vieles galt es zu klären: Warum hielt ich dem als abgetan verschrieenen Reim die Treue? Wieso bewegte ich mich vorzugsweise in jener Grauzone, in welcher nicht mehr auszumachen war, ob die Kinder der Einbildungskraft ihr Dasein einem Spaßmacher oder einem Ernstmacher verdankten? Weshalb schien mir ausgemacht, das Tiefe und das Flache seien – zumal im Gedicht – keine Gegensätze, sondern fließende Übergänge?
Seither, seit dem Jahre 1990 also, habe ich mich wiederholt zum Gedicht geäußert und bekannt: Im gleichen Jahr in einer Gedanken zum Gedicht betitelten Aufsatzsammlung, sodann als selbsternannter Lyrikwart der Wochenzeitung Die Zeit, in der dort unregelmäßig erscheinenden Kolumne „Fragen zum Gedicht“, bis ich mich im – ausgerechnet! – Mai dieses Jahres auch im universitären Bereich als ebenso treuer wie stets aufs neue entflammter Liebhaber der ebenso altehrwürdigen wie seit ihren Anfängen unverändert jugendfrischen Poesie outete.
Doch rasch noch einmal zurück in die jüngere Vergangenheit: 1997 ist ein weiterer – nein! sagen wir nicht: Abschied von, sagen wir: Rückblick auf – eine mir sehr lange Zeit sehr liebe Mitteilungsform zu verzeichnen, ein Rückblick auf Bildwitz, Karikatur, Cartoon, Bildgeschichte, Comic und Bildgedicht – alles Stiefkinder eines etepetetehörigen Feuilletons, da bei diesen quer über alle Grenzen kobolzenden Blagen nie auszumachen ist, welcher Lümmel dem Literatur-Ressort zuzurechnen ist, welche Göre dem der bildenden Kunst. Grund genug für den Vater, die Gelegenheit seines Sammelbandes Vom Schönen, Guten, Baren dazu zu nutzen, seine langjährige Affäre mit der ebenso bildhaften wie wortgestützten Komik öffentlich zu machen und zugleich darauf zu dringen, daß der auf den ersten Blick schwer unterscheidbare Nachwuchs dieser Beziehung nicht einfach in einen Topf geworfen werde, sondern in deutlich getrennte, sorgfältig beschriftete Töpfchen: Bildwitz, Karikatur, Cartoon – und so weiter.
Doch zurück zu mir: Weshalb dieser Beziehungswirrwarr? Weshalb dieser unablässige Wechsel von Mitteilungsform zu Mitteilungsform? Von der Malerei zum Comic, vom Comic zur Satire, von der Satire zum Nonsens, vom Nonsens zur Malerei, von der Malerei zur Prosa, von der Prosa zum Gedicht – und all das auch noch zu allem Überfluß begleitet von sekundären Überlegungen zu all diesen primären Hervorbringungen? Vielleicht liefert das folgende Zitat aus Was gibt’s denn da zu lachen? den Schlüssel zum beschriebenen Verhalten:
Die Frage ist doch: Wann kriegen sie dich? (Ich, der 14jährige, auf dem Fahrrad, im Begriff, in die Innenstadt von Stuttgart hinunterzuradeln, bin plötzlich erfüllt von einem Vorsatz, einem Versprechen, ja fast einer Gewißheit: Sie sollen mich nicht kriegen!)25
Wer sich bewegt, der ist naturgemäß schwerer zu kriegen als der Seßhafte. Und wer sich einigermaßen flink zwischen den Mitteilungsformen bewegt, der ist nicht so leicht feststellbar und sehr viel schwerer haftbar zu machen: Wird der Maler getadelt, fühlt der sich längst als Dichter, geht’s dem Dichter an den Kragen, fühlt der sich grad als Denker, gilt die Kritik dem Denker, dann wähnt der sich als Macher – und so fortan. Freilich kennt auch der so Bewegliche Momente der Besinnung, Augenblicke, in denen er sich fragt, wo er steht, wie es um ihn steht, wes Geistes Kind er im Grunde seines Herzens ist. Dann schlägt die Stunde einer weiteren – wenn man so will: theoretischen – Anstrengung des Künstlers, die Selbstvergewisserung durch den Blick in die Biographien anderer Künstler.
Ölbildchen von Wilhelm Busch
Ebergötzen, Wiedensahl und Mechtshausen heißen die Stationen des Künstlers, dessen Werke ich bereits als Kind liebte und belachte und dessen Leben dem reiferen Menschen zu denken gab: War doch auch Wilhelm Busch, denn das war sein Name, ein Grenzgänger zwischen Ernst und Spaß, zwischen Malerei und komischer Zeichnung, zwischen bildender und geschriebener Kunst. Daß ich mich im Jahre 1980 erstmals forschender über seine Biographie beugte, war prima vista dem Zufall geschuldet – ohne erkennbaren Anlaß hatte mich Hellmuth Karasek, damals noch für den Spiegel tätig, gefragt, ob ich etwas über Busch schreiben wolle.
Ertönte da ein feines Stimmchen, dessen „Nimm und lies“ mich anhielt, dieser Anregung zu folgen? Jedenfalls nahm ich mir erneut Wilhelm Buschs Bildepen vor, zugleich las ich Biographisches von Ueding, Bohne und Leube, und je länger ich las, desto weniger konnte ich umhin, Buschs und meine Vita zu vergleichen. Die Vita, nicht das Werk. Als komischer Zeichner war Busch unvergleichlich, das erkannte und anerkannte der 42jährige Busch-Exeget so begeistert wie bescheiden. Doch warum hatte dieser geniale Komikproduzent die Komikproduktion bereits mit 52 Jahren eingestellt, um weitere zwanzig Jahre lang als „Weiser von Wiedensahl“ kleine Ölbilder zu malen, die er nicht ausstellte, und kleine Gedichte zu schreiben, die er nur ungern aus der Hand gab? Gab es bei den – nennen wir sie mal so summarisch – Leistungskomikern ein biologisches Verfallsdatum, analog zur Leistungsfähigkeit der Leistungssportler?
Das lief dumm, die Zeit ist um
War nicht Morgenstern mit vierzig gestorben? Hatte nicht Tucholsky als Mittvierziger Selbstmord verübt? Hatte nicht Geoge Grosz im selben Alter der Satire abgeschworen und sie als Afterkunst verdammt? Und nun verstummte auch noch Busch an der Schwelle seiner 50er Jahre: Es wehte den 42jährigen kalt an, als er sich vergegenwärtigte, daß auch ihm möglicherweise nur noch zehn Jahre blieben, um das ihm in Sachen Komik zu Sagende zu sagen, also schöpfte er verstärkt aus allen ihm erreichbaren Quellen, um den Wörtersee – so der Titel eines Gedichtsbandes aus dem Jahre 1981 – mit möglichst viel komischer prima materia zu füllen. Denn so viel hatte ich damals bereits begriffen: Alles hat seine Zeit. Dichten hat seine Zeit, Richten hat seine Zeit, Malen hat seine Zeit, Prahlen hat seine Zeit, Witzeln hat seine Zeit, Kritzeln hat seine Zeit, Zeigen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit – und wehe dem Künstler, der den je fruchtbaren Moment – sei es für die Praxis, sei es für die Theorie – verstreichen ließ! Dann nämlich hieß es unerbittlich: Schade, das lief dumm, deine Zeit ist um.
Denn nicht nur jedes, auch jeder hat seine Zeit. So sie ihm denn gegönnt wird. Im Alter von 42 Jahren hatte ich voller unguter Ahnungen den unaufhaltsamen Rückzug des 52jährigen Wilhelm Busch bedacht: exakt 20 Jahre später, als 62jähriger wußte ich es besser und ich wußte mehr. Wieder beugte ich mich über Wilhelm Buschs Vita, erneut war der Grund ein Anstoß von außen. Hans Magnus Enzensberger hatte mich gefragt, ob ich nicht für die Andere Bibliothek ein Konzentrat des ungemütlichen Busch zusammenstellen wolle, und ich wollte. Zugleich trat der Hessische Rundfunk auf den Plan, der mir eine mehrstündige Busch-Lesung und Busch-Deutung abverlangte, und spätestens zu diesem Zeitpunkt glaubte ich nicht mehr an Zufälle: 42, 52, 62 – das war zu dezimal, um casual zu sein. Hatte ich vor zwanzig Jahren bedenklich zum zehn Jahre älteren Busch hinausgeschaut, so schaute ich nun nachdenklich auf den zehn Jahre jüngeren hinab: Was um Himmels willen hatte den 52jährigen Komikproduzenten Busch verstummen lassen? Was ihn bewogen, sich seiner komischen Produkte zu schämen? Was ihn darin bestärkt im ihm unerreichbaren Ernst das eigentliche Heil zu erblicken? Hätte nicht auch er sich jenen fließenden Übergängen anvertrauen können, die im Laufe der Zeit immer mehr zu meinem Element geworden waren:
Sagt: Warum heißt man seit alters sie
Gegensätze? Das Tiefe, das Flache? Sind nicht
Verschwistert sie? Es gehet unmerklich
Das Flache ins Tiefe. Es spüret der Fuß kaum
Den schwindenden Boden des Schwimmers. Also
Mischt sich der Tiefsinn dem Flachsinn, und jene,
Welche da glauben, sie würden noch flachsen
Wissen sie denn, ob sie längst nicht schon tiefsen?26
Damit setzen wir einen Fuß auf ein noch wenig kartographiertes, schwer feststellbares Grenzterrain, in welchem selbst Theorie und Praxis nicht mehr sauber voneinander geschieden werden können. „Du hättest singen sollen, meine Seele“, klagte der dem Zusammenbruch nahe Denker Nietzsche im Bewußtsein der Tatsache, daß dieser Denker den Dichter Nietzsche zeit ihres Zusammenlebens nie so recht hatte zu Wort kommen lassen.
Lehrer Lempels Lehrgedicht
Als ob Denken und Dichten, Sagen und Singen, Fragen und Richten, Lenken und Zwingen unüberbrückbare Gegensätze seien, als ob nicht wenigstens ein Steg trage von der Produktion zur Reflexion und umgekehrt. Es gibt ihn, diesen Steg, und das seit alters, ich zitiere das Sachwörterbuch der Literatur des Gero von Wilpert:
Lehrdichtung, Lehrgedicht vermittelt Wissen um subjektive oder objektive Wahrheiten (Lehren Erkenntnisse) in künstlerischer Form.27
Nur: Wer schreibt denn heutzutage noch Lehrgedichte in der Nachfolge der altindischen Sutras, des Hesiod, der Parmenides, des Empedokles, des Horaz, des Vergil, des Ovid, der Wieland, Lessing, Goethe schließlich?
In aller Bescheidenheit bemerkt: Ich.
Im Jahre 1964 hatte ich in Berlin den Grundstein zu einer lehrhaften Karriere gelegt: Nachdem ich bereits ein Philosophicum und eine Kunsterzieherprüfung passiert hatte, erlaubten mir vier Semester Schmalspurgermanistik mit abschließender Staatsprüfung, als Referendar in den Fächern Kunsterziehung und Deutsch anzutreten. Statt dessen trat ich in die Redaktion der satirischen Zeitschrift Pardon ein, doch da blieb ein Stachel. Der unerlöste Lehrer in mir reckte als Satiriker den mahnenden Zeigefinger, drang als Maler auf Überprüfbarkeit und Handwerk und wagte als Dichter den Versuch, die totgesagte Gattung des Lehrgedichts dadurch wiederzubeleben, daß er sie zum Anlaß des folgenden Selbstvergewisserungsgedichts nahm:
AUCH EINE ÄSTHETIK
Gefragt, was er eigentlich wolle, sagte er:
Will nicht das Theater erneuern,
Habe dergleichen auch niemals erwogen.
Weiß nämlich gar nichts vom alten Theater.
Kann also gar kein Theater erneuern.
Will nicht die Prosa revolutionieren.
Achte doch sonst auch auf Vorschrift und Regel.
Halte bei Rot und fahre bei Grün an.
Gebe Gas und bremse genauso beim Schreiben.
Will nicht das Gedicht vorwärtsbringen.
Denke immer, es sollte mir weiterhelfen.
Frage mich, wo vorn und hinten ist bei Gedichten.
Weiß nur, daß sie Anfang und Ende haben.
Will nicht die Grenzen der Kunst erweitern.
Habe eher Angst, mich in ihr zu verlieren.
Fühlte in kleinerer Kunst mich viel wohler.
Stapf dennoch pfeifend querbeet durch die große.
So macht er sich Mut.28
Geschrieben in einem Moment der Anfechtung – Sie werden dafür Verständnis haben, daß ich in diesem Moment der Ehrung nicht derart kleinlaut und lehrhaft enden kann und will. Nein, dichterische Praxis soll meine Überlegungen zur Theorie beschließen, gebundenes Wort, das sich immer dann gern in die Form des Sonetts ergießt, wenn der Anlaß erhaben ist und der Dichter ich seelisch erhoben fühlt. Oder verhält es sich so, daß die Form des Sonetts jedweden Anlaß adelt und noch den geringsten Dichter dadurch erhebt, daß er sich in einer Reihe mit Sonettisten wie Petrarca, Shakespeare, Goethe und Rilke weiß? Stoff genug für eine Doktorarbeit, die ich glücklicherweise nicht zu schreiben brauche, da Sie mich auch so promoviert haben. Auf diese ebenso ehrenvolle wie kraftsparende Weise weiterbefördert, kann ich nur hoffen, daß mein abschließender Brückenschlag von der Theorie zur Praxis derart solide gebaut ist, daß wir alle unbeschadet zu einem guten Ende dieser Überlegungen gelangen. Hören Sie zum Abschluß das
SONETT VOM DIES MIRABILIS
Seufzend wank ich unter so viel Glück.
Wie parier ich nur den ganzen Segen,
der auf mich herniederprasselt? Regen
ist das nicht mehr. Das – mein Gott, wie drück
ich’s nur aus? Ist Wasserfall, ist Flut,
warme Dusche. Ach, auf allen Wegen,
die ich einschlag’, stürzt sie mir entgegen,
einem Stausee gleich, der lang geruht,
Bis der Damm brach. Lobesmassen
treiben mich in immer höh’re Zonen,
wo um Ruhmestempel Feuer flammen.
Und mich Gernhardt-Priester liebend fassen:
„Herr! Geruh in diesem Haus zu wohnen!“
Anbetend brech ich vor mir zusammen.29
Robert Gernhardt, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, Fischer Taschenbuch Verlag, 2002
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IMDb + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.





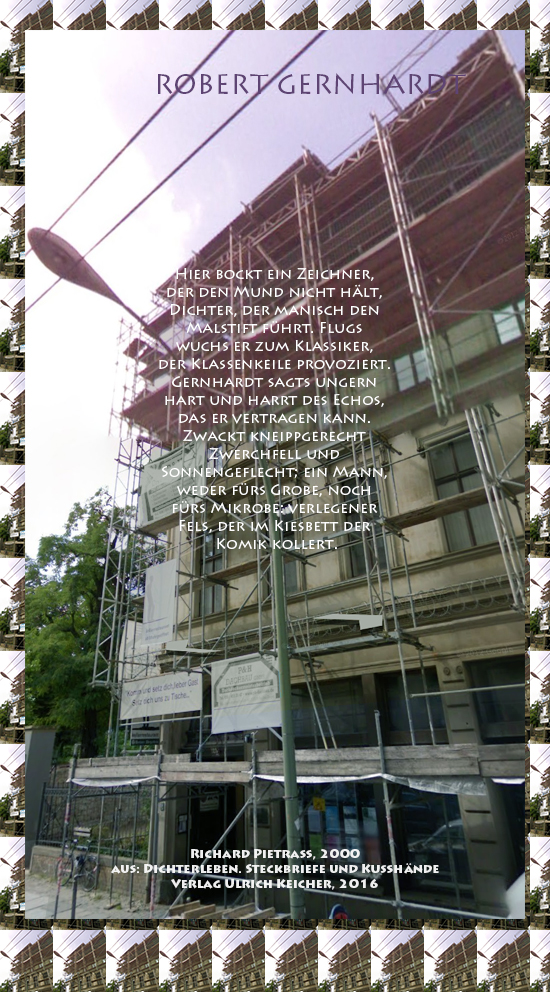












Schreibe einen Kommentar