Robert Gernhardt: Was das Gedicht alles kann: Alles
WIE ARBEITET DER LYRIKWART?
„Vielleicht sollte man doch noch einmal nach dem Handwerk fragen?“, fragt Harald Hartung im prächtigen Sonderheft des Merkur, das auf zwei Säulen ruht:
Lyrik. Über Lyrik.
An die „ehrwürdigen Metaphern Verseschmied, Verseschmieden“ erinnert er, und daran, daß T.S. Eliot The Waste Land, „Haupt- und Bravourstück der lyrischen Avantgarde“, jemandem gewidmet hatte, der dem Poeten kürzend und präzisierend zur Hand gegangen war:
For Ezra Pound, il miglior fabbro.
Das spielt, wir erinnern uns, auf Dante an und bedeutet, übersetzen wir’s mal frei: „dem besten Handwerker“, und es ist dieser Brückenschlag über gut siebenhundert Jahre, der mir Mut und Lust macht, ihn bis in die Gegenwart der Hartungschen Frage zu verlängern, allerdings ohne deren Einschränkung. Nicht vielleicht, natürlich muß mal wieder nach dem Handwerk des Dichters gefragt, ja es sollte regelrecht eingeklagt werden – schließlich sind Gedichte Menschenwerk, und da zählt nun mal nicht das gut Gemeinte, sondern das gut Gemachte. Wer aber befindet in Sachen Gedicht über gut, passabel und schlecht gearbeitet? Eine Lyrikhandwerkskammer gibt es nicht, also bleibt es selbsternannten Lyrikwarten überlassen, nicht nur die Wirkung eines Gedichts zu referieren, sondern es auch als Werkstück zu kritisieren, zumal dann, wenn der Dichter sein Gedicht nach erkennbaren Regeln gebaut hat, also auch Regelerfüllung und Regelverstoß gelobt werden können beziehungsweise gerügt werden müssen. Klingt alles ein wenig abgehoben und theoretisch? Dann folgen Sie mir bitte auf den Boden der Tatsachen und erleben Sie einen Lyrikwart bei der Arbeit. Gerade schaut er auf die Uhr, und da kommt auch schon der zu diesem Termin angesagte Dichter, Sie kennen ihn alle – herzlich willkommen, Dr. Benn!
Warum ich Sie zu mir gebeten habe? Nun, neulich las ich mal wieder Ihre späten Gedichte, vor allem jene, die Sie 1955 in Ihrem letzten Gedichtband Aprèslude versammelt haben – eine beeindruckende Ernte!
Reimloses neben Gereimtem, Zynisches – „dumm sein und Arbeit haben: Das ist das Glück“ – neben überraschend Anrührendem wie „Menschen getroffen“, ein reimloses Hohelied der Sanftmut und zugleich ein mutiges Gedicht, da das Preislied erfahrungsgemäß ungleich riskanter ist als der Schmähgesang.
Den Beweis dafür liefern Sie selber in einem anderen Gedicht dieser Sammlung, das sich „Kommt –“ nennt und ebenfalls ganz schön mutig ist. Aber ist es auch schön?
Kommt, reden wir zusammen
wer redet, ist nicht tot,
es züngeln doch die Flammen
schon sehr um unsere Not.
Der Anfang – ein Gedicht! Hell wie eine Fanfare, einprägsam wie ein Sprichwort – wunderbar! Demgegenüber bleiben die Flammen, die da um „unsere Not“ züngeln, leider etwas dunkel: Einerseits sind es ja die Flammen selber, die normalerweise eine Notsituation heraufbeschwören, andererseits züngeln sie um die Not und könnten diese daher auch in Asche verwandeln, also beseitigen – was eigentlich ist gemeint? Aber lesen wir weiter:
Kommt, sagen wir: die Blauen,
kommt, sagen wir: das Rot,
wir hören, lauschen, schauen
wer redet, ist nicht tot.
Eine Strophe, die ich ebenfalls mit gemischten Gefühlen lese. Einerseits begrüße ich es, daß die suggestive Zeile „Wer redet, ist nicht tot“ erneut auftaucht und so etwas wie ein Refrain zu werden verspricht. Lobenswert auch die Wiederholung des auffordernden „Kommt“ – doch was sich zwischen Auftakt und Schlußzeile abspielt, kann nicht wirklich Ihr Ernst sein. Wie schon die erste Strophe ist auch diese kreuzweis gereimt, und es ist, fürchte ich, der Zwang auf „tot“ zu reimen, der jenen merkwürdigen Dialog in Gang setzt, der „die Blauen“ gegen „das Rot“ ausspielt: Wer so redet, mag zwar noch nicht ganz tot sein, etwas blöd ist er ohne Frage. Aber weiter im Text:
Allein in deiner Wüste,
in deinem Gobigraun –
du einsamst, keine Büste,
kein Zwiespruch, keine Fraun,
– ich unterbreche, um dreierlei zu konstatieren: Der Refrain fehlt. Statt des lyrischen Wir tritt unvermittelt ein lyrisches Du auf den Plan. Wo eben noch Flammen gezüngelt haben, ist dieses Du nun von einer Landschaft umgeben, die sich durch den Mangel an Brennbarem auszeichnet, von Wüste. Aber weiter im Text:
und schon so nah den Klippen,
du kennst dem schwaches Boot –
kommt, öffnet doch die Lippen,
wer redet, ist nicht tot.
Refrain und „Kommt“ sind wieder da – mehr kann ich der Schlußstrophe beim besten Willen nicht abgewinnen. Eben litt das Du noch einsamst in der Wüste, da sitzt es schon – gottlob ohne Büste – im schwachen Boot und hat mit Wassermassen zu kämpfen. Lebensgefahr – doch seltsamerweise wird nicht das Du zum Reden aufgefordert, sondern das reaktivierte Wir. Sitzt dies, soeben noch von Flammen bedroht, etwa ebenfalls im Kahn?
Tja, Herr Benn – hier muß der Lyrikwart zu radikalen Eingriffen raten, um den rettenswerten Kern von den krausen Wucherungen zu befreien. Das bedeutet im Klartext: Beibehaltung des Kreuzreims, des Refrains, des „Kommt“. Verzicht auf Feuer- und Wüstenmetaphorik und Beschränkung auf ein Bild, das Wasser. Streichung der dritten Strophe inklusive des einsamsten Herrn, der sich dort nach „Büste“ sehnt – offenbar der eigenen –, nach „Zwiesprache“ – offenbar, weil „Zwiegespräch“ nicht ins Metrum gepaßt hätte – und nach Fraun – offenbar ein Scheich.
Wie das Ergebnis der Operation aussehen könnte? Hier der Vorschlag Ihres Lyrikwarts:
Kommt, reden wir zusammen.
Wer redet, ist nicht tot.
Kommt, laßt uns den verdammen,
der uns mit Schweigen droht.
Kommt zu dem Fluß der Rede.
Das Wort sei unser Boot.
Als Sprache dien’ uns jede:
Wer redet, ist nicht tot.
Kommt! Schon so nah den Klippen
des Schweigens tut eins not:
Das Öffnen eurer Lippen.
Wer redet, ist nicht tot.
Sie schweigen, Herr Benn? Kommt, reden wir zusammen! Oder möchten Sie meinen Vorschlag noch einmal überschlafen?
„Scheiden, Sieben, Machen“
– Robert Gernhardts Poetologie der Praxis. –
„Die Lust, Gedichte zu lesen, ist uns einfach abhanden gekommen“, konstatiert Andreas Thalmayr alias Hans Magnus Enzensberger 1985, und stellt die Frage in den Raum:
Vielleicht sind die Dichter schuld?1
Wie sein Cento „Teestunde“, ein Flickengedicht aus Versen von Günter Herburger, Michael Krüger, Jürgen Theobaldy und Rolf Dieter Brinkmann,2 zu belegen scheint, tragen die Dichter zumindest eine Mitschuld an der „Ausdruckskrise“ der Nachkriegszeit.3
Peter Rühmkorf zufolge haben die ,Jungen‘ seit den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts den „glänzenden Tricks“ ihrer Zunft den Laufpaß gegeben und von den „atemberaubenden Fertigkeiten“ der ,Alten‘ kaum noch Gebrauch gemacht: unter „Ästhetizismus, Isolationismus. Esoterismus“ subsumierte er das „Kollektivphänomen“ der zeitgenössischen Lyrik.4
Wie Rühmkorf lange vor Enzensberger vorgeführt hat, gibt es jedoch immer auch Ausnahmen: Dichter, die „Offenheit gegenüber Weltstoff und Wirklichkeit“5 demonstrieren und gezielt mit dem tradierten Formenrepertoire arbeiten, ohne daß sich der Saccharine „Sentimentalismus“ der „Neuromantiker“ oder die gefühlig-kunstgewerbliche „Schönmalerei“6 der Naturlyriker wie Mehltau über die Strophen legte.
Zu den Autoren, die welthaltige, kulturell anschlußfähige, bei der Kritik wie beim Leser erfolgreiche Gedichte verfaßt haben, gehört ohne Zweifel Robert Gernhardt mit seinem eindrucksvollen Werk. Es erfüllt alle Anforderungen, die Rühmkorf an zeitgemäße Lyrik stellte, aber immer nur partiell-vereinzelt realisiert sah: „Rückgriffe auf die Tradition“ sowie „Erweiterung und Belebung der poetischen Möglichkeiten“; „absolute Stilsicherheit“ und „kluge Kombination von verschiedenen Ausdrucksweisen“; „Aufgeschlossenheit“ und ein „leidenschaftliches Verhältnis zu Welt und Wirklichkeit“; „Anschauungs- und Einfühlungsbegabung“ sowie „Individualität“.7
Robert Gernhardt verstand viel von Lyrik und er hat oft von seinen „Erfahrungen mit Gedichten“ Zeugnis abgelegt. Als „Lyrikwart“ hat er von der Lust und der Last aller Dichtungskritik gekündet, in seinen Poetikvorlesungen stimmte er sein Auditorium praktisch wie theoretisch auf das „Handwerk des Dichtens“ ein:
Leiden, Lieben, Lachen – das reimt sich schließlich auf Scheiden, Sieben, Machen, alles Tätigkeitswörter, die davon künden, daß jedes Gedicht Menschenwerk ist, das getrost von anderen Menschen untersucht, gewogen und für gewichtig genug oder für zu leicht befunden werden kann.8
Darüber hinaus überzeugte er durch seine Autorentheorie, die sich als Fürsprache und Kritik des Gedichts verstehen läßt: denn alle „Rückzugspraktiken“ und „Reduktionsverfahren“ der Lyrik und der Lyriker lehnte er, wie schon Rühmkorf, ab, ihrer Selbstbescheidung und Selbstbeschneidung trat er entgegen.9
Ich rühm Korf:10
Der Grund, weshalb Peter Rühmkorf in Gernhardts Poetik ebenso wie in unserem Nachwort vergleichsweise prominent vertreten ist, dürfte nicht nur in der unermüdlichen Produktivität jenes Autors in Theorie und Praxis, sondern auch in gemeinsamen Überzeugungen und gegenseitiger Wertschätzung zu suchen sein. Seit den fünfziger Jahren hat Rühmkorf eine Fülle von Kritiken und Beiträgen zur Lyrik publiziert und daraus mehrfach Summen gezogen. Die deutsche Gegenwartslyrik bilanzierte er bereits 1962 mit unmißverständlicher Schärfe; in „Das lyrische Weltbild der Nachkriegsdeutschen“ kritisiert er den poetischen Kleinmut und die Kleinmalerei der Kollegen Auctores und kommt zu dem Befund, daß die „Überkatastrophe“ des ,Dritten Reiches‘ anscheinend „nichts Erheblicheres als die perfekte Mittelmäßigkeit“ hervorgebracht habe: Denn wo „zeigte sich auch nur der Hauch einer Auf- und Umbruchsliteratur, ein Wagnis aus Stil, ein Neubeginn aus Sprache“?11
Rühmkorfs Positionsbestimmungen sind durchaus als Vorgriff auf Gernhardts Poetik lesbar: Wie jener beklagt Gernhardt die Dunkelheit und Wirklichkeitsentfremdung der kurrenten Lyrik; wie jener bekämpft er die diffuse Selbstbespiegelung, die dem Alltag die Gefolgschaft und der Gegenwart das Interesse aufkündigt; und wie jener scheut er sich nicht, selbst bei großen Namen Angelesenes statt Erlesenheit, Plastikperlen statt Rarissima, Flachsinn statt Tiefsinn, Wortbetrug statt poetischer Wahrheit zu konstatieren.
Beider, Gernhardts wie Rühmkorfs Unbehagen richtet sich gegen Strömungen und Tendenzen, die sich – wie das „Behelfsprogramm der Naturlyrik“12 etwa – aus den „gesellschaftlich bedingten Erscheinungsformen“13 herausstehlen. Die Aufgaben der Lyrik seien „Ortsbestimmung“, „Bestandsaufnahme“, „Besitznahme“ und nicht Abkehr von der Wirklichkeit.14 Beiden ist die Konzeption von „Kunst als Enklave des zeitlos Absoluten“15 suspekt, beide erwarten von der deutschen Lyrik, daß sie deutlich, verständlich und zeitbezogen sei.
In „Was bleibt?“, seiner vierten Düsseldorfer Vorlesung, zitiert Gernhardt Rühmkorfs Befremden darüber, daß „die ersten Nachkriegspublikationen mit Umbruch und Erschütterung, mit Wandlung oder Neubeginn nicht das mindeste zu tun hatten“: In direkter Bezugnahme auf dessen Essay „Das lyrische Weltbild der Nachkriegsdeutschen“ diskutiert er Rühmkorfs Kritik an den „Nachkriegsidyllikern“, die der „Überkatastrophe anscheinend nicht viel mehr als die perfekte Mittelmäßigkeit“ abzugewinnen wußten.16
Ähnlich wie Rühmkorf, der sich von Walther von der Vogelweide an in eine illustre Folge namhafter Lyriker einreiht, aber nach 1945 speziell die „schöpferische Revision des deutschen Expressionismus und eine Besinnung auf die eigenen modernen Traditionen“17 vermißt, geht es Gernhardt um die Traditionsbestände lyrischen Sprechens insgesamt. Dabei ist ihm die Moderne, vielleicht aufgrund ihrer leerformelhaften Beschwörung durch seine Zeitgenossen, von vornherein suspekt, und sie ist bei ihm – anders ausgedrückt – nicht deshalb schon positiv konnotiert, weil sie ,modern‘ ist. Sie ist allzuoft, so suchen es Gernhardts Analysen zu erweisen, selbstvergessen, bezugslos, beliebig, realitätsfern. Gernhardt bemängelt die extrem reduzierte Wirklichkeit, die ihm etwa in den Gedichten der Anthologie Transit vermittelt werden soll,18 und er lehnt vor allem auch die esoterische Separiertheit und den ästhetischen Dünkel jener Anthologisten ab, die mit ihren Produkten offenbar unter sich bleiben wollen. Walter Höllerers Auffassung, wonach Gedichte „schon deswegen vernachlässigt werden“ dürften, weil sie in Anthologien bereits „breiteren Raum einnehmen“ würden, muß ihm absurd erschienen sein.19 Denn er hat im Gegenteil nichts gegen die Prominenz einzelner Gedichte, nichts gegen die Signalwirkung berühmter Verse, die Beliebtheit bestimmter Genres (der Gedankenlyrik etwa); er hat keine Einwände gegen Texttypen und „Mitteilungsformen“ (wie dem Sonett), in denen sich über alle Zeiten hin die Dichter versuchten.20 Ihm geht es gerade um die bekannteren Texte und Texttypen, auf die sich der schmale Pfad der Anthologien verengt, weil sich anhand ihrer erst ein Kanon der Literaturgesellschaft formiert.21 Erst der gemeinsame Nenner stiftet Identität, und deshalb ist er auch bemüht, für das, was dort hineingehört, zu werben, und gegen das, was dort nicht hineingehört, Argumente zu sammeln.22
„Große, gute Macher waren schon immer die besten Kritiker“,23 sagt Gernhardt und begutachtet mit Anteilnahme und methodischem Bedacht die poetischen Mittel seiner Zeitgenossen. Er verwandelt sich nach Bedarf „in den gefürchteten ,Lyrikwart‘“24 und gründet in dieser Rolle „seinen Stolz“ auf die Fähigkeit, „ein Gedicht bereits nach kurzer, aber scharfer Musterung“ klassifizieren, analysieren und kritisieren zu können.25 Der Dichter müsse sich auf sein Handwerk verstehen, so seine Forderung, und er müsse sich der Kritik stellen. Folglich münden seine Ausführungen zur Theorie und Praxis der Lyrik in eine Poetik des Gedichts. Sie wurde laufend erweitert und strategisch arrondiert und läßt die Schwerpunktsetzungen erkennen, nach denen dieser Band gegliedert ist.
So ein Gedicht, das
schreibt sich doch nicht selber hin!26
Kein Autor ohne Autorentheorie. Die Selbstreflexion gehört zu den Erwartungen, mit denen sich jeder Autor der Moderne konfrontiert sieht, und auch wenn er sich der Moderne nicht zurechnet oder verpflichtet fühlt, bleibt er doch auf sie bezogen. Es wird daher nur wenige Lyriker seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert geben, die sich nicht poetologisch geäußert und nicht auch Gedichte mit autorentheoretischen Implikationen verfaßt hätten. Wenn es aber für selbstverständlich genommen werden kann, daß Dichter über die Bedingungen und Folgen ihrer poetischen Produktion Überlegungen anstellen, dann ist auch anzunehmen, daß wenigstens einige von ihnen damit ein Sendungsbewußtsein im Sinne einer Produktionsästhetik verknüpft haben.
Letzteres ist schon nicht mehr so selbstverständlich, denn nicht jede dichtungskundliche Überlegung kann oder muß zu einer Richtlinie auch für andere Autoren ausgestaltet werden. Nicht unüblich hingegen ist es, daß sich kleinere und größere poetologische Arbeiten zu einem Schwerpunkt im Œuvre aufsummieren, der für die Zeitgenossen attraktiv ist und die Stellung des Dichters im literarischen Feld begünstigt. Nimmt man nur die Lyriker der Nachkriegszeit in den Blick, so haben von Gottfried Benn über Peter Rühmkorf und Karl Krolow bis hin zu Hans Magnus Enzensberger und Robert Gernhardt nicht wenige Autoren ihre Selbstreflexion mit Konsequenz und Nachhaltigkeit betrieben und dabei ihre Zeitgenossen in den Blick genommen. Gottfried Benn („Probleme der Lyrik“) und Paul Celan („Der Meridian“) haben der Dichtungs- als Autorentheorie bedeutende Impulse gegeben; Peter Rühmkorf hat früh den Begriff des „Volksvermögens“ (1967) geprägt und ihn argumentativ ebenso wie in seinem „virtuosen literarischen Spielertum“ eingesetzt;27 Karl Krolow hat eine fulminante „Phänomenologie des deutschen Gedichts im 20. Jahrhundert“ (1980) vorgelegt, in der er die wichtigsten Leitlinien der Lyrik nach 1945 aufzeigt und benennt: Restauration, Überwindung der Tradition und der Naturlyrik, Auffächerung surrealistischer Ansätze, Formen des spielerischen und experimentellen, des politischen und des ,gewöhnlichen‘ Gedichts usw.; schön zu sehen ist auch, wie Krolow darin über sich selbst spricht, im distanzierten Gestus der dritten Person, so als könne er ein objektives Bild „von Krolows eigener Positions-Entwicklung“ vermitteln.28 Marie Luise Kaschnitz schließlich, von Krolow als „eigentliche Überwinderin“ einer Phase hochartifizieller Restauration und „literarisch-konventioneller Anfänge“ namhaft gemacht, meldet sich ebenfalls prominent mit Beiträgen zu Wort, die Büchnerpreisrede auf Paul Celan beispielsweise stammt aus ihrer Feder.29 In der DDR bekommen die im Rahmen der Werkausgabe gesammelten Essays Johannes R. Bechers einen literaturpolitischen Akzent, versuchen Peter Hacks und Rainer Kirsch, die „bescheidenere“30 Gattung durch Dichtungsreflexion vor „schematischer‘ Vereinnahmung durch die Machthaber und einer kulturpolitisch verordneten „progressiven‘ Ästhetik zu schützen.
Oft geht es den poetologischen Positionsbestimmungen darum, im Rückgriff auf das eigene Werk die Defizite in der poetischen Praxis der Zeitgenossen anzusprechen. Benns Bemerkung, vieles sei „nur Sesselgemurmel, nichtswürdiges Vorwölben privater Reizzustände“, kann zumindest so verstanden werden.31 Den Klagegesängen über den Zustand des Gedichts entspricht die allgemeine „lyrische Bedürfnislosigkeit“; an ihr, so Erich Kästner, trage keineswegs „das Publikum“ die Hauptschuld:
Schuld daran sind vor allem die Lyriker selber! Ihre Gedichte sind, wenn man von wenigen Autoren absieht, in keiner Weise verwendbar: der Fall ist nicht selten, daß sie nicht einmal verständlich sind.32
Die Klagen sind folglich so neu nicht, sondern notorisch, und deshalb ist zwischen der „Strukturschwäche“ der Lyrik und ihrer Erfolglosigkeit beim Leser einerseits und der forciert betriebenen Autorentheorie in der Moderne und speziell der Nachkriegszeit andererseits ein Zusammenhang zu unterstellen: Es geht offenbar um den Versuch, der „Lyrik im luftleeren Raum“33 zu Bodenhaftung und zu mehr Respekt und Resonanz zu verhelfen. Und da das Gedicht keine Lobby hat – dem „Kartell lyrischer Autoren“ um Richard Dehmel und Arno Holz, das zwischen seiner Gründung 1902 und seiner Auflösung 1933 versuchte, den eigenen Markt- und Stellenwert in der Gesellschaft zu verbessern, war eine Renaissance nicht vergönnt –, sind andere Instrumente der Krisenbewältigung vonnöten: Hans Bender entwickelt zwischen 1954 und 1980 seine Zeitschrift Akzente zu einem Forum aktueller Lyrik-Debatten, die der „instinktiven Abwehr“ (Gernhardt) der Gattung auf den Grund gehen;34 Walter Höllerer versammelt und ediert 1965 poetologische Texte der Moderne; Hans Magnus Enzensberger schließlich demonstriert mit seiner Anthologie Das Wasserzeichen der Poesie (1985, unter Pseudonym), wie man den „zähen, stummen, entschlossenen Widerstand“ des Lesers brechen und die „Lust, Gedichte zu lesen“,35 erneut wecken kann: „ein Buch, das, wenn nicht den Leser selbst, so doch die Art seines Lesens auf spielerische Art verändern wird“, urteilte die Kritik.36
war die Zeit unschuldigen Heckens vorbei, mußte ich
mich der Poesie erklären37
Als der hier zu erörternde Autor 1990 die erste Zwischenbilanz seiner Bemühungen um die Gattung zieht, liegen die großen Lyrik-Debatten der Bundesrepublik schon einige Jahre zurück, doch sind ihre wichtigsten Argumentationslinien, wie nicht zuletzt Gernhardts Thesen belegen, aktuell geblieben. So erinnert die Sicht Gernhardts auf die zeitgenössische Lyrik, die er in der Sammlung Gedanken zum Gedicht (1990) entwickelt, an die 1979 geführte, von Jörg Drews angestoßene Diskussion um „Selbsterfahrung und Neue Subjektivität in der Lyrik“. Der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Drews konstatierte und kritisierte damals „Standard-Posen“ statt poetischer „Individualität“, „Naivität“ statt gedanklicher und sprachlicher „Reflexion“, einen spannungslosen „Parlando-Ton“ statt „Überraschung, Abweichung, Spannung“ im lyrischen Gestus; er beklagte explizit den „Verzicht auf entschiedene sprachliche Stilisierung“ und fehlenden Mut zur formalen Gestaltung: nicht wenige Lyriker hätten sich von einem „emphatischen Kunstanspruch“ abgewandt, und von den „strengen poetischen Verfahren“, seien es „Strophe und Reim“, seien es die Finessen der „Experimentellen Poesie“, könne kaum mehr etwas vernommen werden. Im Fazit: Die Poesie sei nicht nur ohne intellektuelle, sie sei auch ohne „politische Perspektive“.38
Diese Thesen wurden in den Folgenummern der Zeitschrift Akzente heftig attackiert, ließen sich aber nicht bagatellisieren. Der große Peter Wapnewski versuchte in der Wochenzeitung Die Zeit nachzuweisen, daß ein „eigener Ton“ erst „mit Hilfe der Form“ ins Gedicht Einzug halte: Lyrik müsse sich der „handwerklichen Kunst“ bedienen, „die das Gesetz der Gattung ausmacht“.39 Er sprach von Beliebigkeit, indem er Prosa-Formen (einen Handke-Text, eine Reparatur-Rechnung) in die Gestalt des Gedichts überführte und ein Gedicht von Rolf Dieter Brinkmann als Prosa präsentierte.
Stimmen und Kritik, die nicht ohne Widerspruch blieben: Vor allem wehrten sich die betroffenen Lyriker, an deren Texten die Vorwürfe exemplifiziert wurden; andere, wie Christoph Derschau in einem programmatischen Gedicht, hatten zuvor schon den bewußten Verzicht auf jeglichen „Kunstanspruch“40 erklärt – sie riskierten damit die Marginalisierung der Dichtung und des Dichters und provozierten den Laien ebenso wie den Fachmann. Die 1978 geführte und noch im gleichen Jahr im Lyrikkatalog Bundesrepublik dokumentierte Debatte glich einer aktuellen Bestandsaufnahme mit poetischen Texten und poetologischen „Statements“; zugleich demonstrierte sie, daß es auch anders, auch besser geht.
Als konstante Größe in Theorie und Praxis gilt damals Peter Rühmkorf, der „eine Poetik verkündet hat, welcher weltweit ein einziger Dichter zu genügen imstande war: Er selber“,41 und der in den siebziger und achtziger Jahren seine Haltung bekräftigte, der zufolge aus einer „Handvoll Momentaufnahmen“ noch kein Gedicht entstünde.42 Sein Essay „Der Reim und seine Wirkung“ (1980) erblickt ironisch in den „geliebten Massenmedien“ ein letztes Reservat poetischer Praxis: „Tatsächlich durchwest der Reim“, so sein Plädoyer für die „formale Attraktion“ der gebundenen Sprache, „unseren Konsumentenalltag weit ausgiebiger als uns gemeinhin bewußt ist“.43
An diese Entwicklungen und Positionsbestimmungen läßt sich mit Gernhardt nahtlos anknüpfen. In Thesen zum Thema, seinem Referat von 1989, das er ein Jahr später in Gedanken zum Gedicht aufnahm, verweist er darauf, daß „Werbung und Journalismus“ den Fundus „suggestiver Mitteilungsweisen“, darunter Reim, Rhythmus, Vers und Strophe, „hemmungslos ausbeuten“, während die Dichter, die diese Techniken einst erst „entwickelt und unendlich verfeinert“ haben, davon keinen Gebrauch mehr machten.44 In Hans Benders Anthologie Was sind das für Zeiten (1988), einer „ganz auf unsere Zeit und Gegenwart konzentrierte[n] Gedicht-Auswahl“,45 erblickt er „viel mürrisches Parlando“, dessen „ästhetischer, sentimentaler oder gar intellektueller Ertrag naturgemäß gering“ sei.46 Er vermißt, ähnlich wie zehn Jahre zuvor Drews, „jede Form von Gedankenlyrik“:
Auch jede Art erzählender Lyrik. Jede Tendenzlyrik. Schließlich jedwedes dezidiert komische Gedicht.47
Oja! Ich bin ein großer Freund deutschsprachiger Lyrik-Anthologien!48
In diesem Zusammenhang fällt auf, wie viel Beachtung Gernhardt Anthologien geschenkt hat. Er konsultierte und rezensierte sie, stellte sie immer wieder vergleichend gegeneinander, litt an ihnen und wurde Mitherausgeber des Jahrbuchs der Lyrik. Schließlich initiierte er selbst Hell und schnell – das Kompendium von „555 komische[n] Gedichten aus 5 Jahrhunderten“, und lud einen Jüngeren dazu ein, sein Mitherausgeber zu werden.
Gernhardt wertet die ,literarische Großgattung‘ der Anthologie als das zentrale Medium zum „Aufspüren“ literarischer „Entwicklungslinien und Zeitgenossenschaften“.49 So kontrastiert er 1990 die von Kurt Pinthus herausgegebene Menschheitsdämmerung (1919) mit dem Luchterhand Jahrbuch der Lyrik 1988/89.50 In seiner sechzehn Jahre später gehaltenen Düsseldorfer Poetik-Vorlesung exemplifiziert er den lyrischen „Modernisierungsschub“51 in der Lyrik der 1950er Jahre durch einen Vergleich von Gunter Grolls Anthologie De Profundis (1946) mit Walter Höllerers Transit (1956). An Transit demonstriert Gernhardt zugleich, daß die Anthologie als Kanonisierungsinstanz für die Rezeption jedes Dichters praktisch unverzichtbar ist, und – damit einhergehend – sowohl zur Inthronisierung von Dichtern instrumentalisiert werden kann als auch zur Überprüfung, ob ein solches Unternehmen geglückt ist.52 Anläßlich seiner vergleichenden Besprechung von neun Anthologien 2001 habe sich, so Gernhardt, sein „Problembewußtsein“53 für dieses Instrument geschärft. Zusätzlich dürfte ihm seine Mitarbeit an der Frankfurter Anthologie Einblick in das Geschäft blütenlesender Kanonisierung vermittelt haben.
Daß entgegen manchem Vorurteil Anthologien als Aufbewahrungsort des Abgelegenen dienen können, zeigt sich in der hohen Zahl der Anregungen, die Gernhardt der schon erwähnten Anthologie, Gunter Grolls De Profundis, verdankt. Diese gehörte zwar zu den ersten Veröffentlichungen aus den „Lagerbeständen“54 der Inneren Emigration, doch ist sie lange schon vom Buchmarkt verschwunden und durch den moderneren Höllerer, den umfassenderen Conrady, den aktualisierten Echtermeyer, den vertieften und erweiterten Reiners-Brunnen usw. auch dauerhaft verdrängt worden. Grolls nicht unumstrittenes Programm war es, ein repräsentatives Bild des ,inneren‘ Reichs als des „anderen Deutschlands“ zu zeichnen und dabei „ausschließlich Gedichte von Autoren“ zu bringen, die „während der letzten zwölf Jahre in Deutschland“ gelebt hatten.55
In einem Text aus dem Nachlaß56 (vermutlich 2005 entstanden) analysiert Gernhardt das Gedicht „Ahnung“, das die existentielle Gefährdung eines politischen Gefangenen thematisiert.57 Für dessen Autor Günther Weisenborn (1902–1969) spricht seine „achtungsgebietende Vita“ (Gernhardt). Der Dramatiker und Erzähler ist „vereinzelt“ auch mit Lyrik hervorgetreten, doch gibt es abgesehen von einem Schullesebuch überhaupt nur drei Nachkriegsanthologien, die davon etwas berücksichtigt haben.58 Gernhardts Herangehensweise an Autor und Gedicht ist exemplarisch: Er kann sich für Weisenborn selbst, nicht aber für dessen ,Zeitdichtung‘ erwärmen. Er bemängelt die schwach ausgeprägte Textökonomie und Stringenz, den fehlenden „zeitlichen Zusammenhang“, die rätselhafte Ereignisfolge und ihre verrätselten Bilder, schließlich den progredienten Verlust an Stimmigkeit.59 Gernhardt erkennt ausdrücklich die Not an, in der Weisenborn sein Gedicht verfaßte, doch das entbindet in seinen Augen nicht davon, auf das Werk auch Kriterien der Stimmigkeit, des ,Gutgemacht-Seins‘ anzuwenden.
Bereits für die Essener Vorlesung (2002) zeigte Gernhardt am Beispiel eines Gedichts der damals wie heute fast unbekannten Dichterin Dorothea Taeger (1892–19??) die komplementäre Konstellation. Es ist wie „Weisenborns Ahnung“ ebenfalls in De Profundis erschienen. Taegers Sonett „Der deutschen Dichtung“ weist Gernhardt gerade keine handwerklichen Fehler nach, sondern im Gegenteil die Tendenz, über „strenge Form und hohen Ton“ jeder Auseinandersetzung mit eigener „Erfahrung, Verstrickung oder Verschuldung“60 auszuweichen. Zur formalen Stimmigkeit der Ausführung muß demzufolge die inhaltliche Angemessenheit hinzutreten, die zum Beispiel in einer Verarbeitung des Erlebten und Erlittenen bestehen kann. Nur aus dem Zusammenspiel beider ergibt sich die Dignität des Gedichts – ein Ansatz, der nicht unbedingt ausgefallen wirkt. Originell und innovativ ist aber die Erkenntnislust und Argumentationsfreude, mit der Gernhardt seinen Ansatz verfolgt. Immer bleibt er konkret am einzelnen Gedicht, akzeptiert erst einmal jeden Weg, jede ,Spielregel‘, die ein Dichter vorgibt, stets aber ist er auch wachsam und empfindsam wie ein Seismograph, wenn dieser unter seinen Möglichkeiten bleibt oder das „Gesetz, nach dem er angetreten“,61 bricht.
Denn mit kleinen Verbesserungen allein wird es kaum getan sein62
Das schlagendste Beweismittel ist nämlich immer das Gedicht. Hier hat auch – wie gezeigt – das kritikwürdige Gedicht seinen Ort, sogar das selbst verfaßte – denn hin und wieder hat Gernhardt auch eigene Gedichte ,verbessert‘. Evident erscheint uns, daß er einen ästhetischen Zweck damit verfolgt, dergestalt, daß er sein Publikum für Ordnungsmuster des Gedichts sensibilisieren möchte, indem er zu demonstrieren sucht, daß sich gerade eine per definitionem ,persönliche‘ und ,sensible‘ Gattung wie die Lyrik der Qualitätskontrolle unterziehen muß. Die gemeinsamen Auftritte mit Matthias Politycki etwa geben uns einen Eindruck davon, wie lustvoll diese erfolgen kann. Darüber hinaus legt der „Literaturdidaktiker“63 dar, wie unverzichtbar literarische Bildung insgesamt und wie wertvoll speziell der Fundus lyrischer Sprechweisen ist. Entsprechend scharf verurteilt er die als Fehlentwicklungen apostrophierten Erscheinungen, darunter den Mangel an und den allmählichen Verlust von formalen und literarhistorischen Kenntnissen aller Art – beim schreibenden Dichter ebenso wie beim lesenden Publikum.
Der Lyrikkritiker scheut sich nicht, auch bei prominenteren und gewichtigeren Stimmen die Probe aufs Exempel zu machen. So analysiert er „Die gestundete Zeit“, ein anthologisch gut belegtes64 Bachmann-Gedicht, und kommt zu dem Befund mangelnder Konsequenz im poetischen Verfahren: Der Einstieg sei „ungewohnt deutlich, sogar zeitbezogen“, doch schon bald werde das Gedicht dunkel und zunehmend unplausibel, wenn es da etwa heißt: „Wirf die Fische ins Meer“ („Im Ernst? […] Ist der Befehl nicht reichlich unüberlegt, lyrisches Ich?“).65 Schließlich nehme Bachmanns Text im Widerspruch zu seiner Programmatik eine „angestrengte Poetisierung“ vor. Darüber hinaus kontextualisiert Gernhardt das Gedicht mentalitätsgeschichtlich ebenso wie literarhistorisch.
Mit der Forderung nach dem Realitätsbezug nähert sich Gernhardt dem Dichter-Theoretiker Peter Rühmkorf wieder an, der 1962 seiner unmittelbaren, „akuten Gegenwart“ eine „kopflose Zeit- und Wirklichkeitsflucht“ bescheinigt hatte, die unweigerlich ins „stumpfsinnigste Klischee“ führen müsse. Einen ,Beleg‘ dafür, Ingeborg Bachmanns Rede „vom ionischen Salz“, filterte Rühmkorf dabei aus ihrem Gedicht „Das erstgeborene Land“ heraus.66 Er bescheinigte den Dichtern im allgemeinen (und damit auch der Dichterin im besonderen) ein „seltsam verqueres, gespanntes und dennoch leidenschaftliches Verhältnis zu Welt und Wirklichkeit“.67 Rühmkorf ließ damit ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zu ihrem Werk erkennen wie der „Theoretiker und Zergliederungsmeister“68 Hans Egon Holthusen. Dieser hatte sich von Bachmann beeindruckt, wenn auch nicht restlos begeistert gezeigt und im Titelgedicht ihres Bandes Die gestundete Zeit das „geschichtliche Lagebewußtsein“ einer zur „Mündigkeit“ herangereiften Jugend vermutet,69 während Hilde Spiel das Poem als „existentielles Gleichnis“ las und die „Vielfalt“ seiner „möglichen Assoziationen“ feierte.70 So repräsentiert Hilde Spiel im Spannungsfeld verschiedener Parteinahmen die emphatische Fürsprecherin, die den Reichtum an „Bildern, Gedanken, Gefühlen“ würdigt, während Holthusen den kritischen Begleiter verkörpert, der angesichts der „Sinnfülle“ der Gedichte von „freudiger Genugtuung“ erfüllt ist.71
Demgegenüber diagnostizieren Rühmkorf wie Gernhardt assoziative Beliebigkeit und überflüssige Metaphern, und dabei ist es natürlich ein Unterschied, ob man Bachmann zu Beginn ihrer Autorschaft kritisiert oder mehr als vierzig Jahre später, als ihr Ruhm sämtliche anderen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts weit überstrahlt. Gernhardt geht damit ein Risiko ein, ein höheres als Rühmkorf, aber er kann dies mit Sicherheit (und Selbstsicherheit) tun, weil er sich als Anwalt der Dichtung und des Gedichts versteht und nicht vorrangig als Kritiker. Jenseits des literaturpolitischen Arguments zielen Gernhardts Lesarten stärker vielleicht als die Rühmkorfs auf die innere Konsistenz des Gedichts und lehnen weniger Sprechweisen a priori ab. Seine Poetik ist zudem ,volksnäher‘ und besticht durch ihre absolute Vorurteilsfreiheit, die überall Perlen zu fischen hofft, wo Dichter dichten.
Gleichwohl hat Gernhardt der Literaturkritik einen hohen Stellenwert zugemessen – und zwar ebenso dort, wo sie erfolgte, wie dort, wo sie ausblieb. Sein Gedichtband Wörtersee (1981) blieb, von einer Ausnahme abgesehen, bei der Kritik ohne Resonanz, was seine Kritik der Kritik provozierte;72 sein Gedichtband Im Glück und anderswo (2002) hingegen wurde häufig rezensiert und forderte dennoch seinen Widerspruch73 heraus: Wo die Tugend des genauen Blicks nicht geübt wird, ist der Dichter selbst gefordert – und dem kommt er lehrreich, sorgfältig und umsichtig nach, wie nicht zuletzt seine akribischen Anmerkungen in den Gedichtsammlungen belegen.
In seiner Serie „Fragen zum Gedicht“ für Die Zeit entwickelt Gernhardt schließlich mit dem „Lyrikwart“ den neuen Typus Rollenprosa weiter, den er in „Darf man Dichter verbessern?“ (1990) begründet hatte: Eine Kunstrichter-Analytik, die sich strikt argumentativ mit Problemen tradierter und moderner Dichtung und Dichter befaßt. Darin wird gefordert, daß Poesie nicht nur zeitgerecht sei und das Niemandsland der Allerweltsbezüge meide, sondern auch im Detail den Ansprüchen der Überprüfbarkeit und Exaktheit genüge. Folglich muß der Kunstrichter mit gutem Beispiel vorangehen: Seine Kritik darf nicht zur Leerformel, zu Fehllektüren, zur kritiklosen Akklamation tendieren. Das besondere an der Rolle des „Lyrikwarts“ ist, daß dieser der Forderung nachkommt, die seit Urzeiten jedem Kritiker entgegengeschleudert wird:
Machs doch besser!
Ja, der Lyrikwart scheut weder große Namen noch ehrwürdiges Alter. Seine Vorstöße, von Platen bis Grünbein Dichter verbessern zu können, mögen respektlos sein, auf jeden Fall sind sie höchst unterhaltsam. Und sie bringen die Gedichte auf die Erde, sie geben sie dem Leser zurück, denn bei aller Hochachtung, die Gernhardt vor Gedichten empfindet, er besteht immer darauf, daß sie Menschenwerk sind.74
Mochte seine Bezugnahme auf De Profundis noch überraschen, so erweist sich Gernhardts Kritik der ungleich wirkungsmächtigeren Anthologie Transit als geradezu folgerichtig. Dort nämlich, so sein zentraler Vorwurf, werde die Klassische Moderne als „Steigbügelhalter“ für eine ,zweite Moderne‘ reklamiert – ein Vorgang, den ihr Kritiker nüchtern als „Form der Legitimationserschleichung“ qualifiziert.75 Die implizite wie explizite Modernitätsbehauptung, die der Band typographisch, argumentativ und durch sein Ordnungssystem vollführt, wird als „lupenreine Literaturpolitik“ gebrandmarkt, mittels derer sich eine Gruppe ,Neugesalbter‘ literarisch ,inthronisiert‘ habe.76 Die „Rechtmäßigkeit“ des Unterfangens wird von Gernhardt klar in Abrede gestellt, ihr Erfolg bei der Nachwelt ebenso.77 In Höllerers fast vorbehaltlose Feier der Moderne kann er ohnehin nicht einstimmen, und die „vornehmste Aufgabe des modernen Dichters“, das Gedicht „von tradierten Inhalten ebenso wie von überkommenen Regeln“ zu befreien, kann er keinesfalls gutheißen.78
Gesang vom Gedicht79
Wollte man dafür plädieren, einer Autorentheorie alle literarischen und nicht-literarischen Texte zuzurechnen, die sich als implizite oder explizite Poetik lesen lassen, gleichviel, welcher Gattung sie angehören, fällt bei Gernhardt die große Zahl der explizit poetologischen Gedichte auf. Mehr noch: Poetologische Dichtung zieht sich durch das gesamte lyrische Werk, angefangen bei Die Wahrheit über Arnold Hau und damit gut zwei Jahrzehnte früher als der Beginn seiner poetologische Essayistik („Thesen zum Thema“).80 Unter motivischen Aspekten ist damit die „Gattung“ des poetologischen Gedichts eine der wenigen, die sich in jedem einzelnen von Gernhardts Gedichtbänden findet (ein anderes Beispiel wäre das Tiergedicht). Entsprechend der Entwicklung seines lyrischen Gesamtwerks, haben seine frühen poetologischen Gedichte überwiegend eine heitere Grundstimmung; andererseits besitzt das Gedicht „Frage“ („Kann man nach zwei verlorenen Kriegen…“) im Vergleich zu seinen anderen frühesten Gedichten einen sehr ernsten Hintergrund, nämlich die metaliterarische Debatte, die seit Adornos Verbotsästhetik („Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch“)81 um die Funktion und Zulässigkeit dichterischen Sprechens angesichts der Verbrechen des Hitler-Regimes und der poetischen und moralischen Depravation des Gedichts in der Nazizeit tobte.82
Letztlich findet jedes Charakteristikum von Gernhardts essayistischer Dichtungskunde eine Entsprechung in einem poetologischen Gedicht. Glanz und Elend des Reims thematisiert „Anno 24“ (Besternte Ernte). Die Lust an der Präzision wird etwa in Sprechen und Schweigen, dem letzten Gedicht in Wörtersee gefeiert. Freude am Gelingen drückt „Warum das alles?“ (Körper in Cafés) aus. Die dichterische Verarbeitung des Leids und die lindernde Wirkung auf den Leser analysiert Gernhardt in „Arme Dichterin“83 (in Weiche Ziele) – also bevor sein eigenes Leiden in Herz in Not und Die K-Gedichte zentral wird, und auch deutlich vor seinen essayistischen Erforschungen des Themas.84 Das Lob der Textökonomie singt und exemplifiziert das Gedichtpaar „Lied des Mädchens“ und „Lied des Mädchens in der Kurzfassung für den eiligen Gedichtleser“ (in Lichte Gedichte). Und auch die profan-ökonomischen Rahmenbedingungen der Lyrik, die Gernhardt in seiner Essayistik nicht ausklammert,85 bedichtet er in „XV Heimkehr“ (in Klappaltar).86 Mit dem „Couplet vom Hauptstadtroman“ (in Berliner Zehner) demonstriert Gernhardt die Reaktionsfähigkeit des Gedichts auf kurrente Sprache und aktuelle Debatten im Wettstreit mit anderen Gattungen. Das Dichten als Selbsterkenntnis schildert das sehr persönliche Gedicht „Stimmen im Kopf. 1. Juni“ (in Im Glück und anderswo).87 Im „Sonett von der Geburt eines Kritikers“ (in Die K-Gedichte) wird die ständig dräuende Kränkung des Dichters durch den Kritiker deutlich sowie die Möglichkeit, auf Kritik zu reagieren. Das Dichten in seiner Qualität als Prozeß und dessen Rekonstruktion mit Hilfe der Aufzeichnungen des Dichters – ein Verfahren, das Gernhardt selbst für „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ unternahm –,88 stellt er selbstironisch-uneigentlich gebrochen in „Genial“ (Später Spagat) dar. Überhaupt ist in Rechnung zu stellen, daß Gernhardts Gedichte in sehr vielen Fällen eine ironische Lesart zulassen. Stärker noch als in seiner Essayistik spielt er mit der Erwartungshaltung des Lesers und dessen mitgedachtem Widerspruch.
als ob nicht wenigstens ein Steg trage von der Produktion zur Reflexion und umgekehrt89
Besonders aufschlußreich für die Gernhardt-Philologie sind jene Ausführungen, in denen der Autor eigene Gedichte zitiert und analysiert. Bedeutsam sind diese Ausführungen nicht zuletzt deshalb, weil sie – über den Erweis seiner Fertigkeiten hinaus – eine individuelle Handschrift und ein persönliches Programm erkennen lassen: es geht darum, die Rolle der existentiell involvierten Person mit der Funktion des Poeta doctus aufs engste zu korrelieren. Immer öfter und immer gezielter greift er dabei auf selbst erprobte Techniken und Verfahrensweisen zurück; einiges davon ist publiziert, vieles noch zu entdecken, da Gernhardt die Gelegenheit, sich und sein Tun zu erklären, auch in Briefen gern genutzt hat. Selbst von seinen Lesungen und Vorlesungen dürfte so manches dokumentiert sein, was seine Deutungskunst belegt oder uns einen Begriff von der Spontaneität und Virtuosität des Dichters vermittelt. Ein Beispiel aus der vierten Frankfurter Poetikvorlesung mag diesen Eindruck belegen, denn einen Zwischenapplaus beantwortet Gernhardt, Brecht und Jesus paraphrasierend, wie folgt:
Ja, auch das sei bedankt. Ich habe Ihnen den Beifall nicht abverlangt, aber wenn er dann kommt, dann lasset ihn zu mir kommen.90
Wer Gernhardts Dichtungskunde als lustvoll, engagiert und existentiell klassifiziert, sollte im gleichen Atemzuge ihre gedankliche und begriffliche Schärfe ansprechen: Präzision verbindet sich hier mit einem gelösten Duktus, wie man ihn sonst vielleicht in einer Rhetorik alter Schule vermuten möchte. Umsichtig wandert der Dichter und Essayist durch das Haus der Poesie, einem jeden Raume Bedeutung zuweisend, seiner Funktion entsprechend. Plausibilität und Stimmigkeit sind dabei Maßgabe auch der Theorie – sie darf nicht anders beschaffen sein als das gute Gedicht:
Gut gefühlt
Gut gefügt
Gut gedacht
Gut gemacht
Die genuin literarische Qualität seiner Poetik erwächst genau aus diesem Anspruch.
Gernhardts Feldforschungen dienten nicht zuletzt der eigenen Kanonisierung. Die Beschäftigung mit Klassikern und Weggefährten, mit klassischen und modernen Formen, mit historischen und zeitgenössischen Stoffen erst erschafft das Bezugsfeld, in dem der Autor verortet werden möchte. Spätestens mit Erscheinen seines Gedichtbandes Körper in Cafés (1987) nahm ihn das Feuilleton als Lyriker wahr, wodurch er freilich auch neue Spielarten der Kritik erfuhr. Denn einige Stimmen, die sein Werk ausschließlich unter Komik verbucht hatten, sahen ihn plötzlich in die Domäne ,ernsthafter Lyrik‘ einbrechen und schienen dies bedauern zu müssen. Insgesamt aber hat hier eine zwar verspätete, jedoch machtvolle Rezeption eingesetzt, die auch von seiner dichtungskundlichen Begabung profitierte: Gernhardt erwies sich als hervorragender Vermittler seiner Profession. Bezogen auf das eigene Werk war er sogar dem literaturwissenschaftlichen wie auch dem literaturkritischen Zugriff oft eine Nasenlänge voraus: immer noch beschränken sich manche Gernhardt-Philologen auf das Nachbeten seiner Theorien, noch sind unabhängige, originäre Positionsbestimmungen wie die Gustav Seibts selten.
Hab der Welt ein Buch geschrieben91
Die Verbesserung von Gedichten ist ein zentrales Anliegen seiner poetologischen Grenzgänge zwischen Literatur und Kritik. Ob Gernhardt dabei mit der Einsicht der Dichtenden gerechnet hat? Die toten konnte er ohnehin nicht erreichen, aber auch die lebenden erwiesen sich nicht immer als belehrbar. Der quicklebendige Poet Günter Kunert jedenfalls ließ sein „Bomarzo“-Gedicht in der Auswahl So und nicht anders (2002) unverändert erneut erscheinen, obgleich Gernhardt ihm sachliche Fehler nachgewiesen hatte.92
Für diese weitgehende Resonanzlosigkeit seiner Bemühung um das gute, das bessere, das verbesserte Gedicht mag es viele Gründe geben, auch ganz prosaische. Denn als Gernhardt seine erste Zwischensumme poetologischer Arbeiten 1990 zu der Auslese Gedanken zum Gedicht versammelt, läßt sein Zürcher Verlag sie prominent und doch verlegerisch halbherzig als ,Haffmans Taschenbuch 100‘ erscheinen: Offenbar hat man im Verlag dieser Textsammlung, die dem Hauptprogramm gut anstünde, keinen größeren Widerhall zugetraut. Zwar berief sich Peter Rühmkorf ausdrücklich auf Gernhardts Begriff der (Lyrik-)„Hämmer“93 und teilte auch den Befund, daß es von diesen in der zeitgenössischen Lyrik zu wenig gäbe. Eine grundlegende Diskussion der Gernhardtschen Thesen zum Thema ist aber ausgeblieben, was schade ist, denn sie sind suggestiv gearbeitet und bieten Zündstoff für eine grundsätzliche Verständigung über das Gedicht und speziell über das Lyrikverständnis des Dichters. So mündet sein erster Argumentationsstrang in die These, das Gedicht sei „kurz, also rasch zu rezipieren“. Jedenfalls ist es schneller gelesen. Doch ist es deshalb rasch zu rezipieren? Ist es nicht gerade das Kennzeichen von Lyrik, daß sie die intensive und kreative Lektüre und Relektüre erfordert? Ist es nicht gerade seiner Dichte und formalen Gestalt geschuldet, daß wir – im Verhältnis – dem Gedicht mehr Zeit widmen müssen als der Prosa? Es gibt eben verschiedene Arten, Gedichte zu ,rezipieren‘: diejenige, die ,hell und schnell‘ das Wesentliche erfaßt, und diejenige, die nach allen Regeln der Interpretationskunst vorgeht, die umsichtig, für andere nachvollziehbar den Gehalt des Gesagten und nicht Gesagten, der formalen wie inhaltlichen Aspekte aufbereitet, eine Analyse, die der Komplexität des Gedichts angemessen ist.
Das zeigt: So prononciert und verführerisch Gernhardts Thesen sind, so diskutierenswert sind sie auch, zumal uns seine eigenen Gedichte, die leichtfüßig-nonsenshaft konventionellen ebenso wie die raffiniert gebauten, gewaltige Kopfnüsse aufgeben können. So bedarf es, wie Kurt Flasch demonstrierte, keines geringen intellektuellen Formats, das Gedicht vom Schnabeltier auszulegen, und eines hohen persönlichen Einsatzes, es auf den Punkt zu bringen.94
Gernhardts Thesen zum Thema zielen darauf, Lyrik zur herausragenden „Mitteilungsform“ zu bestimmen, die in der Vergangenheit hoch geschätzt gewesen sei, in der Gegenwart aber an Bedeutung verloren habe. Dieser Bedeutungsverlust, so seine These, ergebe sich aus formalen wie inhaltlichen Aspekten zeitgenössischer Lyrik. Die Lyriker treffe eine Mitschuld:
Allzu häufig nämlich stellt sich heraus, daß der viele weiße Raum nicht dazu dient, sprachlicher, emotionaler oder intellektueller Essenz den gebührenden Platz und Rahmen zu geben, sondern daß er als auratisierendes Passepartout mißbraucht wird, um ziemlich privaten Kurzmitteilungen von erheblicher Nichtigkeit größtmöglichen Respekt zu erschleichen.95
Eine Diskussion dieser These hätte am Literaturbegriff ansetzen können. Wenn gelten soll, daß alle Privatheit durch Literarisierung transzendiert wird, dann – so könnte eine Gegenthese lauten – spielt die Nichtigkeit oder Erhabenheit der „Kurzmitteilung“ keine Rolle, denn das Gedicht, zu dem sie wurde, enthebe sie der Nichtigkeit, und zwar unabhängig davon, wie hoch der persönliche, sprachliche, emotionale oder intellektuelle Einsatz des Autors war – denn es dürfte einige nichtige Anlässe geben, die in großen Gedichten verhandelt werden. Als Beispiel könnten etliche Gedichte genannt werden, die Gernhardt selbst Jahre später in „Schläft ein Lied in allen Dingen?“96 für eine erfolgreiche Poetisierung des Alltags genannt hat.
Schon dies zeigt, daß eine solche Diskussion nicht in einer Widerlegung einer von zwei sich ausschließenden Positionen münden müßte, daß vielmehr eine Klärung hätte erfolgen können, wie viel Nichtigkeit des Anlasses ein großes Gedicht verträgt, ob ein besonderer Kunstverstand nötig ist, um gerade das Nichtige zu erhöhen, oder unter welchen Voraussetzungen auch umgekehrt der Nichtigkeit des Anlasses mit einfachen Mitteln begegnet werden kann, ohne in Beliebigkeit zu enden. Wir sind überzeugt, daß Gernhardt auf diese Fragen höchst kompetente und unterhaltsame Antworten gefunden hätte, und mitunter hat er die recht harschen Thesen aus Gedanken zum Gedicht in seinen späteren Äußerungen auch selbst – und ohne öffentliche Diskussion – relativiert.97
Gernhardts Gedanken wären also zu diskutieren – und es macht geradezu ihren Reiz aus, daß sie streitbar Gegenposition zu den geläufigen Überzeugungen bezogen haben. Man muß ihnen dabei keineswegs bedingungslos folgen, um den heuristischen Wert der Argumente zu erkennen. Seine Autorentheorie ,siedelt‘ nicht von ungefähr im „noch wenig kartographierte[n], schwer feststellbare[n] Grenzterrain, in welchem selbst Theorie und Praxis nicht mehr sauber voneinander geschieden werden können“,98 und ist demgemäß durch eine doppelte Fokussierung charakterisiert: Sie ist zunächst einmal auf das eigene Schaffen bezogen, bedarf aber auch der Parameter jenseits des Eigenen: Wie machen es die anderen? Was ist ihnen gelungen, was nicht? Was kann man ihnen abschauen, was muß man ihnen vorhalten?
Begriff sich Gernhardt lange als Lernender, so versteht er sich zum Schluß auch als Lehrender, denn seine Poetikvorlesungen folgen dem Impuls, die kaum oder zu wenig geführte Debatte über den Wert und Unwert lyrischen Sprechens für unsere literarische Kultur in die Öffentlichkeit zu tragen und aus der Perspektive des handwerklich versierten Poeta doctus zu diskutieren. Seine Vorträge bestechen durch ihre gelungene Mischung aus Freundlichkeit und Verbindlichkeit, Helligkeit und Schnelligkeit – und Schärfe und Polemik. Als Polemik lesbar, enthält seine Apodiktik vor allem Thesen und weniger „Rechtfertigungen“.99 Von der ersten Textsammlung, den Gedanken zum Gedicht (1990) angefangen, bis hin zu den Poetikvorlesungen spricht ein starkes, ungebrochenes Sendungsbewußtsein aus seiner Autorentheorie und entspricht im Kern einer Produktionsästhetik. Im Unterschied zu Rühmkorf jedoch, der als Poetologe über die Zeitläufte hinweg pamphletistisch-scharf auf die Dichter zielte, entwickelte Gernhardt eine eher ausgleichende Dichtungskritik. In Gedanken zum Gedicht dominiert noch Gernhardts Abgrenzung vom etablierten zeitgenössischen Lyrik-Betrieb. Seine damalige Intention ist, sich von den gängigen Sprechweisen zu scheiden, zu erklären, warum er diesen Weg nicht geht. In seinen späteren Texten, insbesondere den Poetikvorlesungen, nimmt er stärker auf seine eigene Lyrik Bezug, sieht in ihr einen Weg – keinesfalls den einzigen, aber doch einen gangbaren Ausweg – aus der Aporie, die er 1990 schilderte. Weggenossen, zeitgenössische Autoren also wie Rühmkorf oder Enzensberger werden hier deutlicher sichtbar, auch klarer als Vorbilder benannt, Gernhardt siebt also stärker unter den Gegenwartsdichtern. Vor allem aber rückt Gernhardt mehr in den Vordergrund, den Hörer und Leser daran teilhaben zu lassen, wie Gedichte entstehen – wie Gernhardt selbst ein Gedicht macht.
Wenn ihr poetologischer Impuls nicht immer ohne den polemischen auskommt, so tragen ihm seine Argumente doch auch viel Anerkennung ein: Die Ehrendoktorwürde der Universität Freiburg (Schweiz) gilt ausdrücklich auch dem Poetologen Gernhardt und seiner Dichtungstheorie der Praxis. Die heftigsten Anwürfe erntet Gernhardt ausgerechnet für den Titel seiner Vorlesungen „Was das Gedicht alles kann: Alles“. Seine Gegner übersehen, daß er nicht von seinem Gedicht spricht, sondern von „dem Gedicht“, also dem „Gedicht aller Zeiten, Räume, Sprachen und Dichter“ – wie Robert Gernhardt in einem Brief an einen Kritiker festhält.100 Seine Losung mag hochfahrend sein, hochmütig ist sie nicht. Möge sie sich durchsetzen.
Lutz Hagestedt und Johannes Möller, Nachwort
„In diesem Buch steht alles drin:“101
– Editionsbericht. –
Im Mai 2001 hielt Robert Gernhardt seine vierteilige Poetik-Vorlesung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität zu Frankfurt am Main unter dem Generalthema Was das Gedicht alles kann: Alles. Er entschied sich, seine Vorlesung nicht wie üblich im Rahmen der edition suhrkamp zu veröffentlichen, sondern sie für eine spätere, umfangreichere ,Poetik‘ aufzubewahren. Vermutlich gehen also Gernhardts Überlegungen, seine poetologischen Texte in einen größeren Zusammenhang zu stellen, auf das Jahr 2001 zurück. Schon ein dreiviertel Jahr später, im Februar 2002, realisierte er unter demselben Obertitel an der Universität Essen eine diesmal fünfteilige Poetik-Vorlesung. Seine letzte, ebenfalls fünf Vorträge umfassende Vorlesung schließlich stand im Januar und Februar 2006 an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf unter der Überschrift Leiden, Lieben, Lachen. In einer Liste künftiger Projekte vom 2. Juni 2006 – genau vier Wochen vor seinem Tod – nennt Gernhardt als eine Position:
Poetik – liegt als Vorlesung vor; muß ergänzt werden durch die Suche nach sämtlichen anderen poetologischen Texten, die ich noch so verfaßt habe.
Er wollte den Poetik-Band als drittes Projekt – nach Später Spagat und Denken wir uns – noch selbst in Angriff nehmen, kam aber leider nicht mehr dazu.
Die ,Poetik-Vorlesung‘ ist ein vielgestaltiger Textkorpus: In seinen Essener und Düsseldorfer Vorträgen griff Gernhardt teilweise inhaltlich auf seine schon gehaltenen Vorlesungen zurück und paßte sie den lokalen und aktuellen Gegebenheiten an, teilweise erweiterte er sie inhaltlich erheblich, teilweise konzipierte er sie völlig neu. Das bedeutet im einzelnen: Drei Vorlesungen, nämlich Von nichts kommt nichts, Die mit dem Hammer dichten und Schmerz lass nach, wurden in jeweils drei verschiedenen ,Fassungen‘ gehalten. Von einer Vorlesung, nämlich Ordnung muss sein, liegen zwei Fassungen vor; drei Vorlesungen endlich, nämlich Schläft ein Lied in allen Dingen?, Was bleibt? sowie die in diesem Band Leben im Labor betitelte, wurden jeweils nur einmal vorgetragen – wobei der letztgenannte Vortrag in Düsseldorf unter Ordnung muss sein firmierte, dem Titel also, unter dem in Frankfurt und Essen ein ganz anderer Vortrag gehalten wurde.
Unsere Auswahl für diesen Band haben wir nach folgenden Grundsätzen getroffen:
(1) Wir wollten die Überlegungen, die Gernhardt in seinen Vorlesungen als dem Kernstück seiner Poetik ausgeführt hat, möglichst vollständig versammelt wissen.
(2) Es war unser Ziel, bezogen auf die einzelne Vorlesung, möglichst konsequent einer von mehreren Fassungen zu folgen.
(3) Wir haben versucht, die Lesbarkeit der Vorlesungen als Gesamttext zu wahren, insbesondere Wiederholungen zu vermeiden.
Es liegt auf der Hand, daß diese drei Ziele miteinander konfligieren. Jede ,einfache‘ Lösung verletzt einen der genannten Grundsätze empfindlich: Wären wir ausschließlich den Vorlesungen einer einzigen, zum Beispiel der Frankfurter Reihe gefolgt, hätte dies zwar dem zweiten und dem dritten Grundsatz entsprochen, doch hätte eine Abweichung vom ersten Ideal darin gelegen, daß wir damit auf drei Einzel-Vorlesungen entweder komplett hätten verzichtet müssen, oder doch darauf, sie in den Kontext der Gesamt-Vorlesung zu stellen. Die vollkommene Umsetzung des ersten und zweiten Grundsatzes hätte in der Wiedergabe aller 14 gehaltenen Einzelfassungen gelegen – unter Inkaufnahme größerer Wiederholungen.
Wir haben deshalb den ersten Grundsatz betont und die Lösung gewählt, alle sieben Einzelvorlesungen, die Teil mindestens einer Vorlesungsreihe waren, in eine Gesamtfolge zu stellen. Bei Vorträgen, die in unterschiedlichen Versionen gehalten wurden, geben wir jeweils in der ersten unserer Anmerkungen (ab S. 556) an, welcher Fassung wir folgen. Oft ist das die letzte, am stärksten ergänzte und erweiterte Fassung. Als Ausnahme vom zweiten Grundsatz halten wir es aber für vertretbar, Kürzungen, die Gernhardt offensichtlich nur aus Zeitgründen vornahm – etwa um eine thematische Erweiterung der Vorlesung gegenüber der Vorgängerfassung auszugleichen –, wieder rückgängig zu machen. Dazu sehen wir uns aufgrund der Textlage berechtigt, denn die nur ad hoc herausgekürzten (per Hand durchgestrichenen) Passagen sind Teil der jeweiligen Vorlesungsunterlagen geblieben. Das Gekürzte wieder hereinzunehmen, bedeutet nicht mehr, als die größeren formalen Freiheiten des Buches gegenüber dem Vortrag zu nutzen.
Variiert hat Gernhardt von Reihe zu Reihe auch die Art, die einzelnen Vorlesungen zu betiteln: Standen in Frankfurt die Titel für sich allein, faßte er in Essen jede Vorlesung in einem erläuternden Satz zusammen. In Düsseldorf reduzierte er diese Sätze zu Untertiteln. Die Essener Zusätze und Düsseldorfer Untertitel sowie die Daten, an denen die Vorlesungen gehalten wurden, sind in den Nachweisen (ab S. 581) dokumentiert, während wir die wichtigsten inhaltlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen in den Anmerkungen (ab S. 556) dargelegt haben.
Die geringfügigen Überschneidungen zwischen den hier nacheinander folgenden Vorlesungen Ordnung muss sein und Leben im Labor (die wohlgemerkt in keiner Vorlesungsreihe gemeinsam gehalten wurden) erschienen uns hinnehmbar. Auch sie sind in unseren Anmerkungen dokumentiert.
Die Texte der Vorlesungen liegen jeweils als handschriftlich überarbeitetes Typoskript vor. Außerdem existieren Computerdateien, die den Typoskripten entsprechen. Ausnahmen hiervon weisen wir in der jeweils ersten Anmerkung zur Einzelvorlesung nach, wobei wir den Terminus ,Manuskript‘ für handgeschriebene Aufzeichnungen reservieren. Daneben enthalten die Vorlesungskonvolute Fotokopien, in der Regel von Gedichten, die in den Vortrag einflossen. Nicht immer ließ sich mit letzter Sicherheit klären, ob Gernhardt die Texte im Vortrag gänzlich oder auszugsweise zitierte. Im Zweifel haben wir uns für die vollständige Wiedergabe entschieden. Wenn Gernhardt ein Gedicht zitierte, das in verschiedenen Versionen veröffentlicht vorlag, haben wir in der Regel die Fassung berücksichtigt, die sich aus den Vorlesungsunterlagen ergibt oder diesen in Kopie beiliegt. Bei einigen von Gernhardts Gedichten ergeben sich dabei auch Varianten zu den bislang veröffentlichten Fassungen, die wir in den Anmerkungen dargestellt haben. Bezüglich anderer Gedichte ließ sich die Herkunft der Kopien nicht immer zweifelsfrei bestimmen. Soweit den Unterlagen kein Abdruck des Gedichts beilag, dieses aber in Hell und schnell aufgenommen wurde, haben wir uns für die dort berücksichtigte Fassung entschieden.
Grundsätzlich folgen wir den schriftlichen Vorlesungsunterlagen und geben kein Wortprotokoll der tatsächlich gehaltenen Vorlesung. Gernhardt war auch insoweit ein ausgezeichneter Vortragender, als er sich gegebenenfalls von dem vorformulierten Text zu lösen wußte, sei es, um etwas ganz Aktuelles einfließen zu lassen, sei es, um Reaktionen des Publikums oder auch die Störung durch ein klingelndes Handy schlagfertig zu kommentieren. Seine Vortragskunst kann anhand der im HörVerlag veröffentlichten Live-Mitschnitte studiert werden. Auch die interaktiven Elemente in Gernhardts Vorlesungen („Hausaufgaben“)102 haben in den ausformulierten Unterlagen103 keinen Niederschlag gefunden, folglich bleiben sie in diesem Band unberücksichtigt. In einzelnen Zweifelsfällen haben wir zur Rekonstruktion der Vorlesung auf die Mitschnitte zurückgegriffen und dies in den Anmerkungen entsprechend ausgewiesen.
Gernhardt hat in seinen Vorlesungen mitunter so anlaß- und situationsbezogen argumentiert und zitiert, daß man aus ihnen ersehen kann, wo die Vorträge gehalten worden sind.104 Diese kontextbezogene Sprechweise haben wir so belassen, denn die hier dokumentierten sieben Vorlesungen wurden eben nicht an einem Ort, sondern innerhalb von sechs Jahren an drei verschiedenen Orten gehalten. Wir haben deshalb solche Hinweise auf den situationellen Kontext (etwa Gernhardts Bezugnahme auf eine Passage „meiner letzten Vorlesung“)105 in den Anmerkungen entsprechend erläutert. Entbehrlich erschienen uns lediglich vereinzelte Ausleitungsfloskeln, etwa Hinweise auf Ort und Zeit der kommenden Vorlesung; sie haben wir, selbst wenn sie schriftlich ausformuliert waren, nicht für den Druck übernommen.
Bei der Suche nach „anderen poetologischen Texten“ sind wir von Gernhardts Sprachgebrauch ausgegangen, der auch in den Vorlesungen dokumentiert ist und – in Abweichung von der germanistischen Fachterminologie – ,Poetik‘ auf die Poetik der Lyrik beschränkt. Gernhardts zahlreiche Beiträge zur Poetologie der Satire (unter anderem aus Letzte Ölung) sowie komischer Texte (unter anderem aus Was gibt’s denn da zu lachen?) haben wir daher nicht berücksichtigt. Nicht als Texte zur Poetologie gewertet haben wir die Anmerkungen zu einzelnen Gedichten im Anhang der Gesammelte Gedichte – denn sie erfolgten in Gestalt von Nachweisen und scheinen uns eher eine Kommentierungsfunktion zu haben.
Die oben dargelegten Grundsätze haben wir mutando mutandis auf die Ergänzung der Vorlesungen um andere poetologische Texte angewandt. Dabei erschienen uns einerseits Überschneidungen zwischen den Vorlesungen und den weiteren Texten sowie innerhalb der letztgenannten eher vertretbar als innerhalb der Vorlesungen, die das Zentrum der Poetik bilden. Denn es versteht sich, daß bei einer Sammlung einzelner Texte, die aus den unterschiedlichsten Anlässen in einem Zeitraum von neunzehn Jahren entstanden sind, bestimmte Gedanken oder Aspekte mehrfach auftauchen. Andererseits konnten wir aus schlichten Platzgründen längst nicht jeden poetologischen Text aufnehmen, der uns wichtig erschien, sondern mußten uns auf eine Auswahl beschränken.
Wenn wir uns entschieden haben, die Aufsätze aus Gedanken zum Gedicht nicht zu berücksichtigen, dann zum einen aus dem pragmatischen Argument, daß sie über diese Sammlung schon relativ gut zugänglich sind. Zum anderen griff Gernhardt in unterschiedlichen Zusammenhängen seiner Vorlesungen Überlegungen aus diesen frühen Aufsätzen wieder auf, und zwar gerade solche, die Grundfragen der Lyrik betreffen, etwa ihre Abhängigkeit von der Regel oder ihren sinkenden Einfluß auf das kollektive Sprachbewußtsein. Dabei zitierte Gernhardt an einer Stelle seine damaligen Überlegungen sogar wörtlich und reduzierte sein altes Urteil in der Schärfe. Insoweit sind wir davon ausgegangen, daß Gernhardt seinen Überlegungen in den Vorlesungen die letztverbindliche Gestalt geben wollte. Auch auf andere bedeutsame Texte haben wir verzichtet, wenn ihr Gehalt zu einem Großteil in den Vorlesungen aufgegangen ist. Um diese Entwicklung nachvollziehbar zu halten, haben wir auf die Vorgängerversion(en) teilweise auch mit ihren Unterschieden in den Anmerkungen verwiesen (so zum Beispiel zu „Schläft ein Lied in allen Dingen?“). Was diese vergleichenden Nachweise betrifft, erheben wir keinesfalls den Anspruch auf letzte Vollständigkeit, zumal Gernhardts Autorentheorie ungeachtet seiner Präzisierungen den Begriff des ,poetologischen Textes‘ schillern läßt und eine Fülle von Übergangsformen ermöglicht.
Wir haben bei der Auswahl von Texten und bei der Akzeptanz gewisser Überschneidungen auch berücksichtigt, daß einige Texte in einem seriellen Zusammenhang stehen, der Vollständigkeit wünschenswert erscheinen läßt. Das gilt etwa für die jeweils elf Texte, die Gernhardt in der Frankfurter Anthologie und der Zeit-Serie Fragen zum Gedicht (von Gernhardt selbst oft als „Lyrikwart“ bezeichnet, obwohl dieser Ausdruck nicht in jedem Text der Serie fällt) veröffentlichte. Daß sich in beiden Folgen jeweils ein Text befindet, der auf Peter Hacks’ Gedicht „Rote Sommer“ eingeht, bedingt Wiederholungen, die uns aber wesentlich besser vertretbar erschienen, als eine der genannten Serien nur unvollständig aufzunehmen. Unter demselben Aspekt haben wir die ersten beiden Gedichtinterpretationen Gernhardts, die in der Frankfurter Anthologie erschienen sind, hier berücksichtigt, obwohl sie auch in Gedanken zum Gedicht abgedruckt waren.
Unsere Gliederung des Bandes orientiert sich an den anderen großen theoretischen Sammlungen Gernhardts, also an Was gibt’s denn da zu lachen? und an Der letzte Zeichner. Wir haben in Anlehnung an diese beiden ,großen Theoriebände‘ sowie auch an Gedanken zum Gedicht nur ausnahmsweise Nachweise für die von Gernhardt zitierten Texte erbracht. Diese Leistung wäre nur bei der Ergänzung des Textes um Fußnoten bzw. um einen Stellenkommentar sinnvoll gewesen. Fußnoten aber erschienen uns als zu großer Eingriff in den Text, wie ihn sich Gernhardt höchstwahrscheinlich zur Veröffentlichung vorgestellt hat. Ausnahmen betreffen insbesondere solche Gedichte von Gernhardt, die sonst nicht leicht auffindbar sind, etwa weil sie Gernhardt in der Vorlesung mit einem Untertitel zitiert, der durch den Index der Gesammelte Gedichte 1954–2006 nicht ermittelt werden kann; hier haben wir in den Anmerkungen entsprechende Nachweise erbracht.
Soweit uns für bereits erschienene Texte die entsprechenden Typoskripte und Computerdateien Gernhardts vorlagen, haben wir die Fassungen miteinander verglichen und sind im Zweifelsfall Gernhardts Dokument gefolgt. Größere Varianzen sind im Anmerkungsapparat dokumentiert.
Wir weisen in unseren Anmerkungen, in unserem Nachwort „Scheiden, Sieben, Machen“ sowie in diesem Editionsbericht selbständig erschienene Titel in VERSALIEN, unselbständige in Kapitälchen aus. WAS GIBT’S DENN DA ZU LACHEN? zielt folglich auf den erstmals 1988 erschienenen und zwanzig Jahre später auch als Fischer Taschenbuch vorliegenden Band zur Komik-Kritik. Mit „Was gibt’s denn da zu lachen?“ ist hingegen der unselbständig veröffentlichte Beitrag gemeint, der zuerst in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen ist und auch in diesen Band aufgenommen wurde.
Offenkundige Unrichtigkeiten, wie Ungenauigkeiten beim Zitieren oder falsche Lebensdaten, haben wir stillschweigend korrigiert. Zweifelsfragen haben wir in den Anmerkungen niedergelegt.
Wir danken dem HörVerlag und der Heinrich-Heine-Universität für die Überlassung der Vorlesungsmitschnitte. Für Hinweise und wertvolle Auskünfte danken wir Herrn Professor Jochen Vogt von der Universität Essen und Herrn Günther Opitz, der bis 2006 das Werk Robert Gernhardts im S. Fischer Verlag betreute. Bedankt seien für Recherchen und vielfältige Unterstützung bei der Erfassung der Texte Hans Braam, Susanne Hagestedt, André Kischel, Matthias Kubitz, Sabine Landes, Esther-Maria Möller, Ragna Scharnow und Ricardo Ulbricht. Unser größter Dank aber gebührt Almut Gehebe-Gernhardt, die diese Edition vertrauensvoll in unsere Hände gelegt hat, uns bereitwillig Einblick in den Nachlaß gab, stets mit Auskünften und Ratschlägen zur Seite stand, unsere Recherchen unterstützte, unermüdlich bei der Entzifferung von Robert Gernhardts Handschrift half und uns für unsere Arbeit großherzig Gastfreundschaft gewährte.
Bei aller Hilfe, die wir erfahren durften, kann nichts darüber hinwegtäuschen, daß der vorliegende Band ein runderer, ein hellerer, ein unbeschwerterer geworden wäre, wenn Robert Gernhardt ihn noch selbst zusammengestellt hätte. Es war unser größter Wunsch, in seinem Sinne zu handeln. Ob dies gelungen ist, möge der Leser entscheiden.
Lutz Hagestedt und Johannes Möller, Nachwort
Inhalt
VORLESUNGEN ZUR POETIK
– Von Nichts kommt Nichts
– Die mit dem Hammer dichten
– Ordnung muß sein
– Leben im Labor
– Schläft ein Lied in allen Dingen?
– Was bleibt?
– Schmerz laß nach
ZU DICHTERN
– Der Schiller-Prozeß
– Nachlaß oder Nachlast? (zu Friedrich Rückert)
– Ein Verbündeter (zu Wilhelm Busch)
– Morgenstern
– Überall ist Ringelnatz
– Den Benn alleine lesen
– Brecht lesen und lachen
– In Alltags Krallen (zu Zbigniew Herbert)
– Peter Rühmkorf und wir
– Bedeutung? Gepfiffen! (zu F.W. Bernstein)
ZU GEDICHTEN
Frankfurter Anthologie
– Pein und Lust
– Crime und Reim
– Schön und gut
– Liebe contra Wahrheit
– Dichter und Richter
– Unfamiliäre Verse
– Fasse dich kurz
– Ein Hoch dem Fuffzehnten Julei
– Letzte Runde
– Die blanke Wahrheit
– Der Weg ist das Ziel
– An der Angel
– Die Lehre der Leere
– Ende schlecht, alles gut
– Ingeborg Bachmann: Die gestundete Zeit
– Warum Günther Weisenborns Gedicht „Ahnung“ kein gutes Gedicht ist
FRAGEN ZUM GEDICHT
– Langt es? Langt es nicht?
– Wie arbeitet der Lyrikwart?
– Aufgeladen? Aufgeblasen?
– Wie schlecht war Goethe wirklich?
– Warum gerade das Sonett?
– Dürfen die das?
– Was wird hier gespielt?
– Kein Beifall für den Mauerfall?
– Simon who?
– Was gibt’s denn da zu lachen?
– Stiften sie noch was, die Dichter?
ÜBER DEN UMGANG MIT GEDICHTEN
– Herr Gernhardt, warum lesen Sie Ihre Gedichte vor?
– Das ist eine kurze Geschichte. Ich bitte um Ihr Ohr:
– Berührt, nicht gerüttelt
– Einer flog aus dem Amselnest
– Sieben auf einen Streich
ÜBER DAS DICHTEN
– In eigener Sache
– Zehn Thesen zum komischen Gedicht
– Dichten in der Toscana
„ZUERST DIE POETIKEN…“
– Zu Peter Rühmkorfs Auffangpapieren
ANHANG
– „Scheiden, Sieben, Machen“ Nachwort
– „In diesem Buch steht alles drin:“ Editionsbericht
– Anmerkungen
– Nachweise
– Bibliographie
– Register
Robert Gernhardt
ist nicht nur einer der bedeutendsten Lyriker unserer Zeit, sondern auch ein kluger Theoretiker und brillanter Essayist, der sich immer wieder mit Dichtern und ihren Werken, mit der Lyrik als solcher und den Bedingungen ihrer Entstehung auseinandersetzte. Der vorliegende Band, herausgegeben von Lutz Hagestedt und Johannes Möller, vereint seine wichtigsten Überlegungen zum Gedicht, allen voran die Poetikvorlesungen in Frankfurt am Main, Essen und Düsseldorf.
S. Fischer Verlag, Ankündigung
Schlich Robert, dem Elch im Gewande
Dieses Buch ist zwiespältig aus zwei Gründen. Für den ersten kann der Autor nix, für den zweiten alles.
Wo Gernhardt im Allgemeinen bleibt, ist er großartig. (Eine interessante Feststellung, ist es doch bei anderen Autoren meist genau umgekehrt.) Seine Ausführungen zum Gedicht als solchen[tm] sind kenntnisreich, seine ausgebuddelten obskuren Beispiele faszinierend, sein Einblick in die Dichterwerkstatt erhellend.
(*****)
Sobald es konkret wird, rennt er frontal in Grund #1. Warum ist Gedicht A ein Meisterwerk, Gedicht B ein alter Latsch? Er denkt gar nicht daran, es zu begründen (allenfalls kann er formale Regeln angeben, gegen die verstoßen wurde, aber Kunstregeln sind willkürlich, und daß die poetische Kraft eines Dichters daran hängt, wie gut er die befolgt, hätte auch Gernhardt nie behauptet). Was ist an „Obskur Obskur“ so schlecht?
(***)
Nix, außer natürlich Grund #2. Gernhardt gehört(e) zu einer Clique. Cliquen hudeln alle, die zu ihnen gehören, und verbeißen alle anderen. Der obskure Autor, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, gehörte zum anderen politischen Lager. Auf ihn!! Geradezu ekelerregend wird es, wenn Gernhardt bei anderen Cliquen geißelt, daß sie Cliquendichtungswirtschaft betreiben. Wenn der Mann nicht leider schon tot wäre, gehörte er dafür im typischen TITANIC-Stil mal gründlich beleidigt, was sich jetzt natürlich aus Pietätsgrunden verbietet.
(*)
Geben wir Fonty Python das Schlußwort:
Mir klingt das Rauschen süß und traut,
Ich lausch’ ihm immer noch,
Dazwischen aber klingt es laut:
Er ist ein Frankfurter doch.
Ich seh’ dich nicht, ich höre dich nicht,
Das ist alles, was ich kann,
Ein Elch vor meinem Angesicht
Wär’ ein verlorener Mann!
Der allerschärfste Kritiker der Elche, der gerichtlich die Behauptung verbieten ließ, er wäre je selbst einer gewesen, gibt hiermit *** Punkte.
Hauke Reddmann, amazon.de, 14.1.2014
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Timo Danzer: „Das Gedicht kann Menschen aus Fleisch und Blut zusammenführen und gemeinsam beschäftigen“ – ein Kommentar
fss-hh.de, 4.5.2016
Bernd Blaschke: Der Lyrikwart als Alleskönner
literaturkritik.de, Februar 2011
Die Lyrik Robert Gernhardts
im Kontext der zeitgenössischen Literaturkritik
Robert Gernhardt war nach eigener Aussage immer dort zur Stelle, wo etwas anfing, dessen Ausgang bzw. Erfolg keineswegs vorauszusehen war: Schon im Gründungsjahr von Pardon 1962 ist er mit Beiträgen vertreten.106 1973 beginnt seine Zusammenarbeit mit Otto Waalkes, und 1979 ist er eines der Gründungsmitglieder des Satiremagazins Titanic, nachdem er aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Chefredakteur von Pardon die Mitarbeit dort aufgegeben hat. Was das Verlagswesen anbelangt, veröffentlicht er als einer der ersten Schriftsteller bei Zweitausendeins und 1982 als „Autor Nr. 1“ beim Haffmans Verlag.107 Auch wenn er diesen Verlauf in der Sendung MonTalk des WDR 2 durchaus stolz nachzeichnet und seine Neugier für „fragwürdige Unternehmungen“ darstellt, trug doch gerade der Umstand, in keinem großen Verlagshaus verlegt zu sein, dazu bei, daß Gernhardt bis in die achtziger Jahre von Seiten der Literaturkritik kaum Beachtung geschenkt wurde. Er selbst bezeichnet sich als Außenseiter oder Nischenautor und gibt an, sich nicht über das ausbleibende Interesse gewundert zu haben, da, auf Zweitausendeins bezogen, aufgrund fehlender Werbung außerhalb der Merkhefte, in denen das jeweilige Angebot des Versands monatlich bekanntgegeben wird, keine Aufmerksamkeit zu erwarten gewesen sei.108 Diese versöhnliche und abgeklärte Haltung Gernhardts muß allerdings mit Vorsicht genossen werden, denn der gemeinsam mit F.W. Bernstein verfaßte Gedichtband Besternte Ernte wurde mehreren renommierten Verlagen – Piper, Hanser, Diogenes und Rowohlt – angeboten, bevor er schließlich, wie bereits 1974 Die Wahrheit über Arnold Hau, 1976 bei Zweitausendeins erschien.109 Daß er trotz ansehnlicher Verkaufszahlen mit der Zeit immer mehr Verunsicherung darüber empfand, ob sein Werk möglicherweise „nicht wert [sei], wahrgenommen zu werden“, ob er „Mitteilungen, die nicht gebraucht“ wurden, produziere, räumt Gernhardt in einem Interview in der Neuen Rundschau ein.110 Nachdem auch dem Gedichtband Wörtersee von 1981 kein größeres kritisches Echo zuteil wurde, setzte mit dem Erscheinen des Romans Ich Ich Ich im neugegründeten Haffmans Verlag langsam die breitere Rezeption ein. Und seit dem Lyrikband Körper in Cafés 1987 kann man nicht nur von einem regen Interesse an Gernhardt sprechen, sondern auch von Erfolg bei der Literaturkritik. In den „fünf meinungsbildenden Blättern der Republik“111 finden sich überwiegend positive Besprechungen. Daß Gernhardt zu einer festen Größe im Literaturbetrieb geworden ist, bestätigt die einhellig positive Aufnahme auch der jüngsten Bände. Nach Weiche Ziele von 1994 wird vor allem 1997 Lichte Gedichte als Glanzstück gefeiert. In Reclams Jahresüberblick über die Deutsche Literatur 1997 wird in bezug auf Robert Gernhardt von der „endgültigen Promotion eines deutschen Poeten zur Kanonreife“ gesprochen.112 Das bestätigt nicht nur der sogenannte „Spiegel-Kanon“ von Marcel Reich-Ranicki vom Juni 2001, der Gedichte Gernhardts unter jenen Büchern der deutschsprachigen Literatur aufführt, die „jeder heute kennen sollte“,113 sondern auch die Einladung von Seiten der Salzburger Festspiele an Robert Gernhardt, im Sommer 2002 ihr „Dichter zu Gast“ zu sein.
Mit dem Deutschen Kinderbuchpreis für Der Weg durch die Wand, den er zusammen mit Almut Gernhardt 1983 erhält, beginnt die Liste der Preise. Es folgen unter anderem 1987 der Kritikerpreis der Berliner Akademie der Künste und schließlich 1998 der Bertolt-Brecht-Preis sowie ein Jahr später der Erich-Kästner-Preis. Ebenso wird Gernhardt zu einem gerngesehenen Gast in Talkshows, Rundfunksendungen und bei kulturellen Großveranstaltungen. Auf der Expo 2000 in Hannover fand im Deutschen Pavillon unter dem Motto „Dichter im Gespräch“ eine Lesereihe statt, in der Gernhardt Anfang August auf Peter Rühmkorf traf. Die beiden Dichter nahmen den Leitspruch ernst und setzten ihre Gedichte in thematische Beziehung. Das Ergebnis ist im Gedichtband In gemeinsamer Sache nachzulesen. Eine ähnliche Zusammenarbeit hatte es bereits mit Matthias Politycki gegeben, die das Jahrbuch 1997/98 mit einer Veröffentlichung würdigt. Robert Gernhardt und Matthias Politycki hatten sich „in rappelvollen Sälen […] kritisiert, gelobt, lektoriert, mit Zeilen zum Weiterdichten beschenkt und die Gedichte des anderen vorgelesen“.114
Von Oktober 1999 bis Juli 2000 war Gernhardt Fellow des Wissenschaftskollegs in Berlin, im Mai 2001 hielt er seine Frankfurter Poetikvorlesung. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Fribourg im gleichen Jahr ist ein weiterer Beleg für die Wertschätzung Gernhardts in der modernen Literaturwissenschaft.
Aus Anlaß einer Veranstaltung im Literaturhaus München im Oktober 2000, wo das Erotik-Special der Lyrikzeitschrift Das Gedicht vorgestellt wurde, beteiligte sich Gernhardt, einer der Autoren des Heftes, an einer Diskussion über erotische Poesie. In dieser Zeitschrift wird in der Ausgabe vom Oktober 1995 der Band Weiche Ziele besprochen und als eines „der wesentlichsten Werke“ derzeitiger Lyrik hoch gelobt. Axel Kutsch geht so weit, daß, wer Gernhardts Gedichtband nicht kenne, sich nicht als „profunden Kenner der deutschsprachigen Lyrik unserer Tage“ ausgeben dürfe.115 Danach gibt es eine zweijährige Pause, bevor Gernhardt in Das Gedicht Nr. 7 als Jurymitglied an der „Hitliste der Jahrhundertlyriker“ mitwirkt, in deren deutscher Sektion er schließlich selbst Platz 36 einnimmt. Unter die ersten hundert internationalen Dichter schafft er es nicht. Allerdings rangiert er, wenn auch knapp, nicht nur vor Raoul Schrott und Durs Grünbein, sondern auch vor Christian Morgenstern und Kurt Tucholsky, als deren Nachfolger er regelmäßig von den unterschiedlichsten Rezensenten eingeschätzt wird. Er scheint inzwischen in den Köpfen von Autoren, Kritikern, Literaturwissenschaftlern, Übersetzern, Herausgebern und Verlegern, die die Jury bildeten, präsenter zu sein als diese.116
Auch ist er inzwischen Beiträger großer überregionaler Tageszeitungen wie etwa der Süddeutschen Zeitung. In der Frankfurter Anthologie ist er sowohl als Rezensent wie auch als Dichter vertreten. Bezüglich seiner Präsenz in Anthologien im allgemeinen könnte man zwei Schlüsse ziehen. Erstens kann man auch hier die 1994 erschienenen Weiche Ziele als ausschlaggebend für die Aufnahme in ab 1995 herauskommende Anthologien ansehen und zweitens ist zu konstatieren, daß Gernhardt in den Anthologien, die sich nicht nur auf deutschsprachige Gedichte beschränken, nicht vorhanden ist. In Sartorius’ Atlas der modernen Poesie von 1995 wird Gernhardt ebensowenig berücksichtigt wie in vorausgehenden Sammlungen, z.B. Thalmayrs Das Wasserzeichen der Poesie oder Hartungs Luftfracht. Hartung jedoch wird 1998 in seinem Jahrhundertgedächtnis, das exemplarisch deutsche Lyrik des 20. Jahrhunderts versammeln will, Gernhardt mit zwei Gedichten aufnehmen. Es läßt sich nicht entscheiden, ob 1991, zur Zeit der Luftfracht; noch vor Weiche Ziele, Gernhardts Anerkennung nicht so groß war wie 1998, als er bereits den Preis der LiteraTourNord erhalten hatte, und er deshalb nicht aufgenommen wurde, oder ob er vor allem im nationalen Vergleich unverzichtbar ist.
Besonders viel Platz räumt Jörg Drews Gernhardt in seiner Anthologie Das bleibt ein, die deutsche Gedichte von 1945 bis 1995 umfaßt. Mit sieben Gedichten überholt Drews damit sogar den Neuen Conrady, der immerhin deutsche Gedichte von den „Anfängen bis zur Gegenwart“ vorstellen will, aber nur sechs Gedichte Gernhardts aufnimmt. Viel zitiert wird Drews’ Einschätzung, Gernhardt sei „ein legitimer Erbe Brechts“.117 Leider sind die Wiedergaben meist ungenau, man liest immer wieder:
Der legitime Erbe Brechts.118
Möglicherweise aber wollte sich Drews diesbezüglich nicht vollständig auf Gernhardt beschränken, sondern ihn lediglich in eine Entwicklungslinie mit Brecht stellen. Dafür spricht, daß Drews Gernhardt an anderer Stelle als „im Moment vielleicht herausragendsten Schüler“ Brechts bezeichnet.119 Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß Drews Gernhardt im Juni 2001 geringschätzig zu „einer dem common sense zugänglichen vorbildlichen Poesie“ zählt und ihn in die Nähe einer „Restitution von naturlyrischer Blaublümelei“ rückt, wobei er den Begriff der „blauen Blume“ einseitig als Pendant für etwas naiv „Treuherzig-Stimmungsmäßiges“ benutzt.120
Es zeigen sich also zwei Tendenzen. Der beginnenden Kanonisierung des Autors steht eine Verharmlosung seines Werks gegenüber, die es u.a. als eines der „verlässlich[en] Zugpferde des Mainstreams“121 klassifiziert.
Diesen Entwicklungen und ihren einzelnen Aspekten soll nun nachgegangen werden.
Gernhardt gibt an, bereits 1990 bewußt einen provokanten Satz formuliert zu haben, an dem sich die Leute reiben können und der sie zu einer intensiveren Auseinandersetzung reizt, indem er in Gedanken zum Gedicht die viel beachtete, vielzitierte und oft auch ungenau zitierte Behauptung aufstellt:
Die These aber lautet, daß alle Gedichte komisch sind.122
Diese bemerkenswerte These wird erstaunlicherweise von der Kritik wie eine Selbstverständlichkeit zitiert, obwohl sie doch mit den gängigen Lyriktheorien unvereinbar scheint. Und vor allem hat sich dieser eine Satz aus Gernhardts Abhandlung verselbständigt, da sich kaum jemand die Mühe macht nachzulesen, daß Gernhardt eine Einschränkung gibt:
Dazu ein paar Erläuterungen und Einschränkungen: Den Begriff ,Gedicht‘ verwende ich im verbreitetsten und plattesten Sinne: als sprachliche Mitteilung, die sich am Ende reimt.123
Der Mensch lasse sich leicht vom Reim verführen. Der Reim suggeriere Zusammenhang, Geheimnis, Inhalt, wo nicht zwangsläufig derartiges vorhanden sei. Gernhardt spricht von einer Art Eigendynamik der gereimten Sprache im Sinnstiftungsprozeß, die der Dichter kontrollieren und sich zunutze machen könne. Solange er die „zutiefst komische Qualität aller vom Reim gelenkten Sinn- und Beziehungsstiftung“ unter Kontrolle halte, entstehe Komik nicht unfreiwillig. Ist er nicht auf Komik aus, so sei sein Ziel, den Leser vergessen zu lassen, „daß da überhaupt noch gereimt wird“.124 Daß die Komik vollkommen zu entfernen sei, bezweifelt Gernhardt, wie er in einem Gespräch ausführt:
Das Potential des Komischen webt manchmal in kaum nachvollziehbarer Verdünnung mit, wenn man Gebilde danach strukturiert, daß sich Worte reimen.
Beim Versuch einer nachträglichen Umschreibung bzw. Interpretation spricht er von einer Art von Heiterkeit, die mitwirke, wenn man die Sprache nach Reimwörtern organisiere, einer Heiterkeit, die „der Erdenschwere trotzt, im Gegensatz zur meist ungegliederten und nicht rhythmisierten normalen prosaischen Rede“.
Wenngleich Gernhardt die unfreiwillige Komik mancher Gedichte aufs Korn nimmt und den Reim als eher zufällig geleitetes Verfahren zur Sinnstiftung problematisiert, bedeutet das nicht, daß er Lyrik, die vor allem mit Klang arbeitet und den Aufbau von Atmosphäre einer direkt faßbaren Aussage vorzieht, als „faulen Zauber“ bezeichnen würde.
Gernhardt führt seine Nonsensgedichte als Beispiel für eine Art der Lyrik an, die Sinn suggeriert, wo keiner ist.125 Ähnliches meint Kenneth Koch, wenn er anhand des Beispiels „Two and two / are rather blue“ verdeutlicht, wie
eine unsinnige Aussage allein durch ihre Musik eine Art von Wahrheit zu gewinnen oder zumindest etwas zu sein scheint, […] in gewisser Weise sogar denkwürdig wird.126
Ablehnend steht Gernhardt Gedichten gegenüber, die pathetisch und gestelzt klingen, die gedankenlos mit den lyrischen Ordnungsprinzipien umgehen und hinter denen ein Dichter wirkt, „der sich die Toga umwirft, sich auf den Sockel stellt und dichterisch spricht“. Wohl und hohltönende Verse, das ist für ihn „fauler Zauber“ im Gegensatz etwa zur Magie der Lyrik Brentanos, die über Sprache sehr viel Gefühl transportiert.127
Gernhardt gibt an, in seinen Anfängen nicht auf Originalität aus gewesen zu sein, sondern vielmehr darauf, sich selbst und die Leser zu unterhalten. Seine Gedichte zielten auf komische Effekte ab und suchten die Pointe.128 Noch 1994 widerspricht er der These nicht, die Deutschen schätzten ihn vor allem als gewitzten Nonsens-Literaten.129 Der Nonsens hat ihn berühmt gemacht. Darin sind sich alle einig; Gernhardt eingeschlossen, der mit dem Begriff „leben kann“, nicht jedoch mit dem Begriff Blödeln, den er für „spaßherabsetzend und nonsensfeindlich“ hält.130
Tatsächlich benutzen die Rezensenten Wörter wie Blödsinn, Blödeleien, Blödeln, um die Anfänge Gernhardts als „Jugendsünden“ oder zumindest als weniger ernstzunehmend, qualitativ weniger gelungen abzutun. Um die negativen Aspekte des Ausdrucks Blödsinn zu mildern, greift Julia Schröder in der Stuttgarter Zeitung zu der Formulierung „höherer Blödsinn“.131 Dieter E. Zimmer interpretiert diese Termini als Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit der Kritik gegenüber Gernhardtschen Versen:
Da uns die approbierte Art fehlt, uns über diese Kunstsparte zu verständigen, fällt es uns auch schwer, Niveauunterschiede dingfest zu machen.132
Es gibt nicht viele Rezensenten, die sich auf eine klare Einordnung von Gernhardts Lyrik oder gar bestimmter Gedichte einlassen. Der Großteil begnügt sich mit nicht literaturwissenschaftlich definierten Begriffen oder setzt sie im umgangssprachlichen Sinne ein. Gern wird auch ohne direkten Bezug zu bestimmten Texten von Parodie, Satire etc. gesprochen. Dieser Weg ist relativ ungefährlich, da Gernhardt in der Tat auf sämtlichen Gebieten tätig war bzw. es noch ist.
In der FAZ rühmt Kurt Flasch Gernhardts „Kunst, berühmte Verse zu persiflieren und literarische Formen zu parodieren“, konkrete Beispiele bleibt er schuldig.133 Drews ordnet den Wörtersee dem Entertainment zu, von wo aus sich über Körper in Cafés als einer Art Zwischenstation der ernstzunehmende Dichter in Weiche Ziele entwickelt habe.134 Wolfgang Nagel charakterisiert in der Zeit Gernhardts Produkte für Pardon pauschalisierend mit der Vokabel ,Kalauern‘.135 Diese Vorgehensweise, nur einen Aspekt der früheren Arbeit herauszugreifen, wird oft herangezogen. Ebenso gerne wird verallgemeinernd von der Anfangsphase Gernhardts als Nonsenszeit gesprochen, ohne den Zeitraum einzugrenzen.
Genauer Begriffsklärung bedürfte es dort, wo einzelne Gedichte untersucht werden. Doch selbst die Interpreten, die Gedichtinterpretationen im Rahmen der Frankfurter Anthologie veröffentlichen, sind bemüht, das Problem zu umgehen, indem sie sich vor allem auf inhaltliche Aspekte konzentrieren. Manches Mal führt das allerdings in die Nähe einer Nacherzählung.
Exemplarisch für die Reihe sei die Interpretation Christa Rotzolls angeführt:
Rotzoll nennt „Siebenmal mein Körper“136 ein „komisches Gedicht, kein hochmoralisches, erst recht kein frommes“ und steigt nach dieser Feststellung ohne Umschweife in eine assoziative inhaltliche Interpretation ein. Formale Gesichtspunkte untersucht sie nicht. Ihr Einstieg mit der Formulierung „ein Ich, das Robert Gernhardt heißt“ illustriert eine Herangehensweise an Gernhardt, die Autor und artikuliertes Ich137 gleichsetzt und Gernhardts Biographie benutzt, um Deutungsansätze zu stützen.
Rotzoll möchte vor allem die Verbindung zum Alltag des Lesers hervorheben und verdeutlichen, daß Gernhardt ihm aus der Seele spricht. Besonders für Leserinnen sei das Gedicht aktuell, da sie einen ständigen Kampf gegen den Verfall des Körpers führen müßten. Daneben gibt sie anschauliche Beispiele, wie der einzelne in den unterschiedlichen Lebensstadien seinen Körper empfinden kann, den Gernhardt in seinem Gedicht als unvernünftig, egoistisch und undankbar charakterisiert. Ihr Fazit lautet:
Für einen Menschen, der nicht weiblich ist und noch nicht alt, hat mein Lieblingspoet Gernhardt […] über die Dreistigkeit des Körpers allerhand herausgekriegt.138
Die Erwähnung, daß Gernhardt ihr Lieblingspoet sei, weist auf einen sympathetischen Zugang zum Untersuchungsgegenstand hin und auf die Abneigung, den Text unter einem literaturwissenschaftlichen Blickwinkel zu klassifizieren.
Als 1987 mit Körper in Cafés die Auseinandersetzung mit Gernhardts Werk einsetzte, wurde vor allem Wert auf die Frage gelegt, ob und inwiefern es eine Entwicklung des Gcrnhardtschen Stils gab.
Nach Herbert Lindenberger von der Stuttgarter Zeitung überwiegt noch in den Gedichten von Körper in Cafés der Nonsens, was er an dem von der Literaturkritik auch in anderen Zusammenhängen besonders gerne angeführten Gedicht „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ festmacht. An ihm zeigt sich der „bündige, trockene, lakonische Ton“, den der Rezensent anscheinend für nonsens-typisch hält. Allerdings stellt er auch fest, daß sich „der Witzbold […] sehr bald mit dem Sinnsucher und dem Ästheten“ vermische.139 Wie auch immer Gernhardt anfangs eingeschätzt wird, ob als Nonsens-Autor, Satiriker, Humorist etc., niemand ist der Ansicht, Gernhardt verliere später seinen Witz. So auch Nagel nicht, der jedoch im Gedicht „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ die Schwelle vom Nonsens hin zu „meisterhaftem satirischen Ernst“ überschritten sieht. Seiner Ansicht nach ist Gernhardt mit Körper in Cafés ein weiterer Schritt in Richtung der „vordersten Reihe der deutschen Gegenwartsliteratur“ gelungen, ohne seinen Witz verloren zu haben.140
Drews aber sieht die vielversprechende Entwicklung unterbrochen. Für ihn ist Wörtersee Gernhardts Meisterwerk auf seinem Weg weg vom Titanic-Niveau, das Drews offensichtlich negativ einstuft. Körper in Cafés stelle einerseits einen Rückschritt dar, da in diesem Band „gequält-spaßige Versehen, die in der Titanic notfalls ihren Platz hatten“ versammelt seien, und andererseits eine Anpassung an die Verhältnisse. Gernhardt resigniere angesichts der allgemeinen Stimmung in Deutschland und ziehe sich, wie viele andere Künstler auch, ins Private zurück. Mit einigen Themen und stilistischen Elementen geht Drews scharf ins Gericht. Er empfindet zum Beispiel Gernhardts von anderen als treffend und treffsicher eingesetzte Szene-Sprache als peinlich. Sie klinge „als biedere der 50jährige bei der Sprache der 25jährigen sich an“. Und die Themen seien größtenteils „ausgelutscht“, „nichtig“ oder künstlich aufgebauscht:
Wenn mir die Kirschbäume hinterm Einfamilienhaus in Pasing kaputtgehn, ist das spießig; wenn aber die Bäume in der Toskana – ja, das ist halt schicker. Wirklich?
Drews vermißt also im Grunde, was Harald Hartung141 besonders schätzt, die Freiheiten und Frechheiten von Wörtersee. Und er findet das, was Hartung Gernhardt von vorneherein abspricht:
bierernste, mit gesetztem Temperament formulierte Kulturkritik.142
1995 wird Drews eine gegenteilige Meinung vertreten: Gernhardt baue gegenwärtige Redensarten wie z.B. ,auf den Sack gehen‘ auf eine Weise in den Text ein, die ihnen ihr bloß Gröbliches, Jargonhaftes nimmt.143
Stefanie Holzer drängt sich in ihrer Rezension zu Weiche Ziele in der Wiener Zeitung bezüglich der Abteilung „Zu Paaren“ die „schlimme Beschuldigung ,Zweiter Frühling‘“ auf. Die Art, wie hier das Thema Sexualität behandelt würde, wäre bei einem jüngeren Autor wohlwollend mit „pubertärer Indisposition“ zu entschuldigen. Dieses Kapitel zeichne sich nicht durch den Humor aus, der „diffus an Ringelnatz und Morgenstern erinnert“, der „erfrischend blöd und auch tiefsinnig“ ist und den man „gern hat“, weil er „lustvolles Gelächter“ auslöse.144 Schon die bei Holzer stehende Überschrift „Lyrik am Zahn der Zeit“ verrät, daß sie die Stimmen repräsentiert, bei denen „ein enttäuschter, ja besorgter Unterton nicht zu überhören ist: Jetzt geht also auch er den Weg aller alternden Komiker, er wird weise, wertvoll und weinerlich.“145 Zu diesem Kreis gehört auch Carola Rönneburg, die – wie Klaus Modick – mit Beginn der neunziger Jahre eine „leise Altersmilde“ feststellt, die sie aber nicht entschuldigt, sondern die ihr Sorgen macht. Gernhardt sei nicht mehr er selbst, nicht mehr „der natürliche Feind aller Grünen und Sozialdemokraten“.146 Diese politische Komponente findet sich auch bei Hans Christian Kosler. Seine Bezeichnung „subversiver Humorist“ bezieht sich vor allem auf die Anfänge Gernhardts.147 Verkörpert Gernhardt heute eine andere Art des Humoristen? Verfolgt er keine umstürzlerischen Ideen mehr? Nach eigener Aussage hat er dergleichen nie radikal betrieben. Dennoch galt er schon als Nonkonformist, als er mit seinem Universitätsabschluß zu Pardon ging, statt „zu einer respektierlicheren Zeitung“.148
Als Beispiel dafür, wie ein von Gernhardt selbst als Humoreske eingestuftes Gedicht149 von der Literaturkritik aufgenommen wird, sei an dieser Stelle das Gedicht „Ach“ aus Lichte Gedichte angeführt.
Besonders deutlich wurde die heitere Grundstimmung trotz des ernsten Themas Tod bei Gernhardts Vortrag in seiner Frankfurter Poetikvorlesung. Ein redseliges, weltfremdes, naives Ich malt sich aus, wie es sich verhalten wird, wenn es im Angesicht des Todes steht:
Ach, noch in der letzten Stunde
werde ich verbindlich sein.
Klopft der Tod an meine Türe,
rufe ich geschwind: Herein!
Es weiß genau, daß seine vertrauensselige Art an dieser Stelle eher fehl am Platze sein wird. Diese leicht resignative Erkenntnis drückt das „Ach“ aus, welches immerhin auch Titel des Gedichts ist und in vieren der sechs Strophen aufgegriffen wird. Nachdem das Ich „Herein“ gerufen hat, tritt der Tod ein. Das Ich beginnt Konversation zu betreiben und erkundigt sich neugierig und arglos: „Woran soll es gehen? Ans Sterben?“ oder „ Ach – und das ist Ihre Sense? / Und die gibt mir dann den Rest?“ Es ist bemüht, sich höflich und zuvorkommend zu verhalten, verbindlich eben, und alles richtig zu machen. Am Ende des Gedichts akzeptiert es:
– ach! Ich soll hier nichts mehr sagen?
Geht in Ordnung! Bin schon
Eine unspektakuläre, fast nebensächliche Art zu sterben. Sterben ist in dieser Humoreske kein Drama – zumindest wenn Gernhardt sie vorliest? Diesen Eindruck gewinnt man, betrachtet man eine Interpretation, die im Rheinischen Merkur erschienen ist. Dort stellt der Rezensent richtig fest:
Ein Ich spricht mit einem Du, das unhörbar bleibt.
Dieses Du ist der Tod. In der Tat tritt er „als mittelalterlicher Knochenmann mit Kutte, Sense und Sanduhr“ auf, was ich als Indiz für die komische Grundstimmung des Gedichts werten würde, da es an märchenhafte Darstellungen erinnert und dadurch Distanz zur Realität schafft. Der Rezensent jedoch sieht einen „grimmigen Killer“, der „unwichtige Aufgaben (Sanduhr halten) […] an sein Opfer delegiert“ und schließlich ungehalten „irgend etwas wie ,Schnauze!‘“ ruft. Der „liebenswerte Tollpatsch“, das Ich, steht einer grausamen Gewalt gegenüber. Auch wenn man glauben könnte, aus diesem Kontrast ergäbe sich eine Komik, die sich in der Nähe einer Slapstick-Komödie befindet, so ist der Rezensent anderer Ansicht. Blicke man nämlich tiefer, so werde man einer bedrohlichen Atmosphäre gewahr:
Könnte es sein, daß das lyrische Ich in Wahrheit gar nicht Konversation macht? Daß es glasklar über seine Lage Bescheid weiß? Daß es Wort um Wort und Vers um Vers versucht, das Unvermeidliche immer weiter hinauszuschieben? Dann wäre dieses ulkige Gedicht ja beim zweiten Hinschauen gar nicht so ulkig […].150
Nach dieser Auslegung steht das Gedicht für eine typisch menschliche Verhaltensweise dem Tod gegenüber, für die der Verdrängung und des Nicht-wahrhaben-Wollens. Dieser ernsten Interpretation schließt sich Gerhard Schulz in der FAZ an. Auch er sieht im artikulierten Ich einen „Helden unserer Zeit, der die Worthülsen des modernen Geschwätzigkeitsidioms zum Mittel macht, Transzendenz zu bewältigen und der Angst vor den letzten Schritten Herr zu werden“. Er schreibt: „Dies ist kein Morgensternsches Gedicht, zusammengefügt aus Demut, Ironie und Weltweisheit“, denn es gibt eine tiefere Dimension:
Es geht aus diesem Gedicht jene Stille hervor, gegen die sich nicht anreden und die sich nicht aussprechen läßt.151
Symbol für diese Stille ist der verweigerte Reim am Ende des Gedichts.
In der Frankfurter Poetikvorlesung allerdings ist von alledem nichts zu spüren, das Publikum bricht in schallendes Gelächter aus, während Gernhardt schelmisch in die Runde blickt. Vorausgeschickt hat er seinem Vortrag, daß selbst Nonsensgedichte durch das ernste Thema Tod „diffus geadelt“ würden.152
Die Wertschätzung Gernhardts als ernstzunehmenden Schriftsteller hat ihre Basis in seiner perfekten Beherrschung quasi sämtlicher Stile, Versmaße und Ausdrucksformen. Er hat sich seinen eigenen Ton durch die „witzige Variation großer oder bekannter Muster“153 erarbeitet. Es entwickelte einen eigenen Stil, der alte Stimmen aufnimmt und vor allem mit alten Formen experimentiert. Gernhardt ist der Ansicht, daß „diese Formen keinesfalls verbraucht sind“.154
Bezüglich seines Goethe-Zyklus „Würstchen im Schlafrock“, der 1998 in Klappaltar veröffentlicht wurde, bekundet Gernhardt in der bibliographischen Notiz die Hoffnung, sich vom goetheschen Vorbild gelöst und mit eigener Stimme gesprochen zu haben.155 Er ist nicht der Meinung, „daß es die eigene Stimme verstummen läßt, wenn man sich hin und wieder anderer Stimmen bedient“, vorausgesetzt, man hat sich seine eigene Stimme erarbeitet und, noch wichtiger, ist bereit sie zu zeigen.156 „Würstchen im Schlafrock“ kann als Paradebeispiel für Gernhardts Entwicklung gelten. Der Zyklus fängt als Parodie des „Goethe-Sounds“ an, die durch Übertreibung eine „flackernde, eher verhaltene, aber dafür intensive Komik“ erzielt. Im weiteren Verlauf des Zyklus jedoch tritt die Parodie immer weiter in den Hintergrund, und Goethe liefert nur noch die Idee, den Anlaß für Gernhardts Gedichte.157
Seit 1987 durchzieht die Anerkennung für seine profunde Kenntnis der literarischen Tradition die Rezensionen in allen Zeitungen. Die deutschen Kritiker loben ausnahmslos den „begnadeten Alleskönner“158 der „handwerklich über allen Zweifel erhaben“159 ist, „auf gesichertem Bildungskanon aufbaut und gesättigt ist mit der Lyrikerfahrung der Vergangenheit“.160
Skasa liefert eine bemerkenswerte Begründung für Gernhardts wachsende Akzeptanz bei der Literaturkritik: Der Kritiker könne ohne „ein flaues Gefühl“ lachen, weil Gernhardt inzwischen bewiesen habe, daß er auch ernste Gedichte auf hohem Niveau verfassen kann. Gute Verse, denen „die allergründlichste Kenntnis abendländischer Dichtung anzumerken ist, diese Gewissenhaftigkeit und […] der Ernst einer lebenslangen Beschäftigung mit Lyrik, Kunst und Kritik“, verlangten dem Kritiker noch mehr Bewunderung und Anerkennung ab, wenn er um Gernhardts Nonsens-Vergangenheit wisse. Im Vergleich mit den früheren qualitativ weniger ansprechenden Werken erscheine Gernhardts heutige Leistung als um so größer:
wenn Robert Gernhardt in seinen zehn Trauergedichten tatsächlich mal ganz, ganz ernst ist, rührt uns das noch viel tiefer an als bei den bekannten Gramlyrikern.
Aber auch andersherum funktioniert dieser Mechanismus. Auch die Vergangenheit wird aufgewertet, da die Vermutung naheliegt, daß man in früheren Zeiten etwas übersehen habe.161
Lyrik gehorcht Regeln, so Gernhardt, folglich muß sie im Ergebnis überprüfbar sein. Kriterien, auf die sich die Kritik stützen könnte, wären Reim, Rhythmus, Wortwahl oder Tatsachenbehauptungen, nicht die Weltsicht oder Poetik der Autoren.162 Trotz der „scheelen Blicke seiner Dichterkollegen, die die kostbaren alten Suggestionstechniken naserümpfend den Werbern überließen“, bedient sich Gernhardt eben dieser Techniken.163
Er bezweifelt, daß der Verzicht auf bewährte Fertigkeiten Kunst befördere und steigere.164 Er unterstellt, daß die Lyriker vielmehr der Gefahr fundierter Kritik entgehen wollten.
[…] kein Wunder, daß die Ernst-Dichter im Laufe dieses Jahrhunderts immer entschlossener immer mehr Regelsysteme über Bord warfen, nicht nur den Reim, auch den Vers, das Metrum, den Takt und den Rhythmus.165
In seinen Frankfurter Poetikvorlesungen erweitert er die Liste um Strophe, Zeichensetzung, Syntax und Rechtschreibung und deutet damit an, daß sich die Tendenz zur Regellosigkeit seit 1990 weiter radikalisiert habe.166 In die gleiche Kerbe schlägt Thomas Steinfeld, der behauptet:
Die erprobten Mittel der Dichtung sind ja nicht aufgegeben worden, weil sie ihren Dienst versagten.167
Indem Gernhardt sich ihrer weiterhin bedient, manövriert er sich in eine Außenseiterrolle, durch die ihm anfangs der Ruhm versagt blieb und die ihm jetzt sozusagen ein Marktmonopol sichert. Gernhardt beherrscht „alle literaturbetrieblichen Gebräuche und Tricks“ und hart„ inzwischen […] die meisten Konkurrenten hinter sich gelassen, was Bücherpräsenz und Bekanntheit betrifft“.168
Dabei gibt er zu bedenken, daß mit Handwerk nicht die blinde Befolgung „verstaubter Regelsysteme- oder einer „normativen Ästhetik“ gemeint ist. Vielmehr soll das dichterische Handwerkszeug Voraussetzung dafür sein, „jedem Gefühl und jedem Gedanken sprachlich gewachsen zu sein und aus jedem Einfall das Beste zu machen“.169
Gernhardt rückt vom Geniegedanken ab; dem Dichter würden ab und zu einige Zeilen geschenkt, alles weitere sei Arbeit.170 Von Wilperts Definition von Lyrik als
sprachlicher Gestaltung seelischer Vorgänge im Dichter, die durch erlebnishafte Weltbegegnung entstehen, in der Sprachwerdung aus dem Einzelfall ins Allgemeingültige, Symbolische erhoben werden und sich dem Aufnehmenden durch einfühlendes Mitschwingen erschließen171
grenzt sich Gernhardt in seiner Frankfurter Poetikvorlesung ausdrücklich ab. Anhand eines Gedichts von Goethe zeigt er, wo die Grenzen dieser Definition liegen.
ANNONCE
„Ein Hündchen wird gesucht,
Das weder murrt noch beißt,
Zerbrochene Gläser frißt
Und Diamanten…172
Nach Wilpert wäre dieses Gedicht nicht nur nicht der Lyrik zuzurechnen, sondern, da es auch sonst keiner der „drei Naturformen der Dichtung“173 zuzuordnen ist, überhaupt keine Dichtung. Gernhardt konstatiert dementsprechend ironisch:
Wenn ein Gedicht und eine Definition zusammenstoßen und es hohl klingt, muß es nicht immer am Gedicht liegen.174
Der vorsichtigeren und wesentlich allgemeiner gehaltenen „Minimaldefinition“ Conradys schließt er sich hingegen an:
Zur Lyrik gehören alle Gedichte, und Gedichte sind sprachliche Äußerungen in einer speziellen Schreibweise. Sie unterscheiden sich durch die besondere Anordnung der Schriftzeichen von anderen Schreibweisen, und zwar durch die Abteilung in Verse, wofür bei der ,Visuellen Poesie‘ die Bildgestaltung mit den Mitteln des (nicht immer nur) sprachlichen Materials und der Schrift eintritt. Der Reim ist für die Lyrik kein entscheidende Merkmal.175
Gernhardt macht Definitionen wie die Wilperts als „Poesieverklärung und Lyrikverdunkelung“ mitverantwortlich für das mangelnde Interesse an Lyrik.176
Der Autor stellt die Situation der heutigen Lyrik selbst nicht gerade positiv dar. Er konstatiert, daß der Leser immer weniger gewillt ist, sich für Gedichte Zeit zu nehmen. In seiner Frankfurter Poetikvorlesung bedauert er in gewohnt salopper Weise, daß es keinen allgemein bekannten literarischen Kanon mehr gebe, auf den jeder rekurrieren könne. Die Jugend von heute könne nicht mehr auf poetische Verständigungshilfen zurückgreifen. Man könne nicht davon ausgehen, daß das Gegenüber die gleiche Literatur gelesen habe wie man selbst. Gernhardt ist mit der Schuldzuweisung vorsichtig: Er zieht leise in Zweifel, ob „wirklich die Dichter und nur die Dichter versagt“ hätten oder ob nicht auch das Bildungssystem und die Medien falsche Schwerpunkte setzen würden. Die „zunehmend reizhungrige und abwechslungssüchtige Zeit“ hätte möglicherweise keinen Platz, keine Verwendung mehr für Poesie.177
Vielleicht liegt es auch an der Unübersichtlichkeit der Lyrikproduktion, die selbst von den Literaturwissenschaftlern und Kritikern nicht mehr eingeordnet werden mag. Aus meist verstandesmäßig geleiteten Überzeugungen werden bestimmte Gedichte positiv bewertet. Sie bringen formale Neuerungen oder Ungewöhnliches im Duktus. Wie Heinz Ludwig Arnold beschreibt, erhalten die Dichter wenig Echo von den Lesern selbst, meist sind sie auf die Resonanz der Literaturzeitschriften und Zeitungsrezensionen angewiesen. Inwiefern sind diese medialen Organe meinungsbildend? Inwiefern vermitteln sie zwischen Produkt und Konsument? Inwiefern sind zum Beispiel die Anthologisten daran interessiert, den elitären Charakter der Lyrik zu unterstreichen? Die meisten Lyrikkonzepte sehen in der Poesie weiterhin etwas über alle andere Literatur Erhabenes, das für den Leser schwer faßbar sei(n müsse). Man wünscht sich einen Leser, der sich den existentiellen Fragen des Lebens stellen will, man wünscht sich Lyrik, die diese Fragen kompromißlos formuliert. Gernhardt läßt dem Leser die Wahl, wie weit er sich einlassen will. Er versucht eine Verbindung aus Ernst und Komik. Er gibt der Literaturkritik Grund mißtrauisch zu sein, indem er scharf mit der Auffassung ins Gericht geht, daß Lyrik schwer sein müsse, inhaltsschwer oder schwer verständlich. Die Hemmschwelle, einen Lyrikband aufzuschlagen, sei weiterhin wesentlich größer als bei jeder anderen Literatur, da das Image der Lyrik sich immer noch am Geniegedanken orientiere und „das Beste, Größte und Tiefste, was Sprache leisten könne“ verspreche.178 Solche Perfektion und Größe schreckten ab. Dennoch will sich Gernhardt nicht von der Unterhaltungsbranche vereinnahmen lassen. Auch er sieht seine Klientel unter den „Sinnsuchern“.179
In Zeiten, in denen Lyrik von mehr Menschen produziert als gelesen wird,180 bescheinigt man Gernhardt von verschiedenen Stellen, mal vorwurfsvoll, mal mit mißgünstigem Unterton, mal bewundernd, er spreche Leserkreise an, die sonst keinen Zugang zu Gedichten fänden. Es sei eine Leserschaft, die weder besonders gefühlsbetonte, geheimnisvolle noch intellektuelle, metasprachlich oder sprachskeptisch orientierte Lyrik suche, sondern anspruchsvolle, verständliche, intelligente Gedichte. Kosler führt Gernhardts Popularität auf einen neuen Lesertypus zurück, der sich in den letzten Jahren gebildet habe und weniger nach Lebensersatz verlange als nach geistreicher Unterhaltung.181 Auffermann formuliert es so:
Gernhardt ist einfach, Gernhardt ist Kult, und Kult heißt heute Pop.182
Unsere Gesellschaft wünscht sich demnach eine Lyrik, die auf humorvolle Weise an die unterschiedlichsten Probleme herangeht. Pathetik ist nicht zeitgemäß, Pragmatik rangiert weit vor dem Ehrgeiz, sich einer Utopie zu verschreiben. Ein solches Lebensgefühl sucht im Kleinen nach Veränderungen und Möglichkeiten der Bewältigung, es verträgt sich mit Gernhardts „praktischer Lebenshilfe“.183 Gernhardt macht Sinnangebote, aber er erklärt seiner Leserschaft nicht die Welt. Er erschafft kein anzustrebendes Idealbild, da ihm „Unbedingtheit nicht gegeben“ ist, sondern beschränkt sich eher auf die Kommentierung des Ist-Zustandes.
Gernhardts Verhältnis zur Welt ist das eines Skeptikers, von dem er sagt, er sei ein „verhinderter Gläubiger“.184 Gernhardt versteckt eine pädagogischen Absichten geschickt, so daß sich Publikum oder Leser nicht belehrt fühlen.185 Wenn sich das Ich einmal lehrerhaft präsentiert, dann stets mit selbstironischem Unterton und guter Laune. Gernhardt gilt als „sanfter, freundlicher Vermittler“,186 als „diesseitig und lebensfreundlich“,187 als Satiriker mit einem „gefühlvollen Herzen“,188 dessen „Entspanntheit befreiend“189 wirkt. Dabei bedichtet er durchaus die großen Themen wie Liebe, Alter, Tod, Natur. Er beschäftigt sich auch mit den dichterspezifischen Themen wie Sujetsuche, Inspiration, Konkurrenz. Aber Sprachskepsis scheint es bei ihm nicht zu geben. Gernhardt glaubt in einer Welt, der man Kontaktlosigkeit und Vereinsamung attestiert, an die Möglichkeit von Kommunikation:
So helfen die Dichter den normalen Menschen, sich zu verständigen.190
Gernhardt ist ein „Poet, der aufgeklärt und ironisch auf die zivilisierende Wirkung der formgesättigten Ironie setzt“.191 In Berufung auf Goethe und Schiller charakterisiert Gernhardt das Gedicht im allgemeinen als anspruchsvoll seinen Lesern gegenüber. Es verlange Sammlung, dränge sich auf, es sei unbequem. Ansonsten sei es aber durchaus ein Gesellungsmedium.192
Selbst „die Intellektuellen, die Friederike Mayröcker oder Thomas Kling lieber loben denn lesen, erholen sich“ bei Gernhardts Gedichten,193 an denen man Lesbarkeit, Einprägsamkeit und – eins der meistgebrauchten Wörter zur Charakterisierung Gernhardtscher Verse – Leichtigkeit schätzt. Aber die steht in Deutschland nicht besonders hoch im Kurs.194
Einem „poetischen Handwerksmeister“ und sei er „von hohen Graden“195 spricht man allzu leicht die Fähigkeit zu „magischen Zeilen“ mit „Zauberspruchcharakter“ ab.196 Ein Genie bürgt für Originalität im Sinne von etwas noch nie Dagewesenem, während man mit dem Abgeleiteten den Schöngeist in Verbindung bringt.197 Wenngleich vor allem seit Lichte Gedichte vom unverwechselbaren Gernhardt-Ton gesprochen wird, so wird dessen Einmaligkeit doch häufig mit der unverwechselbaren Art begründet, mit der Gernhardt alte Muster und Vorbilder verarbeitet.
Dieter M. Gräf, selber Lyriker, meint, Gernhardt sei nicht fälschungssicher, aber unverwechselbar.198 Eine Differenzierung, die die Probleme der Rezensenten mit Gernhardts Stil offenlegt. In eine ähnliche Richtung weist die problematische Unterscheidung Verena Auffermanns von Lyriker und Dichter:
Robert Gernhardt, der Dichter, der kein Lyriker und trotzdem ein Dichter ist.199
Auffermann definiert den Unterschied zwischen Dichter und Lyriker nicht. Der Tenor ihres Artikels geht allerdings dahin, daß sich der Lyriker durch eine eigenschöpferische Leistung auszeichne, der Dichter vor allem durch seine handwerklichen Fähigkeiten.
Auch Jan Koneffke, gleichfalls Lyriker, bezweifelt, daß Gernhardt das Zeug zum Klassiker hat, obwohl der Verlag „uns das […] mit einer in Format und Gestaltung an Klassikerausgaben erinnernden Gedichtsammlung [weismachen]“ wolle. Er betrachtet Gernhardt als Gelegenheitsdichter von hohem Rang, der jedoch „keinen Anspruch auf Ewigkeit oder mindestens Zeitlosigkeit“ erhebe. Seine Verse seien fest an ihre Zeit gebunden. Ihre „kindliche Beziehung zur Zeit“ und der fehlende ernste Hintergrund ließen sich nicht mit einem Klassiker vereinbaren.200
Gräf rühmt Gernhardt als „Meister seines Fachs“, aber welches ist seiner Meinung nach Gernhardts Fach? Die Antwort wird in der Rezension nicht gegeben. Gräf nennt Gernhardts Gedichte „lyrische Hits, Ohrwürmer“, speziell das von ihm rezensierte Gedicht „Gut und lieb“201 sei ein „angenehm simples Textgebilde“, wenn auch keineswegs „in einer pfiffigen Viertelstunde aufs Papier“ zu bringen, „sympathisch“, „eine runde Sache“, die keiner Verbesserung bedürfe, aber keine Lyrik. Gräf vergleicht Gernhardts „Hits“ mit denen der Beatles, auch diese haben seit Jahrzehnten Bestand und werden wohl so schnell nicht in Vergessenheit geraten, aber bei den Songs wie bei Gernhardts Gedichten handele es sich um leicht konsumierbare Kost, um Produkte zur Unterhaltung, für den schnellen Genuß. Gräf macht einen Unterschied, in wessen Gedächtnis der Dichter aufgehoben bleibt. Er verweist Gernhardt in die Nähe des Showbusineß, ordnet ihn der Unterhaltungsbranche und einem größerem Publikum zu, das „sonst eigentlich nicht zu Gedichten “ komme.202
Volker Hage verfolgt zunächst eine ähnliche Spur wie Gräf. Er kommt nicht umhin, Gernhardts Gedichten „klassische Vollkommenheit“ und große Popularität zu attestieren. Dennoch stellt er die Frage: „Ist er denn […] mehr als ein Verseschmied?“ und glaubt anhand von Gedichten wie „Auch eine Ästhetik“203 oder „Alles über den Künstler“204 Selbstzweifel bei Gernhardt zu erkennen. Gegenüber den Zeilen „Fühlte in kleinerer Kunst mich viel wohler. / Stapf dennoch pfeifend querbeet durch die große“ regt sich bei Hage der Zweifel, ob sich hier nicht ein unbedeutender Dichter bewußt klein mache um größer zu erscheinen.205 Relativ unbedacht, wie viele seiner Kollegen auch, setzt Hage den Dichter mit dem artikulierten Ich gleich.206 Das geschieht ebenfalls, wenn er schreibt: „Auch […] hadert und kokettiert Gernhardt mit seiner Rolle“ oder wenn er Gernhardts „Neid auf die von den großen Feuilletons favorisierten Kollegen“ feststellen will.207
An dieser Stelle soll erwähnt werden, daß Gernhardt sich in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen explizit zu Grünbeins Gedicht „Biologischer Walzer“ geäußert hat und das in anerkennender Art und Weise. Das Gedicht sei ihm ein „liebes Gedicht“, das sich aus dem regellosen Einerlei der zeitgenössischen Lyrik wohltuend heraushebe, da es einer Regel folge, ihm nämlich der Rhythmus eines Walzers zugrunde liege. Außerdem habe Grünbein in diesem Gedicht Zeilen geschaffen, „die das Zeug zu Hammerzeilen“ hätten. Gernhardt erfaßt mit dem Schlagwort „Hammerzeile“ solche Zeilen, die Dichtern nur selten während ihrer gesamten Schaffenszeit gelingen, Zeilen, die sich einprägen und die Zeiten überdauern.208
Die Kritik allerdings beachtet weniger Gernhardts Sympathie bezeugenden Worte als vielmehr seine Unverfrorenheit, einen Star wie Grünbein zu verbessern. Gernhardt hatte für eine Zeile der zweiten Strophe in Grünbeins Gedicht einen Verbesserungsvorschlag gemacht, da sie als einzige im Original aus dem Rhythmus fällt. Für Auffermann handelt es sich um „Diffamierungen der Kollegen“,209 für Christoph Schröder um eine „Demonstration der eigenen Stärken“ und ein „Herumbasteln“, bei dem man „mit viel gutem Willen […] noch einen selbstironischen Unterton heraushören“ konnte.210 Nachdem Gernhardt seit über zehn Jahren das Projekt „Darf man Dichter verbessern?“ durchaus ernsthaft verfolgt und seine Vorschläge fundiert begründet, kann man nicht davon ausgehen, daß es sich um eine scherzhafte, rein zur Unterhaltung bestimmte Angelegenheit handelte; zumal gerade die Überprüfbarkeit von lyrischen Gebilden eine von Gernhardts ältesten Forderungen und eng an seine Verteidigung des Reims und anderer Regeln geknüpft ist. 1989 hielt er ein Seminar im Nordkolleg Rendsburg ab, dessen zweite Sitzung unter der Frage stand „Kann man Gedichte verbessern?“,211 welche 2001 in der Frankfurter Poetikvorlesung unverändert wiederkehrte.212 Es scheint Gernhardt am Herzen zu liegen, Studenten oder Seminarteilnehmern unreflektierte Ehrfurcht auszutreiben, auch damit sie nicht „durch Schweigen über so viele Ungereimtheiten mitschuldig werden an der verstörenden Friedhofsruhe, in welcher die ganze Gattung zur Zeit dahindämmert“.213 In Praxis und Theorie vertritt er den Standpunkt, Gedichte zu verbessern sei kein Sakrileg, da die Originale unversehrt bleiben, es wird ihnen lediglich eine Alternative an die Seite gestellt.214 Diese Alternative orientiert sich an konkreten Regeln und möchte durchaus eine Steigerung erzielen. Laut Hagestedt hat Gernhardt
einen handwerklichen, pragmatischen Zugang zur Lyrik, er rückt ab vom ,Kunst ist ewig‘-Postulat, er glaubt nicht, daß der Dichter ,es‘ nur so und nicht anders habe sagen können, er vertritt im Gegenteil die Auffassung, daß sich Gedichte verbessern lassen […]215
Die Argumentationskette ist aber dahingehend unschlüssig, als gerade im Vorgang des Verbesserns die Ansicht zutage tritt, daß der Dichter „es“ anders hätte sagen sollen, um möglicherweise ein untadeliges Gebilde zu produzieren, ein Gebilde, „gut gefühlt, gut gefügt, gut gedacht, gut gemacht“.216 So wie „es“ zunächst gesagt wurde, war es Gernhardts Meinung nach nicht richtig, die ursprüngliche Gestalt ist nicht eine andere Möglichkeit, wie man es auch hätte ausdrücken können, sondern eine schlechtere.
Gernhardt möchte dem Mythos entgegenwirken, daß der Lyriker grundsätzlich dem normalen Menschen um Längen voraus ist und die Geheimnisse der Welt besser durchschaut. Aber immer noch scheint uns derjenige ernstzunehmender, der sich aufgrund außerordentlicher Erfahrungen aus dem Durchschnitt heraushebt. So ist Gernhardt möglicherweise passiert, was er ironisch in Gedanken zum Gedicht formuliert: daß private Schicksalsschläge wie zum Beispiel der Tod seiner ersten Frau oder seine Herzoperation seinem Werk „den Stempel der Authentizität [verliehen]; wer derart von der Kelter des Lebens gepreßt worden war, der mußte ja etwas Essentielles abgesondert haben.“217
Die Resonanz auf Lichte Gedichte ist im wesentlichen eine Reaktion auf Kapitel IX „herzlich“. Es gibt keine Rezension, die den „Herzgedichten“ nicht besondere Aufmerksamkeit und besonders viel Raum schenken würde, und gut die Hälfte bezieht sich bereits in Titel oder zumindest Untertitel auf diesen Teil. Halter sagt ausdrücklich, „so zynisch es klingen mag: Die Operation hat Robert Gernhardt gutgetan.“ Einige Gedichte aus den anderen Abteilungen von Lichte Gedichte seien nämlich bloß noch routiniert und würden mit großer Kunstfertigkeit „ein gedankliches Nichts“ vertuschen. In „Herz in Not“ aber, wo der Autor existentielle Erfahrungen verarbeite, wo wichtige Gedanken zu transportieren seien, da gelinge es ihm wieder, die Sprache genau, treffsicher und sparsam einzusetzen.218 Gernhardt beweist der Welt, daß er ein wahrer Dichter ist, weil er im Angesicht des Todes schreiben muß.
Gernhardt holt den Alltag ins Gedicht, die kleinen Ereignisse, die Klischees, die großen Einschnitte, jegliches Gefühl vom Minderwertigkeitskomplex bis zum Größenwahn, alle Stadien von Liebe und Leid. Er bedichtet ein Interview mit Steffi Graf oder ein Tennisendspiel von Boris Becker, er schreibt ein „Diät-Lied (mit Ohrfeigenbegleitung)“219 oder über eine Rolle Klopapier. Diese Gedichte werden besonders oft in den Kritiken genannt, um zu illustrieren, daß es für Gernhardt nichts gibt, woraus er kein Gedicht machen könne.220 Dabei wird nicht untersucht, wie die Themen verarbeitet werden, die Rezensenten beschränken sich auf die Feststellung, daß die Verse leicht klingen. Aber sind sie wirklich „ohne jeden Tief- und Hintersinn“221 entstanden? Greifen sie nicht zielsicher den Tennisboom Mitte der 80er Jahre in Deutschland auf und holen die „deutschen Helden“ von ihrem Podest, indem sie die Banalität eines Interviews oder die Belanglosigkeit eines Sieges offenbaren?
Die Literaturkritik ist einhellig der Ansicht, Gernhardt sei kein Streiter für gesellschaftliche und soziale Veränderungen und mit seiner persönlichen Stellung zufrieden. Halter stellt fest, „die gesellschaftskritische Lyrik war noch nie sein Ding“, obwohl er in der gleichen Rezension Gernhardt zitiert, der noch jedem Witz eine eindeutige Absicht unterstellt, unter anderem die Absicht, den Menschen die Augen zu öffnen, Partei zu ergreifen, lachen zu machen.222 Liefe eine derartige Wirkung nicht auf gesellschaftliche Veränderungen hinaus? Oder beschränkt sich Gernhardt auf das Lachen machen?
Gernhardt selbst äußert sich diesbezüglich vorsichtig: sofern er ein Teil der Gesellschaft sei und sich selbst kritisiere, mache er auch Gesellschaftskritik. Einen eher abgerückten Standpunkt wie der Satiriker nehme er nicht ein. Seine Gedichte seien Reaktionen auf gesellschaftliche und politische Ereignisse, die ihn selbst beträfen. Bereits zu Pardon-Zeiten hätte er sich der Rolle des Satirikers, „der den Finger hebt und sagt: ,das ist falsch und nun bessert Euch!‘ nicht ganz gewachsen gefühlt“ und in der Welt im Spiegel die Möglichkeit ergriffen, den Gestus des Strafenden zu persiflieren.223 Gleichwohl veröffentlichte er politisch-satirische Glossen. Gernhardt spricht diesbezüglich von zwei Seelen, die in seiner Brust wohnen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, er möchte – durchaus kritisch – „auf die Zumutungen des Lebens reagieren und Spaß dabei haben“.224 In diesen Zusammenhang paßt auch die vielzitierte Aussage Gernhardts, daß er sich immer denjenigen zugerechnet hat, „die sich am Nebentisch wohl fühlen“, weil sie von dort unbeobachtet beobachten können.225 Für Gernhardts Lyrik, die von der Reaktion auf die Gesellschaft lebt, ist die Position des Nebentischs sicher wichtig. Bei aller Einsicht, daß zum ungestörten Beobachten ein sich Bescheiden gehört und man „selber natürlich weniger wahrgenommen“ wird, ist ein Hauch von Bedauern spürbar, wenn Gernhardt sagt:
Das muß man in Kauf nehmen, nimmt man auch gerne in Kauf.226
Die nachgeschobene Versicherung könnte durchaus darauf hinweisen, daß er, bildlich gesprochen, wenigstens auf den Oscar für die beste Nebenrolle hofft.
Britta Malpricht, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, Fischer Taschenbuch Verlag, 2002
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + IMDb + KLG + Archiv +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.


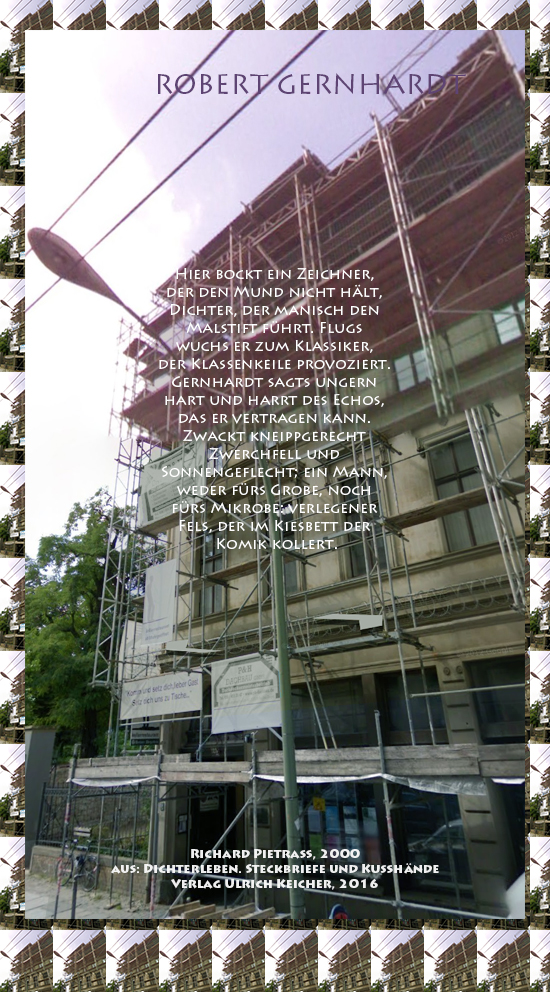












Schreibe einen Kommentar