Robert Gernhardt: Wörtersee
WAS IST ELEKTRIZITÄT?
Dorlamm, um ein Referat gebeten,
hält es gern, um dies hier zu vertreten:
„Wenn das Ohm sie nicht mehr alle hat,
heißt es nicht mehr Ohm, dann heißt es Watt.
Jedoch nur, wenn’s gradeliegt, liegt’s quer,
heißt es nicht mehr Watt, dann heißt’s Ampere.
Heißt Ampere, ja, wenn es liegt, nicht rollt,
rollt es nämlich, nennen wir es Volt.
Rollt ein Volt nicht mehr und legt sich quer,
heißt es wieder – wie gehabt – Ampere.
Heißt Ampere, wenn sperrig liegt, liegt’s glatt
wird es – na wozu wohl schon? – zum Watt.
Wird zum Watt, zur Maßeinheit für Strom,
wenn’s nicht alle hat. Sonst heißt es Ohm.“
Dorlamm endet, um sich zu verneigen,
doch er neigt sich vor betretnem Schweigen.
„Glaubt es nicht“, ruft Dorlamm, „oder glaubt es –
mir egal!“ Und geht erhobnen Hauptes.
Von den Gedichten und Bildergeschichten,
die Robert Gernhardt 1981 unter dem Titel Wörtersee zusammengefaßt hat und die seitdem mehrere Auflagen erlebten, sind viele zu Legenden geworden: „Bilden Sie mal einen Satz mit pervers – Ja, meine Reime sind recht teuer: per Vers bekomm ich tausend Eier.“ Immer wieder zitiert, sind sie eingegangen in den deutschen Sprachschatz wie manche Cartoons von Loriot. Loriot und Robert Gernhardt – wie früher Wilhelm Busch haben sie Text und Bild in ein unzertrennbares, Auge und Ohr gleichermaßen betörendes Ganzes verwandelt. Die Komik der Gernhardtschen Texte und Zeichnungen beruht auf einer Gratwanderung zwischen Sinn und Unsinn, Feinem und Derbem, Ernst und Spaß. Daß sich die Gedichte auf Vorbilder beziehen, auf Autoren genauso wie auf literarische Formen, ist ein Indiz unter vielen dafür, daß sie kunstvoller sind, als sie zunächst scheinen. Der Reiz dieser berühmt gewordenen Gedichte und Bildergeschichten des neugierigen Sprach- und Zeichenkünstlers Robert Gernhardt liegt in ihrer klugen, kritischen Geistesgegenwart bei gleichzeitig höchstem Unterhaltungswert: „Bilden Sie mal noch einen Satz mit Garant – Der Hase trug den Kopfverband, seitdem er an die Wand garant.“
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1996
Im „Weißen Rüssel“ am Wörtersee
Am Tag als Robert Gernhardt starb, beziehungsweise kurz danach, titelte DIE WELT:
Plötzliche Stille im Wörtersee
Es liegt noch gar nicht so lange zurück, dass Robert Gernhardt von uns ging. Er schrieb vornehmlich lustige Gedichte. Im Bereich der deutschsprachigen Lyrik wurde er zu einem der bekanntesten Dichter der letzten Jahrzehnte. Selbst der Rhein-Neckar-Poet (Rezensent der vorliegenden Kritik) sah in ihm seinen Meister, sein Vorbild. Vieles von dem was Robert Gernhardt reimte und zeichnete – ja, Gernhardt war auch so was wie Cartoonist (er wäre gerne ein zweiter Wilhelm Busch geworden) – fasste er in seinem 1981 erstmals veröffentlichten Büchlein Wörtersee zusammen.
Ein Großteil seiner Wörtersee-Gedichte sind, so sagt man, inzwischen Legende. Wir finden den „Bilden.Sie.mal.einen.Reim.auf“-Zyklus, das schöne „Doch da ist noch ein Falter“ (eine klare Anspielung auf das berühmte „Danach“ von Kurt Tucholsky), das Wortspiel „Der Mördermarder“, die Ballade „Das Scheitern einer Ballade“, den Zyklus über den Dichter Dorlamm (wers’n das?), „Als er sich mit vierzig im Spiegel sah“ und viele, viele andere. Ein besonderer Leckerbissen: „Der große und der kleine Künstler“.
Wörter aus dem See, zu Sätzen gebildet, zu Versen geformt, zu Reimen geschmiedet, die für sich alleine betrachtet große kleine Literatur darstellen:
Denkt euch, ich habe den Tod gesehn,
es ging ihm gar nicht gut.
Plötzliche Stille im Wörtersee!? Doch diese Stille wird nicht lange währen. Vertraue darauf: wir werden die Wellen am wogen halten. „Drum rudere und dichte weiter im Dienste dieses Schiffes“, heißt es beim Rhein-Neckar-Poeten in seiner „Antwort an Czesław Miłosz“. Denn: Sollten Schiffe untergehen, sinken in die Tiefen der Baltischen See, versinken in den Untiefen des Mains bei Frankfurt, hinabgerissen in die Fluten des Wörtersees, so wird es Robert Gernhardt sein, der immer wieder auftaucht…
Helmut Schmid, amazon.de, 22.6.2007
Vielseitigkeit eines großen Künstlers!
Einer der beliebtesten Gedichtschreiber und Zeichner, Satiriker, Karikaturist und Spötter unter den neuen deutschen Dichtern hat uns vor zwei Jahren verlassen. Er starb am 30. Juni 2006 im Alter von 68 Jahren an Krebs.
Mit unzähligen Preisen ausgezeichnet hat er ein immenses Werk hinterlassen.
Im Taschenbuch des Fischerverlages findet man eine charakteristische Auswahl mit Zeichnungen und Gedichten des beliebten Künstlers.
Er kannte die Menschen, war Psychologe, Philosoph und Geschichtenerzähler in einem. Lyrisch und makaber, bissig und verständnisvoll, liebevoll und sarkastisch, vor allem aber humorvoll: in seinen Gedichten findet man die eigenen und die Schwächen der anderen verdichtet, und schon aus diesem letzten Wort könnte er wieder zu einem Reim finden!
Er hat andere hoch genommen und sich selbst nicht geschont. Er konnte lachen und weinen machen und dem Leben die heitere Note belassen. In ihm finden wir Spuren von Morgenstern und Ringelnatz wie z.B. in dem Gedicht „Sonntag“.
Der See ist blau, der Wald ist grün,
durch gelbe Felder Rehe ziehn.
Dann sind da Menschen vielgestalt
und buntgekleidet in dem Wald.
Und schaun hinüber zu dem See
Und sagen: läuft da nicht ein Reh?
Zuletzt folgt der Vers:
Die Sonne steht am Himmelszelt,
ein Glück, dass sie nicht runterfällt.
Orthographie wird zugunsten der Dichtkunst abgewandelt, damit alles seine Richtigkeit hat.
Hinter der naiven Betrachtung steckt die pfiffige Erkenntnis, dass auch die einfachen Freuden dem Dichter Anlass zur Komik boten.
In den Gedichten: „Die Nacht“, „Das Glück und der Tod“ sind komische und weise Gedanken zu finden, die zuletzt immer mit einem Kick versehen sind, der ihnen die Melancholie und den Trübsinn nimmt.
Das Taschenbuch aus dem Jahr 1996 bietet die ganze Palette seiner Fähigkeiten als Zeichner, Komiker und Beobachter.
Zuweilen hat man den Eindruck, dass ihm keine Situation, keine Erkenntnis über das menschlich Allzumenschliche entging. Unermüdlich strömen die Verse und Einfälle aus seiner Feder. Aus dem Nichts zaubert er Allegorien auf das Leben, und er erweist sich als unerschöpfliches Genie.
Zu Lebzeiten schien er allgegenwärtig: als Poet, als Dichterfürst, als Lehrender, Vortragender und allzeit Lernender. Seine Poetik-Lesungen boten Glanzpunkte seines Könnens. Er wurde von einem breiten Publikum geliebt, verehrt und bewundert.
Wer sich mit ihm beschäftigen möchte, dem sei dieses kleine Taschenbuch ans Herz gelegt, erbaulich und köstlich und schließlich auch erschwinglich!
cl.borries, amazon.de 13.6.2008
Fug und Unfug für Fortgeschrittene
Dass Robert Gernhardts Gedichtbändchen Wörtersee noch nicht öfter rezensiert wurde, wundert mich auch. Deswegen werde ich jetzt Abhilfe schaffen und hier eine zweite Lobeshymne auf einen der größten deutschen Wortverdreher erklingen lassen…
Lyrikbände haben mich bislang selten begeistert, da ich Gedichte eher einzeln zu schätzen weiß. Wörtersee mit seinen Aneinanderreihungen von skurrilen bis aberwitzigen Einfällen, illustrierten Reimen und Parodien auf bekannte Dichter und Kunstformen bildet da eine sehr vergnügliche Ausnahme.
Gernhardt macht wirklich vor nichts halt, weswegen man hier für fast jede Lebenslage das geeignete Spottgedicht finden kann. Ich empfehle zum Beispiel „Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs“ (ein Schmähgedicht über Sonette in vollendeter Sonettform) für Germanistikseminare oder „Nimm und lies (die drei Berufungen des Kirchenvaters Augustin)“ zur Auflockerung von Konfirmandenstunden. Allzu trockenen Physikunterricht könnte man sehr schön mit „Was ist Elektrizität?“ bereichern. („Wenn das Ohm sie nicht mehr alle hat / heißt es nicht mehr Ohm, dann heißt es Watt…“)
Meine Begeisterung für dieses Buch hat mir schon viele entgeisterte Blicke eingetragen, wenn ich unaufgefordert daraus rezitierte. Aber letztendlich habe ich sie alle zum Lachen bringen können, man braucht nur für jeden das passende Gedicht.
Wer sich also respektlos behandelte Dichterfürsten und verwurstete Motive aus der Weltliteratur (meine Lieblingsstelle: „Begegnung mit einem Geist“, und zwar mit dem, der stets verneint) interessiert und auch sonst Nonsens mag, der kommt hier voll auf seine Kosten. Einen Punkt Abzug bekommt Wörtersee dafür, dass mich nicht ausnahmslos alle Verse begeistern, aber die Auswahl ist immer noch groß genug. Dieses Buch ist also trotzdem noch sehr zu empfehlen!
Amazon Customer, amazon.de, 19.2.2004
„Und aus des toten Recken Hose…
….wuchs eine kleine Heckenrose“.
Man muss sie einfach mögen, die Gedichte und Albernheiten Robert Gernhardts. Stets hat man bei dem studierten Germanisten den Eindruck, die Gedichte irgendwoher bereits zu kennen: Sind doch viele seiner Werke angelehnt an die klassische Literatur und Lyrik. Nur dass sie bei Gernhardt früher oder später gegen den Strich gebürstet, entfremdet, auf den Kopf gestellt, oder – zumindest – mit einem völlig unerwarteten Ende versehen werden.
Gernhardts Humor ist teilweise dem von Loriot nachempfunden, jedoch ist er überraschender, chaotischer und anarchistischer, manchmal auch profaner. Auf alle Fälle sorgt der Humorist für kurzweilige und anregende Leseunterhaltung, die in ihrer sinnfreien Zeitlosigkeit sicherlich noch viele Generationen anhalten wird.
So endet auch diese Rezension mit einer gernhardt’schen Lebensweißheit:
Paulus schrieb den Irokesen: Euch schreib ich nichts, lernt erst mal lesen.
weinundkäse, amazon.de, 4.5.2010
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Werner Burkhardt: Ein Punk-Sonett im Wörtersee
Süddeutsche Zeitung, 24./25.10.1981
Kleine Formen, großer Witz
– Der populäre Vers bei Robert Gernhardt. –
Vorbemerkung des Herausgebers
Klaus Stieglitz hat die vermutlich erste Monographie über Robert Gernhardt geschrieben. Er kam mit Gernhardt ins Gespräch, als seine Magisterarbeit über das „komische Verfahren in den Gedichten“ 1988/89 entstand. Stieglitz hinterließ, als er 1991 bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam, ein Bündel Gedichte, darunter eines mit der anrührenden Überschrift: „Für Robert Gernhardt. Dichter Dorlamm in: Eine große Erfindung“. Es nimmt Bezug auf den Zyklus der „Dorlamm“-Gedichte aus Wörtersee, der wiederum auf Ror Wolfs Zyklus „waldmanns abenteuer“ zurückgeht:
waldmann stößt auf einen dunklen fleck:
der baron verschwunden, fort und weg
ror wolf
Dichter Dorlamm tritt in ein Lokal,
und er sagt sich: Na, dann wolln wir mal!
Robert Gernhardt
Dichter Dorlamm setzt sich an den Tisch
und da liegt ein blütenweißer Wisch
Klaus Stieglitz
Stieglitz’ Gedichte wurden aus dem Nachlaß herausgegeben, und Gernhardt steuerte ein Vorwort bei: Fackellauf. Dort heißt es:
Da ist eine Fackel von Hand zu Hand gereicht worden, und die triste Pointe dieser Stafette besteht darin, daß ausgerechnet Klaus Stieglitz, der jüngste und letzte Läufer, es nicht mehr erleben kann, ob diese Fackel noch einmal aufgegriffen wird, und wer sie wohl wem weiterreichen könnte.1
Klaus Stieglitz’ Gedichtband erschien unter dem Titel Vielleicht war alles umsonst, aber wir hatten ein gutes Gefühl. Aus seiner Magisterarbeit schließt sich hier ein leicht gekürztes Kapitel an. Sie soll nicht umsonst gewesen sein, das gibt uns ein gutes Gefühl.
Die kleinen Formen, Zwei- und Vierzeiler (paar- oder kreuzgereimt), nehmen in den Gedichten Gernhardts eine besondere Stellung ein. Ihre Bündigkeit erlaubt eine schnelle, umstandslose Hinführung zum Witz. Sie sind leicht rezipierbar und dementsprechend leicht weiterzuerzählen. Dieser Aspekt macht sie zum komischen Gebrauchsgegenstand – zum Verswitz.
Wie die Volkspoesie greifen viele Kurzgedichte Gernhardts große Themen auf, um sie tabuverletzend zu brechen. Kirche, Politik, Philosophie, Geschichte und Kultur werden auf ein Maß an Überschaubarkeit zurückgeführt, das es ermöglicht, sich von der Last ihrer Autorität zu befreien. Die Relativierung des Bedeutenden bleibt in der Dichtung Gernhardts im Gegensatz zum Volksmund eher verhalten. Grobe Gesten sind ihr ebenso fremd wie vernichtender Hohn. Spöttisch-Satirisches mischt sich mit einem menschlichen Blick auf die Dummheiten und widersinnigen Zustände, in die man oft genug selbst verstrickt ist.
Wenn diese Verse zwar weniger mit dem Mittel der Entlarvung von Werbeslogans, Schlager-Geplapper und Klassikersprache arbeiten, wie es die Volkspoesie tut, haben sie mit dem Volksmund doch den entscheidenden Lachgrund gemeinsam: die Schadenfreude. Sie kommt auf, wenn die unantastbare Autorität eins auf die Nase kriegt. So werden etwa Klassengegensätze auf einen von aller Schönfärberei befreiten, eindeutigen und schlüssigen Nenner gebracht:
HERR UND KNECHT
Der Herr rief: „Lieber Knecht,
mir ist entsetzlich schlecht!“
Da sprach der Knecht zum Herrn:
„Das hört man aber gern!“2
Ungeachtet des satirischen Impulses bleibt der Vierzeiler ohne Tendenz in dem Sinne, daß er keine konkrete Analyse der Gesellschaft liefert und damit politische Handlungsanleitung verbindet. Die Art, in der der Klassengegensatz angegangen wird, stellt sich als Anachronismus dar. Während die Gesellschaftsstrukturen heute einem zunehmenden Verschleierungsprozeß unterworfen sind, erinnert die Gegenüberstellung von Herr und Knecht an eine vorindustrielle Zeit, wo die Zustände noch klar und eindeutig benennbar waren.
Analog verfährt ein weiteres Gedicht, in dem allerdings das konkrete Personal hinter Abstrakta zurücktritt, die wiederum vermenschlicht werden und miteinander sprechen:
BASIS UND ÜBERBAU
Die Basis sprach zum Überbau:
„Du bist ja heut schon wieder blau!“
Da sprach der Überbau zur Basis:
„Was is?“3
Die marxistischen Termini werden ihrer Theorielastigkeit entkleidet und zu handelnden Personen vereinfacht. So entpuppt sich der Überbau als fauler, nichtsnutziger Trinker, der von der Basis wegen seines Lasters gescholten wird. Durch das mit alkoholisiertem Zungenschlag gelallte „Was is?“ stellt sich der Überbau ins Abseits. Der Bruch des drei Zeilen lang durchgehaltenen metrischen Schemas (vierhebiger Jambus) zum trochäischen Einakter signalisiert die schlechte Verfassung des Überbaus, der nicht einmal mehr die einfache Ordnung eines alternierenden Verses einhalten kann.
Die reale Macht wird der Lächerlichkeit preisgegeben, weil sie nicht mehr so übermäßig groß erscheint, sondern klein, hilflos, fehlerhaft, mit einem Wort: menschlich.
Als angreifenswert und der Entlarvung bedürftig gilt dem
Volksmund schlechthin alles Hochgestellte, Ehrwürdige,
Verbrämte, feierlich Getragene, idealistisch Aufgestockte.4
Berührungspunkte mit den Pfarrerversen, parodistischen Klassiker-Adaptionen, dreisten Verballhornungen von Amt- und Würdenträgern weisen, wie bereits gesehen, auch zahlreiche Gedichte Gernhardts auf. An den Sockel ehrwürdiger Denkmäler zu pinkeln, Autoritäten aus ihren geweihten Tempeln zu zerren und sie in die Umgebung profaner Ereignisse, einfacher Handlungen, menschlicher Triebe und Wünsche zu setzen, stellt ein stets wirksames Lustmoment dar. Die Freude, die sich im Akt des Herabsetzens, des Entkleidens ausdrückt, rührt immer wieder aus der im Märchen formulierten Erkenntnis „Der Kaiser ist ja nackt“, er sieht genauso aus wie wir, hat die gleichen Fehler und Laster und nichts außer seiner Position unterscheidet ihn von einem ganz normalen Menschen.
Je entrückter die Autorität, je vermessener ihr Anspruch, desto tiefer ihr Fall. Das gilt namentlich für die Religion bzw. für deren zum gesellschaftspolitischen Machtfaktor geronnenen Organisationsform Kirche. Trotz ihrer verblassenden Wirkung gibt sie immer noch eine beliebte Folie für tückische Späße ab:
ÖKUMENISCHER DIALOG
„Trinken ist ein Laster –
ist das klar, Herr Paster?“
„Alles klar, Herr Kaddinal –
dassselbe bidde nocheinmal!“5
Formal lehnt sich dieses Gedicht an die beiden besprochenen Vierzeiler an. Bei den Dialog-Vierzeilern stehen sich immer zwei Positionen/Kontrahenten gegenüber, der für die Komik notwendige Antagonismus liegt bereits im Personal vor, ebenso die Gemeinsamkeit: denn die widerstreitenden Kräfte sind einander verwandt. Sie gehören entweder der gleichen Sphäre an oder entstammen einer Redewendung6 und erzielen so Stimmigkeit.
Im ökumenischen Dialog stehen sich keine verschiedenen Gesellschaftsschichten gegenüber, sondern zwei Vertreter der christlichen Kirche, der katholischen und der evangelischen. Das Zusammentreffen der rivalisierenden Kräfte gleichen Glaubens findet statt unter dem Leitspruch der Verständigung. Indessen erweist sich die Überschrift als Euphemismus, gerät das Bestreben der Einigung christlicher Konfessionen zum Stammtischdisput, dessen Qualität mit fachtheologischen Auseinandersetzungen nichts gemein hat. Leutselig wird der strengen Mahnung stattgegeben, allerdings in einer Art, die die Autorität sogleich unterläuft und ihr zu verstehen gibt, daß sie mit ihren weltfremden Vorstellungen höchstens die Einladung liefert, sich ihr zu widersetzen. Die gewitzte Antwort des Pastors entspringt daher der gleichen Lust auf Opposition wie die clevere Bemerkung des Knechtes, dessen Schadenfreude durch den höflich-zurückhaltenden Ton doppelt witzig wirkt. Beide vertreten Volkstümlichkeit, zeigen sich der Obrigkeit überlegen, indem sie mit Sprachwitz einen intellektuellen Vorsprung bekunden. Interessant in dieser Hinsicht ist die unterschiedliche Bewertung des Alkoholgenusses. Während im vorigen Vierzeiler der Überbau nicht mehr durchblickt – das Schlimmste, was ihm passieren kann –, ist der Pastor, trotz seines angeschlagenen Zustands, völlig Herr der Lage. Dem Überbau gereicht die negativ bewertete Trunksucht zum Nachteil, weil sein ansonsten auf Hochglanz poliertes Niveau absinkt, auf ein Feld, das er nicht mehr bestellen kann, er ist entlarvt und kann dem Gelächter übereignet werden. Dagegen gleicht der Pastor dem Schelm, der sich mit List und Gerissenheit auch beim Gegner noch einen Vorteil erschleicht. Daß sich nun gerade der Titel der katholischen Eminenz auf die formelhafte Bestellung des nächsten Schoppens reimt, zieht den Würdenträger vollends ins Lächerliche. Bei aller Gegensätzlichkeit der Bereiche und trotz des Widerspruchs stiftet der Reim klanglich Einheit, gaukelt Einverständnis vor – mithin ein Fall von lautmalerischer Ironie, denn die Bestätigung des Pastors steht in krassem Gegensatz zu der Art und Weise, wie schnittig-elegant sich das „nocheinmal“ an den „Kaddinal“ ranschmeißt, ja fast anschmiegt, um sich lieb Kind zu machen. Wie er es auch treibt, der Reim bleibt Unschuldsengel und lacht sich ins Fäustchen.
Erst dem Reim ist es gegeben, einen tollen Einfall haltbar zu machen, einen Witz überlieferungswürdig. […] Ganz allgemein fällt dem Reim in der Umgangspoesie eine hervorragende Schlüsselrolle zu. […] Zum einen dient er offensichtlich als Transportgerät, als Bindemittel, als Gedächtnisstütze, d.h. er erfüllt gewisse technische Voraussetzungen der Nachrichtenübermittlung; zum andern […] wohnt ihm eine selbständige Beweiskraft inne, stellt er ein Argument dar, einen schlüssigen Beleg, der faktisch durch nichts zu widerlegen ist – es sei denn durch Gegenreime. […] der Volksgeist […] gibt auch dem Reim etwas von seinem eigenen zwinkernden Mißtrauen mit auf den Weg, von seinem mangelnden Wunderglauben, seiner Spottlust, seiner Arbeiter- und Bauernschläue.7
Die Nähe zur Volkspoesie ist bei den besprochenen Versen unverkennbar.8 Was sie davon abhebt, ist die Tatsache, daß ihnen alles Zotige und Ordinäre abgeht. Auch sind sie stimmig durchkomponiert, es fehlt ihnen das Kantige, Ungeschlachte. Zwar dominiert ein einfacher Rhythmus, doch der mühelose, flotte Tonfall verschleiert die Schwierigkeiten der Reimfindung, die in der Volkspoesie des öfteren durchschlagen. Religionsverwalter und andere Sittenwächter sind das beliebteste Opfer obszöner Witze, deren Inhalt sich in der Regel gegen den kirchlichen Sittenkodex und verlogene Doppelmoral richten. Aber der Spaß an der freizügigen Darstellung sexueller Vorgänge muß sich nicht unbedingt gegen irgendeine Autorität wenden. Er kann auch purer Lebensfreude entspringen, die den Sachverhalt ohne Wertung ausspricht:
Das Vorspiel nahm den Hengst so mit,
daß er geschwächt zu Boden glitt.9
Da ist nun nichts von der Disparatheit zweier Bereiche zu spüren, die Gernhardt in einer Humorkritik10 über die Verse des „Goldenen ABC“ als Voraussetzung für komische Wirkung nennt. Um wieviel drastischer klingt folgender Zweizeiler aus dem erwähnten ABC:
Des Quäkers Leben ist geregelt,
Es quatscht, wenn man im Wasser vögelt.11
Abgesehen davon, daß der formale Aufbau der Gedichte ganz unterschiedlich verläuft (der erste Zweizeiler steigt gleich in sein Thema ein, während der zweite die Aufmerksamkeit zunächst auf einen anderen Bereich lenkt, um sodann eine überraschende Wendung zu vollziehen, die den Angehörigen einer puritanischen Religionsgemeinschaft mittels Reim hämisch in eine bloßstellende Gemeinschaft bringt), drehen sich beide um das gleiche Thema: Sexualität. Und das wird im zweiten Beispiel wesentlich direkter, drastischer angegangen. Ohne Umschweife oder umschreibende Formulierungen wird die Sache beim Namen genannt. Die befreiende Wirkung von Derbheit und Plumpheit konstatiert auch Köhler12 in bezug auf die häufig Verwendung tabuverletzender Motive im modernen Nonsens und belegt das an einem anderen Muster aus den „Animalerotica“ von Gernhardt:
Der Wal vollzieht den Liebesakt
zumeist im Wasser. Und stets nackt.13
Auch wenn diese Verse zu ihrer Entstehungszeit14 noch mit Bemerkungen wie Bierulk und Herrenwitz15 abgetan wurden, zeigen sie doch einen anderen, zurückhaltenderen Umgang mit dem Thema als das „ABC“ und die populären Reime des Volksmunds.
Rühmkorf listet eine ganze Reihe von Beispielen auf, denen es an deftigen und groben Ausdrücken nicht mangelt. Wörter wie „Ritze“, „Eier“, „Loch“, „stoßen“, „ficken“ usw. sind keine Seltenheit; bei Gernhardt sucht man sie vergeblich.16 Als derb und plump lassen sich seine kleinen Gebilde sicher nicht bezeichnen. Verstärkt kommt hier zum Ausdruck, was Rühmkorf bezüglich des Kinderverses als „Sublimierung ins Humane“17 gedeutet hat. Die verbale Provokation ist in der Sammlung der Animalerotica derart abgeschwächt, daß die Tabuverletzung als entscheidendes Kriterium für die zustandegekommene Komik ausscheidet. Zudem entbehren die Situationen jeglicher Realität. Ihre Transposition ins Tierreich kennzeichnet sie als spaßiges Spiel und weist sie als harmlos aus.18 Der Geschlechtsakt des Tieres gilt nicht als anrüchig, da es sich im ursprünglichen Zustand natürlicher Unschuld befindet. Erst die lange Zivilisationsgeschichte der Menschheit führte zu Triebregelungen und Restriktionen und verlegte die Sexualität in einen außeröffentlichen Bereich, wenn sie sie nicht gleich zur Tabuzone erklärte. Erst eine neuerliche Verschiebung auf eine fiktive Ebene – sei sie nun zeitlich, räumlich oder biologisch definiert – macht es möglich, den Sachverhalt auszusprechen, ohne Anstoß zu erregen.19
Ob eine Zote geschmacklos ist oder ob sie zum Lachen reizt, das hängt nach Gernhardt weniger mit dem Inhalt als mit der Form ihrer Präsentation zusammen, dergestalt, „daß nicht nur das Kitzeln subjektiver Ähnlichkeiten oder Obsessionen den Lacher bewirkt, sondern ebenso sehr, wenn nicht vor allem, die Beachtung objektiv gültiger Witzgesetze“.20 Dabei geht es Gernhardt nicht um eine Klassifizierung in ,derber‘ und ,feiner‘. Das „Nichtanerkennen der Unterschiede zwischen dem Fein- und Grobsinnigen“21 ist für Gernhardt und den versammelten Kreis der sogenannten Neuen Frankfurter Schule ein bis heute gültiges Anliegen. Daraus folgt ein bewußtes Spielen mit Niveaubarrieren, das Verknüpfen umgangssprachlicher Redewendungen mit der hohen Form des Gedichts, das Zusammentreffen von Kalauer und ,geistreichem‘ Witz, woraus eine spannungsvoll kontrastierende Komik entsteht. Dennoch enthalten die Gedichte Gernhardts keine wirklichen Zoten, der nur scheinbar plumpe Einsatz niederer Themen und Wörter gestaltet sich vielmehr als sehr differenziert und kunstvoll, so daß man davon sprechen kann, das sie „ebenso ins Volkstümliche zielen, wie sie die Intellektuellen erfreuen“.22
Im Gegensatz zu den Volksversen richten sich diese Gedichte nicht direkt gegen Autoritäten. Sie sind nicht aggressiver Ausdruck eines unterdrückten Individuums, das sich mit Spottversen von Zwängen und Verlogenheiten zu befreien sucht. Diese Einschätzung legen auch die immer wiederkehrenden Themen wie Kirche und Adel nahe – Erscheinungen, denen heute keine machtpolitische Bedeutung mehr zukommt:
Witze über Religion werden in dem Maß fad, wie die Inhalte der Religion oder die Taten der Religionsverwalter das Ich nicht mehr nachhaltig belasten oder bedrücken können.23
Trotz dieser Argumente empfindet man die angeführten Gedichte als komisch. Wenn also weniger die Tabuverletzung zum Lachen reizt, erhebt sich die Frage, worüber und weshalb dann gelacht wird. Zur Klärung dieser Frage möchte ich das obige Wal-Poem heranziehen.
Formal fällt zunächst auf, daß die Reimwörter für sich genommen weder besonders komisch sind noch konträren Gebieten entstammen (der Liebesakt wird im allgemeinen eben nackt vollzogen). Auch die Erkenntnis, daß dies im Wasser stattfindet und in Wal unbekleidet ist, ist hochgradig trivial. Wir haben es also offensichtlich mit einer Antipointe zu tun, die die Erwartungshaltung nach einer plötzlichen Verbindung zweier unterschiedlicher Ebenen unterläuft. Dessen ungeachtet, erzeugt diese Konstellation eine amüsante Spannung, die im wesentlichen aus einem sehr diffizilen Beziehungsgeflecht zwischen Mensch und Tier resultiert. Ein Tier „vollzieht“ keinen Liebesakt, es paart sich mit einem oder begattet ein anderes Tier. Zwar sind höhere Tiere der emotionalen Wahrnehmung durchaus fähig, auch zeigen sie Triebe und Gefühle, aber der Begriff „Liebe“ stammt doch eindeutig aus der menschlichen Sphäre. Allerdings ist der Anthropomorphismus des Zweizeilers gar nicht so konstruiert, wie es auf den ersten Blick scheinen mag: Wie der Mensch ist der Wal ein Säugetier und die Familie der Wale zählt neben dem Menschen zu den intelligentesten Lebewesen, von denen man weiß, daß sie ein ausgeprägtes Gefühlsleben besitzen. Diese Gemeinsamkeit macht den Fakt interessant. Indem nun die erste Zeile einen Geschlechtsverkehr ankündigt, ruft sie beim Leser gleich die Frage nach dem Wo und Wie hervor. Der Neugier wird jedoch nicht entsprochen, die angekündigte Enthüllung bleibt aus. Dabei wird die Spannung zweimal gesteigert, einmal durch die Zäsur am Ende der ersten Zeile, das zweite Mal, stärker noch, nach Vollendung des Satzes, Mitte der zweiten Zeile. Nachdem die Erwartung schon einmal ausgetrickst wurde, kündigt die Pause nun doch mehr an und der mit „Und“ beginnende Zusatz scheint vielversprechend, aber auch er mündet bloß in eine äußerst schlichte Feststellung. Damit sind noch nicht alle Komponenten der Komik genannt. Das Verb „vollzieht“ verleiht dem Akt einen feierlichen und zugleich einen technokratischen Ton, beides entspricht, auf die menschliche Sexualität übertragen, der realen Erfahrung. Diese Doppeldeutigkeit in Verbindung mit dem Pendeln zwischen Mensch und Tier schafft eine komikträchtige Ausgangslage, die mit dem Temporaladverb „zumeist“ auf den ersten Höhepunkt zusteuert. Die hier angedeutete Möglichkeit, der Liebesakt des Wales könne auch außerhalb seines natürlichen Elements stattfinden, täuscht über die wahre Gegebenheit hinweg und relativiert kurzzeitig die banale Aussage. Dem wirkt das abschließende „Und stets nackt“ entgegen, da die Konjunktion „Und“ unpassend an die vorherige Relativierung anknüpft. So entsteht eine vorgeblich schlüssige Verbindung einer eingeschränkten und einer eindeutigen Aussage, nämlich, daß der Wal stets nackt ist. Dieses Hin- und Herschlagen zwischen verschiedenen Bereichen wird durch Reim und Rhythmus zusammengehalten. Die schnelle und harte Reimsilbe „akt“ bildet durch ihren starken Akzent einen klar definierten Höhepunkt. Ähnlich funktioniert auch das Hengst-Gedicht. „Hengst“ ist eigentlich die Bezeichnung eines männlichen Pferdes, gilt aber sinnbildlich auch für menschlich-männliche Potenzkraft, die hier kläglich scheitert. Das harte Reimwort „glitt“ ist neben den eben genannten Gründen deshalb so effektvoll, weil es bildliche Vorstellungen evoziert.
Daß sich die Schmählust des Volksmunds gern an bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten entzündet, zeigt das folgende Gedicht aus dem Zyklus „Kleine Erlebnisse großer Männer“. Es illustriert sehr schön die grüne Grenze zwischen dem Erhabenen und Niederen:
KANT
Eines tags geschah es Kant,
daß er keine Worte fand.
Stundenlang hielt er den Mund,
und er schwieg – nicht ohne Grund.
Ihm fiel absolut nichts ein,
drum ließ er das Sprechen sein.
Erst als man zum Essen rief,
wurd er wieder kreativ,
und er sprach die schönen Worte:
„Gibt es hinterher noch Torte?“24
Das komische Moment solcher Gedichte beruht auf der Konfrontation einer großen Person mit kleinen Dingen und profanen Ereignissen. Einen Namen wie Kant denkt man nicht im Zusammenhang mit alltäglichen Verrichtungen, sondern definiert ihn stets über seine geschichtliche Bedeutung, in diesem Fall über das philosophische Werk, hinter das der Mensch zurück tritt, und zwar so weit, daß er zum Denkmal erstarrt. Unsterblich durch die Dauerhaftigkeit ihrer Werke, geht der Person jeglicher Bezug zum menschlichen Dasein verloren. Fast scheint es, als habe sie nie wirklich gelebt, sondern immer nur ihr Werk. Den Gegenbeweis liefern allein intime Aufzeichnungen oder die Anekdote. Ob wahr oder erfunden, sie lebt vom Bekanntheitsgrad ihres Protagonisten und der Diskrepanz von Wichtig und Nichtig. Tauschte man den Namen des Königsbergers mit dem eines völlig Unbekannten, ohne den Reim zu beeinträchtigen, setzte also statt Kant beispielsweise Brant, so stünde man immer noch vor einem einigermaßen lustigen Gebilde, doch die komische Fallhöhe ist viel größer durch die Bedeutsamkeit des Philosophen. Daß es ausgerechnet einem professionellen Benutzer der Sprache dieselbe verschlägt, scheint ungewöhnlich und mag bereits Anlaß zu Schadenfreude geben. Doch er wäre schließlich nicht der Philosoph der Vernunft, könnte er für dieses Versagen keinen triftigen Grund angeben. Der allerdings nähert sich der Tautologie und verweist zirkulär auf die eingangs erwähnte Angabe, daß Kant einmal stumm geblieben war. Ein banaler Anstoß von außen bringt seinen Geist wieder auf Trab und führt ihn zu einer ebenso simplen Frage, die euphemistisch als eine in schöne Worte gekleidete, kreative Leistung hervorgehoben wird. Ein Geistesmensch triebhaft ins Materielle verstrickt, die Rückführung des dem normalen Leben Entrückten auf den Durchschnitt, das ist komisch.
Neben formalen und inhaltlichen Anlehnungen haben einige Gedichte Gernhardts auch direkte Vorläufer in der Subpoesie. Etwa die mit F.W. Bernstein und F.K. Waechter gemeinsam verfaßten „Rotbart-Lieder“,25 die auf Schülerparodien zurückgehen, welche ihrerseits die bekannte Ballade „Schwäbische Kunde“ Ludwig Uhlands zum Vorbild haben. Das gilt auch für das priamelartige Poem „Kleines Lied“ sowie die Persiflage auf Paulus’ fleißiges Briefeschreiben:
Bin ich taub und stumm und blind
Bin ich Adolfs liebstes Kind.26
KLEINES LIED
Bin ich auch arm
Bin ich doch dumm
Bin ich auch schief
Bin ich doch krumm
Bin ich auch blind
Bin ich doch taub
Bin ich auch Fleisch
Werd’ ich doch Staub.27
Paulus schrieb an die Korinther:
Wer nicht mitkommt, der bleibt hinter.28
WEILS SO SCHÖN WAR
Paulus schrieb an die Apatschen
Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen.
Paulus schrieb an die Komantschen:
Erst kommt die Taufe, dann das Plantschen.
Paulus schrieb den Irokesen:
Euch schreib ich nichts, lernt erst mal lesen.29
Wie der klassische Nonsens (Ringelnatz, Morgenstern) bevorzugt Gernhardt die traditionellen Formen des Gedichts, die den Normverstoß nahelegen. Heraus ragen Ballade, Dialoggedicht, Epigramm und vierzeilige Volksliedstrophe. Alle diese Formen besitzen die potentielle Fähigkeit, umstandslos eine komische Wendung herbeizuführen. Bei der Ballade eignet sich besonders ihr dramatischer Zug zum Erstellen eines Gegenpols, die kompakten Gedichte begnügen sich meist mit einem pointierten Schlußeffekt.
Das Erscheinungsbild der Gedichte hat sich in Form und Inhalt im Laufe der Jahre nicht grundsätzlich verändert, doch der lockere, unbedarfte Ton, der auch vielen Sponti-Sprüchen Vorbild war, entfaltet mehr und mehr einen tieferen literarischen Anspruch. Die ersten Gedichte zeichnen sich, gemäß dem WimS-Umfeld, dem sie entstammen, durch eine schlichte und direkte Sprache aus, sind verstärkt an der Schmählust des Volksmunds orientiert und erfuhren unverkennbare Prägung durch die in den Spätsechzigern und Frühsiebzigern formulierte linke Kritik an bürgerlichen Werten und Normen, welche ihrerseits wieder Anlaß zu (selbst-)ironischer Distanzierung wird, sobald sie zu bloßen Parolen verkommen.30 Dagegen mischen sich mit dem Band Wörtersee unter den puren Nonsens auch ambitioniertere Themen und Formen, die nicht mehr ausschließlich auf den bloßen Lacher aus sind. Es mehren sich literarische Bezugnahmen und mit ihnen eine zwar spielerische, aber ernstzunehmende Auseinandersetzung über alltägliche und zeitlose Menschheitsprobleme. Die lyrische Form wird jetzt nicht mehr lax verweigert, sondern eingebunden in eine humoristische Skepsis, der Ernst und Witz keine widerstreitende Positionen mehr sind. Bezeichnend für Gernhardts komischen Weltblick ist das Aufgreifen kleiner, unscheinbarer Ereignisse, die in der komischen Zuspitzung plötzlich eine philosophische Tiefe offenbaren. Umgekehrt werden große Themen relativiert, indem das kulturelle Erbe mit modernen Zweifeln und Widersprüchen durchtränkt wird, ohne jenes zu denunzieren. Das ,Nebensächliche‘ beansprucht seine Geltung neben dem ,Wesentlichen‘, beide sind gleichwertig. Insofern gerät Gernhardts Humor in die Nähe des ,totalitären Humors‘ Jean Pauls, dem angesichts der Nichtigkeit menschlichen Lebens und Strebens vor der Unendlichkeit von Zeit und Raum alles gleich wichtig und nichtig ist.
Allerdings wendet Gernhardt diese Einstellung nie ins Negative. Statt einem naheliegenden Fatalismus zu verfallen, versucht er, dem Verlust an festen Werten und klarer Orientierung mit der Komik etwas Positives abzugewinnen. Beinahe programmatisch widmet er in Wörtersee ein ganzes Kapitel dem „Spaßmacher und Ernstmacher“. In Körper in Cafés greift er Titel und Thema erneut auf:
Sagt: Warum heißt man seit alters sie
Gegensätze? Das Tiefe, das Flache? Sind nicht
Verschwistert sie? Es gehet unmerklich
Das Flache ins Tiefe. Es spüret der Fuß kaum
Den schwindenden Boden des Schwimmers. Also
Mischt sich der Tiefsinn dem Flachsinn, und jene,
Welche da glauben, sie würden noch flachsen,
Wissen sie denn, ob sie längst nicht schon tiefsen?31
Der antiquierte Tonfall, zu dem auch das didaktische Bild paßt, und die Wortspiele der Schlußzeilen führen hier nicht mehr zur reinen Komik – sie bewahren der Aussage eine durchaus ernstzunehmende Triftigkeit. Das Pendeln zwischen Komik und Ernst nimmt seit Körper in Cafés mehr Raum ein als zuvor. Es kommt zu einer Hinwendung an große Themen, die ums Altern, Tod und Probleme der Geschlechterbeziehung kreisen. Auch rückt das literarische Ich stärker in den Mittelpunkt und bekennt sich zur Nachdenklichkeit, die jedoch vor jeglichem Anflug von Larmoyanz oder weihevoller Geste gefeit bleibt. Gernhardt bezieht zu diesem Prozeß wie folgt Stellung:
Die Komiker merken, daß es sie selber ja auch noch gibt, ihre Produkte werden autobiographischer, auch subjektiver – das kann Sentimentalität, Humoriges oder kraus Privatistisches zur Folge haben, kann aber auch zu Werken führen, in denen der radikalkomische Ansatz der Jugendzeit sich mit breiterer Lebens-, Welt- und Icherfahrung zu einer seltsam schillernden komischen Einheit verbindet.32
Diese heikle Gratwanderung vollzieht Gernhardt dennoch spielerisch leicht. Angesprochen auf seine Komik verweist er immer wieder auf die „Helligkeit und Schnelligkeit“, mit der sich einst Morgenstern gegen Begriffe wie Blödeln, Ulk und höherer Blödsinn verwahrte.33 Hell und schnell sind auch die nicht-nur-komischen Gedichte Gernhardts, solange eine gewisse Distanz zu den behandelten Gebieten besteht.
Klaus Stieglitz, aus Lutz Hagestedt (Hrsg.): Alles über den Künstler. Zum Werk von Robert Gernhardt, Fischer Taschenbuch Verlag, 2002
Gespräch mit Robert Gernhardt
Bernd Kreuzinger, Daniel Lenz und Eric Pütz: Sie haben sich selbst einmal im „Restaurant zur deutschen Literatur“ die Position am Nebentisch oder im Bistro, keineswegs aber am Fenster zugewiesen. Würden Sie sich – nach Ihrem Anschlag auf Peter Handke in dem Roman Ich Ich Ich – zu jemandem wie ihm an den Tisch setzen? Worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?
Robert Gernhardt: Sicherlich würde ich mich mit ihm unterhalten, bloß ist Handke einer von denen, die gerade auf den Haupttisch zugesteuert sind. Insofern ist das nicht eine Frage, ob ich mich mit ihm an einen Tisch setzen würde, sondern eine Frage seiner Platzwahl. Handke hat immer eine hohe Meinung von sich gehabt. Schon sein erstes Auftreten in der Gruppe 47 machte Furore. Auf einmal wußte jeder von Handke. Keiner hatte etwas von ihm gelesen, aber alle erfuhren, daß da ein neuer Mann in der deutschen Literatur ist. Er ist sofort die Großen angegangen. So, wie Brecht zu seiner Zeit sich ausguckte: Wer ist der Größte? Natürlich Thomas Mann. Dem semmel ich jetzt verbal mal links und rechts eine rein. So ähnlich dann auch Handke, der zwar keine Namen nannte, aber den Konsens der Gruppe 47 aufkündigte. Zwar war seine Prosa, die „Hornissen“, ziemlich modisch, doch hatte er Erfolg beim Theater, zum Beispiel mit der Publikumsbeschimpfung. Seither ist er mit jeder Veröffentlichung ein umstrittener, auch gefeierter Autor geblieben. So ein Platz wird einem nicht zugewiesen von den Kellnern im Literaturrestaurant, den muß man sich ergattern oder ergaunern. Den hat er angestrebt und bekommen, hat allerdings viel dafür tun müssen: Das geht nicht ohne Selbststilisierung und Selbstbeweihräucherung.
Ich wußte von vornherein, daß ich ganz anders gebacken war. Ich glaube, daß es die Möglichkeit derer am Nebentisch ist, die am Haupttisch sehr viel besser wahrzunehmen als umgekehrt. Ich glaube nicht, daß Handkes Wahrnehmung seiner Kollegen, seiner Branche sehr erkenntnisfördernd ist, weil er damit beschäftigt ist, seinen Platz zu verteidigen und sich an denen zu orientieren, die noch bessere Plätze haben. Derjenige aber, der sich bescheidet und sagt, da will ich gar nicht hin, ich bleib an der Bar und guck mal durch die offene Tür, was die an den Haupttischen da so machen, bekommt mehr mit und wird selber natürlich weniger wahrgenommen. Das muß man in Kauf nehmen, nimmt man dann aber auch gerne in Kauf.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Haben Sie mit Tagebuchschreiben angefangen?
Gernhardt: Ich habe nie geschrieben, um mich selbst zu finden oder mich meiner selbst zu vergewissern, jedenfalls als junger Mensch nicht. Dafür hatte ich die Malerei. Das war zunächst für mich das Gebiet, auf dem ich glaubte, meinen Weg gehen zu müssen. Schreiben war etwas für mich, was ich aus geselligen Gründen tat, um Mitschüler zu erfreuen, Lehrer zu leimen oder irgendwelche bunten Abende zu gestalten. So ging das los.
Als ich dann zur Kunstakademie ging, habe ich das Schreiben zunächst weder betrieben noch vermißt. Doch dann traf ich in Berlin auf Fritz Weigle alias F.W. Bernstein, und als wir dann Germanistik als Beifach studierten, haben wir das, was wir dabei an Formen und Inhalten aufgriffen, durch den Wolf der Komik gedreht, um Distanz zu dem zu gewinnen, was wir uns tagsüber so anhören mußten. Das war aber nie Schreiben unter dem existentiellen Vorzeichen, und lange Zeit blieb es dabei. Bis Anfang der achtziger Jahre betrieb ich das Schreiben unter dem Vorzeichen, andere zu unterhalten sowie mich selbst zu unterhalten, im doppelten Sinne, also auch um Geld zu verdienen.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Gustav Seibt hat Ihre Lebenserfahrungen seit Mitte der achtziger Jahre als die „eines bundesdeutschen Wohlstandsbürgers“ beschrieben, „dem seine eigene Welt recht suspekt war, der sich aber immer als ein Teil von ihr begriff“. Das erinnert mich an eine Passage in Hesses Steppenwolf, wo es heißt:
Die allermeisten Künstlermenschen bleiben an das schwere mütterliche Gestirn des Bürgertums gebannt. […] Nur die stärksten von ihnen durchstoßen die Atmosphäre der Bürgererde und gelangen ins Kosmische […] und gehen auf bewundernswerte Weise unter – sie sind die Tragischen. Den anderen aber steht ein drittes Reich offen, der Humor.
Könnte man so Ihre soziale Position festmachen als die eines Grenzgängers, der das Bürgertum von innen ausleuchtet und sich dabei immer etwas abgrenzt?
Gernhardt: Der Begriff des Bürgerlichen hat lange Zeit genügt, um etwas abzuwerten oder ganz niederzumachen. Für die Boheme war der Bürger der Spießbürger, der nur in einer platten Welt des Erwerbs und des Wohlseins lebte. Für die Linken war der Bürger der Vertreter einer Klasse, die überwunden werden mußte, weil ja erst, wenn das Bürgertum abgestorben war, die Diktatur des Proletariats zu ihrem Ziel kommen konnte. Ich selber habe als junger Mensch sehr genau jene Momente wahrgenommen, bei denen ich so etwas spürte wie einen instinktiven Widerstand gegen die Welt, die mich umgab. Ich wollte mir die Marschrichtung nicht vorschreiben lassen. Und ich erinnere mich daran, daß lange vor dem Abitur einer der stärksten Eindrücke das Gefühl war: Sie sollen mich nicht kriegen; wer immer auch „sie“ war oder waren: die Gesellschaft, die Familie, die Pfaffen, die Lehrer oder sonstwer. Was darauf folgte, ist schwer zu sagen: eine Fluchtbewegung, eine Anpassungsbewegung oder ein Prozeß, bei dem ich lernte, mich sowohl in dieser vorgefundenen Welt zu bewegen und zugleich ihre Grenzen zu überschreiten?
Auf jeden Fall war es für mich ein wichtiger Schritt, nicht Lehrer zu werden, obwohl ich die Staatsexamen für Malerei und Germanistik gemacht habe. Damals fingen Weigle und ich dann verstärkt mit der Produktion von Komischem an, zuerst ohne daran zu denken, das Komische zu Geld zu machen. Da scheint ein wirklich existentielles Bedürfnis vorgelegen zu haben. Komik ist, glaube ich, Produkt eines gewissen Leidensdruckes, der sich nicht im Lamento, sondern im auftrumpfenden Lachen äußert. Mit Weigle bin ich dann zu Pardon gegangen. 1964 wurden wir Redakteure. Seitdem wir 1966 die Redaktion verlassen haben, bin ich freier Autor und Zeichner.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Würden Sie die Aussage unterschreiben, daß zwar eine Welt ohne Komik vorstellbar ist, jedoch keine Welt ohne den Ernst, da die Komik den Ernst, das Normative und Schickliche verarbeitet?
Gernhardt: Die Komik und der Nonsens schmarotzen natürlich beide vom Sinnbedürfnis der Menschen und von seiner Sinnproduktion an sich. Das wird immer so gewesen sein, schon in der Urhorde. Idealtypisch gedacht: Da wird ein Häuptling gewesen sein, der gesagt hat: Du machst dieses, du machst jenes. Dann wird da der Schamane gewesen sein, der den Leuten erklärt hat, warum sie dem Häuptling gehorchen müssen: Weil es doch noch einen Oberhäuptling gibt, der hinter den Wolken sitzt und dem Häuptling die Macht verliehen hat, stellvertretend Befehle zu geben. Und dann wird es einen gegeben haben, der den Häuptling sowie den Schamanen hinter deren Rücken nachgeäfft und veräppelt hat. Der Gruppenclown war naturgemäß nie der erste, sondern immer der dritte in dieser Reihe hinter König und Priester. Aber ohne diesen Clown hätten diese Gruppen nicht überlebt, glaube ich, bis auf den heutigen Tag nicht. Dauernden Ernst hält niemand aus. Man kann das Modell noch vereinfachen, dahin gehend, daß es zwei Kasten gegeben hat, die es geschafft haben, die anderen für sich arbeiten zu lassen: die Krieger und Könige einerseits und die Priester und Künstler, die Intellektuellen andererseits. Deswegen sehe ich auch heute noch Zusammenhänge zwischen Gaukler und Priester. Ob da nun unter ernstem Vorzeichen gegaukelt wird oder unter lustigem, ist doch nur die Medaille mit den zwei Seiten. Bis auf den heutigen Tag muß ich über den Papst lachen, der sich einen hohen Hut aufsetzt, damit er größer ist als die anderen Menschen. Also wird auch der Narr sich irgend etwas Komisches auf den Kopf setzen, Eselsohren, Narrenkappe oder ulkige Hüte.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Hat der Narr nicht immer das ernsthafte Vorbild im Hinterkopf?
Gernhardt: Ja, und hin und wieder treffen sich die beiden, der Narr und der Sinnstifter, sogar, etwa in der Gestalt des Künstlers. Shakespeare mit seinen Tragödien und seinen Komödien ist eine solche Synthese. Wenn man aber schematisch vorgeht, dann wird da erst einmal der Moses hergekommen sein, der die zehn Gebote verkündet hat. Und einer in der Menge der Zuhörer wird das elfte Gebot dazu gefaselt haben, etwa:
Du sollst nicht eher brechen, bevor du nicht auch was gesoffen hast.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Würden Sie zustimmen, daß ein Komiker bewußt eine unverbindliche Position einnimmt, eine geringe Angriffs- bzw. Kritikfläche ausstülpt, um sich rechtzeitig verstecken zu können?
Gernhardt: Nicht unverbindlich – unangreifbar. Mit Ironie, die eine wunderbare Möglichkeit eröffnet, seine Meinung zu sagen, ohne dafür haftbar gemacht werden zu können.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Kann man den Komikern zum Vorwurf machen, daß sie bewußt hinter der Ironie oder dem Witz ernste Anklänge verstecken, mit der Option, den Ernst immer wieder dementieren zu können?
Gernhardt: Da ist etwas dran. Aber zur Zeit wird manchmal so getan, als ob man sich vor Komikern gar nicht mehr retten könne. Wir leben, wird behauptet, in einer Spaßgesellschaft, wir lachen und amüsieren uns zu Tode. Die so reden, beziehen sich dabei immer nur auf ein Medium: das Fernsehen. Und da kann man ja aus- oder umschalten. Wenn ich es gerne ernst habe, kann ich mir im Fernsehen jeden Abend ein exquisites Ernstmenü zusammenstellen. Es gibt zwar eine Menge deutscher Comedy-Sendungen, aber man könnte genausogut sagen, daß es zu viele Melodramen oder politische Informationssendungen gibt, mit dem Fazit: Wir informieren uns zu Tode. Oder: Wir weinen uns zu Tode. Oder: Wir denken uns zu Tode.
Es gibt nur wenige genuin komische Talente. Und wenn dann jemand solch ein Talent hat, wie etwa Woody Allen, dann ist es doch ein Segen, daß der von seinem Ingmar-Bergman-Trip runter ist. Woody Allen hat ja selbst immer wieder die schlechteste Meinung von der Komik geäußert: Sie sei ein Pappbecher, aus dem man trinkt und den man wieder wegwirft. Ich bin heilfroh, daß er sich eines Besseren besonnen hat. In seinem neuen Film Deconstructing Harry ist er wieder groß in Form.
Und auch in der deutschen Literatur kommt auf 100 Ernstmacher nur ein wirklich komischer Kopf. Den sollte man achten und bestätigen. Dem sollte man nicht sagen: Du traust dich im Grunde nicht, ernst zu machen.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Aber die Komik funktioniert doch auch als Transportmedium?
Gernhardt: Natürlich, es gibt instrumentalisierte Komik. Sie ist beispielsweise das Transportmittel jedweder Satire. Satire ist Kritik, die nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit Augenzwinkern geäußert wird. Der Zuckerguß der Komik überdeckt den bitteren Kern der Pille. Zudem wird Komik in vielfältigster Form instrumentalisiert, nicht nur um satirische Pillen besser rutschen zu lassen, sondern auch in der Werbung, um Produkte besser an den Mann zu bringen. Es gibt auch tendenzfreie Komik, zum Beispiel den Nonsens. Und dann gibt es sogar so etwas wie personengebundene Komik. Woody Allen, Tucholsky und Morgenstern sind unverwechselbar komisch. Komik ist nichts per se Wertvolles oder Wertloses, so wie der Ernst kein Wert oder Unwert für sich ist. Es kommt darauf an, was man aus der jeweiligen Haltung macht.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Sie weisen der Komik die Eigenschaft zu, einen Moment lang soziale Ordnungssysteme außer Kraft setzen zu können. Komik könne diese zwar nicht abschaffen, aber den Druck, der von ihnen ausgeht, durchaus mildern. Gibt es denn Momente, in denen die Komik diese lindernde Funktion für Sie selbst nicht mehr besitzt, in denen Ihnen selbst also die Komik fremd ist?
Gernhardt: Davon weiß ich ein sehr ernstes Liedlein zu singen. Ich habe erlebt, was nicht vielen Menschen widerfahren ist. Da ich über Jahre hauptamtlich Komikproduzent war, konnte mich die Komik nicht davor bewahren, abends in ein dunkles Loch zu fallen. Normalerweise machen die Menschen tagsüber ernste Arbeit und machen abends in der Kneipe Witze über ihren Chef. Witze über mein eigenes Metier aber konnte ich des Abends nicht mehr machen, weil es ja daraus bestand, tagsüber Witze zu machen. Gott sei Dank hatte ich aber noch die Malerei. Die betrieb ich mit großem Ernst und großer Hingabe. Auf meinen Bildern gab es überhaupt nichts zu lachen, nicht den Hauch einer Pointe. Das war meine Entlastung vom beruflichen Komikproduzieren. Über viele Jahre hatte ich Rubriken und ganze Seiten zu füllen, etwa elf Jahre „Welt im Spiegel“ in Pardon, viele Jahre „Hier spricht der Dichter“ im Zeitmagazin, „Gernhardts Erzählungen“ in Titanic und als letztes Zeichnungen im FAZ-Magazin zu Texten von Lichtenberg. Das habe ich immer gerne gemacht, weil ich wußte, daß nur kontinuierliches Produzieren die nötige Professionalität mit sich bringt. Zweitens sichert es den Lebensunterhalt, und drittens hat es zur Folge, daß man immer mehr abhaken kann: Weiß ich, weiß ich, was gibt es noch? So kann man die Möglichkeiten des Komischen erweitern und auf Sachen stoßen, die es in dieser Form nicht gegeben hat.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: In Ihrem Buch Glück Glanz Ruhm erzählen Sie von einer nervenaufreibenden Dichterlesung vor einem Dutzend Zuschauern, bei der jemand dauernd mit einem Plastikbecher knackt und der Autor eigentlich gar keine Lust mehr hat weiterzulesen. Geht es Ihnen manchmal wie dem Böllschen Clown, der insgeheim todtraurig oder schlecht gelaunt ist, aber den Schein des Lachens bewahren muß?
Gernhardt: Diese Dämonisierung des Clowns und des Komischen teile ich nicht. Man weiß ja genau, worauf man sich einläßt. Ich muß ja nicht komisch sein auf einer Lesung. Ich kann schauen, daß ich eine einigermaßen unterhaltsame Auswahl von Texten zusammenstelle, aber wenn mir danach ist, kann ich die Leute auch mit Texten konfrontieren, die unpointiert sind und bei denen es nichts zu lachen gibt.
Wenn ich den Band Lichte Gedichte vorstelle, sage ich den Leuten vorher: Es wird nicht immer was zu lachen geben. Es ist nicht Ihre Schuld, wenn Sie nicht immer die Pointe finden.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Ist es auch möglich, daß viele Komiker zunächst einen anderen Weg gegangen sind und sich an Ernstem versucht haben, daran aber gescheitert sind und so zur Komik kamen?
Gernhardt: Da muß ich mal die von mir ein wenig erforschten Biographien der bekanntesten komischen Köpfe deutscher Zunge Revue passieren lassen. Lichtenberg plante einen Roman, der aber sicherlich satirisch geworden wäre. Er hat es nicht zu dieser großen Form gebracht, sich aber dann in seinen Sudelbüchern ein bleibendes Denkmal geschaffen. Ich glaube nicht, daß Lichtenberg ein verhinderter ernster Schriftsteller war. Heine war immer zweigleisig, wenn ich das richtig sehe. Das Buch der Lieder hat komische und ernste Momente wie die Nordsee. Wilhelm Busch wollte ernster Maler werden wie ich. Ernster Schriftsteller wollte er nie werden, also ist er auch kein verhinderter ernster Schriftsteller. Tucholsky hat gleich angefangen mit Rheinsberg, man weiß bei ihm nichts von verhinderten ernsten Geschichten. Kästner hat nicht als ernster Schriftsteller angefangen, sondern gleich mit komischen Gedichten. Auch seine Kinderbücher haben viele komische Momente.
Ich glaube nicht, daß die These stimmt, daß die Spaßmacher ursprünglich ernst sein wollten und dann ins komische Fach gegangen sind, zumindest im deutschen Sprachraum nicht. Aber es gibt eine andere Entwicklung, die einige Expressionisten wie Hasenclever oder Werfel betrifft, die angefangen haben mit solchen Vatermordgeschichten und später als Lustspielautoren endeten. Das ging los mit Oh Mensch und endete mit Jakobowsky und der Oberst.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Muß ein Lyriker, der sich nicht den Zwängen des Reimes unterwirft, inhaltlich weitaus mehr bieten als der reimende Dichter?
Gernhardt: Reim oder nicht Reim, das ist für mich keine Frage. Reimlosigkeit ist keine Errungenschaft der Moderne. Ein Großteil der klassischen deutschen Dichtung ist ungereimt, der ganze Klopstock zum Beispiel. Für Goethe war das nie ein Thema, weil er mit tausend Zungen reden konnte, im Volksliedton ebenso wie in klassischen Metren. Ich höre im Moment morgens auf dem Ergobike Hermann und Dorothea, was mir einen Riesenspaß macht, weil die Fallhöhe zwischen Hexameter und bürgerlichem Epos sehr hoch ist. Bei reimlosen wie bei gereimten Gedichten gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Der Reim selber ist nicht so schwierig, man muß zwar ein gewisses Talent mitbringen, aber man kann ja auch mit dem Steputat arbeiten, dem Reimlexikon. Ich habe das nie getan. Einige Rapper tun es und delegieren den Sinn dann ganz und gar an das Reimlexikon. Man kann reimlos oder gereimt sinnvolle oder sinnlose Gebilde zusammenbringen.
Ich habe in den letzten beiden Jahren zwei Zyklen geschrieben, den einen im Krankenhaus, der dann in Lichte Gedichte eingegangen ist: „Herz in Not“. Das sind reimlose Eintragungen. Aber da ich die Form brauche, habe ich mir selber die Regel auferlegt, daß jede Mitteilung siebenzeilig sein soll, sechs Zeilen davon zweihebig und die letzte Zeile zwei- bis dreihebig. Der andere Zyklus heißt „Würstchen im Schlafrock“ und steht im Klappaltar. Den habe ich im September des letzten Jahres innerhalb von zwei Wochen niedergeschrieben, insgesamt 90 Gedichte.
Das fing ganz harmlos an. Ich wollte mich bloß ein wenig im Ton des reifen Goethe versuchen. Am 18. September habe ich drei Gedichte gemacht, am 19. September waren es schon sechs. Und so fortan. Dann setzte ich mir ein zeitliches Limit und sagte mir, ich tue mal so, als ob ich mir für zwei Wochen den Schlafrock des alten Goethe aus dem Kostümverleih der deutschen Literatur ausgeliehen hätte:
Dichten meint Vermummen, reicht mir
jenen Rock und diese Züge,
für zwei Wochen, ich will durch sie
sprechen,
zeiht mich nicht der Lüge.
Wer da spricht, ist noch ich selber,
was er spricht ist ungeschöntes
Leben maskenhaft vermittelt,
bin ja selbst gespannt, wie tönt es.
So geht das Ganze los – und endet damit, daß am 1. Oktober um 20 Uhr der Kostümverleih mahnt. Er will den Rock wieder zurückhaben:
Bist im Weimaraner Schlafrock
lang genug herum stolzieret,
Würstchen, leg ihn ab, ich seh doch,
wie’s dich trotz der Maske frieret.
Spür’s, nicht wärmt mehr das Geschlotter,
nun versprechen bessere Hitze,
gutes Essen, holde Eintracht,
alter Wein und neue Witze.
Dazwischen also 90 Gedichte. Zusammengehalten von einer ganz klaren Form. Vierzeiler, aber nicht wie meist bei Goethe kreuzgereimt, sondern einfach gereimt, a-b-c-b. Die Erfahrung, die ich bei solchen reimlosen und gereimten Eintragungen gemacht habe, ist, daß es wichtig ist, daß die Mitteilungen etwas Triftiges bekommen.
Das Gedicht als kurze Mitteilung muß besonders darauf achten, daß es plausibel ist: Warum erzähle ich das alles überhaupt? Das ist wie beim Unterschied zwischen Brief und Telegramm: Wenn ich ein Telegramm schicke, muß ich wirklich etwas zu sagen haben. Das Gedicht ist verglichen mit dem Roman ein Telegramm. Der Dichter muß klarmachen, warum er den Leser überhaupt mit einer solch kurzen Mitteilung belästigt. Der Epiker hat es da einfacher: Wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Wir haben einige Gedichte gefunden, die zweifellos betroffen machen. Zum Beispiel haben Sie ein Gedicht geschrieben, das „Nach der Lektüre einer Anthologie“ heißt. Ein Ausschnitt daraus lautet:
[…] Diesen Pißfleck am Fuß der Rolltreppe der U-Bahn-Station Miquel-Adickes-Allee,
Vor Augen gedenk ich der Stimmen
die heut zu mir sprachen, so
drucklos, so dranglos, so
schwunglos, so harmlos, so
bißlos, so zwanglos, so
harnlos, so hirnlos.
Würden Sie diesen Zustand als symptomatisch für die junge deutsche Lyrik bezeichnen?
Gernhardt: Die Anthologie, auf die ich mich da beziehe, ist im Hanser Verlag erschienen und versammelt Lyrik der achziger Jahre. Da fand sich eine Reihe von Dichtern, deren Attitüde ich mit dem Begriff „mürrisches Parlando“ zu klassifizieren versuchte. Die sind alle nicht so ganz einverstanden mit dem Leben und ihrer Situation darin, finden dafür aber keine grellen oder wie auch immer gearteten verstörenden Bilder, sondern klagen moderat vor sich hin. Es wäre ungerecht, Namen zu nennen. Diese Dichter sind einander so ähnlich, daß man ihre Gedichtzeilen austauschen oder zu neuen Gebilden montieren könnte, ohne daß zu merken wäre, wo der eine anfängt und die andere aufhört. Das könnte man mit einem Gedicht von Rilke, Benn oder Rühmkorf nicht machen. Die haben einen sehr eigenen Sound, und das halte ich auch für eine Leistung dieser Dichter, so skeptisch ich auch manchmal dem Rilke oder dem Benn gegenüberstehe. Dieses Gedicht über die Anthologie meint also: Traut euch mehr, stimmt etwas kräftigere Gesänge an, nicht so harmlose.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Das wäre also Ihr Appell, den Sie an die deutschen Lyriker richten?
Gernhardt: Ja, und auch an mich selber.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Oder ist das vielleicht sogar eine Frage der deutschen Mentalität, auch wenn das schon ein Stereotyp zu sein scheint?
Gernhardt: Mir ist mittlerweile der Gegensatz zwischen komisch und ernst nicht mehr so wichtig wie der zwischen suggestiv und nicht-suggestiv. Das hat Schiller schon gesagt, daß das Gedicht den Leuten als Offenbarung oder Gespenst erscheinen soll. Es soll sie auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise beunruhigen oder beeindrucken. Und das gibt es ja Gott sei Dank immer noch, sowohl ernste wie auch komische Gedichte, die einen aus der Ruhe bringen, vielleicht sogar zum Lachen, auch ein bewegter Zustand. Unlängst las ich in der Frankfurter Anthologie der FAZ ein gewaltiges Gedicht von Christine Lavant. Es geht um eine Hündin, der das Kreuz zertreten wurde, und um Gott, den das nicht kümmert; ein unglaublich starkes Gedicht. Ich glaube, daß kein fühlender Mensch, der das zu Gesicht bekommt, da unbewegt lesen kann. Solche Gedichte gibt es. Das sind zwar Sternstunden, aber man muß darauf hinarbeiten, daß die sich hin und wieder ereignen: Gedichte außerhalb des halbwegs normalen Räsonierens.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: In Lichte Gedichte haben Sie sich mit dem Tod beschäftigt, der ja persönlich auftritt. Auch Brecht hat in einem Gedicht ein Epigramm für seinen Grabstein vorgeschlagen:
Er hat Vorschläge gemacht. Wir haben sie angenommen.
Was würden Sie sich für Ihren Grabstein wünschen?
Gernhardt: Brecht hat sich immer wieder Gedanken über seine Grabinschrift gemacht. In einem anderen Gedicht sagt er, sie solle lauten: „Rein. Sachlich. Böse.“ Ich habe mir die Gedanken nie gemacht. Brecht war seit seiner Kindheit herzkrank. Vielleicht hat man dann ständig das Gefühl, man könnte abberufen werden. Für mich kam meine Herzoperation sehr überraschend und in reifen Jahren. Die habe ich nicht als tödliche Bedrohung, sondern als Prüfung empfunden.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Schon vor über zwanzig Jahren haben Sie gesagt: „Ich leide an Versagensangst, besonders, wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zuschande.“ In „Der Dichter“ führen Sie aus:
[I]ch seh mich schon im Grabe, wenn ich nichts zu dichten habe.
Haben Sie Angst, daß Ihre Sprache eines Tages leer ist und nichts Überraschendes mehr produziert?
Gernhardt: Nein, ich habe nicht die geringste Angst davor, daß irgendwann etwas leer wäre. Ich lasse mich überraschen, im Zweifelsfall kann ich immer noch einen fremden Tonfall aufgreifen oder die Gedichte anderer verbessern beziehungsweise veralbern. Außerdem kann ich auch zum Bild zurückkehren.
Kreuzinger, Lenz und Pütz: Ist es denn gerade beim Dichten nicht ernüchternd, wenn man immer wieder auf dieselben Reimwörter stößt?
Gernhardt: Überhaupt nicht, weil es ja immer neue Kombinationen gibt. Mein Gedicht „Nachdem er durch Metzingen gegangen war“ zum Beispiel enthält einen Reim, den ich noch nicht gelesen hatte:
Dich will ich loben: Häßliches,
du hast so was Verläßliches.
Dann aber:
Das Schöne schwindet, scheidet, flieht –
fast tut es weh, wenn man es sieht.
Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit,
und Zeit meint stets: Bald ist’s soweit.
Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer.
Das Häßliche erfreut durch Dauer.
Bis auf das erste Reimpaar sind das alles Reimworte, die auf der Hand liegen. Bloß ist dieser Zusammenhang noch nicht hergestellt worden. Warum sollen Reimwörter ausgefallen sein? Auch die Worte an sich sind in der Regel bekannt, und es geht nur darum, wie sie neu zusammengefügt werden. Morgenstern hat mal ein schönes Gedicht geschrieben:
Ohne Wort, ohne Wort,
fließt das Wasser immer fort.
Andernfalls, andernfalls
spräche es auch nichts anderes als
Brot und Bier und lieb und treu,
und das wäre auch nicht neu.
Dieses zeigt, dieses zeigt,
daß das Wasser besser schweigt.
Alles bekannte Worte, bloß hat der Morgenstern daraus etwas Neues zum alten Thema „Es gibt nichts Neues“ gemacht. Gerade wenn man mit Sprache viel und oft zu tun hat, dann freut man sich über ganz minimalistische Verrückungen, die unerwartet Neues herstellen:
Alles geht natürlich zu, nur meine Hose geht natürlich nicht zu.
Finder und Erfinder: Heinz Erhardt.
Sinn und Form, Heft 6, November/Dezember 1998
Christoph Haas: Der Schlafrock, das Licht und die Wünsche, Merkur, Heft 600, März 1999
Robert Gernhardt: Über einige Erfahrungen beim Verfassen von Gedichten. Vortrag bei der Philosophisch-Literarischen Gesellschaft in Baden-Baden 2005.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Jan Philipp Reemtsma: Robert Gernhardt zum 60sten ein Dank
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Zum 15. Todestag des Autors:
Alexander Solloch: Robert Gernhardt und seine unverwüstlichen Gedichte
NDR, 30.6.2021
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IMDb + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Robert Gernhardt: Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝
FAZ.NET-Spezial ✝ Netzeitung ✝ Titanic ✝ SZ, Seniorentreff ✝
Göttinger Elch ✝ Der Spiegel 1 + 2 ✝ Haus der Literatur ✝
Die Welt ✝ Der Stern ✝ Berliner Literaturkritik
Robert Gernhardt – Leben im Labor.


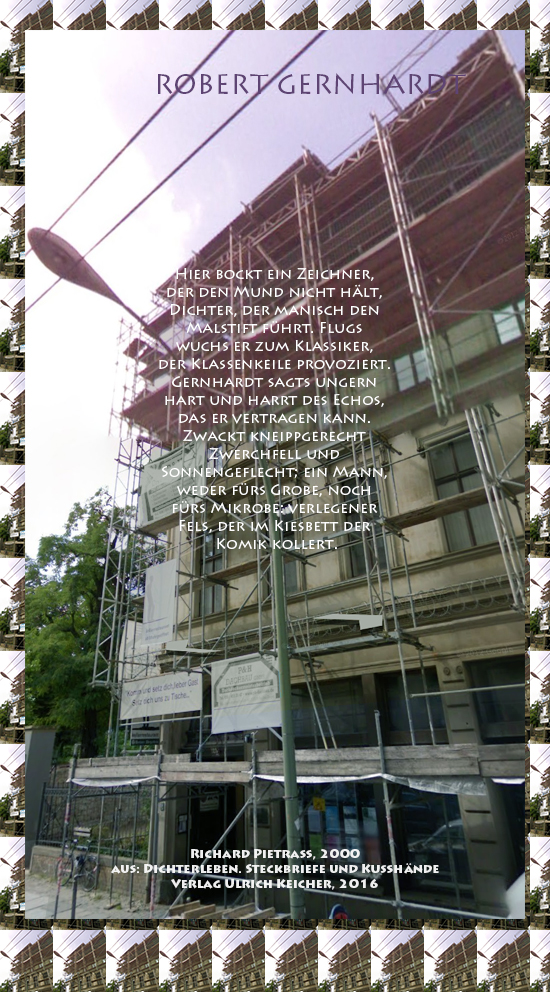












Schreibe einen Kommentar