Rolf Riehm: aprikosenbäume gibt es, aprikosenbäume gibt es (CD)
„Kunst an ihrer äußersten Spitze
kümmert sich nicht um irgendwelche Verpflichtungen oder Einlösungen“, sagt der Frankfurter Komponist Rolf Riehm und meint damit auch die Verbindlichkeiten, die ein vornehmlich auf Identifizierung ausgerichtetes „Eigenes“ mit sich bringt. Die wiedererkennbare Handschrift, die Dingfestmachung des Künstlers im „Personalstil“ ist Riehm suspekt:
Ich finde es eher langweilig, eine sogenannte eigene künstlerische Sprache zu entwickeln.
Stattdessen bedeute Komponieren für ihn, einen „Bestand an emotionaler Sensibilität“ zu sichern – wahrzunehmen, empfänglich zu sein, zu reagieren. Diesen Bestand gilt es immer aufs Neue zu erweitern; Sensibilität verträgt keine Muster, kein Repertoire von Verfügbarkeiten, aus dem der passende Affekt bloß noch herausgegriffen werden muss. Jedes seiner Werke ist somit ein neuer Versuch, sich einzulassen, sich achtsam dem jeweiligen Sujet zu widmen, es in Beziehung zur Gegenwart zu setzen. Die Fülle dieser Sujets ist enorm: politisches Zeitgeschehen, historische Fakten, Mythen, Märchen, Erinnerungen, Lyrik, Epik und Dramatik, Exponate aus der Musikgeschichte – Stoffe verschiedenster Herkunft trägt Riehm ohne erkennbare Systematik zusammen. Deren Vernetzung erfolgt erst im Prozess des Komponierens – die Griffe in den Zettelkasten sind dabei wiederum von keiner objektivierbaren Folgerichtigkeit geleitet.
„Musik ist für Riehm in Klänge gesetztes Denken und Erleben“, schreibt der Musikjournalist Frank Hilberg. Jenes Denken, das Riehms Kompositionen vorausgeht und ihre Entstehung begleitet, ist – im Sinne von Claude Levi-Strauss – ein „wildes“; ein Denken, das nicht infolge kausaler Ableitungen, als vielmehr durch fortwährende Kombinationen und Assoziationen zu Erklärungen gelangt. Dementsprechend verweigert sich seine Musik den „klassischen“ Standards einer Bezogenheit der Materialien, einer Schlüssigkeit der Entwicklung. „Die Seele“, sagt Riehm, „fühlt die Dinge nicht der Reihe nach, sondern kreuz und quer und in vielen Geschwindigkeiten gleichzeitig“. Einer solchen Form der unaufgeräumten Wahrnehmung will er mit seiner Musik entsprechen: Unstimmigkeiten und Widersprüche sind jederzeit zulässig.
Die drei Stücke dieser SACD, sämtlich Aufträge des Westdeutschen Rundfunks für die Wittener Tage für neue Kammermusik, sind musikalische Wahrnehmungen literarischer Fundsachen: Texten von Inger Christensen, Rainald Goetz und Jossif Brodskij. Dass diese Kompositionen keiner poetischen Programmatik folgen und schon gar nicht vertonen, steht außer Frage. Auch hier gilt die Absage an die Konsistenz: Riehm stülpt der Musik nicht die Semantik der Texte über; Sprache und Klang bleiben autonom, jegliche Form der narrativen Verdopplung wird ausgeschlagen.
aprikosenbäume gibt es, aprikosenbäume gibt es. Mit diesen Worten beginnt der 1981 entstandene Gedichtzyklus „alfabet“ der dänischen Lyrikerin Inger Christensen. „alfabet“ ist eine Bestandsaufnahme, in der die schiere Existenz von Dingen, sortiert nach den Anfangsbuchstaben ihrer sprachlichen Bezeichnung im Dänischen, referiert wird. Dementsprechend fungiert als Dreh- und Angelpunkt das Verb „findes“ – „es gibt“. Ausgehend von der schlichten Feststellung des Vorhandenseins von Aprikosenbäumen, beginnt der Text sich zu verdichten; der einzelne Satz des Anfangs steigert sich sukzessive in immer längere Gedichte. Der Abfolge des Textes liegt eine arithmetische Formel zugrunde – die Wachstumsreihe des mittelalterlichen Mathematikers Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 … Jeder Abschnitt des Gedichtes ist einem Buchstaben zugeordnet und dieser wiederum einer Stelle in der Fibonacci-Reihe, die angibt, wie viele Zeilen das Gedicht umfasst. Während dem „a“ nur eine Zeile entspricht, besteht der dem „n“ zugehörige letzte Teil aus 610 Zeilen.
In dieser Kombination von Poesie und Mathematik liegt ein Charakteristikum von Inger Christensens Arbeit: Im Zusammenwirken von rechnerischer Akribie und dichterischer Erfindungsgabe entsteht eine Form von Distanz, eine „Aufweichung“ der auktorialen Kontrolle des Entstehenden:
Wenn ich [Christensen] Gedichte schreibe, dann kann es mir einfallen, so zu tun, als schriebe nicht ich, sondern die Sprache selber. Ich tue so, als wäre es möglich, als Person ein wenig zurückzutreten und die Sprache sozusagen von außen zu überwachen, so als hätte ich sie selber nie benutzt.
Dass ein solches Denken bei Rolf Riehm Anklang findet, überrascht nicht, sind doch die Eigendynamik des Materials, die Verbindung von konstruktiven und assoziativen Momenten ebenso grundlegende Konstituenten seiner Musik. An Christensens Gedicht faszinierte ihn die Ungleichartigkeit der kreativen Methoden, das „paradoxe Geflecht aus rigider Formalistik und austreibender Wörterflora“, wie er es formuliert. „Mit der Musik“, so Riehm, trete „ein weiterer Aktionsraum dieser Verfahrensweisen auf den Plan. Das Geflecht wuchert weiter, aber in einem anderen Genre“.
Seine 2004 entstandene Komposition für Kontrabassklarinette, Violine, Violoncello, Trompete, Posaune und Zuspielung beginnt mit der ersten Strophe von „alfabet“, gelesen von Inger Christensen; im Folgenden übernimmt dann die Kontrabassklarinette die Rolle des „Rezitators“. Deutlich ist zu hören, wie die Techniken der Dichtung die Musik bestimmen: der Zeilenbau, die alphabetisierende Formelhaftigkeit der einzelnen Strophen, die „sprechende“ Dramaturgie der Solostimme. Zu keiner Zeit finden sich dagegen musikalische Nachbildungen der phonetischen Eigenheiten des Textes oder anders geartete Annäherungen an den „Sprachkörper“ (Riehm) der Wörter. Die Kontrabassklarinette bleibt im ersten Drittel des Stücks der alleinige Protagonist, erst dann treten die übrigen Instrumente allmählich ins Klanggeschehen ein. Zunächst den Solisten verhalten flankierend, greifen sie dessen Rezitationston nach und nach auf.
Ab diesem Moment ließ Riehm eine andere, von Christensens Dichtung unabhängige Assoziation in die Musik dringen: das Bild „Dans mes rêves je t’adore“ des Berliner Malers Bernhard Martin, das den Tagtraum einer staubsaugenden Hausfrau illustriert. Gegenstand ihres Begehrens ist ein nackter Mann, der vor einer Kitschkulisse ins Wasser hechtet. Was das mit Christensens Lyrik zu tun hat? Nichts, sagt Riehm, vielmehr vermittelten die beiden sich fremden Ebenen „eine Vorstellung von den depravierten Interaktionen, zu denen die kommunikativen Mittel inzwischen nur noch fähig sind“. In dieser drastischen Art der Verweigerung von Kontinuität wird Riehms Vertrauen in die Unerlässlichkeit des gedanklichen Sprungs deutlich: Er unterbricht die anfänglich in Aussicht gestellte Entwicklung seiner Komposition, um in einer Parenthese Gesellschaftskritik zu üben. Dass danach Christensens Stimme zurückkehrt, die Komposition zu ihrem „Thema“ zurückfindet, lässt den Querverweis ebenso fremd wie akzentuiert erscheinen. Das Moment des Widerspruchs, das Riehm in „alfabet“ ausmacht, wird in seiner Musik fortgeführt:
Ein Gefühl für die Unvereinbarkeit von Konstellationen erzeugen, für ruinöse Mittel
Einer Unvereinbarkeit ist auch Riehms 1994 fertiggestellte Komposition Ahi bocca, ahi lingua für vier Vokalisten auf der Spur. Der Titel ist ein Zitat aus Claudia Monteverdis Madrigal „Sì, ch’io vorrei morire“ („Ja, ich will sterben“) aus dem 1603 erschienenen „Quarta Libro dei Madrigali“. Monteverdis Stück für fünf Stimmen gehört zu den erotisch explizitesten Werken des Komponisten – das unverhohlene Thema ist der Liebesakt, der ersehnte Tod eine Metapher für dessen Höhepunkt. Im Zentrum des Textes stehen mit „bocca“ (Mund) und „lingua“ (Zunge) die Körperteile, die sowohl für das imaginierte Geschehen als für dessen gesangliche „Wiedergabe“ konstitutiv sind – der Text benennt sie, seine Hervorbringung hängt von ihnen ab. Man könnte darin eine doppelte Einlösung dessen sehen, was der Madrigalstil der Seconda pratica zum ästhetischen Leitbild erhob: die „Vermenschlichung“ des Wortes mit musikalischen Mitteln. „Nichts als Vortäuschungen (Simulationen) und Ersätze (Simulakren)!“, macht dagegen Rolf Riehm aus und betreibt in seiner eigenen kompositorischen Auseinandersetzung mit der Gattung Madrigal eine klare Trennung von Gesang und Sprache. Textliche Grundlage ist ein kurzer Dialog von Rainald Goetz.
Krieger: Wenn du singst, höre ich nichts. Erzähle mir lieber wirkliche Geschichten. Hirn: So eilten wir dahin, Stille, Schrift, und ich erzählte wirkliche Geschichten.
Kein Wort dieses Textes wird bei Riehm gesungen – die textlose Musik findet zwischen den Bedeutungsträgern statt:
Wo der Text in die Emphase der Interpunktion ausweicht, habe ich Musik gesetzt.
„Vertont“ werden also die Leerstellen nach den Satzzeichen, womit, so Riehm, die madrigaleske Textnähe nicht aufgegeben, sondern durch einen anderen Zeitbegriff artikuliert werde: den der Verschiebung. Indem die Musik in den Zwischenräumen stattfindet, kann sie auf den vorangegangenen Text Bezug nehmen, ohne ihn zu doppeln oder ihn – ans Wort „gekettet“ – auszudeuten. In diesem Abstand schafft Riehm der Musik einen Freiraum:
Die fruchtbare Distanz zwischen dem, was man noch sagen kann (Text), und dem, was in seiner Gefühlskraft, raschen Reaktionsfähigkeit, nervösen Empfindsamkeit weit darüber hinausgeht (Musik) ist bei mir ins zeitliche Hintereinander entfaltet. Text und Musik autonom und doch innig verbunden.
Diese Autonomie findet sich in Ahi bocca, ahi lingua letztlich auch in der konsequenten Realisierung der im Titel angelegten Differenz: Die „bocca“ verweist auf den aus „zungenlosen“ Phonemen bestehenden Gesang, während die doppelsinnige „lingua“ nunmehr exklusiv die Sprache meint.
Die unterschiedlichen Qualitäten von Musik und Sprache thematisiert Riehm auch in der Komposition Schlaf, schlaf, John Donne, schlaf tief und quäl dich nicht für Violine, Bassklarinette, Akkordeon und Keyboard: Das Stück entstand für die Wittener Tage des Jahres 1997 – „Musik – Sprache“ hieß damals das Leitthema. Im Rahmen der vorbereitenden Lektüre stieß Riehm auf einen Artikel in der Berliner Politik- und Kulturzeitschrift Freibeuter, in dem vehement eine Wiederbelebung des Werks von John Donne gefordert wurde. Riehm, dem der englische Renaissancedichter bis dahin nur dem Namen nach bekannt war, erinnert sich:
Dieser Autor schrieb über Donne, als wäre der eine Lupe auf die gegenwärtige Gefühlskarte.
Daraufhin beschäftigte sich Riehm mit Donne sowie mit weiteren seiner Wiederentdecker – T.S. Elliot, Van Morrison und Jossif Brodskij. Ein Werk von Brodskij, seine 1963 entstandene „Große Elegie für John Donne“, war letztlich auch der Ausgangspunkt der Komposition.
Brodskijs Elegie ist bei Riehm auf einen einzigen Satz reduziert:
Schlaf, schlaf, John Donne, schlaf tief und quäl dich nicht.
Und obgleich dieser Satz in Form eines Stimmsamples – auf eine Dauer von fast zwanzig Minuten gestreckt – fast das gesamte Stück grundiert, hat dessen semantischer Gehalt keine Auswirkung auf den musikalischen Verlauf; vielmehr wirkt er als „eine Art Beleuchtung oder Widerschein“. Das phonetische Material des Zitats wird zum Rückgrat der klanglichen Entwicklung. Während die Stimme anfänglich noch in Bewegung ist und ihre weitschweifigen Melismen von den Instrumenten dezent umspielt und erweitert werden, kehrt sich das Verhältnis nach einem Drittel des Stücks um. Die Stimme beschränkt ich nun auf lang ausgehaltene Töne, und die Instrumente übernehmen den Part des arabesken „Gesangs“. Besonders deutlich wird diese Inversion nach einer zwischengeschalteten Einspielung, in der Brodskij, begleitet von einem verzerrten Technobeat, auf Russisch aus einem seiner Gedichte rezitiert. Danach beschränkt sich die Stimme über acht Minuten auf den Vokal „u“, bevor das ergänzende „… nd quäl dich nicht“ lakonisch nachgeschoben wird.
Über die Konjunktion ,und‘ erstarrt die melismatische Energie im Gesang und springt auf die sonst nur begleitenden Instrumente über, die sich in einer riesigen Exklamation verausgaben. Da, wo sich die Stimme die Seele aus dem Leib singt, da hört man die Instrumente und nicht den Gesang, und zwar auf einem Textteil, der nichts sagt. Der Gesang dagegen ist schon auf dem Anlaut vereist.
In „Schlaf, schlaf, John Donne…“ zeigt Rolf Riehm wiederum, dass die Fährten, die er legt, irreführen. Das Stück ist keine Musik über eine Gedichtzeile, keine Musik über John Donne oder Jossif Brodskij. Es ist eine Musik mit einem poetischen Satz, gerissen aus einem Zusammenhang, den die Komposition weder erzeugen noch ersetzen will. In diesem Sinne schließt Riehm seinen Werkkommentar mit einer Aussage, die dem Versuch, seine Musik auf einen Begriff zu bringen, einmal mehr eine Absage erteilt – und insofern exemplarisch für sein gesamtes kompositorisches Werk gelten kann:
Man kann hier nichts näher bezeichnen, es gibt keine ,Linie‘. Es ist einfach so, dass einem alles eine zeitlang unterkommt. Und das ist stärker als eine vorsätzliche konzeptionelle Absicht.
Michael Rebhahn, Vorwort
Fakten und Vermutungen zum Komponisten + IMDb + Archiv +
Kalliope
Thomas Sparr: Lesbarkeit der unlesbaren Welt. Die dänische Lyrikerin Inger Christensen, Merkur, Heft 567, Juni 1996
Uljana Wolf sprach im Rahmen des poesiefestival berlin 2008 mit Inger Christensen.
Zwiesprachen: Nico Bleutge über Inger Christensen. Am 5. November 2019 im Lyrik Kabinett, München
Jan Wagner: Weltenformeln. Vor allem über Inger Christensen. Zweiter Bamberger Poetikvortrag im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur
Beim 1. Internationalen Literaturfestival in Berlin, am Samstag, den 16. Juni 2001, lesen im Festsaal der Sophiensäle in Berlin-Mitte die Lyriker Rita Dove (USA), Günter Kunert (Deutschland) und Inger Christensen (Dänemark), gefolgt von einer Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum (moderiert von Iso Camartin).
Fakten und Vermutungen zu Inger Christensen + Instagram + IMDb +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
IMAGO + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Inger Christensen: FAZ ✝ Die Zeit ✝ poetenladen.de ✝
Neue Zürcher Zeitung ✝ FR ✝ Die Welt ✝ cafebabel.com ✝ Tagesspiegel
Inger Christensen spricht 2008 mit Paal-Helge Haugen.



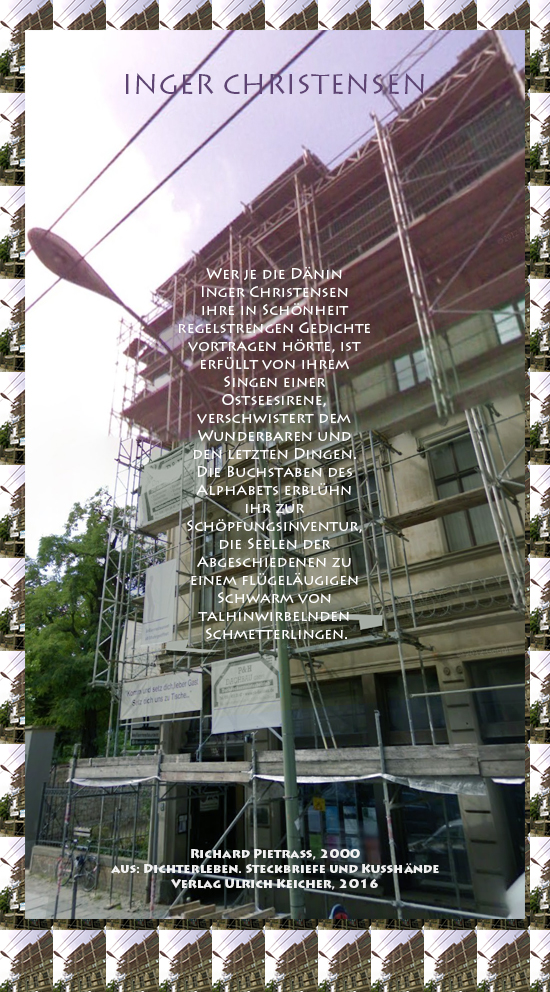












Schreibe einen Kommentar