NACHRICHT AUS LESBOS
Ich weiche ab und kann mich den Gesetzen
Die hierorts walten länger nicht ergeben:
Durch einen Zufall oder starren Regen
Trat Wandlung ein in meinen grauen Zellen
Ich kann nicht wie die Schwestern wollen leben.
Nicht liebe ich das Nichts das bei uns herrscht
Ich sah den Ast gehalten mich zu halten
An anderes Geschlecht ich lieb hinfort
Die runden Wangen nicht wie ehegestern
Nachts ruht ein Bärtiger auf meinem Bett.
Und wenn die Schwestern erst entdecken werden
Daß ich leibhaft bin der Taten meines Nachbilds
Täterin und ich nicht meine Schranke
Muß Feuer mich verzehren und verberg ichs
Verrät mich bald die Plumpheit meines Leibes.
![]()
Das Buch
Traurig und trotzig, diskret und persönlich, mutwillig, verspielt und doch ernsthaft sind diese Gedichte. Natur und Gesellschaft, innere und äußere Verhältnisse werden mit lyrischer Präzision festgehalten. Man braucht nicht zwischen den Zeilen zu lesen. Sarah Kirsch erklärt das so:
Wenn man schreibt, schreibt man erst mal für sich selber, darüber, was einen selber angeht. Danach setzt die eigentliche Arbeit ein: Man überprüft, ob das ein persönliches Gedicht ist. Das kann es ruhig sein: aber wenn es nur privat ist, sollte man es lieber in den Papierkorb werfen, denn dann gibt es für andere Leute nichts mehr her… Ich habe da ein paar Sicherungen eingebaut. Wenn ich ein Gedicht geschrieben habe, kontrolliere ich es, ganz lange, das heißt: ich arbeite immer daran… Die beste Sicherung aber ist, daß man ein paar Freunde hat, denen man vertraut…
Deutscher Taschenbuch Verlag, Klappentext, 1978
Beitrag zu diesem Buch:
Karl Krolow: Spröde Sprache
Nürnberger Nachrichten, 3.2.1978
Unter anderen Titeln auch in: General-Anzeiger, Bonn, 4.3.1978
Tagesspiegel, Berlin, 19.3.1978
Darmstädter Echo, 21.4.1978
Der Droste jüngere Schwester
„Die ganze Welt ist Bühne“ – heißt es bei Shakespeare. Für die Lyrikerin Sarah Kirsch ist die Welt eher eine Folie. Ihre Poesie bietet keine Lebensdeutung. Vielmehr vergegenwärtigt sie Seelenzustände: Sie macht Empfindungen und Stimmungen bewußt. Wem? Dem Leser? Nicht unbedingt.
Gewiß wäre es übertrieben, wollte man sagen, er werde von Sarah Kirsch ignoriert. Schließlich läßt sie ihre Verse drucken. Aber sie wendet sich nicht dem Leser zu, sie ist nicht einmal auf ihn angewiesen, will ihn nicht ermahnen oder gar überzeugen. Vom Pädagogischen will diese Lyrikerin nichts wissen, den Ehrgeiz des Aufklärers kennt sie nicht, der Gestus des Agitators ist ihr fremd. Ob sie singt oder scheinbar nur vor sich hin spricht, ob sie schreit oder flüstert – ihre Gedichte sind Selbstgespräche, ihre Poesie ist Selbstbekenntnis und Selbstdarstellung. Nur hierzu benötigt sie die Welt als Hintergrund.
Leitmotiv und Dominante dieser Verse ist eine große Sehnsucht. Nach Freude, nach Erfüllung und Glück? Oder nach Selbstverwirklichung? Man kann es kürzer sagen, mit einer einzigen Vokabel, die all das umfaßt: nach Liebe. Von ihr handelt Sarah Kirschs Lyrik auch dann, wenn Liebe mit keinem Wort erwähnt wird. Diese Dichterin ist eine Panerotikerin. Und das soll heißen: Erotisch ist nicht nur ihr Verhältnis zu den Menschen, sondern auch zur Heimat und zur Natur, zum Geist und zur Literatur, ja, sogar zur Politik.
Schon in einer ihrer frühesten lyrischen Veröffentlichungen, der „Dreistufigen Drohung“,1 fällt die für Sarah Kirschs Verse bezeichnende innere Spannung auf:
Du willst jetzt gehn?
Das sag ich dem Mond!
Da hat sich der Mond
im Großen Wagen verladen,
der fühlt mit mir, weißzahnig
rollt er hinter dir her!
Die Klinke drückst du?
Ich sag es dem Wind!
Er schminkt dich
mit Ruß und Regen
peitscht dich mit Hagelkörnern,
glasmurmelgroß.
Du mußt jetzt fort?
Gut, ich sag es keinem.
Ich werde ohne Tränen
und Träume schlafen;
nichts hindert dich.
Nicht ohne Feierlichkeit werden sie hier angerufen: der Mond und die Sterne, die den großen Wagen bilden, der Wind, der Regen und der Hagel. Aber hinter diesen pathetischen Apostrophen und den großen Gebärden verbirgt sich eine spröde Beichte. Jemand, gewiß eine Frau, wurde verlassen und will sich damit nicht abfinden. So ist die Anklage in Wirklichkeit eine Klage: Die Liebende, die in den ersten beiden Strophen heftig protestiert, ja, empört aufschreit, erkennt ihre Ohnmacht. Mit der leisen Ankündigung in der letzten Strophe – „Gut, ich sag es keinem“ – wird sie sich bewußt, daß sie die Rückkehr des Ungetreuen nicht erzwingen, sondern bestenfalls erbitten kann. Nichts hindere ihn, sagte sie, fortzugehen – was wohl bedeuten soll: Nichts hindert dich, es sei denn der Umstand, daß du mich unglücklich machst und mich wieder glücklich machen könntest. Wie elegisch der Ton der letzten Strophe auch sein mag – sie weigert sich zu kapitulieren, sie hört nicht auf zu hoffen.
Die dreistufige Drohung ist also eine dreifache, dreistufige Bitte. Und was zunächst wie Auflehnung anmuten mag, geht auf das Bedürfnis nach Hingabe zurück. Anders ausgedrückt: Die Rebellion zielt auf Unterwerfung ab. So bilden Trotz und Demut hier keinen Gegensatz. Es sind vielmehr die Pole dieses Gedichts, die Pole der Liebeslyrik Sarah Kirschs.
Die Liebe wird von ihr niemals als etwas Selbstverständliches aufgefaßt. Sie ist gleichsam ein Geschenk, eine Gnade oder ein Fluch, auf jeden Fall aber eine Notwendigkeit, auf die sich unter keinen Umständen verzichten läßt:
die Fische sind zwei
die Vögel baun Nester wir
stehn auf demselben Blatt.
Und in einem anderen Gedicht heißt es, keinen Zweifel duldend und jeden Widerspruch wegwischend:
Lieber zu Zweit verhungern als Einzeln
In goldenen Wagen spazieren fahren.
So kennt diese Poesie keine Gelassenheit, und von Distanz will sie nichts wissen. Charakteristisch für die Gedichte Sarah Kirschs ist nicht etwa die Vielfalt der Empfindungen, sondern deren Stärke, nicht der Reichtum an Stimmungen, sondern deren Heftigkeit.
Es ist eine Lyrik der großen Gefühle und der mächtigen Leidenschaften, des hochgespannten Tons und des dramatischen, wenn auch nicht melodramatischen Gestus. Daher schwanken diese Verse zwischen den Extremen, zwischen strahlendem Sonnenlicht und düsterer Nacht. Ihre Skala reicht von der Erfüllung bis zur Verweigerung, von leiser Zärtlichkeit bis zu dröhnender Wut und gewaltigem Zorn, von der Seligkeit des Triumphs bis zur Bitterkeit der Niederlage. Frühling und Herbst, die in der deutschen erotischen Dichtung so beliebten Jahreszeiten, spielen bei Sarah Kirsch kaum eine Rolle. Sie bevorzugt den heißen Sommer und den kalten Winter.
Ob himmelhoch jauchzend oder zum Tode betrübt – sie schreitet den ganzen Kreis der Schöpfung aus, vom Himmel durch die Welt zur Hölle, und verwandelt alles, übermütig und treuherzig zugleich, in die Szene ihrer Liebe. Die Frau, die im Mittelpunkt dieses poetischen Universums steht, sehen wir meist, wie schon in der „Dreistufigen Drohung“, als Abgewiesene, als Betrogene oder Verschmähte: Jemand hat sie gekränkt und verletzt, sie gibt nicht auf, sie wehrt sich, hofft und wartet. Häufiger als Triumphmeldungen oder Liebesbeteuerungen finden sich in Sarah Kirschs Lyrik Notsignale, Hilferufe und auch schreckensvolle Verdammungen.
Das Gedicht „Fluchtformel“ wünscht dem „Zarthäutigen“, dessen Poren verstopft seien und der „die einfachsten Dinge“ nicht mehr vernehmen könne, Eis „zwischen die Zehen mit denen ich / Einstmals die Finger verflocht“. Die „Rufformel“ appelliert an Phöbus, den Geist des Ungetreuen zu verwirren, daß er nicht weiß,
… ob er Ovid
Gelesen oder gesehen hat ob ich
Sein Löffel seine Frau bin oder
Nur so ein Wolkentier
Quer übern Himmel
Doch hinter dieser Aggressivität verbirgt sich nichts anderes als die Selbstverteidigung einer Unglücklichen, die sich tödlich getroffen fühlt: Die Intensität der Verwünschung läßt die Intensität der Bindung erkennen.
Aber man sollte Sarah Kirschs bisweilen geradezu raubtierhafte Aggressivität nicht immer und nicht unbedingt für bare Münze nehmen: Was sich in diesen Versen an Passion (nicht ohne gelegentliche Koketterie) und an Zorn (nicht ohne Anmut) findet, hat mit ihrem Lebensgefühl zu tun, dem man magische Züge nachsagen kann, und mit ihrer Affinität zum Märchenhaften. Und das Märchenhafte ist mehr als ein Ornament ihrer Lyrik – es bildet ihr geheimes Fundament.
Nicht nur Menschen und Götter, auch Tiere, Bäume und Pflanzen, Flüsse und Gestirne, Naturphänomene jeglicher Art und schließlich sogar tote Gegenstände – sie alle nehmen an den dramatischen Vorgängen teil, müssen den Liebenden beistehen oder sie rächen, sie sollen ihre Gefühle und Stimmungen sichtbar und spürbar machen: Es sind Akteure auf einer Bühne, die riesig ist und dennoch stets intim bleibt.
Geh unter schöne Sonne, stirb
weniger kunstvoll, Haus zerfall
zögert nicht: mein grauer Delphin
ist hin zu anderer Küste geschwommen
Im „Klagruf“ ist „mein schneeweißer Traber“ durchgegangen. Das Gedicht „Unglück läßt grüßen“ beginnt mit den Worten:
Seit er fort ist fallen Palmen um…
Und in dem Gedicht „Der Himmel schuppt sich“ wird der Schnee zu Hilfe gerufen:
Schnei ihn ein, Schnee fall aus allen Wolken
bring Nacht, Mauern aus Eis, teil
deine Flocken ohne Unterlaß, roll ihn in Hochlandlawinen.
Der Schnee, heißt es hier, sei das „Reimwort auf Weh“. Was immer Sarah Kirsch sieht und evoziert – es sind Reimworte auf ihr Weh und Glück. Und wohin sie, getrieben von der Sehnsucht nach fremden Orten und Welten, auch kommen mag – wenn sie etwas entdeckt, dann die Kontinente der eigenen Seele. Sie findet stets sich selbst:
In Pflaumenmuskesseln
spiegelt sich schön das eigne Gesicht und
Feuerrot leuchten die Felder.
Das Gedicht „Schwarze Bohnen“ vergegenwärtigt mit äußerster Knappheit die Niedergeschlagenheit oder Verzweiflung einer Frau, die offenbar vergeblich auf ihren Freund gewartet hat:
Nachmittags mahle ich Kaffee
Nachmittags setze ich den zermahlenen Kaffee
Rückwärts zusammen schöne
Schwarze Bohnen
Nachmittags ziehe ich mich aus mich an
Erst schminke dann wasche ich mich
Singe bin stumm
Die emotionale Substanz und die sprachliche Einfachheit dieser Verse (freilich mit dem erstaunlichen, gleichnishaften Motiv der schwarzen Bohnen) beglaubigen sich gegenseitig. Die Diktion ihrer Lyrik verpönt das Preziöse und liebt das Kuriose. Gern läßt Sarah Kirsch ihre Figuren in verfremdenden, zumal mittelalterlichen Kostümen auftreten. Ja, sie hat bisweilen eine Schwäche für das Skurrile. Sie ist jedoch stark genug, um das, was sie darstellt, nicht zu skurrilisieren. Mit anderen Worten: Ihre Poesie ist authentisch.
Es fehlt in Sarah Kirschs Versen keineswegs an Bildern anmutiger Landschaften und moderner Großstädte, und es sind Bilder von hoher Plastizität und Suggestivität. Aber ob es Berlin, Moskau oder Venedig ist, die Mark Brandenburg oder die Toscana, die Ostsee oder der Apennin – die Topographie liefert nur den Hintergrund, die Landschaften dienen bloß als Schauplätze. Es sind Projektionsflächen für psychische Erlebnisse, die mit diesen Orten wenig oder nichts zu tun haben.
Das Gedicht „Moskauer Tag“ zeichnet eine idyllische Szene auf einem Platz in der Innenstadt von Moskau. Die hier berichtet, sitzt in der Sonne und raucht. Sie registriert, was sie sieht: ein Puschkin-Denkmal, Fontänen, Spatzen und Tauben, einen Bauer im schwarzen Mantel, eine Großmutter mit einem gebündelten Säugling. Inmitten dieser Beschaulichkeit wird sich die Besucherin ihrer eigenen Person bewußt:
Saß da
Mit mir auf der Bank ich in der Mitte ich rechts von mir
Und links auch noch.
Etwas weiter folgt die trotzige und natürlich unwahre Behauptung:
Mir tat nichts weh ich wünschte dich nicht.
In Venedig ergeht es ihr nicht anders: Der Markusplatz kann sie von ihrer eigenen Existenz, von ihrer Sehnsucht nicht ablenken. Was also fällt ihr dort ein?
Daß es hier Steine gibt, auf denen
Im Winter dein Fuß stand.
In einem anderen Venedig-Gedicht sieht sie, im Café Florian am Markusplatz sitzend, „mein Kind, das als Geisel in Berlin-Mitte geblieben war“. Die Prosaminiatur „Die Toscana“ widmet dem Marktplatz von Siena und dem Dom, dem „sechzehnbeinigen Zebra“ mit dem zuckenden Fell, nur wenige Worte, stellt indes fest:
Tage später träum ich den Platz. Drauf stehn, die ich liebe, nun zwei…
Wer sich nach jener tragischen Grundhaltung sehnt, der ein großer Teil der deutschen Lyrik auch unseres Jahrhunderts gerecht werden möchte, wird bei Sarah Kirsch nicht auf seine Rechnung kommen. Ihr Artistentum nährt sich aus einer trotzigen und elementaren Lebensbejahung, aus einem Daseinsgefühl, das man vitalistisch nennen könnte. Erotik und eine Naturverbundenheit, die frei von vager Naturschwärmerei ist, finden hier zu einer selbstverständlichen Einheit zusammen.
Die Landschaft sei „groß und voller Bewegung“ heißt es im Gedicht „Das schöne Tal“: Berge, schwarze Wolken, Blitze, krachende Donner, eine wahre Sintflut und „alles in einer Glocke“. In der zweiten Strophe schrumpft der Raum: statt der mächtigen Landschaft nur noch das kleine Auto, das dieses Gebirgstal durchquert. Und während sich am Ende der ersten Strophe die „Blitze bespringen“, endet die zweite mit den Worten:
Er legt mir die Hand in den Schoß.
Ähnlich beschwört die Prosaminiatur „Anziehung“ in nur drei Sätzen, lapidar und generös zugleich, den Nebel und den Mond, die Wolken, das Eis und See. Indes lautet der vierte und letzte Satz schlicht:
Komm über den See.
Für diese hocherotische Weltsicht bietet das Gedicht „Rot“ die poetische Formel:
In Olevano
Fangen die Berge
Im Schlafzimmer an, die Akazien wachsen
Ein ganzer Wald aus dem Spiegel…
Und in dem Gedicht „Verloren“ ist eine geplante Reise des Liebespaars mit der Fortbewegung seines Bettes identisch:
… in zwei Wochen
Steht es auf der Piazza Navona oder
Wir segeln Mund an Mund durch die Berge…
Diese betont emotionale Perspektive, die ebenso Hingabe wie Trotz umfaßt, kennzeichnet zugleich Sarah Kirschs Beziehung zur DDR und zum Kommunismus. Für sie, die 1935 geboren wurde und in dem Land zwischen der Elbe und der Oder aufwuchs, war die DDR das prägende, das entscheidende Jugenderlebnis.
Das methodische und diskursive Denken ist ihr fremd, sie reagiert auf die Umwelt vor allem intuitiv und impulsiv. Natürlich konnte die Bürgerin der DDR die Politik schwerlich aussparen oder gar ignorieren, gewiß wäre es falsch oder zumindest überspitzt, wollte man sagen, ihr Verhältnis zur SED, der sie viele Jahre angehörte, sei unpolitisch gewesen. Aber eine politische Dichterin war sie nie.
Was die Buchstaben DDR der Sarah Kirsch bedeuteten, hatte nur bedingt mit ideologischen und politischen Kategorien zu tun. Denn sie symbolisieren für sie eben nicht bloß den Staat, zu dem sie sich bekannte, und nicht bloß die von ihm vertretene Doktrin, sondern zugleich und in erster Linie die Heimat – und dies keineswegs nur im geographischen Sinne.
Sie suchte in der DDR und in der SED, was sie von Jugend an dringend benötigte: Zuflucht und Obhut. Sie fand dort, um es mit einer altmodisch klingenden Vokabel anzudeuten, „Geborgenheit“. So war es ein Verhältnis – und die Zweideutigkeit dieses Wortes ist hier durchaus angebracht –, das in hohem Maße von Gefühlen bestimmt wurde, vom elementaren Bedürfnis nach Vertrauen und Freundschaft.
Nicht der Klassenkampf zog die junge Sarah Kirsch an, wohl aber die gemeinsame Aktion, nicht marxistische Gedanken faszinierten sie, wohl aber die menschlichen Beziehungen zwischen den im Zeichen einer nationalen Aufgabe und einer übernationalen Idee vereinten Individuen. Es war ein gleichsam intimer, ja, fast schon erotischer Patriotismus, der sie mit der SED-Welt verband: In einem ihrer frühen Gedichte nannte sie die DDR „mein kleines wärmendes Land“.
Die Entwicklung in den späten sechziger Jahren – und erst recht in der folgenden Zeit – blieb nicht ohne Einfluß auf Sarah Kirsch: Sie reagierte auf die Zustände in der DDR unruhig und eigenwillig und mit wachsender, vornehmlich emotionaler Skepsis. In widerborstigen, sprunghaften und schwermütigen Versen hat sie Erfahrungen häufiger verallgemeinert als verschlüsselt, doch auf jeden Fall scharf artikuliert.
Viele dieser Gedichte lassen sich als Idyllen bezeichnen – nicht beschauliche freilich, sondern düstere: Sie sollen weder besänftigen noch trösten, hingegen sollen sie aufstören, mit poetischen Mitteln irritieren, wenn nicht provozieren. Eine solche Idylle ist das Gedicht „Trauriger Tag“ aus der Sammlung Landaufenthalt (1967):
Ich bin ein Tiger im Regen
Wasser scheitelt mir das Fell
Tropfen tropfen in die Augen.
Die Friedrichstraße wird erwähnt, der Alexanderplatz, die Spree. Aus den Versen spricht Wut:
Ich brülle am Alex den Regen scharf.
Und:
Ich fauche mir die Straße leer
und setz mich unter ehrliche Möwen.
Muß man zu den Möwen gehen, um sich nicht einsam zu fühlen? Was verbirgt sich hinter dem dunklen, bösen Stimmungsbild? Etwa die List der Naivität? Jedenfalls geht es nicht um Persönliches, denn das Fazit lautet:
Ich meine es müßte hier
noch andere Tiger geben.
Enttäuschung und Verbitterung bilden den Urgrund vieler dieser Gedichte, das Bewußtsein der Bedrohung bestimmt ihr Klima:
Die Nacht streckt ihre Finger aus
Sie findet mich in meinem Haus
Sie setzt sich unter meinen Tisch
Sie kriecht wird groß sie windet sich
Und weil jene, die hier spricht, bedroht ist, wenden sich die Menschen von ihr ab, Angst erfüllt ihr Zimmer wie Rauch:
… dann
Zähl ich alle meinen lieben
Freunde an den Fingern ab
Es sind zu viele Finger, die ich hab
Zu wenig Freunde sind geblieben
Das Gedicht „Nachricht aus Lesbos“, ebenfalls im Band Zaubersprüche (1973) enthalten, weist schon auf den Jahre später erfolgten Bruch zwischen Sarah Kirsch und ihrer Welt hin: Eine Frau weigert sich zu leben, „wie die Schwestern wollen“. Sie kann nicht mehr „die runden Wangen lieben“, sie will und muß sich für das andere Geschlecht entscheiden:
Nachts ruht ein Bärtiger auf meinem Bett.
Diese Abwendung ist politisch gemeint, die ersten beiden Verse sagen es unmißverständlich:
Ich weiche ab und kann mich den Gesetzen
Die hierorts walten länger nicht ergeben.
So wird der sexuelle Wechsel mit der Abweichung von der Parteilinie assoziiert. Und es handelt sich nicht etwa um einen nur instinktiven Entschluß. Denn die Wandlung trat ein „in meinen grauen Zellen“, sie ist ein Protest gegen „das Nichts das bei uns herrscht“, gegen eine sterile Gesellschaft, in der Abweichler mit dem Tod bestraft werden.
Ähnlich wird – in dem Gedicht „Schneeröschen“ – erotische Vereinsamung zum Bild politischer Gefährdung. Die hier berichtet, sieht sich von einer stündlich wachsenden Schneehecke umgeben:
Keiner kommt durch ich befinde mich abgeschnitten
Weg sind die Wege…
Doch jener, der sie retten könnte, schlägt aus dem Eis ein Abbild, kauft „gläserne Blumen“ und verfaßt „den künstlichsten Nachruf“, der ihn berühmt macht „unter den Eisdichtern des Landes“.
Die Liebe ist in Sarah Kirschs Lyrik auch die Metapher für die Teilung Deutschlands. „Die dunkle, die weggleitende Sonne“ weckt die Erinnerung an „dich, auf der anderen Seite der Welt“. In einem anderen Gedicht aus dem Band Rückenwind (1976) heißt es:
… mein Himmel
Dehnt sich will deinen erreichen
Bald wird er zerspringen…
In dem Gedicht „Der Milan“ hören wir von einem wüsten Vogel, der
noch arglos
Segelt in Lüften. Hat er dich
Im südlichen Auge, im nördlichen mich?
Wie wir zerrissen sind, und ganz
Nur in des Vogels Kopf…
Ein uraltes Motiv wird hier aufgenommen und variiert: Es ist die Geschichte von den beiden Königskindern, die einander so lieb hatten und zusammen nicht kommen konnten. Und wie eh und je lautet die Anklage: Schlecht ist die Welt, die das Glück der Liebenden verhindert.
„Herzschöner wollen wir Julia und Romeo sein?“ – lautet die scheinbar treuherzige Frage in dem Gedicht „Datum“. Es sei günstig, man wohne
Wohl in der gleichen Stadt, aber die Staaten
Unsere eingetragenen Staaten gebärden sich, meiner
Hält mich und hält mich er hängt so an mir…
Wenige Seiten weiter findet sich in diesem Band das Gedicht „Ende Mai“. Es ist nicht ein lyrisches Ich, das hier seine Absichten verkündet, sondern Sarah Kirsch selber: Sie will sich „aus den Stäben der Längen- und Breitengrade endlich“ befreien.
In der „Trennung“, einem der zentralen Bekenntnisgedichte aus dem Band Drachensteigen (1979), erklärt eine Verzweifelte, was sie zu tun gedenkt:
Wenn ich in einem Haus bin, das keine Türen hat
Geh ich aus dem Fenster.
Nach dem sie sich für den ausgebürgerten Wolf Biermann engagiert hatte und aus der SED verstoßen wurde, verließ Sarah Kirsch im August 1977 die DDR und lebt seitdem in West-Berlin.
Das Verbum „verlassen“ klingt in diesem Zusammenhang allzu harmlos, die Vokabel „Flucht“ träfe nicht zu, da die Übersiedlung von den Behörden der DDR genehmigt wurde. Gleichwohl haben wir es mit einem hochdramatischen Vorgang mit deutlich erotischen Zügen zu tun: Diese Abwendung von der DDR erinnert an den Abbruch einer langjährigen Liebesbeziehung. Unverkennbar ist der Schmerz einer Liebenden, die begreift, daß sie von ihrem Partner getäuscht und hintergangen wurde, und die dennoch die Gefühle, die sie für ihn von Jugend an hatte, unter keinen Umständen missen möchte.
Mit ihrer Übersiedlung in den Westen trennte sie sich von ihrer Heimat, ohne damit ihr zentrales Erlebnis im nachhinein zu verurteilen. In dem Gedicht „Der Rest des Fadens“, dem ersten in West-Berlin geschriebenen, hat sie hierfür das poetische Bild gefunden. Vom Drachensteigen ist die Rede, von einem „Stern aus Papier“, der „unhaltbar ins Licht gerissen“ wird und entschwindet. Das Fazit, gleichsam die Bilanz einer Generation, die sich in der DDR dem Kommunismus verschworen hat und die an ihre Zeit der großen Illusion mit Rührung zurückdenkt, lautet:
Uns gehört der Rest des Fadens und daß wir dich kannten.
Was wohl heißen soll: Unsere Hoffnung wurde enttäuscht, man hat uns betrogen. Doch haben wir das Glück gekannt, an Ideale zu glauben, an eine Utopie. Und dieses Glück kann uns keiner mehr nehmen.
Die Metapher vom Rest des Fadens, dem unnützen und doch kostbaren, beweist abermals, in wie hohem Maße Sarah Kirsch dem Visuellen verpflichtet ist: Ihre Gedichte gehen von Bildern aus oder laufen auf Bilder zu, ihre Verse sind voll Farbe, voll Licht und Schatten, Blitz und Donner. Sie erinnern uns daran, daß es auch in unserer modernen Welt Phänomene gibt (und zwar keineswegs periphere), die sich nur auf dem Weg über die Lyrik erschließen lassen.
Aber was immer Sarah Kirsch benennt, worauf sie auch verweist – sie befaßt sich unentwegt mit der eigenen Person. Doch fühlt sich der Leser, wie wenig sie ihn beachten mag, niemals abgewiesen oder ausgesperrt. Im Gegenteil: Der Spielraum, den ihm Sarah Kirsch zwischen den Worten und Zeilen gönnt, erschwert zwar oft die Deutung ihrer Motive, fordert indes zugleich seine Phantasie heraus. Gerade ihre natürliche, gänzlich selbstverständliche und nie um Rechtfertigung bemühte Egozentrik und zugleich jener weite Spielraum bieten dem Leser, wonach er sich, bewußt oder unbewußt, sehnt: Identifikationsmöglichkeiten.
Indem sie immer nur zeigen will, was, mit Goethe zu sprechen, „durch das Labyrinth der Brust / wandelt in der Nacht“, artikuliert sie ein weibliches Existenzmodell, das freilich unsere militanten Feministinnen befremden, wenn nicht entsetzen muß: Indem sie von sich selber spricht, spricht sie im Namen anderer. Darin liegt eine der Ursachen ihres starken Erfolgs.
Exemplarisch ist in dieser Hinsicht die glanzvolle Parabel vom König. Sie beginnt mit den Worten „Ich wollte meinen König töten / Und wieder frei sein“, erzählt von einer Rebellion gegen die Abhängigkeit und endet, auf den Judaskuß im Markus-Evangelium anspielend, mit der überraschenden Unterwerfung:
Küßte den andern, daß meinem
König nichts widerführe.
Ein Gleichnis also vom Individuum, das den Zwang freiwillig auf sich nimmt. Aber welchen Zwang? Wer ist der König? Der Staat? Das Kollektiv? Der Kommunismus? Die Kunst? Oder vielleicht eine Person? Der Geliebte? Der Ehemann? Man soll einer Dichtung nicht abpressen, was sie sich selber gibt. Die Antwort kann nur lauten: Jeder hat seinen König.
In einem ihrer Gedichte besingt Sarah Kirsch die große Annette von Droste-Hülshoff, die Wolfgang Koeppen einmal eine Besessene nannte, eine Poetin, die sich „immerfort bespiegelte und nicht begriff“.2 Ehrerbietig setzt die Spätgeborene an:
Der Droste würde ich gern Wasser reichen.
Doch bald fallen auch in diesen Versen diskrete erotische Akzente auf: Die beiden Lyrikerinnen sitzen am Spinett und spielen „vierhändig Reiterlieder oder / Das Verbotne von Villon / Der Mond geht auf – wir sind allein“. Die Vertraulichkeit verblüfft, die Nachbarschaft mag kühn sein. Ein Sakrileg ist sie nicht.
Marcel Reich-Ranicki, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.5.1980
Auf Sarah Kirsch
Liebe Sarah Kirsch, sehr geehrte Damen und Herren, obgleich ich selber Gast in Bergen-Enkheim, fühle ich mich heute abend doch als Mit-Gastgeber. Das gibt mir die Gelegenheit, Sarah, dich einmal offiziell zu begrüßen. Das darf auch nur höchstens einmal passieren.
Sarah Kirsch vorzustellen, das ist ein Auftrag, den ich sehr gern angenommen habe, obwohl ich damit eigentlich Eulen nach Athen trage, denn Sarah Kirsch ist heute die einzige populäre Lyrikerin deutscher Sprache, populär, wie es in den letzten Jahrzehnten nur Ingeborg Bachmann war, d.h. sie findet eine vergleichsweise große Resonanz, nicht erst seit ihrem Umzug von Ost- nach Westberlin.
Ich will nun nicht biografische Daten beifügen, die überall nachzulesen sind; manches Blatt hat sie genüßlich in ihrem Schlund zergehen lassen. Lieber will ich ein paar Sätze sagen über ihre Gedichte, die gar nicht populär genug sein können. In ihnen ist die Vielfältigkeit und Vieldeutigkeit menschlichen Lebens aufbewahrt, kleine zarte Reserveenergien gegen jene anderen ungleich größeren Energien, die danach trachten, mit dem Menschen fertig zu werden, ihn zu Ende definieren, die ihm zur letzten Eindeutigkeit verhelfen wollen, damit er abgehakt werden kann, berechenbar wird.
Zunächst einmal sind die Gedichte einfach schön, von großer entschiedener Schönheit, die manch einen Zeitgenossen, der sie unmittelbar mit unserer Realität vergleicht, als ärgerlich erscheinen mag. Liegt das aber etwa an den Gedichten, die doch nur etwas aufbewahren, das unser Ureigenstes ist, nämlich Kindheitserinnerungen, eine beinahe kreatürlich empfundene Nähe zur Natur, das Gehenlassen und die Gültigkeit von Gefühlen, von Traumbildern, Nebengedanken. Das alles wird uns doch, wird schon unseren Kindern ausgetrieben, weil wir effiziente Wesen sein sollen, nützliche Glieder in der Kette, zuverlässige Hersteller und Verbraucher.
Sarah Kirschs Zartheit ist, wenn man genauer hinschaut, robust und strapazierfähig; ihre Verse sind nicht die eines Heimchens hinterm Herd; sie sind nicht weltfremd, sondern beharren geradezu auf Welt, auf Erde, Wasser, Luft, Feuer, sie sind elementar; sie zeigen uns (glücklicherweise sind diese Groß-Substantive vom Geruch einer Blut- und Boden-Mythologie befreit worden), daß Erde, Wasser, Luft, daß alles, was da kreucht und fleucht, nicht einfach Rohstoff zur industriellen Weiterverarbeitung ist, sondern Erweiterung unseres Körpers, Geistes und unserer Seele.
Sarah Kirschs besondere Beziehung zur Natur bringt nicht Naturlyrik im traditionellen Sinne hervor, sondern eine sowohl erinnerte als auch imaginierte Ganzheit unseres Lebens. Auffällig ist, wie sicher hier ein solch diffuser Gegenstand wie die Liebe zwischen Menschen verschmolzen wird mit dem Blick auf die eigenen Bedingungen, auf die natürlichen Lebensbedingungen überhaupt; eine Einheit entsteht so, die in den Gedichten sich allerdings von Realität irritiert zeigt, die traurig und zuweilen melancholisch ist, auch das darf nicht einfach verdrängt oder mit einer Medizin heruntergespült werden.
Sarah Kirsch verzichtet oft sehr entschieden auf bloße Widerspiegelung von Realität, statt dessen erlangen, wie schon gesagt, jene zentralen menschlichen Bezirke der Erfahrung und Wahrnehmung, die heute an den Rand und über den Rand hinausgedrängt sind, wieder zentrale Bedeutung. Darin, meine ich, liegt noch immer und vielleicht mehr denn je ein Nutzen der Poesie, obwohl es ja bekanntermaßen der Poesie nicht gut bekommt, sie auf ihren Nutzen zu reduzieren. Und deshalb ist Poesie überhaupt, und im besonderen die von Sarah Kirsch, notwendig, und deshalb ist es auch gut, daß jemand, der solche Gedichte schreibt, auch einmal vergleichsweise populär werden kann.
Zwei Gedichte von Sarah Kirsch könnten für das, was ich vereinfachend gesagt habe, Belege sein. „Im Sommer“ und „Feuer“; sie sind schön und nützlich; sie handeln von unserer Welt und von den Plagen, denen sie immer eindeutiger anheimfällt. Und nichts Kampagnehaftes ist an ihnen; es ist die Welt noch nicht auf Umwelt reduziert.
Nicolas Born, 1978/79, aus Nicolas Born: Die Welt der Maschine. Aufsätze und Reden, Rowohlt Verlag, 1980
Gespräch mit Sarah Kirsch
Herlinde Koelbl: Frau Kirsch, ist es für Sie wichtig, mit der Hand zu schreiben?
Sarah Kirsch: Ich schreibe sehr viel mit der Hand, denn ich habe das Gefühl, dass die Sprache, die sich ja direkt aus dem Gehirn auf das Papier übertragen muss, beim Schreiben erst entsteht. Es muss ein Fluss sein bis durch meinen Füllfederhalter. Der ist eigentlich nur eine Fortsetzung, eine mit Tinte gefüllte Flügelfeder. Also, ich glaube, dass es direkter und für Dichter nicht anderes machbar ist, als zuerst mit der Hand zu schreiben.
Koelbl: Ist für Sie demnach der Prozess des Schreibens selbst von großer Bedeutung?
Kirsch: Es gibt ja Leute, bei denen ist das schon im Kopf ausformuliert, und sie können es dann fast fertig hinschreiben. Für mich ist aber der Vorgang des Schreibens ganz wichtig. Ich habe die Einfälle erst beim Schreiben, und auch die Wörter entstehen erst dann… Als ob ich dadurch etwas auslöse, und dann kann es erst passieren.
Koelbl: Sie schreiben mit verschiedenen Füllern?
Kirsch: Ich habe mindestens sieben. Verschiedene Federn und verschiedene Schnelligkeiten. Es gibt ja Federn, die wie der Teufel schreiben können. Und dann gibt es zierlichere, hübschere. Teils sind sie gekauft, teils geschenkt, manche bewähren sich, manche gehen eines Tages kapores. Heute wird ja nichts mehr repariert, das ist eine richtige Katastrophe. Wie bei dem einen italienischen Füller, den ich so lange hatte, dass er wirklich nicht mehr ging. Aber wenn man mindestens fünf laufen hat, dann kann man immer schreiben. Die Hälfte meiner Füller kann man richtig mit dem Tintenfass füllen. Das ist sehr wichtig,
Koelbl: Ist die Zeremonie des Füllens wichtig oder das Tintenfass?
Kirsch: Alles ist wichtig, die schönen Füller, die Papiere, die schönen Hefte: Das muss alles ein bisschen hübsch sein. Aber das sind nur Dinge, um sich einzustimmen. Ich könnte natürlich fortwährend auf dem teuersten Büttenpapier schreiben. Sicher ginge es auch auf Zeitungspapier oder Packpapier, aber das würde ich dann wohl verzieren. Beim Schreiben eines Textes würde es mich wirklich stören, gleich in die Maschine zu tippen. Ich brauche einen schön sauber abgeschriebenen Text, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Koelbl: Ihre Gedichte sind manchmal sehr schwermütig und sehnsüchtig. Entsteht ein solcher Text in einer bestimmten Stimmung?
Kirsch: Ich würde behaupten, dass es eine fröhliche Schwermut ist, denn das ist eine Stimmung, in der man gut schreiben kann. Ganz ohne Wehmut, Schwermut möchte ich eigentlich nicht leben, das ist eine Grundstimmung, die ich, ach, seit frühester Kindheit kenne. Das muss so sein, sonst könnte man alles andere gar nicht aushalten, glaube ich. Und man schreibt auch aus Sehnsucht nach etwas, und man lebt auch aus Sehnsucht nach etwas – wenn alles so durchsichtig wäre und es diese Schwermut nicht gäbe, dann wäre es doch sehr langweilig. Und immer nur glücklich sein würde man gar nicht aushalten.
Koelbl: Ist Ihre Schwermut eine fröhliche geworden, weil Sie sie im Schreiben kanalisieren können?
Kirsch: Ich kann natürlich nicht sagen, was ich damit anfangen würde, wenn ich nicht schreiben könnte. Man schreibt ja eben auch aus einem Ungenügen daran, wie Leben geschaffen ist. Mit einem Text kann man sich verändern. Man kann schreiben, wie man es lieber hätte, oder einfach fremde Schicksale annehmen. Prosaschreiber haben es da sicher sehr gut, wenn sie so richtig in fremden Geschichten drinstecken und immer wieder dahin zurückkehren können. Das muss sehr, sehr reizvoll sein. Deshalb würde ich manchmal gerne Romane schreiben – aber das ist mir nicht gegeben.
Koelbl: Gabriel Garcia Márquez sagte einmal, er schreibe, um geliebt zu werden.
Kirsch: Da ist auch was dran, geliebt werden von möglichst vielen. Das sind sehr verfängliche Bereiche, denn es ist ja auch gefährlich, sich beliebt zu machen: Wie weit geht man damit? Lug und Trug ist beim Schreiben, bei Kunst sowieso dabei, wobei es ja fast dasselbe ist, ob etwas schön gelogen ist oder einen Kern Wahrheit hat – oder ob es selbst erlebt ist oder nicht.
Koelbl: Wann fängt die gut gelogene Lüge an, Wahrheit zu werden?
Kirsch: Es muss überhaupt nicht die Wahrheit sein. Es muss nur in sich stimmen, oder es muss so gut dargeboten werden, dass der Leser es frisst. Wenn man etwas mit einem Text macht, ist das genauso wahr wie die Wirklichkeit. Was nicht heißt, eine schönere Wirklichkeit schaffen zu wollen. Da käme man gleich wieder in Gebiete, wo es spannungslos und kitschig zuginge. Das Entzückende an der Kunst ist eben, dass man den Leuten was einreden kann. Das macht Spaß. Dann darf man lügen, betrügen, stehlen, alles darf man. Und wenn es geglaubt wird, hat man es gut gemacht, und man freut sich. Wer es am besten kann und am schönsten macht, den lieben die Menschen. Also ist es etwas ganz Lebendiges.
Koelbl: Orientieren Sie sich da an einem Vorbild?
Kirsch: Das schöne Lügen, das habe ich von der Annette von Droste-Hülshoff gelernt. Ihre Übertreibungen sind ja sagenhaft, wenn man den „Knaben im Moor“ liest zum Beispiel, jeder normale Sumpf ist ein Klacks dagegen. Bei ihr lebt ganz viel vom Übertreiben, vom Lügen. Auch in den Prosastückchen, wie dem vorn Leben der Westfalen, da gerät sie so in Fahrt und beschreibt ihre westfälischen Bauern, als ob sie Eingeborene auf Sumatra schildert, also das ist zauberhaft. Dieses Übertreiben, das Lügen, hat natürlich mit Intensität zu tun, und wenn man etwas ganz intensiv empfinden und dann auch ausdrücken kann, das ist schon was Tolles.
Danach strebt man beim Schreiben immer, dass man etwas haargenau, so wie es in einen hereinkommt, reproduzieren kann. Man sieht oder fühlt etwas, das können Farben in einer Landschaft sein oder das Geräusch des Windes – und dann ist da eine Sucht, das genau zu beschreiben. Einen Ausdruck dafür zu finden. Dabei gibt es eigentlich nur eine gute Möglichkeit, und der muss man so nahe wie möglich kommen. Das ist es, was einen süchtig macht, es immer wieder zu versuchen.
Koelbl: Kommt nie der Moment der Verzweiflung, dass man sie nicht findet?
Kirsch: Immer! Manchmal geht das tagelang, man denkt, es geht nicht weiter… aber das gehört alles dazu. Da rege ich mich auch schon gar nicht mehr auf, wenn es Tage gibt, an denen nichts geht und es einem nicht einfällt und man noch nicht einmal das, was man geschrieben hat, beurteilen kann. Da muss man einfach eine Weile warten. Man lernt aber im Laufe der Zeit, dass jeder misslungene Versuch zum Arbeitsprozess gehört und nichts, was man in den Papierkorb schmeißt, umsonst gewesen ist.
Herlinde Koelbl: Schreiben!. 30 Autorenporträts, Knesebeck Verlag, 2007
DAS ERWACHEN
(für Sarah Kirsch in T.)
Abbilder ferner berge
liegen die schafe um dich
die fähre über den bach
gesunken seit gestern
zum anderen meer
zwei lichtschritte
nich einmal ganz
goldammer durchsiebt
von einem wanderbusch
schnurstracks und glücklich
sich halbwegs zu finden
im magma des morgens
der eine natter zeugt
Jiří Gruša
Urs Widmer: Sarah Kirsch ist eine Hexe, Die Zeit, 2.7.1976
Rolf Michaelis: Winter im Sommer, Die Zeit, 5.8.1977
Karin Huffzky spricht mit Sarah Kirsch: Den Himmel beschreiben, Die Zeit 28.10.1977
Gespräch zwischen Klaus Wagenbach und Sarah Kirsch um 1979
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Heinz Stade: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG + Archiv + Internet Archive + IZA + Kalliope + DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: akg-images + Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK + Keystone-SDA
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Die Welt ✝ Die Zeit 1 + 2 ✝ FAZ ✝ Focus ✝ FR ✝ junge Welt ✝ KAS ✝ Spiegel ✝ SZ ✝ Tagesschau ✝ Tagesspiegel ✝ titelblog ✝ MZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝


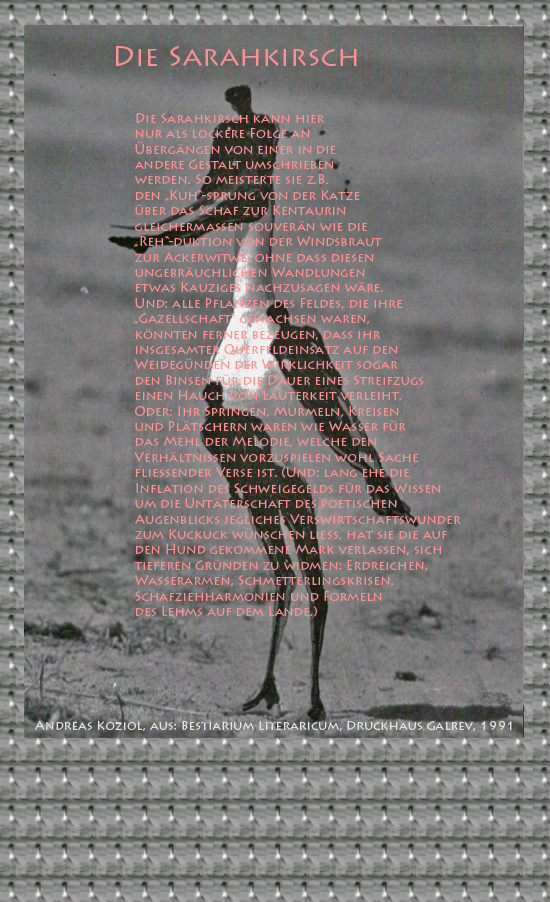













0 Kommentare