Sarah Kirsch: Wiepersdorf
2
Hinter Jüterbog öffneten sich
Der erste, der zweite Himmel, ließen herab-
Strömen, was sich gesammelt hat, siehe
Es wurde ein mächtiger blasenschlagender
Landregen draus, es goß sogar Schwefel.
Später in Wiepersdorf, als zwischen zwei
Windhosen die Möglichkeit war sich zu ergehen
Das liebe freie Land
Recht ins Auge zu fassen, war Freude
Freude. Die schönen Fenster im Malsaal
Öfters sechs mal vier kleine Scheiben, die Flügel
Vorn zierlichen Knebeln gehalten. Innen
Bizarres altes schlängelndes zipfelbemütztes
Kakteengewirr, außen
Maifrischer Park.
Die Steinbilder lächeln – ich ging
Gleich bis zum Zeus, der hielt den Blitz an der Stelle
Wo der Park mit dem Wald schläft. Englischer Rasen
Den bläuliches Waldgras verstrickt hat, es reckt
Noch ein Fliederbusch wirklich!
Vergißmeinnichtblaue Finger zum Himmel und
Selbstverständlich Unmassen Vögel ringsum
In Büsche und Bäume geworfen. Ich staunte
Vor Stunden noch enge im Hochhaus
in der verletzenden viereckigen Gegend, nun
Das – ich dachte bloß noch: Bettina! Hier
hast du mit sieben Kindern gegessen, und wenn
Landregen abging
Muß es genauso geklappert haben Ende Mai
Auf die frischaufgespannten Blätter – ich sollte
Mal an den König schreiben
Im Park des Hermaphroditen
– Sarah Kirschs „Wiepersdorf“-Zyklus. –
Der letzte vor ihrer Ende August 1977 erfolgten Übersiedlung in den Westen noch in der DDR erschienene Gedichtband Sarah Kirschs, Rückenwind, enthält mit den elf „Wiepersdorf“-Gedichten die längste als zusammengehörig gekennzeichnete Text-Sequenz ihrer Lyrik. Der autochthone Charakter dieses Zyklus, der in Rückenwind etwa die zweite Hälfte des ersten Teils ausmacht, wird noch dadurch unterstrichen, daß fast parallel zur westdeutschen Ausgabe im gleichen Verlag ein Separatdruck publiziert wurde.1 Diesem Textcorpus zurechnen ließen sich noch zwei Gedichte aus dem von der Benutzung einer Transitstrecke durch die Mark Brandenburg ausgelösten Zyklus „Reisezehrung“ in dem 1982 erschienenen Band Erdreich, wo im Rahmen einer Retrospektive auf Herkunft und Lebensweg auch die Aufenthalte in Wiepersdorf erinnert werden und noch einmal die unterdessen an der Politik des SED-Staates zersplitterte ,Sächsische Dichterschule‘ fast vollzählig versammelt wird.2
So wie über die reine Örtlichkeit hinaus die Erwähnung von Elke Erb und Adolf Endler als auch der kopflosen Orpheus-Statue in „Reisezehrung 7“ direkt auf die Gedichte „Wiepersdorf 7“ bzw. „Wiepersdorf 4“ zurückverweist, so auch die melancholische Einfärbung von „Reisezehrung 6“ auf das Eröffnungsgedicht des Zyklus in „Rückenwind“. Die atmosphärische Korrespondenz der beiden letzteren wird noch durch die Verwandtschaft ihrer je vierzeiligen Form ergänzt. Im Falle von „Wiepersdorf 1“ scheint man es dabei mit einer Art Programmgedicht zu tun zu haben, das den Charakter des nun folgenden Zyklus ankündigen soll. Es lautet:
Hier ist das Versmaß elegisch
Das Tempus Praeteritum
Eine hübsche blaßrosa Melancholia
Durch die geschorenen Hecken gewebt
(R, S. 18)
Betrachtet man jedoch unter diesem Blickwinkel die Gedichte des Zyklus, erweist sich der Lektürehinweis eher als Irritationsstrategie, denn die Texte sind weit davon entfernt, die metrischen Gesetze des Distichons etwa in der Weise wie Goethes „Römische Elegien“ zu befolgen, noch halten sie es im Imperfekt aus. Bereits ab „Wiepersdorf 3“ verfällt das lyrische Ich3 unter dem machtvollen Andrang seiner Vergegenwärtigungen ins präsentische Sprechen, und selbst der von einer verklärend-wehmütigen Rückschau geläuterte und temperierte Klageton wird immer wieder von neu aufflammendem Schmerz oder eruptiver Wut spontan durchbrochen.
Einzig das mit Abstand längste und erzählerischste Gedicht „Wiepersdorf 2“, in dem Sarah Kirsch ihre Ankunft und ersten Erkundungen von Schloß und Park schildert, wahrt noch die präteritale Distanz. Die Fahrt nach Wiepersdorf gleicht dabei einer Schleusenpassage, da ein gewaltiger Wolkenbruch niedergeht, dem das Gedicht in den Versen „siehe / Es wurde ein mächtiger blasenschlagender / Landregen draus, es goß sogar Schwefel“ (R, S. 19) geradezu infernalische Züge verleiht, denen der biblisch-prophetische Sprachgestus und die evozierte Assoziation kochenden Bleis oder Pechs noch zuarbeiten. Jenseits dieser Sintflut und dieses Tränenvorhangs liegt dann „das liebe freie Land“, das als Gegenmodell zu ihrer Berliner Wohnung „im Hochhaus / in der verletzenden viereckigen Gegend“ fungiert. Gleichwohl reproduzieren sowohl das Interieur des Schlosses als auch seine Gartenanlagen das Spannungsverhältnis regelmäßiger und regelloser Formen:
(…) Die schönen Fenster im Maisaal
Öfters sechs mal vier kleine Scheiben, die Flügel
Von zierlichen Knebeln gehalten. Innen
Bizarres altes schlängelndes zipfelbemütztes
Kakteengewirr, außen
Maifrischer Park.
Die Steinbilder lächeln – ich ging
Gleich bis zum Zeus, der hielt den Blitz an der Stelle
Wo der Park mit dem Wald schläft. Englischer Rasen
Den bläuliches Waldgras verstrickt hat (…)
(R, S. 19)
Diese Verse können gleichzeitig als beredtes Zeugnis für eines von Sarah Kirschs dichterischen Verfahren in diesem Zyklus und überhaupt in ihrer Lyrik dienen. Sie selbst hat darauf hingewiesen, daß ihre Gedichte „oft aus einem optischen Einfall“4 entstünden, und diese initiierende Wirkung der Anschauung führt in diesem und vielen anderen Fällen zu einem komprimiert deskriptiven Stil. In einer die anpreisende Sprache von Werbeprospekten nur wenig abwandelnden Manier werden innenarchitektonische Details des Malsaals – wo sich vier Supraporten mit Kopien von Ansichten der Herrensitze Bärwald und Wiepersdorf aus dem 18. Jahrhundert, die etwa 1880 der Historienmaler Achim von Arnim ausführte, befinden – mitgeteilt sowie die Parkanlagen charakterisiert. In der Tat ist dem Lageplan des Wiepersdorfer Schlosses zu entnehmen, daß dort, wo der aus einem barocken Garten hervorgegangene Park mit dem um 1800 angelegten Landschaftspark zusammenstößt und die zugerichtete Natur der Anlage in den Fläming übergeht, eine Skulptur steht.5
Schloß Wiepersdorf, das bald nach seiner Restaurierung 1958 als Erholungs- und Arbeitsstätte für Kunstschaffende der DDR verwendet wurde und auf dem sich Sarah Kirsch auch in dieser Eigenschaft aufhielt, ist das einstige Anwesen des romantischen Dichters Achim von Arnim, auf dem auch Bettina, wenngleich nur kurz von 1814 bis 1816, lebte, um dann wieder in Berlin ansässig zu werden und nur noch sporadisch in Wiepersdorf einzukehren. Auch wenn sie nach Achim von Arnims Tod 1831 ausschließlich in Berlin lebte und dort ihre wichtigen Briefromane sowie ihren phantasie- und anekdotenreichen Fürstenspiegel Dies Buch gehört dem König (1843) schrieb, befindet sich ihr Grab doch in der Wiepersdorfer Dorfkirche und trägt das Künstlerhaus ihren Namen. Wie ein Fanal leuchtet gegen Ende von Kirschs Gedicht Bettinas Name im Text auf und weckt die Absicht:
ich sollte
Mal an den König schreiben
(R, S. 20)
Bei Sarah Kirsch allerdings ist seit ihrem Gedicht „Ich wollte meinen König töten“ in den Zaubersprüchen6 bei dieser Vokabel in erster Linie an den Herzkönig, den Geliebten zu denken, und im Wiepersdorf-Zyklus selbst kommt sie ja im eher unfreiwillig berühmt gewordenen neunten Gedicht7 auf die Verstehensalternativen und ihre eigene privatere Akzentsetzung zurück.
In der Tat wird die Erinnerung an Bettina von Arnims Königsbuch zum Ausgangspunkt für die Verarbeitung der gescheiterten Liebesbeziehung zu ihrem Herzenskönig. Dabei nimmt „Wiepersdorf 3“ in vielfältiger Metaphorik die am Beginn des vorangegangenen Gedichts entworfene Insellage des Schlosses jenseits der Unwetterzone wieder auf. Der umliegende Wald wird als „Bannmeile“ apostrophiert und läßt an die hermetische Abriegelung von Dornröschens Schloß denken. Dazu paßt, daß das Ich „Dornen in den Rosenkranz“ dreht und von „Verwünschung“ spricht. Die schickt sie zwar dem verlorenen Geliebten auf den Hals und knüpft damit an dieser Stelle wie auch am Ende von „Wiepersdorf 8“ („fluche / Du Schönhäutiger Schwacher Verfuckter / Dichselberliebender schöngraues / Schielendes Aug ach geh weck“) an ihren besonders aus den Zaubersprüchen bekannten Sprachgestus der ,Fluchformel‘ an, aber im Blick auf ihre eigene seelische Befindlichkeit als auch ländliche Abgeschiedenheit kann man von ihrem eigenen Verwunschensein sprechen. Dies stützen zum einen Wendungen aus „Wiepersdorf 6“, wo von „diesem frühschlafenden Land-Strich hinter den Wäldern“ (R, S. 24), worin vielleicht die formelhafte Antwort des Spiegels im Märchen „Schneewittchen“ mitklingt, und der „am Tage verwunschen“ aussehenden Landschaft die Rede ist. In „Wiepersdorf 3“ selbst ist die Abkapselung noch in quasi zweiter Potenz gegenwärtig, insofern das Ich „gepanzert“ und mit einem „Minengürtel Einzelheiten zierlich drapiert“ ist. Wie das schlafende Dornröschen hinter der bergenden Hecke erscheint das lyrische Ich eingeigelt hinter dem bergenden Waldsaum. Die Kugelgestalt mit aufgestellten Stacheln vereint das Moment des Rückzugs mit dem der Wehrhaftigkeit und korrespondiert zudem der Schlußzeile „So über den Winter zu kommen in diesem Frühjahr“ (R, S. 21). Nicht zuletzt mag der „Minengürtel Einzelheiten“ auch auf Kirschs poetisches Verfahren der Orientierung am Detail hinweisen, wobei die Zusammenführung heterogener Einzelelemente poetische Sprengkraft zu entfalten vermag.
Die Verrückung ins Märchenhafte setzt das folgende Gedicht „ Wiepersdorf 4“ noch fort, in dem das Ich „das Tränklein Vergessen“ zu sich nimmt und sich dadurch seiner deprimierenden gegenwärtigen Verfaßtheit entzieht. Statt dessen wird es in einer Art zeitenthobenen Interregnums „die Herrin der Bilder und Meubeln bis dann / Nach Tagen das Leben im praktischen Hochhaus“ (R, S. 22) es wieder in die diesseitige Profanität zurückholt. Deutlich wird daran aber auch, daß Kirsch in dem schroffen sprachlichen Kontrast zwischen der antiquiert-französischen Orthographie, mittels derer sie sich quasi in die Zeitgenossenschaft Bettinas begibt, und der nüchternen Charakterisierung ihres Berliner Aufenthaltsortes die Verführungskraft ihres potentiellen Fluchtraums verpuffen läßt.8 Abgewehrt wird damit die umstandslose Lösung des Vergessens, welche in der Identifikation mit dem vergessenen Schloßteich beim Blick in dessen „Spiegel“ sich darbot. Der Lethe-Trank und der betäubende Duft des Geißblatts, das diesen entrückten Zustand als ,je länger je lieber‘ suggerieren möchte, werden ihrer Wirkung durch das Besinnen auf den Alltag beraubt.
Damit gibt es nun aber, wo die Erinnerungsarbeit schon einmal begonnen hat, kein weiteres Entweichen vor der beklagenswerten Trennungserfahrung. Auch Versuche, in der Kunst Entlastung oder gleich eine neue Liebe zu finden, sind, wie es „Wiepersdorf 5“ zu entnehmen ist, gescheitert. Hier dient indessen das Schloß „mit dem zwiefachen Dach“ bloß katalysatorisch zur Erkenntnis „doppelt / Allein“ zu sein und als negatives Äquivalent zu der Zeit, da „fröhlich / Ein Tag der Zwilling des vorigen war.“ (R, S. 23) Wie hier also das subjektive Schmerzempfinden in Korrespondenz zur unbelebten Architektur gebracht wird, so in „Wiepersdorf 7“ mit der belebten Natur, wo „private Unken Kummer“ lautstark Ausdruck verleihen, und schließlich in „Wiepersdorf 9“ mit der menschlichen Natur, wenn Kirsch ihre Schreibsituation mit derjenigen Bettina von Arnims in den Versen „Immer / Sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben“ (R, S. 27), parallelisiert.
Gleichwohl kommen mit diesem Text die direkten oder stellvertretenden Klagen des Ichs zu ihrem Abschluß. Die letzten beiden Gedichte des Zyklus reichen die Klagegeste an andere Wesen weiter, sie wandert vom eindeutig weiblichen lyrischen Ich über den Hermaphroditen in „Wiepersdorf 10“ zur männlichen Statue im Schlußgedicht, welches übrigens als einziges mit „Männliches Steinbild im Park“ einen eigenen Titel aufzuweisen hat. Diese zum Sprechen erweckte Skulptur beklagt sich bitter über die „immer schnurriger“ gewordenen Damen, die sich heutzutage „Dreimal im Leben von Diesem und Jenem“ (R, S. 29) zu trennen belieben und bloß noch Kindern und Arbeit die Treue halten, das heißt dem ,Nötigen‘, zu dem die Männer offenbar nicht mehr zählen. Mit diesem Gedicht, das wieder ganz aus der Perspektive einer ihrer selbst gewissen, souveränen weiblichen Subjektivität geschrieben zu sein scheint und die Überwindung der elegischen Stimmung und Tonart markiert, endet der Zyklus.
Der Preis, den das weibliche Ich dafür zu zahlen hat und zu zahlen bereit ist, läßt sich indes aus dem vorhergehenden Gedicht „Wiepersdorf 10“ herausoperieren, dessen Deutung hier abschließend versucht werden soll. Sein Wortlaut ist folgender:
Der Hermaphrodit geht im Park spazieren
Ich verberge mich zwischen den Zwergen
Der mit dem Clowns-Mund, die Puderperücke
Vertraut mir: der Un-Mensch
Geht um die Zeit noch und wartet
Dort auf einen, endlos zu klagen. Ich danke
Mein Kleiner aus Marmor für diesen Wink, da leg ich
Dir meine Hand, ich muß mich bücken, liebvoll
Auf den großen gewichtigen Kopf und schlage
Schnell einen Bogen um jenes Wesen.
(R, S. 28)
Offensichtlich scheut das Ich die Begegnung mit dem Zwitter, dem Un-Menschen, wie der Zwerg – vermutlich eine aus der Gruppe der Callot-Figuren – ihn nennt. Das Nicht-Menschliche an ihm ist sein Status absoluter Vollkommenheit und absoluter Todesverfallenheit. Wenn es im Gedicht heißt, der Hermaphrodit „geht um die Zeit noch“, so ist der Akut auf das Wort ,Zeit‘ zu setzen. Er biegt um die Zeit, er schlägt einen Bogen um sie, steht außerhalb des Zeitverlaufs. Dort, an einem Ort jenseits der geschichtlichen Prozessualität, wartet er auf jemanden, der mit ihm in dieser zeitlosen Sphäre, eben „endlos“ klagen kann. Als das Ich das erfährt, hat es um so mehr Grund, sein prophylaktisches Versteck nicht aufzugeben, sondern im Gegenteil jede Möglichkeit der Begegnung vermeidend seinerseits einen Bogen um jenes Wesen zu schlagen. Nichts wünscht das Ich weniger als durch ein Zusammentreffen mit dem Hermaphroditen zum unfreiwilligen Partner endlosen Klagens gemacht zu werden. Warum aber ist der Hermaphrodit zu klagen verdammt?
In der Tradition der alchemistischen Ikonographie stellt der Hermaphrodit die Allegorie des lapis philosophorum dar, des Steins der Weisen. Seine Zweigeschlechtigkeit ließ sich als Aufhebung kosmischer Dualitäten und der in Platons „Gastmahl“ geschilderten Teilung der einst ganzheitlichen Menschennatur deuten und damit als „das Versprechen, daß die Spaltung rückgängig zu machen ist“.9 In diesem Sinn konnte der Hermaphrodit zwar als Sinnbild einer quasi verewigten sexuellen Vereinigung gelten, aber zugleich stürzte ihn diese Vollkommenheit in ewige Einsamkeit und Sterilität. So ist denn etwa der Hermaphrodit in den „Chants de Maldoror“ Lautréamonts10 ein melancholisch Sehnsüchtiger, der in Halluzinationen und Träumen dem Fluch der existentiellen Verlassenheit zu entrinnen sucht, dem unerreichbaren Begehren nachtrauert. Seine Vollkommenheit zeitigt derart „letztlich nur Erstarrung, ihre Harmonie Versteinerung; die Vollkommenheit der Statue.11
Andrea Kuhn spricht in ihrem instruktiven Aufsatz davon, daß seine absolute Form „als eine Verabsolutierung der Form, eine Nature morte“12 aufzufassen sei, das heißt als ein Stilleben auch in dem präzisen Sinn, daß der Hermaphrodit der von ihm repräsentierten Idee der Totalität nach über keine Sprache verfüge. Tatsächlich ist Sprache ja nur dem notwendig, der eine Kluft zu überbrücken trachtet, sie ist ein Trennungsphänomen, das gegen das Getrenntsein revoltiert. Der Hermaphrodit kennt Sprache in dieser Intention nicht, er könnte nur mit einem anderen Wesen darüber klagen, daß es Liebe und Sexualität zwischen ihnen nicht geben kann. Damit stellt der Hermaphrodit für das lyrische Ich eine doppelte Gefährdung dar, er bedroht es mit seiner potentiellen Sprachlosigkeit bzw. seinem unendlichen elegischen Monolog als Dichterin und mit seiner asexuellen Vollkommenheit als Frau. Gerade die Gedichte der Sarah Kirsch, die im wesentlichen Liebesgedichte sind, leben aber von Trennungserfahrungen, die sie mit Worten speisen, und von einer oft geradezu verschlingenden körperlichen Begierde. Vor der allegorischen Figur, die diese Triebkräfte durch die Realisation der Idee absoluter Einheit suspendierte, muß ein lyrisches Ich, das seine Schreibenergien in so hohem Grade seiner fast schmerzhaften Fixierung auf das andere Geschlecht verdankt, zurückschaudern. Angesichts des Hermaphroditen triumphiert die Angst vor dem Verlust des eigenen Lustempfindens über jedes sympathetische Gefühl.
Hier wie fast im ganzen Werk Sarah Kirschs werden die Phänomene so gut wie ausschließlich in ihrer Beziehung aufs Ich wahrgenommen, die Bedeutungsvalenzen, welche sich in allen Zeiten und Künsten an sie angelagert haben, kommen fast nie in den Blick. Wenn im ersten Vers von „Wiepersdorf 2“ der Name des Städtchens Jüterbog fällt, so evoziert das keine intertextuelle Kommunikation mit der rätselhaften Zigeunerin im Michael Kohlhaas, in die doch gerade eine so ,hexische‘ Autorin wie Sarah Kirsch mit Gewinn hätte eintreten können. Verschenkte Chancen dieser Art gibt es zuhauf, und es erscheint mir als problematischer Mangel einer zeitgemäßen Version moderner Lyrik, sich solcher Markierungen zu bedienen, ohne ihnen einen Sinn über ihre Funktion als autobiographische Erinnerungszeichen hinaus zu verleihen.
Jürgen Egyptien, aus TEXT+KRITIK: Sarah Kirsch – Heft 101, edition text + kritik, Januar 1989
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Karl Corino: Hübsche blaßrosa Melancholia. Zum Wiepersdorf-Zyklus der Sarah Kirsch
Deutsche Zeitung, 21.10.1977
Im Spiegel eigenen Empfindens
– Begegnung mit der Schriftstellerin Sarah Kirsch. –
(…)
Sie wohnt sehr hoch. Der Blick geht weit über Dächer und Straßen. Zu viel Beton, sagt sie. Aber dann ist da plötzlich dieses Licht. Ein seltsames, unwirkliches Violett übergießt die regengraue Stadt und verwandelt sie in eine Kulissenlandschaft. Ein Maler müßte das sehen, um diesen Augenblick festzuhalten. Oder ein Dichter. Löst dieser Anblick, der sie für Sekunden fesselt, einen Gedanken aus, der sich irgendwann in der Zeile eines Gedichts wiederfinden wird? Versöhnt er sie einen Atemzug lang mit ihrem Leben hinterm Schreibtisch in der x-ten Etage mit Lift und Klimaanlage, während es sie doch hinausdrängt zu Flüssen und Wiesen und Wäldern?
Einmal gab es eine Zeit in ihrem Leben, da sie das genießen konnte: Landschaft, den Geruch nach Stall und nach Tier, als sie ein Jahr lang in eine LPG geschickt wurde, um dort Kulturarbeit in Gang zu bringen. Damals hat sie zum erstenmal erlebt, wie das ist, so richtig müde zu sein von schwerer körperlicher Arbeit. Seitdem ist eine Sehnsucht geblieben und dieser Zweifel, ob das genügt für einen Menschen, sich anderen mitzuteilen, die Frage:
Ach warum bin ich Dichter, ackre den Wagen
der Schreibmaschine übers kleine Papierfeld, fahr Taxi
und koche mit Wasser?
Aber dann gibt sie selbst die Antwort darauf, wenn sie sagt: Schreiben, das ist für sie eine Befreiung. Es läßt ihr keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das, was sie gerade macht, für andere von Bedeutung ist. Sie schreibt, weil es sie zum Schreiben zwingt. Erst später kann sie versuchen herauszubekommen, ob sie anderen damit etwas zu sagen hat, ob ihre Dichtung den Menschen hilft, ein wenig besser mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Sie mochte dem Leser das Gefühl vermitteln, daß er nicht allein steht, möchte seinen Blick erweitern und bereichern, ihm zurufen: Sieh, da ist einer, der so denkt und fühlt und lebt wie du, der dir ein Stück voranhelfen will.
Sarah Kirsch hat nach dem Studium der Biologie über eine Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren in Halle zur Dichtung gefunden, hat sich auslachen lassen mit ihren ersten unbeholfenen Versen, hat geheult und tapfer weiter gedichtet. Der Leiter des Zirkels, der Schriftsteller Gerhard Wolf, hat sie gelehrt auszudrücken, was sie bewegt. Ein Jahr lang hat Sarah Kirsch als Diplombiologin gearbeitet, bevor sie das Literaturinstitut Johannes R. Becher besuchte. Die Lyrik-Seminare unter Georg Maurer haben ihr späteres Schaffen wesentlich beeinflußt. Sein Vorbild hat ihr Mut gegeben bei aller Unerbittlichkeit, mit der er Beispiele aus der Weltliteratur als Maßstab ansetzte. Später ist ihr über die Begegnung mit der Dichtung Bertolt Brechts klargeworden, daß es kein Wort gibt, das nicht literaturfähig ist. Brechts Verse haben ihr dabei geholfen, von falschen Vorstellungen freizukommen und den Weg zu finden, um das Alltägliche poetisch auszudrücken. Sie meint, daß Allgemeinverständlichkeit der Schönheit eines Gedichtes keinen Abbruch tut, hält es für eine Unsitte, hinter jedem Wort einer Zeile nach einem tieferen Sinn zu suchen, der sich dem von selbst enthüllt, der ihn braucht.
Viele Gedichte hat Sarah Kirsch aus fremden Sprachen ins Deutsche übertragen, polnische, sowjetische, russische Lyrik. Es wirkt erregend und anregend auf sie, sich in eine fremde Gedankenwelt hineinzuversetzen. Niemals sonst beschäftigt man sich so intensiv mit einem Gedicht, sagt sie. Jedes Wort, jeder Gedanke, jeder Tonfall muß stimmen. Sie hat soeben vietnamesische Kindergedichte übersetzt, einfache Verse über Spinne und Fledermaus, die nach schönen Reimen verlangen, wenn ihre Anschaulichkeit erhalten bleiben soll. Sie arbeite zusammen mit dem Fotografen Roger Melis an einem Fotokinderbuch. Ihre Kenntnisse als Biologin kommen ihr zugute in einer Geschichte über die kleine Welt, die ein Wassertropfen umschließt. Im nächsten Jahr wird ein neuer Gedichtband von ihr im Aufbau-Verlag erscheinen. Irgendwann will sie sich auch wieder der Prosa widmen, nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchen.
Sie braucht zum Schreiben den Kontakt mit Menschen, den Gedankenaustausch mit Freunden, ihr kritisches Wort, die Tätigkeit im Vorstand des Schriftstellerverbandes, sie liebt es, bei der Arbeit hinterm Schreibtisch Schallplatten zu hören, die Musik von Bach, Haydn, Mozart, Gustav Mahler. Ihre innige Anteilnahme am Aufwachsen des eigenen Kindes prägt die bildkräftige Sprache ihrer Kindergedichte. Immer ist sie Problemen auf der Spur, immer aufnahmebereit für fremdes Erleben, das sie im Spiegel eigenen Empfindens zur Gestaltung drängt, täglich von neuem.
Gudrun Skulski, Neue Zeit, 21.12.1974
Über Sarah Kirsch
Dichter sind selten, Dichterinnen, sieht man durch die Jahrhunderte, ein Glücksfall der Natur. Sarah Kirsch, 1935 in einem Harzdorf geboren, hat wie die meisten ihrer Generation mit um Agitation bemühten Versen angefangen: Einige hübsch-verspielte Gedichte, die scheinbar aus dem Kanon brachen, machten sie damals bekannt. „Liebes Pferd, / es ist verkehrt / zu sagen, es sänke dein Wert / durch elektrifizierte Lieferwagen“ beginnt eines davon. Landaufenthalt, der erste eigene, 1967 veröffentlichte Gedichtband, verschreckte denn auch einen Teil des Publikums durch, wie es schien unvermittelte, Wendung zur Ernsthaftigkeit; Ernsthaftigkeit in der Kunst, also Bemühen um Realismus, wird ja leicht mit Geschichtspessimismus verwechselt und dann für zersetzend gehalten. Daß, statt Abstraktionen aneinanderzufügen, Welt ins Gedicht geholt und der Geschichtsprozeß so an seinem Material reflektiert wird, ist für die mittlere Dichtergeneration der DDR in den endsechziger Jahren charakteristisch. Dichter wie Mickel, Leising, Uwe Greßmann nehmen dabei klassische Verstechniken auf, die sie für ihre Zwecke weiterarbeiten. Im Unterschied dazu ist Sarah Kirschs Vers, wo sie nicht, wie in „Schneelied“, Märchenmotive aktuell verfremdet, meist ein aus gereihten Protokollsätzen bestehendes Parlando, ein Vorsichhinsprechen, das registriert, was zu sehen ist. Die Genauigkeit der Beobachtung macht dabei einzelne Verse zu bösen Metaphern; „es ist schwer in Hitze und Uniform über der Tiefe Lieder zu blasen“, heißt es in „Musik auf dem Wasser“. Der zweite, 1973 erschienene Gedichtband Zaubersprüche findet, bisweilen mit erst zitierten, nicht ganz in eigene Sprache verwandelten Versgesten, zu festeren Strukturen. Dem ausgebreiteten Stoff in „Das Grundstück“, einem der eigenartigsten Gedichte des Bandes, gibt ein frei behandelter Hexameter inneres Gerüst. „Der Meropsvogel“ und die „Wiepersdorf“-Texte – Wiepersdorf war ein Gut der Arnims, Bettina hat dort gelebt – sind danach entstanden; die Beschreibung gewinnt hier den Lakonismus der klassischen Ode.
Rainer Kirsch, 1974, aus Rainer Kirsch: Amt des Dichters, Hinstorff Verlag, 1979
Gespräch mit Sarah Kirsch
– Am 3.Mai 1979 führten Hans Ester und Dick von Stekelenburg in Amsterdam das folgende Gespräch mit der Autorin. –
Hans Ester/Dick von Stekelenburg: Frau Kirsch, wie sind Sie eigentlich zur Literatur gekommen?
Sarah Kirsch: Ich habe erst Biologie studiert, mich zu der Zeit nur so wie jeder Normalverbraucher um Literatur und Theater und Konzerte gekümmert. In Halle verkehrte ich in einem Zirkel junger Autoren – Rainer Kirsch, mein damaliger Mann, war auch dabei. Die Mitgliedschaft bedeutete so eine Art Kanditatur für den Schriftstellerverband; nach fünf Jahren konnte man aufgenommen werden, wenn man bis dahin eine Veröffentlichung vorgelegt hatte – aber darum ging es eigentlich gar nicht.
Jeden Monat tagte diese junge Arbeitsgemeinschaft zwei Tage lang und ihr Leiter war damals Gerhard Wolf, ein kluger kritischer Mentor. Ich habe einfach so, aus freiem Impetus zu schreiben angefangen, ich hatte bis dahin sehr wenig Gedichte gelesen, eigentlich nur solche, die auch mal in Zeitungen veröffentlich werden. Diese meine Naivität war eigentlich mein Glück, denn ich meinte: das muß ja ganz leicht sein, das könnte ich viel besser! Erst viel später bekam ich ein Auge für die sogenannte große Literatur und für die Gedichte anderer. Kurz, wenn ich von Anfang an z.B. Germanistik studiert hätte, wäre ich vielleicht zu sehr vorbelastet gewesen und hätte es wohl nicht mehr so hingekriegt.
Gerhard Wolf hat uns von den großen philosophischen Themen ferngehalten und uns beigebracht, über die Sachen zu schreiben, die uns umgeben, die wir wirklich kennen. Das war der sogenannte „kleine Gegenstand“, wie das dann bald unter Germanisten hieß. Und wir machten Gedichte über die kleinen Gegenstände, über ein Frühstück oder über das Aufwachen, über den Marktplatz von Halle und dergleichen.
Ester/Stekelenburg: 1963 sind Sie dann nach Leipzig, zum Johannes R. Becher-Institut gekommen?
Kirsch: Zu dem Zeitpunkt waren wir schon im Schriftstellerverband, und von daher bestand die Möglichkeit, dieses Institut zu besuchen. Ein sehr schönes Privileg, weil man dort als junger Autor ein gutes Stipendium bekam und alles erst mal nachholen konnte, was sich an Lücken ergab. Das sah fast einem Germanistikstudium ähnlich: Vorlesungen in Weltliteratur, in sowjetischer Literatur und Philosophie usw. Es gab eine sehr gute Bibliothek, wo man auch Camus und vieles andere lesen konnte, was in der DDR damals nicht so einfach war. Vor allem gab es das Lyrik-Seminar von Georg Maurer, ein im Ausland leider unterschätzter Dichter, der uns sehr viel bedeutet hat. Er brachte es fertig, in uns über die Auseinandersetzung mit der Lyrikproduktion dieses und früherer Jahrhunderte ein rechtes Gefühl für die eigenen Arbeiten zu entwickeln – etwa an der Sprachkunst eines Brockes oder der Droste-Hülshoff die eigenen Naturgedichte, die wir gerade fertig hatten, mal spüren zu lassen. Das war sehr plausibel – und manchmal auch sehr peinlich. Es war eine ungeheure Arbeit, die sich Maurer da gemacht hat, mit Gedichten, die wirklich noch nichts waren…
Zu Maurer sind dann auch junge Schriftsteller gekommen, die offiziell nicht am Literaturinstitut waren, Bernd Jentzsch und Volker Braun etwa, die in Jena und Leipzig an der Universität studierten. Wir standen damals schon alle miteinander in Verbindung und wußten genau, womit der andere gerade beschäftigt war.
Ester/Stekelenburg: Mit welchen Zielvorstellungen wurde das Leipziger Literaturinstitut begründet?
Kirsch: Ja, es ging natürlich um den sogenannten Sozialistischen Realismus, obgleich dieser Begriff sich auch damals schon schwer definieren ließ. Kein Mensch wußte so richtig, was das ist. Nach Bitterfeld kam die Vorstellung der Produktionsromane auf. Da dieser Aspekt ziemlich vernachlässigt war, war die Idee, daß Schriftsteller auch mal in die Produktion gingen, gar nicht so schlecht. Ich habe das selbst zweimal gemacht, einmal in einer LPG und dann in einem Großbetrieb; das war für mich schon sehr nützlich, denn ganz freiwillig hätte ich es wahrscheinlich doch nicht gemacht, aus Faulheit. Einiges von diesem Thema: Produktionswelt, Arbeiterexistenz ist schließlich in dieser und jener Erzählung, auch in der Pantherfrau hängengeblieben. Und weil keiner genau wußte, was Sozialistischer Realismus ist, haben wir ihn mehr oder weniger selber gemacht. Das hing natürlich von der jeweiligen Kulturpolitik ab, aber als ich am Institut war, war es eigentlich eine relativ offene Zeit; man konnte mit den Dozenten gut arbeiten, fast bis zum Ende, als meine Sachen dann unbehelligt erscheinen konnten. Schließlich gab es dann doch Krach, Rainer z.B. hat man sein Diplom vorenthalten. Da fing das XI. Plenum an und schon ging nichts mehr.
Ester/Stekelenburg: Und wie verhielt sich damals Georg Maurer, den Sie schätzen, zu den Problemen?
Kirsch: Er hat zu uns gehalten, war aber sehr vorsichtig, was ich ihm nicht verübeln kann.
Ester/Stekelenburg: Wie hat man sich die intensive Zusammenarbeit, von der Sie sprachen, vorzustellen?
Kirsch: Wir standen alle zusammen ungefähr gleichzeitig am Beginn: Volker Braun, Bernd Jentzsch , Rainer Kirsch, Karl Mickel, Heinz Czechowski. Das ist ja diese Generation der 1934–1935 Geborenen, die besonders in der Lyrik produktiv geworden ist. Merkwürdig, wie solche Jahrgänge zustande kommen – und dann ist wieder eine ganze Weile nichts! Wir kannten uns von Halle oder Leipzig, wir wohnten z.T. auch zusammen oder besuchten einander und tauschten untereinander unsere Arbeiten aus. Diese team-work-Attitüde hat sich eigentlich sehr lange, über sehr viele Jahre gehalten; das ist auch heute noch so, auch wenn der eine in der Schweiz ist und manche Freunde in der DDR und andere in West-BerIin. Wir wissen voneinander, woran wir arbeiten und halten die Verbindungen aufrecht.
Ester/Stekelenburg: Wenn Sie nun an diese Anfänge zurückdenken, welche Faktoren halten Sie für verantwortlich für das Aufkommen dieser Lyrikbewegung am Anfang der sechziger Jahre?
Kirsch: Das hatte mit den Lyrik-Lesungen in Moskau zu tun, mit der von den Dichtern dort gepflegten Tradition, vor dem Puschkin-Denkmal oder vor dem Majakowski-Denkmal ihre Gedichte zu lesen. Das versuchte man in der DDR nachzuahmen. Auf die Initiative Stephan Hermlins im Sonntag, alle jungen Leute, die Gedichte schrieben, sollten sie ihm schicken, haben wir alle reagiert. Hermlin traf eine Auswahl und stellte die besten Texte in abendlichen Lesungen an der Akademie der Künste einem großen Publikum vor. Wir hatten da jeder vielleicht zehn oder fünfzehn Gedichte auf Lager; alle wurden gelesen: Volker Braun, Mickel, meine und Rainer Kirschs Gedichte und viele andere. Wolf Biermann hat dort zum ersten Mal seine Lieder gesungen, Hermlin selbst las zwei Stunden lang. Das ging so lange gut, bis die FDJ die Veranstaltungen übernahm und somit überprüfte. Wir mußten unsere Texte vorzeigen, und damit war für uns der erste Zauber schon dahin. Aber die Lyrik-Begeisterung verbreitete sich über die ganze Republik, wir wurden überallhin eingeladen, und es stellte sich die Situation ein, daß wir gar nicht so rasch neue Gedichte zur Hand hatten, wie wir sie lesen sollten.
Ester/Stekelenburg: Machte nicht Rudolf Bahro schon damals von sich reden?
Kirsch: Ja, der damalige stellvertretende Chefredakteur des Forum Bahro war einer der schärfsten Kritiker, als es den ersten Ärger mit den Gedichten gab. Als er uns im Öffentlichen ideologisch an den Kragen ging, war das recht unangenehm. Er ist anscheinend klug geworden, hat von der Arbeit in der Praxis gelernt. Ich sage ihm heute meine ganze Sympathie zu für den Weg, den er genommen hat.
Ester/Stekelenburg: Von Anfang an haben Sie also mit anderen Leuten zusammengearbeitet, den anderen Gedichte vorgelegt und ihre Kritik angehört. Ist das heutzutage noch, in dem Maße, wie es früher der Fall war, Ihre Gewohnheit?
Kirsch: Doch, erstens sind viele meiner damaligen Freunde und Kollegen in West-Berlin, d.h. insofern ist die Tradition noch vorhanden. Aber ich brauche nicht fünfzehn Leute, denen ich meine Texte zeigen muß, bin jedoch gern im Gespräch über das, was ich gerade arbeite.
Ester/Stekelenburg: Sofern es erfragbar ist: Welche Dichter, welche Modelle sind für Sie inspirierend gewesen?
Kirsch: Ja, problematisch war, daß man in der DDR an die moderne Weltliteratur kaum herankommen konnte. Es hat sehr lange gedauert, bis dort einiges in Übersetzungen vorlag, bis es Lizenzen gab, usw. In einer solchen Isolation bedeutet die Kenntnisnahme von Enzensbergers Museum der modernen Poesie, das mir Freunde aus der Bundesrepublik schenkten, eine gewaltige Horizonterweiterung. Hier sah ich auf einmal, wie ein politisches Gedicht überhaupt nichts mit Agitation und ideologischer Parteilichkeit zu tun zu haben braucht, um trotzdem sehr direkt und eminent politisch zu sein. Zu solchen Grunderlebnissen gehörte auch Erich Arendt, dessen Gedichte aus Kolumbien mich sehr beeindruckten, der aber auch den ganzen Raphael Alberti übersetzt hatte. Alberti kannten wir schon viel früher als Pablo Neruda, ja noch bevor die jungen Russen, Jewtuschenko u.a., in der DDR Furore machten. Arendt und der durch ihn vermittelte Alberti: es ist möglich, daß das sogar auf meine ersten Gedichte vielleicht ein bißchen abgefärbt hat.
Ester/Stekelenburg: Meinen Sie, daß von Erich Arendts Werk auch formale Impulse ausgegangen sind?
Kirsch: Ich denke ja, ganz bestimmt, und in dieser Hinsicht auch von Bobrowski. Das gilt eigentlich für uns alle bis hin zu Christa Wolf und der jüngeren Prosa in der DDR. Und dann – weil wir sowieso bei den Vorbildern und Einflüssen sind – sind Kunert und Hermlin nicht zu vergessen. Es gibt da bei Hermlin wirklich unerhörte Leistungen, eigentlich die ersten poetischen Hervorbringungen, wie sie der Sozialistische Realismus bis dahin nicht gekannt hat. Ich denke an meine Lieblingsgedichte „Die einen und die anderen“ und „Die Dame Hoffnung“ zum Beispiel. Das war wirklich eine neue Sprachkultur.
Ester/Stekelenburg: Der ostdeutsche Kritiker Adolf Endler bringt Sie in einer ausführlichen Würdigung Ihres Werkes (in: Sinn und Form 1975, 1) doch in einen gewissen Gegensatz zu Erich Arendt. Im Nachweis des reihenden Gestaltungsprinzips Ihrer Lyrik als Ausdruck der „Beiläufigkeit“ und der ideellen Unverbindlichkeit der Kirsch’schen Assoziationsbezüge hebt Endler bei Arendt eine Mittelpunktssuche, wenn auch als „letzten, entschiedenen Ernst des Nichts“, hervor.
Kirsch: Das mag stimmen. Jedoch ist Arendt für mich kein Vorbild im Sinne von Nachahmung. Meine Bewunderung gilt dem Kollegen Arendt und seiner vermittelnden Tätigkeit, die für uns Jugendliche damals von Bedeutung war. Erich Arendt vertritt etwas, was man nicht so einfach in dieses Schema des Sozialistischen Realismus hineinpassen kann. Übrigens ging es Endler in seinem Aufsatz auch darum, nachzuweisen, daß es bei mir eigentlich ohne Vorbilder abgeht.
Ester/Stekelenburg: Von Ihren Gedichten in Gespräch mit dem Saurier stellte Endler dann eine „temporäre Unfähigkeit, Alltägliches poetisch zu erfassen“, fest.
Kirsch: Es gab Zeiten, wo er meine Gedichte als „baby-talk“ bezeichnete. Der kluge Endler ist ein scharfsichtiger Kritiker, man kann von ihm lernen. Allein damals konnte ich es nicht besser, und bei den Gesprächen mit Sauriern ist es denn auch nicht geblieben.
Ester/Stekelenburg: Würden Sie dem Wort Endlers beipflichten: „Das Abenteuer der Dichtung von Sarah Kirsch, wie das der jüngsten DDR-Lyrik insgesamt, ist nicht anders denkbar als unter den besonderen und sozialistischen Bedingungen unseres Landes“?
Kirsch: Ich würde dem in dieser Zuspitzung nicht beipflichten. Ich weiß nicht, ob die uns umgebende gesellschaftliche Wirklichkeit sich so auswirkt. Aber ich bin mit meiner Biographie, die so lange mit der DDR verbunden war, eigentlich gar nicht unzufrieden. Was wäre gewesen, wenn ich in der Bundesrepublik zu schreiben angefangen hätte? Sehr viel verdanke ich dem Kontakt mit den Menschen in der DDR, der Zusammenarbeit mit den dortigen Dichtern und Kollegen. Aber andererseits meine ich, daß andere Lebensverhältnisse sich auf das Resultat letzten Endes nicht so unterschiedlich ausgewirkt hätten. In dieser Reihenfolge war das alles gar nicht so schlecht für mich, und wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich es gern wieder so haben.
Ester/Stekelenburg: Wo es nun so gekommen ist, würden Sie es ablehnen, eine DDR-Autorin, jetzt eine DDR-Autorin im Exil genannt zu werden?
Kirsch: Nein, ich bin überhaupt nicht im Exil, das wäre auch hochgestapelt. Es ist dieselbe Sprache. Ich habe keine großen Schwierigkeiten, mich in eine andere Mentalität einleben zu müssen. Ich empfinde mich als einen deutschsprachigen Schriftsteller, weiter nichts. Es ist nicht so, daß ich mich nun mein Leben lang als DDR-Dichter fühle. Ich habe dem Land eine Menge zu verdanken, das ist klar, und das Land hat mich auch irgendwie geprägt, aber es hat mich auch weitergebracht. Ich sehe das alles nicht so tragisch. Ich bin nicht traurig, daß ich nicht mehr dort lebe. Aber ich fühle mich überhaupt nicht im Ausland. Ich habe manchmal – ein bißchen übertreibend – gesagt, ich bin nur umgezogen. Und wenn es mir in einer Stadt nicht mehr gefallen hat, da bin ich eben von Halle nach Berlin und von Ost-Berlin nach West-Berlin gezogen. Sie können mir das abnehmen oder auch nicht.
Ester/Stekelenburg: Ja, Thomas Brasch nennt die DDR in einem Gespräch denn auch „ein sehr gutes Internat“. Aber man will ja gerade aus dem Internat heraus.
Kirsch: Ja, so ähnlich ist das, so wie ein strenges Elternhaus, das man gern hat, aber…
Ester/Stekelenburg: Eines hat sich natürlich doch schon entscheidend geändert. Ihre Öffentlichkeit, Ihre Leser sind nunmehr ausschließlich die anderen geworden. Denn ist es nicht so, daß Ihre Gedichte heute, wenn überhaupt, in der DDR nur auf speziellem Wege rezipiert werden können?
Kirsch: Das kann einen traurig machen, daß man dort nicht mehr erscheint, – obwohl ein bißchen kommt immer noch hinüber. Ich habe dort nicht mein ganzes Publikum verloren. Andererseits habe ich in der Bundesrepublik sehr viele Leser, wenn auch wohl aus ganz unterschiedlichen Motiven. Was bleibt einem sonst; vielleicht brechen drüben mal wieder Zeiten an, wo man meine Bücher wieder druckt. Gegenwärtig werden meine Texte aus neuaufgelegten Anthologien herausgelassen. Das hängt dann mit irgendeiner Bahro- oder Havemann-Unterschrift oder mit irgendeinem Interview zusammen.
Ester/Stekelenburg: Es ist doch nicht abwegig, diese eine Erfahrung als spezifisch für alle wie auch immer exilierten Schriftsteller anzunehmen: daß mit dem „Umzug“ das besonders komplizierte Spannungsverhältnis zu Staat, Gesellschaft und Publikum und damit ein wesentlicher Impetus zum So-und-nicht-anders-Schreiben wegfällt?
Kirsch: Nein, ich glaube nicht daran, ein solches Spannungsverhältnis kann sich woanders auch einstellen; der Schriftsteller reibt sich immer an einer gesellschaftlichen Umwelt – das ist universell. Es nimmt ein wenig Zeit, bis man sich in einem anderen gesellschaftlichen System zurechtgefunden hat, bis man dort, wie man es in der DDR war, in positivem wie in negativem Sinne zuhause ist.
Was Endler an mir kritisiert: den Wunsch nach Welt, das Überallzuhause-sein-Wollen, ist nicht ohne weiteres Substanzlosigkeit. Ich lebe von der Entdeckung, von der Eroberung immer neuer Landschaften; ich erobere sie mir dann auch schreibend. Das war so, wenn ich in Rumänien war, oder in Frankreich und in Italien. Ich hoffe, daß meine Reisebilder trotzdem keine Tourismus-Gedichte geworden sind. Insofern wage ich es, den Umzug in andere Gegenden, auch den letzten Umzug, immer als eine Erleichterung und eine Bereicherung für mich persönlich zu empfinden Ich komme zu Dingen, die ich vorher weder kannte noch konnte – es ist eine Leichtigkeit und Lockerheit, die ich brauche. Erich Arendts Flugoden sind in ihrer Schwerfälligkeit mit diesem eher leichtlebigen Wunsch zum Fliegen, zum einfach Losfliegen und Weiterfliegen, wie das in meinen Gedichten schon oft drin ist, tatsächlich nicht zu vergleichen. Natürlich kann da jeder sagen: Das ist alles so leicht und unverbindlich; wo bleiben die gesellschaftlichen Probleme? Aber man kann die Gedichte, glaube ich, immer nur in der Summe beurteilen und muß auch die Dinge, die nicht geschrieben worden sind, mit dazu rechnen.
Ester/Stekelenburg: Merkwürdig bleibt, daß westliche Leser Ihrer Lyrik, auch wo sie auf jegliche gesellschaftspolitische Vordergründigkeit verzichtet, sich immer auf die vermeintlichen hintergründigen Signale einstellen. Was halten Sie von solcher Hellhörigkeit?
Kirsch: Ich finde das sehr richtig. Ich habe Politik nie plakativ betrieben, aber natürlich sind in meine Texte ein bestimmtes Lebensgefühl und bestimmte Lebensumstände, die mich als Einwohnerin der DDR kennzeichnen, eingegangen.
Ester/Stekelenburg: Halten Sie folgende von Ihnen (allerdings zu verschiedenen Zeitpunkten) gemachte Äußerungen für widersprüchlich: „Hätte ich keine politischen Interessen, könnte ich keinen Vers schreiben“ (in: „Acht Fragen an Sarah Kirsch“ in Zaubersprüche), und „In der DDR könnte ich nicht mehr schreiben“ (in einem Gespräch mit Matthias Schreiber in der Saarbrücker Zeitung vom 19.1.1978)?
Kirsch: Zu verschiedenen Zeitpunkten ausgesprochen, bestimmt beides. Daß ich in der DDR am Schluß nicht mehr sehr produktiv war, sein konnte, hatte damit zu tun, daß ich mich um tausend andere Sachen kümmern mußte, weil die Politik sich um mich zu kümmern anfing. Es war gut für mich, dort wegzugehen, mir war allmählich meine Lockerheit und Leichtigkeit abhanden gekommen.
Und ,politische Interessen‘ ist ein dehnbarer Begriff. Ich bin nicht für irgendeine politische Partei und werde mich keiner feministischen Bewegung anschließen. Ich versuche Kunst zu machen, die mit Menschen zu tun hat, mit den Menschen, mit denen ich lebe – und der Mensch ist auch, aber nicht nur ein politischer Gegenstand. Wer meinen Texten gesellschaftspolitische Bedeutungen entnehmen will – ich werde ihn nicht daran hindern.
Ester/Stekelenburg: Welche Beziehung gibt es zwischen der Intention, mit der Sie als Autorin der Pantherfrau aufgetreten sind, und dem erklärtermaßen emanzipatorischen Anspruch von Maxie Wanders Tonbandprotokollen fraulicher Selbstaussagen?
Kirsch: Ich finde Maxie Wanders Buch sehr gut und besser als das, was ich einige Jahre früher gemacht habe. Aber das hängt mit den verschiedenen Zeitumständen zusammen, unter denen die beiden Dokumentationen entstanden sind. Mein Vorbild waren Erika Runges Bottroper Protokolle, aber an Offenheit und Freimut ist in meiner Pantherfrau sehr viel weniger herausgekommen; man ist in der DDR nicht so gewöhnt, über sich selbst zu sprechen und rundheraus zu sagen, wie man lebt, was man denkt. Ich muß sagen, daß das der Maxie Wander schon besser gelungen ist. Ich habe mir gedacht, so etwas kannst du am besten mit Frauen machen, weil die nicht soviel zu verlieren haben und sowieso weniger eitel als Männer sind. Frauen sind außerdem erzählfreudiger. Und genau so war es.
Bei den Frauen-Porträts von Maxie Wander merkt man, daß die Entwicklung schon weitergegangen ist: die Frauen sind bei ihr viel aufgeschlossener und reflektieren ihre persönlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse viel gründlicher. Außerdem hat sie mehr Personen befragt und wird den verschiedenen sozialen Schichten gerechter als ich. Das ist wirklich eine neue historische Kategorie.
Ester/Stekelenburg: Jedoch nicht so neu, daß auch hier die ideologischen Schnitte der Autorin und das Bemühen, Kritik harmonisierend zuzudecken, nach wie vor unverkennbar sind.
Kirsch: Das muß ihr unbewußt passiert sein, so wie mir. Geändert habe ich natürlich nichts, aber natürlich habe ich meine Tendenz und habe, was mir wichtig erschien, besonders hervorgehoben, und dabei anderes beschnitten. Ihrer Kritik an Maxie Wanders Buch muß man entgegenhalten, daß es wohl die interviewten Frauen selbst waren, die ihre Aussagen am Ende abzudämpfen versuchten. Das ist ganz menschlich, daß man es auf den zweiten Blick lieber etwas harmonischer haben will. Wie soll man sonst leben? Dabei sind die Grenzen dessen, was man sagen und besser nicht sagen kann, in der DDR immer viel enger gesteckt. Aber eben deshalb ist und bleibt es ein erstaunlich offenes Buch.
Ester/Stekelenburg: Sie verspüren sonst keine besondere Engagiertheit an Frauenfragen?
Kirsch: Fast eher im Gegenteil. Ich bin da sehr vorsichtig, seit ich in der Bundesrepublik bin, wo es wiederholt Versuche gegeben hat, mich für politische Frauenbewegungen zu vereinnahmen.
Mich interessiert überhaupt nicht, wer schreibt – ob ein Mann, oder eine Frau –, es kommt auf das Ergebnis an. Wobei ich einschränke, daß Frauen es manchmal schwerer haben, jedenfalls es schwerer gehabt haben, überhaupt zu produktiver Arbeit zu kommen, weil sie viel Abhaltung haben und es gottseidank genau so wichtig finden, ein Kind gut durchzubringen als sich ein Buch zu verkneifen. Ich bin in diesen Dingen eigentlich ziemlich rigoros.
Ester/Stekelenburg: Und die Hexameteridylle „Das Grundstück“? Hier thematisieren Sie typisch weibliche Ressentiments den Männern gegenüber.
Kirsch: Ja, das Gedicht für die alleinstehenden Mädchen, das ist schon ein bißchen emanzipatorisch. Aber es ist ganz lächelnd geschrieben, und nicht im geringsten aufrechnend oder boshaft gemeint. So ist es eben – daß die Männer lieber kommen, wenn die Kinder schon im Bett sind, und daß sie von den Frauen oft mehr fordern, als daß sie selbst schenken können. Es ist ein Gelegenheitsgedicht und beruht auf einer wahren Begebenheit; so ist es einer Freundin von mir ergangen. Aber das Gedicht ist nicht so gut, weil es ein wenig plakativ ist.
Ester/Stekelenburg: Es heißt, daß Gedichte ,gemacht‘ werden. Wie, Frau Kirsch, machen Sie ein Gedicht?
Kirsch: Wann genau bei mir ein Gedicht losgeht, ist im nachhinein schwer zu sagen. Das hat bei mir meistens mit optischen Eindrücken etwas zu tun. Da ist irgendwann mal ein Anfang oder ein Zeile, die ich etwas später in die Mitte eines Textes einbaue; der Anlaß kann durchaus trivial sein, kann etwa von einem Fernsehbild herrühren. Und dann ist es, glaube ich, so, daß man schon irgendetwas angespeichert hat, ein Material, das nur irgendeines Auslösers braucht. Ich schreibe erst alles mit der Hand so drei-, viermal runter und verändere dabei immer sehr viel. Dann schreibe ich das Ganze mit der Maschine ab, weil es einem dann optisch etwas fremder wird und man sehen kann, was falsch gemacht ist. Dann lasse ich den Text liegen, bis ich ihn fast vergessen habe, sehe ihn mir nach langer Zeit wieder an und zeige ihn auch mal anderen.
Meine Erfahrung ist, daß die Machart eines Gedichtes sich nicht immer deckt mit der Psychologie des Machenden. Ein Gegenstand kann ganz anders laufen, als man möchte. Man möchte z.B. ein fröhliches Gedicht machen, aber der Gegenstand selbst geht andere Wege. Es gibt da objektive Gegebenheiten, denen man einfach folgen muß.
Ester/Stekelenburg: Das hat offensichtlich Methode, Ihre Art und Weise, in die Zeilenabteilung Verfremdungsmomente einzubauen. Inwiefern ist diese Methode leserorientiert?
Kirsch: Das ist z.T. eine Gebrauchsanweisung zum Lesen. Wenn ich manchmal sehr wenig Kommata oder sonstige Satzzeichen verwende, so ist das, als ob ich zeigen will, wie schnell der Text gelesen werden muß, so atemlos und ohne abzusetzen, damit jedes Wort die gleiche Wertigkeit bekommt und nach rechts und links übergreift, ich meine jetzt auch sinngemäß.
Diese Methode ist, glaube ich, in mir, sie ist durch meine Redeweise bedingt. Ich empfinde Dinge und Bedeutungen ziemlich rhythmisch, und wenn ich eine Zeile breche, so geschieht das schon überlegt und nicht zufällig. So in dem „Wiepersdorf“-Gedicht: „… öffneten sich / Der erste, der zweite Himmel, ließen herab- / Strömen, was sich gesammelt hat…“: dieser rhythmische Vortakt mit anschließender Atempause bei „herab-“ erzeugt einen zusätzlichen Luftdruck in „Strömen“. Es sind dies Details, die intuitiv entstehen, die ich aber erst nachträglich belegen und erklären kann.
Ester/Stekelenburg: Man wird durch dieses sich tatsächlich überstürzende Tempo geradezu in die Irre geführt. Der atemlose Leser muß manchmal zurück, weil er den Faden verloren hat.
Kirsch: Ich habe es gern ganz intensiv, und wenn es in einem Gedicht schon irgendwo wettern soll, dann muß das richtig massiv vor sich gehen. Ich übertreibe da gern.
Ester/Stekelenburg: Damit korrespondiert vielleicht der charakteristische Vorgang, daß das Idyllenhafte, aus dem viele Ihrer Gedichte sich aufbauen, nur selten intakt belassen wird. Das besagte „Wiepersdorf“-Gedicht ist dafür ein Beispiel: die Evokation der politischen Bettina von Arnim führt auf einmal in das Bewußtsein von der Schwere und Disharmonie des Lebens.
Kirsch: So ist das nun mal in der Wirklichkeit. Ich hätte das Leben gern idyllischer, aber da es das nun einmal nicht gibt, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Idylle dann wieder aufzuheben.
Ester/Stekelenburg: Überkommt Sie – wie jeden, der schreibt – nicht manchmal das Gefühl: Ich stehe jetzt vor einer Schwelle, irgendwie müßte ich jetzt meinen Ton, das mir geläufig gewordene poetische Instrumentarium verändern, will ich nicht zum Nachahmer meiner selbst werden?
Kirsch: Ja, das stimmt – das unbehagliche Gefühl, daß man ein Gedicht schreibt, das man eigentlich schon geschrieben zu haben glaubt. Andererseits ist es die Unmöglichkeit, aus einem bestimmten Konzept, das ja man selbst ist, herauszuspringen. Das soll man nicht, das kann man nicht forcieren.
Daß einiges gleichförmig wirkt, mag dem Leser manchmal so erscheinen, einfach weil es Ähnlichkeiten hat. Aber es gibt doch Sprünge und veränderte Sprache und dergleichen. Man kann das von Band zu Band feststellen.
Man muß sich langsam darüber klar sein, was man weiter verfolgt und verstärkt und was man in Zukunft lieber sein läßt. Für meine Prosa weiß ich das noch nicht genau. Ich möchte etwas richtig Schönes und Langes schaffen, also so ungefähr von zwanzig Seiten, was für mich schon viel ist.
Ester/Stekelenburg: Sie fassen Ihre Arbeit – das Schreiben von Lyrik – auf als eine Berufung?
Kirsch: Nein, ich sehe das nicht als ,Berufung‘, sondern als Arbeit, als eine oft sehr arbeitsintensive Liebhaberei, von der man außerdem einigermaßen leben kann. Ich schreibe für die anderen, aber nicht zuletzt auch für mich selbst. Ich weiß auch gar nicht, wie das in Zukunft weitergeht. In der DDR konnte ich davon existieren, und ich bekam daneben Stipendien. Nebenbei habe ich mich journalistisch betätigt, was nützlich ist, da man sich zwingen muß, auch mal was anderes zu machen.
In der Bundesrepublik habe ich immer noch voll zu tun – es sind dort sehr viele Bücher von mir verkauft worden. Aber ich habe auch keine Angst, daß mal Zeiten kommen, da es mal schlechter gehen wird. Dann wird man eben umschalten müssen. Ich muß nicht für fünf Jahre etwas in Vorrat haben.
Deutsche Bücher, Heft 2, 1979
SANDWEGE
für sarah kirsch
die ausgetretenen / zer
rütteten pfade entlang
in die spuren miß
aaaaaachteter vorbilder
aaaaaaaaaagedrückt
in einem land / in dem man
die FREIHEIT zutode geschützt hat
schwer ist es / einen
aaaaaanderen weg zu gehen
aaaaaatemlos geworden
aaaaaOHNE ALTERNATIVE
das dornengestrüpp / hat
seine wirkung verloren / der
dorn im fleisch
aaaaaaaaaaaabrennt nicht mehr
angesichts
aaaaaaaaader neuen GRENZEN
von mauer
aaaaaaaaaund stacheldraht
tiefer
aaaawunden seine dornen
den entmachteten geist / das
aaaaufbäumen
aaaaaaaaaaaaaim schmerz
aus dem schweigen
aaaaaaaaaader eulenwohnungen
und
aaaaaim dunkel der vielen
seelenkerker
brich das SCHWEIGEN auf / das
aaaaaaaaaaschwarze EIS
aaaaaaaaaaunter den lippen
öffne dich : auch in unseren reihen
schauen
aaaaaaaund alles wissen / und
nichts sagen
aaaaaaaaaaund
nicht helfen können
WIE FALSCH SICH ALLES ENTWICKELT HAT
unerträglich
aaaaaaaaaadem MENSCHENFREUND
die sandwege gehen / die man
immer schon ging / anfangs
mit lodernder wortfackel voran /
aaaaaaaaaaam dornenbusch vorbei
in immerwährende sackgassen
aaaaasich im kreis bewegen
aaaaaim signal der sanduhr
(bis das fleisch seine geduld verliert)
oder ermatten
aaaaaaaaaaaain der tiefe
versinken im sand / oder
verstummen
aaaaaaaaaamit zornigem blick
und sich / AUS LIEBE / auf
schwingen
aaaaaaaaaund vogel werden
(als sei es der einzige ausweg)
und
aaaaadie sandwege verlassen / den
aaaaavorgeschriebenen weg / für
eine reise in die HONIGLÄNDER / die
deine BÜCHER / vor dir / bereits
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaangetreten haben
den festen / sicheren
aaaaaaaaaauntergrund
aaaaaaaaaazu suchen
solange es noch möglich ist
die stimme erheben im flug
spähend den (auf einmal)
aaaaaaaaaaaagewehrten FLUCHTweg
finden / den büchern nachfolgen
aaaaaaaaaaund hoffen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaauf die kraft
der anderen / zurückgebliebenen
daß sie durchhalten werden / daß
sie freunde bleiben / und
aaaaaaaaaaweggefährten
über alle räume hinaus / und
aaaaaaaaaader kälte /
aaaaaaaaaaaaaaaaaaadie ihnen entgegenschlägt
widerstehen / und selbst
wiederkehren – wiederkehren
wenn die zeiten entgifteter
aaaaaaaaaaaaaaund besser sind
wenn man
aaaaaaaaader Freiheit / und
aaaaaaaaader WAHRHEIT
paläste baut / im eigenen land /
statt sie mit füßen zu treten
und in die GEFÄNGNISSE zu verbannen
auch
wenn dein WORT / nie die ganze
wahrheit sein kann / und nichts
als die WAHRHEIT :
aaaaaadu
aaaaaaaahast sie gewollt
wohl wissend / daß
aaaaaaaaaaaaaaaasie ist / „WAS
SEIN MÜSZTE / WAS
aaaaaaaaaaaaaaMORGEN SEIN WIRD“
Klaus Rainer Goll
MONDHAAR
Nach Sarah Kirsch
Wie siehst du denn aus Mond
in deinem Haar knistern Raketen
Zopfhalter ein roter Stern
warte ich komm mit der Brennschere
elektrisch von unterm Weihnachtsbaum
ich brenn dir eins über
du Glatzkopf dein Haar
hängt in meiner Suppe
die muß ich jetzt auslöffeln
ach Mond
Kurt Bartsch
WIEPERSDORF (MAI 1995)
angeregt durch Sarah Kirschs gleichnamiges Gedicht
der wald schläft nicht mehr mit die park
gestört entwöhnt und eingekreist
ist sie zerpflegt und er verwildert
schamhaargestutzt und aufgebäumt
rings um das gut der freuden haus
geteilte nebelschleier laken tafeltücher
knallhart der streifen himmel
Christoph Kuhn
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Spiegel ✝ FAZ ✝ FR ✝ Tagesspiegel ✝
Die Zeit ✝ Focus ✝ Die Welt ✝ SZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝ MZ ✝
KAS ✝ junge Welt ✝ Tagesschau ✝ titelblog


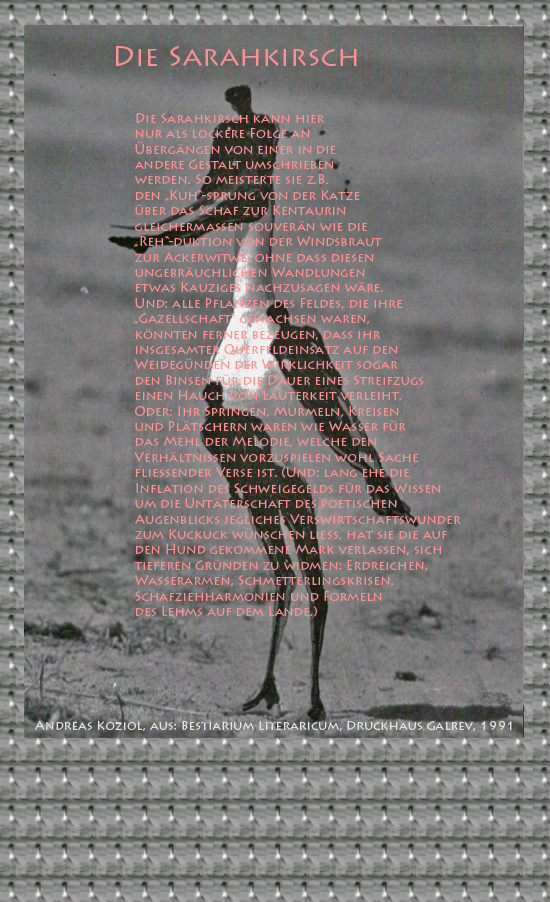













Schreibe einen Kommentar