Sascha Anderson: brunnen, randvoll
WIR SCHREIBEN NICHT OFT GEDICHTE
wir schreiben nicht oft gedichte, die
mit niemandem sprechen. wir
schweigen mitunter ein leben
länger als gut
ist, ein gedicht, ist ein bild
das nichts von sich weiß
wie eine maske aus nektarinen
schalen, fleisch
und blutleeres gemäuer
frontal ins genick, so sahst du mich an.
ich weiß ich seh nichts als eine
demonstration gegen
uns, das wir, ist ein schwarzes schwitzendes
messer schärfer als deine augenbraue gezeichnet.
brunnen, randvoll
versamelt fünf Erzählungen von einem Gefängnis – das zufällig in der DDR steht, aber überall auf der Welt stehen könnte – einen Sonettzyklus und andere Versformen. „Die DDR als Gebilde interessiert mich nicht. Dieser Staat ist nicht souverän, daß er dem einzelnen ständig aufzwingt, sich mit ihm zu identifizieren. Man ist frei vom Staat, weil der Staat einen inhalieren will.“ Sascha Anderson
Rotbuch Verlag, Faltblatt, 1988
Manchmal ist in der Literatur die Wut
des Schriftstellers so groß, daß seine Texte wie Projektile herumfliegen. Das Buch brunnen, randvoll ist so ein Projektilhagel, der dem Leser ins Gesicht fliegt, wenn er den Umschlag entsichert. Nach der ersten Verblüffung, wie wenn man etwa eine Ladung Schrot ins Gesicht bekommen hätte, versucht man doch, aus den Texten etwas herauszupicken.
Den größten Eindruck hinterlassen wahrscheinlich die Gefängnistexte. In einer kräftigen Scheiß-dinix-Sprache kommen Anleitungen an Wärter, Empfehlungen des Staates an seine Insassen und an die Wut der Eingesperrten zusammen. Manchmal wird der Tagesablauf wie ein Inschrift zu einer Heldengedenktafel in den taxt gemeißelt. Bei einer Überstellung von Häftlingen in ein anderes Gefängnis zünden schließlich die Gefangenen den Waggon an und kommen ums Leben. Die Zeitungen melden daraufhin zynisch, daß trotz der vorweihnachtlichen Hektik kein Schaden an der Post entstanden sei.
Wenn man mit der Wut gerade halbwegs zurecht kommt, verblüfft es umso mehr, daß sich aus der groben Sprache auch sanfte Beziehungstexte hauen lassen.
Wäre ich du, ich würde nicht auf mich warten,
denn, der zu dir kommt bin nicht ich.
So liegt einem dieses kleine Büchl wie ein großer Steinbruch im Magen. Einerseits drücken die klobigen Gefängnistexte, andererseits sprießt aus jeder Ritze, die sanfteste Versuchung, einen Menschen zu umarmen. Der Buchtitel stimmt: Die Texte sind randvoll.
Kufstein Aktuell, 9.6.1988
„gekleidet in die ware penepoles, siamesische sätze“
Sascha Andersons (geb. 1953 in Dresden, heute in Westberlin lebend) 4. Buch im Berliner Rotbuch Verlag ist ein Erinnerungsbuch, ein Abschied. 5 Prosatexte und 5 Gedichtzyklen „berichten“ vom Sterben der Zusammenhänge in existenziellen Genzsituationen.
Erinnern heißt Töten des Einstigen, und ist zugleich ein end-gültiges Verlassen des Gewesenen. Denn Anderson erinnert und belebt nicht als „raunender Beschwörer des Imperfekts“ (Thomas Mann) seine Knast-Erfahrung in der DDR (denn davon sprechen alle fünf Geschichten), sondern er tötet diese Erfahrung mit den Mitteln ihrer sprachlichen Rekonstruktion. Er gibt kein poetisches Tagebuch seiner Haftzeit (wie dies in der vielleicht einzig vergleichbaren Intensität Ernst Tollers Schwalbenbuch vorgegeben hat), und er imaginiert keine geschlossenen Erzählhandlungen mit Anfang und Ende. Die erzählten Situationen leben sowohl von der Drastik der Zustände, von der fast unsagbaren Brutalität der sich gegenseitig zerstörenden Menschenleiber in der 60-Mann-Zelle, als auch von der Überlegenheit einer Sprache, die zwar vollgesogen ist mit den Inhalten und keine Tabus kennt, aber sich einen eigenen Raum schafft: den zum Überleben. Vielleicht ist so authentisch noch nie über den Knast (in der DDR – und überhaupt) geschrieben worden, ganz sicher nie so radikal und autonom zugleich. Der autonome sprachliche Raum der Erzählungen baut sich auf durch Satz- und Bildkonstruktionen, die die Genauigkeit der Situation in eine Vielbestimmtheit des Geschehens überführen, in das die subjektiven Metaphern und Bilder eingreifen. Damit vermeidet Anderson fotorealistische Abbilder, die (laut Brecht) sowieso nichts über den Gegenstand auszusagen vermögen. Es sind die Metaphern, die übereinander herfallen, sich gegenseitig hervorbringen und wieder zerstören, die eine Dynamik entfalten, aus der einerseits eine Tiefendimension der Situation „Zelle“, andererseits das Erleben dieser Situation im denkenden Ich der Erzählung und drittens das Sterben dieses Erlebens im erinnernden Text plastisch werden. Diese Struktur des Erzählens, die mit den Bildern im Kopf des Erzählenden, mit der Dominanz einer subjektiv-bildergesättigten Sprache den Vorgang des Erzählens (das ein Erinnern ist) belebt, schafft sich zugleich erst im Erzählen den Raum der Handlung. Das Gewesene, die Zeit in der Zelle, rückt ungewöhnlich nah heran, da es keineswegs als etwas „Objektives“ einfach da ist, das der Erzähler einfach abzuschildern hätte. Andererseits stellt sich in dieser Struktur, die die alte Fiktion von der (unbegründbaren) Integrität, dem a priori des Erzählers gar nicht erst zuläßt, das Subjekt der Erzählung erst im Erinnern her. Es gibt keinen Erzähler außerhalb des Erzählten.
Der Dichter Anderson praktiziert in diesen Texten ein aus der Lyrik bekanntes Paradoxon: indem er das erzählende, sprechende Ich von sich als Person löst, indem er es sich erst im Sprechen herstellen läßt, erschafft er sich die Möglichkeit, im Medium dieses anderen authentisch über sich, seine Erlebnisse zu sprechen. Dieser Umweg allerdings ist nötig, da nur so die Erfahrungen des Autors ohne Larmoyanz und Depression und ohne Zynismus mittelbar scheinen. Die Geschichten gehen fast immer tödlich aus. Sie sprechen vom Sterben, und indem sie es-so-tun, auch vom Weiterleben. Der Autor schreibt sich ein Thema vom Leibe, indem er, was tot in ihm sein soll, im Erinnern tötet. Er tut dies ohne den Gestus einer politischen Abrechnung, ohne Tiraden. Die politische Radikalität der Erzählungen sehe ich gerade darin, daß Anderson von den Körpern des Erzählers und der Häftlinge spricht, die die Gnadenlosigkeit der Situation in sich aufnehmen, daran zugrunde gehen oder sie – irgendwie – überleben. Das ist die erzählerische Substanz der Geschichten, daß sie in dieser Weise ihr Geheimnis bewahren, daß sie das, was ohne Namen bleibt, mit-erzählen.
Auch die Gedichte sprechen vom Erinnern, von der Last des Totseins des Vergangenen, vom Sterben von gelebtem Leben, gelebten doch verlassenen Ort,
da flüssiges
fest war im augenblick
des erinnerns
Wieder entsteht die Spannung aus der Distanz und Identität von Totem und Lebendigem. Die Bilder und Metaphern der Gedichte verlassen den voraussetzbaren Bezug, sind weniger auflösbar in die (Körper-)Sprache einer Situation, sie setzen sich fort im nächsten Bild, das wieder das Bild eines Bildes sein kann. Die Übersetzung Andersonscher Gedichte ins diskursive ist nicht einfach, da aus ihnen eine Auffassung vom Menschen spricht, der mit den Händen sehen, den Zähnen hören, der Nase fühlen und den Augen denken kann. Mir scheint als rebellierten sie unablässig gegen jenen Adorno-Satz, wonach es im falschen Leben kein richtiges geben können. Da die Sprache teilhat an der umfassenden Paranoia dessen, was wir gegenwärtig Realität nennen, bedeutet dies aufs Gedicht übertragen den Versuch, etwas vom Kopf auf die Füße zu stellen, was man „miteinander reden“ nennen könnte. Anderson spricht konsequent von einem (seinem) Ich in einer Welt von Bildern und Spiegeln, hinter denen die Tatsachen verschwinden oder zumindest als beliebige Zeichen füreinander stehen können. Im Prozeß der Verwandlung der Dinge zu Zeichen, der Worte zu Hülsen, der Gesten zu Echos von Gesten: wo alles Metapher sein kann und das Gehörtwerden vom goodwill des Gegenübers abhängt, wo es keine zwingende Kraft des kommunikativen mehr zu geben scheint, versuchen die Gedichte einen poetisch lebbaren Raum des Miteinanders von Menschen zu errichten. Das ist das Gegenteil der Idylle vom „herrschaftsfreien Raum der Kommunikation“, da sie gerade von der unendlich komplizierten Möglichkeit des Verstehens sprechen. Es ist kaum ein Zufall, daß Anderson im letzten, den Band gewissermaßen schon verlassenden Zyklus die strenge Vorgabe der Sonettform wählt (auch wenn er sie sehr frei handhabt), um im Gerüst des Gedichts den Versuch zum Dialog zu unternehmen.
Anderson hat einen Begriff vom Gedicht entwickelt, für das die Metaphern und Bilder verfügbar geworden sind. Da sie ihrer zwingenden Bezüge zur repräsentierten Welt und zum Sprechenden entkleidet sind, kann der Dichter mit ihnen ein wechselvolles Spiel treiben, sie zu assoziativen Räumen neu montieren. Erfahrungen von Entfremdungen und komplexen Verkehrungsstrukturen liegen zugrunde, werden ins Positive des – noch – sinnvollen Sprechens gewendet:
und ich, zeuge mit dem bild ihres
gehens, im duell, den der zeit sekundierenden satz.
Gedichte als Transformationspunkte von Bedeutungen, Orte des Wandels und der Wandlung, die zu einem Gegenüber sprechen, um ihn teilhaben zu lassen, am eigenen Leben. Denn diesen Impuls halten sie immer aufrecht: vom Ich zum Du zu sprechen, sich zu offenbaren, indem sie die eigenen Labyrinthe im Moment des Sprechens fixieren. So sind sie auch Momentaufnahmen unaufhörlicher Wandlung, dokumentieren den Prozeß und sich selbst als in ihm geronnene Fixpunkte. Dieses Lebendigsein muß den beständigen Kontakt mit dem Tod nicht scheuen, da es ihn nicht als ein Problem in die anderen projiziert, sondern in sich selbst als zugehöriges aufspürt. Anderson macht sich zum Meister seiner eigenen Tode, indem er das jeweilige Tote abspaltet und im Benennen bannt.
Ein heikles Spiel? Oder Bedingungen zu offenem Leben. Denn:
nicht umsonst leb ich wie
wasser die richtung ändert.
Peter Böthig, Falter, 3.2.–9.2.1989
… Erst 1988 stellte er einen neuen Band vor:
brunnen, randvoll. Die Ansichten eines ehemaligen Gefangenen sind inhaltlich so surrealistisch und mancher unserer Wirklichkeitsauffassungen widerstrebend, daß sie avantgardistischer Formen nicht mehr bedürfen. In den Kurzgeschichten, Elegien und Sonetten werden Erinnerungen an eine Zeit des Terrors, aber auch des sich unter dem extremen Druck entwickelten literarischen Selbstverständnisses aufgearbeitet. Dieses Abtötungsverfahren befaßt sich sowohl mit dem am eigenen Leib erfahrenen Leben im Gefängnis (in dem Mitgefangene psychisch erniedrigt, Spitzel in der Zelle ermordet werden, das „draussen“ für die „drinnen“ gestorben ist) als auch mit dem Schreiten eines Dichters durch die Gräber seiner Vorbilder, etwa Shakespeares, Hölderlins und Trakls (im Zyklus „the south is also translated“). Die Absage an das Leben und an die Literatur wird dem Text einverleibt – Worte wie „umarmen“ und „besetzen“ deuten auf dieses Verfahren −, dann im „transit“ durchwandert und zerlegt. Mit eigener Feder schreibt er sich das Leblose, wozu er verurteilt war, vom Leib. Ein „epilog“ berichtet von diesem Verfahren:
berührte ich etwas, drang es in mich ein
verlor sich in mir, bis ich nichts mehr war
als der wille dieses kindes, erwachsen zu sein
das letzte zu tun, nach all dieser tätlichkeit
ist unmöglich geworden, der friedhof selbst
ist ein flüchtiger schoß, mit anderen worten
ich schenkte ihm ein grab, ernannte es ruhe
mein produkt des verlangens, schloß die tür und
die frucht seiner leere ist berührung
Anderson schreibt hier aus der Gruft und schafft sich somit allmählich eine tabula rasa seiner literarischen Artikulation, durch die inzwischen immer weniger fremde Stimmen funken – ein Prozeß, der erst in der ständig wiederholten Bewegung neue Laute hervorbringt, um auf diese Weise dem Verstummen vorzubeugen; denn „nur da, frei von einer fordernden kraft, vermute ich meine potenz, die weder mich noch den jeweils anderen befreit. und so weiß ich nun, daß ich bin, wo ich war, in fahrt.“
Gerrit-Jan Berendse, 1.4.1990, in: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.) – Kritisches Lexikon zu deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
Literatur als Rettung aus der Haft
Sascha Anderson, 1953 in Weimar geboren und 1986 in die Bundesrepublik übergesiedelt, gehört zu den umtriebigsten und eigenwilligsten deutschen Schriftstellern seiner Generation. Er war eine Zentralfigur der Subkultur vom Prenzlauer Berg, die von den Behörden der DDR zum größten Teil in den Westen abgedrängt wurde und deren versprengte Überreste die Ost-Berliner Verlage jetzt als Nachwuchs-Reservoir entdecken. Seine ersten beiden Bücher Jeder Satellit hat einen Killersatelliten (1982) und totenreklame (1983) weisen ihn als einen experimentierfreudigen, mitunter spröden Lyriker aus, der eine neue Sprache für die alten Leiden an der deutschen Geschichte sucht.
In den fünf Prosastücken seines neuen Bandes brunnen, randvoll erzählt Anderson von seinem Aufenthalt in einem Gefängnis der DDR Ende der siebziger Jahre. Er teilt uns nicht mit, weshalb er verurteilt wurde, läßt aber anklingen, daß sein Schicksal politische Gründe hatte. Den Haftalltag – die harte körperliche Arbeit, das Leben mit sechzig Männern in einer Zelle, die Übergriffe der Aufsichtsbeamten – skizziert er nur mit wenigen Strichen. Es geht nicht darum, die äußere Passionsgeschichte eines Dissidenten auszubreiten. Er will vielmehr den inneren Veränderungen nachspüren, die er in dieser Zeit erfuhr.
Gleichwohl hat Anderson seine fünf Episoden mit Sinn für Dramatik ausgewählt: Er berichtet unter anderem von einem Häftling, dessen Liebhaber in den Westen entlassen wurde und der daraufhin in seiner Verzweiflung einen Aufseher erschlägt. Oder von einem Spitzel, den seine Zellengenossen – kaum daß er enttarnt ist – gemeinschaftlich ermorden.
Getrieben von solchen Erfahrungen, versucht Andersons Ich-Erzähler verständlicherweise, auf Distanz zu seiner Umgebung zu gehen. Die alltägliche Brutalität erschreckt ihn. Er möchte sich dem Kreislauf von gewalttätiger Unterdrückung durch die Schließer einerseits und gewalttätigem Aufbegehren der Sträflinge andererseits entziehen. Und der Ausweg, den er wählt, ist vielleicht typisch für einen Schriftsteller in seiner Situation: Er rettet sich in die Literatur. Er sucht Schutz in Gedichten, die es ihm gestatten, seine Erlebnisse zu verarbeiten, anstatt nur blind auf sie zu reagieren. So wird das Gefängnis für ihn zugleich zum Prüfstein seiner Schreibweise. Er schiebt die abgenutzte, expressionistische Metaphorik seiner frühen Texte beiseite: „es hat keinen sinn, das rechteckige stück himmel septemberfenster zu nennen, es ist sinnlos, zu sagen, die posten kreuzigen das gekreisch der vögel, oder von mannsbreiten schatten zu sprechen“. Statt dessen bemüht er sich um eine exakte, von Konventionen gereinigte Sprache, um den „eigenen Ton“, der seinem Erleben gerecht wird.
Aber das Gefängnis ist, so deutet er vorsichtig an, im Grunde nur das maßstabsgetreue Modell für eine totalitär regierte Gesellschaft. Die alltägliche Brutalität „draußen“ schreckt ihn ebenso wie die „drinnen“. Hinter seinem Vorsatz, sich ganz auf die persönliche literarische Ausdrucksform zu konzentrieren, verbirgt sich also letztlich ein politisches Konzept: die Sehnsucht, aus den festgefahrenen Fronten zwischen Macht und Gegenmacht, aus dem Clinch zwischen dem Regime und der Opposition auszubrechen. Parallel zu der zunehmend subjektiveren Sichtweise von Andersons alter ego nehmen die Geschichten einen deutlich lyrischen Grundton an. Dies leider nicht immer zu ihrem Vorteil: In die zunächst ganz präzise Prosa schleichen sich schließlich immer häufiger überanstrengte Formulierungen und verschraubte Sätze ein, die auch gutwillige Leser leicht ungeduldig machen können.
Eine ähnliche Entwicklung läßt sich auch bei den fünf Gedichtzyklen beobachten, die Anderson zwischen seine Gefängnis-Geschichten gestellt hat. Auch hier werden für ihn statt der deutschen Vergangenheit die Sprache selbst und das eigene Seelenleben wichtiger. Es sind delikate lyrische Gebilde, die dem raschen Verständnis einigen Widerstand entgegensetzen – und dies absichtsvoll: „Ich nehme nämlich das Gedicht von der großen Öffentlichkeit weg“, hat Anderson kürzlich erst erklärt, „das ist eine Demonstration. Man muß akzeptieren, daß ein Gedicht kein ,an alle‘, nicht der Satz Lenins ist, sondern eine Privatangelegenheit. Wenn man akzeptiert, daß Gedichte privat sind, sind sie jedem verständlich.“
Gewiß, allzugern wird die Literatur von allen ideologischen Lagern auf ihre politische Aussagekraft reduziert und also mißbraucht. Dagegen wehrt sich Anderson zu Recht. Doch die Einsicht, daß es in der Lyrik um Subjektives geht, ist weiß Gott nicht neu. Es kommt doch wohl darauf an, eine zumindest ahnungsvolle Verbindung zum Objektiven nicht völlig abreißen zu lassen. Oder wie es Anderson selbst sagt: dem Leser die Möglichkeit zu geben, „sich zu beteiligen, sich zu interessieren“. Mir kommt es aber so vor, als ob er seine „berliner elegien“ und „sonette“ geradezu mutwillig chiffriert, sie bewußt vor aller Welt verschließt. Der Wunsch sich hier „zu beteiligen, sich zu interessieren“, wird hartnäckig zurückgewiesen. So kann man es wohl niemandem verdenken, wenn er die Texte schließlich schulterzuckend beiseite schiebt.
Wer dies tut, kann allerdings Zuflucht nehmen bei einigen anderen Gedichten dieses Bandes: bei dem poetologischen Abschied von der Kindheit „epilog“. Es sind betörend zarte und irritierend schöne Erinnerungsbilder, mit denen der Lyriker Sascha Anderson beweist, daß er es sehr wohl versteht, ganz für sich und doch auch für andere zu sprechen.
Uwe Wittstock, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.7.1988
Zur Einmischung erzogen
Ich zahl „für nichtgestellte fragen“, meinte vor einigen Jahren der DDR-Autor Sascha Anderson. Gezahlt hat Anderson wohl aber gerade für gestellte Fragen, gezahlt unter anderem mit Gefängnishaft, gezahlt auch mit seiner Übersiedlung nach West-Berlin im August 1986. Der heute 35jährige Schriftsteller war zuvor im Ostteil der Stadt, dem Prenzlauer Berg, einer der vitalsten Verfechter und Organisatoren einer staatsfernen Literatur-, Theater- und Kunstszene.
Aufmerksamkeit erregte er mit seinem zweiten Gedichtband totenreklame, dem eine 7000 Kilometer lange Reise durch die DDR zugrunde liegt. In einem abgezirkelten Schneckenkurs bewegte er sich spiralförmig auf Berlin zu, was an einen eingesperrten Tiger erinnert, der fauchend die Gitterstäbe angrapscht, aber nicht auseinanderbiegen kann: „Die Mauer ist nur noch dazu da, daß wir uns an ihr die Köpfe einrennen.“
Seither hat er drei weitere Bücher herausgegeben, unter anderem eine Anthologie der neuen DDR-Literatur. Nun kann er das dritte eigene Buch vorweisen. Brunnen, randvoll heißt der schmale Band, der fünf Erzählungen, einen Sonettzyklus und viele andere Gedichtformen versammelt. Das Buch, mit 14 Holzschnitten seines Freundes Ralf Kerbach versehen, ist die „Ausbeute aus den Jahren des Wechsels und des Ankommens“.
Anderson verarbeitet in den Erzählungen seine Luckauer Gefängniserfahrungen. Die sind zuallererst einmal geprägt von Sexualität, von homosexuellen Beziehungen, die das ganze Gefängnisleben und die Hierarchie bestimmen. Knastbruder Natzi etwa landete dauernd im Gefängnis, „um aus dem Erzählen der Gefangenen von draußen, weil sein Außen vom Innen lebte, die draußen unaufgeklärten Fälle auszugraben.
Da er selbst aber im Knast nichts erzählen konnte von draußen, weil sein Außen vom Innen lebte, begann er zu verstummen, bis er draußen nichts mehr zu sagen hatte, da ihm drinnen keiner mehr was erzählte. Wer einmal draußen war, der spricht nicht mehr von drinnen.“ Bei solchen Sätzen lohnt es sich, langsam zu lesen.
Der gebürtige Weimarer kombiniert Schreck- und Traumgespinste, Wunschgebilde und Erinnerungsfetzen zu einem wahnwitzigen Crescendo von Quälerei und Selbstquälerei. Er beklagt die Zerstörung der Jugend, die er dem rigorosen Staat anlastet.
Aus dieser Anklage entwickelt sich ein vielstimmiges, poetisches Lamento der unfreien Welt, ein Abgesang auf die Demokratie des Ostblocks. Anderson bekennt kompromißlos: „Ich bin, indem sich das System in mein Leben einmischte, zur Einmischung erzogen worden.“
Anderson experimentiert mit der Sprache, zertrümmert sie und fügt sie neu zusammen; daraus entstehen neben hermetischen Partien und Chiffren zuweilen auch zusammengequälte Wortballungen. Dabei ist er sich der bescheidenen Mittel, über die er verfügt, durchaus im klaren: „Ich habe außer meiner Sprache keine Mittel, um meine Sprache zu verlassen.“
Stärker noch als in den Erzählungen probiert er dies in den Gedichten aus, die aber weiter gefaßt sind. Da stehen expressive Prosagedichte neben schöner Liebeslyrik, Balladen neben einem Sonettzyklus, lakonische Betrachtungen und Reflexionen neben respektlosen Parodien.
Seine Lyrik gibt sich erst einmal spröde, trifft aber genau ins Zentrum des Gemeinten; da stimmt jedes Bild, jede Beschreibung: „Ein Gedicht ist ein Bild, das nichts von sich weiß.“ Und wenn es um die Liebe geht, die Anderson gern besingt, geht es auch ohne Sprachspiele. Da nimmt er sich ganz zurück, stimmt leise die Auflösung von Ich und Du an.
Christian Huther, General-Anzeiger, 1.10.1988
brunnen, randvoll
Manchmal ist in der Literatur die Wut des Schriftstellers so groß, daß seine Texte wie Projektile herumfliegen. Das Buch brunnen, randvoll ist so ein Projektilhagel, der dem Leser ins Gesicht fliegt, wenn er den Umschlag entsichert. Nach der ersten Verblüffung, wie wenn man etwa eine Ladung Schrot ins Gesicht bekommen hätte, versucht man doch, aus den Texten etwas herauszupicken.
Den größten Eindruck hinterlassen wahrscheinlich die Gefängnistexte. In einer kräftigen „Scheißdinix-Sprache“ kommen Anleitungen der Wärter, Empfehlungen des Staates an seine Insassen und die Wut der Eingesperrten zusammen. Manchmal wird der Tagesablauf wie eine Inschrift zu einer Heldengedenktafel in den Text gemeißelt. Bei einer Überstellung von Häftlingen in ein anderes Gefängnis zünden schließlich die Gefangenen den Waggon an und kommen ums Leben. Die Zeitungen melden daraufhin zynisch, daß trotz der vorweihnachtlichen Hektik kein Schaden an der Post entstanden sei.
Wenn man mit der Wut gerade halbwegs zurechtgekommen ist, verblüfft es umso mehr, daß sich aus der groben Sprache auch sanfte Beziehungstexte hauen lassen.
Wäre ich du, ich würde nicht auf mich warten,
denn, der zu dir kommt, bin nicht ich. (S. 76)
So liegt einem dieses kleine Büchl wie ein großer Steinbruch im Magen. Einerseits drücken die klobigen Gefängnistexte, andererseits sprießt aus jeder Ritze die sanfteste Versuchung, einen Menschen zu umarmen. Der Buchtitel stimmt haargenau: Die Texte sind randvoll!
Helmuth Schönauer, aus Helmuth Schönauer: Tagebuch eines Bibliothekars, Bd. I, 1982–1998, Sisyphus, 2015
jeder, der spricht, stirbt
– passagen eines gespräches mit sascha anderson. –
„jeder, der spricht, stirbt.“
ein satz der wahrheit aus lauter lüge. in sascha andersons die erotik/der geier hat er jenen bezug zur wirklichkeit, den ich auch in unserem gespräch sehe; als ein zu grunde gehen, wo unter der oberfläche des schönen scheins die tiefe durchschlägt und das wunder des verstehens auf der suche nach sinn geschieht. in welcher anderen richtung hätte man sich sonst noch etwas zu sagen. interessant sind doch nur jene duelle, die nicht von vornherein im duett angetreten werden. wenn sich trotzdem ein (gemeinsamer) konsens herstellte, dann wurde der immer offen gehalten und kam keiner vereinnahmung gleich. die grenzorte des gespräches entstanden aus der unbegrenztheit der problematik und der spezifik des gegenstandes; in form von andersons texten. dabei erfolgte die beantwortung jener fragen, die sich aus diesem material bildeten, durch anderson, aus einer erfahrung, die er mit sich selbst schon hatte, aber während des gespräches zum teil neu geschaffen wurde. um die sehnsucht zum dialog zu erfüllen und eine begehbarkeit der letzten zelle des dichters, die nur die seine ist, wo kein anderer reinpasst, für mehrere zu ermöglichen ein durchaus akzeptabler vorgang.
wenn ich mit den fragen an sascha anderson zwei probleme besonders nachhaltig anspreche, dann aus folgenden gründen: zum einen halte ich den moment der bewegung, selbst in einem „passiven“ zustand, wie er bei anderson auftritt, für ein entscheidendes merkmal derzeitiger lyrik aus der ddr; andererseits ermöglichte mir der aspekt der „sprechenden bilder“ den inhaltlichen und formalen zugang zu andersons texten und scheint mir der (ver)wandelnde kern und die wesentliche art seines denkens zu sein.
Egmont Hesse: jeder, der spricht, stirbt.“. trifft dieser satz jetzt zu?
Sascha Anderson: das hieße, daß sich die problematik erledigt hätte in dem moment, wo ich darüber spreche.
Hesse: in die erotik/der geier klärt er allerdings die situation.
Anderson: da lag auch das problem anders. eine gesellschaftliche situation wird dort auf einem ziemlich spitzen punkt, nahe dem gipfel, kurz nach der schlacht, präsentiert. sie haben sich hergestellt durch das, was sie taten. jetzt kommt es zu einer identifikation und erledigung. die aus der schlacht kamen, sind soldaten, sind tötende gewesen, ihre funktion innerhalb des gewesenen war töten, und dieses nichtverlassenkönnen ihrer funktion, obwohl die schlacht vorbei ist, heißt, alles, was sie tun, ist töten. das bezeichnet genau diesen wurmfortsatz, der jetzt die gesellschaftliche situation charakterisiert. diese phase wird irgendwann auftauchen als ein kleiner rest nach dem faschismus. und die charakteristik dieser vierzigjährigen epoche, die sprache gewinnt das geschehen, wird mit den wörtern dieses wahnsinns geknüpft sein. wenn man irgendwann das archiv dieser zeit aufmacht, wird man, wenn man mit den begriffen dieser zeit spricht, oder wenn man diese zeit mit den begriffen, ihren begriffen klären will, auf die problematik ihrer begründung im faschismus stoßen. zwar wird diese zeit als positive folge beschrieben, aber eben mit dem zwingenden gestus von reagenzien. und das ist der punkt, an dem ich schreibe, der wahnsinn dieses wurmfortsatzes, die differenz zwischen der begrifflichkeit, die später dafür verwendet wird. und dem, was wirklich ist. ich schreibe in dem sterben der männer auch das sterben der sprache, mit dem sterben des verlierers auch das sterben des siegers. es geht um die sprache einer zivilisation, die trotzdem stabil bleibt. wenn jetzt jemand stirbt, dann stirbt immer der andere. man hat es gelernt, mit der schizophrenie produktiv umzugehen. ich bin nicht schizophren, sondern ich bin der, der schizophrenie als mittel zur verfügung hat. d.h., ich brauche nicht die zwei welten, in denen ich existiere und mich ausdrücke, und ich kann eine immer sterben lassen… welchen sinn das hat, interessiert dabei erstmal weniger als die möglichkeit. ich verfüge über die mittel der schizophrenie, ohne selbst betroffen zu sein. ich halte das aber für negativ.
der grundgestus meiner texte hat immer mit dem tod zu tun, ohne daß mich das persönlich betrifft. die erfindung dieser psychobombe, die bewußte spaltung, um den einen sterben zu lassen, um mit dem anderen alles zu machen.
Hesse: führt dieser wahrheitsanspruch von z.b. „ich bin tot“, den literatur benutzt, und das darüber-hinaus-leben nicht irgendwann zur halluzination?
Anderson: mein problem ist es nicht, aber ich weiß natürlich, daß es ein problem sein kann. wenn ein mensch sagt: ich bin tot oder ich sterbe, dann sagt er das ja nicht vor 5000 jahren. er lebt nicht mehr in einer archaischen gesellschaft, und er lebt nicht mit den tabus und gesetzen dieser ordnung, wo jemandem ein stock vor die füße geworfen werden konnte, und der starb oder mußte sich töten. das ist ja nicht der fall in einer zivilisation, wie sie im moment funktioniert, die mit (ihrer) schizophrenie gut umgehen kann. ich kann also tatsächlich sagen: ich bin tot und lebe weiter. das sind zwei verschiedene sachen. wenn ich behaupte: ich bin tot, dann kann es sein, daß das ein punkt ist, der gewisse dinge in mir beenden soll und möglicherweise auch tut und dort an der stelle ursächlich die archaische funktion erfüllt. dieses beschwören von etwas, dieses andere in mir selbst, dieses ich ist gar nicht so sehr das über„ich“, sondern halt das andere ich. ich lebe ziemlich bewußt mit dieser spaltung. wenn ich sage: ich bin tot, dann spreche ich nicht unbedingt zu mir, sondern, da ich weiß, daß ich ein ziemlich gespaltener Mensch bin (nicht als gespaltene persönlichkeit), nur zu einem bestimmten teil von mir. und natürlich oder besser selbstverständlich soll dann der teil, den ich anspreche, in mir auch wirklich tot sein. und es ist auch eine demonstration mit symbolcharakter. nenne ich mein leben nun sterben oder leben, so ist das eine dialektische angelegenheit. es war für mein schreiben wichtig, nicht realistisch, sondern ziemlich fatalistisch an diese sache heranzugehen und es sterben zu nennen, um den punkt am ende auch ganz klar zu fassen, zu wissen, auf was es zugeht.
Hesse: obwohl der moment des schreibens (die formulierung eines gedankens) den akt des tötens (die vernichtung anderer gedanken) voraussetzt, endet der vorgang doch in einem wort, das auf die gleiche weise andere worte nach sich zieht. siehst du dich auch damit konfrontiert?
Anderson: da würde ich erst einmal sagen: herr richter, ich bin unschuldig. im gegensatz zu papenfuß oder döring gehe ich nicht von der kleinsten einheit des wortes aus. wenn ich über moleküle spreche, bin ich mir natürlich bewußt, daß es atome gibt, aber beim schreiben gehe ich nicht über eine bestimmte philologische, linguistische, gesellschaftliche dimension, die mir bekannt ist, hinaus. ich schaffe durchaus sprachlich keine neuen räume. dadurch, daß es bei mir sehr selten gedichte gibt, die über den satz hinausgehen oder ihn nie erreichen, ist der raum einer aussage schon ziemlich klar angedeutet. und wenn ich mit dem satz, den ich als meine ausgangsposition erkannt habe, etwas anfange, dann weiß ich, daß ich mich damit auf mir bekanntem gebiet bewege. zum teil wurde das von mir selbst geschaffen, aber ich bin keiner, der beim schreiben formal unbekanntes territorium betritt. wo ich mich bewege, dort ist auch meine heimat. da ich nicht mit unvertrauten größen dialogisiere, kommt es kaum zu einer den sprachraum, den platz zerstörenden geste.
aufbrechen ist ein begriff, der mir fast fehlt. es gibt texte von mir, wo das z.t. zutrifft; die sind meistens mit anderen leuten entstanden oder beziehen sich auf das denken oder leben mit anderen. das hat aber in den letzten zwei, drei jahren abgenommen.
Hesse: welche gründe gab es dafür?
Anderson: 1976–78 wurde ich mit den dichtern meiner generation bekannt, und wir hatten einen starken dialog miteinander, der notwendig war, um sich kennenzulernen. das setzte ein aufeinander zugehen voraus und führte zu gemeinsamen arbeiten.
Hesse: ein zustand, der jetzt abgenommen hat?
Anderson: ja, man kennt sich, sieht, was der andere macht, und akzeptiert sich. man bringt sich jetzt mehr als lebender mensch ein, weniger als anregender dichter.
Hesse: aber trotzdem entstehen noch gemeinsame texte.
Anderson: das stimmt. nur beim ersten mal hat das die basis gehabt, zu sehen, was kann, was macht der andere, wie kann man mit den mitteln des anderen etwas tun. je mehr man die expansion, aus sich selbst in den anderen, hinter sich bringt, desto mehr kann man sich mit den mitteln des anderen sehen. jetzt muß man nicht mehr dessen mittel verwenden, um sich selbst mit ihnen zu erkennen. ich erkenne mich durchaus in den texten von papenfuß wieder, ohne sie selber zu schreiben. ich denke, daß das papenfuß oder döring mit mir ähnlich geht.
Hesse: ich beobachte in den bestrebungen einer jungen autorengeneration einen neuen vehementen drang zur bewegung, der (in anderer form) einen gesellschaftlichen zustand widerspiegelt. worte wie gangart erfahren vielfältig erweiterte sinndimensionen, du selbst nennst ein buch von dir totenreklame – eine reise. ist schreiben an sich schon eine form von bewegung und mehr als der balanceakt neben dem seil, das zwischen ernst und spiel pendelt?
Anderson: sicher, nur mit bewegung ist bei mir nicht allzuviel. ich liege lieber. es ist mein problem, daß ich in vielerlei beziehung relativ außerhalb stehe, auch den bewegungen gegenüber, die ich formal umsetze und jenen, zu denen ich einen formalen gestus finde. wenn ich überhaupt die gebärde der bewegung ausdrücke, so muß es durchaus nicht meine bewegung sein.
Hesse: dieser „passive“ zustand ist in deinen texten allerdings kaum spürbar, viel eher merkt man, daß da, wo ein satz durch einen punkt beendet wird, mit dem nächsten, der seinen anfang im vorangegangenen hat, fortgeführt wird. die sätze greifen ineinander und gehen so über sich hinaus. und das erscheint mir durchaus als ein drang nach bewegung.
Anderson: die satzzeichen habe ich sehr spät erobert. 1968 bis ende der siebziger jahre habe ich sie nicht verwendet. erst als ich merkte, daß mein ganzer grund vom gesprochenen satz herkommt, habe ich punkte und kommas sehr gezielt eingesetzt.
Hesse: um den zeilenbrüchen, dem heer kleingehackter alexandriner, zu begegnen, und die blockschreibweise, die du ebenfalls in früheren gedichten benutzt hattest, wieder aufzubrechen?
Anderson: durchaus. im relativ hermetischen block bin ich noch einem prinzip der dialektik gefolgt, das mich jetzt nicht mehr interessiert. der vorteil eines solchen blocks ist seine äußerlich sehr hermetische form, die praktisch eine zeile ist. es gibt kaum verse, die kann jeder für sich, in dem duktus, dem metrum, in dem er denkt und fühlt, herstellen. punkte und kommas waren für mich eine eroberung innerhalb eines gewonnenen selbstbewußtseins.
Hesse: damit ergibt sich aber ein widerspruch. lasse ich dem leser alle möglichkeiten des verstehens, oder dränge ich ihm (m)eine lesart auf.
Anderson: es ist jetzt durchaus so, daß ich in den hermetischen texten eine lesart mitgebe. in den kurzen gedichten war es schon immer anders. die waren doch sehr punktiert geschrieben. am deutlichsten ist der bruch in die erotik/der geier. da kommt das in kurzversen sprechende mit längeren monologen, die mit satzzeichen geschrieben sind, zusammen. in den kurzen zeilen, wo die leute schnell atmen und schnell sterben, da gibt es auch keine satzzeichen. wo ruhepunkte sind, langsam gesprochen wird, da soll ein bewußtsein auch durch die interpunktion gezeigt werden, bei dem, der spricht.
Hesse: hier zeigt sich aber die bewegung in deinen texten ganz deutlich.
Anderson: ich meine, daß eine bewegung, die vor mir stattfindet, die überhaupt stattfindet, sich vielmehr im text widerspiegelt, wenn ich selbst nicht in der bewegung bin. 1980 war das noch anders. da haben wir u.a. ein statement geschrieben, das hieß jetzt. das hauptwort des jahres 1980 war für unser ganzes tun JETZT. und dieses jetzt drückte eine bewegung aus, in der wir selbst steckten. diese bewegung wurde auch in sehr bewegte verse umgesetzt. jetzt beobachte ich bewegungen lieber aus einer gewissen distanz, obwohl sie mich natürlich bewegen.
Hesse: resultiert das aus der angst, von der bewegung mitgerissen zu werden, ohne zu wissen, wo man ankommt?
Anderson: es gibt selbstverständlich die angst, in etwas hineingerissen zu werden. ich habe im knast gesessen, und ich möchte nicht noch mal. das gilt auch für meine texte. strukturell gibt es da keinen unterschied zu meinem verhalten in der gesellschaft. ich setze mir meine punkte selber, ich weiß, wo ich eine neue zeile beginne, auch wenn ich im text spreche, bin ich nicht unbedingt vorhanden, ich akzeptiere, daß meine erfahrungen nicht nur meine erfahrungen sind, ideen haben viele, ich weiß, was ich tue mit jedem text, und ich suche mir die gesellschaft aus für die ich schreibe. nicht die ganze menschheit will ich erreichen, sondern ich schalte ein sieb vor, und die durch dieses sieb, das kein moralisches oder ethisches, sondern ein sehr persönliches ist, durchfallen, für die schreibe ich auch. das sind menschen, mit denen es mir möglich ist, zusammen zu leben, ohne daß aggressionen oder grenzüberschreitungen stattfinden, und die haben auch die möglichkeit, meine texte zu verstehen. ich schreibe sehr bewußt aus dieser perspektive.
Hesse: damit wird der leser aber sehr bestimmend für deine gedichte.
Anderson: ja, es gibt kein gedicht von mir, das nicht irgendjemand liest, da es auch für irgendjemand geschrieben ist. daß es hundert andere mittlerweile auch lesen, ist etwas ganz anderes. problematisch wird es für mich dann, wenn es der, für den ich es geschrieben habe, nicht versteht.
Hesse: heißt das, du würdest nicht schreiben, wenn der, für den du schreibst, es ablehnt, dich zu lesen?
Anderson: angenommen, der dichter schreibt einen text, um einem menschen zu sagen, daß er ihn liebt, und es ist seine einzige möglichkeit es dem menschen zu sagen, und der sagt: ja mein herr, es tut mir leid, aber ich lese ihre gedichte nicht, dann muß der dichter damit leben. das ist genau der punkt, an dem ich abwarte. Es kann sein, daß ich mich in eine liebe stürze, aber in ein gedicht ganz sicher nicht. das gedicht versucht, etwas innerhalb eines prozesses zu fassen, nicht das gewesene, sondern es versucht, ein transformationspunkt zu sein, um etwas innerhalb einer beziehung oder in einem historischen geschehen zu klären, zu verändern.
Hesse: angenommen, schreiben beinhaltet in seiner bewegung den drang zur begegnung, wer trifft dann wen?
Anderson: das ist ein unheimlich weites feld. da spielen worte wie aggression, invasion, expansion eine rolle. das ist eine frage der persönlichkeitsstruktur. da guckt man sich am besten die nasen der dichter an, da werde ich über mich jetzt nicht viel sprechen, sondern einfach ein foto mit dazulegen.
Hesse: der text eines deiner lieder besteht aus dem unendlichen satz: geh über die grenze auf der anderen seite steht ein mann und der sagt geh über die grenze auf der anderen seite steht ein mann und der sagt geh über die grenze…
ist die grenzüberschreitung letztendlich eine rückläufige bewegung?
Anderson: die richtung der bewegung ist in diesem lied nicht vorgegeben, und das liegt daran, daß das vorbild dieser ewigen zeile „ein mops kam in die küche…“ ist, was man dazu sagen müßte. und in „ein mops kam in die küche“ ist das bild sehr klar. es ist räumlich eher so wie ein spiegel, in dem man verschwindet, eine solche offenheit hat diese bewegung. sagen wir, zwei spiegel stehen sich gegenüber, da geht die bewegung nicht immer in der einen richtung, und trotzdem ist die richtung vorhanden. man geht nicht vom punkt a, der man selbst ist, durch einen spiegel und immer weiter, da zwei spiegel sich gegenüberstehen, ist es richtungslos. es ist eher die form eines trichters, aber zwei trichter, die ineinander verschoben sind. der mann in dem gedicht ist man natürlich auch selber, oder das ist dein grab, in das du gehst, oder das ist dein gott, mit dem du dich austauschst. das ist auch ein sehr mythologischer text.
Hesse: in deinen texten habe ich worte gesucht und habe bilder gefunden. wo ich glaubte, dir zu begegnen, stieß ich auf deine figur im spiegel. ist die sprache das reich der bilder? das zeichen die heimat der worte?
Anderson: hier muß ich jetzt auf meine schwierigkeiten im umgang mit fragen hinweisen, ist es doch so, daß ich ziemlich schlecht direkt reagieren kann. wenn ich ein bild habe, dann habe ich viel mehr sprache zu einem bild, ohne daß ich das unbedingt aussprechen will, ohne daß es ausgesprochen werden muß. einem bild gegenüber finde ich meine sprache sofort. – das muß keine lyrik sein – das bild ist ein größerer partner für mich, wörtlich zu reagieren. andererseits, wenn eine frage oder ein satz mir gegenüber auftaucht, habe ich es schwer mit reagieren. dort funktioniere ich ganz anders als in der literatur. in einem satz, der mir begegnet, gehe ich viel mehr auf die bedeutung der worte ein. angenommen da sagt jemand zu mir: guten tag. da müßte ich erst einmal lange darüber nachdenken, was das ist „guten tag“. wenn er aber die hand rausstreckt, ist es einfacher für mich. ich kann die hand ergreifen. um aber auch etwas zu sagen, würde sich das am besten aufheben, wenn ich sage: tag guten oder gat netug. da gibt es noch viel gravierendere beispiele. ich sitze und höre einem gespräch zu; da sind so viele mißverständnisse aus der gewohnheit zu sprechen dabei, da wird mir übel bei dem, was so zwischen wort und wort, zwischen satz und abersatz (der meist nur ein hm ist) passiert. ich bin fast unfähig, auf worte zu reagieren. wenn jemand etwas sagt und wirklich etwas will, dann müßte das, was ich dazu sage, die tat sein, die das, was er will, umsetzt. werde ich von jemanden um ein stück brot gebeten, dann habe ich ihm das brot doch nicht gegeben, indem ich gesagt habe, daß ich ihm brot gebe. also sage ich lieber nichts und hole das brot. oder es muß etwas bewirken. und um noch einmal auf eine frage weiter vorn zurückzukommen (angenommen schreiben beinhaltet in seiner bewegung den drang zur begegnung, wer trifft dann wen?); ich kann natürlich auch jemanden, der mich um brot bittet, mit dem brot umbringen. natürlich will ich mit meinen gedichten begegnungen, aber ohne daß die bewegung zu einem grenzübertritt führt. wenn ich meine grenzen erweitere, dann darf ich den anderen nicht einengen, sondern er muß mit mir die möglichkeit haben, seine grenzen auch zu erweitern (ich glaube, in und durch kunst ist das möglich). nicht wir teilen uns etwas, sondern wir schenken es uns. teilen ist das schlimmste wort, das ich kennen gelernt habe; wie es benutzt wird in dieser gesellschaft. ab einer bestimmten stelle wird teilen immer ein grenzübertritt, um den anderen in sich reinzuzerren, nicht um sich dem anderen zu schenken.
Hesse: du verwendest in großer anzahl metaphern und chiffrierte bilder. nennt ihr inhalt das geheimnis von geheimnissen, die anders nur „das leben“ offenbart, und ermöglicht erst die verwandlung das erkennen? verhüllen die bilder, um etwas sichtbar zu machen, das bis dahin unbekannt war?
Anderson: mit den bildern ist es ähnlich einem haus, das zum potentiellen gebäude für deutsche märchen wird, die am ende gut ausgehen, weil das haus immer noch dasselbe ist. „es war einmal… und wenn sie nicht gestorben sind“, aber dazwischen unendlich viele leichen; und das ist der horror des deutschen märchens: die leichen verändern die geschichte überhaupt nicht; und das ist ein märchen.
Hesse: es gibt von dir zwei texte (ein gedicht und eine erzählung) mit dem gleichen titel brunnen randvoll, dort erscheint mir die verwandlung (im gedicht) mit dem erkennen (in der erzählung) einher zu gehen…
Anderson: brunnen randvoll ist eine glückliche konstellation. da hat das gedicht die gleiche überschrift wie die story. in der story selber ist (für mich) noch ein gedicht begraben. ich habe es nur wieder rausgezerrt für andere. real ist das gedicht verschwunden. es geht in der story um ein gedicht, das ich vor jahren im knast geschrieben habe. dieses gedicht verschwindet aus der story, indem der mann, der mein gedicht auswendig gelernt hat, in den westen geht und als seins verkauft. im grunde genommen gibt es also drei texte mit dem titel brunnen randvoll, es sind aber nur zwei da. das eine gedicht, ein vordergründig politischer text, ist in der erzählung brunnen randvoll begraben. ich würde diesen zustand als metapher sehen wollen, indem ich sage: die gedichte werden in den stories begraben. bei meinem schreiben ist an bestimmten punkten immer so eine bruchlinie, wo mir dinge ziemlich bewußt werden, die ich ganz konkret in diese form der erzählung und des gedichtes und des gedichtes in der erzählung geschrieben habe. in der geschichte ist die gefangenschaft eine räumliche (durch den knast) und im gedicht ein zeitliche (durch das historisierende). also es passiert im gedicht wie in der story genau dasselbe, bloß auf zwei unterschiedlichen ebenen. und der eigentliche raum unter der überschrift brunnen randvoll ist zwischen dem gedicht und der geschichte. genau dort ist das wirkliche zimmer, in dem ich lebe. das wäre auch für mich selbst eine positionsbestimmung.
Hesse: würdest du deine position als ein dazwischen auffassen?
Anderson: wenn ich jetzt sagen würde dazwischen, dann mache ich genau den fehler, den man nicht machen kann, da ich an einer stelle, an der eigentlich die fronten aufgelöst sind, neue fronten schaffe.
Hesse: gedicht und erzählung streben allerdings, für mein empfinden, nach einem ausgleich, wie es zwischen worten diese „sucht nach dem gleichgewicht“ ebenfalls gibt. stellt die sich für dich beim schreiben her?
Anderson: überhaupt nicht. ich bin permanent damit beschäftigt, die lücken, die ich als solche erkannt habe, auch als lücken zu produktivieren und nicht zuzuschütten. das gilt natürlich auch für die lücke zwischen wort und wort, wort und bild. wenn die nicht wäre, hätte ich aus meiner position, die (so hätte ich es gern) eine position der zukunft ist, nichts zu ficken. das schöne ist diese sexuelle differenz. die aber nicht mein thema ist.
Hesse: aber eine unbestimmte geste, und in dieser beziehung dem eNDe – wie eine reihe deiner gedichte überschrieben ist – ähnlich?
Anderson: wahr-scheinlich.
Dieses Gespräch wurde im Oktober 1985 geführt.
Erschienen in: Egmont Hesse (Hrsg.): Sprache & Antwort. Stimmen und Texte einer anderen Literatur aus der DDR, S. Fischer Verlag, 1988.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.


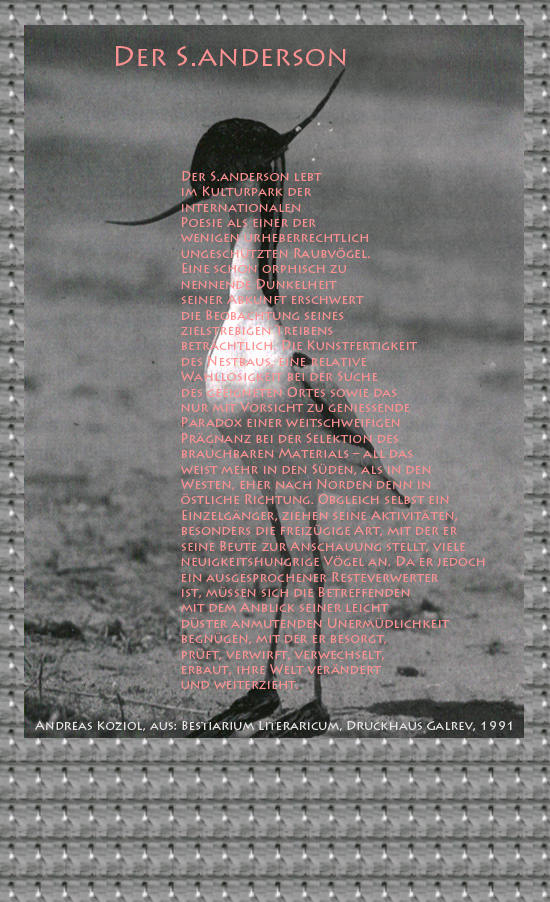












Schreibe einen Kommentar