Sascha Anderson, Fabrik & Zwitschermaschine: alles geld der welt kostet geld
jeder satellit hat einen killersatelliten
jeder satellit hat einen killersatelliten
jeder satellit hat einen killersatelliten
jeder tag hat eine nacht
jeder panzer eine pak
jedes erste programm hat ein zweites programm
jedes zweite programm hat ein drittes programm
jedes dritte programm hat ein viertes programm
jedes vierte programm hat ein fünftes programm
und im nächsten sitzt ein neger
der trinkt whisky sto gramm
Sascha Anderson
Im Bärenfell am Arsch der Welt:
– Ostberliner Poeten und Musiker. –
(…)
Wie bei diesem Projekt war Sascha Anderson, der seine absurden Spagatübungen als Dichter und Zulieferer bei der Stasi bis heute nicht wirklich aufklären konnte, auch an anderen Medialisierungen beteiligt. Schon Anfang der achtziger Jahre hatte er mit der Gruppe Zwitschermaschine (der Bandname war von Paul Klee geborgt) Texte auf die Bühne gebracht, die ins Zentrum eines Lebensgefühls traten:
jeder Satellit hat einen Killersatelliten
jeder Satellit hat einen Killersatelliten
jeder Tag hat eine Nacht
jeder Panzer eine PAK
(…)
oder der Endlos-Vers nach dem bekannten Muster vom Mops in der Küche:
Geh über die Grenze
auf der anderen Seite
steht ein Mann und der sagt:
Geh über die Grenze
(…)
Auch andere Lieder dieser genialen Dilettanten-Gruppe aus Malern und Schreibern wurden später von Anderson mit der Gruppe Fabrik recycelt, jetzt stark Rock-orientiert und an einigen Stellen ein wenig hysterisch überzogen. Allerdings geben die erhaltenen Tondokumente, die 1986 im Studio eingespielt wurden, keinen ganz authentischen Eindruck wieder. Etliche Lieder wurden durch technische Spielereien um ihre eigentliche Aggressivität gebracht, die man live durchaus hatte erleben können.
Neben Dörings „ich fühle mich in grenzen wohl“ hatte Anderson die zweite „Hymne“ der Szene geschrieben, die ihr politisches Selbstverständnis artikulierte. Der Text existiert in verschiedenen Fassungen, in unterschiedlicher Radikalisierung. Um sich mit seinem Tun nicht kriminalisieren zu lassen, wurden kurzerhand die Funktionäre mit ihrem manischen Verhinderungswillen in den Widerstand geschickt:
heute morgen stehe ich wieder nicht auf
bei konnopkes hängt eine fahne raus
ein bulle geht bei rot übern damm
die funktionäre sind im widerstand
…
die gesetze stehen richter bei fuß
ich liebe den ideologischen kuß
der staat baut sich ein türmchen an
die funktionäre sind im widerstand
Im Oktober 1985 hatte Anderson zu Egmont Hesse im Interview gesagt:
ich brauche nicht die zwei welten, in denen ich existiere und mich ausdrücke, und ich kann eine immer sterben lassen.
Er spricht, als Ort seines Schreibens, eine Zivilisation an, „die mit (ihrer) Schizophrenie gut umgehen kann“. Da Schizophrenie ganz sicher eines der Kernpunkte des modernen Subjekts umschreibt, und gewisse Ich-Spaltungen zu den zivilisatorischen Abläufen gehören, konnte Anderson, obwohl das vielleicht pervers klingen mag, nicht nur trotz, sondern vielleicht gerade auf Grund seines Doppellebens einige besonders klarsichtige Statements formulieren:
ich bin kein artist
ich bin kein artist ich mach kein spagat
ich häng mit meinem weissen hals im heissen draht
ich bin kein artist also bleibe ich hier
auch wenn mir dabei noch das herz erfriert
(…)
ich bin kein artist von land zu land
ich bau mir meine mauer selber durch den leib
die eine hälfte fault sogleich die andre mit der zeit
Ein Artist war er wohl doch, der sich seine Spaltungen gleich in mehreren Richtungen vom Leib schrieb. Daß in seiner Attitüde manchmal etwas Übertriebenes und Unechtes steckte, ist Jan Faktor früh aufgefallen.
Peter Böthig, in Roland Galenza und Heinz Havemeister (Hrsg.): Wir wollen immer artig sein… – Punk, New Wave, HipHop, Independent-Szene in der DDR 1980–1990, Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag, 1999
ZWITSCHERMASCHINE (1979–1983)
Cornelia Schleime (voc, lyrics)
Matthias Zeidler (bg)
Wolfgang Grossmann (dr)
Michael Rom (voc, lyrics), ab „starting“ 1981
Ralf Kerbach (g), bis „until“ 1982
Sascha Anderson (voc, lyrics)
Lothar Fiedler (g)
Helge Leiberg (trp), 1982
Volker Palma [tba, vl)
Ob der Bandname auf Paul Klees Bild gleichen Titels zurückgeht, ist nicht gewiss. Dass die wagemutigen Kunststudenten der Dresdner Akademie Cornelia Schleime und Ralf Kerbach genug hatten von Gängelung und eingeschränkten Experimentierfeldern im realen Sozialismus – das ist sicher. Nach einer durch die Umstände vermasselten Ausstellung im Radeburger Heimatmuseum schalteten sie um auf eine härtere Gangart und starteten ein Band-Projekt. Kerbach schätzte die Sex Pistols und die Stranglers, Cornelia Schleime wollte ihren eigenen Texten Stimme geben und so kam es zu einer Konstellation, die sich in dem Maße zu wandeln begann, in dem neue Mitglieder wie Michael Rom, Lothar Fiedler oder Helge Leiberg für kürzere oder längere Zeit integriert wurden. Michael Roms Texte sind romantisch und tragen zugleich eine Ahnung eines Zusammenhangs, obwohl keine Fragen gestellt werden. Sie harren ihrer Wiederentdeckung. Was von der Radikalität der Texte von Sascha Anderson noch übrig bleibt, seitdem bekannt ist, dass er für die Stasi gearbeitet hat, entscheidet sich im Gehörgang derer, die die Zwitschermaschine für die beste Art-Punk-Band der DDR halten.
Christoph Tannert, Ausstellungskatalog Geniale Dilletanten. Szene Ost. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Goethe Institut, 2017
„Ich hatte keine Probleme mit der DDR“
– Mit Sascha Anderson sprachen Thomas Blume und Frank Goyke. –
Thomas Blume: Du hast gesagt, Du hast 1970 Leuten Gedichte von Dir gezeigt.
Sascha Anderson: Ich fing 68 an zu schreiben. Das ist ja bei vielen so, daß sie es aus äußeren Umständen heraus versuchen. Damals war ich 15 und meinte, ein Dichter sollte jeden Tag wenigstens ein Gedicht produzieren. Bei mir waren es mehr. Ich war seriell. Ich habe aus dem Fenster gesehen und hab mir meine Gedanken über die Weltgeschichte gemacht, und da mußte dann irgendwas draus werden. Auf diese Art hatte ich nach den ersten 10 Jahren 5.000 Texte. Aber ich begreif das heute mehr als Naturstudium.
Doch damals sollte das alles an die Öffentlichkeit. Da bin ich dann auf die nächstbeste Lesung gerannt, da las Heinz Kahlau, und dem hab ich das alles hingepackt. Ich war in der Schriftsetzerlehre in Dresden. Über Kahlau kam ich wieder mehr nach Berlin. Eigentlich bin ich in Weimar aufgewachsen. Das war damals alles ein ziemliches Hin und Her. Kahlau, das ist diffizil, er hatte eine gute Art, einem was klar zu machen. Obwohl ich seine Position nie genau einschätzen konnte. Ich wußte nicht, was da für ein Mensch dahintersteckt. Aber er hat uns zusammengebracht und er war solidarisch, hatte Geld und hat es gegeben. Er funktionierte ohne Illusion. Also ich will ja nur sagen, daß ich ihm ziemlich viel verdanke.
In Berlin habe ich dann die Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch zu tun habe, auch literarisch. Frank-Wolf Matthies, Uta Mauersberger, Uwe Kolbe, Stefan Döring und Bert Papenfuß.
1980/81 bin ich dann wieder direkt nach Berlin gezogen. Zwischendurch war ich noch ein paar Jahre bei der DEFA Volontär und an der Filmhochschule als Autor, Nachtpförtner in Pfunds Molkerei in Dresden und im Knast.
Blume: Hattest Du zu der Zeit schon in der DDR veröffentlicht?
Anderson: Ja, einmal sind 4 Gedichte von mir veröffentlicht worden. Ich glaube das war 77, da stellte Paul Wiens in der neuen deutschen literatur junge Autoren vor.
Nach dem Knast habe ich noch ein Jahr in Dresden in der Versöhnungskirche als Hausmeister gearbeitet. Wir haben dort gemeinsam mit sehr aktiven Leuten eine erste Autographenbörse veranstaltet. Der Erlös ging an behinderte Kinder. Zur damit zusammenhängenden Lesung waren Autoren wie Gert Neumann, Wolfgang Hilbig, Uwe Kolbe, Christa Wolf und Franz Fühmann da, ich glaube noch andere, aber das weiß ich nicht mehr so genau, und wir hatten ein Jahr lang Handschriften und Grafiken gesammelt. Natürlich waren damals vor allem die interessant, die im Zusammenhang mit der Biermann-Sache weggegangen sind. Aber es war sehr breit angelegt, und tausende Leute waren da und man sah, daß das politische Engagement einen Effekt hatte.
In diesem Zusammenhang sprach Fühmann Uwe Kolbe und mich an, ob wir nicht in seinem Auftrag eine Sammlung von in der DDR nicht veröffentlichten Autoren machen wollten. Er hatte das wohl wiederum mit Konrad Wolf abgesprochen. Das war so halbintern gedacht, für die Arbeit und zur Diskussion mit Germanisten, Philosophen, Gesellschaftswissenschaftlern. Aber das war ein Eklat. Eine von Fühmanns großen Enttäuschungen, und die Stasi machte dauernd Terror, und Konrad Wolf hatten sie ein Manuskript aus der Schreibmaschine geklaut. Nur uns brachte es in irgendeiner Form zusammen.
Später kam ja dann der Verlag Kiepenheuer & Witsch. Die hatten Elke Erb gebeten, und Elke wiederum bat mich, ihr zu helfen. Und wir haben damals dieses Buch Berührung ist nur eine Randerscheinung angefangen. Etwa gleichzeitig kam ich auch zum Rotbuch Verlag in Westberlin. Paul Gratzik und Heiner Müller waren da Autoren, über die ging das, und vielleicht bin ich dadurch, daß ich mich mit den Leuten von Rotbuch irgend wie gut verstand, nie in Versuchung gekommen, mich in der DDR bei offiziellen Häusern anzubieten. Ich war ja nie in einer Organisation, bin nie zum Amt für Urheberrechte, war nie im Schriftstellerverband und alles das. Wahrscheinlich habe ich im Knast ein Ding weggekriegt. Ich sah die Struktur ziemlich klar und wollte möglichst nicht berührt werden.
Damals wollte ich veröffentlichen, und ich denke, das war eine staatliche Fehlleistung, mich nicht zu nehmen. Die andere Seite ist, daß ich im Laufe der Zeit immer weniger produzierte. Inzwischen habe ich das sehr drastisch auf 10 bis 20 Texte im Jahr gedrosselt.
Der Staat hat sehr viel Energie verbraucht, beim Deuten der Texte gegen sich. Aber die wirklich unabhängigen Strukturen, die sich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der DDR gebildet haben, die waren für die unbegreifbar. Diese Unabhängigkeit, auch die mehr oder weniger ökonomische Unabhängigkeit; hatte ja einen Effekt für das Selbstverständnis, auch das Existenzielle. In diesen Zeitschriften und Grafikbüchern, in allen freien, kleinen Medien hatten wir ein Plateau für das Miteinander. Auf dieser selbstgeschaffenen Ebene ist das Eigentliche passiert.
Blume: War der Bruch, der diese Bewegung in Gang setzte, die Biermann-Sache 1976, die Veränderung in der Kulturpolitik?
Anderson: Ja, das politisierte alles, aber die Entscheidung sich unabhängig zu machen, hatte nichts mit Biermann zu tun, eher mit dem, was diese Angelegenheit bei denen bewirkte, die direkt damit zu tun hatten. Mag sein, daß es für manche Autoren ein Bruch war, aber in die Gemeinsamkeit ging das nicht bewußt ein.
Blume: Fühlst Du Dich dieser Autorengeneration, die Du erwähnt hast, auch literarisch zugehörig? Diese Autoren verweigern ja ein direkt politisches Engagement im Text.
Anderson: Ja, dort genau würde ich mich auch hinstellen, nur die Methode ist eine andere, aber es geht ja nicht um eine Demonstration. Papenfuß ist Astronom und Döring mathematisch, und Faktor kommt vom Automatismus, dem er sich verweigert. Jeder hat so seine Verweigerungen und in dieser Reihe stehe eben auch ich. Ich versuch das eben textlich zu lösen, in Form von Sätzen.
Blume: In Deinen Texten findet sich eher als bei anderen dieser Autoren eine Polemik gegen bestimmte Zustände. Zum Beispiel, wenn Du in dem Reisebuch totenreklame aus einem Gespräch mit einem Offizier ein Gedicht machst; oder Deine Knasttexte in brunnen, randvoll.
Anderson: Normalerweise bin ich viel privater als bei dem Reisebuch, das ich als Konzept ansehe. Eigentlich neige ich dazu, jeden Text, von dem ich nicht weiß, aus welchem Grund er entstand, wegzuschmeißen. Das Warum ist etwas sehr Privates. Ich kann im Widerstand nichts machen und brauche was, das mich zu einer Sache hinzieht, ein persönliches Verhältnis, das ich bejahe. Aber das ist ja das Naheliegendste und vielleicht auch Einfachste.
Blume: Ist in der Zeit, als Du Autor an der Filmhochschule warst, dort etwas von Dir produziert worden?
Anderson: Ich habe als Autor einen Spielfilm gemacht, ein mir sehr wichtiger Gegenwartsstoff, der ist nie gezeigt worden. Der Hauptdarsteller ist noch vor der Synchronisation durch die Spree geschwommen. Einer der Gutachter für die Filme, die fürs Fernsehen gedreht wurden, an der Hochschule, war übrigens Karl-Eduard von Schnitzler.
Aber das Wesentliche war die Erfahrung der gemeinsamen Arbeit. Damals war, das wie ein Rausch. Ich war mir unsicher, wußte zwar, daß ich schreibe, aber gleichzeitig, daß ich kein Filmer bin. Wichtig ist im Nachhinein wie eine Geschichte über Transformationen transportiert wird: Man hat eine konkrete Geschichte, die abstrahiert man in eine bestimmte Sprache, und dann kriegt man das mit den Bildern wieder zurück in die Konkretion.
Nur die Anwesenheit des Staates habe ich nicht ertragen. Das ist bei Gedichten natürlich anders.
Blume: Das Problem, daß Du Dich mit dem Schreiben von Lyrik in eine Nische begibst, hast Du das reflektiert?
Anderson: Ganz sicher.
Blume: Du hast Dich also bewußt entschieden, diese Apparate zu umgehen?
Anderson: Ich halte dieses ununterbrochene Produzieren für falsch. Wenn einer weiß, daß er nur für ganz Wenige schreibt, und vielleicht von 500 gelesen wird, sollte er einen Teil seiner Energie auf zum Beispiel Herausgabe und Herstellung richten. Ich halte das für wichtig, Energie von der Produktion abzulenken. Dahin paßt auch der Begriff der Kreativität besser.
Blume: Wie kam das 1979, als Du im Knast warst? Welche Erfahrungen hast Du da gemacht?
Anderson: Ich war ja mehrmals im Pfeffer. Das ist schwer zu erzählen. Ich kann das jetzt nicht.
Blume: Wie hast Du Dich in der DDR gefühlt?
Anderson: Ich hatte keine Probleme mit der DDR. Ich bin auch nicht aus solchen Gründen gegangen. lch hatte nie ein Verhältnis zum Staat, höchstens ein Interesse an der Distanz, ich meine nicht die körperliche. Die Voraussetzung für mein Leben irgendwo ist, daß ich mit Menschen zu tun habe, die etwas machen, was mich interessiert. Das waren hauptsächlich Maler. Wolfram Scheffler, Cornelia Schleime, Ralf Kerbach, Helge Leiberg und A.R. Penck, alles Menschen, die vor mir weggegangen sind aus der DDR. Das ist kompliziert.
Blume: Ist es Dir also egal, wo Du lebst?
Anderson: Nein, das nicht. Es hängt natürlich mit der Sprache zusammen. Aber man überlegt ja, wenigstens mit der Möglichkeit kokettierend, ob man überhaupt zur Zeit in Deutschland bleiben kann. Ich habe natürlich eine körperliche Angst, mehr vor dem Osten als vor dem Westen. Das System ist zwar zum Kotzen, aber die Gewohnheit der Demokratie kann relativ viel neutralisieren. Hier haben wir etwa 4 bis 5 % rechte Nationalisten, die sich relativ moderat verhalten müssen, wenn sie Wirkung erzielen wollen, da es vor allem um das Ökonomische geht. Bliebe der Osten eigenständig, was normalerweise kein Problem wäre, dann hätte ich schon Angst vor einem solchen unberechenbaren Potential. Das hat nichts mit Neonazismus zu tun, sehr wohl aber mit Faschismus. Und dann sind da ja noch die Balten. Also, im Prinzip ist mir das egal, ob ein, zwei oder mehr deutsche Staaten. Doch besser scheint mir die blöde Einigkeit. Aber ich denke, das ist kurzsichtig. Es scheint der Versuch zu sein, die Schere zwischen Politik und Ökonomie nicht zu groß werden zu lassen. Der europäische Einigungsprozeß ist ein ökonomischer und kein ideologischer. Das kulturelle und damit nationale und regionale Bewußtsein wird genudelt, aber die Region neigt mehr zur Autonomie als zur Ideologie. Insofern ist es keineswegs zwingend, Staaten zu vereinigen, bloß weil die wirtschaftlich Gierigen kopulieren. Kein Italien oder Irland wird sich auflösen wegen Europa.
Bei einer Lesung zu der ich jetzt in Ostberlin war, hatte ich das Gefühl, die Leute erwarteten, daß ich ihr Identitätsproblem positiv berede. Die haben ein Bekenntnis erwartet, das ich nicht liefern konnte und wollte.
Blume: Würdest Du den Begriff Emigration für Dich annehmen?
Anderson: Nein, aber wenn, dann weniger im Sinne von Raum, als von Zeit. Das ist schwer. Doch wenn man mit dem Gedanken ans Emigrieren spielt, schon da setzt man nur einen Weg fort, es ist nur eine Abstrahierung der Art und Weise, wie man sich sowieso verhält. In solchen Begriffen wie Widerstand habe ich zwar eine Identität, aber ich will das nicht unbedingt. Da stünde ich lieber als anderer gegen meine Herkunft.
Blume: Fühlst Du Dich etwas anderem mehr zugehörig?
Anderson: Ja, einem Teil meiner jüdischen Geschichte, die mich sehr beschäftigt, doch da geht es nicht mehr um Identität. Und darum dreht es sich in den Texten.
Blume: Gibt es etwas ,Deutsches‘ für dich, eine Eigenschaft der Leute drüben und hier?
Anderson: Das ist die Mentalität, expansiv zu sein. Man expandiert in das Andere, aber das Andere ist auch nur das Deutsche. Schauen wir auf die Ungarn: das Land ist klein. Man holt sich etwas hinein, man erweitert die Dimension. Während die Deutschen die Neigung haben, etwas zu bringen, und das nur, um sich in dem, was sie brachten, späterhin zu erkennen. Die Deutschen bevorzugen materielle Kräfte. Sie reden nach Rußland mit den Wolgadeutschen, nach Rumänien mit Hermannstadt. Es geht immer ums Deutsche.
Blume: Wie war das für Dich, als Du nach Westberlin gekommen bist?
Anderson: Ich hatte es leichter als viele andere. Ich bin quasi als Letzter gegangen und in einen mir gewohnten Freundeskreis gekommen, und außerdem von Ost- nach Westberlin. Der Bruch war nicht so wie für Leute, die zum Beispiel aus Dresden weggegangen sind nach Westberlin oder auch nach Ostberlin. Außerdem, wenn man Arbeit hat, ist man ziemlich schnell in einem Netz von Menschen, und im Zusammenhang mit der Arbeit spielt es keine wesentliche Rolle, ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt.
Blume: Dein Leben ist also durch die Freunde und die Arbeit definiert, weniger durch die Situation, wie Du Leute auf der Straße erlebst, die Du nicht kennst. Geht Dich das an, ist das anders hier?
Anderson: Das ist hier viel härter. Im Osten Deutschlands verwischen sich die Grenzen zwischen arm und reich, und diese Schwelle ist im Westen, wenn man wirklich arm ist oder wirklich reich, aufgehoben; ich meine, die Hemmschwelle, es vorzuführen. Im Osten gibts diese Unehrlichkeit von Oben. Leute, die so getan haben als wären sie dir oder zum Beispiel den Arbeitern nah. Hier ist das nur noch als Relikt vorhanden. Aber hier bietet sich damit auch die Möglichkeit, differenziert solidarisch zu sein. Im Westen sind persönliche Entscheidungen mit allen Konsequenzen möglich.
Ich begreife mich schon als politisch, obwohl das für Kunst kein Maßstab sein kann. Wir hatten da mal ein Problem mit Volker Braun, da ging es wahrscheinlich darum, wo das ist: Außerhalb und Innerhalb der Gesellschaft. In dem Zusammenhang ist das gelöst, aber aus jetziger Sicht denke ich, daß es dieses „an-Alle-Pathos“ ist, das er vor allem mitbedient hat, und das mit Literatur nichts zu tun hat. Also noch krasser: Jedes Ihr und Wir zerstört dieses Medium, ist nicht akzeptabel, da zeigt sich doch, wieviel mehr Volker sich außerhalb verhält. Da aber ein Dichter dazu neigt, von einem anderen Dichter nur die Gedichte zu sehen, und wenn die dann seinem ethischen Maß nicht entsprechen; naja, das waren so die Mißverständnisse der Vergangenheit.
Blume: In der letzten Zeit, die Du in der DDR warst, hast Du mit fabrik Rockmusik gemacht.
Anderson: Ja, zwei Jahre.
Blume: Wie kam es dazu?
Anderson: Ich wollte mich nicht über Literatur unterhalten, jedenfalls nicht bei Lesungen. Das artet immer in Einmischung aus. Und ich hasse das irgendwie, länger als zehn Minuten zu lesen, ich krieg da Hautausschlag. Außerdem wollte ich mit einer Generation, mit anderen Menschen, als denen, die zu Lesungen gehn, ins Gespräch kommen. Ich hatte schon Anfang der 70er Jahre viel mit Musik zu tun, das wurde aber Leistungsstreß. Mit den Malern Musik zu machen, das war irgendwie freier. Wir hatten mit Kerbach, Schleime und dem Dichter Michael Rom so 1980 rum eine Punkband, hatten auch eine Platte in Westberlin verlegt, aber das Konzept konnte man nicht beliebig erweitern, das war an die Personen gebunden. Bei professioneller Rockmusik ist das anders, mit allen Konsequenzen.
Ich wollte direkter sein, mich durch das Überslandtouren fressen, nicht zu hause sitzen. In der letzten Zeit in der DDR war ich aggressiv und alles hat meine Kräfte irgendwie überstiegen. Wir lebten in einer Keramikwerkstatt, meine damalige Freundin ist Keramikerin, und die Kunden und die Gäste und die Freunde, das war einfach zu viel. Ich habs mir einfacher gedacht. Also, das mit der Rockmusik brachte da auch Veränderung. Kompliziert war, daß die Musiker oft wechselten. Aber wenn wir ein Programm fertig hatten, es gab ja nicht so viele Konzerte, haben wir ein Studio gemietet und mal in Ruhe eine Woche zusammen gearbeitet. Im Team erfährt man doch eine Menge über sich selbst. Ich hab auch kontinuierlich für andere Bands geschrieben, allerdings unter Pseudonym. In dem Bereich verdient man sehr viel, und das konnte ich dann wieder in die Buchproduktion stecken.
Es war natürlich mehr eine intellektuelle Rockmusik, aber ich fands okay. Ich hätt das hier gern weitergemacht, aber man muß ja dann nicht nur sich, sondern auch die Musiker ernähren und auslasten. Da hat man so eine Art Verantwortung, die ich hier nicht tragen könnte.
Blume: Wie hast Du die Bedingungen empfunden, unter denen Ihr aufgetreten seid? War das für Dich normal, daß Ihr behindert wurdet?
Anderson: Ja. Naja, jeder hatte seine Solopappe, wir sind ja nicht unter dem Namen fabrik auf die Bühne, obwohl sich das natürlich rumgesprochen hatte, und es wurde irgendwie unter Jazz verbucht. Das war ja damals allgemeine Praxis. Da traten welche auf, die waren Maler, und plötzlich machten die Musik. Das war so eine Art Verwirrung der Akten. Ich glaube, die mußten so ab Mitte der 70er ihre Rezeption neu ordnen, ich meine die von der Stasi. Was ich an dieser Geschichte nicht so sehr schätze, ist, daß sich daraus ein multimediales Selbstbewußtsein entwickelt hat. Ich bleibe Lyriker, auch wenn ich Rockmusik mache. Bei Malern und Musik ist das ähnlich. Erst durch ein relativ enges und überschaubares Selbstverständnis ist Öffnung zu anderen Bereichen möglich. Mich widert das Multimediale an, das Geschmiere mit Farben, das Rumhampeln mit Musik dazu, und das alles nennt man dann Performance. Ich bin Dichter, und ich kann mit anderen zusammenarbeiten oder umgekehrt, aber da muß jeder sein Selbstverständnis haben. In dem Moment wo das fehlt kommt es zu Unklarheiten und Grenzüberschreitungen, die das Produkt quasi selbstmorden. Ich krieg dann Begriffe wie Aggression, Invasion und Okkupation in den Kopf.
Blume: Was ist ein Lyriker?
Anderson: Ich nicht, ich bin ein Dichter. Ich habe eine lyrische Sicht auf die Welt. Kandinsky glaub ich, hat da ein deutliches Bild gefunden. Der Lyriker ist in einem gelben Würfel und guckt nach außen, da ist die Form egal, die ganze Welt ist gelb. Das Epische hat eine Draufsicht, auf den Würfel. Das ist kein Qualitätsunterschied, sondern hat was mit der Perspektive zu tun. Der Epiker neigt sehr zum Ich, und weil das sehr gespalten ist, versucht der die Last der Welt auf möglichst vielen Schultern, das heißt Charakteren zu verteilen. Beim Lyriker ist das eben anders rum und mit einem einigermaßen entwickelten Abstraktionsvermögen ist die Färbung nicht mehr dominant und Form ist Farbe, ein fast idealer Zustand. Das Gelb bei Kandinsky hat vor allem die Dimension der Erinnerung. Die Erinnerung der Sonne an ihre Exgröße, aber auch der Judenstern.
Blume: Es gibt die These, daß sich viele Autoren Deiner Generation nicht mehr auf Institutionen eingelassen, sondern gleich neben den Strukturen gearbeitet haben. Diese kleinen Zeitschriften waren ein Ergebnis davon. Spielt dieses Modell eine Rolle für Dich?
Anderson: Für meine Produktion ist das nicht wichtig. Es spielt eine Rolle in anderen Bereichen meines Lebens. Aber ich produziere unabhängig. Sicher hat eine Art zu leben Rückwirkungen auf das Schreiben. Aber es ist nicht so, daß ich die Verhältnisse, für die ich mich entschieden habe, thematisiere.
Blume: Du verweigerst Deine Produkte nicht unbedingt diesen Strukturen?
Anderson: Nein, ich verweigere sie nicht. Ich habe mich sehr früh mit dem Rotbuch-Verlag Berlin liiert, und der Verlag hat mich immer fair behandelt. Die Verhältnisse, die ich einmal für mich akzeptiert habe, die gewachsen sind, breche ich nur ganz schwer wieder ab. Andererseits bitte ich Rotbuch meine Gedichte nicht in irgendwelche Anthologien zu geben, weil ich eben nicht neben Irgendjemandem stehen will, dessen Texte ich nicht mag, wie das jahrelang passiert ist.
Und mir geht’s natürlich bei Eurem Buch genauso. Ich weiß nicht, neben wem ich stehen werde. Vielleicht ergänzt sich das sehr gut, aber vielleicht auch nicht, und dann find ichs ekelhaft. Das ist natürlich ein bißchen intolerant, aber ich hab mich dafür entschieden, daß eine „Ausstellung“ von Texten, an der ich teilnehme, auch mit Menschen sein soll, die ich mag, textlich. Davon gibts in der DDR ganz wenige. Das sind Papenfuß und Döring und dann hörts schon auf. Thomas Brasch mag ich auch sehr, Kolbe auf andere Weise. Erb und Mickel, das ist klar. Von allen anderen nur noch einzelne Texte. Ich habe hier im Westen einige Dichter kennengelernt, die ich sehr schätze. Nicht sehr viele, aber genug, um mich ausreichend mit Lesestoff von Lebenden zu versorgen. Im Osten ist das Dichten hochkultiviert, auch politisch. In der DDR kenne ich viele Dichter und eine interessante Dichtung; doch wenige gute Dichter. Das scheint mir auch ein Effekt dessen zu sein, daß im Osten immer noch im Sinne von mehr und mehr produziert wird. Das ist hier schon anders, zum Glück.
Das Denken ist aus der Deutschen Dichtung verschwunden. Das spielt nur noch bei wenigen eine Rolle. Es wird viel aus dem Bauch produziert. Eine permanente Pubertät. Und diese Biedermeierscheiße wird auch noch veröffentlicht. Noch schlimmer ist diese aus dem Bauch des Strukturalismus sabbernde Sprache. Es gibt keinen Grund dafür in Deutschland. In Frankreich gibt es den, weil da das Denken als Medium geschätzt wird.
15.1.1990
Frank Goyke und Andreas Sinakowski (Hrsg.): Jetzt wohin?. Deutsche Literatur im deutschen Exil, Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstraße, 1990
„… beginnt das zersprochene, ja zu sagen.“
– Aus einem Gespräch mit Sascha Anderson am 27. Mai 1990 in Dresden. –
Volkmar Billig: Der Name Sascha Anderson steht für den Dichter ebenso wie für den Anstoßer vieler übergreifender Aktivitäten, die Kontaktperson, den Herausgeber nicht zuletzt, wenn ich nur an ein so wichtiges Buch denke wie Berührung ist nur eine Randerscheinung: Warum gerade du in dieser Vielzahl von Funktionen?
Sascha Anderson: Man begreift sich ja nicht in einer Funktion oder Aufgabe. Das ist im Grunde alles privat und hat eine zwingende Chronologie. Kolbe und ich haben 1979 bis 82 an einer Anthologie für die Akademie der Künste gearbeitet und dabei einen Haufen Material zusammengetragen. Das sollte ein internes Buch werden von 300 Seiten, wo Germanisten, Philosophen, Literaten und und und, Leute, die sich kulturpolitisch beschäftigen, mal sehen sollten: Was wird hier geschrieben, ohne das es veröffentlicht wird. Es sollte ein Gespräch darüber beginnen. Das ist unterdrückt worden. Und Konrad Wolf ist gestorben, Wiens ist gestorben, alle sind gestorben, das war wirklich fatal, die gingen wie die Fliegen mit den Manuskripten ins Grab. Aber es gab bei dieser Arbeit eine Solidarisierung der Autoren untereinander. Dann kam das Angebot von Kiepenheuer & Witsch an Elke Erb: Könnten wir nicht ein Buch mit unveröffentlicher DDR-Literatur machen? Und da sprach Elke Erb mich an und sagte: Ihr habt doch die Arbeit geleistet mit Kolbe, können wir das Material nicht nochmal sichten. Mein Standpunkt war damals der: Ich hatte keine Lust, ein großes Buch zu machen, wo ganz tolle Literatur drin ist, und das ist die nichtgedruckte in der DDR. Ich wollte den Stand der Dinge an einer Stelle zeigen, wo sie nicht nur mit Literatur zu tun haben, eher auch mit Malerei, mit Musik, also das Szenische bringen, das Szenische, in das die Literatur eingebunden ist. Denn das charakterisierte auch die Literatur: das Verhältnis zur Musik, das Verhältnis zur Malerei und umgekehrt. Denn diese Leute fingen ja auch an zu schreiben. Damals gab es schon unabhängige Zeitschriften. Die gab es, als Kolbe und ich arbeiteten, noch nicht. Da gab es nur Literatur in Schubladen. Aber als wir dann die Anthologie für Kiepenheuer & Witsch machten, gab es unabhängige Zeitschriften, und die wurden nicht von Literaten gemacht. Die wurden von Künstlern gemacht, von Musikern, Fiedler z.B., ein typischer Dresdner Künstler, hat hier die erste unabhängige Zeitschrift der DDR gemacht, die und, das ist seine Initiative, nicht meine. Ich war damals schon in Berlin. Ich hab mich zwar engagiert, aber nicht so, daß mir das irgendjemand zuschreiben könnte. Und Berührung ist nur eine Randerscheinung dokumentiert das Szenische. Deswegen sind die Literaten gar nicht so glücklich über diese Anthologie, weil sie nicht die Literatur zeigt, sondern den Zusammenhang, in dem sie entstanden ist. Und die Rezeptionen, die davon ausgehen, das sei der Stand der Untergrundliteratur, sind mißverständlich. Genauso war das mit meinen Sachen. Wenn ich originalgrafische Bücher herausgebe, dann liegt das doch nicht daran, daß ich mich als Herausgeber fühle, sondern daß ich eine bestimmte Kunst mag, die ich im Zusammenhang mit Literatur sehe. Ich sage mir: Wie kommme ich am billigsten zu einem Kunstwerk, das mir gefällt? Indem ich ein Buch herausgebe. Da macht der Künstler die Kunst für mich, und das kostet mich nichts, sondern ich verdiene vielleicht noch dran. Also: Das war alles sehr eigennützig gedacht, nicht finanziell, sondern in Bezug auf Wohlsein. Auf die Weise bin ich Herausgeber geworden. Das Entscheidende ist, daß man sich dabei reduziert, daß man nie anfängt zu sagen: Okay, jetzt bin ich Herausgeber und mache das und das und das Buch. Christoph Tannert, den ich sehr schätze, macht genau das, der sagt: Jetzt bin ich Herausgeber, und dann gibt er eine Buchreihe heraus. Aber ich weiß nicht, ober der mit den Künstlern noch etwas zu tun hat. Ich jedenfalls habe nur mit Künstlern gearbeitet, die ich mochte, mit Schriftstellern und Malern, die mir so nahe waren, daß ich gesagt habe: Das ist die Kunst, die ich mir vielleicht nicht leisten könnte, wenn ich sie kaufen müßte, also produziere ich sie. Im Grunde hängt das ja nicht mit Produktion zusammen, sondern mit einem Produktivmachen menschlicher Verhältnisse oder eines Denkens. Da ist die Buchform eine ganz entscheidende, viel entscheidender als ein Bild oder ein Gedicht. Zur Produktivierung eines Denkens eignen sich einfach zwei Leute, die mit unterschiedlichen Medien arbeiten, besser. Und die Form des Buches ist eine dieses ausdrückende. Genauso ist es mit anderen Dingen. Mit Musik. Ich bin ja nicht zur Musik gekommen, weil ich Musiker bin, oder weil ich ungeheure Lust hätte, jetzt Musik zu machen, sondern weil ich einfach mal andere Leute brauchte. Ich mußte mal mit anderen Leuten reden, mußte etwas zusammen mit anderen Leuten machen. Ich kenne das aus dem Film, wie produktiv Zusammenarbeit mit anderen Menschen für mich ist. Man relativiert sich oder man setzt sich durch, es entstehen psychische Strukturen, die man nicht nur benutzt für die Arbeit, sondern an denen man auch viel erkennt. Man muß sich nicht selbst zerfleischen, man zerfleischt eben die Struktur. Ein Team von drei vier Leuten kann man auflösen, weil die Struktur nicht gut ist, das geht bei 20 und 30 schon schlecht. Wir haben Musik gemacht. Wir waren 5 Leute, haben miteinander kommuniziert. Diese kommunikative Ebene war für mich einfach wichtiger, als mich zu Hause hinzusetzen und ein Gedicht zu schreiben.
Billig: Siehst du etwas spezifisch Dresdnerisches in der Art und Weise künstlerischer Auseinandersetzung deiner Generation von Dresdner Malern, Musikern, Schriftstellern?
Anderson: In der Kunst weiß ich nun nicht, wie das ist. Da kann ich nur sagen: In den siebziger Jahren gab es hier einen eigenartigen Bruch. Und zwar waren an der Kunsthochschule ungeheuer viele Berliner, z.B. Eva (Anderson/d.Hrsg.) kam nach Dresden, sie ist Berlinerin, Cornelia Schleime ist eine Berlinerin, Scheib ist Berliner, Stange, Karla Woisnitza, wie sie alle heißen, die kamen alle aus Berlin und sind hier auf junge Leute gestoßen – Leiberg, Kerbach, Lutz Fleischer, die von der Abendhochschule kamen, die hier mit 16/17 Jahren an der Abendhochschule waren – und das gab eine ganz politisierte Mischung. Dann kriegten die Anfang der siebziger Jahre alle Kinder, und da war das ein großer Kreis. Die machten Kinderfeste und machten gemeinsam Kunst. Ich kann das zwar auf der formalen Ebene untersuchen, aber das interessiert mich nicht so sehr. Ich weiß nur, daß die Leute in relativ stabilen Kreisen lebten, und das ist zum Beispiel in einer Stadt mit einem Fluß viel eher möglich. Dieser Fluß, der so prägend ist – den gibt es eben in Berlin nicht, oder in anderen Städten.
Billig: Betrachtest du die enge Symbiose zwischen Malern, Musikern und Dichtern eher als eine Eigenheit oder eine Selbstverständlichkeit?
Anderson: Das ist der blanke Zufall. Es gab ja in Dresden immer nur 5 oder 6 Dichter gleichzeitig. Die konnten sich gegenseitig nicht leiden oder konnten ihre Gedichte nicht leiden. Aber weil man eben so nahe lebte und in einer relativ kleinen Stadt, haben es alle zusammen versucht irgenwie. Also z.B.: In Thomas Rosenlöchers Garten ist mein erstes Stück aufgeführt worden. Oder mit Bernhard Theilmann haben wir am Obergraben gearbeitet. Und jeder von uns hatte eine Aktivität, die irgenwie mit Malerei zusammenhing, das kam dann alles zusammen, vor allem bei Kinder- und Gartenfesten, in Kneipen. In Berlin ist das nun eher wie in einer modernen Großstadt: Jeder hat seine Kneipen, und da finden sich ganz bestimmte Szenen. Das Prägende ist ja hier auch, daß alle in derselben Kneipe rumhocken. Selbst jetzt, wo es 5 Kneipen in der Neustadt gibt, sitzt in jeder Kneipe das ganze Puplikum, quer durch. Das ist schon bemerkenswert. Nun könnte man sagen, wenn es 20 Kneipen gibt, und an jeder Ecke noch irgendwas, dann differenziert sich alles wieder, aber ich denke das nicht.
Billig: Ist die Dresdner Literaturszene bescheidener als die in den anderen künstlerichen Bereichen?
Anderson: Man kann ja im Grunde genommen nur mit Leipzig vergleichen. Da gibt es die ganze homogene Dichterszene über Jahre hin. Die hatten das Literaturinstitut, egal wie schlecht die dort alle waren, sie haben trotzdem die Szene geprägt in irgendeiner Form, sie haben ja auch die städtischen Schreiber gereizt zum Wiederstand. Und hier gab es eine offizielle Malerszene. Und da gab es eben auch einen starken Untergrund außerhalb dieser Schule. Und die Schule ist ja ganz zentral in der Stadt gelegen, über die lief ja jahrelang entweder das gesamte kulturelle Leben oder das Widerstandspotential gegen das Kulturelle Leben. Das war nicht zu trennen in so einer Stadt. In Berlin ist das nicht so. Die Kunsthochschule spielt keine Rolle im städtischen Leben, in der städtischen Kultur. Das ist eindeutig so. Und ansonsten kommen in Berlin alle Leute von irgenwoher, nur nicht aus Berlin, mal abgesehen von Kolbe und Frank-Wolf Matthies gibt es in Berlin keine Berliner Dichter. Papenfuß kommt aus dem Norden, ich komme aus Thüringen. Ich könnte jetzt alle aufzählen, wie sie auch heißen, die kommen nicht aus Berlin. Aber wer geht nach Dresden? Das müßte man prozentual messen: Wer geht aus Dresden weg, und wer kommt nach Dresden? Aber wer geht aus Berlin weg? Der geht vielleicht zum Studium, oder auf Urlaub oder zum Häus’l auf dem Lande, oder zur Datsche an die Ostsee. Das passiert ständig, aber niemand geht von Berlin weg. Das heißt, ich bin ja von Berlin weggegangen. Ich habe als Kind in Weimar und Berlin gelebt, während der Zeit an der Filmhochschule habe ich in Berlin gelebt, ich habe immer in Berlin gelebt und bin aus sehr persönlichen Gründen nach Dresden gekommen.
Billig: Und du bist wieder nach Berlin gegangen. Warum?
Anderson: Ich hatte eine große Liebe in Berlin. Und ich hatte auch sehr viele Freunde. Ich mußte an irgendeiner Stelle tatsächlich in Literaturkreisen nicht bloß leben, sondern das waren mir sehr wichtige Dichter. Stefan Döring lebte in Berlin, Bert Papenfuß lebte in Berlin, mein Verlag war in Berlin, also in Westberlin, aber das ist ja auch Berlin. Und natürlich bin ich hier in eine Situation gekommen, da war der Druck einfach zu groß für mich, der ist ja dann auch in Berlin wieder zu groß geworden. Aber das war okay. Man hat sich mit dem Schritt von Dresden nach Berlin in eine gewisse Anonymität begeben, die entscheidend war. Man lebte eben im Hinterhof in einer Millionenstadt. Wie man dann in seinem Kiez politisiert oder in seinem Kiez politisches Leben macht, das ist etwas ganz anderes. In Dresden ist das unmöglich, man ist in der Kneipe, da drehen sich die Leute um, und irgendwas wird dann geredet und irgendwie – das geht alles nicht.
Billig: Viele Literaten hier haben bei dir angeknüpft, dich dabei vielleicht auch zum Teil mißverstanden, sehen dich als Orientierungspunkt. Wie stehst du dazu?
Anderson: Ich habe ein poetisch-zeichnerisches Frühwerk, was davon geprägt ist, daß ich alle Formen einfach durchgespielt habe, und das in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, weil mir wichtig war, das ungeheuer schnell zu machen und nicht lange dran hängen zu bleiben. Das ist eine rein formale Sache. Ich mußte sehen, wie schreiben die das alles, den ganzen Dreck, oder wie ist der ganze Dreck geschrieben worden, und da habe ich das eben schnell gemacht, ich wollte sehen, wie das geht. Und ich habe relativ schnell die Formen gewechselt. In dem ersten Bändchen Jeder Satellit hat einen Killersatelliten ist dies sicher charakteristischer als das, was geschrieben wird, als das, worum es geht. Ich kenne viele Leute, die mir hinterherschreiben, junge Leute, aber in Dresden eigentlich niemanden. Rainer Schedlinski hat viel mit meiner Literatur zu tun, Udo Wilke ist dem ganzen Ding verfallen, ich kenne auch viele Mißverständnisse, die einfach nicht wissen, was ich tue. Aber letzten Endes ist das doch in Ordnung, wenn jemand sich an jemandem orientiert. Das ist ja nicht meine Person, das ist ja dann doch wohl eher meine Lyrik. Da dürften wir nicht über mich reden, da müßten wir über Penck und Dresden sprechen, das liefe dann richtig hart ab. Jeder Mensch, jede literarische Gesellschaft hat das Bedürfnis, sich an einige Personen anzulehnen, das ist ganz normal und auch gut so.
Billig: Fühlst du dich irgendwo als Dresdner Dichter?
Anderson: Nein. Ich bin ja kein Dresdner. Ich bin in Thüringen geboren und in Berlin aufgewachsen. Ich meine, es gibt sehr viele Leute, die obwohl sie weggegangen sind, trotzdem als Dresdner Dichter zu bezeichnen sind. Z.B. Czechowski ist ein Dresdner Dichter. Der ist hier aufgewachsen und ist dann weggegangen. Aber man kann natürlich nicht von jedem Weggegangenen sagen, er sei ein Dresdner Dichter. Andererseits kann man von vielen Weggegangenen sagen, sie sind es immer noch. Bei Czechowski ist das der Fall, bei Mickel in Maßen, obwohl der natürlich zuwenig schreibt, ist Mickel ein Dresdner Dichter. Die haben hier ihre Formsprache entwickelt und wollen auch gar nicht davon runterkommen, dieses Dresden zu thematisieren. Die haben natürlich auch die Zerstörung von Dresden erlebt als Kinder. Insofern ist Penck vielleicht sogar ein Dresdner Maler, das mag sein. Für ihn ist immer noch der entscheidende Punkt die Zerstörung Dresdens, dort geht das los, auch in seiner Malerei ist das drin. Ich habe gesehen, wo Penck in London gelebt hat, da sah es aus wie in Dresden-Döltzschen, und wo er in Stuttgart gelebt hat, sah es aus wie in Dresden-Pieschen. Und ob das Bild dann in New York gemalt ist, das Freunde-Bild, am großen Tisch im Brooklyn-Hotel, das ist egal, das kann trotzdem ein Dresdner Bild sein. Niemand wird sich in New York hinsetzen und Dresden malen, man malt ja das, was man vor Augen hat, aber die Menschen, die dieses Bild besiegeln, beleben, die können tatsächlich nur die sein, mit denen man auch zu tun hat, oder sie sind nur Figuren auf einer Bühne. Aber wenn man das malt, was einem wichtig ist oder das schreibt, was einem wichtig ist, dann wird das von den Menschen belebt, die einem wichtig waren oder wichtig sind. Und das ist dann eben bei den Künstlern meist ein Freunde-Bild, wo der Maler im Profil ganz am Rande steht.
Billig: Die meisten deiner Generation sind ja schließlich im Westen angekommen. Wie siehst du das heute?
Anderson: Das ging ja eigentlich 80 los mit Penck, 80 ging Bonk aus Berlin weg, 80 ging der Leo Lippolt weg, der ein ganz enger Freund von uns war, der nach Amsterdam gegangen ist. Der wollte ja immer Maler werden und ist Galerist geworden. Aber das ist ja entscheidend, solche Punkte sind viel entscheidender, als wenn einer Maler bleibt. Und der hätte ja auch hier Galerist werden können, und vielleicht wären dann viel mehr hiergeblieben. Solche bindenden Persönlichkeiten sind manchmal wichtiger, als daß alle eine Front aufmachen. Dann ging der Kerbach weg. Dann ging der Leiberg weg, die Schleime weg, das war ja alles 82 bis 84.
Billig: Nun denke ich aber, daß du deine Arbeit auch als eine Art von Widerstand gegen hiesige gesellschaftliche Mechanismen verstanden hast. Warum dann doch der Schritt in den Westen?
Anderson: Ich muß das akzeptieren. Ich werde immer wieder damit konfrontiert, daß ich im Widerstand war. Ich habe eindeutig gesagt: Nicht ich war im Widerstand, die Funktionäre waren im Widerstand. Aber das macht nichts weil, das ja auch nur ein Bild ist. Ich meine, mein Körper, meine Psyche hat das alles nicht vertragen, irgendwo im Widerstand zu sein. Ich mußte mich aus einem System, was mich ständig als Ich konstituieren wollte, damit ich angreifbar war, herausnehmen. Das ist der politische Aspekt. Es gibt ja Aspekte, die viel dominierender sind, der private z.B. Ich stand unter ungeheurem Druck, sowohl gesellschaftlich als auch privat, und der private war dabei wahrscheinlich eher ausschlaggebend als der gesellschaftliche. Einer zog ja dem andern hinterher. Der Freund ging und der Freund vom Freund ging und der Freund des Freundes des Freundes. Daran merkt man aber, daß menschliche Zusammenhänge viel entscheidender sind als politische. Du kannst gegen etwas im Widerstand sein, aber wenn alle deine Freunde fehlen, da gehst du dorthin, wo deine Freunde sind, da ist dir der ganze politische Widerstand völlig wurscht. Einer geht, weil der andere gegangen ist. Und er geht nicht, weil der andere sagt, im Westen ist es ganz toll und die Freiheit ist super, sondern weil ihm der Mensch fehlt. Der ganze politische Kladderadatsch ist so uninteressant von außen betrachtet, so lächerlich. Nicht der Kampf oder das Ergebnis des Kampfes, aber wie das passiert. Frank-Wolf Matthies sprach in den 70erJahren noch von einem absurden Theater, politisch. Und in den letzten Jahren war das zu einem Ohnesorg-Theater, zu einem Zimmer-Theater verkommen. Wenn du von außen auf das gesehen hast, was hier politisch passiert ist, dann war das auf einem Niveau, da konntest du sagen: Samstagabend schalt ich den Fernseher ein, da kuck’ ich entweder Ohnesorg-Theater oder DDR. Das war so finster, und man konnte sich gar nicht vorstellen, daß nicht irgendjemand auf die Straße gegangen ist und gesagt hat: Ihr lebt in einer politischen Struktur, die ist so lächerlich, so infantil. Das war unglaublich, was da von außen zu sehen war. Die Distanz zu einer Struktur zu behalten, war mir schon sehr wichtig. Aber ich bin nicht deswegen gegangen. Ich bin nie irgendwo weggegangen, weil ich es politisch nicht mehr ertragen hab’.
Für mich ist sehr wichtig, daß die privaten Verhältnisse auseinandergehalten werden von der öffentlichen Problematik. Das Private ist das eine. Da kann man viel mit sich selbst machen und auch durchaus mal sagen: Alles falsch gewesen. Man relativiert sich. Die privaten Verhältnisse bestimmen die Formen in der Kunst, die sind ausschließlich durch private Verhältnisse bestimmt, nicht durch politische Strukturen, Ordnungen, Systeme. Wenn unter einem Bild, das mit Erde gemalt ist, steht: Versaut eure Umwelt nicht!, oder: Beutet die Erde nicht aus!, ist das komisch. Das ist genau der formale Irrtum. – Dieses private Verhältniss für die Formbestimmung nutzen, ist das eine. Das andere ist, man muß der Gesellschaft, egal, ob sie’s tut oder nicht, die Möglichkeit geben, muß sie zwingen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ihr könnt nicht die Aufgabe übernehmen, euch damit auseinanderzusetzen, daß gewisse Leute aus Dresden weggegangen sind. Anderson ist aus Dresden weggegangen. Wie können wir das thematisieren? Wie können wir darüber sprechen? Und das alles. Das müssen die tun, das ist deren Sache. Wir können über ganz andere Dinge sprechen, über’n Fluß, über Loschwitz, über Malerei, über Kunst, aber das politische ist deren Problem, das sollen die selber klären oder auch nicht klären, das ist mir nur recht. Mir ist dann auch dort die Lücke lieber, als daß ihr die Aufgabe von denen übernehmt.
Billig: Was ist dir heute die „DDR“? Würdest du es akzeptieren, ein „DDR-Dichter“ genannt zu werden?
Anderson: Das ist viel örtlicher gebunden. Mit der DDR hat das meiner Meinung nach gar nichts zu tun. Das ist ja so, als wenn jemand sagt: Du bist in Karl-Marx-Stadt geboren und hast immer Gedichte über Karl Marx geschrieben. Und jetzt heißt das Chemnitz. Und was ist nun mit deinen Karl-Marx-Städter Gedichten?
Billig: Das sehe ich aber anders. Schließlich bedeutet ja DDR auch einen ganzen Komplex spezifischer Erfahrungen, mithin auch Formen von Auseinandersetzungen, Stilen, die sich von anderen unterscheiden.
Anderson: Aber das ist ja beliebig. Das ist überall so. Überall entstellt eine spezifische Kunst. Ob diese Spezifik gut ist, ist eine andere Frage. Natürlich gibt es im Westen eine ziemliche Amerikanisierung, das ist klar. Aber durch dieses flächendeckende Überschwappen des Amerikanismus sind auf der anderen Seite wieder Regionalismen entstanden, die ganz ganz stark sind. Wenn ich an Achternbusch denke z.B. oder solche Typen, die sich in der West-Kunst gezeigt haben, selbst Handke, das kann man sehen wie man will. Ich mag Handke nicht, seine Literatur, und trotzdem ist das was. Überall entstehen in spezifischen Verhältnissen spezifische Formen, weil die Leute sich untereinander kennen und verständigen, nicht weil das so oder so ist. Das hängt eher mit Landschaften zusammen, hängt mit Geschichte zusammen, und in Deutschland hängt das eben mit einer gebrochenen Geschichte zusammen, daß es mal ein Drittes Reich gab, das gab es ja plötzlich nicht mehr, und dann gab es eben die DDR, und jetzt gibt’s die eben nicht mehr. Das ist doch wunderbar. Gut. Phantastisch. Die Leute müssen eh ein bißchen über die Vergangenheit nachdenken. Wie du über DDR redest, klingt aber stark nach Identifikation, nicht deiner, sondern eben Identifizierung eines Dichters mit der DDR. Das ist natürlich hart. Das läßt sich wahrscheinlich ein anständiger Dichter nicht gefallen. Oder das hat er zumindest nicht gern, wenn ihm das aufgedrückt wird. Aber wie du das von außen siehst oder auch aus einer nächsten Generation, kann das schon sein, daß das so ist, da akzeptiere ich das auch. Für mich selber weniger. Natürlich, dort wo ich in dem Moment sitze, setze ich mich auseinander. Nur da entsteht noch lange nichts draus. Ich sage immer: Wenn’s ganz schlimm kommt, wenn mir ein Einfall für ein Gedicht kommt in der Situation, da sage ich: Da machen wir ein Gedicht draus. Das wird aber eines von Lutz Rathenow. Machen wir mal was draus! Dieses Prinzip. Wenn’s eben DDR heißt, machen wir eben was draus. Heißt’s Bayern, machen wir was draus.
Billig: Es gibt ja aber nun auch eine gewisse Kontinuität künstlerischer Auseinandersetzung.
Anderson: Die DDR verschwindet ja nicht. 40 Jahre hat es die gegeben. Und wenn es die jetzt 100 Jahre nicht gibt, ist sie trotzdem nicht verschwunden. Sie spielt, eher thematisch als formal, für eine ganze Generation von Dichtung eine Rolle. Christa Wolf, Heiner Müller, die ganzen großen Schriftsteller, die hier leben, haben das thematisiert, und das ist gut. Und meine Generation hat vielleicht eher das Fehlen der Außenwelt thematisiert. Das ist ja ganz situationsbedingt. Die Situation war das Fehlen der Außenwelt. Kann man thematisieren. Genauso kann man DDR thematisieren. Das ist völlig wurscht. Das muß jeder entscheiden, was wichtig für sein Leben ist.
Billig: Ich denke heute, das Klima hier war dennoch ganz fruchtbar, produktiv. Durch die behördlichen Zwänge, diese Notwendigkeit unmittelbarer Auseinandersetzung.
Anderson: Das finde ich nicht. Für mich geht das bis zur Destruktion. Erstmal hält man sich für wichtiger als man ist, schon weil man z.B. mal einen politisch mächtigen Gesprächspartner hat. Man fällt auf deren Sprache rein, wird plötzlich von denen verstanden, und erst hinter einem solchen Gespräch merkt man: Was hätte ich nicht alles sagen können, sagen müssen. Das ist ein Effekt. Aber eigentlich spricht man doch eine andere Sprache, eine Sprache, die mit denen nichts zu tun hat. Ich wollte nie von denen verstanden werden, aber ich habe mich auf das Gespräch eingelassen und dann bemerkt: Ich spreche deren Sprache. Und die drücken hinterher aufs Knöpfchen und du fährst irgendwo ab, oder es setzt sich eine Maschinerie in Bewegung, die alles mit dir machen kann. Das ist völlig unproduktiv.
Billig: Aber im Westen gibt es den Markt. Den halte ich auch nicht für produktiv.
Anderson: Den Vergleich zwischen Osten und Westen halte ich in diesem Hinblick für sehr kurzsichtig. Ich sehe den Markt als etwas ungeheuer Produktives. Er ist relativ unmenschlich, denn er hat mit dem Menschen nichts zu tun, ist eine reine Struktur. Aber er ist ziemlich natürlich, wenn man an Selektion denkt und solche Sachen. Ich halte es für sehr, sehr gut. Und ich habe in den letzten Jahren im Westen eine Unmasse von Menschen kennengelernt, die ganz wichtig sind für mich, Dichter vor allen Dingen, Literaten, die ganz klare Denker sind, die sehr rational mit dem System, in dem sie leben, umgehen, und trotzdem gar nichts verloren haben, von dem, was man Engagement nennt, ganz grandiose Leute. Im Osten meinte man immer, man wird Künstler in der Notsituation. Das halte ich für schlimm. Das ist ein ganz typisches östliches Vorurteil, mit dem ich auch lange bei mir selbst zu kämpfen hatte. Ich saß bei mir in Westberlin zu Hause im ersten Jahr und dachte: Scheiße! Alles was du gut findest, kommt aus dem Osten. Das hängt aber nicht damit zusammen, daß das so ist, sondern daß man eben selber aus dem Osten kommt, weil man das, was man gewöhnt ist, gut findet. Das ist ganz normal. Aber Dichter wie Gerhard Falkner, wie Thomas Kling, wie Peter Waterhouse, die übersteigen alles, was hier geschrieben wurde unterhalb von Papenfuß und Döring. Das ist immer schlecht, wenn man sowas sagt, aber es gibt hier so eine ungeheuer weiche Widerstandslyrik, das ist wie ein großer Schwamm, alles Kacke, ziemlicher Schrott. Und dort habe ich tatsächlich Menschen erlebt, die ganz grandioses Denken auch formal umsetzen können. Das habe ich hier kaum getroffen. Falkner kennt ja hier keiner. Man ist immer davon ausgegangen, man wüßte mehr über den Westen als die über den Osten. Das kann schon sein. Aber es gibt eine östliche Ignoranz dem Westen gegenüber, die ist verheerend. Die Kunst ist dort so weit, weil sich jeder Künstler nennen kann, und das ist erstmal die Basis dafür. Hier durfte man sich selbst in Kreisen, die professionell arbeiten und gute Maler sind, erst Künstler nennen, wenn man eine Ausstellung hatte. Man war anerkannt, wenn sich der Name in der Mehrheit rumgesprochen hatte. Dort ist das Prinzip anders: Jeder ist Künstler wie jeder Mensch ist, und dann geht das los. Und das ist erstmal sehr gut. Oder hier im Osten z.B. der Zwang, von Kunst zu Leben: Ein grauenvoller Ansatz, weil das heißt, daß Kunst zu einem Produktionsprozeß verkommt. Das ist tatsächlich, auch im globalen Sinne, negativ, wenn Kunst in die Produktion einsteigt, den Begriff Produktion für sich annimmt. Der Künstler in Dresden war der, der um 7 Uhr an’s Elbufer rannte mit der Staffelei und Zeichnungen machte, dann nachmittags in’s Atelier und was malte, und wer nicht ständig präsent war in der Produktion, der durfte sich auch nicht so nennen. Das würde man bei Dresden sagen: das magische Künstlersein. Und das muß man sich im Westen sehr stark überlegen. Da muß man sich überlegen, ob man den Platz hat, 100 Bilder zu lagern. Du kannst nicht 100 Bilder malen, wenn du die 100 Bilder nicht irgendwo hinstellen kannst, weil du den Platz für die 100 bezahlen mußt. Du kannst nicht ununterbrochen produzieren. Das ist eine Energiefrage. Das ist eine Frage, wieviel Farbe nehme ich aus der Erde raus und setze die auf dem Bild um, oder wieviel Platz kann ich bezahlen. Also das sehr, sehr materielle Denken in Zusammenhang mit Kunst verhindert eine Produktion. Und das halte ich für sehr gut. Aber Dresdner Kunst ist geprägt davon, daß alle ununterbrochen viele, viele Bilder malen. Und Dichter bist du erst dann, wenn du jeden Tag ein Gedicht schreibst. Also du mußt dich hier ununterbrochen durch Produktion legitimieren. Das kritisiere ich z.B. an Penck, obwohl der ja nun nicht mehr anders kann. Der arbeitet ja von früh an und dann 20 Stunden, und dann hat er 4 Stunden die Augen offen, und da hat er gut geschlafen und dann arbeitet er weiter. Das ist eine andere Generation. Mein Widerstand gegen diese Generation fängt ja nicht bei der Malerei an, gegen die Generation von Penck, Herrmann, Graf, sondern mein Widerstand fängt in der Auffassung an: Was ist Kunst? Da sind wir verschieden. Die Kunst von Penck und Hermann sieht vielleicht genauso aus wie von denen, die nach ihnen kommen, aber es ist eine grundlegend andere Auffassung von Kunst. Ich sehe dieses Herausnehmen aus der Produktion als einen wichtigen Aspekt für die Zukunft, weil das ja auch mit Erdzerstörung zu tun hat, mit Ausbeutung der Erde, mit Ausbeutung der Natur, mit dem Verdrängen des ökonomischen Aspekts. Im Grunde werden die gesamten Realien verdrängt zugunsten der Kunst, das ist im Grunde ein ganz romantisch-aufklärerisches Verhältnis, nämlich: Der Mensch steht im Mittelpunkt. In der Romantik war das eben ein Text oder ein Bild, in der Renaissance z.B. stand der Mensch im Mittelpunkt eines Bildes, heute ist es der Künstler, da hat sich was verschoben, aber letztendlich ist es dieselbe Auffassung. Es werden abstrakte Bilder gemalt, aber der Künstler ist das wichtigste. Im Grunde steht immer noch der Künstler im Mittelpunkt des Bildes, ein Prinzip der Renaissance. Das muß irgendwann aufhören.
Billig: Was ich aber nicht an der DDR festmachen würde. Das ist die althergebrachte Vorstellung vom Künstlersein.
Anderson: Das hat sich aber in solchen feudalen Systemen wie hier fortgesetzt, und hat sich so formalisiert, daß es Usus wurde. Im Westen, das ist die andere Seite der Medaille, malen viele Künstler Bilder, wenn eine Ausstellung kommt. Wenn keine Ausstellung in Sicht ist, fangen sie gar nicht erst an zu malen. Das wäre ja nicht schlimm, wenn sie den ganzen Tag arbeiten würden, sich grafisch üben würden, wenn sie denken würden, verarbeiten würden, ununterbrochen etwas machen, was auf das Malen der Bilder, wenn die Ausstellung kommt, hindeutet. Aber sie fangen überhaupt erst an, sich mit Kunst zu beschäftigen, wenn eine Ausstellung in Sicht ist, das ist wieder eine Übersteigerung auf der umgekehrten Seite. Aber für sehr gut halte ich: Morgen habe ich eine Ausstellung, heute male ich die Bilder, gestern habe ich drangedacht. Das wäre das Prinzip, nach dem ich arbeiten würde. Das ununterbrochene Dabeisein gehört natürlich dazu, das ununterbrochene Trainieren, etwas formalisieren zu können. Das schätze ich nun an Penck wiederum: Wenn der malt, malt er in 10 Minuten 100 Quatratmeter voll, das ist gar kein Problem. Alle denken, das ist aber Scheiße alles, aber er hat wirklich monatelang ununterbrochen gezeichnet, ununterbrochen umgesetzt und weiß dann ganz genau, was er tut. Das gibt’s beim Schreiben ähnlich. Ohne mich jetzt vergleichen zu wollen. Früher habe ich den ganzen Tag Gedichte geschrieben. Drei Gedichte am Tag, ein Gedicht am Tag, stapelweise. Ich habe 5.000 oder 10.000 Gedichte geschrieben, also ich kann es genau sagen: Von 1968 bis 1978 habe ich 5.000 Gedichte geschrieben. Das würde man heute nennen: Okay, das sind seine frühen Skizzenbücher. Da hat er eben skizziert. Und die schönsten Skizzen habe ich dann irgendwann zu einem Band gemacht, die für mich noch gültigen Skizzen. Heute setze ich mich hin und schreibe das Gedicht, wenn ich weiß: Das wird es! Also, es gibt eine Ökonomisierung dieses Prozesses. Ich schreibe nicht ununterbrochen Gedichte. Alle Westkünstler gehen arbeiten. Die jobben und jobben und malen dann, wenn sie ihr Geld zum Leben verdient haben. Das ist ganz gut, weil sie nicht malen müssen, um zu leben. Und hier wollte man von Kunst leben. „Was wird jetzt aus uns armen Künstlern?“ – hieß es auf einem Treffen von Ostschriftstellern und Westschriftstellern in Westberlin. Die Westschriftsteller leben alle nicht von dem, was sie schreiben. Und im Osten: Was wird nun aus uns Lyrikern? Wie ein entlassener Sklave. Der ist funktionslos. Wenn er entlassen ist, ist es vorbei.
Billig: Nun schwappt, glaube ich, in diesen Tagen das gewesene Dresden nochmal an die Oberfläche, das ja immerhin auch ein Stück DDR war. Private Galerien entstehen, Nachtcafés. Und dann kommen ausgerechnet Anderson und Kerbach und Leiberg und lesen bzw. stellen in der Privatgalerie Lehmann aus. Ist da nicht doch ein Stück Identifikation im Spiel?
Anderson: Ist nicht. Ganz eindeutig nicht. Oder weniger mit Dresden, weniger mit den hießigen Verhältnissen, gewesenen oder seienden, sondern das ist eben, daß der Lehmann schon vor der Wende diese Galerie hatte. Und der kam dann zu mir und sagte: Er würde gern mal. Und das fand ich gut. Denn das gab es eben schon, und die Leute, die jetzt dort ausstellen, arbeiten ja auch nicht anders, als sie früher gearbeitet haben. Vielleicht sieht das unterschiedlich aus, aber im Grunde genommen ist das für mich diese Kontinuität, von der ich gestern gesprochen habe. Die gibt es in der Galerie. Und die gibt es bei den Leuten. Und deshalb fand ich das gut. Und man ist natürlich immer gespannt, wie Leute einer Generation darauf reagieren, die man eigentlich nicht mehr kennt oder mit der man nur aus dem Katalog was zu tun hat. Früher haben wir nur in die Westkataloge gekuckt, und jetzt kucken wir eben auch, was die Leute machen, die hier leben, das ist doch völlig in Ordnung. Alles okay. Das ist eigentlich keine Ausstellung von Ralf Kerbach, Cornelia Schleime und Helge Leiberg, sondern das ist eine Geste an Lehmann, weil der die Galerie vorher gemacht hat und jetzt immer noch macht. Egal ob die Galerie einen guten Ruf hat oder nicht, der Punkt ist es, der mich dazu gebracht hat, zu sagen: Ja, das ist in Ordnung. Und dann war es ja ursprünglich so, ich wollte ein paar Grafiken von mir raussuchen, aus der neueren Produktion und die hinhängen, und da haben eben die Künstler gesagt: Ja, mach das, aber wir nehmen dann auch die neuen Grafiken. Und das fand ich auch eine Bereitschaft der Freunde von mir. Eigentlich ist das eine ganz private Geschichte. Das hat mit Dresden nicht allzuviel zu tun. Wenn das wirklich mit Dresden zu tun hätte, mit der Auseinandersetzung um dieses ganze Problem, da hätte man sich hinsetzen müssen und sagen: Nein. Wenn nicht im Albertinum, wenn nicht im Kulturpalast, ein Scheißhaus, aber wurscht, wenn nicht auf der großen Bühne im Kulturpalast, dann gar nicht. Ich stell mich nicht nach Dresden hin: Jetzt wollen wir mal die Sache klären! – und dann gehe ich in die Galerie Ralf Lehmann. Da würde ich sagen: Okay. Auf der großen Bühne im Kulturpalast, unter 2.000 Zuschauern gar nichts, und da wollen wir mal sehen, um was es da geht, wie sehr mißverstanden man wieder wird. Aber es ging um diese völlig private Sache. Und der Lehmann zittert z.B. und hat Angst, daß ihm unter 20 Leute kommen, oder unter 50, und ich habe mich in den letzten Jahren so relativieren können, und das halte ich für ganz wichtig für mich, daß ich 10 Leute genauso wichtig nehme wie 1.000. Für mich macht das keinen Unterschied. Im Gegenteil. Ich weiß, warum 1.000 kommen, aber warum 10 kommen, das will ich dann einzeln wissen. Und das krieg ich dann auch raus. Bei 1.000 Leuten, da fühl ich mich benutzt, denn 1.000 Leute haben gar nichts mit Literatur zu tun. Aber von 10 Leuten weißt du, was die damit zu tun haben, und mit Kunst ist das genauso. Das ist keine sentimentale Veranstaltung für Dresden gewesen, sondern das ist eine Privatgeschichte gewesen. Da spielt der Lehmann eine größere Rolle als die Galerie Lehmann, und mein Verhältnis zu Conny, Ralf und Helge spielt eine größere Rolle als die Klärung kulturpolitischer Vergangenheit. Das ist eine Möglichkeit, daß vielleicht hier eine Generation informiert wird, was die Leute jetzt machen oder was sie gemacht haben, denn das sieht man ja auch an den Sachen, die sie jetzt machen. Die Grenzen sind offen. Man kann sich gegenseitig besuchen, man kann bestimmte Mythen abbauen. Denn selbst im Fehlen war man ja ein Mythos, viel eher als ein erreichbarer Mensch. Als ich als Mythos erreichbar war, war es einfach belastend für mich, als ich unerreichbar war, setzte die Interpretation ein, bin ich wie eine Leiche behandelt worden. Konnte man alles sagen: Er hat mal gesagt, er denkt, er meint – Nichts meint er. Er lebt, bloß nicht hier.
Billig: In dem, was du in Dresden gemacht hast, liegt ein großes Maß an Aggressivität, auch eine Absage an Form, was sich in deinen neuen Texten nicht mehr findet, bei denen man eher geneigt ist, von gefundener Form zu sprechen. Da hat offenbar ein Prozeß stattgefunden.
Anderson: Ich bin in den letzten Jahren, das habe ich gemerkt, viel weniger aggressiv geworden. Mein Vater lebt in Dresden, elbabwärts in Radebeul, meine Mutter lebt in Dresden elbaufwärts. Die Stadt ist sehr von Politik dominiert gewesen, von diesen Stadträten, von solchen Typen wie Berghofer und Seltmann und Modrow, und ich hatte natürlich mit denen allen zu tun. Das waren die schrecklichsten Typen, die man sich überhaupt vorstellen kann, und da wird man aggressiv, das ist eindeutig. Wenn man jung ist, wenn man 20 ist, da denkt man, man hält das auch durch. Und dann fängt irgendeine Ökonomie des Arbeitens an, und da kann man das nicht: Das ist zuviel Nein. Und das tötet, immer nur Nein zu sagen. Das bringt einen um. Ich kann nicht zu einem Menschen Ja sagen, und zu dem, was ich schreibe, Nein. Das ist eine Schizophrenie, die zerbricht alles, die zerbricht jede Form. Ich habe gestern, das ist für mich einer der wesentlichsten Texte gewesen, zuerst aus dem Pasolini-Zyklus vorgelesen: „beginnt das zersprochene, Ja zu sagen“. Das ist das Ende eines Textes, der für mich sehr wichtig ist, deswegen habe ich den auch zuerst vorgelesen. – Da ist eine Änderung. Aber das hängt damit zusammen, daß man eben älter wird. Ich bin 10 Jahre älter geworden, und ich bin zu dem, was ich in Dresden angefangen habe, 20 Jahre älter. Was soll’s?
Billig: Mit Befreiung von Vergangenheit, auch von Dresden, hat das nichts zu tun?
Anderson: Man könnte das interpretieren. Das ist möglich. Aber ich sehe das als für mich nicht wesentlich an. Das kann ja Verdrängung sein. Aber ich halte das für mich nicht für so wesentlich, Dresden zu verdrängen. Eher, das Nein zu verdrängen, oder Masse zu verdrängen, oder andere Sachen. Aber das sind eben mehr strukturelle Angelegenheiten, die ich für wichtiger halte, als das an einer Stadt, an einem Begriff, an einem Menschen oder Namen festzumachen.
Billig: Was hat dich beeinflußt in den letzten Jahren, ließ dich zu jener Form finden, wie wir sie gestern gehört haben?
Anderson: Das sind ganz innere Dinge, die da eine Rolle spielen. Daß man Zeit hat sich zu konzentrieren, daß man sich unbedingt konzentrieren muß, das hängt mit der Ökonomisierung zusammen, das hängt mit Dingen zusammen, die mich interessieren, Physik, Geschichte, solchen Sachen. Ich sehe da auch nicht allzu viel neue Formen. Das ist eine einfache Entwicklung. Das man eine bestimmte Sprache nicht gefunden hat, aber eine Sprache für sich akzeptiert hat, und das ist nunmal die eigene. Ich schreibe nur noch, wenn ich meine, das ist es. Ich setze mich nicht hin und schreibe ununterbrochen, ich schreibe eben tatsächlich das Gedicht dann, wenn ich meine, das wird das Gedicht, und diese Konzentration spürt man vielleicht auch am Gedicht. Ich bin von den Spielereien, vom formalen Training runtergekommen. Ich trainiere auf einer anderen Ebene, meine, daß es wichtiger ist, sich im Denken zu trainieren, in anderen Medien. Ein Buch über Physik trainiert mich weit mehr in Lyrik, als am Tisch zu sitzen und Alexandriner zu üben. Ich habe einfach gewisse Dinge für mich geklärt. Aber die hängen mit der Welt gar nicht zusammen.
reiter in dresden, Heft 3, 1990
Übern Fluss, das andre suchen…
– Conny Schleime und Ralf Kerbach im Interview mit Bert Papenfuß. –
Das folgende Gespräch mit Cornelia Schleime (geb. 1953 in Berlin) und Ralf Kerbach (geb. 1956 in Dresden) über ihre 1980 in Dresden gegründete Band Zwitschermaschine sollte eigentlich ein Beitrag für Spannung. Leistung. Widerstand. Magnetbanduntergrund DDR 1979-1990 werden, erfolgte jedoch zu spät für die Drucklegung. Es wurde in Zonic #20 in Auszügen nachgeliefert, die nebenbei die Schwierigkeit von Erinnerungsarbeit dokumentierten. Diese Version ist nun um einige der dort getätigten Irrungen bereinigt, ohne dass sich alle Dinge geklärt hätten. Zum Abgleich der Wahrheitsfindungsversuche siehe die Fußnoten sowie auch den folgenden Beitrag von Zwitschermaschine-Schlagzeuger Wolfgang Grossmann bzw. den vorherigen mit Dimitri Hegemann und Karl-Ulrich Walterbach.
Bert Papenfuß: Ich kann mich erinnern, als wir Ende der 1970er Jahre bei Göschel1 draußen waren, Stefan Döring war noch mit, da haben wir so ein bisschen musikalisch rumgesponnen. Aber du hast ja vorher schon Musik gemacht.
Ralf Kerbach: Ich hab Bassgitarre gelernt. Bass und Kontrabass, aber nur ein halbes Jahr.
Papenfuß: Aber du hast doch vorher schon mit Helge Leiberg…2
Kerbach: Mit Penck3 haben wir Musik gemacht, und zwar so eine Art Free Jazz, in der Wohnung auch öfiers mal am Klavier mit Freudenberg4 zusammen gespielt. Als Maler haben wir immer Musik gemacht. Das war so eine Art Free Jazz-Hausmusik.
Conny Schleime: Gut organisiert war das vor allem beim Penck. Dass man da zusammenkam, jeder, der was spielen konnte, und so eine Free Session gemacht hat. So am Samstagvormittag. Aber das hat uns alles nicht interessiert. Denn diese ganze bärtige Free Jazz-Musik, die ging uns eigentlich mehr oder weniger auf die Nerven.
Papenfuß: Penck ist ja 1980 in den Westen gegangen. Bis dahin habt ihr mit Penck gearbeitet, oder?
Kerbach: Ne, das war sehr unterschiedlich.
Schleime: Wir sind da dreimal hin, glaube ich. Das war schon ein fester Stamm von Musikern oder Malern, die musizierten, den er da hatte und mit dem er diese Free Sessions wöchentlich machte. Aber wir waren ja bedeutend jünger. Wir sind da hinzugestoßen, aber es war auch nicht so, dass wir da jede Woche kontinuierlich hingingen. Wir haben da nur mal geguckt: ach so, so machen sie es dort…
Papenfuß: Bei den Musikern oder Malern, wer war dort dabei?
Kerbach: Es gab verschiedene Besetzungen. Freudenberg war dabei, Leiberg war dabei, Lothar Fiedler5 war manchmal mit dabei. Penck natürlich. Reinhard Sandner6 hat mitgespielt. Und das war es. Dann wurde das durchmischt, manchmal mit einem ganz bekannten Bassisten, den hatte Leiberg mit angeschleppt, das war ein Berufsmusiker. Und so hat sich das auf dieser Freemania-Ebene durchmischt. Das ging bis in die 1980er hinein. Aber der Hauptpunkt war, dass wir zusammen mit dir damals, und, wie hieß er, aus Stralsund…?
Papenfuß: Aus Schwerin. Günther Spalda.7
Kerbach: Da fing das eigentlich an, sich herauszuschälen, das andere Musikkonzept.
Schleime: Ich glaube auch, dass wir ganz andere Musik hörten als der Penck. Der hörte ja auch selber Free Jazz. Wir hörten eher Captain Beefheart, Zappa, Can. Die drei eigentlich, und Can waren favorisiert. Dazu kamen Sex Pistols oder Stranglers. Joy Division war ganz wichtig damals, die frühen Sachen.
Papenfuß: Wie kam es dann zur Gründung eurer Band? Die hieß ja auch nicht von Anfang an Zwitschermaschine?
Schleime: Wir hatten immer wechselnde Namen. Die wechselten, weil es ganz früh schon Auftrittsverbot gab. Der Grund, überhaupt eine Band zu machen war, dass wir aufgrund einer Ausstellung, die wir noch während des Studiums gemacht hatten, Ausstellungsverbot bekamen. Da haben wir uns gefragt, was haben wir denn in der DDR noch für eine Zukunft, wenn wir nicht einmal ausstellen dürfen?! Du willst ja mit deinen Aggressionen auch nach außen, also gab es diese Überlegung. Das Bild selbst ist ästhetischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, was wir ja in der Schule gelernt hatten. Also ist man da in einem inneren Zwiespalt, seinen Frust nicht einfach nur rauszuschreien, weil man ästhetisch geschult worden ist. Das Medium Musik, das wir ja nicht studiert hatten und wo wir vollkommen unbefangen waren, war genau richtig, um unserem Frust Luft und Platz zu verschaffen.
Kerbach: Es ging eigentlich so los, dass ich von der Kunsthochschule rüber gegangen bin ins Atelier, in die Schönfelder Straße. Ich hatte mir so einen Verstärker gekauft, einen kleinen Kofferverstärker, eine E-Gitarre hatte ich schon da, und ich hab für mich so ein paar Riffs gespielt, ganz einfache Dinge. Dann kam Conny abends dazu und ich sagte, stell dir mal vor, du würdest darüber jetzt irgendwelche Gedichte singen, wie du sie damals schon gedichtet hast. Das war der Kern. Wir beide haben die Gründung gemacht, hatten die Idee.
Schleime: Wobei ich relativ schnell merkte, dass es mit den Gedichten, die man draufspricht, nicht funktioniert, sondern man auf die Musik eingehen muss, mit der Musik auch den Text erfindet. Die Musik bietet dir etwas an und dazu findest du die Worte. Und wir merkten, zu zweit, da fehlt irgendwie was. So wurde der Zeidler, ein Freund von ihm, aktiviert, um im Schnellkurs Bassgitarre zu lernen. Der kam immer in die Wohnung, und du hast ihm gesagt, er soll diese und jene Folge von Tönen spielen, und es klappte noch nicht, und er sollte üben. Dann kam er eine Woche später an, bis er irgendwann so ein Dreierding hinkriegte.
Kerbach: Matthias Zeidler hat die Basslinien drunter gespielt, alles im ganz rhythmischen Maschinensound. Uns fehlte noch ein Schlagzeuger. Da hatten wir am Anfang mehrere Leute dabei, die Namen fallen mir nicht mehr ein. Dann kam Wolfgang Grossmann hinzu, und der war ein absoluter Gewinn für die Geschichte. Der war Profi, konnte sehr gut spielen. Damit hatte die Rhythmusgruppe ihre Gestalt angenommen.
Schleime: Der nahm seine Emotionalität auch zurück. Denn von der Psychologie war es ja so, dass wir alle ein bisschen extrovertiert waren…
Kerbach: Künstler! (laut lachend)
Schleime: Der erste Schlagzeuger war auch so extrovertiert, und wenn vier Extrovertierte aufeinandertreffen – das hat sich durchkreuzt, wie so ein Highway. Und dieser Schlagzeuger, der war total ruhig, hat sich eigentlich gar nicht geäußert. Der hat sich nur musikalisch geäußert und hat es unterstützt. Das war sehr effektiv.
Papenfuß: Irgendwann kam dann Michael Rom8 dazu.
Kerbach: Das war der nächste Punkt, dass Michael Rom hinzukam, der die Ausstellung in Radeburg für uns organisiert hatte, die auch geschlossen wurde. Bei der Gelegenheit stellte sich heraus, dass er Texte, Gedichte schrieb, die interessant waren, und vor allem für sich schon mehrmals Versuche unternommen hatte, musikalisch wirksam zu werden. Er fragte mich eines Abends, ob ich mir vorstellen könnte, dass er einsteigt. Ich fand das sehr gut, wir fanden den Typ sehr gut – leider weilt er nicht mehr unter uns. Er war ein großer Gewinn mit dieser fast wespenartigen schöpferischen Nervosität, die er ausstrahlte und die mich von vornherein fasziniert hat.
Schleime: Und er brachte so eine Modernität vom New Wave herein, die wir so noch gar nicht kannten. Er war bei Auftritten auch immer gekleidet wie ein Konfirmand.
Kerbach: Eher wie Hamlet.
Schleime: Man kannte im Osten auch diese Coolness nicht, die er rein brachte. Die war auch nicht gespielt, die war echt. Dazu auf der Bühne diese Mischung von Introvertiertheit und extremer Extrovertiertheit. Er konnte da von einer Sekunde auf die andere wechseln. Das war total verrückt.
Papenfuß: Zu welchen Anlässen seid ihr mit der Band aufgetreten? Wie hieß die überhaupt zum Anfang?
Schleime: Schwarz-Weiß. Ende. Alle möglichen Namen.
Kerbach: Wir hatten eigentlich keinen fest gefügten Namen. Der erste Auftritt war in einer Kirche. Mir ist das Kabel gerissen und du warst extrem heiser, weil du zum ersten Mal laut gesungen hast und mit der Technik nicht klarkamst.9
Schleime: Das war in Berlin in der Kirche. Und auch nicht allein, sondern mit Rosa Extra zusammen.
Papenfuß: Kann mich erinnern, war in der Galiläa-Kirche in Friedrichshain.
Kerbach: Zuvor hatten wir ja mal den Auftritt in dem kleinen Klub, wo du noch gesungen hast. Da habe ich Bass gespielt.
Papenfuß: Ne, ich hab nicht gesungen.
Kerbach: Aber du hast irgendwas gemacht.
Schleime: Wir hatten doch bei Volker Henze10 was in der Anfangsphase…
Kerbach: Ne, das war der letzte Auftritt. Das weiß ich von der Geschichte her ganz genau, das war kurz vor meiner Ausreise. Da haben wir in dem Atelier den Zwitschermaschinen-Sound entwickelt. Das war ein Atelier-Auftritt, der ging über mehrere Stunden. Zu dem Anlass, dass wir die Scheib11-Picasso-Party geschmissen haben.
Papenfuß: Am 30.12.1979 war dieses Konzert unter Sonjas Wohnung im Studentenklub.12 Da hast du mitgespielt?
Kerbach: Da hab ich Bass gespielt.
Schleime: Bei Rosa Extra?
Kerbach: Nein. Der Schwarze Kanal hieß die Band. Da haben wir zusammen gespielt. Von dort eigentlich ging die Idee auch los.
Schleime: Da hast du den Spalda auch kennengelernt. Ich erinnere mich an die Party.
Kerbach: Das hat mich so interessiert, dass ich mir sagte: Jetzt setzen wir doch mal die Musik-Idee um, die mich wirklich interessiert. So war das von der Chronologie her.
Papenfuß: Euer erstes Konzert war also in der Galiläa-Kirche. Das findet man raus, steht alles in meinen Stasi-Akten.13 Dann war also die Band zusammen.
Kerbach: Bestehend aus Conny Schleime, Michael Rom, Wolfgang Grossmann, Matthias Zeidler…
Schleime: … und Ralf Kerbach. Danach hatte Anderson Auftritte organisiert, mit dem wir ja befreundet waren. Das waren auch irgendwelche Landpartien im Vogtland. Da hat er meines Erachtens auch das Mischpult bedient. Da war er noch gar nicht Band-Mitglied, sondern hat gesagt: Du, ich hab da was Tolles organisiert und wir treten da auf. Er managte mehr oder weniger. Dann hatten wir bei Gabriele Kachold14 einen Auftritt in der Anfangszeit, in Erfurt.
Kerbach: Das war zu meiner Ausstellungseröffnung. Das war alles 1981.15 Es gab diesen Auftritt, den Conny schon erwähnt hat, mit der Landpartie dahin. Das war eine Art Landtreffen, auch von der Kirche irgendwas.
Schleime: Das war ja immer von der Kirche…
Kerbach: Da fanden eigenartige Zusammenkünfte statt und es gab dort auch unerlaubte Punk-Bands. Rosa Extra hat da gespielt, Schleim-Keim glaube ich noch nicht. Da hatten wir einen Auftritt. Das Tolle dabei war, dass wir auf sehr guten Instrumenten gespielt haben. Wir hatten eine richtig gute Anlage, die uns eine Band überlassen hatte: Fender-Gitarre, Fender-Bass, gutes Drumset. Dort ging es auch ziemlich ab. Da hatten wir die ersten Leute, die an dem Ganzen, an der Idee interessiert waren.
Schleime: Du merktest auch das Feedback von der Masse. Die grölten irgendwie, das war schon verrückt. Auf einmal wurde man zum Sänger.
Kerbach: Es war eben nicht privat im Atelier, sondern es gab eine Öffentlichkeit, die sich dafür interessierte.
Papenfuß: Irgendwann kam Sascha ja dazu.
Kerbach: Sascha! Ja, der wohnte bei uns gegenüber auf der Kamenzer Straße, hörte sich das ganze Spektakel immer an, war durch seine Texte, die er für Rockbands angeblich schrieb, ganz anders orientiert und hat uns eigentlich als Dilettanten angesehen, die wir ja auch waren, die Sachen aus Liebe und Begeisterung gemacht haben. Es dauerte nicht lange, da fragte er eines Abends, er hätte ein paar Texte geschrieben, ob er damit einsteigen könnte. Da gab es schon den ersten Konflikt, denn die Band hatte auf einmal drei Sänger.
Schleime: Drei Sänger und drei Musiker. Und wir wollten natürlich keine Bläsersätze, keinen Free Jazz oder solche Elemente, wir wollten ja Archaik. Wir wollten archaische, ursprüngliche Musik machen, die reduziert ist. Wir wollten auf keinen Fall in Richtung irgendwelcher Jazz-Elemente. Das war ja das, was es zu bekämpfen galt. Da war Dresden ja die Hochburg!
Kerbach: Dixieland. Free Jazz.
Schleime: Uargh! Grauenhaft. Im Grunde genommen Rentnerrock, dieser Freejazz. Das wollten wir alles nicht. Deshalb war das sozusagen mit Bassgitarre, E-Gitarre, Schlagzeug und drei Sängern problematisch. Weil bei zwei Männern und einer Frau zumindest die beiden Männer zwangsläufig in Konkurrenz standen. Für mich als einzige Frau in der Band war es weniger problematisch, aber zwischen Michael Rom und Anderson ergab sich so ein Dualismus.
Kerbach: Es gab ständig Konflikte. Wer singt zuerst, wer singt am besten, wer singt zusammen? Dann hatten wir versucht, dem Problem abzuhelfen, indem es einen Refrain gab, den beide Sänger unterstützten.
Schleime: Damit die was zu tun hatten. Du standst ja sonst dumm rum. Man macht ja nun nicht das Nummerngirl, während der Anderson… Also standen wir trübsinnig hinter den Musikern und warteten, bis der Einsatz kam.
Kerbach: Dann gab es die Idee des Refrains, wo jeder eine Zeile mitgebracht hat. Aber es war alles unbefriedigend, das muss man sagen. Im Grunde genommen gab es den meisten Spaß, wenn der eine oder der andere nicht da war. Wenn Conny für sich solitär war oder Michael Rom oder ihr beide zusammen, war es immer am besten. Michael Rom war, das muss man dazu sagen, sehr extrovertiert, ein Individualist, ein sehr snobistischer Typ, der mit Anderson überhaupt nichts am Hut hatte. Da gab es also ständig Krach. Das war schon der erste Spaltpilz, der in der Band war.
Schleime: Wer den Sound bestimmt hat, die Richtung, in die es gehen sollte, das war eigentlich der Kerbach. Du hast gesagt, es soll so oder so sein, sich zum Beispiel anhören wie Public Image Ltd., die wir sehr mochten.
Kerbach: Das waren aber alles Vorbilder, die später nicht mehr interessierten.
Schleime: Deine Vorgabe war auch, Musik und Text sollen eine Einheit bilden. Der Text soll nicht davor stehen. Das war wichtig. Rom hatte auch seine Texte für die Musik geschrieben. Aber Anderson kam im Grunde genommen mit fertigen Texten und das war so problematisch, weil da der Text vorne stand.
Papenfuß: Sascha Anderson war nun Mitglied der Band und hat bestimmte Konzerte für euch organisiert. Wo waren die so?
Kerbach: Schauspielschule „Ernst Busch“ Berlin. Da kam der Oberchef Hans-Peter Minetti persönlich und sagte, der Klassenfeind wäre zu Gast, und wir mussten den Raum wieder räumen.16
Schleime: Anderson hatte Michael Rom und mir gesagt, wir sollten, weil wir immer so aufgeregt waren vor den Auftritten, vorher ein Glas Wein trinken gehen. Er kannte auch gleich eine Kneipe in Oberschöneweide in der Nähe der Schauspielschule. So bin ich mit dem Rom in die Kneipe, ein Glas Wein trinken. Als ich mit dem Rom zurückkam, sah ich dieses weiße Auto, wir hatten uns ja so einen Bus gemietet, das schon wieder mit den Instrumenten beladen wurde. Dann habe ich noch ein bisschen rumgeschrien auf dem Innenhof, Sauerei, Schweinerei, und dann fuhren wir ab. Später war aufgrund der Aktenlage klar, dass ihm, Anderson, das schon vorher klar war, dass dieser Auftritt nie stattfindet. In den Akten stand auch, dass er gesagt hatte, den Rom und die Schleime, die werde ich separieren, weil die immer so hysterisch reagieren. Das war ein richtiger Maßnahmenplan. Die Sache leuchtet mir bis heute nicht ein. Er organisiert diesen Auftritt, dann wird dieser Auftritt verboten und er lässt uns dort noch hinfahren, separiert Rom und mich, damit es, das nehme ich jetzt mal an, nicht ausstrahlt auf die Schauspielstudenten, die hätten durch so einen Eklat ja auch aktiviert werden können. Es wurde also mehr oder weniger im Stillen wieder abgebaut und wir fuhren nach Hause. Anderson wusste von Anfang an, als wir das Auto in Dresden starteten, dass dieser Auftritt nicht stattfindet.
Papenfuß: Aber er hat doch nicht nur Konzerte organisiert, die nicht stattfanden?
Schleime: Er hat auch Konzerte organisiert, die stattfanden. In Leipzig, in Erfurt. Man muss dazu sagen, dass er die Band dann mehr oder weniger gut gemanagt hat. Uns hat die Musik Spaß gemacht, aber in solchen organisatorischen Sachen waren wir viel fauler.
Kerbach: Was man bei Anderson noch hinzufügen muss: der hat sich um die ganze Technik gekümmert. Er hatte Kontakte zu Musikern, wo wir eine Bandanlage bekamen. Wir waren ja gar nicht so gut ausgestattet. Da gab es ein technisches Knowhow, das wir zur Verfügung hatten, das profimäßig war.
Schleime: Auch als die Platte für den Westen produziert wurde, die DDR von Unten.
Papenfuß: Nächstes Kapitel. Wer hat eigentlich die Platte DDR von Unten (…) kompiliert?
Kerbach: Es ist so, dass der „Leningrad Sandwich“, Dimitri Hegemann, das gesamte Material gesichtet, sich angehört und zum Schluss diese Titel zusammengefügt hat. Und er hat unsere Cover-Zeichnungen genommen. Da gab es auch ein ganz großes Dilemma. Dieses eNDe. DDR von Unten – ich wollte dass DDR da nicht mit drauf steht, denn die DDR hat uns nicht interessiert, Es ging mehr oder weniger um unsere Musik, um unsere künstlerische Aussage. Am Ende kam diese Platte raus, wo alles durchmixt noch worden ist, mit dem DDR von Unten usw. Hegemann war der spiritus rector, er hat entschieden, wie diese Platte auszusehen hatte. Man müsste mal zu Aggressive Rockproduktionen gehen, vielleicht haben die sogar noch das Archivmaterial da, um die gesamten Titel mal zu hören, denn es gab viel mehr Material.17
Schleime: Er war auch jemand, der regelmäßig in die DDR kam (…). Er war in der Szene und man kannte ihn. Ihm schwebte eine Platte vor mit Rosa Extra auf der einen Seite und uns, Zwitschermaschine, auf der anderen.
Papenfuß: Das war noch anders. Es sollte ein Sampler sein, da sollten mehr Bands drauf sein.
Schleime: Das war die Anfangsidee. Dann reduzierte sich das auf die zwei Bands Rosa Extra und Zwitschermaschine. Mit dem Günther Spalda hatte ich damals gesprochen, der hatte gesagt, sie werden nicht mitmachen (…).18 Rosa Extra fiel weg, dafür kam Schleim-Keim aus Erfurt dazu. Mit denen trafen wir uns in der Wohnung bei Ekke Maaß,19 als es um die Vorbereitung der Platte ging – welche Titel reinkommen usw. Wir hatten sonst mit Schleim-Keim wesentlich weniger Kontakt, das entstand erst in Folge dieser Plattenproduktion.
Papenfuß: Rosa Extra waren nicht drauf, weil die Stasi, die von dem ganzen Projekt natürlich durch Sascha Anderson wusste, sie unter Druck setzte und sie mussten ihre Aufnahmen zurückziehen, sonst hätten sie mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen. Nämlich Gefängnis. Dann hat vermutlich Sascha Schleim-Keim angesprochen. Aber es gab ja auch schon vorher Aufnahmen.
Kerbach: Kassettendeckmitschnitte.
Schleime: Die waren aber nicht brauchbar für eine Plattenproduktion.
Kerbach: Ich hatte mit Sascha einen Auftritt im Theater der jungen Generation in Dresden, wo ihr als Sänger gefehlt habt und er ausschließlich seine Titel gespielt hat. Also „Jeder Satellit hat einen Killersatellit“ oder „Häng mich mit meinem Hals in den heißen Draht“, eigentlich ziemlich gute Texte. Das wurde im Theater der jungen Generation im Studioraum richtig aufgenommen. Da gab es einen Bandmitschnitt, der war profimäßig organisiert. Wie es dazu gekommen ist…?
Schleime: Ich nehm an, das hat er gemacht, weil er zeitgleich beim Rotbuchverlag das Buch20 veröffentlichte und er wollte sozusagen für Gabi Dietze21 zum Promoten dieses Buches eine Veröffentlichung rausbringen, nur seine Titel mit der Band.
Kerbach: Die Band löste sich ja auch schon langsam auf. Meine Ausreise war in greifbarer Nähe. Ihr habt aber ja noch richtig weiter gemacht.
Schleime: Nein, wir haben überhaupt nicht weiter gemacht, denn im Grunde genommen war mit deiner Ausreise die Band am Ende. Aber es kam dieses Angebot mit der Plattenproduktion. Dann hatte Anderson den Egon in Radebeul,22 das waren junge Kirchensöhne, von so einem Pfarrer die achtköpfige Familie, alles rothaarige Jungs, die auch musizierten, engagiert. Die waren ganz clever und machten eine Art Hausmusik. Sie hatten studioähnliche Bedingungen in so einer Scheune aufgebaut und da produzierten wir die Platte. Anderson hatte vorher noch bei einer Profiband angefragt, bei Jojo Baumgärtel, aber wir produzierten in der ausgebauten Scheune. Ich sagte dem Anderson, wir können doch den Kerbach nicht ersetzen? Da meinte der, das machen wir schon. So kam der Fidi (Lothar Fiedler) als Gitarrist hinzu. Aber Fidi kam aus dem Free-Jazz-Bereich und wir hatten den Leiberg auch noch mit Bläsersätzen dabei. Die kamen wie aus den Wolken gefallen, denn wir hatten vorher nie Bläser. Das heißt, diese Musik hatte einen komplett anderen Charakter gekriegt, mit den gleichen Texten.
Kerbach: Bigband-Sound!
Schleime: Nicht ganz.
Kerbach: Die Platte hat ja drei Titel, wo ich mitspiele. Und zwar die aus dem Theater der jungen Generation, wo dieser Ur-Sound richtig da ist. Später kam diese Sache mit den Bläsern dazu, die Aufnahmen mit Fiedler, und das ist eine ganz andere Musikkonzeption gewesen.
Schleime: Es gab mehr Material, aber ich glaube mich zu erinnern, dass, als wir diese Platte unter studioartigen Bedingungen produzierten, auch nicht alle Titel aufgenommen haben. Anderson hatte da schon gesagt, das ist zu viel. Der hier ist ein wichtiger Titel, wir nehmen den und den und den… Da wurde nicht das gesamte Repertoire aufgenommen, sondern bereits ausgesucht. Aber zumindest gab es da zwei oder drei Titel von Michael Rom.
Papenfuß: „Übern Fluss“ – kannst du dich an diese Aufnahme erinnern? Die Aufnahme auf der Platte ist auch im Studio aufgenommen, oder?
Schleime: Richtig. Aber da blieb der Bläser weg. (…) Leider fehlten vom Michael Rom auf der Platte ein paar Titel. Es ist nur ein Titel, wo wir Background singen für Anderson. Mein „Übern Fluss“ ist drauf und von Michael Rom gar nichts. Man muss auch zum Verständnis dazu sagen, dass jeder seine Texte selber schrieb.
Papenfuß: In welcher Situation ist der Text zu „Übern Fluss“ entstanden?
Schleime: Der ist über Proben entstanden. Das heißt, Kerbach gab einen Sound vor und dazu fiel mir ein Satz ein, das war kein Text, den ich separat gemacht hab, Die letzten Texte von mir wie „Krieg, tot, aufstehn, wieder hoch“, sind auch immer in Probesituationen entstanden. Wenn ich die Musik hörte, machte ich mir meine Notizen, und fügte zuhause vielleicht noch den einen oder anderen Satz hinzu. aber es entstand immer durch das Hören, mit der Musik, nicht als Literatur.
Kerbach: Es war immer so ein multimediales Zusammenspiel. (…) Im Grunde genommen habe ich mit den Musikern im Atelier auf der Schönfelder Straße geprobt, das mit Matratzen ausgebaut war. Eine Art Matratzengruft die wir gebaut haben, weil sich die Nachbarn ständig aufgeregt haben, die Polizei ständig anrückte. Wir hatten ja keinen Probenraum. Es lief immer so: vormittags habe ich gemalt, nachmittags kamen Zeidler und Grossmann, da haben wir musikalisch irgendwie einen Sound entwickelt. Zeidler (…) hatte oft Basslinien komponiert, so gab es erstmal einen Klang, einen Sound, einen Rhythmus.
Schleime: Als Sänger saß man aber schon in dieser Entwicklungsphase mit drin.
Kerbach: Du hattest damals das Atelier an der Schauburg; Und hattest das im Ohr, gingst nach Hause und abends haben wir uns wieder getroffen, und du hast gesagt: ich hab hier einen Text, probiert das mal. Wir haben es gespielt und so fügte sich da was zusammen, was zum Schluss ein großes Ganzes war, was einen Klang hatte, einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Aura hatte.
Schleime: Darum ging es uns. Es ging um die Aura, darum, Aggression zu transportieren: Es ging natürlich auch um Form, aber nicht um Textmaterial, das sozusagen vermusikalisiert wurde. Es ging immer um dieses gemeinschaftliche Ding, auch bei Auftritten, wo wir dann Performances machten. Bei drei Sängern standen zwei hinten und wickelten mit irgendwelchen Binden das Publikum ein. Das sollte wie eine große brodelnde Masse wirken. Es ging nie darum, irgendwelche intelligenten oder poetischen Texte zu vertonen. Deswegen waren meine Texte auch immer sehr kurz. Dieses „Übern Fluss“ hatte was anderes, etwas Psychedelisches. Es gab immer unterschiedliche Elemente. Bei Michael Rom gab es diese New Wave-Anklänge, bei mir dieses Psychedelische, weil meine Stimme damals schon wie so ein alter Traktor klang, da war ja auch nicht viel mit zu machen. Das heißt, man musste irgendwie so in Wiederholungsmuster gehen, versuchen, so eine Art Magie zu erzeugen. Jeder versuchte, mit seinen stimmlichen Möglichkeiten das Beste herauszukriegen.
Papenfuß: Könnt ihr euch an euer letztes Zwitschermaschine-Konzert erinnern?
Schleime: Wir überlegen, welches das letzte war. Wann die Schauspielschule war, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich auch nicht an den Fasching an der Kunsthochschule erinnern,
Kerbach: Ich glaube, das war eines der letzten. Wo wir uns in die Kunsthochschule als Frauen verkleidet eingeschlichen haben.
Schleime: Als Saubermachfrauen, Toilettenfrauen verkleidet.
Kerbach: Zur Stunde Null war so ein Tohuwabohu, da bauten wir ganz schnell auf. Dann haben wir bis früh um vier gespielt. Leider gibt es die Kunsthochschulfaschings nicht mehr. Das war richtig gut, und das war im Februar ’82. Das war der letzte Auftritt. Anschließend gab es viele künstlerische Projekte. Eine Ausstellung im Leonhardi-Museum, die kam noch rein. Dann hat jeder von uns gearbeitet. Es bröselte sich so langsam auf. Aber wir haben immer weiter musiziert, wir hatten ständig uns im Atelier getroffen und an der Musik gefeilt.
Schleime: Diese Band existierte bis zu deiner Ausreise. Danach war ich auch nicht mehr gewillt, da weiter zu machen, weil wirklich du derjenige warst, der die Musik entwickelt hatte. Auch Michael Rom hatte keine Lust mehr. Mit dem In-den-Westen-Gehen zerbröselte das und nur noch für die Platte gab es diesen Moment, wo wir uns noch mal trafen. Wir waren ja auch nicht mehr im Training drin. Das war schon sehr synthetisch. (…)
Kerbach: (…) Es sind ja viele Bands von Malern gegründet worden, von Kunststudenten überhaupt. Bei unserer Linie kann man sehen, dass wir uns alle zum Bildnerischen zurückgezogen haben. Wir haben nicht mehr die Musik weiter gemacht, wahrscheinlich auch aus diesen gesellschaftlichen Umständen, die auch mit Repression und Tingeltangel zu tun hatte.
Schleime: Wir kamen vom Ausstellungsverbot in die freie Musik. Die Musik blieb vielleicht ein Jahr frei und dann hatten wir Auftrittsverbot. Wir kamen vom Regen in die Traufe und da war eins klar: ab in den Westen! Was sollen wir in einem Land, in dem wir weder malen oder richtig ausstellen können, noch Musik machen? Wie sollen wir da alt werden, als was? Das war im Grunde genommen eine klare Entscheidung für uns.
Kerbach: Damit war’s das mit der Musik in dieser Produktivität und in diesem auch jugendlichen Enthusiasmus…
Schleime: Ich hab zu der Zeit weniger gemalt, machte nur noch Super-8-Filme kurz vor der Ausreise. Ich hatte zwei Jahre lang nur noch aus Koffern gelebt, weil meine Ausreise nicht voranging. Aber ich hatte noch das Interesse an Musik. Ich weiß noch, als ich in den Westen ausreiste, bin ich in Kreuzberg zu diesen Kellerbands gegangen. Man hörte sich das auch im Westen an, ich war schon infiltriert. Im Westen hab ich auch wieder gemalt.
Kerbach: Ich hab viel gemalt in der Zeit, also fast nur noch gemalt.
Papenfuß: Nach Ralf Kerbachs Ausreise existierte die Band nicht mehr. Sascha Anderson hat weiterhin Musik gemacht. Hat er dich mal angesprochen, ob du da mitmachen willst?
Schleime: Ne, hat er nicht. Er wird es auch deshalb nicht gemacht haben, weil er wusste, ich hatte nichts anderes im Kopf als in den Westen zu kommen. Ich saß auf meinen Sachen und machte sehr konzentriert Super-8-Filme. Machte aber innerhalb der Super 8-Filme selber meine Musik, machte meine Filmmusik. Auf Klavier, auf Bassgitarre, E-Gitarre. Obwohl ich komplett dilettantisch war, brachte ich es zumindest bei der Filmmusik auf einen ähnlichen Sound wie „Übern Fluss“. Also so eine gewisse psychedelische Monotonie, die da vorherrschte. Ich hab auch später im Westen, auch in Los Angeles, noch Musik gemacht, wo ich auch so eine Mischsituation hatte, mit Bändern und Schleifen. Aber das war immer dem Film untergeordnet als Filmmusik.
Kerbach: Es gibt eine Aufnahme von Anderson, wo der mir vorkommt wie so ein Countertenor. Wo der in höchsten Höhen versucht, fast so eine Kastratenstimme zu entwickeln. Da gab es ein Vorbild für ihn, Klaus Nomi. Aber das hatte mit der Musik, wie wir sie gemacht haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Es gibt eine CD, die ist seinem Buch beigefügt,23 da hörst du diesen Countertenor. Diese hohe Stimmlage – über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos.
Schleime: Ich glaub schon, dass wir in dieser Musik von der Grundessenz her ähnliche Dinge wollten wie damals in der Malerei. So einen Mikrokosmos schaffen, wie so ein Gedärm, wo es brodelt…
Kerbach: Eine Einfachheit auch.
Schleime: Aber auch eine Magie, die unter die Haut geht. Etwas schaffen, was wir so vorher noch nicht gehört hatten. Das wurde aber immer ferner und auf einmal waren wir eine Band mit Sängern. Das war aber nicht das, was wir wollten.
Papenfuß: Was ist denn aus Zeidler geworden und Michael Rom?
Kerbach: Michael Rom hatte ich, als ich in Westberlin lebte, einmal in Frankfurt/Main besucht und hab sein eigenartiges existentielles Dasein gesehen. Das war alles nicht so toll. Ich hab ihm gesagt, dass er lieber nach Berlin ziehen sollte, weil er da noch Freunde hat. Er kam mir sehr isoliert vor, hatte da in der Theaterszene viel zu tun, auch mit so einem Fassbinder-Kreis. Er kam dann nach Berlin, hatte aber mit musikalischen Ambitionen nichts mehr am Hut. Er hat sehr viel Gedichte geschrieben und Erzählungen und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, unter anderem als Nachtportier. Als die Mauer schon auf war, hatte ich sehr viel mit ihm zu tun. Wir waren vorher zwei Tage zusammen in Dresden in meinem Elternhaus, ich musste einiges organisieren und er stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite, weil er ein Organisationstalent war. Ich war am nächsten Tag noch einmal da, fuhr zurück nach Berlin und las in der Zeitung: „Im Todesfall Michael Rom nichts Neues.“ Das war die Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Ich dachte erst, das ist eine Namensverwechslung. Ich hab ihn angerufen, aber es meldete sich niemand. Bis ich einen befreundeten Maler anrief, der mir bestätigte, dass er es war. Man hatte ihn umgebracht, während seiner Arbeit.
Schleime: Während seiner Arbeit als Nachtportier hat angeblich jemand die Kasse haben wollen. Andererseits sagte die Kripo, es war wie eine Hinrichtung. Er hatte dort im Hotel gearbeitet, ein Buch gelesen, das war noch aufgeschlagen, und er war nach hinten gekippt, mit einem Kopfschuss, genau in der Mitte. Es fehlten 200 DM aus der Kasse. Das war natürlich äußerst suspekt. Man hatte auch einen Verdächtigen gehabt, einen Tankstellenmörder. Der ist aber ausgebrochen und hat sich in Frankreich selbst wieder der Kripo gestellt und gesagt, ich hab die Tankstellenwächter ermordet, aber ich hab mit dem Tod von Michael Rom, den man mir unterschieben will, nichts zu tun. Das wurde bis heute nicht geklärt.
Papenfuß: Und was ist aus Zeidler geworden?
Kerbach: Zeidler ist Familienvater geworden, hat sich zurückgezogen. Hat mit Musik nichts mehr zu tun, schreibt auch nicht mehr. Der ist unter die Stillen im Lande gegangen.
Zum Schluss des Gespräches fällt Conny Schleime noch ein Text ein, den sie in der Frühphase von Zwitschermaschine oft gesungen hat und der vermutlich nicht als Tondokument überliefert ist.
Wenn Euch die Schwänze über’n Kopf gewachsen,
den Arsch den kneift Ihr zu
& Eure Hände so verwachsen,
wie Flossen eines Krokodils
& Eure Nasen sind nach hinten losgegangen
& Eure Beine spitz und dünn –
die tragen einen Quallenkörper,
der zittert nachts, aus Angst
weil nichts mehr stimmt.
Aus Alexander Pehlmann, Ronald Galenza und Robert Miessner (Hrsg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Verbrecher Verlag, 2023
Ich bin der Schlagzeuger von Zwitschermaschine
Zeidler beginnt einfach: Eins, zwei, drei, vier, auf seiner Bassgitarre holzt er Achtel, so schnell es geht. Acht Achtel auf der leeren tiefsten Saite, acht im ersten Bund. Dann wieder leer. Das macht er drei- oder viermal. Dann ZACK! springt das Schlagzeug an, Grossmann hackt sich auf genau den Achteln fest. Die ersten Köpfe im Publikum beginnen zu nicken, Conny Schleime schlägt rhythmisch mit der flachen Hand auf ihre Hüfte. Ralf Kerbach nimmt seine Gitarre und krätscht schräge, atonale Akkorde in den Bass-Schlagzeug-Teppich. Das dauert. Michael Rom tritt vor, fixiert das Mikrofon, dann schreit er:
Die Wochen kriechen dahin… die Jahre verfliegen im Wind.
Er setzt sich auch genau auf die Achtel vom Zeidler, lässt kleine Pausen, zerhackt die Verse.
Der Buhmann geht um.
Die Combo ist im Takt, Rom hält eckig mit, seine Hände zucken, er gebärdet unverständliche Gesten.
Begießen, begreifen Abzäunen, abpfählen werd ich meinen Garten… abpflöcken, lokalisieren Begrenzung.
Blickkontakt mit allen.
Das ist der Begriff.
Und PENG! ist mit dem Doppel-f das letzte Achtel verheizt, der Song bricht ab, die Musik ist weg.
Das war das Stück, mit dem 1981 eine Band ihre Auftritte begann, die erst nach ihrem Zerfall so hieß, wie manche sie heute noch kennen: Zwitschermaschine.
Die Malerin Cornelia Schleime beschreibt 2007 in Punk in der DDR – too much future24 das Entstehen und Arbeiten der Band aus Dresden ausführlich und zutreffend. Ja, die Oase waren Conny Schleime und der Maler Ralf Kerbach, dann Matthias Zeidler und optimal passend Michael Rom. Es ging um Ausdruck, Kunst, Lust. Da Schleime und Kerbach ihre Bilder nicht ausstellen konnten, das Zeigen ihrer Kunst verboten war, gingen sie andere Wege, sich erkennbar zu machen: Wort, Ton, Film, Geräusch, Musik. Sascha Anderson turnte in der Szene aktiv herum, dockte an die vier an, prägte tendenziell, nahm Einfluss, packte einiges dazu, organisierte viel, verriet alles.
Ich war seit Frühjahr 1981 der Schlagzeuger von Zwitschermaschine. Wir waren alle keine Musiker. Um Musik ging es nicht. Wichtig waren Einfachheit und Rhythmik. Drei von uns sangen, Cornelia Schleime und die Dichter Michael Rom und Sascha Anderson. Drei weitere benutzten Instrumente, Ralf Kerbach (git), der Dichter Matthias Zeidler (bg) und ich. Kerbach und Zeidler spielten uns auf den Proben von ihnen gefundene Musikstrukturen vor und entwickelten sie da auch weiter. Schleime, Rom und Anderson, die ihre eigenen Texte dabei hatten, meldeten sich dann, wenn einer zur Musik passen könnte. Das wurde ausprobiert und so entstanden relativ schnell unsere Songs. Allerdings immer Solisten mit Band. Sang jemand, hatten die beiden anderen Pause. Oder Zeit, dann bei unseren Auftritten, parallel performative Dinge zur Musik zu tun: Große Blätter mit gezeichneten Sonnen zerreißen oder Publikum, Musiker und Gegenstände im Raum mit Bindfaden verknüpfen, Leute fotografieren. Wir spielten oft in Kirchen, meist in Berlin, im August 1981 bei Volker Förster, einem Bühnenbildner aus Magdeburg, der im Dorfgasthof von Eschenbach im Vogtland ein Malertreffen mit Sommerfest gemacht hatte, im Mai 1982 an der Berliner Schauspielschule, vier Wochen später in Erfurt, wo wir Schleim-Keim kennenlernten. In Berlin trafen wir mit Rosa Extra auf einen Westberliner, genannt Dimitri Leningrad, der vor allem mit Sascha sprach, wegen Tonaufnahmen. Die machten wir dann etwas später inoffiziell im Theater der jungen Generation in Dresden und im Januar 1983 in einem kleinen privaten Tonstudio bei Dresden, dort ohne Kerbach, der im September 1982 in den Westen gegangen war. Bei beiden Sessions spielten wir alles, was wir hatten, einmal mit und einmal ohne Kerbach, statt seiner half uns beim zweiten Mal Gitarrist Lothar Fiedler. Die Band zerfiel dann, Conny Schleime meint treffend, wir haben uns atomisiert. Mit Connys Weggang hörte das Doppelherz von Zwitschermaschine ganz auf zu schlagen. Außer Matthias Zeidler folgten wir so einzeln Kerbach in den Westen, ich als letzter 1986. Wir kennen uns, haben sporadisch und zufällig Kontakt und gehen jeweils unserer eigenen Wege.
Am 20. Mai 1983 hörte ich auf NDR „Musik für junge Leute – Bericht zur Lage der Nation“ unseren Song „Alles oder nichts und noch viel mehr“ im Radio und erfuhr so vom Erscheinen der Split-LP eNDe, die durch den Aufdruck „DDR von unten – Schallplatte mit 2 Gruppen und Textbeilage“ Aufmerksamkeit erregte. Verlegt in Westberlin, bei Aggressive Rockproduktionen. Das waren Schleim-Keim alias Sau-Kerle und wir. Nur dort und seitdem hießen wir Vierte Wurzel aus Zwitschermaschine, inspiriert vom Maler Paul Klee. Jedoch hört man auf der West-Platte fast nur Sascha mit Combo; das gezählt überwiegende Restmaterial der anderen beiden Sänger fehlt auffällig. Rosa Extra sollte bei dem Projekt auch dabei sein, sie machten ebenfalls ihre Aufnahmen bei Dresden, wurden dann aber von der Stasi bedroht und erpresst und gaben ihr Originalband beim Spitzeldienst ab. Es findet sich heute in der Stasi-Unterlagen-Behörde in Berlin.
Musik von Zwitschermaschine gibt’s nur auf der bekannten Platte. Irgendwelche weiteren Tondokumente sind nicht zugänglich. Die anderen Studio-Aufnahmen sind zwischen Ost und West gesunken oder wurden weggebunkert. Es gab noch eine Tonband-Kassette, die unseren Auftritt in der Schauspielschule dokumentiert, die hat mir Sascha allerdings direkt nach der Show penetrant abgeschwatzt, ich gab sie ihm also, jetzt hat er sie und rückt sie nicht raus. Nicht geschenkt.
Angeregt durch das Herausgeben von Michael Roms Buch will nicht zu den großohrigen elefanten,25 in dem sich die Rohlinge der Texte Roms (der 1991 bei einem Raubüberfall ermordet worden war) finden, aktivierte ich, als Der Schlagzeuger von Zwitschermaschine, meine Erinnerungen 2020 und versammelte Musiker, die ebenfalls die Rom-Songs als Cover-Band wiederbeleben wollten. So wurde Altmaterial aus dem Kopf rekonstruiert und neue Tanzmusik hergestellt, die mit Michael Roms nicht entgrateter Dichtung Punk, Freestyle und Expressionismus annektiert. Deswegen gibt es jetzt eine weitere Schallplatte: ROM.26
Wolfgang Grossmann, aus Alexander Pehlemann, Ronald Galenza und Robert Miessner (Hrsg.): MAGNETIZDAT DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Verbrecher Verlag, 2023
Auflistung aller relevanten discographischen Daten bei discogs.com
Fakten und Vermutungen zu Zwitschermaschine
Zwitschermaschine: Geh über die Grenze.
Fabrik: alles oder nichts und noch viel mehr.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.


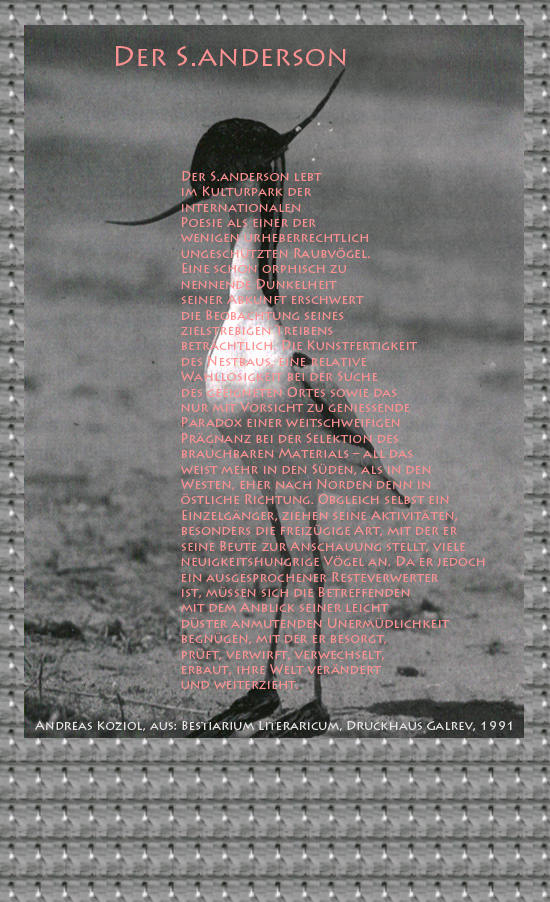












Schreibe einen Kommentar