Sascha Anderson: Herbstzerreissen
OHNE TITEL
Das Schiff ist zu schwer, sagst Du, recht
hast Du, unübersetzbar ist Zeit und ihre Sätze ohne
aaaaaweiteres
aaaaaaaaaBild, leicht
mißzuverstehn, erst wolkiges Meer dann handlicher
aaaaaStein
In der Hosentasche, und wie heißt sein Ufer, Böhmen,
aaaaaaaaabist Du gewiß, dann setz’
der Wildnis die Segel, denn nichts will ich mehr, als in diesem
Märchen, da auch der Winter mit in die Flasche muß,
aaaaaaaaaregelrecht untergehn.
Herbstzerreissen –
ein vergleichsweise unspektakulärer Gedichtbuchtitel, erinnert man sich an Totenreklame, Jewish Jetset oder an Jeder Satellit hat seinen Killersatelliten von 1982, das Buch, das Andersons Dichtung, auch im Westen, zum Begriff werden ließ. Den durchaus spektakulär zu nennenden Erfolg seines ersten Buches hat er nicht wiederholen können; in den 80er Jahren erschienen seine Bücher wie nebenbei, waren immer da, andere, teils leichtfüßiger daherkommende berliner Dichter gerieten mehr ins Augenmerk – was schade ist, da die durchaus anstrengende Beschäftigung mit Andersons Gedichten lohnt. Auch in Herbstzerreissen ist die düstergestimmte Grundmelodie, die sein viriles Pathos trägt, stets unüberhörbar – das, was als Andersons Kennung bezeichnet werden könnte. Gehalten haben sich die hochkomplexen grammatischen Strukturen, die seinen – durchaus nicht! – „kahlen Bildern“ ihren bitteren Griff umlegen, und die der Leserschaft ein hohes Maß an Konzentration abverlangen: „immerzu /Worte die von Bildern abgeleitet“ sind, „sprechende Namen“.
Klarnamen wie Klopstock, wie Hölderlin, die der Dichter als Hilfsgeister herbeifleht. Ein Angeschlagener, schwer Getriebener ist der Verfasser der Abschieds- und Liebesgedichte („Gier nach deiner Stimme, Gier nach Kunst“); Weimar, Rom, Agrigent sind die Einsteigerorte in die (Unter-)Welt von Sascha Andersons elegischen, selten nur sich dem Sentiment hingebenden Gedichte, die sich in „Herbstzerreissen“ der Kleinschreibung enthalten. Traditionsbewußte Dichtung, die nur zu leicht als „hermetisch“ denunziert werden könnte – denn: „beginnst / Du mitten im Vers / Anfang und Ende sind schlüssig“.
Thomas Kling, Druckhaus Galrev, Programmheft, 1997
Sascha Anderson. Die Angst im Herzen,
die Jäger im Nacken
− Herbstzerreissen eine elegische Selbsterkundung in Versen. −
Sascha Anderson, Sie erinnern sich? Deutscher Dichter aus Dresden, dessen wohlklingender Familienname kein Pseudonym ist. Wolf Biermann hat ihn mit dem Etikett „Arschloch“ überklebt – für breitschultrige Stasi-Dienste im Künstler-Kiez Prenzlauer Berg. Dieses öffentliche Etikett wird Anderson nicht los, solange er nicht öffentlich Klartext redet über das, was war; über das, was mit ihm war. Anderson aber redet keinen „Klartext“; er schreibt Gedichte.
Mit Herbstzerreissen legt Anderson seinen dritten Lyrikband nach 1989 vor. Der Titel klingt nach Herz-Zerreißen, nicht zufällig. Der Autor, Jahrgang 1953, ist sich selbst ein biographisches Rätsel, dem spürt er nach, in dem er Fährten legt – für die eigene Seelen-Kunde und für die Nachrichten-Häscher der Außenwelt.
Dreißig Gedichte und einen Essay bietet der Lyriker heute – eine wohltuende Zahl. An diesem Gedichtband ist nichts Zufälliges, kaum Überflüssiges – das ist selten in diesem Genre. Es ist die neue Ernsthaftigkeit und Dichte der Verse, die diesen Lyrikband zu einem Ereignis machen. Anderson spielt kaum noch, er verzichtet auf alles Entertainment, Zeile für Zeile graviert er – zuweilen zu gravitätisch; er schlägt einen neuen, klassizistisch gezügelten, sehr elegischen Ton an.
In sechs Kapitel gegliedert, bietet das Buch eine Serie von Momenten, in denen sich Anderson ins Verhältnis setzt zu seiner Mitwelt und dem Klassiker-Terrain Thüringen, das ihm Seelenlandschaft ist. Sehr oft ist hier von „Angst“ die Rede, der „Angst vor der Stimme, der schwarz auf weißen / Insel in ihrer Beschreibung“. Oder der neuen Furcht des Dichters vor dem ersten Satz: „von innerer Angst, noch flüssig, beginnst du mitten im Vers“.
In der Abteilung „Elegien“ geht Anderson ans biographisch Eingemachte. Er spricht von einer „Grenze“ nach außen, die ihm „einstürzt“ („E VII“). Und er sagt: „Vor dem Gartenhaus stehen drei Birken, die heißen / Schuld und Sühne, ich weiß welche die Liebste mir ist.“ Das „Liebste“ ist ihm ein Drittes, das in Debatten kaum Chancen hat.
Die Sprache der Rückschau-Debatten – so lässt sich interpretieren- nennt Anderson im Essay „Uhrteile“ ein so „perfekte“ wie für ihn chancenlose: „Grund und Garant dafür, dass die Geschichte nicht anders wird als wie sie war“. So sieht sich Anderson, der das Gedicht als „effektiven Fluchtpunkt“ erwählt, von Jägern umstellt: „Bisher wollte ich einen Text, der im Auge des Betrachters subjektiv sich darstellt. Nun nicht mehr.“ Und er zitiert den Philosophen Schelling in eigener Sache: „Die tiefste Note des historischen Gemäldes bezeichnet die Jagdstücke.“. Den Einband des Bibliophil gestalteten Buches ziert eine Jenaer Schießscheibe des Jahres 1830.
Es mag heute Anderson jagen wer will. Herbstzerreissen ist ein Gedichtband für Leser nicht für eifrige Bekenntnis-Fahnder eines der eindrucksvollsten Poesiealben des Jahres 1997.
Christian Eger
Andersons Hermetik
Trotz ihrer Geschliffenheit wirken die neuen, sich auf die poetische Tradition (Goethe, Schiller) berufenden Gedichte von Sascha Anderson abweisend: „Was ist’s für ein Wesens immer wieder aufzuzieh´n, anhand der Stämme / Dan und Benjamin, nicht Kahn mehr, noch nicht Kirche, das Augensegel stumpf genannt / und stumm vor’m Ufer die Bibliothek, die noch im Waldbrand“, usw. In „Herbstzerreissen“ zelebriert Anderson eine verschlossene Schönheit, die (zu?) viele Aufgaben und Bedingungen stellt, will man ihr näher treten. Nachvollziehbarkeit ist eh kein Anliegen des Prenzlauer-Berg-Dichters, der für die Stasi gearbeitet hat und auch diese Vorgänge nicht verstehbar machen konnte (wollte?).
Basler Zeitung, 20.2.1998
Es gibt einfältige Gemüter,
die von Sascha Anderson endlich Klartext erwarten. Alle anderen werden kaum überrascht sein, dass er statt dessen erneut mit hermetischen Gedichten aufwartet, die seinen Ruf wahren, „eine emphatisch auf Gegensprache gegründete Literatur zu schreiben“, so Wolfgang Emmerich in seiner Literaturgeschichte der DDR. Für Sascha Anderson hat das nie bedeutet, in Text und Kontext – Buchtiteln, Überschriften und Anmerkungen – auf konkrete Bezüge und aktuelle Anspielungen zu verzichten, die seine hochabstrakten Texte „interessant“ machen sollen; man denke an Titelzeilen wie „Jewish Jetset“ und „Jeder Satellit hat einen Killersatelliten“.
Vielleicht führen nicht einmal seine lyrischen Metaphern – wie Geritt Berendse im Kritischen Lexikon der Gegenwartsliteratur vermutet – „als Chiffren ein fast uncodiertes Eigenleben“. In seinem neuen Band jedenfalls drängen sich die verdeckten Botschaften zur Befindlichkeit seines Autors geradezu auf. Da ist in einem Gedicht von einstürzenden Grenzen, von einem Kartenhaus und gar von Schuld und Sühne die Rede; es endet: „Vor dem Gartenhaus stehen drei Birken, die heißen / Schuld und Sühne, ich weiß, welche die Liebste mir ist.“ Und warum wohl vermeldet der Werbetext des Verlags eigens, der Bucheinband sei „mit Abbildungen einer Schießscheibe“ versehen? Anderson pflegt diese Texte selbst zu verfassen. Will er sich ernsthaft oder ironisch – als Zielscheibe, gar als verfolgte Unschuld hinstellen? Zum Abschuß freigegeben?
Auch die Texte scheinen das nahezulegen. Die meisten Gedichte des Buches präsentieren sich als Elegien, von der einleitenden „Elegischen Gelegenheit“ bis zu den neun Gedichten einer ganzen Sequenz von Elegien. Das letzte Gedicht, ein Fragment, hat ein in Klammern verstecktes Stichwort. Gedächtnisschwund. Unwillkürlich, wenn ihn die scheinbare Willkür und Vieldeutigkeit der lyrischen Syntax im Stich lässt. Aber dieser Schein trügt: Nichts ist in ihrem Gefüge zufällig, kein Satzzeichen, kein Zeilenfall, nicht einmal Klein- und Großschreibung. Durch seine Verwendung der Kleinschreibung zeigte sich Anderson bisher „der Lyrik der historischen Avantgarde (Schwitters, Ball, Breton) und vieler gleichaltriger Kollegen in der DDR verbunden“ (Berendse). Daß sich seine neuen Gedichte „der Kleinschreibung enthalten“, deutet ein kryptisches Zitat der Verlagsankündigung als Wende zu einer „traditionsbewussten Dichtung“ und warnt zugleich, sie als hermetisch „zu denunzieren“. Nach der Schießscheibe nun ein Schießverbot? Nebbich. Das Latein des Autors lässt zwar zu wünschen übrig – er schreibt „in spe“ mit einem französischen accent aigu und „Annalen“ peinlicherweise „Analen“ -, es soll ihn aber offenbar als poeta doctus ausweisen. Seine Anmerkungen nehmen geläufig auf Kloppstock, Hölderlin, Goethe und Benn Bezug. Nur: Warum Benn? Von ihm gibt es eine Rechtfertigungschrift für seine Rolle im Dritten Reich mit dem Titel „Doppelleben“. Aber nicht jeder, der eines geführt hat, ist schon ein Benn.
Hannes Schwenger
Auf den ersten Blick ist dieser Gedichtband eine bloße Fortführung
von Rosa Indica Vulgaris, auf den zweiten Blick hingegen öffnet sich in dem Gedichtband eine neue Dimension, die in Rosa Indica Vulgaris noch nicht erkennbar war. Andersons Italienreise ist eine tiefe Auseinandersetzung nicht nur mit der Kultur Italiens, sondern auch mit der „deutschen Klassik“, die wesentliche Anstöße durch ihren Kontakt mit der italienischen Kultur erhielt. Anderson nimmt nicht mehr nur „Posen“ (Böttiger) ein, er bezieht jetzt eine im Lyrischen, im Vergleich zu seinen frühen Werken, neue Position. Thematisierte Anderson in seinen früheren Werken den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft, was sich oftmals an expressiven Selbstreflektionen ablesen läßt, so bettet Anderson diesen Konflikt jetzt in eine harmonische Ummantelung ein. Exemplarisch wird diese neue Position im folgenden Gedicht vorgestellt.
HERBSTZERREISSEN
So zurückgebrochen wie die Schrift, die Du nicht von oben
lesen kannst, schwärzer als gesagt
getan und gekleidet immernoch in Selbstbetrachtung, von
der Stimme aufgehob’ner Herbst, ist, was das Hunde-
herz, Klopstock gab dem seinen,
in den Zwischenraum vernarrt, den Namen Robespierre
unter’m ersten Schnee verscharrt. Etwas, das
von mir zwar, aber
nie von den kahlen Bildern abgefallen wär.
In diesem Gedicht wird beispielhaft Andersons Hauptthema der Selbstreflektion in eine neue Form überführt. Durch den Hinweis auf Klopstock findet eine neue Auseinandersetzung mit dem klassischen „Erbe“ statt. Dieses löst sich vom politischen Kontext, nachdem dieser mit der DDR verschwunden ist. Die Experimente seiner früheren Werke werden exemplarisch mit dem Revolutionär Robespierre „unter’m ersten Schnee“, einer häufigen Metapher in Anderons frühen Werken, begraben.
Dies bedeutet aber nicht, daß Anderson seinem Thema der Selbstbetrachtung untreu geworden wäre, vielmehr übernimmt er Stücke des „klassischen Erbes“, um dieses Problem zu diskursivieren. Andersons Anleihen sind nicht einfach nur formale Adaptionen, vielmehr sind sie eine sehr subtile Auseinandersetzung mit der Kunst der Klassik. In seinem Gedicht ist ein Zitat aus Klopstocks Gedicht „Der Schoßhund“ eingebaut, welches durch den Hinweis auf Klopstock auch als solches kenntlich gemacht ist. Anderson spricht durch Klopstocks Mund. Die neue Qualität entsteht einerseits durch die Ablösung von der durch den sozialistischen Realismus deformierten Klassikvorstellung und andererseits in der Auseinandersetzung mit den kulturellen Wurzeln der europäischen Kulturen. Anderson übernimmt in Abkehr von seinen früheren Konzepten das „klassische Ideal“ einer Kunst, das sich nicht von sozialen oder politischen Interessen leiten läßt und erweitert es dahingehend, daß seine Kunst sich in ihrem Ausdruck nicht einmal mehr von subjektiven Gründen leiten läßt. Das dichterische Subjekt löst sich im Zitat „klassischer“ Bezüge auf.
In dem Essay „UHRTHEILE“, der dem Gedichtband beigefügt ist, entwickelt Anderson seine neue Kunstkonzeption.
„Dieses Umfassende, ist selbst (…) kein Anderes als das in ein selbstausgeschlossenes, selbstblindes Ich zusammengestürztes, verdichtetes, sogenanntes Sein, eine in den Spiegel gespülte, perfekte Sprache.“
Das Gedicht ist für Anderson ein Objekt, an dem sich Kommunikation demonstrieren läßt, die tiefer ist als das von gesellschaftlichen Regeln geprägte Sprechen. Hier schließt Anderson implizit wieder an den Essay „KURZER TEXT ÜBER KÜNSTLICHES LICHT“ in Rosa Indica Vulgaris an. Zum Großteil ist dieser Essay ein Konglomerat philosophischer Ansichten, die Andersons Kunstkonzept darlegen. Stellenweise finden sich jedoch Aussagen, wie sie bisher nicht in Andersons Essays zu finden waren. Anderson kommentiert explizit seine „Ars Poetica“. Zentral ist die folgende Aussage, die die neue Qualität der Texte Andersons benennt:
− Ich habe alles versucht (mit den Bildern), (es blieben immer Sinnbilder). Das Gedicht ist nicht übersetzbar in seinen Hintergrund, da es keinen Vordergrund hat.
(…)
− Bildlich. Bisher wollte ich einen Text, der im Auge des Betrachters subjektiv sich darstellt. Nun nicht mehr:
Anderson sieht keine Möglichkeit, sich subjektiv zu entäußern. Hier bezieht er sich in seinen Erläuterungen ausdrücklich auf Wittgenstein. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit einer subjektiven Sprache, die Andersons ersten Gedichtband prägte, wird auf eine formale Ebene transformiert. Das nach Sprache ringende Subjekt, das charakteristisch für die frühen Gedichte Anderson ist, ist in diesem Essay an einen Punkt gelangt, an dem es erkennt, daß es keine Möglichkeiten gibt, sich zu äußern. Die letzte Möglichkeit, sich als Subjekt bemerkbar zu machen, ist originell, ist, Original zu sein.
− Aus der fünfhundertjährigen Schule der Originaliät ist wenigstens eines nicht überliefert, daß man ein Gedicht kopieren und hinterher vom Original unterscheiden könne.
Man ist angesichts dieser konsequenten Poetik, die harmonische aber auch autonome Kunstwerke als die einzig möglichen Formen von Kommunikation entwirft, gewillt, gerade im Hinblick auf Andersons frühe Gedichte, bereits von seinem „Alterswerk“ zu sprechen.
Sacha Szabo, „Sascha Arschloch“. Verrat der Ästhetik – Ästhetik des Verrats, Tectum Verlag, 2002
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.


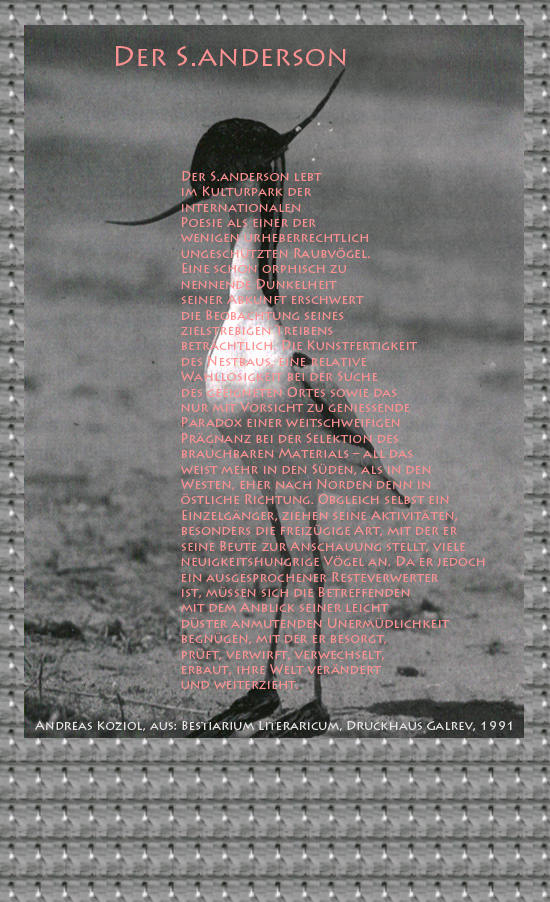












Schreibe einen Kommentar