Sascha Anderson: jeder satellit hat einen killersatelliten
alle dinge liegen klar in meinem herzen das modell
der schwarze vogel februar tanzt auf den wochen &
aaaaaich
habe angst dass er eines tages im august alles zurück
dreht um es wieder september zu nennen
alle dinge liegen klar in meinem herzen denn die
gelegenheitsstunde an der weissen parkuhr unschuld
hat zwei zeiger die jedes lied sechzig mal teilen & das
ist auch das alibi für das ende der zeit
alle dinge liegen klar in meinem herzen nichts wird
vergessen werden denn der punkt am ende ist nach
zwei der menschlichen seiten offen & nur auf den
pfauenaugen taut der schnee zum mittag restlos
alle dinge liegen klar in meinem herzen so dass mir
nichts bleibt als an den abenden wenn ich der graue
spiegel über dem wortefluss bin jenes schwarze recht
eck nacht auf die namen und reime zu legen
alle dinge liegen klar in meinem herzen zeugen wird
es nicht geben mutter sag dass der krieg eine er
findung ist & alles wurde nur erfunden um in den spiel
höllen die väterlichen taschen zu wechseln
alle dinge liegen klar in meinem herzen das modell
der weisse vogel november tanzt auf den wochen & ich
habe angst dass er eines tages im februar alles zurück
dreht um es wieder frühling zu nennen
Siebzehn Jahre nach der Veröffentlichung
von Jeder Satellit hat einen Killersatelliten und sieben Jahre nach der Bestätigung des Stasivorwurfs kann man einen zweiten Blick auf Sascha Andersons ersten Gedichtband werfen. Vierzehn alte Gedichte sind neu hinzugefügt. In Weimarer Elegie (1981) finden sich die Zeilen:„wer zahlt nun / den steigenden preis / für meinen sinkenden wert“. Wie ein Seiltanz zwischen Prophetie und Selbstverrat liest sich heute manches wie „ich hab mich sattgefressen / am fleisch im widerstand“. Jonglieren mit Uneindeutigkeit, zurückgenommene Verneinung, Paradoxien sind ein unabweisbarer Oberton, der alle Gedichte begleitet:„ich bin kein artist, ich mach kein spagat / ich häng mit meinem weißen hals im heißen draht“. In die romantische Ironie von Liebe und der Literatur fällt mitunter bleischwerer Ernst, der fast immer den Tod als Zeugen aufruft:„ich bau mir meine mauer selber durch den leib / die eine hälfte fault sofort / die andere mit der zeit“. Als Ort des Sprechens weist Anderson das Niemandsland zwischen Absurdität und „ostwestlicher die wahn“ aus: „die zusammenhänge sind / einfach & irreal“.
Eine sarkastische Leichtigkeit des Seins vermittelt auch die zweite Lektüre der Liebesgedichte, und ein Gran Jung-Wertherscher Ernst weht aus „alle dinge liegen klar in meinem herzen“ herüber. Andersons lyrische Melange aus Politik und Poesie entzog sich schon zu ihrer Erstveröffentlichung einer klaren Scheidung zwischen literarischer Betrachtung und Lektüre als politischem Schlüsseltext. Damals dachte man unangestrengte ,postmoderne’ Dissidenz zu erkennen, heute glaubt man Verrat und Selbstverrat herauszuhören. Literaturkritik sui generis wird hier auf absehbare Zeit keinen neutralen Grund finden. Die Lektüre bleibt ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.
Gabriele Dietze, Druckhaus Galrev, Programmheft, 1998
Lyrik aus dem Drahtverhau
− Das Debüt des DDR-Autors Sascha Anderson. −
In seinem Essay „Vom großen Aufstand“ behauptet Henry Miller, „daß es viele Rimbauds in der Welt gibt und daß sie allmählich immer häufiger vertreten werden“. Miller geht es mit dieser Prognose nicht um künstlerische Genialität – da ist er eher skeptisch, sondern um den sich verschärfenden „Kriegszustand zwischen dem Kollektiv und dem einzelnen“. Auch der junge Dichter Anderson ist ein „Rimbaud-Typ“, ein einzelner, der sich vehement lossagt von den Bindungen an das Kollektiv, an die Welt derjenigen, die es stets nur „gut meinen“ mit ihm.
Andersons Gedichte sind ein Versuch der Befreiung. An den Anfang seines ersten Lyrikbandes hat er die desillusionierte, programmatische Erklärung gestellt: „Ich weiß keine weltanschauung keine fernfahrkarte oder weiteres ding worauf mehr als der preis geschrieben steht und ich habe außer meiner sprache keine mittel meine sprache zu verlassen.“ Diese seine Sprache aber handhabt Anderson in einer erstaunlichen Variationsbreite. Sie ist rebellisch und respektiert keine Begrenzungen. Manches Gedicht birst förmlich unter dem Ansturm der Phantasiebilder, der immer rascher aufeinander folgenden Assoziationen, denen mit formal-logischen Kriterien kaum noch beizukommen ist.
John Lennon und Yoko Ono in New York, die dreitausend Soldaten an Polens Ostgrenze, Charlie Chaplin und Rosa von Praunheim, die Liebknecht-Gedächtniszelle in Luckau und ein Leningrader Konfekt namens Krupskaja: allem öffnen sich diese Gedichte, ohne in sinnloses Gestammel zu münden. Selbst da, wo auf den ersten Blick nichts als dadaistischer Nonsens steht, in dem poème trouvé „eNDe II“, muß sich der Leser schließlich mit einem Lachen geschlagen geben. „eNDe II“ beginnt mit den Zeilen „abendstern ahn alle alles am auf auge / bereiche bewegter / dämmrung der der der die die…“ und endet „weiden widerspiegelnd / zauberschein zitterst zuerst.“ Das ist Goethes Altersgedicht „Dämmrung senkte sich von oben“, dessen Wörter streng alphabetisch aneinandergereiht worden sind – ein respektloser Beitrag zum Jubiläumsjahr.
Anderson (geboren 1953 in Weimar) lebt in Dresden, im Geltungsbereich einer Kulturpolitik, die seit einigen Jahren sehr konkrete Vorstellungen über die „Bedeutung der Erbeaneignung und Traditionsbildung für den literarischen Schaffensprozeß“ entwickelt hat. Richten sich Anderons Goethe-Parodie und sein unkonventioneller Umgang mit tradierten lyrischen Formen (Volkslied, Sonett, Prosagedicht) nicht auch gegen solch bürokratisch steife Annäherungsversuche an die Großen seiner Heimatstadt?
Eine kaum überbrückbare Distanz zur staatlichen Emblematik prägt alle Gedichte dieses Bandes. Anderson hat sich von den offiziell geförderten oder zumindest geduldeten „verschiedenen Handschriften“ viel weiter entfernt als sein ebenfalls recht aufmüpfiger Berliner Altersgenosse Uwe Kolbe. Das gilt nicht nur für Andersons hemmungslos experimentierende „wilde“ Sprache, sondern mehr noch für die angesprochenen Themen.
Dem Leser wird mitunter angst und bange vor der Radikalität, mit der die Entfremdung von Familie und Gesellschaft mitgeteilt wird. Das zwei Seiten lange Prosagedicht „mann kann watzmann geheißen haben mit zet & en en“ liest sich wie ein Stenogramm der „Unvollendeten Geschichte“ von Volker Braun, ja, es übertrifft diese noch in der Eindringlichkeit und Kompromißlosigkeit, mit der die Zerstörung der eigenen Jugend notiert wird. An dieser Zerstörung ist der Konformismus des Vaters, der „die fahnen raushängt wenn dazu aufgerufen wird gestern heute morgen“, ebenso beteiligt wie die Willkür der Behörden. Aber der Leser findet keine Klage, kein Selbstmitleid, schon gar nicht Verkniffenes, sondern stets das stark ausgeprägte Bewußtsein eigener schöpferischer Freiheit: „ich habe außer meiner sprache keine mittel meine sprache zu verlassen.“
Am eindrucksvollsten zeigt sich die poetische Begabung des jungen Dresdner Autors in einem sorgsam komponierten Zyklus von zwölf Liebesgedichten. Anderson erzählt in diesen Gedichten über eine romantische Liebe zwischen Ost und West, der DDR und den Niederlanden. Das allerprivateste „Ich küsse dich / ich liebe dich lege mir die hand auf die adern / der nacht soleil et chair“ verbindet sich mit der Verachtung für jene „Staatsorgane“, die sich bereits durch die Liebe zweier junger Menschen bedroht fühlen.
In den Liebesgedichten artikuliert sich ein Außenseiter, der die eigene Existenz aufs Spiel setzt (auch darin ein Millerscher Rimbaud), der bereit ist, „den roman bis zum blutigen / ende im drahtverhau / zu treiben was auch bitte sehr / nur eine metapher ist die ich verrate“. Große Betroffenheit schließlich löst das lange Gedicht „het litteken“ (niederländisch: das Zeichen, die Narbe) aus. In ihm hat Anderson alles spielerisch Experimentelle zurückgenommen, die Sprache ist leise, es geht um den Augenblick des Abschieds, um den verzweifelten Versuch, ihn aufzuschieben, ihn rückgängig zu machen. Aber die Anstrengungen der Phantasie sind vergeblich.
Rezension der Erstveröffentlichung
Andreas F. Kelletat, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.5.1982
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Herbert Wiesner: Bilder einer wunden Welt
Süddeutsche Zeitung, 19.5.1982
Ohne Mauer im Kopf
– Sascha Anderson – Lyriker, Erzähler, Promotor vom Prenzlauer Berg. –
Es gibt eine Fremdheit gegenüber der Gesellschaft, die über jede Kritik hinausgeht. Die innere Distanz des einzelnen zur herrschenden Ordnung ist so groß geworden, daß ihm jede Argumentation – mit der er doch zumindest die Möglichkeit einer Verständigung anerkennen müßte – sinnlos erscheint. Er betrachtet seine Umwelt von außen mit einer Mischung aus Mitleid und Gleichgültigkeit, die ihm gelegentlich einen schmerzlich genauen, hellsichtigen Blick verleiht.
Sascha Anderson, 1953 in Weimar geboren, lebte bis zu seinem Umzug nach West-Berlin im Sommer 1986 im Ost-Berliner Stadtteil Pankow. Wer ihn zu Beginn der achtziger Jahre besuchte, hatte es nicht leicht ihn zu finden. Von einer Wohnung im gutbürgerlichen Sinn konnte kaum die Rede sein. Er teilte sich mit einigen anderen Künstlern oder auch Lebenskünstlern die verwinkelte Erdgeschoßetage eines Hinterhauses. Wäre Anderson ein Angehöriger der New Yorker Scene gewesen, hätte man seine Behausung wahrscheinlich ein „Loft“ genannt und Parallelen gezogen zwischen der Lebens- oder Arbeitsgemeinschaft ihrer Bewohner und Andy Warhols Factory. Doch zwischen den immer noch zerschossenen Altberliner Fassaden wirkte Andersons „Werkstatt“ nicht mondän, sondern eher wie der Unterschlupf einiger an den Rand Gedrängter.
An der Eingangstür fand sich keine Name, lediglich der lakonische Hinweis auf ein „Keramik-Atelier“ – was vor allem bei westlichen Besuchern den Eindruck verstärkte, nunmehr einen fast schon konspirativen Treffpunkt zu betreten. Im ersten, größten Raum stand ein selbstgefertigter Brennofen, auf einer Werkbank türmten sich Töpfermaterialien, Farben, Ton, Pinsel, Näpfe mit Glasur, und auf dem Boden standen ausgebreitet die fertigen Produkte: Schalen, Schüsseln, Vasen, Kannen, Geschirr in bizarrem Design und den erstaunlichsten Bemalungen. Andere Räume erinnerten an eine Kellergalerie: Anderson veranstaltete hier mit seinen Freunden jenseits des offiziellen Kulturbetriebs private Ausstellungen oder auch Lesungen. An den Wänden hingen Bilder, die man hierzulande gewiß den „Neuen Wilden“ zugerechnet hätte: Grelle Kompositionen, die sich von jeder malerischen Tradition radikal loszusagen schienen. Andere zeigten dagegen nur kurze Texte, die jemand mit verschliffener Handschrift auf die Leinwand geworfen hatte. Die wenigen Möbel in den Zimmern waren alt und abgenutzt, ein Tisch, eine Couch, ein paar Stühle, dazwischen, auf dem Boden liegend, einige Musikinstrumente – auf konventionellen Komfort schien hier niemand Wert zu legen.
Im Gegensatz zu seiner lebhaften Umgebung wirkte Sascha Anderson still und zurückhaltend, aber energiegeladen. Es war ihm anzumerken, daß er die Position des Beobachters der des Akteurs vorzog. Geleitet wurde die Keramik-Werkstatt von seiner Frau. Bei ihr war er als Gehilfe angestellt, um vom Finanzamt die in der DDR unumgängliche Steuernummer zu bekommen. Als Autor erkannte man ihn in seiner Heimat nicht an, da er dem Schriftstellerverband nicht angehörte und die staatlichen Verlage lediglich einige wenige Texte aus seiner Feder in der von Dorothea von Törne herausgegebenen Anthologie Vogelbühne (1983) veröffentlicht hatten.
In der Bundesrepublik dagegen waren zu diesem Zeitpunkt schon zwei Bücher von Anderson erschienen: die Gedichtsammlung Jeder Satellit hat einen Killersatelliten (1982) und der lyrisch eingefärbte Reisebericht totenreklame (1983). Ihnen sollte noch während seines Aufenthalts in der DDR die Waldmaschine (1984) folgen, eine „Übung, vierhändig“ gemeinsam mit den Malern Ralf Kerbach und Cornelia Schleime und dem West-Berliner Schriftsteller Michael Wildenhain. Die Bände zeugen von einer überraschenden Breite literarischer Ausdrucksmöglichkeiten: Da stehen freie Verse mit gewagter, eigenwilliger Metaphorik neben balladesken Liedern, dadaistische Parodien neben expressiven Prosagedichten, Reflexionen neben wirkungsvoll verfremdeten Fundstücken aus dem Sprachgebrauch des Alltags oder aus dem „Neuen Deutschland“, das er sarkastisch „eNDe“ abkürzt. In allen Texten aber macht sich eben jene Fremdheit bemerkbar, die sich vom Gewohnten ausschließt und vielleicht deshalb deren Banalität umso treffender beschreiben kann.
abends seh ich tv. ein film, ich weiß nicht von wem. ich sehe die menschen wie sie leben, nachdenken darüber, sprechen davon. leben, unaussprechlich.1
Mit diesen Worten zieht Anderson in seinem Buch totenreklame das Fazit einer Reise, die ihm seine Heimat und das, was man gemeinhin „Alltag“ nennt, nahebringen sollte. Doch der Abstand bleibt unüberbrückbar, bleibt „unaussprechlich“. Vielsagend ist bereits der siebentausend Kilometer lange Weg, den er quer durch die DDR zurücklegte – durch ein Land, in dem er doch kaum mehr als fünfhundert Kilometer in eine Richtung fahren konnte, ohne an fast unpassierbare, teilweise waffenstarrende Grenzen zu stoßen. Anderson wählte, abseits aller üblichen Strecken, eine sich spiralförmig auf Berlin zubewegende Route, die eher an das verzweifelte Im-Kreis-Laufen eines eingesperrten Tiers denken läßt, als an touristische Vergnügungen. Getrieben von jener „expansiven Sehnsucht nach Weite, nach Ferne, nach Reisen“2 – die Günter Kunert in seinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen bei vielen jüngeren DDR-Autoren ausmachte –, durchstreift er den kleinen, eingemauerten Staat und meditiert in den damals entstandenen Berichten über die Bäume, die Flüsse, die Landschaften – unfähig, die Menschen, ihr Tun und Lassen oder auch ihre „Monumente der Machte“3 ohne Ironie oder den Umweg über ein entlarvendes Zitat zu beschreiben. Ihm versagte, so will es scheinen, die Sprache angesichts der Lebenssituation seiner Mitbürger.
Anderson war, anders als offenbar die meisten von ihnen, einerseits nicht bereit, sich mit den staatlich verordneten Existenzbedingungen abzufinden oder sich andererseits an den allgegenwärtigen Beschränkungen wundzureiben. Die Mauer, so wurde ihm klar, sei dazu da, damit man sich ihr füge oder sich an ihr den Kopf einrenne. Er versuchte im Handeln wie im Schreiben, aus den von den politischen Gegebenheiten diktierten Verhaltens- und Denkweisen auszubrechen, die zu immer neuen Konfrontationen führen, zum „östwestlichen die wahn“4, wie er in einer spöttischen Goethe-Paraphrase feststellt. Gerade die Literatur wollte und will er bis heute nicht in jenes Freund-Feind-Schema pressen lassen, in dem es in seinen Augen keine annehmbaren Lösungen, keine wirklich freien Entscheidungen mehr gibt. Statt wie gebannt auf die Vorgaben der Politiker zu starren und – kritisch oder willfährig – auf sie zu reagieren, versucht er seinerseits zu agieren, indem er konsequent seine ästhetischen Vorstellungen verfolgt. Eine Verweigerung, die nichts mit träumerischer Weltabgewandtheit zu tun hat, sondern auf die subversive Gewalt der – in ihrer Eigengesetzlichkeit ernst genommenen – Kunst vertraut.
Er formulierte poetisch und poetologisch, was Jean Baudrillard Mitte der siebziger Jahre politisch durchdachte. „In allen Bereichen ist das Bipol das vollendete Stadium des Monopols“, schreibt der französische Soziologe in seinem Essay „Der symbolische Tausch und der Tod“ – und weiter:
… die Macht ist nur dann absolut, wenn es ihr gelingt, sich in verschiedene Äquivalente aufzuspalten, wenn es ihr gelingt, sich durch eine Zweiteilung zu verdoppeln. Das geht von Waschpulvermarken bis zur friedlichen Koexistenz. Zwei Supermächte sind notwendig, um eine Welt unter Kontrolle zu halten: ein Imperium allein würde in sich zusammenstürzen. Das Gleichgewicht des Schreckens ist nur dasjenige, wodurch die Einführung der regulierten Opposition ermöglicht wird…5
Baudrillard bringt so die Erfahrungen Andersons auf den philosophischen Begriff: Der allumfassende, alles durchdringende Konflikt zwischen den Weltanschauungen und Hemisphären bedroht die Mächtigen beider Lager nicht mehr, sondern zementiert ihre Herrschaft. Der ständige Hinweis auf die Gefährlichkeit ihres Gegners dient ihnen als Rechtfertigung der eigenen Bunkermentalität: als Vorwand für das dogmatische Verteidigen einmal gefaßter Grundsätze, für das Ersticken jeder oppositionellen Regung im Inneren, für das Verhindern aller sozialen Experimente und für die Harthörigkeit gegenüber Vorschlägen, die aus der Situation des fingierten ideologischen Zweikampfs herausführen könnten. Gerade um solche Vorschläge aber ging es Anderson und geht es ihm auch heute noch. Folglich versuchte er konsequent, aus den üblich gewordenen politischen Denkmustern, die doch immer wieder nur in ein lähmendes Dauer-Duell führen, auszubrechen.
Er gewann so in der DDR, frei von allen taktischen Erwägungen einen großen Freiraum, ging aber auch, unfähig zu allen taktischen Rücksichten, ein nicht minder großes Risiko ein. Ende der siebziger Jahre saß er bereits einmal im Gefängnis, und zwar in „luckau / zwei etagen über der liebknecht-gedächtniszelle“.6 Daß er danach weiterhin regelmäßig verfolgt, verhört, bedroht wurde, tat er mit einem Achselzucken ab. Zwar konnte er solche Nachstellungen nicht ignorieren, doch war er zu keinerlei Kompromiß bereit, da dies bereits bedeuten würde, die Macht der Politiker und die von ihnen geschaffene politische Realität anzuerkennen. In diesem Sinn versprach er sich auch nicht viel von einer Übersiedlung in den Westen: Dort sei er, sagte er schon vor seinem Umzug nach West-Berlin, nur auf der anderen Seite einer quer durch das Land und die Köpfe verlaufenden Front, mit der er sich nicht abfinden wolle.
Daß er dann 1986 dennoch den kleinen, aber lebensverändernden Schritt von Ost- nach West-Berlin vollzog, hatte – darauf bestand er – keine politischen, sondern vor allem private Gründe. Er war nach der Übersiedlung der meisten seiner Freunde und Mitarbeiter in eine gewisse Isolation geraten: Er hatte den Kontakt zu seinen alten Gefährten verloren, die sich jenseits der Mauer wieder zusammenfanden. Dies gab für ihn letztlich den Ausschlag: Seine Gedichte entstanden stets aus der Zusammenarbeit, dem Zusammenleben mit jenen Freunden heraus. Ob sich dieser Kreis im Osten oder im Westen befände, war für ihn letztlich von geringerer Bedeutung, wenn nur die produktiven Kontakte aufrecht erhalten blieben.
Im Gegensatz zu manchen anderen Schriftstellern ließ sich Anderson wohl nicht von der Möglichkeit in die Bundesrepublik locken, endlich ohne jede Bevormundung publizieren zu können. Er hatte sich bereits in der DDR mit viel Phantasie und der Hilfe seines Freundeskreises Gelegenheiten geschaffen, seine und auch fremde Texte jenseits der staatlich kontrollierten Kanäle an die Leser zu bringen. Er war mit dem Beginn der achtziger Jahre rasch zu einem Promotor der Nachwuchskünstler vom Prenzlauer Berg aufgestiegen: Er gab hektographierte Zeitschriften heraus, stellte in abenteuerlichen Druckverfahren Kunst- und Lyrik-Bände in kleinsten Auflagen her oder organisierte Rock- und Punk-Konzerte, auf denen er seine Lieder gelegentlich selbst sang. Jene Bilder beispielsweise, die in seiner Ost-Berliner Wohnung hingen und nur kurze Texte zeigten, waren nichts anderes als großformatige Abschriften seiner Gedichte, die er mit oder ohne offiziellem Segen auf verschiedenen Ausstellungen präsentierte.
So konnte es sich Anderson leisten, schon bei der Vorbereitung seiner ersten und einzigen Veröffentlichung in der DDR Forderungen an den Verlag zu stellen. Er sei nur dann bereit, sich an der Anthologie Vogelbühne zu beteiligen, ließ er die Herausgeberin Dorothea von Törne wissen, wenn darin auch Texte des damals erst zweiundzwanzigjährigen Bert Papenfuß-Gorek aufgenommen würden, dessen experimentelle Lyrik er schätzte und der ansonsten keine Chance hatte, gedruckt zu werden. Ein solcher Akt der Solidarität – der vergeblich blieb, denn der Ost-Berliner Verlag der Nation setzte sich über die Bedingungen Andersons kurzerhand hinweg – war für ihn keine Heldentat, sondern eine schlichte Notwendigkeit. Da er sich gegen die gesellschaftliche Ordnung der DDR sperrte, war er in hohem Maße auf den Zuspruch und den Beistand der Menschen in seiner Umgebung angewiesen. Zu ihnen bekannte er sich mit der gleichen Radikalität, mit der er sich sonst verweigerte: Dem konsequenten Nein zu einer Welt, die nur die Wahl zwischen selbstzerstörerischer Auflehnung und erstickender Anpassung läßt, steht in seiner Lyrik das innige Zusammengehörigkeitsgefühl mit einigen wenigen gegenüber.
Aber dieses enge, verschworene Miteinander brachte und bringt für Anderson literarisch auch Nachteile mit sich. So benutzt er bis heute eine schwer zugängliche, gelegentlich hermetische Chiffren-Sprache, mit der er bewußt ein größeres Publikum ausschließt. Ein esoterischer Zug, den er nicht nötig hat, wie seine frühen liedhaften, aber auch seine späteren klar komponierten Verse zeigen, mit denen er gewiß auf seiner Subjektivität besteht, aber sich dennoch nicht ganz vom Leser abwendet:
ich bin kein artist von land zu land
ich bin kein artist von land zu land
ich bau mir meine mauer selber durch den leib
die eine hälfte fault sofort die andre mit der zeit
ich bin kein artist ich mach kein spagat
ich häng mit meinem weissen hals im heissen draht
ich bin kein artist also bleibe ich hier
auch wenn mir dabei noch das herz erfriert7
Über die Wirkung seiner Arbeit macht sich Anderson keine Illusionen. Er weiß, wie wenig die Literatur vermag. Aber das hält ihn nicht davon ab, weiterhin sein Unbehagen an dieser Welt zu formulieren, einer Welt, deren höchste Anstrengung noch immer der Zerstörung des gerade erst Erreichten galt:
Der Titel jeder Satellit hat einen Killersatelliten ist einfach ein Symbol für den Stand der Dinge, für die Deformation des Begriffs Dialektik. Das kommt also mehr von Schweinedialektik und Hundephilosophie. Ich bin kein Fatalist, aber ich glaube, daß ich so realistisch bin zu wissen, daß sich die Dinge so entwickeln, wie sie sind. Wir können nichts dagegen tun, außer die Entwicklung so gut wie möglich zu stören. Das bedeutet nicht sie zu zerstören, sondern in ihr Risse, Lücken zu schaffen. Ich fülle mit Sätzen nicht bestimmte Risse, sondern ich schaffe Risse.8
Uwe Wittstock, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.6.1983
neu veröffentlicht (und wahrscheinlich auch erweitert) in Uwe Wittstock: Von der Stalinallee zum Prenzlauer Berg. Wege der DDR-Literatur 1949–1989, Piper Verlag, 1989
körperlosigkeit
lettern schwarz auf weißem grund
schwarz die nationen ihre rolle spielen
(schwarz als reaktion auf weiss
weiss als reaktion auf schwarz)
vielleicht sollte man die wahrheiten
die durch die literatur verbreitet
werden grau auf grauem grund
drucken. ich weiß keine weltanschauung
keine fernfahrkarte oder
weiteres ding worauf mehr
als der preis geschrieben steht
ich habe ausser meiner sprache keine
mittel meine sprache zu verlassen.
Bereits das Eingangsgedicht in Sascha Andersons Gedichtband dokumentiert seine poetische Grundüberlegung. So bildet die Reflexion der eigenen Person in ihrer Beziehung zur Umwelt mit Hilfe der Sprache für Christine Cosentino eines der zentralen Themen von Andersons Dichtung. Sobald sich Sprache auf einen Gegenstand richtet, wird dieser durch die Sprache in ein bestimmtes System, in einen bestimmten Kontext eingeordnet. Reflektiert man mit Hilfe der Sprache über sich, so hebt man mit Hilfe der Sprache die eigene Identität auf, man überschreitet die Grenze der eigenen Identität und wird sich selbst ein Fremder. Auf diese Weise werden die gesellschaftlich vorgegebenen Grenzen der Sozialisation sichtbar.
Diese Analyse ist mehr als nur Ursachenforschung, da sie die Zusammensetzung der eigenen Identität als Person und damit auch als Künstler hinterfragt. Sie untersucht die künstlerischen Grundlagen des eigenen Schreibens und thematisiert das Ergebnis dieser Analyse mit künstlerischen Mitteln. So endet das Gedicht auch mit einer Zeile, die an die Sprachspiele Wittgensteins erinnert. Anderson schafft eine irritierende Gleichzeitigkeit von „Drinnen“ und „Draußen“, indem er die eigene eingebundene Situation als Außenstehender reflektiert. Diese Grenze wird gerade durch ihren Übertritt eine manifeste, und zwar dadurch, daß dieser Prozeß ein sich Selbstbewußtmachen der sozialen Rolle ist, die sich innerhalb des konkreten Kontextes gebildet hat. Anderson faßt diesen Vorgang als eine Form der Schizophrenie auf.
„ich bin nicht schizophren, sondern ich bin der, der schizophrenie als mittel zur verfügung hat, d.h. ich brauche nicht die zwei welten, in denen ich existiere und mich ausdrücke, und ich kann eine immer sterben lassen, welchen sinn das hat, interessiert dabei erstmal weniger als die möglichkeit.“
Im Gedicht „dresden zum dritten“ greift Anderson diese Form der Schizophrenie durch Reflexion auf sich selbst noch einmal auf. Dort heißt es: „und so spalt ich mich, ihr lieben und bin immerfort der Eine ich weiß dass die selben wiederkehren um andere zu sein“. Am deutlichsten wird diese Diskursivierung der eigenen Identität im Gedicht „Ich bin Mary Westcott“ thematisiert, in dem Anderson seinen Eigennamen benutzt.
ich bin mary westcott
& ausserdem dass
ich unter dem namen s. anderson
worte für den rosenkranz
der generationen
jage in die doppelherzalben
Formal wird dieser Vieldeutigkeit in Andersons Gedichten durch die Zeilenbrüche und die Verwendung des Satzzeichens „&“ Rechnung getragen. Denn durch die Brechung der Zeileneinheiten lassen sich Andersons Texte, so Annelie Hartmann: „oftmals sowohl mit dem Vorangehenden als auch mit dem Nachstehenden in Bezug setzen. Indem sie rückwärts wie vorwärts weisen, geraten die Zeilen ins Fließen, werden doppelbödig, mehrdeutig“
Die Erfahrung einer entfremdeten Identität baut für Anderson auf einer entfremdeten Welt auf. Die Erkenntnis dieser Grundlage wird von Anderson in dem Gedicht „eNDe“ thematisiert, und zwar dadurch, daß er pointiert typische Versatzstücke der DDR-Realität aufzählt.
eNDe IV
östwestlicher die wahn
machs gut mit spekulatius
machs gut mit kohlenanzünder dem weissen
machs gut mit erika love again
machs gut schöne grosse blonde leere
rin machs gut ödipus
machs gut unten spiegelverkehrt
eine nuance zu concafé machs gut
augenblicklich signiert machs gut ein
tv zwei
die macht sie fördert frauenliteratur unter dem aspekt
steigt laicht das bewusstsein ein frontstaat zu sein
machs gut im aquarium
sitzen immer die anderen machs gut
amnestie für die angebrochene
packung kekse marke favorit
Dieses Gedicht ist eine offensichtliche Charakterisierung der DDR, zumal Andersons „eNDe“-Gedichte eine Anspielung auf das offizielle Parteiorgan der DDR, das „Neue Deutschland“ (ND) sind. Anderson verfolgt jedoch eine weitere Intention, als nur den (scheinbaren) Sinn im „Neuen Deutschland“ durch Unsinn zu ersetzen „und damit bloßzustellen“. Anderson stellt die in der DDR geläufigen staatlich genormten sprachlichen Zeichen in einen Kontext, so daß sie einen neuen Sinn ergeben. Dadurch, daß er den Zusammenhang von Signifikant und Signifikat auf eine unkonventionelle Weise neu bestimmt, schafft er einen „Sprachwitz“, der ein Vorgriff auf die Etablierung einer neuen Sprachrealität und damit letztlich einer neuen gesellschaftlichen Realität darstellt. Diese Form des Sprachspiels stellt durch die Neudeutung eine kommunikative Grenzüberschreitung dar, und in der Neuschaffung einer sprachlichen Realität liegt zugleich auch ein Gegenentwurf zum herrschenden Diskurs vor.
Durch den Bezug auf Goethe („West-östlicher Divan“) spielt dieses Gedicht mit dem „Erbe-Begriff“ der DDR-Kultur. Das Gedicht wird mit diesem Bezug auf die „Erbe“-Aneignung in einen politischen Kontext gestellt („östwestlicher die wahn“), in dem die DDR-Kulturpolitik als ein Teil des Kalten Krieges überführt wird. Diese Kritik wendet sich zugleich auch gegen den Westen, der das andere Extrem in diesem stabilen Duopol der Abschreckung markiert.
Sacha Szabo, „Sascha Arschloch“. Verrat der Ästhetik – Ästhetik des Verrats, Tectum Verlag, 2002
Gespräch mit Sascha Anderson
– Das folgende Gespräch mit Sascha Anderson führten Thony Visser und Annette van Erp am 28. Oktober 1986 in Amsterdam. –
Thony Visser und Annette van Erp: 1982 stelltest Du Dich mit Deinem Gedichtband Jeder Satellit hat einen Killersatelliten zum ersten Mal einem breiteren Leserkreis vor. Welches sind damals Deine Motive gewesen, Gedichte zu veröffentlichen, und siehst Du im Dichten „die einzig annehmbare Lebensform“ für Dich?
Sascha Anderson: Bei dem Band sind die Umstände ziemlich konkret. Heiner Müller, und ich glaube Paul Gratzik, die beide Autoren beim Rotbuch Verlag sind, haben irgendwann meine Gedichte und verschiedene andere Texte der Lektorin vom Rotbuch Verlag gezeigt. Diese Lektorin, G. Dietze, die erst 1980 zum Verlag gekommen ist, hat sich vorgestellt, noch einen jungen DDR-Autor in den Verlag zu nehmen. Dann haben sie sich für mich entschieden. Sie haben aus einem Stapel von vielleicht zweitausend Texten – und wovon für mich tausendneunhundertneunzig schlecht waren – die fünfzig oder sechzig Texte ausgewählt. Das geschah relativ unabhängig von mir. Meine ersten Veröffentlichungen, oder das, was ich als Veröffentlichungen begriffen habe, haben in der DDR in der Form von Lesungen stattgefunden. Das begreift man in der DDR bereits als Veröffentlichung. Auch habe ich in Dresden eine Edition von etwa zehn Heften gemacht, die „Poe-Sie-All-Bum“ hießen, also so ganz eigenartig geschrieben. Diese Hefte, mit Malern zusammen gemacht, waren eigentlich meine ersten Veröffentlichungen. Müller und Gratzik haben diese dann auch zum Rotbuch Verlag gebracht, und auch hieraus wurden Sachen ausgewählt. Dieser Band Killersatellit ist also eine Auswahl früher Texte. Die Öffentlichkeit spielte für mich keine wesentliche Rolle. Als das Buch herauskam, war ich natürlich gespannt, was es an Reaktionen geben würde. Die waren aber sehr unterschiedlich. Da gibt es z.B. Kritiken, wo man plötzlich von außen betrachtet wird, aus einer Perspektive, die man selbst zu sich nicht hat, z.B. die Medienperspektive: Westmedienperspektive zu Ostschriftsteller. Das ist immer etwas ganz Kurioses, damit habe ich aber inzwischen gelernt zu leben. Das war aber sehr überraschend. Da hat einer in der FAZ geschrieben, „wenn man bei ihm in die Wohnung kommt, ist es ein Hinterhof im Prenzlauer Berg“. Ich habe ihn angerufen und gesagt, so etwas kann man nicht machen. Du machst einen Impressionismus aus Bildern, die bei mir an der Wand hängen. Ich habe, wenn überhaupt, expressive Bilder an den Wänden und du schreibst einen impressionistischen Text, also deine Impressionen, wie Hinterhof-Poeten leben. Das stimmte überhaupt nicht, aber das ist natürlich eine Perspektive von außen, die ich akzeptieren muß. Aber wie kommt diese Art von Sicht zustande? Das hat mich sehr überrascht. Ich habe ihn dann gebeten, sich das doch einfach mal genauer anzugucken. Seitdem macht er immer mit seiner Freundin Fahrradtouren durch die DDR.
Für mich spielte also die Öffentlichkeit keine so große Rolle. Für mich war vielmehr interessant, wie viele Öffentlichkeiten es gibt. Die Westpressen-Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit der Verlagsleute, mit denen ich zu tun hatte, die Öffentlichkeit der Kollegen in der DDR und die wenigen Menschen, die ich dort zu der Zeit, außerhalb dieser Öffentlichkeit, kannte. Diese kollegiale Öffentlichkeit ist natürlich entscheidend, aber es ist nicht die, durch die man merkt, was für das Leben wichtig ist.
Als das Buch herauskam, lebte ich noch in Dresden und dort kamen, in einem Weinkeller, ab und zu junge Leute zusammen, die über irgendwelche Texte sprachen. Das ist dann die Öffentlichkeit, die mich mehr interessiert hat. Öffentlichkeit an sich spielte also keine Rolle.
Visser und Erp: Inwieweit ist das Schreiben von Gedichten für Dich eine Auseinandersetzung mit der Umwelt?
Anderson: Es gibt Situationen, da ist der Text ein Kommentar zur Öffentlichkeit. Das akzeptiere ich auch. Das gibt es sicher auch bei mir. Das ist aber wirklich nur ein Aspekt der Gedichte. Es gibt erstmal für mich keinen Zusammenhang zwischen Öffentlichkeit und Text. Die Öffentlichkeit ist tatsächlich der naheliegendste Grund, aber die wirkliche Veröffentlichung ist die, daß man jemandem anderen etwas sagt. Dem anderen etwas sagen und die Form des Gedichtes. Warum das gerade ein Gedicht ist, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich bloß mit Gedichten großgeworden. Ich bin mit russischer Dichtung aufgewachsen: Puschkin, Lermontow. Vielleicht war für mich die Form des Gedichts die einzige, mich verständlich zu machen. Jetzt bin ich der Meinung, daß man auch vieles sagen kann, ohne aus allem ein Gedicht zu machen. Es gab in der DDR Mitte bis Ende der 70er Jahre eine Tendenz, aus jedem Gedanken, den man hatte, ein Gedicht zu machen. Eine Flut von Gedichten, die überhaupt nichts sagen, keine Aussagen bringen, die nur sprechen, so ein Mumbling. Erst sehr spät, Anfang der 80er Jahre, kam die Differenzierung zustande, daß man durchaus einen essayistischen oder einen kritischen Text schreiben kann. Das muß nicht alles ein Gedicht sein. Für mich ist also das Gedicht nicht gleich Öffentlichkeit. Ich setze das Maß für Öffentlichkeit sehr gering, sehr privat, sehr persönlich an.
Visser und Erp: Bei Dumont ist 1985 ein Kunstbuch bzw. ein Museumskatalog unter dem Titel Tiefe Blicke herausgekommen, in dem auch Texte zu einigen DDR-Malern von Dir erschienen sind. Wie kam es zu diesem Katalog und Deinen Texten?
Anderson: Ein westdeutscher Galerist sah zufällig im Fernsehen einen Film über mich, und er sah auch die Bilder, die bei mir an den Wänden hingen. Er kam zu mir und wollte alle diese Bilder kaufen, doch ich sagte ihm, daß er besser zu den Malern direkt gehen könnte. Wir sind eine Woche herumgefahren, und er hatte dann alles eingekauft und ins Museum in Darmstadt gebracht. Ich habe dann so ein paar diese DDR-Maler einleitende Worte geschrieben. Derartige Texte, auch die für diesen Katalog, haben immer einen bestimmten Anlaß des Entstehens. Wenn ein Maler eine Ausstellungseröffnung hat oder ein Katalogtext gebraucht wird, dann setze ich mich hin und arbeite dazu. In diesem Katalog steht auch ein Text über Penck drin, der eigentlich das Vorwort zu dem Stück „Erotik der Geier“ in dem Buch Waldmaschine ist.
Visser und Erp: Entstammt Deine Zusammenarbeit mit Malern und Musikern einem künstlerischen Bedürfnis oder liegen dem ausschließlich Freundschaftsmotive zugrunde?
Anderson: Ich hatte keine künstlerischen Bedürfnisse, die gab es bei mir nicht. Ich habe mal als Pförtner in einer Molkerei gearbeitet. Da habe ich immer so für mich hin gezeichnet. Da gab es auch Durchschlagpapier, das war ein interessantes Material. Das habe ich, während ich da saß, bearbeitet. Die so entstandenen Bilder habe ich sogar mal auf einem internationalen Jazzfest in Peitz, einem Jazzort in der DDR, ausgestellt. Ich hatte aber nie Ambitionen zu malen. Wohl gibt es ein Malen, das des gemeinsamen Malens, das für mich sehr interessant war. Es geht nicht darum, ein Bild zu malen, sondern darum, Dinge untereinander zu klären. Ich habe mit verschiedenen Malern so aus Spaß zusammen gemalt. Es gibt dabei auch einen psychologischen Hintergrund; man klärt Situationen untereinander. Genau in demselben Sinne bin ich auch kein Musiker. Mich interessiert gute Musik, aber ich möchte nicht selbst Musiker sein. Die Zusammenarbeit mit Musikern interessiert mich jedoch wieder. Beim Schreiben ist das eben anders. Ich glaube, daß ich nur existiere, wenn ich schreibe.
Visser und Erp: Auf welche Weise entstehen Deine Texte? Wurzeln in Deinen Prosatexten, wie z.B. in Totenreklame, andere Grunderfahrungen als in Deinen Gedichten, oder bedeuten die Texte im zweiten Band, also Totenreklame, eine Erweiterung der Formexperimente, die sich im ersten Band nur im Gedicht manifestieren?
Anderson: Killersatellit und Totenreklame sind sehr unterschiedliche Konzepte. Der Band Killersatellit ist vom Verlag konzipiert worden, und Totenreklame ist ein Konzept, was sehr an der Bewegung durch das Land, durch die DDR, haftet. Als ich anfing, durch die DDR zu reisen, mit meinem Freund Kerbach, wußten wir nicht, was passieren würde. Wie wichtig können uns Landschaften, Bäume oder Materie im Leben werden. Schließlich hat sich herausgestellt, daß doch die Menschen, die man traf, viel wesentlicher waren. Die haben viel stärker Geschichte und Gegenwart zusammengefaßt als ein Stein, der dann nur eine Metapher ist für Geschichte, Gegenwart oder Zukunft.
Es sind also zwei sehr unterschiedliche Bücher. Was ähnlich an ihnen ist, ist, daß ich die Form jedes Buches, was ich mache, als Konzept begreife. Dieses Konzept wird in der Form des Buches umgesetzt. Daß die Texte in Totenreklame Prosa sein sollen, habe ich nicht so verstanden. Das wäre auch nicht die für mich akzeptable Prosaform. Ich glaube eher, daß es ein Konglomerat aus Lyrik, Essayistik und Prosatechniken ist, weil es mir in dem Band auch mehr ums Sprechen als ums Verdichten ging. Für mich ist es keine Prosa. Im nächsten Jahr kommt beim Rotbuch Verlag ein Band mit drei Erzählungen und drei Gedichtzyklen heraus. Ich glaube, daß das dann wirkliche Prosa ist.
Visser und Erp: Deine Lyrik knüpft sehr stark an den Expressionismus bzw. Dadaismus an. Hat das Formgründe oder identifizierst Du Dich mit dem Weltbild dieser Strömungen?
Anderson: Ich würde gerne wissen, welches Gedicht…, also doch, die bla-Texte, l-Texte, das stimmt. Als ich diese Texte im Killersatellit geschrieben habe, habe ich natürlich Breton gelesen. Dann habe ich auch tatsächlich die Zeichen Bretons verwendet, nicht, um wie Breton zu schreiben, sondern um zu zeigen, daß das mit Breton zu tun hat. Ich hätte genauso gut den Buchstaben m benutzen können und damit die Quelle verdecken, verschlüsseln können.
Visser und Erp: Es wird aber auch in anderen Gedichten deutlich, z.B. durch die Wortreihungen, die Simultaneität, die Chiffrierung, das Spiel mit den Sinnelementen, die starke Bedeutung der Farben, vor allem gelb…
Anderson: Grün…, ja, Farben spielen eine große Rolle. Weniger aber in bezug auf den Dadaismus, als daß ich mit Malern zu tun habe. Durch Brechungen und das Zerreißen von Worten ist mir bewußt geworden, daß das Wort gerade nicht zerreißbar ist. Ich habe das Wort zerrissen und ein hermetisches Textgebilde in dieser Rechteckform hergestellt, um zu zeigen, daß alles zusammengehört. Es ist alles eins. Ich glaube, daß „die zusammenhänge sind einfach“ (Killersatellit) das bezeichnendste Gedicht in diesem Band ist. Das war tatsächlich der geistige Stand der Dinge. Ich bin aufgewachsen mit der Dialektik in der Muttermilch, und damit mußte ich klarkommen. Ich bin kein Mensch der großen Dialektik, aber ich weiß, daß es eine bestimmte Grundlage gibt, von der aus ich dann auch wieder ,schwarz und weiß‘ sagen kann. Mit Dada und Surrealismus habe ich jedoch sehr wenig zu tun. Eher noch mit der Malerei des Surrealismus, die ich aber auch viel früher ansiedle als die Surrealisten.
Visser und Erp: Die Autoren und Maler des Dadaismus arbeiteten auch sehr eng zusammen. Sehr oft war ein Maler auch Autor und umgekehrt…
Anderson: Das stimmt. Die Zeit des Dada, also die Zeit der 20er Jahre, ähnelte sehr den 70er Jahren in der DDR-Kultur. Das sind aber die gesellschaftlichen Realitäten. Es kommt nach einer bestimmten expressiven Zeit in der Kunst wieder eine manieristische Phase. Viel mehr als vom Dadaismus und Surrealismus kenne ich das von der Zeit des 16. und 17. Jahrhunderts in England. Es gab damals in London einen ungeheuren expressiven Dichterkreis, der dann von Shakespeare manieriert wurde. Shakespeare ist der Berühmte geworden; die Expressionisten sind in diesem Falle untergegangen. Die Chance der Expressionisten Anfang dieses Jahrhunderts war ja nur, daß sie gemeinsam gearbeitet haben. Sie wären sonst untergegangen, von den Manieristen geköpft worden. Ich sehe also mehr in einem gemeinsamen parallelen Arbeiten und möchte dieses parallele Arbeiten auch veröffentlichen. Öffentlichkeit ist, zu zeigen, in welchem Kontext man steht, lebt und existiert. Ich habe also keine sehr großen Einflüsse gehabt. Für mich sind John Donne und Shakespeare viel wesentlicher. Gerade in Totenreklame geht es ja zum Teil sogar um Manierismus. Ich habe natürlich Trakl und Heym gelesen, ich habe die Expressionisten gelesen, aber nie so, daß sie mir so wichtig geworden wären wie andere. Die frühen Russen sind mir viel bedeutender. Die kann ich auch viel eher zitieren. Das einzige, was ich vom Surrealismus weiß, ist der Buchstabe l von Breton. Ich habe nichts anderes mehr im Kopf davon. Ich kenne ein paar Bilder von Max Ernst. Ich kenne natürlich Bilder. Die sind mir eher haften geblieben als die Literatur.
Visser und Erp: Zum Avantgardismus gehört der Begriff Innovation. Inwieweit würdest Du Deine Lyrik als avantgardistisch oder neo-avantgardistisch betrachten und worin liegt für Dich persönlich das Neue Deiner Texte?
Anderson: Wenn man im Alter von 16 Jahren wüßte, was Avantgardismus ist, dann wäre man mit 16 avantgardistisch. Dann wäre man mit 18 neoavantgardistisch und dann ist man mit 20 darüber hinaus. Das Wort Avantgarde ist durch seine Behandlung deformiert worden. Ich kann mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Avantgardismus ist für mich eine Pubertät, inhaltlich eine Pubertät. Es ist für mich Kindertheater, aber nicht Theater für Kinder. In meinen Texten sehe ich auch nicht so viel Neues. Die einzige Chance, die ich habe, ist, daß ich nach Brecht oder nach x anderen Autoren, die schon alle tot sind, lebe. Aber neuer, als daß ich spät lebe, bin ich nicht. Es gibt ein paar Aussagen, die aus einer bestimmten Situation kommen, und die kann man nur formulieren, weil man in eben dieser Situation lebt. Ich beschränke das immer sehr auf meine eigene Situation. Ich habe nämlich Angst davor, daß ich über das, was ich sinnlich wahrnehme, hinausgehe. Das halte ich für expansiv. Das hängt auch mit dem Wort Expressionismus zusammen. Ich halte das für okkupierend, für aggressiv, für expansivisch. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn ich diese Malerei sehe. Von den hundert oder von den tausend, die zur Zeit malen, bleiben zwei oder drei.
Visser und Erp: Welchen Einfluß hat die Malerei des Manierismus auf Dich? Ist es der Spiegel von Parmigianino als Verformer des eigenen Ichs oder der Wirklichkeit, oder spielen für Dich auch die Schönheitsideale des Manierismus eine Rolle?
Anderson: Ich habe 1978–1979 Gustav René Hocke gelesen. Das war für mich das Standardwerk, und ich habe es sehr gut verstanden. Für mich war wesentlich, daß in einer bestimmten Phase gesellschaftlicher Dekadenz eine hochmanieristische Kunst am Werke war. Es gibt für mich das Wort Perversion nur im Verhältnis zwischen Kunst und Leben. Der Zwischenraum, der in bestimmten Situationen entsteht, ist für mich ein perverser Zwischenraum, in den ich Begriffe wie Manierismus und Dekadenz fügen kann. Ich mag die Manieristen in der Malerei sehr, aber es gibt Unmassen von Manieristen, das habe ich gerade in Italien gesehen… Eine scheußliche Malerei, schauderhaft, unglaublich schlecht gemalt und einfach nachgemalt. Es gibt jedoch für mich wichtige Leute, z.B. Athanasius Kircher, Raimundus Lullus – der immerhin im 13. Jahrhundert gelebt hat –, die für mich viel eher Manieristen sind. Am Manierismus war für mich interessant, was mit der Schrift im Bild geschieht. Die Schrift im Bild war für mich immer ein Teil der ganzen Manieristenkunst. Dieses tatsächliche Wurzeln im Orient, das Orientalische, auch das orientalische Denken, also: die Schrift im Bild.
Dann, in zweiter Linie, habe ich erst Leute wie z.B. Parmigianino oder Greco in Reproduktionen gesehen. Ich bin zuerst auf die Schrift im Bild gestoßen, auf das Wesentliche. Parmigianino war also nicht unbedingt derjenige, von dem ich sagen könnte, das ist der Maler. Da kann ich ganz andere nennen. Botticelli z.B., oder Greco, das sind Maler, die mir ganz wichtig sind.
Visser und Erp: Von Parmigianino gibt es aber dieses Selbstporträt im Spiegel, wodurch das Ich, die Ichfigur, verformt wird, sowie…
Anderson: Das hatte ich jedoch nicht gesehen. Ich hatte nur Reproduktionen gesehen, ich bin deformiert worden. Ich wußte, daß ich ein manieristisches Bild der surrealistischen Gesellschaft DDR bin. Ich hatte keinen Parmigianino gesehen, ich hatte Peter Graf gesehen. Das ist ein Dresdner Maler, der einen Selbstbildnispapagei in den Spiegel gemalt hat. Das war für mich das Erlebnis. Diese Bezüge. Es gibt einen malenden Berliner Filmer, der sich damit sehr gut auskannte und zum Lehrer dieser ganzen Generation von Peter Graf, Peter Hermann Penck, Jürgen Böttcher u.a. wurde.
Ich hatte keine Originale gesehen, ich habe von Reproduktionen gelebt. Mir ist es genau an der Stelle bewußt geworden, daß ich von Reproduktionen lebte. In meinem Elternhaus gab es impressionistische Bilder, dann erlebte ich in Dresden die expressionistischen Bilder. Von den Malern, die diese expressiven Bilder malten, erfuhr ich, daß es auch Manieristen gibt. Ich habe mir die Bücher besorgt und mir die Bilder in Reproduktionen angeguckt. Da merkte ich, was eigentlich mit mir los war, daß ich diese Bilder gar nicht im Original sah. Ich merkte also durchaus, daß ich in einer Zeit lebe, in der die Gesellschaft dekadent und deformiert ist. Es gab Affinitäten zwischen der manieristischen Kunst und der Gesellschaft, in der ich gelebt habe. Ich würde das jedoch nicht, wie Kolbe, als Ausnahmezustand bezeichnen. Dann müßte ich sagen, daß der ganze Manierismus Ausdruck eines Ausnahmezustandes ist. Das kann ich nicht machen. Ausnahmezustand ist eine Perspektive von außen…
Visser und Erp: Inwieweit spielen wortspielerische Elemente für Dich eine Rolle? Reflektieren Deine stilistischen ,Eigen‘-artigkeiten ein Suchen nach Zusammenhang?
Anderson: Ja, aber der Zusammenhang liegt woanders als in der Frage. Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen spielt für mich eine Rolle. Ich habe mit Papenfuß zusammengearbeitet, und wir haben ein Stück geschrieben „Flucht nach vorne“. Mit Papenfuß und Stefan Döring habe ich eine Oper geschrieben, Dolorosa überhaupt, eine Wagnerbearbeitung. Ich habe damals sehr gerne gespielt. Im Killersatelliten habe ich auch gespielt, aber immer im Kontext zu dem, was andere schrieben. Wir haben auch zusammen Gedichte geschrieben, sind herumgefahren und haben Lesungen gemacht, und wir haben viel miteinander gesprochen. Ich brauchte das Schreiben in der Form eines anderen, um die Möglichkeit zu haben, mich mit dem anderen zu identifizieren. Über die mir fremde Form habe ich das andere kennengelernt, und indem ich das machte, was ein anderer macht, habe ich verstanden, was ein anderer macht. Es ist also ein ganz anderer Zusammenhang, als daß ich gerne Wortspiele mache. Eigentlich interessieren mich Wortspiele nicht. Jeder hat so kleinste Einheiten, über die er nicht hinausgeht. Das ist bei mir eigentlich der Satz. Aus Subjekt und Prädikat bestehend, kleiner kann ich es nicht. Ich kann nicht in das Wort gehen. Das Wort kann ich nicht aufbrechen.
Visser und Erp: Du erwähntest soeben Deine Zusammenarbeit mit Papenfuß…
Anderson: … ja, Papenfuß halte ich für den wesentlichsten Lyriker meiner Generation. Er ist ein Erneuerer des Denkens, des lyrischen Denkens, ein ganz wichtiger Mensch.
Visser und Erp: In der Lyrik Deiner ersten beiden Bände gebrauchst Du keine Interpunktion. Verbindest Du der Gedanken „denn der punkt am ende ist nach zwei der menschlichen seiten offen“ (Killersatellit) mit diesem Vorgehen? Warum gibt es in Waldmaschine wohl Interpunktion?
Anderson: Ich habe sehr spät die Punkte und Kommas entdeckt, das stimmt. Ich glaube, in Totenreklame sind Punkte und Kommas vorhanden…
Visser und Erp: Aber nicht in der Lyrik…
Anderson: Nicht in der Lyrik, das stimmt. Erst dachte ich, daß der Vers das Wesentliche für mich war. Das war er aber nicht, es war der Satz. Zu sehen, daß man innerhalb dieses Satzes wieder mit Interpunktion etwas anfangen kann, war für mich eine Entdeckung. Ich setze meine Interpunktion teilweise außerhalb der Gesetze der deutschen Grammatik, also nicht so, wie die Grammatik es vorschreibt. Erst sehr spät, als mir der Satz wesentlicher wurde als der Vers, habe ich Punkte, Kommas, überhaupt Satzzeichen entdeckt. Der Vers ist für mich ein Teil des Satzes. Ich ziehe, glaube ich, doch immer den ersten Satz über den ersten Vers hinaus. Auch in den Sonetten habe ich dann angefangen, Langzeiler zu schreiben. Das hängt einfach damit zusammen, daß ich einen langen, grammatisch verdrehten Satz benutzt habe, um Polysemantik herzustellen. Die war für mich eindeutiger als das Arendtsche. Ich könnte Arendt auch in Langversen ausdrücken. Es ist für mich ein kleingemachter Langvers; der Langvers wird zu Kurzversen gemacht. Bei Arendt hat das eine Bedeutung; er hat Zeitebenen hineingebracht, Zeit und Raum versetzt in Kurzverse, dort hat es einen wirklichen Sinn. Was ich aber sonst an junger Lyrik lese, immer zwei Worte auf einer Zeile, hat bei mir irgendwann aufgehört, Bedeutung zu haben.
Visser und Erp: Durch Deine spezifischen Textformen, den Gebrauch des Wortenjambements, Verrätselung mittels einer gebrochenen Syntax, wird der Mitteilungscharakter Deiner Gedichte belastet. Ist das als Widerspiegelung der Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Menschen in der modernen Gesellschaft zu verstehen?
Anderson: Nein, das glaube ich nicht. Sprache hat immer noch alle Möglichkeiten der Verständigung. Sprache ist ein so weites Feld und von so vielen Sinnen erfaßbar. Ich glaube, daß sie auch noch alle Möglichkeiten der Kommunikation bietet. Sie ist dafür nicht weniger geeignet als vor 400 Jahren. Es gibt bestimmte Gründe, einen Text formal so zu schreiben, daß ihn nicht alle verstehen. Wenn ich z.B. eine Fremdsprache verwende, nicht unbedingt Zitate, sondern Zeilen, die ich im Englischen aufschreibe, dann ist das eine Privatisierung des Textes. Das hat einen Grund: Das sollen einfach nicht alle verstehen. Das zeigt eine, natürlich etwas erzwungene, Ebene des Gedichts an. Ich nehme nämlich das Gedicht von der großen Öffentlichkeit weg. Das ist eine Demonstration. Wenn man das als Demonstration begreift, kann man das Gedicht auch wieder verstehen. Man muß akzeptieren, daß ein Gedicht kein ,an alle‘, nicht der Satz Lenins ist, sondern eine Privatangelegenheit. Wenn man akzeptiert, daß Gedichte privat sind, sind sie jedem verständlich. Das hängt natürlich überhaupt nicht nur mit Literatur oder mit Kunst zusammen, sondern das ist insgesamt im Leben so. Eine Distanz zu einer privaten Angelegenheit bringt viel eher Verständnis als ein Hinterfragen, ein Öffnen der Metaphern.
Visser und Erp: Ein anderes Beispiel aber sind die „Ans-Gedichte“ aus dem Band Killersatellit. Davon hast Du gesagt, daß sie eigentlich auf Niederländisch veröffentlicht werden sollten, weil das Publikum sie nicht verstehen sollte. Der Verlag hat dann nur das Gedicht „litteken“ deutsch und niederländisch in den Band aufgenommen, die anderen aber sind deutsch veröffentlicht. Wenn diese Texte so privat waren, warum wolltest Du sie dann doch herausgeben?
Anderson: Weil ich doch glaube, daß alles, was Menschen machen, völlig egal was, daß alles, was sie tun, als Angebot für eine Öffentlichkeit gesehen werden sollte. Alles ist eine Möglichkeit anderer, sich zu beteiligen, sich zu interessieren. Nichts, was einer macht, ist ein Geheimnis. Es gibt keine Geheimnisse.
Visser und Erp: Du hast aber bestimmt auch Texte geschrieben, die Du nie veröffentlichen würdest…
Anderson: Ja, die schmeiße ich weg. Ich habe einige tausend Gedichte geschrieben, die ich sicherlich nicht veröffentlichen werde. Über das Verhältnis zwischen dem Privaten und der Öffentlichkeit muß ich noch einmal nachdenken. Mir ist das nicht ganz klar. Vielleicht bin ich nur in dem Verständnis aufgewachsen, daß ein Dichter ein Dichter und alles, was er macht, für die Öffentlichkeit ist, auch das Privateste. Ich gebe immerhin anderen Menschen die Möglichkeit, an dem teilzunehmen, was ich denke. Ich erwarte das in jeder anderen Form auch von anderen Menschen. Vielleicht ist meine Art, etwas zu veröffentlichen, verbunden mit der Erwartung, daß andere sich veröffentlichen. Egal in welcher Form. Ich habe Problematiken in dem, was ich sage, auch wenn ich es nur einem einzigen Menschen sage. Die Form eines Gedichtes bringt diese Problematik wundervoll zutage. Das Gedicht ist für mich von der Form her die identischste Gestalt der Problematik, über die man spricht, die einen bewegt; die Klärung mit jemand anders. Ein Gesicht auf einem Bild ist immer ein privates Gesicht, aus dem Gedächtnis des Malers oder direkt vom Modell. Es veröffentlicht immer ein total privates Verhältnis des Malers, und alle akzeptieren es als Bild.
Visser und Erp: Die Metapher ,Schnee‘ wird von Dir in verschiedenen Kontexten gebraucht. Einerseits verbindet sie sich mit Kälte und Spuren, andererseits will Dein lyrisches Ich selbst Schnee sein. Dafür ein Zitat aus dem Gedicht „die zusammenhänge sind einfach“ (Killersatellit): „es bleibt ein rest von mir / schnee von mir & die anderen / denken nicht mehr als wirklich ist / an meinem grab“. Personifizierst Du Dich oder sogar die Welt mit diesem Zustand? Warum die Beschäftigung mit dem Motiv ,Schnee‘, ,Kälte‘?
Anderson: Ist es van Gogh, der mal gesagt hat, das Bild ist eine Erfindung des Nordens? Der Süden ist so farbig, daß er keine Bilder braucht, in dem Sinne, wie der Norden sie braucht. Der Schnee ist ein sehr nördliches Motiv. Ich weiß auch, woher ich komme und was Schnee ist. Schnee ist Wasser, es ist ein Bild von Wasser. Schnee ist ein ungeheures Bild für ganz, ganz vieles, überhaupt die Farbe Weiß. Dieser Zustand, die Materie Schnee, ist etwas ganz Wesentliches in meinem Leben. Ich bin mit Schnee großgeworden. Man hat ja mit Schnee das erste Mal eine Veränderung von Landschaft wahrgenommen. Ich merkte vielleicht nicht als erstes, daß ein Herbst auf einen Sommer folgt, sondern der Bruch ist erst deutlich, wenn man weiß, daß ein Winter kommt. Erst wenn der Winter da ist, nimmt man wahr, daß es einen Herbst gegeben hat. Ich kenne eine wundervolle Zeile über Schnee von Peter Orlowski, die ich sehr früh gelesen habe: „Er winkte zum Abschied und verlor den Arm im Schnee“. Das hat mich sehr beeindruckt. Diese Zeile habe ich nicht bei Orlowski im Original gelesen, sondern zitiert von Ginsberg in seinen Tagebüchern, wo er über Orlowski spricht: Selbst das ist noch ein Bild für eine Art meines Denkens. Ich weiß gar nicht, wie wichtig mir jetzt Schnee als Wort, als Metapher noch ist.
Visser und Erp: Andere, häufig auftretende Symbole sind Bäume, Wald, Wolken und Wasser…
Anderson: Ja, wie kommt es, daß die Elemente immer wieder auftreten? Ich kann da gar nichts zu sagen. Man müßte mit einem Psychologen darüber reden.
Visser und Erp: In dem Band Waldmaschine spielen Traum- und Hypnosemotive eine Rolle. Ist das ein Anknüpfen an den Surrealismus?
Anderson: Es gibt für fast jeden Text, den ich geschrieben habe, einen Grund. Wenn ich mich beim erneuten Lesen eines Textes noch an den Grund des Schreibens erinnern kann, dann akzeptiere ich den Text, ohne daß ich diesen Grund veröffentlichen muß. Ich kenne Tausende Gedichte von mir, wo ich den Grund nicht mehr weiß.
Visser und Erp: Beim 77. Mann in Waldmaschine schreibst Du:
schlaf ein. verweigere dich nicht. wähle nicht. entwaffne dich und wage die gewaltsame trennung… schlaf ein. ich will dir deinen traum erzählen…
Anderson: Ich merke schon, daß ich vor zwanzig Jahren Freud gelesen haben muß. Das hat aber gar nichts damit zu tun. Das ist ein Knasttext, ein Text, den ich nur aus der Situation des Gefängnisses heraus habe schreiben können. Dieses absolut In-sich-Fallen, bis man sich auflöst in seine eigene Negativform. Das hat mit dem Gefängnis in der DDR zu tun. Träume spielen im Gefängnis eine sehr große Rolle. Gesprochen wird immer nur über das Draußen. Geträumt wird aber nicht immer von draußen. Plötzlich sind die Figuren, von denen man träumt, im Gefängnis. Psychologisch bin ich mir nicht ganz klar darüber, aber wenn zwei Menschen sich im Knast unterhalten, dann sprechen sie von draußen. Wenn man im Knast träumt, träumt man das Draußen im Drinnen. Um weiterleben zu können, auch über diese Zeit hinaus, muß man mit dieser Situation, diesem Drinnen und Draußen, klarkommen, ein Verhältnis dazu haben. Dafür spielen Träume eine sehr große Rolle. Auch muß man den Unterschied kennen zwischen Traum, Sprache und Situation. Das hat mit Hypnose wenig zu tun.
Visser und Erp: Die Formulierung, die Du verwendest, erinnert doch aber sehr stark an eine Herbeiführung des Schlafes durch einen Hypnotiseur…
Anderson: Traum im Knast ist die einzige Vereinigung von Drinnen und Draußen. Drinnen ist Arbeit und Fertigwerden mit dem, der einen in die Fresse hauen will und umgekehrt. Draußen ist alles, was in der Sprache, im Gesprochenen ist. Drinnen und Draußen gibt es nur im Traum zusammen. Deswegen lasse ich den 77. Mann bitten, „schlaf ein“, damit es endlich zusammenkommt. Das Hypnotische daran ist der Gestus, mit dem gesprochen wird. Das Metrum assoziiert Hypnose.
Visser und Erp: Welche Haltung nimmst Du gegenüber dem häufig geäußerten Vorwurf ein, daß aus der Lyrik Deiner Generation eine Art Untergangsstimmung besonders fühlbar wird? Inwieweit spielt für Dich der Gedanke an Zerstörung und Vernichtung eine Rolle?
Anderson: Spielt keine Rolle. Das interessiert mich nicht. Ich kenne keine für mich interessanten Texte, die Untergangsstimmung suggerieren. Ich kenne sehr viele alles negierende Texte. Das sind aber nicht die, die mir wichtig sind.
Visser und Erp: Aber eine Art Verzweiflung hinsichtlich bestimmter Probleme…
Anderson: In Zeiten, wo die Verzweiflung in der Literatur keine Rolle spielt, ist sie aus der Literatur ausradiert worden. Da sind die Literaten von bestimmten Situationen hypnotisiert worden. Verzweiflung spielt immer eine Rolle, in jeder Gesellschaft, in jeder Zeit, die ich literarisch überblicke. Ich kenne nur Zeiten – sie werden in der Literatur auch dokumentiert –, die im Verhältnis zu den Katastrophen der Zeit stehen. Die wesentlichen Texte verbreiten jedoch weder Untergangsstimmung, noch sind sie negierend. Nicht einmal bei Beckett…
Visser und Erp: Und der Vorwurf der mangelhaften Teilnahme oder des mangelhaften Interesses am Weltgeschehen?
Anderson: Am Nichtbeteiligtsein am Weltgeschehen? Das ist keine Frage des Interesses am Weltgeschehen, sondern eine Art der Beteiligung am Weltgeschehen. Das ist in der DDR natürlich ein sehr dubioses Beteiligtsein, aber es macht auch bewußt, wie wenig man am Weltgeschehen beteiligt ist, und das produktiviert tatsächlich.
Visser und Erp: Würdest Du von Dir selbst sagen, daß Du politische Gedichte schreibst?
Anderson: Ja, das akzeptiere ich. Politik ist ein Teil meiner Texte, selbst die Politik, die ich nicht mag, die offizielle z.B.
Visser und Erp: Wie schätzt Du das Problem des Generationskonfliktes, der von der offiziellen Seite der DDR negiert wird, ein?
Anderson: Einen Eltern-Kind-Konflikt gibt es immer, das ist ein grundlegender Antagonismus, aber einen Generationskonflikt in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt vielmehr einen ganz anderen. Die Generation unserer Eltern hat viel mit der offiziellen Politik zu tun, alle sind in irgendeiner Form Funktionäre. Beim jungen Künstler ist nun nicht das Schreiben der Grund eines Konflikts und auch ein Konflikt ist nicht der Grund fürs Schreiben. Die Konflikte entstehen erst, wenn man schreibt oder was macht.
Visser und Erp: Aus Deinem Gedicht „jeder satellit hat einen killersatelliten“ (Killersatellit) geht einerseits deutlich hervor, daß es eine einfache Wahrheit ,schwarz auf weiß‘ für Dich nicht gibt, andererseits aber bekommt dieser Satz dadurch, daß Du ihn als Titel dieses Bandes gewählt hast, eine zusätzliche, schwerere Bedeutung, etwa die Angst vor den Errungenschaften der modernen Welt, Angst vor Zerstörung – obwohl Du bereits gesagt hast, daß das keine Rolle spielt –. Auffallend ist aber doch auch Deine Auseinandersetzung mit dem Tod, die vielfache Verwendung der Todessymbolik, der Titel Totenreklame usw. Könntest Du dafür Deine Gründe nennen und Deine Antwort auf die anderen Ängste, z.B. die vor der Zergliederung der Zeit, vor dem Vorübergehen des Moments und vor Wiederholungen, die aus Deinen Texten sprechen, erweitern?
Anderson: Mein Verhältnis zum Tod ist ein ganz einfaches. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und nicht bei meinen Eltern. Dadurch habe ich wahrscheinlich ein viel bewußteres und einfacheres Verhältnis zum Tod. Als ich zwanzig war, starben meine Großeltern, beide in einem Jahr. Ich wußte, wie abhängig sie voneinander waren, sie mußten in einem Jahr sterben. Hätte ich mit meinen Eltern zusammengelebt, dann wäre mir das wahrscheinlich gar nicht so wesentlich geworden, wie es jetzt scheint.
Der Titel Jeder Satellit hat einen Killersatelliten ist einfach ein Symbol für den Stand der Dinge, für die Deformation des Begriffs Dialektik. Das kommt also mehr von Schweinedialektik und Hundephilosophie. Ich bin kein Fatalist, aber ich glaube, daß ich so realistisch bin zu wissen, daß sich die Dinge so entwickeln, wie sie sind. Wir können nichts dagegen tun, außer die Entwicklung so gut wie möglich zu stören. Das bedeutet nicht, sie zu zerstören, sondern in ihr Risse, Lücken zu schaffen. Ich fülle mit Sätzen nicht bestimmte Risse, sondern ich schaffe Risse, im Gegensatz zu Peter Hacks, der für mich nur Lücken füllt. Das ist auch der Unterschied zwischen Hacks und Müller. Der eine ist ein Lückenfüller, der andere ein Risseschaffer, Bewußtmacher.
Visser und Erp: Könntest Du noch etwas zu der Rolle, die die Zeit in Deinen Texten spielt, sagen?
Anderson: Jahre und Jahrhunderte spielen weniger eine Rolle als Sekunden und Stunden. Das hängt mit der eigenen Person zusammen. Ich kann eben nur zu dir schauen, wenn ich mit dir rede, und nicht in die Jahrtausende. Ich habe nur den Augenblick oder die Sekunde oder die Stunde und nicht Jahrhunderte. Ich weiß, daß ich eben nur 80 Jahre lebe. Mich interessieren auch die Jahrhunderte nicht. Mich interessiert auch von Shakespeare nicht, daß er 1600 gelebt hat. Mich interessieren die Sekunden, in denen ich den Satz von Shakespeare erfasse.
Visser und Erp: Die Aussage „die finger öffnen die faust“ aus dem Gedicht „ich wachte auf und sah meine hand“ (Killersatellit) könnte assoziiert werden mit dem Gedanken an die Kraft der Menschen (Finger) in der Gesellschaft (Faust). Die Menschen, aus denen eine Gesellschaft entsteht, sind imstande, die Gesellschaft zu verändern?
Anderson: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube sogar das Gegenteil. Die Gesellschaft wird irgendwann nicht mehr durch die Menschen gebildet, sondern sie ist nur noch eine Struktur, die mit Menschen arbeitet. Das ist das Gefährliche. Der theoretische Ausgangspunkt ist immer noch, daß eine Gesellschaft aus Menschen besteht. Sie besteht aber aus einer Ordnung, die mit Menschen arbeitet.
Hier ist die Hand ein Symbol oder ein Bild für die Natur. In dem Falle auch von menschlicher Natur, aber an ihren Ursprüngen, nicht vom Denken oder Konstruieren bestimmter Gebilde her. „die finger öffnen die faust“, das ist in der Natur so, aber nicht in der menschlichen Gesellschaft. Dort geschieht das Gegenteil. Dort ist alles in der Richtung zu spät. Wenn ich sage, die Menschen, aus denen, die Gesellschaft besteht, müssen sie verändern, dann ist es zu spät. Dann bin ich betrogen. Die DDR-Gesellschaft verändert sich natürlich auch, mit den und durch die Menschen, die in ihr leben. Aber die Menschen, die in ihr leben, bestehen nicht nur daraus, daß sie in ihr leben. Sie bestehen genauso aus ihren Utopien, Visionen, aus ihrer Kenntnis vom anderen Leben. Die Kenntnis des Anderen ist vielleicht eine viel größere Kraft als das Wissen, was man selbst, durch sich, an dieser Gesellschaft, in der man lebt, ändern kann. Die Position des Anderen zu begreifen, halte ich für wichtiger als identifiziert zu werden mit dem Gebilde, in dem man lebt.
Visser und Erp: Dein Mottogedicht des Satellitbandes, „lettern schwarz auf weißem grund“, wird von Literaturwissenschaftlern häufig als Dein poetologisches Programm zitiert. ,Schwarz auf weiß‘ hieße dann die quasi-absolute Wahrheit und ,grau auf grauem Grund‘ die subjektive Wahrheit des Dichters. Da ein Symbol sich aber auch buchstäblich lesen läßt, könnte der Gedanke entstehen, daß ,grau auf grau‘ sich aufhebt, ein Nichts entstehen läßt.
Anderson: Dann müßte man bei Gert Neumann über Klandestinität nachlesen. Wenn ich aber das Buch jemandem geschenkt habe, dann habe ich immer die ersten Zeilen weggestrichen. Der erste Teil ist eigentlich Ethologie. Ich lasse das eigentlich. Das interessiert mich auch nicht. Schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz oder grau auf grau, das sind Dinge, auf die man mit zwanzig hereinfällt. Das ist eine Sache, womit Bühnenbildner noch arbeiten können, aber Leute, die schreiben, nicht. Das sind alles Regieanweisungen für Bühnenbildner, die müßte ich aus dem ganzen Buch streichen.
Visser und Erp: Häufig wird dieses Gedicht aber mit Deiner Wahrheitssuche verbunden…
Anderson: Ja, das ist die Wahrheitssuche, die ich mit zwanzig hatte. Wenn Leute heute über meine Texte nachdenken, dann sollten sie über die Differenz zwischen meinen frühen und meinen späten Texten nachdenken und nicht versuchen, mich auf meine frühen Texte festzunageln. Denn es gab tatsächlich, nicht nur bei mir, das Theoretisieren im Gedicht. Das Gedicht wurde als Form verwendet, um Theorien zu verbreiten. Man hat die Theorie des Gedichts im Gedicht selbst verpackt. Das ist uneffektiv. Das nutzt dem, mit dem man spricht, eigentlich nichts. Das sind zwei verschiedene Dinge. Kreative Spaltung, kreative Schizophrenie wäre mir da lieber als ein Gedicht, worin alles steht, auch noch die Theorie des Gedichts. Wenn jedes Gedicht auch noch die Poetik verkündet, nach der es geschrieben wurde, dann wird es einfach langweilig.
Visser und Erp: Warum ist die Entlarvung der verschiedenen – nennen wir es mal ,Jargons‘ – der deutschen Sprache so wichtig für Dich? Hierbei ist an Märchen- und Liedelemente, Sprichwörter, Klischeedialoge der Alltagssprache usw. zu denken. Inwieweit ist das ein Suchen nach der eigenen Sprache?
Anderson: Nein. Das kommt einfach daher, daß ich bei der Wahrnehmung von Sprache recht sensibel bin. Ich höre sehr gerne Menschen sprechen. Immer, wenn man an einem Tisch sitzt, sagen andere einem nach zwei Stunden, Mensch, sag doch auch mal was. Ich habe aber schon alles gesagt, indem ich zugehört habe. Wenn ich irgend etwas lese oder höre, z.B. Leber, Gehirn und Nierchen, dann ist das so etwas Irres für mich, das setze ich so um. Das ist so was Absurdes, was Schönes aber auch. Das sind einfach Zitate des Lebens, der Sprache. Zitate sind Material, was ich ungeheuer schätze. Das ist ein Teil meiner Substanz. Das wird man bei Hölderlin, wenn er Schwäbisch anfängt zu dichten, genauso finden. Deshalb streichen sie heute bei schlechten Ausgaben von Hölderlin immer sein Schwäbisch.
Ein Teil der Sprache, die ich spreche und höre, die für mich Material ist, war eben, ehe ich dazu kam, daß Sprechen selbst eine Form ist, gesprochene Sprache. Sprechen im geschriebenen Text ist nicht bloß Sprache, sondern auch Sprechen. Dazu braucht man schon eine Weile. Man spricht so vor sich hin, bis man merkt, daß Sprechen eigentlich etwas ist.
Visser und Erp: Auffallend in Deinen Texten ist die Verbindung zwischen Sprache und Tod. Als Beispiel könnte man den 52. Mann in Waldmaschine nennen: „DU, WIRST SPRECHEN, STERBEN WÄHREND DU SPRICHST“.
Anderson: Ja, das ist genau die Mitte des Stückes. Da sprechen 100 Männer und etwa vom 50. ab merken die, daß sie, wenn sie sprechen, sterben, und sie hören dann nicht mehr auf zu sprechen. Das Sprechen selbst wird ein Bild des Sterbens bzw. des Nicht-sterben-Wollens. So geht es in fast allen meinen Büchern um das Verhältnis zum Tod, d.h. der Tod hat ein besonderes Verhältnis zu mir. Der 52. Mann kommentiert dann die Situation. Das heißt aber nicht, daß sich sein eigener Tod im Kommentieren der Situation auflöst. Es ist der Wille, seinen eigenen Tod aufzulösen, indem man ihn ausspricht. Ich bin da also wieder sehr realistisch.
Visser und Erp: Liegt darin auch eine Verbindung zu dem Stück Kaspar von Peter Handke? Auffallend ist doch, daß wir vom 52. Mann auch noch Folgendes erfahren:
du dachtest, du würdest ein anderer, […] der du nie gewesen bist
Dieser Satz könnte den Worten Kaspars gegenübergestellt werden, die wie folgt lauten:
Ich möcht ein solcher werden wie einmal ein andrer gewesen ist
Bei Handke liegt der Schwerpunkt darauf, daß einer dadurch, daß er zuerst mal vorgesprochenes Sprachmaterial nachspricht, zum freien Sprechen gebracht wird. Bei Deinem Stück ist es dann eigentlich umgekehrt; dadurch, daß man spricht, stirbt man.
Anderson: Das, was Handke da geschrieben hat, glaube ich nicht. Handke schreibt sehr viel. Man müßte wahrscheinlich erst mal eine wissenschaftliche Ausgabe von ihm machen, um die paar Aussagen zu finden, die er wirklich macht. Ich habe Handke gelesen, aber das Buch habe ich nicht gelesen. Der Handke schreibt vielleicht in Wirklichkeit über das 19. Jahrhundert, obwohl er seine Figuren im 20. Jahrhundert ansiedelt. Ich könnte meine Figuren auch im 15. Jahrhundert ansiedeln und würde trotzdem über das 20. schreiben. Ich habe das Gefühl, Handke sei auch so einer, der über Cézanne so irres Zeug erzählt hat. Ich glaube in Über die Dörfer [muß sein: Die Lehre der Sainte-Victoire], da ging es um Aix-en-Provence. Er erzählt da pure Kacke. Von bildender Kunst keine blasse Ahnung. Nichts weiß er von Cézanne, nichts weiß er von bildender Kunst. Und die Leute reden und reden. Schöne Sätze reden sie, aber alles 19. Jahrhundert. Cézanne hat auch im 19. Jahrhundert gelebt, nicht?
Visser und Erp: In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung hast Du gesagt, daß Deutschland für Dich nie eine Rolle gespielt hat, weil Du nur die eine Hälfte von Deutschland kanntest. Wie ist dann die Suche nach der deutschen Geschichte und Dein Anknüpfen an z.B. Heines Wintermärchen in dem Band Totenreklame zu verstehen?
Anderson: Ich mag Heine einfach so sehr. Vielleicht spielt nicht das, was er schreibt, eine so große Rolle, sondern die ungeheuer überzeugende, schöne Art, in der er schreibt. Es gibt nicht nur das Heinesche Wintermärchen, es gibt auch das Biermannsche. Ich habe das einfach in sechs oder acht Strophen drangehängt. Es ist ja sehr kurz. Wenn ich wirklich ein Wintermärchen hätte schreiben oder da anknüpfen wollen, dann hätte ich ein ganzes Buch geschrieben. Dann wäre ich der Dritte, vielleicht auch schon der Siebente im Bunde gewesen.
Visser und Erp: Deine Reise durch die DDR ist in diesem Zusammenhang doch wohl auch nicht ohne Bedeutung?
Anderson: Ein Freund von mir ging in den Westen, hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Wir sagten uns einfach, wir müssen dieses Land noch mal ganz kennenlernen. Wir müssen das einfach mal ganz ausloten und sehen, was es uns wirklich bedeutet. Daß Deutschland keine Rolle spielt, hängt natürlich mit dem Theater zusammen. Deutschland ist für mich keine Figur. Es gibt die gespaltene Figur Deutschland, aber mit allen Chancen. Es ist für mich eine ungeheure Chance, diesen Zwischenraum zu figurisieren. Für mich ist der Zwischenraum eher eine Figur für Deutschland. Er drückt mehr aus als die zwei Deutschlands, die für mich doch bloß eine Suppe sind und keine Rolle spielen. Sie sind für mich eher ein Bühnenbild, der Platz, auf dem das deutsche Theater steht. Sie sind nicht die Figur, die in dem Stück, das ich gerne schreiben würde, eine Rolle spielen würden.
Visser und Erp: Und die Figuren aus dem 2. Weltkrieg, wie Hitler, Speer usw.?
Anderson: Die sind für mich zu Symbolen geworden. Ich kenne die nur als Symbole für irgend etwas. Aus alten Filmen, von Bildern, von dem, was sie gesagt haben, wie sie rezipiert wurden und wie ihre Aussagen in jeder Zeit deformiert wurden. Das Fehlen dieser Figuren in der bestimmten DDR-Realität drückt ja viel mehr über das Land DDR aus als ihr Vorhandensein in der Geschichte. Über das Land DDR sagt das Leben von Hitler wenig, aber sein Fehlen, seine Verdrängung aus der DDR-Gesellschaft, sagt sehr viel.
Visser und Erp: Doch drückt aber diese Reise durch die DDR und das Schreiben derartiger Texte (für die Waldmaschine) ein gewisses Suchen nach der Vergangenheit – und ich sage es doch einmal – nach Deiner Heimat aus…
Anderson: Ich suche überhaupt nicht nach der Vergangenheit. Ich bin nur ununterbrochen auf sie gestoßen. Es gibt Accessoires in der Gesellschaft, die sie gerne beseitigen würde. Aber indem sie sie beseitigt, stößt sie wieder auf ein anderes beseitigungswürdiges Accessoire. Irgendwann merkt sie dann, daß es ein ganzer Turm ist, und man schafft es nicht, ihn zu beseitigen.
Visser und Erp: In dem Band Waldmaschine ist der Aufbau auffallend: 100 Männer und ein Epilog mit weiblicher Altstimme. Warum hast Du diese Struktur gewählt und warum hat gerade eine weibliche Stimme die Epilogfunktion bekommen?
Anderson: In dem Buch ist ein Unglück passiert. Es hätte hineingeschrieben werden müssen, daß der Prolog von vier weiblichen Stimmen gesprochen wird. Das sind vier völlig getrennte Situationen, völlig getrennte Arten der Reflexion aus ganz verschiedenen Ebenen, mit ganz verschiedenen Lebens- und Bildvorstellungen, Existenzwünschen und -ängsten, und diese vier Frauen sind am Ende eine Frau. Am Anfang gibt es also vier Positionen, die vielleicht gar nicht Positionen sind, sondern bloß einfach Reaktionen. Am Ende ist eine tatsächliche Position die für mich entscheidende, nämlich die des Zwischenraumes. Das klingt sehr formal, aber ich brauche diesen formalen Halt, um diese Männer überhaupt sterben lassen zu können. Die sind ja irgendwoher gekommen, das waren Soldaten, die aus dem Krieg übriggeblieben sind, und nun liegen sie da. Wie tote Bäume hängen sie am Hang herum und quatschen. Hier ist ,grün‘ übrigens nicht mehr symbolisch, sondern im Prolog gibt es zwei verschiedene Grüns, die sich sehr ähneln: „da ist ein grün am ende / des krieges, selbst / das grün vom aas fällt / nicht aus dem bild“. Da bin ich endlich über das symbolische Verwenden der Farbe Grün hinausgekommen. Im Killersatellit ist das noch sehr direkt und manchmal sehr symbolisch. Gelb für Vergangenheit oder vor allen Dingen für Erinnerung. Das habe ich sein lassen. Das geht nicht. Ich bin auf die Malerei reingefallen. Ich habe nicht nur Glück mit ihr gehabt.
Visser und Erp: Warum sind es Frauen, die den Prolog und Epilog sprechen?
Anderson: Ich hätte gerne, daß die Männer nicht aus dem Krieg geboren wären, sondern tatsächlich auch noch Mütter haben. Der Chor spielt die Hauptrolle, und die Frauen spielen eigentlich die Chorrolle. Im Grunde müßten während des ganzen Stückes Frauen singen. Ich stelle mir das Stück von einer einzigen Frau gespielt vor, und das Publikum, das nur aus Männern bestehen dürfte, stirbt, einer nach dem andern, während diese Frau den Text spricht. Das wäre die ideale Inszenierung für den Sinn des Stückes. Auch ist dieses Stück der Versuch eines totalen Austausches der Bedeutungen. Dadurch, daß Dinge nacheinander gesprochen werden, bekommen sie miteinander zu tun. Tauschen sich die Dinge, die gesagt wurden, mit denen, die gesagt werden, und denen, die noch nicht gesagt sind.
Visser und Erp: Hast Du einmal daran gedacht, Musik in Dein Theaterstück einzubeziehen oder soll das ausschließlich Sprechtheater werden?
Anderson: Als Schreiber sind mir die anderen Elemente erst einmal völlig egal. Ich habe bestimmte Vorstellungen von dem Ort, an dem es spielt, aber wenn an diesem Stück auch Musiker und Maler mitarbeiten, was wahrscheinlich ist, da zu meinem Freundeskreis auch Musiker und Maler gehören, dann werden die sicher mit dem Stück etwas anfangen, werden sie auch ihren Teil dazutun. Ein Theaterstück ist eine Montage aus verschiedenen Medien, und beim Schreiben habe ich nur die Sprache, nichts anderes.
Visser und Erp: Du hast in letzter Zeit mehrmals den Wunsch nach Anonymität geäußert. Bist Du auf der Suche nach Isolation?
Anderson: Nein, nicht isoliert sein. Anonymität und Isolation sind auch zwei verschiedene Worte. Es hängt ganz konkret mit der Praxis in der DDR zusammen. In Weimar kennt jeder jeden und in Dresden kennt irgendwann jeder jeden. Wenn man nur ein bißchen mehr macht als die Norm, dann fällt man auf. Da gibt es diesen berühmten Fall von Hennecke, der die Norm gebrochen hat und nicht mehr davon weggekommen ist. Das soll mir bitte nicht passieren. Ich habe Angst davor, über der Norm zu stehen, davor, daß ich aus der Rolle, in die ich dann gedrängt werde, nicht mehr herauskomme. Das ist keine Qualität, sondern eine reine Quantitätsfrage. Vor dieser Verwechslung zwischen Quantität und Qualität habe ich Angst.
Visser und Erp: Siehst Du in der geplanten Zusammenarbeit mit Deinen Freunden aus der DDR, die größtenteils auch in West-Berlin wohnen, nicht die Gefahr, daß Dir wieder die Katalysatorfunktion zugeteilt wird, die Dir bereits in der DDR auferlegt wurde und von der Du Dich entfernen wolltest?
Anderson: Katalysator ist man immer in so einer Situation. Das ist man und man muß sehr sachlich mit dieser Funktion, in die man auch gedrängt wird, umgehen. Man wird aber nichts besonderes dadurch. Ich hoffe natürlich von jedem anderen, daß er für mich auch ein Katalysator ist. Das ist die Gleichberechtigung, die ich gerne hätte. In zehn Jahren werden wir wissen, was diese Zusammenarbeit, das Zusammenleben, gebracht hat.
Visser und Erp: In der DDR hattest Du auch eine Rockband, die Fabrik hieß. Mit diesem Namen verknüpft man leicht Gedanken an Vorgänge der automatischen Produktion, die doch im Gegensatz zu einem kreativen Prozeß stehen. Wie verhält sich diese Assoziation mit der Produktion Deiner Texte für diese Gruppe, aber auch für die Texte Deiner Gedichtbände?
Anderson: Das ist wirklich ganz kurios. Ursprünglich hieß die Gruppe Factory hoch vier. Das hatte durchaus einen manieristischen Hintergrund, die Zahl vier spielte eine Rolle. Ganz am Anfang hatten wir eine Combo, die Schwarz-Weiß-Combo. Danach hatten wir eine Gruppe, die Vierte Wurzel aus Zwitschermaschine hieß. Ja, das ist der Dadaismus. Wir kennen natürlich unseren Schwitters, oder war es Klee… Der Name Factory hoch vier, der das Gegenteil von Vierte Wurzel aus Zwitschermaschine war, war zu lang. Die Leute nannten uns immer nur Factory. Als Factory verboten wurde, hießen wir Sawot, das russische Wort dafür. Als Sawot dann nicht mehr ging, hießen wir plötzlich Fabrik. So kam es also, ohne daß es kommen sollte. Es hat überhaupt keinen größeren Hintergrund. ,Fabrik‘ ist auch so ein schönes, weiches Wort, das sagt gar nichts. Es sagt nicht immer etwas von Produktion. Vielleicht ist die Musik, die wir machen wollten, das Gegenteil von ,Fabrik‘.
Visser und Erp: Wie schätzt Du heute die Literatur in der DDR ein?
Anderson: Gerade in der Lyrik glaube ich in der DDR eine substantiellere Literatur zu sehen als in der westdeutschen Literatur. Einen großen Unterschied gibt es z.B. in der Kultur des Nachdichtens, des Übersetzens. Man kompensiert natürlich etwas, es wird viel ins Land hereingeholt, transportiert und transformiert. Diese Hochkultur des Nachdichtens gibt es in WestdeutschIand nicht. Die Leute dort fahren irgendwo hin, nehmen alles vom Leben her wahr, und dann macht einer eine Interlinearübersetzung und setzt den Originaltext daneben. In der DDR beschäftigt sich ein Dichter mit Texten fremdsprachiger Autoren sehr intensiv und das hat auch auf das eigene Dichten, das eigene Schreiben eine Wirkung. Also viel substantieller.
Deutsche Bücher, Heft 1, 1986
Was macht eigentlich Sascha Anderson?
– Der Mitbegründer der subversiven Dichterszene am Ost-Berliner Prenzlauer Berg wurde 1991 von Wolf Biermann als „Sascha Arschloch“ bezeichnet und als Stasi-Spitzel enttarnt. –
Dieter Krause: Wann hat Sie das letzte Mal jemand „Sascha Arschloch“ genannt?
Sascha Anderson: Lange her. Da wollte einer zeigen, daß er informiert ist.
Krause: Gelingen Ihnen seit 1991 noch lyrische Zeilen?
Anderson: Das ist kein Problem. Meine Lyrik ist nicht abgenabelt. Im Gegenteil. Von jedem Gedicht, das ich veröffentliche, weiß ich wenigstens noch den Grund.
Krause: Stasi-Spitzeleien in lyrischen Versen?
Anderson: Das Thema im Gedicht, vielleicht? Obwohl es nicht gerade meine favorisierte Begrifflichkeit ist. Die Wirklichkeit hat andere Normen als die Sprache. Das sieht man am Gesprochenen. Davon bleibt im Gedicht nur die Ebene des Desasters.
Krause: Wie viele Bändchen haben Sie seit der Wende veröffentlicht?
Anderson: Vier. Das letzte ist eine erweiterte Neuauflage von jeder satellit hat einen killersatelliten.
Krause: Welche Auflage?
Anderson: In der Regel 1.000 Exemplare. Die haben dann zehn Jahre Zeit, abzulagern.
Krause: Können Sie davon leben?
Anderson: Zum Glück kann man von Lyrik nicht leben. Und so soll es auch bleiben. Ich arbeite als Herausgeber und Layouter für verschiedene Verlage. Außerdem schreibe ich wieder Texte für Rockbands.
Krause: Sie waren seit 1975 Spitzel der Stasi, haben mehrere hundert Berichte geliefert. Trotzdem haben Sie zunächst versucht, alles abzustreiten…
Anderson: … das war ein Versuch, öffentlich Idiotie zu demonstrieren. Aber eigentlich ging es darum, einen Zusammenbruch zu verhindern. Auch Idiotie.
Krause: Sind Sie danach auf Ihre bespitzelten Freunde zugegangen?
Anderson: Nein, so einfach ist das nicht. Gerade ich gehe nicht irgendwo hin und sage: Guten Tag, ich hätte da ein paar Antworten, die alles erklären.
Krause: Fehlte Ihnen der Mut, oder waren die anderen schneller?
Anderson: Weder noch. Es war mal wieder Gründerzeit nach der Wende. Die ideale Bedingung fürs Verdrängen. Es ist nicht einfach, ohne Selbstzweifel und auch noch intelligent aus der Wirklichkeit auszusteigen.
Krause: Wie haben Sie Ihren Freunden den Verrat erklärt?
Anderson: Ich habe bis heute kaum Erklärungen, schon gar keine öffentlichen. So unterschiedlich, wie die Gründe sind, daß ich zur Staatssicherheit kam und blieb, so differenziert wird wohl auch der Weg aus dem Trichter heraus sein. Gläubigkeit, Voyeurismus, das Spiel mit der eigenen Existenz?
Krause: Ist das nicht pervers: am Abend Vortänzer in der subkulturellen Szene und am nächsten Tag beim Führungsoffizier?
Anderson: Das ,Wir‘ auf der einen Seite und die Überheblichkeit auf der anderen. Der Stasi gegenüber. Das ist vielleicht noch viel schlimmer, im nachhinein. Der Knast hat, zumindest mir damals, die Illusionen aus den Gedärmen getrieben.
Krause: Welches Wort haben Sie dafür – Verrat?
Anderson: Verrat ist das richtige Wort. Die Kunstszene hat das partiell anders gesehen, aber die Opposition hatte sicher nichts zu lachen. Es war ja auch Verrat an einem Ich, das ich immer noch ablehne.
Krause: Was hat von der Dichterkolonie im Berliner Prenzlauer Berg überlebt?
Anderson: Alles. Es sind alle noch da, nur älter.
Krause: Und abends trifft man sich im Torpedokäfer – der Kneipe für unangepaßte Dichter.
Anderson: So ist es. Ich habe meine Geheimnisse verloren und werde nicht mehr erkannt. Heute geht es nicht darum, ein Gedicht zu schreiben, sondern darum, es zu vermeiden.
Stern, 15.6.2001
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Gegner + U. K. + E. E. + noch einmal + Förräderi + Anatomie
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Robert-Havemann-Gesellschaft +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
Sascha Anderson antwortet auf die Standartfragen von faustkultur.


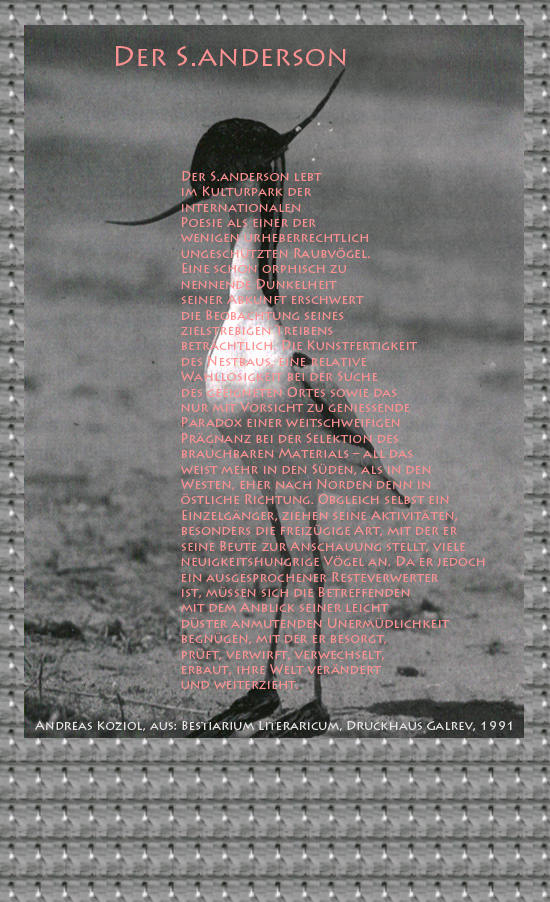












Schreibe einen Kommentar