Seamus Heaney: Die Amsel von Glanmore
ALPHABETE
I
Ein Schatten, den sein Vater (mit Händepaar,
Daumen und Fingern) macht, mümmelt an der Wand
Wie ein Häschenkopf. Soviel ist klar:
Mehr wird ihm klar dann in der Schule sein.
Dort malt er Kringelrauch die erste Woche lang,
Malt dann den Stock mit Querstück namens T.
Das ist Schreiben. Hals-und-Buckel eines Schwans
Machen die 2 sichtbar: Sie sagen kann er eh.
Zwei Sparren und ein Balken auf der Tafel
Sind der Buchstabe ah (so seine Lautgestaltung).
Es gibt Karten, Überschriften, eine richtige Griffel-
haltung gibt’s und eine falsche Haltung.
„Schreiben“ ist es zuerst, und später „Englisch“;
Lehnt eine kleine Hacke dran, heißt’s: richtig so!
Tintengeruch steigt in der Klassenzimmerstille.
Ein Globus am Fenster kippt wie ein buntes O.
II
Flexionen hallten luftig wie ein Hosanna,
Während, Turm um Schichtenturm von Formen,
Band Eins von Elementa Latina,
Mahnend und marmoriert, in ihm emporwuchs.
Denn er bezog dann eine strengere Schule,
Benannt nach dem Patron des Eichenwaldes,
In der die Stunden nach dem Schlag der Glocke spulten
Und er, nach dem forum des Lateins, den Schatten
Neuer Kalligraphie wie Heimat fühlte.
Die Zeichen dieses Alphabets waren Bäume.
Die Großbuchstaben Obstgärten in voller Blüte,
Die Zeilen Gräben, wirr von Dornensträuchern.
Bebänderten Gewands und barfuß stahl sich,
Ringelgelockt von Assonanz und Singen,
Des Dichters Traum hier über ihn wie Sonnenlicht,
Um dann in düstrem Dickicht zu versinken.
Er lernt diese andere Schrift. Er ist der Schreiber,
Der ein Kielgespann trieb über sein weißes Feld.
Vor seiner Zelle picken Amseln, flattern.
Dann Selbstverleugnung, Fasten, reine Kälte.
Nach Regeln, starrer, je nördlicher sie kamen,
Beugt er sich, neu beginnend, über seinen Tisch.
Die Sichel Christi ist durchs Unterholz gefahren.
Die Schrift wird karg und merowingisch.
III
Der Globus drehte sich. Er steht in einem O aus Holz.
Er spielt auf Shakespeare an. Auf Robert Graves.
Die Zeit hat Schule und Fenster eingewalzt.
Mähdrescher stanzen Ballen, wo gedockte Garben
Zur Ernte Lambdas auf den Stoppeln machten,
Und man den Delta-Kopf jeder Kartoffelmiete
Festknetete und -klopfte gegen Frost.
Vergangen auch das Omega; es hielt
Wache über jeder Tür, das Glückshufeisen.
Doch kann das Bild-Wort, absolut im Äther
Wie Konstantins HOC SIGNO-Himmelszeichen,
Ihm noch was sagen; oder dem Beschwörer,
Der an die Deckenwölbung seines Hauses
Ein Bildnis von der Welt mit ihren Farben
Zu hängen pflegte, daß das Bild des Kosmos
Und „nicht bloß Einzeldinge“ seine Augen träfen,
Wenn er spazierenging. Der Astronaut sieht so
Aus seinem kleinen Fenster alles, was ihm Leben
Gab: das aufgegangene, feuchte, eine, klare O,
Wie ein Ovum, ausgedehnt und schwebend –
Oder wie mein staunend vorbewußtes Starren
Auf den Verputzer, der auf seiner Bühne
Unseren Giebel glättet und darauf unseren Namen
Mit der Spitze der Kelle schreibt, Rune um Rune.
Übersetzung: Ditte Bandini
Der Erinnerungskünstler
Das erste Buch von Seamus Heaney, das mir in die Hände fiel, war die amerikanische Ausgabe von Field Work von 1979; ein schmales Paperback von nicht einmal siebzig Seiten, auf dem – in brauner Farbe – eine Landkarte von Glanmore im County Wicklow abgebildet war, jenem Ort, wohin sich der Dichter, wie ich später erfuhr, für ein paar Jahre zurückgezogen hatte. Er hatte vorher in Belfast gelebt und war der dort herrschenden blutigen und rhetorischen Auseinandersetzungen überdrüssig geworden.
Im Zentrum von Field Work stehen die Sonette über Glanmore – die Hecken-Schule auf dem Land –, über eine pastorale Welt des Friedens, die allerdings durch das flackernde Geschützfeuer des anhaltenden Bürgerkriegs am Horizont begrenzt wird. Dieser Bürgerkrieg ist in allen Büchern des (katholischen Dichters) Seamus Heaney gegenwärtig, und man ahnt, welche unmittelbare moralische Bedrohung von ihm auch dann noch ausgeht, wenn von den unverhofften Freuden des kargen Landlebens gesprochen wird. (Eine der großartigsten Beschreibungen der allmählichen Vergiftung einer ganzen Familie durch die Verstrickungen in die IRA ist nach wie vor der auf persönlichen Erfahrungen beruhende Roman von Heaneys Freund Seamus Deane: Im Dunkeln lesen, 1997.)
Ich war von dem Ton, dem Reichtum dieses schmalen Bändchens schwer beeindruckt. Die große irische Poesie der Moderne hatte ich fünfzehn Jahre vorher kennengelernt, als ich für einige Zeit im Londoner Bezirk Camden Town lebte, wo damals außer ein paar sich bis aufs Blut hassende griechische und türkische Zyprioten ausschließlich Iren anzutreffen waren. Und für diese Iren, die in der Regel von schwerer körperlicher Arbeit gekennzeichnet waren, war es selbstverständlich, daß sie ihre Dichter kannten und vieles von ihnen sogar auswendig wußten. Ich sehe heute noch den bärenstarken, vollkommen zahnlosen Straßenarbeiter aus dem Nebenhaus vor mir, der auf die Frage nach seinem Wohlbefinden stets mit dem ersten Satz des mir damals liebsten Romans antwortete:
Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues.
Und nun also Seamus Heaney.
Inzwischen waren in Deutschland die eigenbrötlerischen Schlachten über Sinn und Bedeutung der modernen Poesie geschlagen, alles war unendlich oft diskutiert und durchgekaut worden, und am Ende war man froh, daß in diesem langwierigen und umständlich geführten Prozeß nicht auch noch die Poesie selber abgegangen war. Es hatte sich schließlich die Einsicht durchgesetzt, daß in der poetischen Rede – in der poetischen Rede – etwas zum Ausdruck kommen kann, das sonst nicht vorkommt, und da zum Glück nach 1968 für eine Weile die Hierarchisierung verpönt war, konnte halt jeder so schreiben wie er Lust hatte. Die lyrische Schutzpolizei hatte sich aufgelöst. Die Frage nämlich, ob man nun Helmut Heißenbüttel und seinem Konzept einer modernistischen Poesie oder Peter Huchel folgen sollte, stellte sich nicht mehr. Plötzlich ging der theoretische Vorhang hoch und eine Fülle von neuen Namen wurde sichtbar: Tomas Tranströmer und Lars Gustafsson, Jan Skácel und Vasco Popa, Allen Ginsberg, Robert Lowell und Lawrence Ferlinghetti, Yves Bonnefoy und Philippe Jaccottet – und viele andere. Und die Vorstellung, daß es nur eine Richtung geben sollte – wie die „Neue Subjektivität“ in Deutschland –, war angesichts der so unterschiedlichen wie am Ende doch miteinander verwandten Dichter so lächerlich und spießig, daß ein großes erleichtertes Aufatmen spürbar wurde. Denn auch wenn sich die Dichtung immer auf ihr langes Erbe beruft, auf Regeln und Formen, so wird sie im einzelnen Fall doch nicht daran gemessen, ob der Dichter sie erfüllt, sondern ob er im Umgang mit der Tradition einen eigenen Ausdruck findet.
Ich lernte Seamus Heaney bald darauf persönlich kennen. Er stand mit seinem weißen Haarschopf und einem verschmitzten Lachen im Büro seines amerikanischen Verlegers Roger Straus und war verblüfft, wie genau ich seine Gedichte kannte: seine genaue Beschreibung von Naturvorgängen, die immer auch diskrete Beschreibungen seelischer Stimmungen des Autors sind, seine liebevollen Verse über Tiere – über den Otter und den Skunk –, die Zärtlichkeit gegenüber der Schöpfung insgesamt. Von da an gehörte dieser Ire zu meinen Dichtern.
Wir sahen uns dann öfter. Unvergessen seine Lesung im Lyrik Kabinett in München. Seine Gedichte – wie er sie vorlas und wie er über sie sprach – waren immer eine gesteigerte Antwort auf die Welt, nicht auf eine Gegenwelt; ein konkretes, deutliches Echo, nicht eine künstliche Alternative; eine Feier, nicht ein artistischer Abschied. Nach der Lesung gingen wir in ein Münchner Bräuhaus, vollgepackt mit Menschen. Nach dem Essen verirrte sich zufällig eine irische Opernsängerin ins „Spaten“, die Marie und Seamus erkannte und sich zu uns setzte. Und wenig später sangen sie zusammen herzzerreißende irische Balladen, daß den bayerischen Biertrinkern ganz anders wurde. Die unbedingte Treue zu ihrer Landschaft, zu ihrer Heimat, dem Land ihrer Geburt – und zu ihrer Sprache – wurde so greifbar und authentisch, daß mir (und einigen anderen) Hören und Sagen verging – da saß die materialisierte Poesie mitten unter uns.
Dann kam sein Weltruhm, die unterschiedlichsten Anerkennungen, schließlich der Nobelpreis.
Als ich Seamus Heaney vor zwei Jahren das letzte Mal sah, in einem plötzlich reich und verschwenderisch gewordenen Dublin, verabredeten wir den vorliegenden Band. Sein Freund Joseph Brodsky – Brodsky, Heaney und Derek Walcott wurden in den Vereinigten Staaten nur „the boys“ genannt – war entzückt von der Paperback-Ausgabe der Hundert Gedichte von W.H. Auden, also schlug ich Heaney vor, daß wir hundert Gedichte aus seinem Werk heraussuchen und in einer wohlfeilen Ausgabe versammeln.
Gleich in Seamus Heaneys erstem Gedichtband, Tod eines Naturforschers, steht eine hymnische Eloge auf seinen Großvater und seinen Vater, die beide als Torfstecher und als Farmer mit dem Spaten umzugehen wußten. Diese Tradition kann der Autor nicht fortsetzen – aber:
Zwischen Finger und Daumen
Halte ich die stämmige Feder.
Damit werde ich graben.
Also haben wir rund hundert Gedichte ausgegraben. Da Heaney oft große Zyklen veröffentlicht hat, haben wir auswählen müssen, wobei wir die Numerierung des Originals beibehalten haben. Insgesamt ist aber ein Durchgang durch sein Werk entstanden, der die Vielfalt dieses großartigen Dichters zeigt.
Dank der generösen Zustimmung des S. Fischer Verlags und meines Freundes Hans Jürgen Balmes liegt der Band nun vor und findet hoffentlich die Leser, die sich trotz einer sich verlaufenden Gegenwart noch zur Poesie und ihrer ganz eigenen Energie bekennen wollen.
Michael Krüger, Mai 2011, Nachwort
Seamus Heaney
ist aus der englischsprachigen Lyrik nicht mehr wegzudenken. Schon seit langem gilt er als der „beste irische Dichter seit Yeats“ (Robert Lowell).
Die Welt seiner Kindheit ist eines seiner großen Themen: Irland, die Farben und Gerüche seiner Landschaft, der Wind und das Meer, das harte Leben der Torfstecher und Bauern.
Mit diesem Akzent auf eine tief empfundene Humanität geht eine Aufmerksamkeit für das Werk der Hand einher: Menschen, die Strohdächer decken, im Stall fast archaisch anmutende Werkzeuge benutzen, eine Mistgabel aus einem besonderen Holz. Das alles sind keine Elemente einer Nostalgie, sondern Momentaufnahmen aus einer sich wandelnden Welt, deren Geschwindigkeit man nur ermessen kann, wenn man auch ruhende Objekte in seiner Welt zuläßt.
In diesem Aspekt gleichen seine Gedichte oft Schwarzweißaufnahmen – wäre da nicht die vokalreiche Sprache mit ihren Hunderten von Farben und Tönen, die man manchmal nur hören kann, wenn man einen Iren sie vorlesen hört. Dies kann man auch als Geste gegen das „richtige“ Englisch verstehen, die normierte Sprache, deren Zwängen er – genauso wie dem von England „aufgezwungenen“ Nordirland-Konflikt – seine Gedichte entgegensetzt. Sie sind Denkmale der Friedfertigkeit, die sich der Gewalt leise widersetzen.
Michael Krüger hat sein Werk seit Jahren begleitet und gemeinsam mit Seamus Heaney die einzige umfassende zweisprachige Ausgabe seiner Gedichte zusammengestellt.
Fischer Taschenbuch Verlag, Klappentext, 2011
Keine poetischen Tricks oder „Kalte Perlen aus Geschichte
und Heimat“ oder „We still believe that we hear.“
Vorweg: Dies ist eine längere Rezension – wer lieber nur ein Fazit möchte kann den Abschnitt unten, beginnend mit „Ein Beobachter“, als solches lesen.
Hoard and praise the verity of gravel. (Horte und preise die Ehrlichkeit von Kies.)
Gems for the undeluded. Milt of earth. (Schatz für den Unverblendeten. Roggen der Erde.)
Its plain, champing song against the shovel (Sein schlichtes Knirsch-Lied gegen den Schaufelbiss)
Soundtests and sandblasts words like ,honest worth‘. (sondiert und sandstrahlt Worte wie ,wahrer Wert‘)
Beautiful in or out of the river, (Schön, in Flüssen und außerhalb.)
The kingdom of gravel was inside you too – (Das Reich des Kieses war auch in dir drin –)
Deep down, far back, clear water running over (Tief innen, fern, rann Wasser klar über Steinchen: falb)
Pebbles of caramel, hailstone, mackerel-blue. (Kandisbraun, milchweiß, taubenblau, meergrün.)
„In time that was extra, unforeseen and free.“, so heißt eine Zeile am Ende eines Gedichts von Seamus Heaney, wo es um das Fußballspielen auf Trampelwiesen zu Kinderzeiten geht, mit hingeworfenen Kleidungsstücken als Torpfosten, in launiger, unbändiger, fast erbarmungsloser Freiheit, welche wohl erst mit der nahenden Dunkelheit der Dämmerung zu Ende ging, so als stehe ihr das Wasser schon bis zum Hals und schwappe bereits leis am Schüsselrand der unendlich weiten Kinderseele, als ein Anzeichen und Schwinden von Glück.
So nah und wahrheitsgetreu sind manche Verse dieses nordirischen Dichters, dass es fast unmöglich ist, ihre Worte als literarische Distanz und nicht als ein langsames wirklich werden von Erinnerungen und Eindrücken zu sehen. Womit ich Heaney natürlich nicht die „highness ambition“ seiner Verse absprechen will. Und es ist ja eigentlich, neben dem Mittragen von Geschichte und Kultur, der größte Verdienst der Lyrik, wenn sie nicht nur wiedergibt, sondern mitteilt und sogar vollendet.
And drive back home, still with nothing to say
Except that now you will uncode all landscapes
By this: things founded clean on their own shapes,
Water and ground in their extremity.
(Aus dem Gedicht: „Die Halbinsel“)
1939 in Nordirland geboren und aufgewachsen, wo er schon lange nicht mehr lebt, ist Seamus Heany seit 1995 Nobelpreisträger, womit er sich als Dichter in der guten Gesellschaft von Joseph Brodsky (der ebenfalls vor einiger Zeit eine „Hundert Gedichte“ Ausgabe bei S. Fischer bekam: Brief in die Oase), Wisława Szymborska, Tomas Tranströmer, Charles Walcott und vielen anderen befindet. Seit über 40 Jahren schreibt er Gedichte; hundert sind hier versammelt, ausgewählt in Zusammenarbeit mit Michael Krüger.
Manche Gedichte führen uns in eine andere Welt, die Welt der Naturbewegungen, der operierenden Sprache, der Überlegungen, der Frage- und Antwortspiele etc.
Heaneys dagegen führen uns, über ihre ganze Weite, vor allem durch ein Leben. Nicht nach Art einer rein autobiographischen Bekenntnisdichtung, sondern in dem Sinne, dass Heaneys Gedichte fast alle von einer heimatlichen/biographischen Präferenz ausgehen. Das ist, mir Verlaub gesagt, natürlich eigentlich auch die ehrlichste Variante Dichtung. Sie zieht all ihre Magie und Wirkung aus dem, was Heaney meint, wenn er in seiner Nobelpreisrede über den Verdienst und das Vermögen der Dichtkunst spricht:
weil die Dichtkunst eine Ordnung herstellen kann, die die Einwirkung der äußeren Realität so wahrheitsgetreu wiedergibt und so empfindlich ist für die inneren Gesetzte des Seins des Dichter wie die kleinen Wellen die sich über das Wasser jenes Kücheneimers vor fünfzig Jahren [bei mir zu Hause] nach innen und nach außen kräuselten.
Also aus dem Wiedergeben dessen, was von der eigenen inneren Wirklichkeit von der Außenwelt herrührt, davon bestimmt wurde, darin lebt.
So schreibt Heaney z.B. über das heimatliche Moorland:
Wir habe keine Prärien
Um Abends die große Sonne zu zerschneiden –
Das Auge gibt überall nach
Dem übergreifenden Horizont,
Umworben wird es vom Zyklopenauge
Des Bergsees. […]
Sie haben das Skelett
Des irischen Riesenelchs
Aus dem Torf gehoben, es aufgestellt,
Erstaunliches Flechtwerk voll Luft.
oder die „Mooreiche“:
A carter’s trophy (Die Trophäe eines Fuhrmanns)
split for rafters, (zu Sparren zerkleinert,)
a cobwebbed, black, (spinnenwebbehangne, schwarze,)
long-seasoned rib (lang gelagerte Rippe)
under the first thatch. (unter der ersten Lage Stroh.)
In all diesen Versen schwingt nicht nur etwas von dem Wesen der Landschaft, der Beschaffenheit des Lebens dort mit, sondern es liegt darin auch eine Kraft, mit der die Poesie die Welt aufs Neue in einen vorstellbaren Begriff zu bringen versteht – zurück in das Blickfeld eines alten, erkenntnisreichen, lange geschlossenen Auges. Mit dem leicht rauen Ton, der direkt aus dem Moorland, wie Nebel aufsteigt.
Heimat und Leben geschehen in Heaneys Gedichten als ein Bild und Gefühl von Natur, gepaart mit vertrauten Gerüchen, Geräuschen, die Sehnsüchte und Ängste präg(t)en – und auch die Vorstellungen, Vergleiche, die Reaktionen auf Stimmungen und, nicht zuletzt, die Sprache, auf einer ganz eigenen, sehr sinnbildlichen Ebene.
The garden mould (Die Gartenerde war leicht)
bruised easily, the shower (zu prägen, der Regenschauer,)
gathering in your heelmark (im Abdruck deiner Verse gesammelt,)
was the black O (war das schwarze O)
in ,Broagh‘ (in Broagh)
its low tattoo (sein leises Trommeln)
among the windy boortrees (zwischen windbewegten Machandelbäumen)
and rhubarb-blades (und Rhababerblättern)
endet almost (endet fast)
suddenly, like that last (plötzlich wie jenes g h am Schluss),
g h the strangers found (mit dem die Fremden)
difficult to manage (Schwierigkeiten haben)
Das ist der eine Teil und die darin vorkommende lyrisch-kontemplative Note wird Heaney als großer Dichter, der er ist, auf immer seinen Platz unter den großen Lyrikern sichern. Aber zu seinem Schreiben und Leben gehörten nicht nur Natur und Eindrücke, so wie auch dies nicht alles war, was seine Heimat ausmachte. Da war auch noch Geschichte, war bürgerkriegsähnliche Stimmung. Auch damit setzte Heaney sich oft in seinen Gedichten auseinander, auch mit seiner Beobachterrolle selbst. Und auch oft mit dem Tod, der am Anfang noch der Tod im Torf des Moores, später dann der Tod an einer Backsteinmauer, erschossen, aufgrund der eigenen Religion und Nationalzugehörigkeit, ist.
Als wäre er in Teer
gegossen, so liegt er
auf einem Torfkissen
und weint den schwarzen
Fluß seiner selbst.
Aber auch diese beiden zentralen Aspekte machen selbstverständlich Heaneys Werk nicht allein aus. Man kann ja keine Dichtung, erst recht keine moderne, irgendwie an ein paar simplen Stichworten festmachen. Wichtig war es mir, einen Einblick zu geben, denn letztlich ist das Werk Heaneys im Kern, eben wie ein Leben, sehr vielfältig, unfixiert von Text zu Text, wenn auch eindeutig durch einen Kern, der sicherlich die obengenannten Komponenten enthält, zusammengehalten.
So schreite auf Wolken wider bessren Wissens.
Ah, poet, lucky poet, tell me why
what seemed deserved and promised passed me by?
Große Dichtung hat oft etwas von einem endlosen Strom genau aufeinander abgestimmter Worte. Bilder, nebst Schönheit, blitzen auf und erscheinen im Schein des nächsten bereits als Schatten; so mancher Vers zeigt das Pendeln, das oft zwischen Gedanke und Eindruck vor sich geht. Darstellung ist gleichzeitig Ausdruck und Chance zur Erkenntnis. Und ab und an ragt ein Vers oder ein Gedicht durch seine schlichte Gespanntheit und Unauslöschlichkeit hervor. Und bei all dem, mit all dem, liegt in einem Gedichtband die Möglichkeit, sehr viel mehr zu sagen, als jemand lesen kann oder als es auf dem Papier zu finden gibt. Für manche mag das eine abstruse Feststellung sein und man könnte es auch anders und einfacher Formulieren, wenn man sagt, dass Gedichte, den Moment, der sie erlebt, größer machen als er eigentlich sein kann. Heaney gehört zu den Dichtern, denen das immer wieder (man würde sagen regelmäßig, wenn das nicht so schlimm klänge) gelingt.
Walking with you and another lady (Als ich mit dir und einer anderen Frau)
In wooded parkland, the whispering grass (Im waldigen Parkland ging, da ließ das flüsternde Gras)
Ran it’s fingers trough our guessing silence (seine Finger durch unser vermutendes Schweigen gleiten)
And the trees opened into a shady (Und die Bäume öffneten sich zu einer schattigen,)
Unexcepted clearing where we sat down. (Unerwarteten Lichtung, in die wir uns setzten.)
Ein Beobachter und einer, der sich sehr vielem verbunden fühlt, als solcher tritt Seamus Heaney meisten auf; oft auch als Abwesender, seltener als Suchender – es scheint, als schreibe er hauptsächlich über das, was er bereits gefunden hat. Ohne große Geste ist er malerisch, ohne falsche Tricks, sind seine Gedichte subtil durch ihre Herangehensweise und ihre klargestellte Herkunft. Heaney führte die Gespräche seines Landes in Gedichten und es ist die Wichtigkeit dieser Tatsache für einen deutschen Leser wie mich vielleicht gar nicht nachzuvollziehen, aber allein schon, dass er eine Ahnung geben kann, mit den Geschichten- und Gesprächsanteilen seiner Verse, ist beeindruckend und einzigartig. Großer Dichter, diesen Titel haben ihm viele gegeben. Ich möchte mich jetzt einfach nur bescheiden anschließen. Er hat geschafft, was er selbst in seiner Nobelpreisrede über das Gedicht schrieb:
Doch es gibt Zeiten in denen ein tieferes Bedürfnis hinzukommt, in denen das Gedicht nicht nur angenehm passend, sondern unwiderstehlich weise sein soll, nicht nur eine überraschende Variation auf die Welt, sondern ein Neustimmen der Welt selbst.
All that. And always, orange drums.
And neighbours on the roads at night with guns.
Glänzende Pfütze, in der das seelenfreie Wolkenleben schweift.
Zur Edition: Die Übersetzung zu kritisieren ist nicht notwendig, meistens sind sie (bis auf einige ganz frühe Texte) exzellent oder ermöglichen zumindest im Deutschen eine echte Hilfestellung und es wurde auch nicht immer krampfhaft nachgereimt, was Heaneys Texte auch wirklich nicht brauchen. Der Reim ist mehr Fußstapfen, den Gesangsnote.
Das die Nobelpreisrede mit enthalten ist, war zumindest für mich ein großer Gewinn und auch ein wichtiges Dokument, das man vor der Lektüre der Gedicht vielleicht zu lesen in Erwägung ziehen sollte. Im knappen Nachwort klärt Krüger hauptsächlich über seine Begegnung mit Heaney und die Entstehung des Buches auf, aber neben der Nobelpreisrede hielt man eine weitere Dokumentation vielleicht nicht für nötig – die Meinung würde ich teilen.
Einzig zu bemängeln ist das Fehlen eines Abschnitts mit Anmerkungen, die zwar nicht wirklich unverzichtbar sind, aber bestimmt doch interessant gewesen wären.
I reach for a book like a doubter (Ich greife mir ein Buch wie ein Zweifler)
and want it to flare round my hand, (und wünschte, es flammte auf um meine Hand,)
a black-letter bush, a glittering shield wall (ein Frakturstrauch, eine glitzernde Schilderwand)
cutting as holly and ice. (schneidend wie Stecheiche und Eis.)
Timo, amazon.de, 6.6.2013
Rettungsanker
Über vier Jahrzehnte Gedichte zu versammeln in einem Band, das ist eine Aufgabe, die Michael Krüger mit diesem Band gelungen ist.
Und Seamus Heaney dem deutschen Publikum zu eröffnen, das ist eine weitere schöne und wichtige Tat, die beinahe nahe an dem steht, was wir, ich meine wir als Gedichteleser, so sehr wünschen, was aber, da bin ich mir sicher vorbei geht an dem, was so zur Zeit gelesen wird. Ha, das wäre doch gelacht: Gedichte!
Und dann hinein ins Eingemachte, denkt man sich gerade noch und sogleich, etwas zögerlich zwar, doch immer intensiver das Erfahren von Wahrheiten, die sich verlaufen haben in Sümpfen und schöner Erinnerung, in Kindertagen und im Beobachten von Natur, harter Arbeit und Gesang, der wiederum zu neuen Beobachtungen hinführt.
Ein Dichter, der ein Buch (oder zwei Bücher) geschrieben hat und der meint, damit sei alles gesagt, hat unter Umständen auch etwas geschaffen und somit etwas gesagt.
Doch immer wieder schreiben bis an sein Lebensende unter Umständen, oder bis nahe dahin, das ist etwas anderes.
Seamus Heaney tut es, er tut es mit einer Inbrunst, die wehtut und die erlöst. Sie erlöst von ungenauem Weltschmerz, denn wir lernen durch seine Melodie das Leben (wieder) kennen. Dass es lebenswert und schwer ist (sein müsste!) und so unendlich wunderschön zugleich.
Weil aber das Böse immer und überall zugegen ist (zu sein scheint), ist es gerade so wertvoll, das alles zu wissen. Und unser Poet ist ein echter irischer Katholik, das sei nicht verschwiegen.
Auch in Irland war es so, ist es vielleicht noch so, nicht nur bei uns hier, hier bei uns allen, dass Gutes und Böses so nah beieinander liegen.
Ja, in der Welt ist es so und darum es ist gut, dass ein Mensch davon singt, wie es Seamus Heaney tut, dass es Derek Walcott tut und andere ebenso.
Und wir, die Leser? Sind wir nicht beschämt ob des mutigen Singens? Wir mit unseren eingebildeten und wirklichen Sorgen?
Diese „Bibel“ hier besingt das Leben und Treiben in der Welt, es holt Vergangenes wieder herbei und verbindet es so mit möglicher Zukunft. Das ist auch ein Ziel, ein Wollen der Kunst.
Dafür bekam unser Poet den Nobelpreis, gottseidank. Dafür wird er geliebt.
Mehr ist zu diesem „Erlösungswerk“, das ständig zu wachsen scheint, nichts zu sagen.
Klaus Grunenberg, amazon.de, 27.2.2012
Irische Torfmusik
– Seamus Heaneys Gedichte in einem Band. –
Ein Gedicht ist ein Stück konkreter Welt. Kein Lyriker hat dies so sehr zum Programm gemacht wie Seamus Heaney. Dass die Welt weder rund noch in der Totalen zu überschauen ist, hat der 1939 im nordirischen County Derry in eine Großfamilie katholischer Bauern und Torfstecher Hineingeborene früh mitbekommen – und der Erfahrung kolonialenglischer Bevormundung, lokaler Begrenztheit und latenten Terrors etwas Rundes abringen können: Jeder seiner Verse fügt sich – ausgehend von einer Kindheitserinnerung, der Küste bei Connamarra, dem Hochmoor oder der Londoner U-Bahnlinie „District & Circle“ – zum Daseinsentwurf.
Heaney handhabt das Sonett so souverän wie freiere Formen. Er ist ein Meister lautmalerischer Wortmusik im Dienst der Landschaft, die vor unseren Augen entsteht. Von ihrem Abwechslungsreichtum kündet ein von Michael Krüger in Zusammenarbeit mit dem in Dublin lebenden Poeten besorgter Auswahlband von gut hundert Gedichten, der das Beste aus elf zwischen 1966 und 2006 erschienenen Büchern sowie Heaneys Dankesrede zum Literaturnobelpreis 1995 enthält. Die den englischen Originalen zur Seite gestellten Übersetzungen (u.a. von S. Fischer-Lektor Hans Jürgen Balmes und dem Dichter Richard Pietraß) kommen dem erdnahen, stets winddurchfluteten, Ausblicke auf Himmel und See gewährenden Heaney-Sound oft nahe. Übertreffen können sie ihn nicht.
„Claritas. Das Wort, lateinisch nüchtern“, heißt es in „Seeing Things – Gesichtetes“ etwa, „Passt tadellos auf den behauenen Stein des Wassers, / Das Jesus bis ans unbenetzte Knie reicht, / Während der Täufer ihm weiteres Wasser / Über den Kopf gießt: All das im hellen Sonnenlicht / An der Fassade einer Kathedrale. Linien, / Hart und dünn und wellig, stehen für / Des Flusses Fließen. Unten, zwischen diesen Linien, / Sind komische Fischlein zugang. Weiter nichts, / Und doch ist bei all dieser Sichtbarkeit / Der Stein ganz voll von dem, was nicht zu sehen ist: / Wassermyrte, flüchtigem Sandgestöber“. Auf Englisch beginnt das so:
Claritas. The dry-eyed Latin word
Is perfect for the carved stone of the water
Where Jesus stands up to his unwet knees
And John the Baptist pours out more water
Over his head: all this in bright sunlight
On the façade of a cathedral.
Jan Röhnert, Der Tagesspiegel, 31.12.2011
Retten Gedichte unsere Seele, Mr. Heaney?
– Das Haus des Lyrikers Seamus Heaney liegt direkt an der Bucht von Dublin. Durch ein Oberlicht kann der Nobelpreisträger bei der Arbeit einen verschwenderischen Himmel bestaunen. –
Thomas David: Sie haben über die Häuser von W.B. Yeats und Thomas Hardy geschrieben, die Monumentalität des einen und die Herkömmlichkeit des anderen, und für die BBC durch Wordsworths Dove Cottage geführt. In welchen literarischen Gefilden steht das Haus, in dem Sie arbeiten?
Seamus Heaney: Das Haus, in dem wir uns befinden, ähnelt natürlich eher Hardys „Max Gate“ als „Thoor Ballylee“, dem Turm, in dem Yeats lebte. Aber Glanmore Cottage, mein Haus im County Wicklow, in das ich mich für gewöhnlich zum Schreiben meiner Gedichte zurückziehe, lässt mich oft an Wordsworths Cottage denken. Es handelt sich um ein altes Torhaus mit Schieferschindeln und so weiter – außerhalb von Dublin auf dem Land, wo es sehr still ist. Im Unterschied dazu ist dieses Haus hier eher eine Art Bürgerhaus – eine Maschine, in der das Familienleben betrieben wird.
David: Haben Sie in den fünfunddreißig Jahren, die Sie inzwischen hier wohnen, nie ein Gedicht in diesem Haus geschrieben? Angeblich trommeln Sie den Rhythmus von Gedichten sogar auf Flugreisen aus.
Heaney: In meinen Zwanzigern und Dreißigern konnte ich tatsächlich im größten Durcheinander arbeiten, aber mittlerweile brauche ich die Stille. Ted Hughes sagte mir einmal: „Es ist gut, wenn man nicht gestört wird. Aber noch wichtiger ist zu wissen, dass man nicht gestört wird.“ Auf dem Land weiß ich, dass ich nicht gestört werde, und als wir 1976 in dieses Haus einzogen, hatte ich anfangs das Gefühl, Verrat zu üben, weil es sich um kein Schriftstellerhaus handelte. Ich musste mir hier erst ein Nest bauen.
David: Das enge „Nest-unter-dem-Dach“, das Sie in Ihrem Gedicht „Das Oberlicht“ erwähnen?
Heaney: Richtig. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mich nach unserem Einzug ganz bewusst hinsetzte, um über einen Freund zu schreiben, der während des Nordirland-Konflikts, kurz nach dem „Blutsonntag“ ein paar Jahre zuvor, bei einer Explosion ums Leben gekommen war. Das Herumschieben der Strophen und Reime war hilfreich, um mit dem Tod dieses Mannes zurechtzukommen, und als ich das Gefühl hatte, dass mir ein gutes Gedicht gelungen war, dachte ich: „Okay, ich bin in diesem Haus sicher.“ Neben diesem Gedicht, „Opfer“, habe ich aber noch einige andere der in dem Band Feldarbeit erschienenen Gedichte hier geschrieben – einige von denen, die mir selbst die liebsten sind.
David: Welcher innere Zustand bringt ein Gedicht hervor?
Heaney: Ich kann nicht ohne eine gewisse Erregung anfangen, ohne ein Versprechen, dass irgendetwas geschieht. Hin und wieder beginne ich ein Gedicht zu früh, manchmal halte ich eine Idee, ein Bild oder die initiierende Energie zu lang zurück und verpasse den richtigen Moment des Anfangs. Für einen alten Lyriker wie mich ist es am besten, auf Teufel komm raus loszulegen, sich einfach mit Begeisterung oder Vertrauen kopfüber in die Sache hineinzustürzen – Risiken einzugehen, immer wieder bereit zu sein, Änderungen vorzunehmen, ein wenig herumzuspielen. Einen Großteil der Zeit ist man natürlich sehr ernst und mürrisch gegen sich selbst.
David: Liest man Human Chain, Ihren 2010 erschienenen jüngsten Gedichtband, hat man den Eindruck, Sie bewegten sich mühelos zwischen Gegenwart und Vergangenheit und den verschiedenen Elementen, zwischen der Erinnerung an irische Lyrik des zwölften Jahrhunderts und der Beobachtung eines aufsteigenden Drachens. Welche Orte suchen Sie in Ihren jüngsten Gedichten am liebsten auf?
Heaney: Ich nehme an, dass ich am häufigsten an die Orte im nordirischen Ulster zurückkehre, an denen ich aufgewachsen bin. Meine Erinnerungen, meine Energie und meine Inspiration sind dort größtenteils verwurzelt. Orte waren für mich schon immer eine wichtige Inspiration, weshalb natürlich auch die Gegend um mein Cottage in Wicklow einer ist, über den ich oft geschrieben habe. Neuerdings wende ich mich auch gern Vergil zu, Dante und so weiter, und früher waren für mich die Reisen ins Werk mitteleuropäischer Lyriker wie etwa Czesław Miłosz sehr wichtig, obwohl sich das in meinen Gedichten vielleicht nicht so zeigt. Miłosz hatte ein starkes Bewusstsein für das menschliche Befinden: Er war frei und wahrhaftig, nicht schwermütig, aber ernst.
David: „Die Strichelspur von Vaters Eschenstock / Auf dem Strand von Sandymount / Ist gleichfalls etwas, was die Flut nicht tilgt.“ Für „Der Strand“, das kürzeste der Gedichte, die Sie für die unlängst in Deutschland erschienene Anthologie Die Amsel von Glanmore ausgewählt haben, scheinen Sie nur mal eben vor die Tür getreten zu sein.
Heaney: Das Gedicht ist auf ganz eigene Weise hermetisch und spielt auf den Ulysses an, wo Stephen Dedalus über den Strand von Sandymount spaziert. Seine Spuren werden von der Flut nicht getilgt, weil sie für immer in Joyces Roman bewahrt sind. Hier in Dublin ist man sich der Präsenz von James Joyce auf Schritt und Tritt bewusst, und ich hätte nicht über den Strand vor meiner Haustür schreiben können, ohne mich dabei vor Joyce zu verbeugen.
David: Dennoch ist das Gedicht nicht nur eine Referenz an Joyce, sondern auch an Ihren verstorbenen Vater, und es scheint die Beharrlichkeit der Erinnerung zu thematisieren, die für Ihr Gesamtwerk charakteristisch ist. Welches Verhältnis besteht zwischen Erinnerung und dichterischer Imagination?
Heaney: Für Samuel Taylor Coleridge war beides beinahe identisch, und je älter ich werde, desto mehr stimme ich ihm zu. Auch in „Human Chain“ kommen mein Vater und meine Mutter wieder vor, Jahrzehnte nach ihrem Tod, und zum Teil ist es der Prozess des Schreibens selbst, der die Erinnerung heraufbeschwört. Viele der Gedichte, die ich in den siebziger und achtziger Jahren schrieb, hatten ihren Ursprung in der Notwendigkeit, den Nordirland-Konflikt zu verarbeiten, in einem Gefühl sozialer Verpflichtung. Als ich jedoch merkte, dass dies zu nichts führte, besann ich mich zunehmend auf eine sehr viel persönlichere Form der Selbstfindung und Festigung und wandte mich in meinen Gedichten wieder meinen biographischen Wurzeln zu, meinen Grundfesten sozusagen.
David: Bereits aus „Vom Graben“, dem Auftaktgedicht Ihres ersten, 1966 erschienenen Lyrikbandes, spricht die starke Verbundenheit mit dem Erd- oder Ackerboden Ihrer ländlichen Herkunft im County Derry, wo Ihr Vater Bauer und Viehhändler war. Kommt der Erinnerung an die Ursprünglichkeit bäuerlicher oder handwerklicher Arbeit, die Ihr Werk bewahrt, in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen vor allem auf die Handhabung ihres Smartphones und der Tools ihres Computers verstehen, eine neue Bedeutung zu?
Heaney: Früher hatte ein Großteil der Einwohner Dublins einen ländlichen Hintergrund, aber ich stimme Ihnen zu und glaube, dass die Erinnerung an das Land für Angehörige jüngerer Generationen keine Rolle mehr spielt oder bereits verloren ist. Mir selbst ergeht es manchmal wie dem eisenzeitlichen Tollund-Mann, der in meinem Gedicht „Der Tollund-Mann im Frühling“ in unsere „virtuelle Stadt“ gelangt und sich angesichts der „verkabelten, abwesend blickenden Lächler“, die mit Kopfhörern zum Beispiel vor den Bankautomaten Schlange stehen, sehr fremd fühlt. Der innere Kern des schöpferischen Wesens, das in mir wohnt, liegt in der physischen Welt, in der in „Vom Graben“ beschriebenen Welt, die nach „Kartoffelhumus“ und „sumpfigem Torf“ riecht. Aber ein anderer Teil von mir, der Zeitgenosse und Staatsbürger, lebt an einem anderen Ort, fährt Mercedes und ist auf ganz normale Weise Teil der Konsumgesellschaft.
David: Ende der neunziger Jahre haben Sie das mehr als tausend Jahre zuvor entstandene angelsächsische Versepos Beowulf ins Neuenglische übertragen. Was verlieren wir, wenn uns die Erinnerung an Texte wie Beowulf abhandenkommt, die Teil des Nährbodens sind, aus dem unsere heutige Kultur hervorgegangen ist?
Heaney: Ich glaube, man verliert ein Gefühl für den Ernst, für die Erdschwere der menschlichen Existenz. Gedichten wie Beowulf ist eine Art von psychischem Gewicht zu eigen, das sich von dem Diskurs, dem wir im Alltag oder in der Alltäglichkeit heutiger Literatur begegnen, grundlegend unterscheidet. Im ersten Teil ist Beowulf ein junger Mann, der sich als Krieger und als Held erst beweisen muss, aber die eigentliche Schönheit des Gedichts liegt im zweiten Teil, in dem der gealterte Beowulf abermals von etwas herausgefordert wird, das in der Macht seines Schicksals steht und ihn schließlich zerstört. Ich glaube, das Leid oder die Trauer, die diesem zweiten Teil eingeschrieben sind, ist für die Faszination, die dieses Gedicht auf seine Leser nach wie vor ausübt, nicht weniger verantwortlich als die darin beschriebene Entfesselung von Gewalt. „Furcht und Mitleid“, wie Aristoteles in seiner Poetik schreibt. Ich glaube, die Sehnsucht nach dem Gewicht einer Ernsthaftigkeit, wie sie Gedichte wie Beowulf auszeichnet, existiert in vielen Menschen. Das Wesen des Menschen hat sich in den letzten tausend Jahren nicht wirklich verändert, und auch wenn ein angelsächsisches Publikum aus Beowulf vielleicht noch mehr herausgelesen hätte als ein heutiger Leser, ist das Timbre des Textes nach wie vor spürbar.
David: In seinem Nachwort zu Die Amsel von Glanmore erinnert Michael Krüger daran, dass in der poetischen Rede etwas zum Ausdruck kommen könne, „das sonst nicht vorkommt“. Ist die Lyrik angesichts der unablässigen Talkshow unserer globalen Kommunikation von besonderer Relevanz?
Heaney: Ich denke schon, dass die Lyrik in einer Welt, in der der Einzelne von morgens bis abends, sei es an seinem Mobiltelefon oder im Internet, einer Vielzahl von oft nicht sehr eindringlichen linguistischen Begegnungen ausgesetzt ist, ein guter Kompass sein kann. Wir erwarten von jedem Gedicht eine Ahnung dessen, was in der Sprache möglich ist, und spüren sofort, wenn es ihm daran ermangelt. Aber sogar ich ändere meine Gewohnheiten und muss Ihnen gestehen, dass ich in den letzten vier oder fünf Jahren zu einem Googler geworden bin: Ich hätte vor unserem Gespräch Ihren Namen googlen sollen.
David: „Alles kann geschehen, die höchsten Türme können / Umgestürzt, die Hochstehenden eingeschüchtert, / Die Übersehenen beachtet werden“: Wie verändert sich unser Blick auf die Realität vertrauter, fortwährend reproduzierter Bilder wie jenen von den Anschlägen auf das World Trade Center, wenn sie von einem Gedicht beleuchtet wird?
Heaney: Auf der glatten Oberfläche der Bilder, die uns im Alltag umgeben, kann ein Gedicht allenfalls ein Haken sein, an dem der Leser Halt findet. Aber die Aktualität oder der unmittelbare Zeitbezug, wie ich ihn zuletzt in einigen Gedichten meines vor fünf Jahren erschienenen Bandes District and Circle gesucht habe, kann sich als problematisch und vordergründig erweisen. Es gibt einen amerikanischen Lyriker, der als Soldat den Krieg im Irak oder in Afghanistan überlebt und darüber geschrieben hat. Seine Gedichte handeln von den Schrecken des Krieges, sie beinhalten viele Informationen, dringen aber nicht bis zu der menschlichen Erfahrung wirklichen Leids vor. Derartige Gedichte sind eher wie guter Journalismus und erzählen uns eigentlich gar nichts darüber, was es heißt, Mensch zu sein.
David: Wenn Lyrik eine „Bewegung der Seele“ ist, wie Sie einmal geschrieben haben: Wie schützen Sie Ihre Seele vor den Anstürmen der Gegenwart?
Heaney: Durch Widerstand. Man muss sich der Dinge bewusst sein, die um einen herum existieren, und diesen widerstehen. Man schützt seine Seele, indem man sein Werk schützt – soweit das eben geht. Es ist ein schweres Geschäft.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.12.2011
Spaten und Wasserwaage:
– Seamus Heaneys’s Suche nach Herkunft und Gleichgewicht. –
Seamus Heaney, der 1939 auf einem kleinen Bauernhof in der Grafschaft Derry, Nordirland, geboren wurde, hat nie den Kontakt zu seiner bäuerlichen Herkunft verloren. In seinen frühen Gedichtsammlungen Tod eines Naturforschers (Death of a Naturalist, 1966) und Tür ins Dunkle (Door into the Dark, 1969) beschwört er eine Vergangenheit, die vom Leben und Arbeiten in der bäuerlichen Gemeinschaft geprägt ist. Mit Präzision und mimetischer Kraft erinnert er sich an den Bauch der kalbenden Kuh, „gewölbt wie eine Hängematte“, das „muffige Dunkel“ der Scheune, die „einen Waffenhort“ von Gerätschaften barg, den „Spaten“, der „in kieseligen Boden“ drang, an Frösche, „die großen Könige des Schleims“, und an eine Ratte, „Auswurf des Wassers“. In anderen Gedichten spürt er dem Geheimnisvollen in der Arbeit des Handwerkers nach: im Dunkel seiner Werkstätte hämmert der Schmied „ein Pfauenrad aus Funken“; in der Hand des Wünschelrutengängers „zuckte“ die „gegabelte Rute“ über der verborgenen Quelle auf und ab. Beispielhaft ist auch die Genauigkeit, mit der sein Vater den von einem Pferdegespann gezogenen Pflug führt.
An den Rain gelangt, genügte ein kurzer Ruck
Am Zügel, und das schwitzende Gespann
Kehrte wieder feldein. Er kniff
Ein Auge zu, zielte nach dem Gewann,
Vermaß die Furche gerade wie einen Strich.
Seine Bewunderung für die Arbeit der Männer, die Strohdächer decken, Torf stechen, säen und ernten, und die Aufmerksamkeit, mit der er ihren Stolz über die getane, gute Arbeit vermerkt, sind Zeichen seiner Wertschätzung. Wie der Mann, der die Strohdächer deckt, so geht auch der Dichter vor.
Dann stellte er die Leiter auf, legte geschärfte Klingen bereit
Und schnippelte am Stroh und spitzte beide Enden des Zweigs,
Und die ergaben, zusammengebogen, weiß spitzige Krampen,
Um seine Welt daran zu befestigen, eine Handvoll nach der anderen.
Tod eines Naturforschers schließt mit „Privater Helikon“ (Personal Helicon), einem Gedicht über das kindliche Vergnügen, Brunnen zu erkunden – „… ich liebte / Den dunklen Schacht, den eingefangenen Himmel, / den Duft nach Schimmel, feuchtem Moos und Wassermyrte“; über musikalische Echos – „Andere hatten Echos, gaben dir deinen Ruf / Mit reinem neuen Klang zurück“; und über das Warum des Schreibens – „Ich reime, / Um mich zu sehen, und damit dunkle Tiefen hallen“.
Die Stellung von „Moorland“ (Bogland) am Schluß von Tür ins Dunkle bestätigt noch einmal die Tiefendimension der poetischen Welt des Dichters, zugleich nehmen die fließenden Definitionen dieses Gedichts den Stil der nächsten Sammlung vorweg. Indem „Moorland“ die Imagination der amerikanischen Dichter, die in die Weiten des Westens ausgreifen, mit der irischen Imagination kontrastiert („Überall fügt sich das Auge / Dem zudringlichen Horizont,“), erkennt der Sprecher die Grenzen an, die seinem Schaffen als irischer Künstler gezogen sind. Doch weil das kulturelle Erbe so reich ist, bedeutet diese Beschränkung keine Kapitulation.
Sie haben das Skelett
Des Irischen Riesenelchs
Aus dem Torf geholt, es aufgestellt,
Eine erstaunliche Kiste voll Luft.
Die Moore Irlands, die früher als gefährliche und unheilvolle Orte verrufen waren, bewahren und läutern auch, was ihnen anvertraut wurde.
Butter, vor über
Hundert Jahren versunken,
Fand man wieder, salzig und weiß.
……………………………………………….
Noch stoßen unsre Pioniere weiter
Einwärts und abwärts vor.
Jede Schicht, die sie bloßlegen
War, scheint’s, früher bewohnt.
Die Moorseen könnten atlantische Lecks sein.
Die nasse Mitte ist bodenlos.
Der schwungvolle, von Zuversicht getragene Ton dieses Gedichts bekräftigt den Glauben an die Quellen Irlands. Von W.B. Yeats stammen die denkwürdigen Worte „Die Dinge fallen auseinander; die Mitte kann keinen Halt bieten.“ Heaney ist anderer Ansicht und behauptet, daß die irische Seele über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt. Das kulturelle Erbe seiner Heimat ist nicht minderwertig, die Geschichte baut sich aus vielen Schichten auf. Für ihn ist „die nasse Mitte bodenlos“, die dichterischen Möglichkeiten unbegrenzt:
Noch stoßen unsre Pioniere weiter! Einwärts und abwärts vor.
Heaney machte diese Entdeckungen in dem Raum, den ihm die Bildung zwischen dem schreibenden Ich und dem Ich als Gegenstand der Beschreibung eröffnete. Der Junge vom Bauernhof hatte zuerst das Internat St. Columb’s College in Londonderry besucht (1951–1957), ehe er an der Queen’s University in Belfast (1957–1961) studierte, wo er seinen Abschluß in Englischer Philologie machte. Für Schule und Studium verließ er seine Heimat und damit die feste, ihm wohlbekannte bäuerliche Gemeinschaft, in der die traditionellen Formen des Landbaus verschwanden.
Sein Leben nahm eine andere Richtung: er wurde Lehrer am St. Joseph’s College (1963–1966), heiratete 1965 Marie Devlin und wirkte als Dozent an der Belfaster Queen’s University (1966–1972). Anfang bis Mitte der sechziger Jahre, als Heaney mit dem Schreiben begann, stand er einer Gruppe von Nachwuchsautoren nahe, zu denen die Lyriker Derek Mahon, Michael Longley und James Simmons zählten. Sie bildeten zusammen eine literarische Gruppe, deren Haupt damals Philip Hobsbaum war. Als Hobsbaum 1966 wegzog, trat Seamus Heaney an seine Stelle und leitete die Sitzungen bis 1970. Später stießen jüngere Lyriker wie Paul Muldoon, Frank Ormsby und Michael Foley hinzu. Im Jahr 1969 kam es in Nordirland wieder zu Ausbrüchen extremistischer Gewalt, und 1972 zog Heaney mit seiner Familie nach Süden in die Grafschaft Wicklow in der Republik Irland. Eine Zeitlang (1975–1981) arbeitete er als Lehrer am Carysfort College, gleichwohl war das Schreiben mehr und mehr zu seinem Lebensinhalt geworden.
Es folgten Jahre auf verschiedenen Posten – 1970–1971 als Gastprofessor in Berkeley, Kalifornien, und nochmals 1976–1977, eine Berufung auf den Boylston-Lehrstuhl für Rhetorik in Harvard (1984ff.) und auf den Poetik-Lehrstuhl in Oxford (1989–1994). Ferner bekam er viele Preise, darunter den Denis Devlin Award (1973), den American-Irish Foundation Literary Award (1973), den Duff Cooper Memorial Prize (1975), den W.H. Smith Annual Award (1976), den Whitbread Award für Die Hagebuttenlaterne (1987) und den Sunday Times Award für literarische Meisterschaft (1988). Die Royal Society for Literature verlieh ihm den Titel eines „Companion for Literature“ (1995). Ebenfalls 1995 erhielt er schließlich den Nobelpreis für Literatur, und im darauffolgenden Jahr ernannte ihn der französische Kultusminister zum Commandeur des Arts et Lettres der Légion d’Honneur.
In Überwintern (Wintering out, 1973), seinem dritten Gedichtband, erkundet Seamus Heaney mit mimetischer, den Riten nachspürender Imagination die geschichtlich-kulturellen Ursprünge seines lyrischen Terrains. Im Sprachmaterial der Ortsnamen findet er Spuren des anhaltenden Minderheitenkonflikts und der kolonialistischen Enteignung. Viele Gedichte sind in dem aus „Moorland“ bekannten Geist spielerischen Vertrauens geschrieben. In „Orakel“ (Oracle) lebt das namenlose lyrische Ich unter Naturdingen, es wohnt als lauschender Vertrauter in einem hohlen Weidenstamm:
Kleinmund und -ohr
in holzigem Spalt,
Läppchen und Kehlkopf
der moosigen Plätze.
Die Gedichte hängen mit allen Fasern an der Landschaft; in der Musikalität ihrer Sprache tut sich eine auditive Imagination kund, die Heaney später als „jenes Gefühl für Wort und Silbe“ beschreiben wird, „das unter die Ebene alltäglicher Sprachverwendung geht, um die ursprünglichen und die im Lauf der Zivilisation abgelagerten Assoziationen zu vereinen, die die Wörter erworben haben“.
Das lohfarbne, kehlige Wasser
buchstabiert sich: Moyola
ist sich selber Noten und Zusammenklang,
bettet die Örtlichkeit
in die Äußerung,
Schilfmusik, ein alter Barde
der seine Nebel atmet
durch Vokale und Geschichte.
In Gedichten wie „Fodder“, „Anahorish“, „Toome“ und „Broagh“ lotet Heaney die Ortsnamen seiner Heimat aus und fördert ihr gespaltenes Erbe zutage – das katholische und das protestantische, das irisch-nationalistische und das britisch-loyalistische. Auch die Gedichte, in denen es nicht um die politische Spaltung und ihre Konsequenzen geht, sind davon gefärbt; die Personen, die im Gedicht erscheinen, tragen oft die Züge von Außenseitern, von Menschen, die unter gesellschaftlicher Diskriminierung leiden oder sich ausgeschlossen fühlen.
Einen entscheidenden Anstoß zu seiner Deutung von Landschaft erhielt Heaney, als er 1969 die Forschungsergebnisse des dänischen Archäologen P.V. Glob in dessen Buch Die Schläfer im Moor für sich entdeckte. Glob schildert in seinem Werk über die früheisenzeitliche Kultur in Nordeuropa unter anderem auch Rituale, in deren Verlauf Jünglinge der Erdgöttin Nerthus als Sühneopfer dargebracht wurden, um damit gute Ernten zu erwirken. Heaney war frappiert von den Analogien, die zwischen dem Ritualgeschehen im eisenzeitlichen Nordeuropa und dem wieder aufflammenden Konflikt in Nordirland bestanden. Der Zwist zwischen den Bevölkerungsparteien gewann nun dramatische Gestalt in Form von Bombenanschlägen, Morden, Aburteilungen und Hungerstreiks. Die Spirale mörderischer Gewalt und Gegengewalt ließ auch die Arbeit des Dichters nicht unberührt, von dem man erwartete, daß er sich zum Sprachrohr der Klagen und Leiden seiner Landsleute machte.
In „Der Mann aus Tollund“ (The Tollund Man), einem von mehreren Gedichten über die Moorleute, nimmt er die Maske des Pilgers an.
Einmal werd ich nach Aarhus fahren,
Seinen torfbraunen Kopf zu sehen,
Die sanften Schoten seiner Lider,
Seine spitze Lederkappe.
Der katholische Dichter setzte sich dem Vorwurf der Blasphemie aus, wenn er diesen „Heiligen“ aus dem Moor um Fürbitte für Frieden in Nordirland anrief. So wie katholische Heilige für ihren Triumph über die Vergänglichkeit des Leibes gefeiert werden, so haben auch diese Körper ihre Unversehrtheit und Schönheit in dänischen Mooren bewahrt. Barbarische Wildheit wurde verwandelt. Wie Christus, das Opferlamm, das von den Toten auferstand und verklärt wurde, so haben auch die Moorleichen ihr Begräbnis überlebt und existieren in einem neuen Licht fort. Das Gedicht setzt zwei Formen der Gewalt in Beziehung, das Fruchtbarkeitsritual der Vorzeit und die Wiederkehr solcher Grausamkeit in der Gegenwart. Die Analogie wird schmerzhaft deutlich.
Da draußen in Jütland,
In den alten mann-mordenden Gemeinden,
Werd ich mich verloren fühlen,
Unglücklich und daheim.
In Norden (North, 1975) sagt Heaney angesichts des Schreckens, „wenn jetzt die Nachrichten kommen / von jedem Mord in der Nachbarschaft“, [spüren wir] Sehnsucht nach „Zeremonien / nach Rhythmen des Brauches“. Das Gedicht bietet besänftigende Bilder – „gemäßigte Schritte“, „surrende Familienlimousinen“, „schlafwandelnde Frauen“, alles stimmt ein in das „gedämpfte Trommeln / von zehntausend Motoren“. Der „langsame Triumphzug“ der Trauergesellschaft zu den Megalithgrabstätten an der Boyne verbindet das heutige Nordirland mit dem alten, mythologischen Ort. Wenn die Trauernden in den Norden zurückkehren, dann, so heißt es im Gedicht, hat sich ihr Schmerz gelöst. Als Teil dieser Besänftigung vergegenwärtigt Heaney das Bild Gunnars, der in der isländischen Njals-Saga über den Tod triumphiert. So wie dessen Brüder für ihn antworteten, so antwortet das Volk im Gedicht den Bildern seiner Vorfahren.
jene unter dem Hügel denken wir uns
zur Schau gestellt wie Gunnar,
der sehr schön lag
in seiner Grabkammer,
obwohl gewaltsam getötet
und ungerächt.
Männer sagten, er habe
Verse über die Ehre gesungen
und vier Lichter hätten gebrannt
in den Ecken der Kammer:
die sich dann öffnete, als er sich wandte
mit freudigem Gesicht
den Mond zu betrachten.
Im Tod wurde Gunnar von der Vergeltung befreit. In der Kunst, ob in der Saga oder im Gedicht, wird Zwietracht gelöst. Der Dichter lindert die Leiden seines Volkes, indem er Tod, Gewalt und Schmerz durch die Schönheit der Sprache verwandelt.
Aber er muß seine Unabhängigkeit wahren. In Norden ermahnt ihn die Wikingerstimme
… leg dich
in den Wortschatz, erforsche
Windung und Schimmer
deines gefurchten Hirns.
Schreibe im Dunkel.
Harre auf langem
Raubzug des Nordlichts,
doch keiner Lichtkaskaden.
Dieser Ratschlag stellt dem alten Wikingerhaß und mörderischem Zwist die Geheimnisse der dichterischen Gestaltung gegenüber; die Verbindung von „Wortschatz“, „erforschen“ und „langem Raubzug“ transponiert den Sinn in die Domäne der ästhetischen Schöpfung. Andere Gedichte in Norden schwelgen in Sprach- und Bildassoziationen. „Verwandtschaft“ (Kinship) besteht aus vierzeiligen Strophen und kommt in einer flüssigen Abfolge von Vergleichen und Bildern leichtfüßig daher. Es ist ein Liebesgedicht an das, was „Moorland“ forderte.
Erdene Vorratskammer, Knochengewölbe
Sonnenufer, Einbalsamierer
von Votivgaben
und niedergesäbelten Flüchtlingen.
Unersättliche Braut.
Schwertschlucker,
Sarg, Dunghaufen,
Treibeis der Geschichte.
Diese ungemein suggestiven Gedichte sind Akte der Einfühlung; der Dichter imaginiert und erschafft in einem Zug, das Gedichtete wird das, was es vergegenwärtigt. Heaney, der nach Keats vielleicht größte sensualistische Dichter, kann im Gedicht Ausbrüche öffentlicher Gewalt thematisieren und zugleich über privaten Frieden und das Feiern von Intimität schreiben. Solche in tiefe seelische Schichten vordringende Gedichte, die sich in allen Epochen seines Schaffens finden, entziehen sich der intellektuellen Analyse und bewahren ihr Geheimnis. „Sonnenlicht“ (Sunlight), das erste von zwei Gedichten in Norden, die unter dem Titel „Mossbawn: Zwei Widmungsgedichte“ zusammengefaßt sind, gleicht einem Gemälde von Vermeer: das Spiel von Licht und Schatten, der lichtdurchflutete Raum, die genrehafte Darstellung des Handwerks des Brotmachens.
Nun fegte sie den Tisch
mit einer Gänseschwinge,
nun sitzt sie, breithüftig,
mit mehlweißen Nägeln
und fleckigen Schienbeinen:
nochmals ein Raum,
während im Ticken zweier Uhren
der Teekuchen aufgeht.
Und Liebe –
wie eine Zinnschippe,
die aufschimmerte
und im Mehltrog versank.
In Feldarbeit (Field Work, 1979) stellt sich der Dichter die Frage nach seiner Rolle in Zeiten anhaltender Gewalt. „Was wird aus uns werden?“ „Unsere Insel ist voll trostloser Geräusche.“ Welchen Wert und welche Funktion hat Dichtung? Die Antwort wird eher durch Bild und Metapher vermittelt als durch expliziten Ausdruck von Hoffnung. „Unsere Insel ist voll trostloser Geräusche.“ In „Die Straße nach Toome“ (The Toome Road) begegnet der Dichter britischen Soldaten in gepanzerten Konvois; sie sind auf seinem Weg. In den Elegien für tote Freunde verzichtet Heaney auf mythologisierendes Sprechen wie in Norden und findet zu einer direkten Auseinandersetzung mit der Gewalt extremistischer Sektierer. Die Beschreibung der Ermordung seines Vetters in „Der Strand von Lou Beg“ (The Strand at Lough Beg) schließt in einem tröstenden Ton:
Knie mich selbst hin ins triefend nasse Gras
Und schöpfe kalte Händevoll von Tau,
Um dich zu waschen, Vetter. Reinige dich mit Moos,
Fein wie ein Geniesel, das die Luft aufschwemmt.
Ich heb dich an und lege dich zurecht.
Ich rupfe frische Binsen aus und flecht
Ein Skapulier aus Grün zu deinem Totenhemd.
Zu Beginn des Purgatorio fährt Vergil mit der gleichen Handbewegung über Dantes Gesicht, und tatsächlich ist die Gestalt des italienischen Dichters in Station Island, Heaneys nächster Gedichtsammlung, in der viele Begegnungen mit Opfern der Gewalt im Nordirlandkonflikt gestaltet sind, durchgehend präsent.
Die sorgenvolle Stimme aus Feldarbeit artikuliert sich in Station Island (1984) direkter, und diese Sammlung beginnt auch mit Gedichten, die nach dem Wert der Dichtung überhaupt fragen.
Was bürgt noch für Bestand,
wenn Eisenbahnen wie Dorngestrüpp
aus Böschungskraut gerissen werden können?
Im Titelgedicht, einer Schilderung der Pilgerreise des Dichters nach Lough Derg, in deren Verlauf er Gestalten und Ereignisse der Vergangenheit vergegenwärtigt, sieht sich der Dichter herausgefordert. So wirft der ermordete Vetter Heaney vor, er habe eine bloße Ausflucht mit künstlerischem Takt verwechselt.
Den Protestanten, der mir den Kopfschuß gab,
den klag ich an, doch indirekt auch dich,
der du jetzt vielleicht Abbitte tust auf diesem Bett,
fürs Häßliche, das du geschönt hast.
Die Jalousien des Purgatorio hast du herabgelassen
und meinen Tod mit Morgentau versüßt.
Ein anderes Opfer erlebt in den Gedanken des Dichters nochmals seine Ermordung und enthüllt damit des Dichters „Umsichtige Anteilnahme“. Heaney erwidert: „Verzeih mein feiges Unbeteiligtsein.“
Ich hasse es, wie rasch ich kuschte.
Ich hasse, wo ich geboren wurde, hasse alles,
Was mich teilnahmslos und fügsam machte.
Er möchte Wiedergutmachung leisten, möchte im Drama des Gedichts zeigen, wie sehr ihn die Ereignisse mitgenommen haben. Gleichzeitig fordert er aber auch seine Rechte als Dichter. Mit seiner Pilgerreise hofft er, sein Gewissen zu läutern und sich sein Freiheitsrecht zu verdienen. Von James Joyce, dem er am Ende seiner Reise begegnet, erhält er den Rat:
… Halte dich tangential.
Öffnen sie den Kreis, ist es an der Zeit,
hinauszuschwimmen auf eigne Faust, das Element
mit Signalen deiner Frequenz zu markieren,
Echolote, Bodenproben, Leuchtköder,
Aal-Schimmer im Dunkel der See.
und das ist die Antwort, die der pilgernde Poet sucht.
Die Gedichte über Sweeney in der letzten Abteilung der Sammlung illustrieren die Wahrheit dieser Ermahnung. In der Gestalt des legendären irischen Königs, der wegen eines Sakrilegs in einen Vogel verwandelt wurde, in die Wälder floh und Exil und Isolation als Anlaß zum Dichten nahm, unterstreicht Heaney das Recht auf poetische Freiheit. Sweeney in der Irre (Sweeney Astray, 1983), eine Nachdichtung der irischen Verserzählung Buile Suibhne, kann, wie er selbst sagt, gelesen werden als „ein Aspekt der Spannung zwischen der freien schöpferischen Imagination und den Zwängen religiöser, politischer und privater Verpflichtung“. Sweeney flüchtet vor der Menge und befreit sich von staatlichen und kirchlichen Fesseln. Er verkörpert Heaneys Verständnis von Dichtung, die „außergewöhnlich, befremdend und anders“, aber nicht pflichtbewußt und volkstümlich sein dürfe.
Ich stand fest in Treue,
bis sie mich schließlich,
einen Esser fern der Schlachtfelder nannten.
So meisterte ich neue Lufträume
und überflog aus sicherer Entfernung
ihre Lager und Freudenfeuer auf den Höhen
Einige Gedichte aus Die Hagebuttenlaterne (The Haw Lantern, 1987) sind Parabeln für die dem Dichter unverzichtbare Unabhängigkeit. „Von der Grenze des Schreibens“ (From the Frontier of Writing) beginnt mit der Beschreibung einer Militärkontrolle, die das lyrische Ich – „übermannt, ja untertänig zahm“ – über sich ergehen läßt. Dann aber wird diese Erfahrung in Dichtung verwandelt und bringt die Freiheit zurück.
Und plötzlich bist du durch, angeklagt doch freigesetzt.
In der Hagebuttenlaterne (1987) und in Gesichtetes (Seeing Things, 1991) hat sich Heaney fester denn je in der Republik seines Gewissens eingerichtet. Er ist nicht an das Alltagsgeschäft gebunden. „Unsichtbares“ schimmert auf, erscheint und verschwindet. Die geistige Welt mit all ihren Bedeutungen und Erscheinungen ist das geheime, flüchtige, leuchtende, manchmal auch gefürchtete Thema. In einem Gedicht aus der Folge der „Peilungen“ (Squarings) scheint das „sichtbare Meer“ dem suchenden Blick leer zu sein, aber kaum habe man ihm den Rücken gekehrt, „hatte es plötzlich tausend Augen wie Argus“. Schaue man wieder zurück, schien es
Noch unberührt, und dennoch wie entleert,
Als wär eine Truppe in schimmernder Wehr, die eben noch
am Rande des eignen Gesichtsfelds exerzierte,
hinter dem Horizont verschwunden, sich neu zu formieren.
Der Sprecher wendet seine Aufmerksamkeit dem Daseienden zu: „vollkommene Schau“ – wenn sich die Dinge in hellem Licht darbieten. Die Sprache befaßt sich mit Wirklichem, aber auch mit abwesendem oder vergangenem Wirklichen wie z.B. mit dem Kastanienbaum:
Seine Wucht und Stille werden ein helles Nirgends,
Eine Seele, sich verästelnd und für immer
Schweigend, jenseits des Schweigens, das man sucht.
Was jenseits des Schweigens, jenseits des Sichtbaren, aber doch nicht völlig verloren ist, muß nicht geringer sein, als das, was dem Dichter direkt in die Sinne fällt.
Wer sah denn je
die Grenze im Gegebenen?
Das Wunderbare lebt im Gewöhnlichen – das geht dem lyrischen Ich bei vielen Gelegenheiten auf, beim Betrachten eines sich drehenden Rads, beim Schaukeln, beim Liegen auf gefällten Bäumen, beim Gehenlassen und Wiederkommen, wie Aeneas, gestärkt und bereichert:
das Gegebene
Kann jederzeit vergegenwärtigt werden
Auch das ist eine Pilgerfahrt „über unsere gewöhnliche Selbstkontrolle hinaus“. Kontrastierende Ansichten der Wirklichkeit werden innerhalb eines Gedichts oder in der Abfolge zweier Gedichte dargeboten. Das Ausgleichen und Austarieren, das Aufstellen immer neuer poetischer Gleichungen sind Mittel, mit denen der Dichter zu seiner Balance findet. Er gelangt an den Punkt, an dem die Wasserwaage des Zimmermanns im Gleichgewicht steht, in der Mitte zwischen widerstreitenden Kräften:
In Apposition zur
Allgegenwart, zum Gleichgewicht, zum Rand
Im Schauen erreicht er verschiedene Seinsstufen, sieht klar und deutlich das Gegebene oder vergegenwärtigt Abwesendes oder Vergangenes. Entscheidend ist das poetische Wiedererschaffen. Das Bild der Wirklichkeit, das Dichtung bietet, soll diese transformieren, nicht lediglich widerspiegeln.
Der wirklich schöpferische Autor wird dadurch, daß er seine Wahrnehmung und seine Ausdrucksmittel in die Waagschale wirft, die Voraussetzungen verwandeln und das hervorbringen, was ich die „Verteidigung der Poesie“ (the redress of poetry) genannt habe.
Die verwandelnde Macht der Dichtung ist in der Sammlung Die Wasserwaage (The Spirit Level, 1996) überall spürbar. „Ein Sofa in den vierziger Jahren“ (A Sofa in the Forties) bringt eine Erinnerung an ein Spiel aus Kindertagen, als die Kleinen auf dem Sofa knieten und so taten, als seien sie in der Eisenbahn.
Erst rangierten, dann pfiffen wir, dann
Sammelte jemand Unsichtbares ein
Als Fahrscheine und lochte es gravitätisch,
Während Wagen um Wagen unter uns
Beschleunigte, tsch-tsch, die Sofabeine
Verschwammen, und die Unerreichbaren
Fern auf dem Küchenboden zum Abschied winkten.
Durch die verwandelnde Kraft der kindlichen Phantasie wird das Alltägliche und Wirkliche zum Außergewöhnlichen und Unwirklichen, ja das Phantasierte scheint mit einemmal realer. Dem Geist der Bewegung und des Elans entsprechend, zeichnet sich das Gedicht durch klangliche und rhythmische Vielfalt aus. Es gibt dem Wunderbaren Raum und macht es zugleich glaubhaft. Die suggestive Kraft der dichterischen Imagination versetzt auch unseren Geist in Bewegung und Schwung.
Wo lebt der Geist? In oder außer
Erinnertem, Gemachtem, Ungemachtem?
Wir nehmen an dem Kinderspiel teil und erkennen freudig seine Wahrheit als erinnerte Erfahrung an. Die kindliche Erfindungsgabe macht auch Mängel wett – „das unzulängliche Spielzeug“ – und auch darin sieht Heaney eine Tugend der Dichtung: Die Entschädigung für Enttäuschungen. „Die Verwandlung des menschlichen Daseins durch Imagination“, sagt er, „ist das Mittel, durch das wir es am besten verstehen und begreifen können.“
… hatte es für sich Bestand,
Himmelwärts strebend, sicher erdverhaftet,
Teil eines Sinns, vielleicht, einer Enttäuschung.
Die Fähigkeit des Menschen zum Spiel, das ihn zugleich entspannt und trägt, prägt diese Gedichte ebenso wie der Sinn für die stabilisierende Kraft der Dichtung. Sie kann Gleichheit wiederherstellen, uns zu einer Neuorientierung befähigen, uns unseren Aplomb wiedergeben und unsere emotionale Spannkraft erhalten. Alle Bedeutungen von „wiederherstellen“ (to redress) sind relevant. In „Aushalten“ (Keeping Going) schildert Heancy, wie sein Bruder einen Dudelsackpfeifer mimt; eine Malerbürste ersetzt die Felltasche, ein umgekehrt über der Schulter gehaltener Küchenstuhl dient ihm als Dudelsack. Seine schauspielerische Begabung, sein Talent, andere zu verzaubern und bei der Stange zu halten, ist das Sublime an dieser Szene.
Deine Augen am Überquellen, deine dicken Backen am Platzen
vor Lachen, und dabei den Baßton aushaltend,
Weiter und weiter, zwischen raschen Atemzügen.
Die Darbietung ist die Hauptsache. Und eben diese Fähigkeit feiert das Gedicht, indem es die Erinnerung an unbeschwerte Kindertage mit dem zeitgenössischen Bombenterror in Parallele setzt. Die Malerbürste dient nun dazu, die Spuren einer Bluttat wegzuwischen.
Graues wie Rollsplitt, mit Blut vermischt,
klebt an der hellen Tünche. Eine saubere Stelle,
wo sein Kopf gelegen hatte,
Am Schluß wendet sich Heaney an den Bruder – „du hast Ausdauer. / Du stehst deinen Mann, wenn es drauf ankommt“. Er bleibt in der Rolle, freudestrahlend und gestikulierend; darin liegt auch etwas Rettendes. Damals in der Küche war er der alle verzaubernde Dudelsackpfeifer, jetzt aber „kannst du die Toten nicht auferwecken; oder das Krumme Gerade machen“, aber er hat Stehvermögen.
Heaney setzt sich mit den dunklen Seiten auseinander, spricht ohne Umschweife und mit erdnaher Stimme über das Böse und Häßliche. Das Zuhause der Kindheit kannte auch Angst und Furcht, den Schwefelgeruch der Hölle. Nur selten wurde die „Seele in Ruhe gelassen“. Die Gewalt, die später ausbrach, machte wahr, was man immer schon geahnt, was in der Luft gelegen hatte. Die Bilanz fällt ernüchternd aus. „Gute Nachrichten“ (Good tidings) laufen auf folgenden Grundsatz hinaus:
Dieser Grundsatz, zu ertragen, tragen
Und austragen, das Unerträgliche in anderen
Gegen das Unerträgliche in uns aufzuwiegen,
Denn was es auch sei, in das wir uns schicken,
Wir müssen es dulden
Wider besseres Wissen.
Es kommt darauf an, sein Gleichgewicht zu finden, die richtige Haltung gegenüber einem Geschehen einzunehmen. In dem Gedicht „Der hl. Kevin und die Amsel“ (St. Kevin and the Blackbird) sehen wir den heiligen Mann mit ausgebreiteten Armen kniend im Gebet, wobei ein Arm durch das Fenster seiner engen Zelle ragt. Eine Amsel baut ihr Nest in der ausgestreckten Hand und legt ihre Eier hinein. Der Heilige ist gerührt, „sieht sich in den Kreislauf des ewigen Lebens eingebunden“, und muß nun die Hand aufhalten, bis die Jungen großgezogen und flügge geworden sind. Was Heaney an dieser Legende interessiert, sind die Fragen. Wie ging das zu? Welches Gefühl hatte der Mann dabei? Vergaß er sich darüber, oder war es für ihn eine einzige Qual? Auch hier geht es um Gleichgewicht und Haltung.
Vom Nacken abwärts bis zu seinen schmerzenden Unterarmen?
Sind seine Finger eingeschlafen? Spürt er seine Knie noch?
Oder ist der traumlose Schlaf der Erde
In ihm emporgestiegen? Hält sein Kopf noch Abstand?
Allein und gespiegelt im tiefen Strom der Liebe,
Betet er, „zu dulden und keinen Lohn zu suchen“.
Sein ganzer Leib spricht dieses Gebet,
Hat er doch sich selbst vergessen, den Vogel vergessen
Und am Ufer den Namen des Flusses vergessen.
Die Gedichte in Die Wasserwaage sind in Heaneys unverwechselbarer Sprache geschrieben: die Imagination realitätsgesättigt, der Rhythmus pulsierend, die Stimme machtvoll, der Ton nuanciert. „Die Schaukel“ (The Swing) gibt eine weitere Metapher für Balance und Gleichung, für das Gehenlassen und Wiederkommen, für die Vision von „Licht über Feldern und Hecken, … wie eine Geburtsszene / Vorder- und Hintergrund“. Die Schaukel selbst ist „ein Trugbild, das die Seele lockt, sich zu erheben“. Die Sprache des Gedichts enthält das beobachtete realistische Detail und die durch geänderte Blickrichtung offenbarte Schönheit, „der strahlende Rand der Grenze“.
Seamus Heaney kann auch in einer bildkräftigen, eleganten Prosa hinreißend über Dichtung schreiben. In Hauptbeschäftigungen. Ausgewählte Prosa 1968–1978 (Preoccupations, 1980) berichtet er von seinen Jahren auf dem Bauernhof und in Belfast. Andere Essays behandeln Dichter, die ihn beeinflußt haben – Gerard Manley Hopkins, dessen stark akzentuierende, konsonantische Sprachmusik er früher selbst nachgeahmt hat; Patrick Kavanagh, der ihm Bestätigung dafür war, daß bäuerliches Leben ein gültiges literarisches Thema sein kann; Wordsworth, an dem er das Verhältnis zwischen dem „beinahe physiologischen Vorgang des Dichtens“ und „der Musik des fertigen Gedichts“ diagnostizierte.
Behandelt Hauptbeschäftigungen Themen seiner frühen Dichtung, greift Die Herrschaft der Sprache (The Government of the Tongue, 1988) Fragen auf, die in Norden, Feldarbeit und Station Island aufgeworfen wurden. Auch hier fragt Heaney, worin die Daseinsberechtigung der Dichtung bestehe. Ist sie nicht Verrat am Leiden der Menschen? Soll man überhaupt Lyrik in Leidenszeiten schreiben? Seine Hochachtung für Schriftsteller, die sich dem Leid gestellt haben, geben eine Antwort auf diese Fragen: Anton Tschechow, der Cognac trank, während er die Deportierten bei der Arbeit im Straflager stöhnen hörte, ist ein Beispiel für das Recht des Dichters auf seine spezifische Begabung. Die Metapher des großen Bienenkorbs, mit dem Ossip Mandelstam Dantes Göttliche Komödie kennzeichnet, ist für Heaney Beleg dafür, daß Dichtung nicht durch theologische oder philosophische Ideen determiniert wird, sondern aus der bedeutungsschaffenden Tätigkeit des freien Ausschwärmens im Unbewußtem resultiert. Autoren, die der politischen Repression getrotzt haben wie Ossip Mandelstam, Zbigniew Herbert und Czesław Miłosz, sind für Heaney Gestalten, deren Bund mit der Dichtung vor aller Politik genau die Entscheidung bestätigt, die er selber stets vertreten hat. Ihr Ideal einer klaren, unverbrämten dichterischen Sprache, die auf die Realität eingeht und Parabel und Gleichnis nutzt, um die politische Zensur zu unterlaufen, kommt dem sehr nahe, was es in Feldarbeit getan hat. Er plädiert für die Einzigartigkeit der Dichtung, die für sich schon einen Wert darstellt. Station Island hat einiges gemein mit Tschechows Bericht über seine Reise nach Sachalin. In beiden Fällen handelt es sich um ein exorzistisches Ritual, an dessen Ende die wiedererlangte psychische und künstlerische Freiheit steht. Beide Autoren stellen sich dem Schrecken, sind tief angerührt, stehen aber unerschütterlich zu ihrem Gewissen als Schriftsteller. Mit anderen Worten, lyrisches Sprechen ist eine Form radikaler Zeugenschaft. Es kommt in einer Sprache zum Ausdruck, die sich nicht einschüchtern läßt. Mit ihm wird ein Gleichgewichtszustand erreicht: im fertigen Gedicht erscheint etwas, das „von Selbstrechtfertigung und Selbstauslöschung gleich weit entfernt ist“. Für die Dauer des Gedichts, so Heaney, stelle sich eine Ebene her, auf der der Dichter in seinem Wesen gestärkt und von Zwängen befreit ist. Der sozialen Verpflichtung entbunden, ist seine Sprache ebenfalls frei. Mit dieser Überzeugung, die bereits im Austarieren von Schönheit und Greuel in Norden anklang, greift Heaney dem Thema seines nächsten Essaybands vor.
Die Verteidigung der Poesie umkreist eine Reihe von Dichtern, darunter W.B. Yeats, Philip Larkin, Elizabeth Bishop, John Clare, Oscar Wilde und Dylan Thomas, und kommt zu der Überzeugung, daß die Verwandlung des menschlichen Daseins durch Dichtung gerade das Mittel ist, durch das wir unser Dasein erst begreifen und wirklich verstehen. Die Idee der Verteidigung schließt die Idee des Gegengewichts ein – „die Waagschalen der Wirklichkeit zu einem transzendenten Gleichgewicht bringen“. Heaney verfährt dabei mit einer Autorität, die er durch sein Schreiben gewonnen hat und macht seine Entdeckungen zum Gegenstand dichterischer Erkenntnis. Schon immer galt seine Aufmerksamkeit dem Geheimnis der Kreativität, den verborgenen Wegen, auf denen Gedichte an die Oberfläche des Bewußtseins kommen, der Verbindung zwischen einem gegebenen, natürlichen Idiom und der durch Bildung und eigene Lektüre erworbenen Sprache, schließlich dem Prozeß des Dichtens, bei dem, wie er es ausdrückt, eine persönliche Kraft durch eine ästhetische Distanz bewegt werde.
Wie anderen Schriftstellern in diesem Jahrhundert blieb auch Heaney die Auseinandersetzung mit Sinnlosigkeit, Nihilismus und Leere nicht erspart. Dichtung, so bekräftigt er, müsse sich szientistisch inspirierter Philosophie entgegenstellen und als Gegenkraft zur Negativität des Bösen wirken. Damit es Menschen gelingt, „die bestmöglichen Bedingungen dafür zu schaffen, sich auf Erden einzurichten, ist es wesentlich, daß das dichterische Bild der Wirklichkeit transformierend wirkt und kein bloßer Abklatsch der gerade hier und jetzt herrschenden Verhältnisse ist. Dichter im wahrsten Sinne des Wortes ist, wer in seinem Schreiben die Bedingungen seiner Existenz, auch wenn er sich ihnen unterwirft, doch zu unterlaufen sucht“. Seamus Heaney ist solch ein Dichter.
Maurice Harmon, aus: Seamus Heaney: Tod eines Naturforschers, Coron-Verlag, 1996
Aus dem Englischen von Reinhard Tiffert
Die Gedichte wurden übertragen von Henriette Beese, Giovanni Bandini / Ditte König und Reinhard Tiffert
DER TUNNEL
für Seamus Heaney
Er ging geradewegs in den Tunnel hinein,
folgte dem Licht seiner winzigen, silbernen
Taschenlampe, erworben auf Kreta.
In seiner Tasche ein Skalpell und ein
zusammengelegter Beutel. Das Telefon
steckte in seinem Gürtel.
Kopfhörer führten ihm Coltranes rauhe
Klänge zu. Er schob sich vorbei
an Hundeschädel und Tennisball,
an einer verstaubten Bibel.
North, der Gedichtband, lehnte
an der Wand. Er vergewisserte sich –
jawohl, signiert. Er schlitterte weiter,
der Lichtstrahl reflektiert von Mosaik-
spiegeln unter der niedrigen Decke.
Das Saxophon tobte, er summte mit,
schnupperte die eingeschlossene Luft,
tastete sich vor, als könne das Licht
etwas Entscheidendes übersehen,
ein Zeichen verbergen.
Er schob sich ein Kaugummi in den Mund
und kaute, kämpfte sich weiter, vorbei
am gerahmten Bild vom zerbombten Berlin,
dem verzogenen Tennisschläger, einem Gewehr.
Die Karte Europas erschien an der Wand,
verschwand wieder. Eine Stimme übertönte
Coltrane, zählte bis hundert,
und genau bei hundert trat er ein
in ein rotes Gemach. Er nahm Haltung an
und ging auf den sitzenden Leichnam zu.
Matthew Sweeney
Übersetzung Jan Wagner
Fakten und Vermutungen zu Michael Krüger + Instagram +
KLG + IMDb + PIA + Archiv
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Michael Krüger – Lebenselixier Literatur im Gespräch mit Norbert Bischofberger, SRF 22.9.2013.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Tobias Döring: Hier regiert die Zunge
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.4.2009
Volker Sielaff: Nachrichten aus dem irischen Ägypten
poetenladen.de, 13.4.2009
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1, 2, 3 & 4 + KLfG +
IMDb + PIA + Internet Archive
Porträtgalerie: Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Seamus Heaney: Der Spiegel ✝ FAZ 1 + 2 ✝
Die Welt ✝ Tagesspiegel ✝ NZZ 1 + 2 ✝ der Standart ✝
Berliner Zeitung ✝ Badische Zeitung ✝ taz ✝ SZ ✝ Akzente ✝︎
Seamus Heaneys Rede zu seinem 70. Geburtstag.


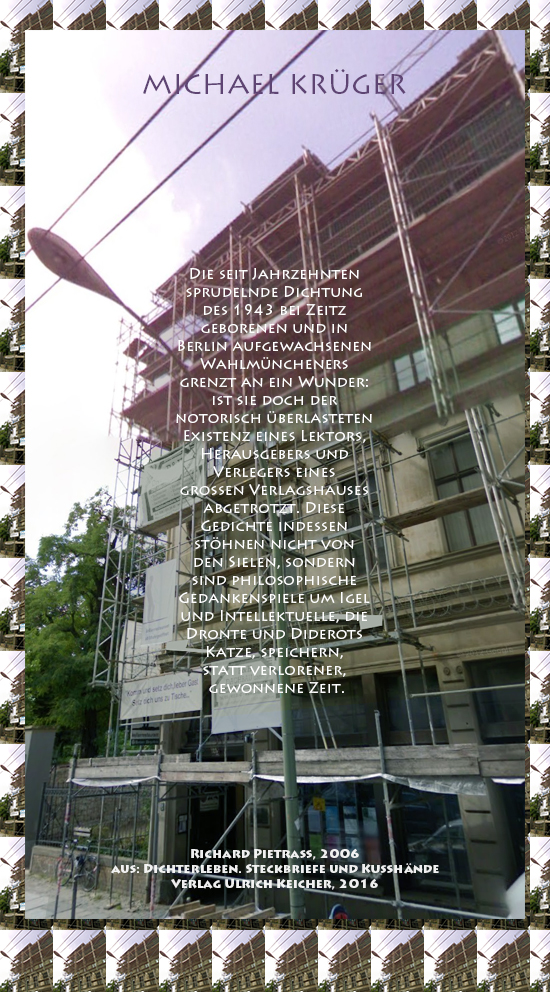












Schreibe einen Kommentar