Steffen Mensching: Tuchfühlung
VOR DEM SICHERUNGSKASTEN
Auch ich hab die Schnauze voll
Elektronischer Bauelemente. Auch die Nase.
Plus oder Minus.
Was ist eigentlich Phase?
So viele Spannungsherde. Seltsam ambivalent.
Wer kennt
Mein privates Stirb und Werde.
10 Ampere oder Watt oder Ohm.
Ich arbeite zuviel und zu oft unter Strom.
Zu gut geerdet
Heißt gefährdet. Und mit Sicherheit
Nicht zu retten.
Ich greife ein in die Leitungen
Mit feuchtnasser Hand.
Sachte, mein Junge (meinen die Zeitungen)
Hat sich schon mancher die Finger verbrannt.
Du bekommst eine gescheuert. Allerdings
Nur mit links
Wird hier gar nichts erneuert.
Ich lasse mir allerhand durchgehn.
Erhitze alte Schalter und Leiter,
Bis sie glühen und irgendwann durchdrehn,
Mache ich immer noch weiter.
Horch, Horch,
Der Energiezähler kichert,
Ob ich auch hoch genug abgesichert.
Nur nicht dran denken.
Ich muß die Leistung erhöhen, die Spannung senken.
Ansonsten brenne ich durch. P = I mal U.
Und raus bist du.
Tuchfühlung
− das ist eine Geste menschlicher Nähe, tastende Suche nach Kontakt, (prüfende) Annäherung an einen Stoff, der einen Körper schützt, birgt, wärmt und verbirgt. Mensching prüft die Nahtstellen von Zeitereignissen und Individuum in der Entwicklung der heute 25-30jährigen, seiner Generation, von Sich aus, als Versuch einer poetischen Biografie. Dabei setzt der Autor das ganze Repertoire seiner – auch durch Bühnenauftritte bekannten – Mittel ein. Wortspiele, pointierte Dialoge, distanzschaffende Ironie und Selbstironie, Anspielungen. Und stockt da einer, möche „na aber…“ sagen, findet er wenig später die poetisch legitimierende Antwort: „… es lebt sich schwer mit einem Geschichtsbuch unterm Kopfkissen!“
Steffen Mensching, bekannt durch seinen Gedichtband Erinnerung an eine Milchglasscheibe, für den er den Debütpreis des Schriftstellerverbandes 1984 erhalten hat, stellt mit Tuchfühlung unmittelbar danach seinen zweiten Gedichtband vor.
Mitteldeutscher Verlag, Klappentext, 1986
„Meine utopische Taschenuhr“
Steffen Mensching ist nun wirklich kein Debütant mehr. Schon als 1979 sein Poesiealbum erschien – es enthielt immerhin einen Text wie „Traumhafter Ausflug mit Rosa L.“ –, konnte man ihn kaum noch einen Geheimtip nennen. Der Band Erinnerung an eine Milchglasscheibe (1984) war sofort vergriffen und löste einige Bewegung im Blätterwald unserer sonst eher moderaten Literaturkritik aus.1 Jetzt legt er seine dritte selbständige Publikation vor. Mensching gehört zu einer Gruppe junger Autoren, die um die Wende von den siebziger zu den achtziger Jahren der Lyrikentwicklung in unserem Land einen kräftigen Auftrieb gegeben haben. Mit Hans Brinkmann, Thomas Böhme, Ralph Grüneberger, Dieter Kerschek, Kathrin Schmidt, Hans-Eckardt Wenzel und anderen setzte er eine Tendenz fort, die sich in den Jahren zuvor bereits abzuzeichnen begann: den Ausbau des „Ich-Gewinns“, der differenzierten Individualitätsgestaltung in lyrischer Poesie durch deren Verschmelzung mit Zugriffen auf die „große Welt“ bedeutsamer gesellschaftlicher Gegenstände. Impulse dazu kamen von zwei Seiten: von der Singe-Szene („Liedertheater“, „Politrock“ eingeschlossen), wo das Bedürfnis nach Differenzierung und Individualisierung operativer, tagespolitischer Texte wuchs, aber auch aus dem inneren Kern der von „subjektiver Authentizität“ getragenen „leisen“ Lyrik, in der das Bedürfnis nach Welthaltigkeit, nach Auseinandersetzung mit den bewegenden Fragen der Epoche stärker wurde. Beide Tendenzen ergeben sich letztlich aus veränderten innergesellschaftlichen und epochalen Konstellationen: aus dem Bewußtwerden globaler Probleme und der Entwicklung des Sozialismus in einem historischen Stadium, da Entscheidungssituationen von strategischem Rang auf der Tagesordnung stehen. Empfindungen der Sorge, des Bedrohtseins verstärkten sich, aber auch das Gefühl der Verantwortlichkeit, die Suche nach Alternativen, nach Möglichkeiten für sinnvolles individuelles und kollektiv-solidarisches Handeln.
All das ist schon den Gedichten in Menschings erstem Band abzulesen. Alltagserfahrung und Weltbewegung rücken näher aneinander („World time table“, „Drei Radios im Hinterhof“). Gegenwart und Geschichte verschränken sich, um zugleich auf Künftiges zu weisen („Blanqui in der Boutique“, „Betrachtung eines Stillebens“, „Siqueiros: Unser Antlitz“). Selbst Momentaufnahmen ganz persönlicher Befindlichkeit enthalten Assoziationen, Gebärden, die auf die Problemlage der „großen Welt“ deuten („Unter den Linden“, „Auf einem Bein, nachts, nackt“), Gestalten der Vergangenheit werden heraufbeschworen, um an ihnen verschiedene Haltungen zur Widerspruchsdialektik revolutionärer Prozesse zu erkunden oder zu erproben („Hegel bei den Skulpturen“, „Traumhafter Ausflug…“, „Urlaub Majakowskis mit Lilja und Ossip Brik. Sommer 1929“, „Hölderlin“). Mit Genugtuung konstatierten Literaturkritik und interessierte Öffentlichkeit einen Zuwachs an Welthaltigkeit, geistigem Profil und künstlerischem Anspruch, zumal letzterer – darin war sich die Mehrheit einig – auf einem beachtlichen sprachlichen Niveau eingelöst wurde.
Es gab zur Milchglasscheibe aber auch kritische Einwände. Michael Franz etwa, der die Mehrheit der Gedichte geradezu mit Begeisterung aufnimmt, resümiert:
Er ist in jungen Jahren bereits ein versierter Mann. Virtuosität sollte kein Vorwurf sein; ich habe jedoch den Eindruck, daß Mensching seine eigene Sprache und Form noch nicht gefunden hat.2
Und Bernd Leistner, der nur einen begrenzten Teil der Texte gelten läßt, bemängelt die weitgehende Abwesenheit eines „existentiellen Ichs“, von dessen „Selbstkundgabe“ die Gedichte getragen sein müßten.3 Da Leistner das „Selbst“ des Dichters im Auge hat, laufen beide Vorwürfe auf den Punkt hinaus, Menschings Poesie sei noch zu sehr von „außen“ bestimmt, von vorgefundenen, gekonnt verwendeten poetologischen Traditionen, von historischen Materialien, von „fremden“ Aussagefiguren anstelle der ganz persönlichen Subjektivität.
Von den Tatbeständen her ist manches davon nicht zu bestreiten. Es fragt sich nur, welchen Wert man der reichhaltigen „Gegenständlichkeit“ in Menschings Gedichten beimißt und ob man bereit ist, den von der Bühne (oder Tribüne) herkommenden eigentümlichen dramatisch-rhetorischen Gestus, den man als Aussage bzw. Sprecherhaltung einer „Rollenfigur“ auffassen kann, auch als legitime lyrische Subjektivität anzuerkennen. Ich sehe nach wie vor keine Veranlassung dafür, lyrische Dichtung generell mit existentieller Selbstkundgabe und diese wiederum mit der „privaten“ Person des Dichters zu identifizieren.
Tuchfühlung heißt nun der neue Band, und das Titelgedicht handelt von der roten Fahne, jenem traditionsgeladenen Motiv sozialistischer Lyrik. Menschings tiefe Beziehung zur Geschichte im Umfeld revolutionärer Prozesse, seine Sensibilität in der Berührung mit dem historischen „Stoff“ ist offenbar geblieben. Das Fahnenmotiv wird zu den Kämpfen der Epoche, zu den Siegen und Niederlagen der Arbeiterbewegung, zu den inneren Widersprüchen einer Revolution, zu Verrat und Konterrevolution so in Beziehung gesetzt, daß ein kritisches, illusionsloses, hart konturiertes, aber dennoch kraftvolles, auf Zukunft dringendes Bild unserer Epoche entsteht. Ein poetisch bedeutsamer Entwurf von hohem politisch-weltanschaulichem Rang! Auch jene Leser, die den Text nicht aus dem Munde des Dichters und von der Bühne herab gehört (erlebt) haben, spüren den szenischen Ursprung, die dramatische Spannung. Von einer „existentiellen Selbstkundgabe“ im engeren Sinne kann kaum gesprochen werden, weil das poetische Material wiederum von „außen“, zum größten Teil aus der geschichtlichen Vergangenheit „herbeigezogen“ ist (wie Leistner sagen würde). Und dennoch: Hier pulsiert das Herzblut des Dichters; auch als Sprecher oder Mime auf der Bühne identifiziert er sich leidenschaftlich mit seinem „Gegenstand“. Lyrik ist „höchste Rhetorik“, hat Goethe einmal gesagt und ihr dabei einen „entschieden historischen“ Zug zugesprochen – als „wenn / er es geahnt hat“.4 Die persönliche Anteilnahme, die sich (noch einmal mit Goethe:) im „enthusiastisch-aufgeregten“ Gestus äußert, sowie die sinnlich greifbare Konkretheit, mit der das „Tuch“ (nicht das allgemeine politische Symbol) der Fahne im Gedicht fungiert, geben dem repräsentativen „Wir“ – es steht für alle, die sich mit der Fahne des revolutionären Proletariats verbunden fühlen – zugleich den Charakter einer ausgesprochen individuellen Subjektivität. Es geht aber in einem erweiterten, „höheren“ Sinne doch um Existentielles: um Schicksale und Perspektiven der Revolution.
Das Titelgedicht steht für die Kontinuität poetisch-politischer Positionen des Autors. Intensive Arbeit mit Geschichte war ihm immer auch Suche nach Räumen für schöpferisches Entfalten und Wirken von Individualität. Grundsatz bleibt: „Ein Blick nach innen, zwei ins Leben“ – so der Titel eines Gedichts aus dem ersten Teil. Die hier vorliegende Sammlung setzt aber die Akzente stärker als der erste Band auf das Individuelle, Persönliche. In vielen Gedichten spielt Autobiographisches eine konstituierende Rolle. Gleich am Anfang steht eine Reminiszenz an die Kindheit. „Eine Statue, in der Dämmerung“ erinnert den Autor an das Versteckspiel im Park, die Suche nach den verborgenen Freunden:
Gebt Antwort,
zeigt euch, …
ich weiß, daß ihr da seid
Gemeinschaft wird beschworen, Solidarität. Am Ende der letzten Gedichtgruppe, in der das Thema Liebe im Mittelpunkt steht, kehrt der Dichter noch einmal zu diesem Gedanken zurück, die Motive Solidarität (Liebe, Freundschaft) und „Zuversicht“ miteinander verknüpfend:
All dies trage ich allein
Liebe Kälte Haß
aaaaaaaaaaaaaaaAngst und mein
Verlassen sein
aaaaaaaaaaaaanur nicht das
allein dies nicht
Zuversicht
Als abschließender vierter Teil des Bandes folgt noch ein „Kapitel“ Prosa, firmiert als „Eine unordentliche Lesart zu einem Gedicht von Jannis Ritsos“. Das Ganze ist strenger durchkomponiert als die Milchglasscheibe.
Im Teil I stellt sich das lyrische Ich – angeregt durch Erinnerungen an verschiedene Stationen des eigenen Lebens – immer wieder der Frage nach dem historischen Gewordensein und den epochalen Strukturen der Welt, in die es hineingewachsen ist und in der es sich orientieren muß. Dabei kommen Erfahrungen ins Spiel, die nicht in Selbsterlebtem wurzeln, dennoch aber als unmittelbar zum eigenen Schicksal gehörig empfunden werden: Faschismus und Krieg („Ohne Echo“, „Für Herbert Baum“, „Ich lehne den Kopf an die graue Mauer“). „Tuchfühlung“ wird thematisch vorbereitet durch „Mauerinschriften“, „Ein Blick nach innen…“ und „Für Peter Weiss“. Sie sind umgeben von humoristisch-satirischen Seitenblicken auf gegenwärtige gesellschaftliche Praxis („Vor dem Sicherungskasten“, „Nur ein Beispiel“) und – aus der Alltagswirklichkeit heraus – von Ausblicken in eine noch offene Zukunft: auf der einen Seite die „Verbißne zerrißne Elegie in Schwarz“, auf der anderen Seite das Aufblitzen ungeahnter Möglichkeiten:
Ist dir aufgefallen, daß der amerikanische
aaaaaSoldat
aaaaaim Buchladen
an der Kasse ein Bilderbuch kaufte für Kinder
ab fünf Jahre, mit bunten Affen und Nashörnern, daß er
aaaaadich anlächelte
und an seinem Uniformknopf fummelte,
als du zurücklächeltest, und daß dieser Augenblick
aaaaaeine Sekunde oder zwei,
sehr seltsam war, so verzweifelt, utopisch, blödsinnig
hoffnungsvoll zeitlos kurz entwaffnend
Diese winzige Beobachtung, die ja nicht zuletzt Selbstbeobachtung ist, bringt ein zentrales Anliegen des Bandes zur Geltung: die Utopie als in die (poetische) Gegenwart geholtes Wunschbild des Künftigen. Sie tritt in unterschiedlicher Gestaltung auf. In dem Gedicht „Für Peter Weiss“ begegnet sie uns in ihrer gleichsam klassischen Form: als lyrisch entfaltete Situationsschilderung aus einer herbeigesehnten Zukunft. (Das erinnert z. B. an Mickels „Friedensfeier“; für Mensching ist es neu, im „Traumhaften Ausflug mit Rosa L.“ wurde der Utopiegehalt noch aus der revolutionären Vergangenheit gewonnen.) In „Mauerinschriften“ rufen Wandkritzeleien von Kindern „nostalgische“ Erinnerungen an Losungen wach, „die nur der Regen abwusch“; zu ihnen gehört die Zeile aus dem sowjetischen Kinderlied „Immer lebe die Sonne“ ebenso wie die Losung der Pariser Studenten „Die Phantasie an die Macht“ aus dem Jahre 1968. Über das Moment der Unangemessenheit, das jedem utopischen „Übersteigen“ der Realität anhaftet, sei es nun kindlich-naiven oder politisch-illusionären Ursprungs, reflektiert Mensching am Schluß seines Ritsos-Kommentars. Anders gelagert ist die Situation bei der eben zitierten Begegnung im Buchladen. Der „entwaffnende“ Augenblick verlegen lächelnden „Erkennens“ zwischen Menschen, die sonst – in der „großen“ politischen Welt – eher Antagonisten sind, hat zunächst sicher etwas Unangemessenes, Unglaubliches, ja Unwirkliches. Er ist jedoch gleichzeitig (natürlich in den Grenzen poetischer Fiktion) sinnlich greifbare, glaubhafte und unter hauptstädtischen Bedingungen fast alltägliche Wirklichkeit. Da ist etwas, was der Autor an anderer Stelle die „ins Leben gerissene Utopie“ nennt, „die über den Augenblick hinausweist“, aber deswegen nicht aufhört, Teil der realen, heutigen „konkreten Bewegung“ zu sein. (94)
Subjekt, Träger, Motor dieser „konkreten Bewegung“, in der jeder Augenblick seine „revolutionäre Chance“ mit sich führt (so im Benjamin-Zitat, mit dem die „unordentliche Lesart“ und somit auch der ganze Band abschließt), ist für den Autor das lebendige Individuum. Dem Problem, ob „die Sorge um die Gattung als die Überwindung der eigenen lebendigen Individualität oder als deren Bestätigung“ auszufechten ist, geht Mensching in Poesie und Prosa nach. Unter Berufung auf Gramsci, den er im Teil IV wiederholt zitiert, entwickelt er ein Konzept, das die Persönlichkeit des einzelnen selbstverantwortlichen, originellen Individuums in den Mittelpunkt rückt. Dies geschieht aber unter bestimmten Voraussetzungen, die in der dialektischen Spannung zwischen Spontanität und Disziplin ausfindig gemacht werden (90–92).
Aufrichtigkeit (und Spontanität) bedeutet ein Höchstmaß an Individualismus, aber auch im Sinne von Eigenbrötlerei (Originalität ist in diesem Falle mit Idiotie gleichzusetzen). Das Individuum ist historisch originell, wenn es ein Höchstmaß an lebendiger ,Gesellschaftlichkeit‘ hervorbringt, ohne die es ein Idiot wäre… (Antonio Gramsci, Aus den Gefängnisschriften)
Mit Gramsci versteht Mensching unter einem „originellen“ Individuum die Verkörperung eines geschichtemachenden, das Bestehende verändernden Subjekts in Gestalt eines realen, lebendigen Menschen. Das ist ein hoher Anspruch, der zudem in einem eklatanten Widerspruch zu stehen scheint zu dem hohen Grad der Vergesellschaftung, den alle sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Vorgänge längst erreicht haben. In dieser niemals aufgelösten Spannung zwischen „Individualismus“ („Spontanität“, „Aufrichtigkeit“) und historisch-gesellschaftlicher Determination (aber auch Eingebundensein in festgefügte Verhältnisse) bewegen sich die Texte des ersten Bandteiles.
Teil II wird im wesentlichen von einem Poem eingenommen, mit dem Mensching den groß angelegten (25 Druckseiten umfassenden) Versuch unternimmt, etwas von der Komplexität jenes dynamischen Spannungsverhältnisses zwischen Ich und Welt in einem einzigen Gedicht einzufangen.
Das Poem trägt den ebenso ernsthaft wie sarkastisch gemeinten Titel „Von mir aus“. Sein poetisch organisierendes Zentrum liegt im Ich des Dichters. Die auf den ersten Blick willkürliche Folge von Assoziationen, Reflexionen, Reminiszenzen oder auch relativ selbständigen lyrischen Gebilden erwächst, wie sich bei näherem Hinsehen zeigt, aus einer im Grunde einfachen, zeitlich und räumlich begrenzten Situation. Es ist die konkrete Situation eines jungen Mannes, der meist innerhalb seiner vier Wände ( deren „Interieur“ immer wieder „eingeblendet“ wird) lebt, liebt, studiert, nachsinnt und – an dem vorliegenden Poem schreibt. Der ideelle Arbeitsprozeß selbst konstituiert das Poem. Er bringt die lyrische (wie die reale) Subjektivität zur Entfaltung, setzt sie in vielfältige, geistig aktive, sinnlich und emotional intensivierte Beziehungen zu den verschiedensten Gegenständen, Vorgängen und Zeiträumen dieser Welt, um sie – und zwar nicht erst „am Ende“, sondern kontinuierlich fortlaufend – zu poetischer Sprache gerinnen zu lassen.
Allerdings stellt diese „im Gedicht arbeitende Subjektivität“ (Schlenstedt/Maurer) an den Leser einige Anforderungen. Er muß sich selbst auf einen geistigen Arbeitsprozeß einlassen, will er sich am poetisch-weltanschaulichen Selbstverständigungsprozeß des Dichters mit Gewinn beteiligen. Dann wird er dem Dichter folgen können auf dessen Ausflügen in die eigene Kindheit, in konfliktreiche politische Ereignisketten der ferneren und näheren Vergangenheit, an deren Schnittpunkten sich seine individuelle Entwicklung vollzog; dann wird auch er spüren, „daß man unruhig schläft mit einem / Geschichtsbuch unter dem Kopfkissen“, und seine Sinne schärfen, um das leise Ticken der „utopischen Taschenuhr“ eines wachen, kritischen Zeitverständnisses zu vernehmen. Das Ich, bisweilen „gehüllt in eine blaue Toga / aus Selbstbewußtsein und Melancholie“, verliert ein Ziel nie aus den Augen:
gewöhnliche Avantgardisten fordern nicht viel nur das
Unmögliche
möglich zu halten
Die alte Tradition des Poems in der sozialistischen Lyrik wird auf moderne Weise fortgesetzt. Anregungen kamen von Ritsos, deutlich bleibt aber auch der Rückgriff auf Brecht. Surrealistische Elemente des Bildaufbaus und der assoziativen Verschränkung von Reflexionsebenen macht er sich fruchtbar, jedoch nicht im Sinne rational ungesteuerter, ganz aus dem Unterbewußtsein kommender „Überwirklichkeiten“, sondern im Sinne realistischer Durchdringung und bewußter Aneignung der Wirklichkeit. Der Gewaltanstrengung des „Großgedichts“ folgen im dritten Teil des Bandes wieder „einfache“, überschaubare Texte. Der Gedanke „I n d i e s e r d u n k l e n W e l t / findet Halt, nur! der einen anderen hält“ wird nun auf das Zusammensein mit der Geliebten bezogen. Im Unterschied zu den schönen Liebesgedichten im Band Milchglasscheibe gelingt es dem Autor nicht immer, das persönliche Erlebnis in überraschende poetische Entdeckungen zu verwandeln. Einige Texte bleiben banal; mitunter grenzen sie an Kitsch: „Ich erwachte allein…“, „Schulter an Schulter“, „Ich mag dich, wenn du traurig bist“. Durch die Anlehnung an antike Traditionen des erotischen Gedichts („Nänie auf die Liebe“) oder die Beziehung zu anderen Kunstbereichen (etwa in „Wir standen am Fenster…“ und „Nocturne for Polly…“) werden jedoch neue Wege der poetischen Verallgemeinerung eröffnet.
Überschaut man den Band als Ganzes, dann verdichtet sich der Eindruck eines poetischen Zugewinns, für den allerdings ein Preis zu bezahlen war. Man findet weniger Gedichte von einer in sich abgeschlossenen, „abgerundeten“ Gegenständlichkeit, die ohne Schwierigkeiten ein selbständiges Leben führen können. Zurückgegangen ist auch die direkte Ansiedlung lyrischer Subjektivität in öffentlicher Kommunikation. Das Ich kommt mehr über die Selbstreflexion zu den großen Gegenständen, die für Mensching nach wie vor wesentlich bleiben. Der schwierige Prozeß der Selbstverständigung sprengt immer wieder die „geschlossene Form“ und verleiht dem Band einen stark experimentellen, suchenden, tastenden Charakter. Auf besondere Weise gilt das für die teils essayistische, teils dokumentarisch-prosaische Ritsos-Lesart. Ein Band des Übergangs? Auf jeden Fall ein wichtiger Band.
Mathilde Dau, aus Siegfried Rönisch (Hrsg.): DDR-Literatur ’86 im Gespräch, Aufbau Verlag, 1987
„Von mir aus“ – Inventur und Programm
„Geschichte“ gehört zu den Hauptwörtern in Steffen Menschings zweitem Lyrikband. Mit dem Satz „Was ich schreibe, muß ich verantworten können, vor mir und vor der Geschichte, die ich nicht von mir abtrennen kann…“ (NDL, Heft 5/1984) fixierte Mensching schon vor einigen Jahren einen Kernpunkt seines poetologischen Selbstverständnisses. Im Band Tuchfühlung begegnen uns ganze Wortfelder zum Begriff „Geschichte“, vom „Geschichtsbuch unter dem Kopfkissen“, das einen unruhigen Schlaf bewirke, ist die Rede. Geschichtliche Vergewisserung verbindet sich für den lyrischen Sprecher zuallererst mit Namen wie Benjamin, Gramsci, Lenin, Sandino, Stalin, Lukács. Zahlreiche Dichter werden in den Texten nicht ehrfürchtig beschworen, sondern als geistige Brüder in vertrautem Diskurs mit Namen, oft – ein enges Verhältnis andeutend – mit Vornamen genannt: Wladimir, Attila, Sergej, Jannis. Naheliegend ist die Vermutung, daß sich für den Autor historisches Bewußtsein nicht zuletzt mit jenen Namen verbindet, die für ein prozeßhaftes Geschichtsbild stehen, das die Emanzipation des Subjekts als zentrale praktische und theoretische Frage begreift. Die Frage allerdings nach dem Verhältnis zwischen den herausragenden Persönlichkeiten, die Vordenker, konzeptive Ideologen sind, und den übergreifenden Gesetzmäßigkeiten des Geschichtsganges zählt bekanntlich zu den häufig diskutierten und weitgehend ungelösten Problemen der Historiographie. Vor diesem Hintergrund kann Lyrik, ohne dies vordergründig zu beabsichtigen, oft einen vermittelten, unerläßlichen Beitrag zu einer nichtabstrakten Geschichtsschreibung leisten. In Menschings erstem Lyrikband fanden sich mit Gedichten wie „Traumhafter Ausflug mit Rosa L.“ und „Amtliches Fernsprechbuch“ überzeugende Beispiele. Im zweiten Band setzt sich das mit Texten wie „Für Herbert Baum“ und „Für Peter Weiss“ fort. Die Gedichte meiden das Eis der Abstraktion konsequent. Die Konturen einer Poetologie werden sichtbar, die auf die unlösbare Verschränkung des Besonderen mit dem Allgemeinen, von Alltäglichem und Ungewöhnlichem setzt. Im Gedicht „Für Herbert Baum“ beispielsweihe apostrophiert sich der lyrische Sprecher als „Student der Ästhetik des Widerstands“. Die letzten Zeilen des Gedichts, das eine berührende und differenzierte Annäherung an die Gestalt des hingerichteten Widerstandskämpfers vorführt, verdeutlicht diese poetische Methode Menschings:
… und vergleiche mich nicht mit dir, obwohl ich dich liebe,
eine kleine Figur am Rande
des Lustgartens, auf dem du Marianne umarmtest, um
durch ihre Haare die Wachmannschaft zu zählen
aber auch, um sie zu umarmen.
Geschichtliches Vergewissern prägt auch das Titelgedicht des Bandes. „Tuchfühlung“ – das meint menschliche Nähe, aber auch das Aufsuchen von Bruchstellen und Verwerfungen im Geschichtsgang. Das Gedicht strukturiert ein auf den ersten Blick überzeugender poetischer Grundeinfall. Das Tuch, das Fahnentuch wird zum weitgespannten Symbol, es wird zum Indikator von Heldentum und Versagen:
… und andere verbrannten es, als es ihnen
zu heiß wurde.
und andere verbrannten sich selbst.
und ganz andere zerrissen es nach einem Parteitag.
während andere
es zerrissen nach einem Gefecht, um die Wunden
zu binden.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob die poetische Idee tragfähig genug ist, denn eigentlich geschieht wiederum das, wogegen der Text polemisiert – die Installation eines vereinfachten Geschichtsbildes. Gerade die Leidseite der Geschichte der Arbeiterbewegung läßt sich, so scheint mir, nicht von der Polarität „die einen – die anderen“ ausgehend begreifen. Den komplizierten Wechselwirkungen, die zu gesellschaftlichem Fortschritt und Rückschlägen, zu Erfolgen und schwerwiegenden Fehlern geführt haben, wird nur eine Position des „Sowohl – als auch“ gerecht. Sicher wird der Begriff „Dialektik“ mitunter inflationär gebraucht. Er ist hier jedoch am Platze, denn die Dialektik geschichtlicher Bewegung wird in diesem Gedicht meines Erachtens durch ein zu grobes Raster ersetzt. Schwer zu beantworten ist die Frage, ob die Gattung Lyrik überhaupt die poetischen Mittel für den Versuch überschauartiger Aufarbeitung vielschichtiger historischer Prozesse besitzt. Kaum zu übersehen aber ist, daß die additive Struktur des Textes die intendierte Aussage unterläuft.
In Menschings zweitem Lyrikbuch erfolgt weit stärker als im ersten Band die Akzentuierung von generationstypischer Erfahrung. In dem 25 Seiten langen Text „Von mir aus“ beispielsweise erscheinen Ich und Welt in wechselseitiger Spiegelung. Anders gesagt: Das Gedicht beleuchtet das Verhältnis von individueller Erfahrung und gesellschaftlicher Biographie. Es fragt nicht zuletzt nach der Beziehung zwischen revolutionärer Bewegung und der Gefahr möglicher Gewöhnung an die enthistorisierende Kraft des Alltags. Die Disparatheit der dichterischen Mittel und das Fragmentarische der einzelnen Textstücke werden dabei zum Strukturprinzip erhoben. Der Titel „Von mir aus“ ist offensichtlich poetologisches Programm und nicht als nonchalante Geste zu deuten. Er beschreibt den Blickwinkel des sprechenden Ichs. Dieser „point of view“ macht zum einen den spielerischen, verfremdenden Umgang mit Abstraktionen möglich und zum anderen ist er Voraussetzung eines Bilanzgedichtes ohne Resümee.
Vor einiger Zeit äußerte sich Steffen Mensching in einem Interview (publiziert im Essayband Positionen 2) zum Weltempfinden der am Ende der fünfziger Jahre geborenen Dichter.
Er verwies auf die relativ ungebrochene „Aufnahme gemeinschaftsstiftender Ideale“, deren spätere Problematisierung durch das Wahrnehmen gesellschaftlicher Widersprüche befördert wurde. Auch der Text „Von mir aus“ macht auf einen offenbar sehr raschen Wechsel generationsspezifischen Empfindens aufmerksam, denn er mündet nicht in die mit dem Stichwort „Hineingeboren“ (Uwe Kolbe) markierte Position, sondern räumt dem Subjekt einen größeren Handlungsspielraum ein.
Schwierig ist es gewiß, dem Thema „Frieden“ und notwendiger Friedenserhaltung mit den Mitteln des Gedichts neue Aspekte abzugewinnen. Mensching gelingt das Unterfangen lyrischer Friedensforschung mit Gedichten wie „Ohne Echo“, „Ist dir aufgefallen…“ und „Nocturne für Polly from Portland“.
Das erstgenannte Gedicht, entfernt an Karl Mickels „Friedensfeier“ erinnernd, versucht ein Bewußtsein dafür zu schaffen, daß auch Visionäres das Aktivieren von Utopiepotential, jenes Handeln befördert, das es ermöglichen könnte, das „Minenfeld des 20. Jahrhunderts“ (Michail Gorbatschow) zu durchqueren.
Konflikt- und Friedensfähigkeit – häufig beschworene und einzig sinnvolle Form des Verhaltens zueinander. Das betrifft bekanntlich die Kultur der Beziehungen zwischen den Menschen, aber auch das Verhältnis von Staaten untereinander. Lyrik verfügt über die Möglichkeit, den Blick zu verfremden und damit zu verhindern, daß aus diesen Begriffen Worthülsen werden. Im bereits erwähnten Gedicht „Nocturne für Polly…“ wird an das gemeinsame sowjetisch-amerikanische Weltraumunternehmen 1975 erinnert. Das konkrete Faktum erscheint reichlich zehn Jahre später in einem veränderten Licht:
Wie Michelangelo unter der Kuppel der Sixtinischen Kapelle
liegen im Gras,
etwas, das vorstellbar bleibt,
die weiche Haut zwischen den Systemen,
reden in der Sprache des Anderen
(wie Leonow und Stafford).
Diesen Blickwinkel lassen auch die Texte erkennen, die nach dem Umgang miteinander beziehungsweise, nach dem Verhältnis der Geschlechter fragen. Das Jannis Ritsos gewidmete Gedicht „Lautlose Verrichtung“ ist in dieser Hinsicht programmatisch. Nicht nur im Sprachgestus erinnert es an Günter Eichs berühmtes Gedicht „Inventur“. Gegenstand des Gedichts ist eine „Inventur“ der Emotionen zweier Menschen. Zu erwarten wäre ein Umschlagen der Beziehung in Zorn und Haß, denn sparsame Andeutungen verweisen darauf, daß latente Konflikte vorhanden sind. Das Erwartete tritt jedoch nicht ein. Eine archaische, fast ritualhafte Handlung wird symbolischer Ausdruck einer haßfreien Beziehung:
Er zeigte mir den Stein. Eine nackte Frau und ein
nackter Mann
sahen sich an. Woher weiß er, dachte ich, was ich
meine.
Dann grub ich das Loch, wir legten den Stein hinein,
schoben mit den Händen Sand darüber.
„Geschichte“ als poetologisches Hauptwort Menschings? Gerät die eingangs formulierte These nicht ins Wanken? Wohl nur dann, wenn „Geschichte im engen Sinne als Ereignisgeschichte verstanden wird. Menschings Geschichtsbegriff ist weit. Er schließt das Unterlaufen von Abstraktionen ein und berührt Kunst- und Geistesgeschichte, Alltagserfahrung und prüfendes Befragen von Welt-Bildern. Der Gefahr, das Gedicht zum Vehikel geschichtlicher Vergewisserung zu machen, entgeht Steffen Mensching vor allem durch die in seinen Gedichten praktizierte poetische „Rehabilitation“ sinnträchtiger alltäglicher Gegenstände und Vorgänge.
Rainer Zekert, neue deutsche literatur, Heft 425, Mai 1988
Steffen Mensching: Tuchfühlung
Da der noch relativ junge Lyriker Steffen Mensching für seinen ersten Gedichtband Erinnerung an eine Milchglasscheibe (1984) den Debütpreis des Schriftstellerverbandes erhielt, ist man selbstverständlich gespannt, inwiefern der zweite Gedichtband dieser Auszeichnung gerecht wird. Ebenso wie im ersten Gedichtband spielt das permanente Bewußtsein der Geschichtlichkeit der Existenz in Tuchfühlung eine entscheidende Rolle, und ebendiese Verflechtung der Gegenwart mit literarisch-politischen Daten jüngster Vergangenheit verleiht den Gedichten ihren besonderen Reiz. Die 34 Gedichte (auf vier Zyklen verteilt) werden dem Leser aber in einem mißverständlich wirkenden Kontext dargeboten. Denn es sind weder die „pointierten Dialoge“, noch die „distanzschaffende Ironie und Selbstironie“ (wie der Klappentext formelhaft verspricht), welche die manchmal eindringliche Sprechweise dieser Lyrik bewirken. Gerade in den angeblich zeitgenössisch-ironischen Gedichten (z.B. „Mauerinschriften“, „Vor dem Sicherungskasten“ und „Ist dir aufgefallen“), in denen der Lyriker sich mit den großen Themen seiner Generation (der heute 25–30-jährigen) auseinandersetzt, verliert die Sprache zuweilen ihre Prägnanz. Letzteres hängt wohl auch mit dem Versuch einer poetischen Rehabilitierung von Gegenständen alltäglichen Gebrauchs zusammen, und obwohl dahingestellt bleiben kann, ob man in dieser Weise dem gegenwärtigen Empfinden wirklich näherkommt, macht dieses Anliegen sich in der Sprechweise leider nicht nur im Sinne der angestrebten Entmetaphorisierung bemerkbar, sondern auch als Verlust einer gewissen Natürlichkeit:
Mein Gehirn ist hart, logisch, kalt und traurig.
Sehnsucht = Furcht. Oder größer als.
aaaaaAls ich
25 Kilo wog, war ich Gruppenratsvorsitzender
Im Kontext des Gedichts („Mauerinschriften“) zielen solche Verszeilen zwar auch auf eine ironische Wirkung ab, doch die lapidaren Sätze können den zu weit gesteckten, eigentlichen Rahmen – die Verbindung von revolutionären Inschriften mit Kindheitsreminiszenzen (1968) – nicht erreichen, weil die Sprechweise im Grunde zurückbleiben muß hinter einer konkreten Vorstellung, die nun einmal nicht zur Metapher werden darf.
Demgegenüber zeigt sich in Gedichten wie „Für Peter Weiss“, „Nänie auf die Liebe“ und ganz besonders in dem langen Gedicht „Von mir aus“, daß Steffen Mensching über eine Sprechweise verfügt, die in aller Einfachheit des Sprachgebrauchs zu eindrucksvollen Versen führen kann. In diesen Gedichten wird die Alltäglichkeit der Gebrauchsgegenstände und modischen Redewendungen ins rechte Licht gerückt, indem die lebendige Vergangenheit in die Alltäglichkeit hineinredet, und das lyrische Ich sich zu einer Haltung (der Gegenwart selbst) bekennen muß. Zur Veranschaulichung dieses vielversprechenden Elements in der Sprechweise von Steffen Mensching seien die letzten Strophen des Gedichts „Von mir aus“ zitiert. Die Verszeilen lassen sich als Epilog zu einem Rundgang durch die Gegenwart lesen, und zwar in dem Sinne, daß das lyrische Ich auf diesem Streifzug durch den Alltag sowohl die eigene Vergangenheit als auch die jüngste Geschichte abtastet. In den folgenden Schlußzeilen spricht sich dann eine mühevoll errungene, dafür aber entschiedene Einsicht aus, eine Haltung, die zugleich eine Stellungnahme beinhaltet. Wie der Lyriker in den Anmerkungen zu seinen Gedichten schreibt, bilden die Strophen eine Variation über den Titel einer Erzählung von Stephan Hermlin:
Da ist keiner mich aus meiner Pflicht
aaazu entlassen
sie sind alle gestorben
sagst du mir es ist lange her
sag ich dir es geschieht
ich wiederhole den Satz den sie lebten
aaabis zuletzt
in dieser dunklen Welt
findet Halt nur
aaader einen anderen hält
Paul Sars, Deutsche Bücher, Heft 1, 1989
Das wäre ja neu; daß wir loben, was uns aufstacheln will
Mensching und sein Kompagnon Wenzel (oder umgedreht?) sind auf diesen Blättern ein wenig gezaust worden weiland. Lob ist eine süße Sache, und wer wüßte nicht, daß an Süßspeisen eine Prise Salz gehört? Wer hat nicht schon, nach Parfait und Sahnetorte, mit Wollust in eine saure Gurke gebissen? Die Autoren und ihr Verlag ließen sich’s nicht verdrießen und legten binnen kurzem die zweiten Bände vor. Da habt ihr! Da haben wir nun. Hat’s geschmeckt? Ist’s bekommen? Schlägt’s an?
Um gleich Auskunft zu geben: Ja, es hat geschmeckt. (Die anderen beiden Fragen sind so kurz nicht zu beantworten…). Es hat geschmeckt, nicht all und jedes, aber Rezensent fand in beiden Töpfen genug für seinen Appetit – der von den ersten Bänden angereizt war. Er fand auch Zweifel bestätigt, Rückfragen genährt, und er denkt, daß es den Autoren darin ähnlich gehen wird. (Er nahm auch Anlaß zu Zweifel und Rückfrage an sich selbst. Hat sich der Autor, fragt sein eines Ich, der Leser, das andre, also ich, bewährt?) Nun denn –
Weniger spektakulär als beim Debüt kommen; die beiden nun daher, weniger (noch weniger?) „geschlossen“ wohl auch – Das mag daran liegen, daß der Reiz des Neuen fehlt und Bewährung und Fortführung gefragt sind. Beide Autoren sind nun um 30, und wir wollen uns freuen, daß es wieder Dichter gibt, die mit 30 nicht mehr Debütanten sind (und Verleger, die’s möglich machen). Man merkt’s den Büchern an, beiden. Die Autoren haben etwas hinter sich, haben Lob und Tadel erfahren, Positionen besetzt, nun gilt es Rückblick und Ausblick. In beiden Büchern Bilanzgedichte. Wenzel:
Ich öffne den grünen Schrank meines Kinderzimmers,
die Grabkammer meiner ägyptischen Zuckertüte,
Das Album, und nehme Abschied.
(…)
Dies alles gehörte einst mir
(„Abschied“).
Soviel Trödel („Die vollständigste Versammlung von Trödel / und Erinnerungen ist die Erde.“), unerfüllte Versprechungen, Prophezeiungen, Schlüssel ohne Schatulle, Unordnung – „ängstlich / Greift die Hand ins Vergangene, / in die Ruinen aus Zeit.“ Aber es fällt doch schwer, sich zu trennen von all den „Stempelkissen und Spendenmarken“, den „Trikoloren / Unter den Kaffeefiltern“. Schuld an allem bin ich (denn „alle schieben’s auf mich“, die Lebenden und Toten, siehe „Amtliches Schuldenbekenntnis“: Wenzel bleibt sich durchaus treu), und dennoch, auch wenn die Feen müde geworden sind, die Zauberer schweigen:
Das ist alles kein Grund zur Verzweiflung.
Einmal aber, und dieser Tag wird kommen, fliegt
der tote Schmetterling aus der Schachtel
Davon, denn in der Stunde des Abschieds
sind die Fenster geöffnet.
Nicht in jedem der neuen Gedichte wird der Vorgang so beim Wort genommen, der Gestus durchgehalten, und der gar nicht platte, der surreale Schluß reißt das Ganze zu Weiterungen auf. Benjamin/Klees „Angelus Novus“, der dem Band als Motto dient, im Hintergrund. Ähnlich das Gedicht „Sonntag“, Sonntagskinds Lebensbilanz und Ausblick. Wie war das doch, als ich ankam, hitzig, Mutter, was deinen Sohn „Anfällig gemacht (hat) für den Herbst, die Kälte, / Für die nebligen Monate des Verrats“? Zeiten, als er noch Vertrauen in Fliehkräfte hatte, als er „Mit einem Schritt die Erde bereisen (wollte) / Und alles in Ordnung bringen.“ (Wie Mensching, Partner schon damals, denn: „Als ich / 25 Kilo wog, war ich Gruppenratsvorsitzender, / ein semmelblonder Anarchist / mit blauem Halstuch. Mit einem Katschi aus Draht / kämpfte ich / gegen Piraten, Indianermörder, Faschisten und alle / andern Schweinehunde / dieser Welt.“), Ja, und die Zeit ist vorbei; auch wenn er’s noch nicht ganz einsieht, Wenzel, dieser „Dogmatiker besserer Zeiten“, und nicht Ruhe geben will – er muß; denn er wird. „Landschaften voller Plakatwände. / Fotografien genormter Freude, / Verschrobene Losungen“, okay, und er muß sich nun fragen (uns!):
Was hat er all die Jahre getan?
Warum hat er nichts ausrichten können?
Er wurde gar nicht gebraucht.
Man hatte es nur so gesagt.
(Hat es gesessen? Schlägt’s an?) Wenzel hat Wichtiges zu sagen, und er sagt es dicht, hier. Er macht es sich und uns nicht leicht (wie man gern sagt), er schwimmt nicht oben (Cummings: „Allein der Sportfisch schwimmt stromauf.“ Und: „Nichttotsein ist nicht Amlebensein.“) Er sucht nach Bedingungen für Leben, das mehr als bloß überleben ist, mehr als dahinleben. Er bilanziert. Sieht sich um.
Er sieht die schönen Mädchen
Das Haar ans dem Gesicht streichen,
Wenn sie die Straßen überqueren;
Er sieht weißhaarige Frauen,
Die ihn traurig machen, und er sieht
Betrunkene am Kiosk und eilig
Laufende Männer, die nach teurem Deo-Spray duften. Dein Sohn
Sieht nur noch!
Und nichts weiter.
Dagegen ist aufzubegehren, und es ist zu fragen, was geschehn ist und was wird. Der Aufstand der Trauer, der Freude, der Sehnsucht:
Hörst du nicht, wie er immer wieder
Seinen Kopf voller Sehnsucht
Gegen das S-Bahn-Fenster schlägt?
Ein Mitkämpfer, der „stirbt, wenn man sich ihn fangen will“. Mensching hat die Pole dieser Haltung, anläßlich eines frühen Gedichts von Wenzel, das Mühsam gewidmet war, beschrieben, er nannte es „ein – allerdings öffentlich ausgestelltes – individuelles Kampfprogramm“, und er hat Mühsams Gedicht „Streit und Kampf“ zitiert:
Nicht nötig ist’s, nach Schritt und Takt
gehorsam vorwärts zu marschieren.
Doch wenn der Hahn der Flinte knackt,
dann miteinander zugepackt
und nicht den Nebenmann verlieren!
Gut, das ist die Kontinuität; doch eine Sache für forsche Bekenntnisse ist das nicht. Streit und Kampf, nun ja: Streit ist vielleicht zu haben, aber wo ist der Kampf? Der Nebenmann; aber der Mitkämpfer? Das ist die Situation, vor der beide, Wenzel und Mensching, jetzt stehen, und sie wissen es. In ihren besseren Texten zumindest. Daß der Schluß des angeführten Gedichts im Vagen landet – sind’s nur die literarischen Nerven, mangelndes Sitzfleisch oder Schlamperei? Zuvörderst ist es die real vorhandene Klippe: nach der Forcierung des Talents das Land zu halten/zu baun. Sich der Besitzstände versichern. Sehnsucht gehört dazu, Trauer. Lebenslust und Sinnlichkeit. Das ist da, und damit ist zu arbeiten.
Das geschieht hier in vielen Texten im Thematischen, und es spiegelt sich nicht minder im Poetologischen wider, im Pendeln zwischen Reflexion und Sinnlichkeit. Wenzel scheint ein eher „sentimentalischer“ Dichter (aber zur Problematik solcher Begriffe weiter unten), dem aber gleichwohl schöne Texte gelingen, die vom Vertrauen auf den Gegenstand getragen werden – sei’s das Haar der Geliebten oder der Löwenzahn (ja – bei aller Gewichtigkeit, bei aller schuldigen Aufmerksamkeit für die großen Themen dieses Dichters wollen wir das schöne Detail, die kleine Geste, das Schüsselchen Löwenzahnsalat nicht geringachten), sei’s ein Zanderessen, ein verlassenes Bett, ein gewöhnlicher Tag mit ganz unmetaphorischem Schnee. Schön auch, wie ein kleines, privates Erlebnis, die verfrühte Ankunft der Geliebten, zur utopieträchtigen Reflexion über die „Zukunft unserer Sinne“ führt:
Werden sie vielleicht doch einmal nach allen verfeinerten Spezialisierungen der Zivilisation, dachte ich, diese in Tausende Bilder und Fakten zersplitterte Welt begreifen können, anschaubar machen, was unseren jetzigen Augen noch versagt ist, sehen? Vielleicht, in den späteren Berichten Homers, wird Penelope, während sie mit dem verkabelten Computer erfolglos nach ihrem Liebsten fahndet, die Freier trotzdem aus dem Haus jagen, nicht aus starrsinniger Treue. Ja, wahrhaft, voller Aufregung erwarte ich diese unbekannten Wahrheiten…
(so im dichten Prosa-„Orakel Nummer April eins“).
Bilanz auch bei Mensching, vor allem in dem meiner Ansicht nach wichtigsten Text des Bandes, dem Poem „Von mir aus“, Rückblick und Ausschau in dreifacher Hinsicht: biographisch, geschichtlich, poetologisch. Sein Schicksal, das seiner Generation, seiner Welt: „wie geschah es wie geschahs“ mit mir, und „mir war klar daß ich ein Deutscher war / und mir war klar / daß wir sehr alt werden müßten um zu begreifen / was mit uns geschieht“. Und zwar geschieht nicht mehr und nicht weniger, als daß einer sein bißchen Biographie, sein bißchen erlebter / angelesener Welt mobilisiert in einem Augenblick, wo es entgegen allem Anschein der „allgemeinen / kontinentalen / Verhärtung“ auf die sechste Ziffer hinter dem Komma ankommen könnte. Das mehr als 20 Seiten umspannende Gedicht ist eine einzige atemverschlagende surrealistische Montage – surrealistisch im Sinne Benjamins, der, wie Mensching im Gespräch zitiert, darauf aufmerksam gemacht hat, „daß surrealistische Dichtung nicht primär als Gedankenexperiment, als auf den Skandal angelegte Produktion zu verstehen ist; sie kommt aus der in sich chaotischen und sich widersprechenden Wirklichkeit der Großstadt, in der das tragischste Moment des Verkehrsunfalles neben dem Zeitungsblatt von vor sechs Tagen und dem Hund eines Börsenmaklers erscheint. Die Dinge kommen willkürlich zusammen und ihr Nicht-Zusammenpassen läßt eine viel tiefere Einsicht in soziale Bewegungen und Vorgänge, ein viel genaueres Hinterfragen zu als ihre logisch konstruierte Zuordnung.“ Soweit also Mensching, mit Benjamin, und er hat an dieser Stelle (Interview mit Christel und Walfried Hartinger) auch klargestellt, daß es nicht um mechanisches Ineinssetzen, sondern eher um eine „Weiterentwicklung der von den Surrealisten gefundenen Schreibweise geht, gewissermaßen um eine Umstülpung insofern, als wir es bei uns mit anderen sozialen Erfahrungen, auch sehr unvergleichbarem Wirklichkeitsmaterial zu tun haben.“ Das Gespräch wurde im Juli 1985 geführt, die Erinnerung an eine Milchglasscheibe war erschienen und hatte Furore gemach und jetzt konnte/mußte er mit seine Prometheus fragen, „warum wieso wieweiter“. In diesem Umkreis, ich weiß nicht, ob vorher oder nachher oder dabei, ist das Poem entstanden. Viele Stichworte des Gesprächs treffen wesentliche Probleme der Dichtung. Da ist von den Erfahrungen der Schulzeit die Rede, wird versucht, die Spezifik der eigenen Generation, der 1965 zur Schule gekommenen, im Unterschied zu den 1968/70 Nachrückenden zu bestimmen, was insbesondere das Verhältnis zu „gemeinschaftstiftende(n) Ideale(n)“ betrifft, wird gefragt, ob der bisher entwickelte Gedichttyp, ob die „gewisse Abgeschlossenheit und Fertigkeit der Texte“ tauglich sei für die Aufgabe, „die Widersprüchlichkeit, jenes Sich-Überlappen und Bekämpfen von verschiedenen Haltungen, Erfahrungen, von Zeitphasen usw. auch erkennbarer in ihrer Zerrissenheit darzustellen“. In diesem Zusammenhang wird die Tradition neu befragt, Mensching sieht bei den Surrealisten nach, bei Cardenal, Ritsos, Nezval… Nicht zuletzt geht es um eine neue Verbindlichkeit, um die Frage der Brauchbarkeit seiner Arbeit. Mit Blick auf die Aufnahme des ersten Bandes stellt er fest, daß er „teilweise nur sehr partiell analysiert oder global untersucht worden“ sei, daß „bestimmte Texte nur selten wahrgenommen werden, sondern immer nur eine Gruppe von Gedichten. Da entsteht eine gewisse Zweiteilung, die mir nicht so behagt, weil ich das Gefühl haben muß, für bestimmte Aspekte einvernommen zu werden“. Solche Überlegungen also setzten die Aufgabe, und wie wird sie gelöst? (Und wie lösen wir sie?)
Die „Selbstprüfung aus gegebenem Anlaß“ ist kein privates Scherbengericht. Sie geht uns mehr an als uns vielleicht lieb ist. Mehr als der biographische Rahmen eigentlich hergibt: Schule Bücherrücken Mädchenbrüste Winkelemente Schlitzohren asiatische Gewürze und und –
und das Geschichtsbuch unterm Kopfkissen der Fernseher mit den Panzern in der Prager Vorstadt die Abschiedsbriefe der Hingerichteten Stalinorgeln Entspannungspolitik – –
und Stalin Beria Che Guevara Cardenal Roosevelt Gagarin Trotzki – – –
alles das, einerseits, im verzweifelten Bemühen des Hineingeborenen um Welt, so generationstypisch wie vielleicht und gleichwohl vielen Gleichaltrigen eher fremd, wie es andererseits die Grenzen seiner Biographie, seiner Generation, ja seines kleinen Landes sprengt. Die Annäherung an Gestalten der Weltgeschichte etwa ist hier mehr als die forsche Geste, als die sie erscheinen mag. Zwei Passagen mögen dafür einstehen, Stalin:
aber Väterchen Väterchen ich war der letzte der
behauptete
du wärst an allem schuld
auch deine Fehler hatten einen gewissen Abstraktionsgrad
erreicht
ich las in der Zeitung du sollst Fehler gemacht haben
es klang so als wärst du dreimal am Nowski-Prospekt
bei Rot
über die Fahrbahn gelaufen
–
Roosevelt klebte seinen Kaugummi unter den
Verhandlungstisch
vor fünfzig Jahren
niemand hat es bemerkt nur ich der ich mich schon
damals
in Dinge mischte die mich nichts angingen
Nicht die Leerstellen seiner Biographie – die offenen Enden unserer Geschichte sind gemeint. Der sich hier zum Einmischen bekennt, der um Haltung ringt – er benennt und berennt unsere Haltungen. (Das alte liebe Mißverständnis: die Dichter legten ihre Probleme auf den Tisch, damit wir die unsern vergessen können). Der ruft uns an, Geschichte zu erinnern, um die Gegenwart zu bewältigen, Rissen nicht auszuweichen, Widersprüche produktiv zu machen, mit allen wirklichen Reibungen. Diskussion von Haltungen findet statt: „ich nicht sagte er ich sage nun was ich denke (aber was / er dachte / war schon nicht mehr von Belang)“, – „ohne Zweifel war es falsch davon zu sprechen ohne / Zweifel / falsch / länger darüber zu schweigen ohne Zweifel“. – „viele waren weggegangen jetzt dachte ich könnten wir / verlangen anzufangen / nach des andern Hand zu langen / eigentlich waren genug / weggegangen“.
„Der Zustand unseres Denkens und unserer Sinne“ – mit diesen Worten von Wenzel aus seinem „geöffneten Brief“ zum Essay „Uhrengeschäft“ ist auch Menschings Thema in seinem Poem zutreffend benannt. Das ist etwas anderes als besserwisserische Aufklärung über diese oder jene platte Wahrheit.
Die Wahrheit liegt oft versteckt zwischen den einzelnen Versatzstücken, ist nicht formulierbar wie ein Lehrsatz, muß in einem kollektiven Prozeß gefunden werden. (…) Denn die alten Abmachungen über Begriffe, in denen ein historischer Erkenntnisprozeß materialisiert vorliegt, sind fragwürdig; sie treiben zu einer Melancholie, deren Gründe nicht mehr auffindbar scheinen und in einem psychologischen Dschungel verschwinden.
Wenzels Überlegungen zu seiner eigenen assoziativ-sprunghaften Methode korrespondieren mit dem gleichzeitigen Nachdenken von Mensching, wie es zu dem Poem „Von mir aus“ geführt hat. Denn was er dort leisten wollte, verlangte mehr als eben ein Sammelsurium von mehr oder weniger banalen Dingen und einigen „frechen“ Anspielungen. Es ging darum, die eigenen Erfahrungen so in den Text zu bringen, daß mit ihnen umgegangen werden kann; darum, „die Texte offener zu machen und assoziativer; anstehende Probleme nicht nur als die unserer Gesellschaft, sondern auch als die der Welt, als epochale, elementare kenntlich zu machen, durch eine freiere und provokantere Fixierung zu dimensionieren“ (so Mensching im bereits zitierten Interview). Durch die offene und surrealistische Montage gelingt es ihm, ein Changierendes, sich allzu rascher Deutung und Festlegung Entziehendes zu schaffen, das dem Leser mehr abverlangt als manche früheren Texte (darunter auch im Band versammelte) und eben dadurch Raum schafft, den vorgeführten und den angerührten (eigenen) Erfahrungen mit Gedankenarbeit dazwischenzukommen. Wer spricht hier, oder schweigt, und wer übersetzt?
und ich brüllte schwitzen ins Telefon und das Telefon
schwitzt nicht
lauschte geduldig selbst in den Pausen und in den Pausen
sagte ich das Eigentliche sie waren zweideutig vieldeutig und
eindeutig
es kam darauf an wie man sie übersetzte
Und so wird der Text, auch hier, zum poetologischen Programm, Übungsfeld für Kommunikation. (Wann kommt das große allgemein Gespräch?). Dämmerungen, Übergänge, Lichtmetaphorik in zahlreichen Gedichte wie des ersten Bandes, so auch hier. Eine kleine Auswahl: das Versteckspiel, mit dem beide Bände eingeleitet werden; die Reihe der Abtönungen in „Kaum merkliche Veränderung“; die Milchglasscheibe…; im neuen Band besonders das Gedicht „Hotelzimmerdämmerung“ mit einer ganzen Toposkette von Übergängen, zwielichtigen Metaphern, Zwischenräumen und dem wichtigen und schönen, vieles bedeutenden Schluß:
im Türspalt
steht dein nackter Fuß, mit sanfter Gewalt
eroberte Zwischenräume,
mehr, sagst du, trauen sie uns nicht zu,
ich sage, daß sie sich bloß nicht irren,
in diesem Licht ist vieles möglich
Eine weitere Spur führt in die im Anhang des Bandes von Mensching gedruckte „unordentliche Lesart“ zu einem Gedicht von Ritsos; „unordentlich“, weil sie Bruchstücke montiert, Reflexionen, Zitate, Witze, Sentenzen, Gedichte; aber auf diesem Umweg schafft sie Bewegungsraum für Assoziationen und Deutung. Mitten darin nun eine Reflexion über das Licht, in der sich Deutung des Gedichts von Ritsos und Schlüssel (auch eines dieser „Schlüsselworte“ bei Ritsos/Mensching) zu Menschings Schreibkonzept verquicken:
Das Licht ist die Grenze, hier erfolgt der Aufbruch, die Rebellion. Jener ist außer sich, so viele Dinge sind ihm bereits entzogen, entfremdet worden, hier aber, am elementarsten, dringendsten Lebens-Mittel, beginnt seine Abwehr. (…) Was ist dies für eine Welt, derart verstellt von Barrieren, fremden Mächten und Medien, voller Filter, Gardinen, Scheiben, eine Welt beständig – wachsender Undurchschaubarkeiten, wo auch das Selbstverständliche nicht länger selbstverständlich bleibt, wo es, so eingefordert, das Unmögliche scheint, obwohl es das Mindeste ist. Verstehst du?
Von jedem Satz dieser Lesart, auch den hier fortgelassenen, führen Spuren zu Gedichten des ersten und zweiten Bandes von Mensching, zu beiden Eingangsgedichten, beiden Titelgedichten und auch zum biographischen Poem, an dessen Schluß die Linien noch einmal zusammengeführt sind, Form und Inhalt, alle Nuancen des Sagbaren und des Lebbaren, Angelika und die Genossen, die Friedenserklärung an alle, die Berliner Tauben, Deutschland meine Trauer, und:
ich verlange erbitte fordere nichts
als die Verteidigung aller Nuancen des Lichts
und des Schattens
Ein Aufklärer: er will mehr Licht. – Aber kein platter: er weiß um Schattierungen auch. Das ist die Fahne („einige verlangten daß ich Fahne zeige…“) und das Programm: Schreibprogramm. Kampfprogramm. Die zahlreichen Bekundungen von Trauer, Melancholie, Zweifel in beider Bänden (Mensching: „aber solange kann ich nicht warten ich ertrage die Erde / nicht wie sie ist“) sind nicht Identifikations-, sondern Arbeitsangebote, gerichtet auf kollektive Definition solcher Zustände. „Solche Momente“ (Wenzel) nicht zu zelebrieren, sondern zu benutzen. Bei aller Verschiedenheit der Temperamente, Schreibantriebe, Traditionen treffen sich hier beide in einer seltenen Kampfgemeinschaft. Nach dem kollektiven Antritt der Braun, Mickel, Kirsch… hier eine vielleicht „intimere“ Form von Kollektivität, aber kaum weniger fruchtbar. Wir sollten den Glücksfall wahrnehmen und annehmen.
Nicht alle Texte des neuen Bandes von Mensching haben jenen reichen, changierenden Ton. Manches inhaltlich gewichtig sich Gebende, vor allem im ersten Abschnitt, ist eher dürr parabelhaft. „Vor dem Sieherungskasten“: nun gut. „Auch ich hab“ manchmal „die Schnauze voll“ usw., was soll’s? Mehr als die eine Bedeutung ist da nicht drin. Menschings Kommentar:
Problematisch wird es dann, wenn man die Absicht merkt und verstimmt ist.
Genau das passiert in einigen dieser Texte, zum Beispiel auch in „Nur ein Beispiel“: wo sich eine schöne Stelle findet: „einige wissen es immer. Andere nicht. / Aber was hat das zu sagen? Rattatatam.“ Der Rest – ein Metallkasten, der nicht mehr als, ungefähr, ein Beispiel abgibt, trotz des aufdringlichen Hinweises im Titel und am Schluß. „Tuchfühlung“ ist da stärker, bis auf den bläßlichen Schluß, als brauchte es eine Fahne, ein Bekennerwort am Ende. Hier sind Texte, die nicht allzuviel Arbeit ermöglichen. Ich vermute – eben das, was zu überwinden war. (Brauchte der Verlag Texte aus der Schublade, den Band anzufüllen?)
Ein paar Worte noch zu den Liebesgedichten des dritten Abschnitts. Neben einigem Überflüssigen finde ich auch hier Wichtiges, das einen Strang aufnimmt, den schon die frühesten Gedichte von Mensching hatten – er hat ihn benannt mit Namen wie Neruda, Vallejo, Cardenal, Ritsos: Leuten, die nicht trennen „zwischen sozial engagierter und individueller (purer) Poesie, etwa zwischen Revolution und Erotik“. Dies in deutscher Dichtung nicht allzu Häufige, zu dem Mensching und Wenzel das Ihre hinzutun, kein geringes Verdienst. Ich nenne das Gedicht über „den Schlüssel von Jannis“, die „Nänie auf die Liebe“ und „Auch ich bin nicht ganz dicht“. Anrennen gegen Tabus, und die Entdeckung des Spermas als subversiver Substanz, die Schönheit des sich Vermischens/sich Einmischens. Hier ist etwas, in der einen wie der andern Richtung, das trägt und das zu Hoffnungen berechtigt.
Neben Wichtigem bringt auch Wenzel eine ganze Reihe braver Gedichte mit zitierfähigen Stellen, und die zitiert werden. Ob’s dem Autor recht ist? Er kann sich ja sein Publikum nicht aussuchen; und wenn wir’s streng nähmen, was wir ja gottlob nicht tun, müßten wir erst einmal klären, was wir mit uns wollen, bevor wir beurteilen, was der Autor mit uns bezweckt oder bei uns bewirkt. Und damit wäre, wie schon öfter bemerkt wurde, der arme Rezensent natürlich überfordert; oder soll ausgerechnet er den Anfang machen? Klammer zu. Und genug der Anforderungen an ihn und zurück zu denen an den Autor: dem wir nicht abverlangen wollen, daß er abstrakten Normen an Vollendung oder Kunstfertigkeit pp. genügen möge; aber aufregend soll’s schon sein dürfen.
Wenn ich draußen nichts erkenne,
Seh ich immerzu bloß mich.
Das ist nicht schlecht und wird gern zitiert werden, weil’s ungefähr das trifft, was wir vom Dichter erwarten (allgemeines Wohlgefallen!); aber viel unbräver als der Rest des Vierzehnzeilengedichts ist es auch nicht. Gesungen in einem Programm mag es seinen Platz haben.
Aber
(sagt mein anderer innerer Zensor), vielleicht war’s gar im Buch so geplant? Vielleicht soll der geneigte liebe Leser (wie er fünfzehn Seiten zuvor angeredet wurde) an dieser Stelle mehr oder weniger heftig zustimmend nicken, um dann auf der gegenüberliegenden Seite aufzulaufen, mit dem geneigten Kinn auf dem Gedicht zu landen, das just und passend so beginnt:
Ich koche mein Süppchen,
Auf Sparflamme.
Gestern nacht hat mich
Die Weisheit befallen.
Jetzt hegt und pflegt
– Wie eine Amme –
Der Schnaps
Mein allgemeines Wohlgefallen.
(wer lacht sich ins Fäustchen?)
Mensching und Wenzel stehen nicht nur zusammen auf der Bühne, und sie haben nicht nur annähernd gleiche Erscheinungszeiten für ihre jeweiligen neuen Bände (und warum sollte es nicht dabei bleiben?). Sie haben auch sonst eine ganze Menge gemeinsam. Zuerst zu nennen wäre da die beiden eigene Kopplung von Sinnlichkeit und weltveränderndem Anspruch, von Lebensgenuß und Revolution, wenn auch von jedem, entsprechend seinem Naturell, anders realisiert. Bei Mensching steht, wenn ich richtig sehe, die weltabbildende und -schaffende Kraft metaphorischen Sprechens im Vodergrund. Wenn der seine Liebe oder seinen Hunger nach Welt oder eine simple Beobachtung im Straßenbild oder was immer anspricht, meint er das Ganze stets mit. Als sein Problem hat er folgerichtig die Gefahr erkannt, die Stufe des unmittelbaren, spontanen Erlebens (Fühlens, Denkens) in allzu kunstfertiger Verwandlung in die Metapher im weitesten Sinne des Wortes (bis zum Gedicht als einem einzigen Tropus) zu überspringen. In surrealistischen Techniken wie im Rekurs auf Dichter wie Ritsos, Cardenal und andere und wohl auch in seiner Bühnenarbeit wirkt er dem entgegen.
Anders bei Wenzel. Gewiß hat sich die langjährige Zusammenarbeit im Liedertheater und darüber hinaus auf die Protagonisten ausgewirkt, und man kann, was negativ als Gefahr für den einen formuliert worden ist, sich vom anderen herabziehen zu lassen, positiv als Glücksfall werten. In dieser Zusammenarbeit bildete sich eine „theoretische“ Übereinstimmung im Kunstwollen und, wenn das Wort erlaubt ist, Weltwollen heraus, die sich vielfältig artikuliert: vom gemeinsamen Bezug auf literarische, philosophische und politische Traditionen, ich nenne Marx und Benjamin, Hölderlin und Mühsam, Kramer, Hoelz…, bis hin zu (ob übernommenen oder gemeinsam erarbeiteten) Motiven, zum Beispiel das Nicht-warten-Können oder das Radio als Vermittlung von Welt (dies letztere gewiß ein generationstypisches, wenn auch sehr verschieden gehandhabt).
Aber die Unterschiede: Wenzel ist spontaner und läßt seine – durchaus widersprüchlichen – Gefühle passieren, wenn auch nicht widerstandslos, wie gesagt wurde. Er hat einen Hang zum Sentimentalen, den er auch nicht unterdrückt, so wenig wie er sein Wissen um Zusammenhänge, seine zweite Regung gewissermaßen, verleugnet. Er verfügt über diesen Hang, nicht der über ihn. Daher der alles andere als einheitliche, alles andere als „Gesamteindruck“ seiner beiden Bücher, immer sowohl als auch, zur Irritation und zum Gewinn des Lesers. Ob er damit „der Poesie einen Dienst“ erweise, sei ihm „vollkommen schnuppe“, sagt Wenzel.
Neu erscheint mir bei wichtigen Texten des neuen Bandes eine gewisse „theoretische“ Anreicherung dieses Gefühls; obwohl der Augenschein mit Vorsicht zu genießen ist: des allgegenwärtigen Augenzwinkerns wegen, siehe auch und besonders Wenzels Essays oder „essay-ab-artigen Gebilde“, mit denen er seine Bücher, wie es in einem (fiktiven?) Brief an den Autor, den er real beantwortet, heißt: zu „verunreinigen“ pflegt („Ein geöffneter Brief“).
Man vergleiche etwa die (nicht in vorliegendem Band, sondern in dem Sammelband Positionen 2 des Mitteldeutschen Verlages gedruckten) „Allgemein wiederholte(n) Auslassungen zu einem hinlänglich bekannten Thema / Diskussionsmitschrift“ und suche den Protokollanten/Autor im Stimmengewirr. Die Reflexion hebt aber so an:
Nach dauerhafter, pflichtgemäßer (nicht nur individueller) Lektüre meiner neuen Texte entdeckte ich ein Phänomen, dessen Ursache mich interessiert: Die Melancholie. Meine epikureische Traurigkeit, die sich besonders in den neuen Arbeiten übermäßig in den Vordergrund spielt. Ich muß mir eingestehen, daß es sich um keine Laune oder Stimmung handelt. Sogar bei grotesken oder satirischen Ausdrucksformen (…) erblickte ich hinter jeder Grimasse ein trauriges Gesicht. Die Anhäufung nun vieler recht stiller, beobachtender (Klage-)Texte, die ihren Nährstoff in meiner Biographie fanden, machte mir dieses Zentrum deutlicher als zuvor. Der Gang meiner Überlegungen (d.i. in diesem Fall oft das plötzliche Wiedererkennen von Fundsachen) verdeutlicht ebenfalls meine Lage: Ich konnte nichts beschönigen (oder mit einem positiven Begriff gesagt: gestalten), begrifflich abheben, damit wäre mir nicht geholfen. Traurig kann nur sein, wer an der wirklichen Welt hängt, barbarisch verliebt ist in seine sinnliche Existenz, in den Genuß und den Ekel.
Im Umkreis solcher Überlegungen stößt der Autor (auch hier) auf einen Mann, vor dem der (fiktive?) Briefschreiber ebenso warnt, wie anderswo reale Briefeschreiber vor „zuviel Benjamin“ warnen zu müssen glaubten. Brechts „Widersprecher“ also, dessen geradezu modisch vielzitiertes Bild vom „Angelus Novus“, dem „Engel der Geschichte“, auch hier auftaucht: dem ganzen Band zum Motto. Koketterie, intellektuelle Mode oder mehr? (Auf Bezüge in Wenzels Texten wurde bereits hingewiesen).
„In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferungen von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen.“ (sagt Benjamin, zitiert Wenzel). Oder in seinen Worten:
Wie sonst soll die Generation, der ich angehöre, den Sinn ihrer Existenz im historischen Prozeß erkennen und kritisieren können, wenn sie in Begriffen denkt, die aus einer ganz anderen, anders bewegten und motivierten Zeit herrühren, wo gesellschaftliche Veränderung etwas anderes bedeutete. Andere Begriffe, die bereitstehen, unsere Unzufriedenheit in sich aufzunehmen, wie Etablierung, Anpassung, Realitätssinn etc. erzeugen nur Schuld- und Nichtigkeitsgefühle der Gegenwart gegenüber.
Zu lernen ist, denke ich, von diesem Vorgang mehreres; geht es doch nicht (und geht es doch auch) um Wenzels Schreibkonzept. Wie kommen junge Menschen am Ende des Jahrzehnts (des Jahrtausends) dazu, ihren Anteil an vergangener und kommender (und laufender) Geschichte wahrzunehmen und wahrzuhaben? Da kann man sich nicht ruhig darauf zurückziehen, daß wenigstens einige schon die richtige Position finden. (Wenigstens Wenzel und Mensching?). Da könnte es lehrreich sein zu sehen, wie diese beiden um ihren Platz noch oder wieder ringen, die doch schon „etabliert“ schienen. Lehrreich auch, wie bestimmte Traditionen, ästhetische und weltanschauliche, wie also etwa Benjamin, auch und vielleicht gerade in seinen „theologischen“ Zügen, die Mensching zitiert, produktiv gemacht werden kann für heutige Sozialisationsprozesse.
Mich hat nach der Lektüre der Benjaminschen Texte die Frage: wie konkret kann eine Geschichtsphilosophie überhaupt sein, tief berührt, hat mich wieder wach gemacht, meine Wahrnehmungen genauer wahr-zu-nehmen. (Wenzel)
Diese Tendenz zu größerer Genauigkeit ist mir an beiden Büchern wichtig (ohne daß es mich Schwächen übersehen läßt: aber es findet Bewegung statt!). Beide suchen mit Brecht nach einer Ästhetik, die von den „Bedürfnissen unseres Kampfes“ abgeleitet ist, einer Ästhetik, zu deren schönsten Hoffnungen es also gehört, uns zu der Frage aufzustören: woher denn, wogegen, wofür… wir da eigentlich kämpfen sollen, na was? – Diese Autoren haben seit ihrem Start viel Lob erfahren und ein bißchen Kritik auch. Aber wofür das Lob, wogegen die Kritik? (Das wäre ja neu; daß wir loben, was uns aufstacheln will, nicht wahr?!). Also eine Ästhetik, der es um das bißchen Kritik und das viele Lob nicht geht. (Freilich, wir sind alle Menschen, also schon drauf angewiesen, aber… ): In diesem Aber steckt der Kern, oder besser: es ist der Kern, um den es lohnt, die Schale zu knacken. Eine Ästhetik, die auf Wirkung zielt: wo, wie, warum nicht… wären da angemessenere Fragen als die nach partiellem Ge- und Mißlingen. Die Autoren zielen auf das, was uns gelingt oder mißlingen kann, oder zu spät. Wollen wir darüber reden? Eine Kritik, die das Amt hätte, den Finger auf die wunden Stellen zu legen – nicht primär der Gedichte, sondern der Wirklichkeit, auf die jene zielen. Die Güte der Gedichte abliest an dem Grad, in dem sie uns dazu nötigen. So gesehen – ist das allgemeine Lob etwa kein warnendes Zeichen? Oder, teils unbewußte, Abwehr? Wen wundert’s, wenn die Autoren den Spieß umdrehen und zur Kritik des Lesers anheben. Schon die Anordnung der Gedichte (bei Wenzel) kritisiert Bedürfnisse, indem sie sie konfrontiert. Ach möchten wir doch, sagt das, mehr Unbescheidenheit entwickeln! Ach möchten wir mit diesen Texten, mit uns, umgehn. Wie, fragen sie, arbeiten wir damit? Mit den Autoren, ohne sie uns fangen zu wollen? Wie, also, bewähren wir uns? Ich frage nur.
Michael Gratz, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1988
Hans Sarkowicz: Ein Kristallisationskünstler mit vielen Talenten. Laudatio auf Steffen Mensching zum Thüringer Literaturpreis 2021.
Friedrich Dieckmann: Weltverzweiflung ist das Vorrecht des Dichters. Laudatio auf Steffen Mensching zum Berliner Literaturpreis 2022.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ulrike Kern: Intendant, Autor und Clown Steffen Mensching wird 60
Ostthüringer Zeitung, 27.12.2018
Jegor Jublimov: Martens, Mensching
junge Welt, 27.12.2018
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer +
Dirk Skibas Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Steffen Mensching & Hans-Eckardt Wenzel bei Verlorene Lieder – verlorene Zeit am 2. Dezember 1989 im Haus der Jungen Talente in Ost-Berlin.


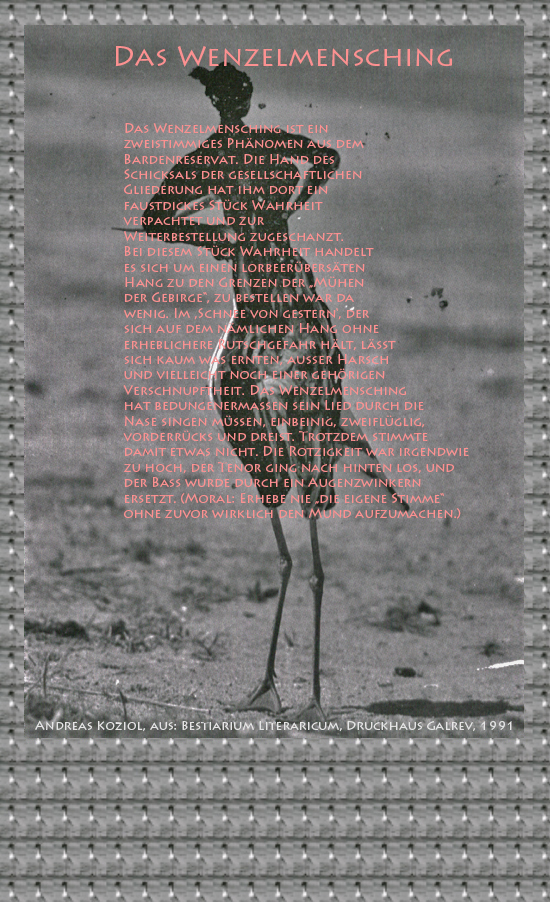












Schreibe einen Kommentar