Thomas Kling: Botenstoffe
ZU DEN DEUTSCHSPRACHIGEN AVANTGARDEN
Avantgarde-Bashing I
Im Rahmen des allgemeinen Kassensturzes am Ende des 20. Jahrhunderts ist nichts so billig geworden, wie das Abqualifizieren der ästhetischen Avantgarden. Dies geschieht unter fragwürdigen Behauptungen und unzulässigen Verallgemeinerungen: beispielsweise der des Kunstkritikers Eduard Beaucamp, daß „das (!) System der einzelnen Schulen… klar durchschaubar“ sei. Einzig, daß hier im trüben gefischt wird, ist klar durchschaubar. Klar durchschaubar ist, außer dem staatsanwaltlichen Stil ausgesuchter Eisigkeit, der bei den Abrechnungen mit den Avantgarden stets zu beobachten ist, zunächst einmal gar nichts. Solch schmallippige Ismen-Bilanz darf in aller Regel als das freudlose Ergebnis einer rumpelnden Pauschalreise durch den wehen Kritikerkopf gesehen werden. Sie fußt nicht zuletzt auf Umständen, die Nietzsche (Jenseits von Gut und Böse) als „Tölpelei moralischer Entrüstung“ bezeichnet hat.
Ich möchte noch vorausschicken, daß ich kein Avantgarde-Fetischist bin, daß dieser Ausschnitt an Tradition mir gleichwohl immer verteidigenswert erschienen ist. Wie, um zwei Dichter der europäischen Moderne zu nennen, Giuseppe Ungaretti und Federico Garcia Lorca, wie die ältesten, von Rhapsoden überlieferten Dichtungen der Menschheit überhaupt. Das Interesse an Dichtung aller Sprachen und Epochen, auch wenn ich den Sinn, in Übertragungen transportiert, oft nur erahnen kann. Das ist bis heute so geblieben. Einen Jacques Vaché (Lettres de Guerre, 1919) kann ich übrigens gut verstehen, wenn er über Apollinaire sagt: „Mit Telephondraht flickt er Romantik zusammen und weiß nicht einmal, was Dynamos sind.“ Bei dieser Königskinderhochzeit zwischen Gedicht und Naturwissenschaft, aus zutiefst romantischem Sehnen entsprossen, die in den 90er Jahren, angeregt durch Benn- und Pound-Lektüre, wieder vereinzelt angestrebt wird, werde ich nicht die Blumen streuen.
Ich sagte: Avantgarde-Bashing. Wie sieht das aus? Es handelt sich um verbissene bis verbitterte Aburteilungen von Dichtern, Künstlern und Theoretikern der klassischen Avantgarden in toto als utopisch-begeisterte, spirituell-fanatische, respektive kriegsgeil-vernebelte Steigbügelhalter und Zungenredner der totalitären Jahrhundertregime. Avantgarde-Bashing gehört, darüber ist nicht hinwegzusehen, inzwischen zum Common sense. Den Ansichten einflußreicher und marktorientierter Kunsthistoriker, bzw. -kritiker wie dem Amerikaner Donald Kuspit, wie dem obengenannten verantwortlichen Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Beaucamp, dem Direktor des Pariser Musée Picasso, Jean Clair, oder Boris Groys, dem Spezialisten für russisch-sowjetische Avantgarden und deren poststalinistischen Erben, ist an dieser Stelle nicht nachzugehen. Bei Hans Magnus Enzensberger, seines Zeichens Verfasser treuherziger Lyrik und süffiger Spiegel-Essays, liegt der Fall näher. Sein Avantgarde-Bashing werden wir weiter unten einer knappen Betrachtung unterziehen.
(…)
Inhalt
− Zu den deutschsprachigen Avantgarden
− Leuchtkasten Bingen. Stefan George Update
− Wie war das mit Ascona
− Spracharbeit, Botenstoffe. Berliner Vortrag über das 17. Jahrhundert
− Totentanzschrift, Fotomaterial. Wiener Vorlesung zur Literatur
− Sprachkonzepte sind Weltapparate. Zu Juana Inés de la Cruz, H.C. Artmann, Konrad Bayer
− CD. Die gebrannte Performance
− Graz und Gedächtnis
− Rhapsoden am Sepik
− Picasso-Homestory
− Venedigstoffe
− Stadtpläne, Stadtschriften
− Oswald von Wolkenstein
− Stefan George, Schülerbibliothek
− Salvatore Quasimodos Toten und zum Programm des Horaz
− Peter Huchel Dankabstattung
− Sprachkörpersprache. Über Christine Lavant
− Geschmacksurteile. Über Ingeborg Bachmanns Gedichte
− „Parallelsprache, Nervenausschnitte“. Über Friederike Mayröckers Heiligenanstalt
− Dieter Roths Welttapete
− Bildwandlerinnen. Sabine Schos Album
− Das kommende Blau. Über Marcel Beyer
− Drei Gespräche aus den Neunzigern
Als Forschungsreisender in den Angelegenheiten des Gedichts
hat Thomas Kling sich in den Essays seines Buches Itinerar (1997) vorgestellt. Sein inzwischen vielbändiges lyrisches Werk hat ihn zum „bedeutenden Lyriker des 20. Jahrhunderts“ (Neue Zürcher Zeitung) gemacht; zuletzt erschien, Schrift- und Sprachklang vereinend, sein Gedichtbuch Fernhandel (1999).
Seine Archäologie des Poetischen treibt Thomas Kling nun mit Botenstoffe voran – denn „Dichtung ist gesteuerter Datenstrom und löst einen solchen im Leser aus.“
Botenstoffe, das sind nicht nur die eigenen Gedichte auf Sprach- und Geschichtsreise, Botenstoffe liegen auch in der Tradition, die Thomas Kling sich und uns facettenreich eröffnet: Er erhellt die Berührungspunkte von Barockdichtung und Moderne, macht mit seiner Lektüre mit der mexikanischen Ordensfrau Juana Ines de la Cruz und den Predigten eines Abraham a Sancta Clara oder dem Sängerdichter Oswald von Wolkenstein vertraut. Ob Horaz, Stefan George, der italienische Lyriker Salvatore Quasimodo, eine Peter-Huchel-„Dankabstattung“ oder seine Beziehungen zur „deutschen Sprache selbdritt“ – Christine Lavant, Ingeborg Bachmann und Friederike Mayröcker −, all das ist genauso faszinierend wie eine Picasso-Polemik oder ein Portrait des Dichterfreundes Marcel Beyer.
Botenstoffe beschließen drei Gespräche mit Thomas Kling aus den 90er Jahren.
DuMont Buchverlag, Klappentext, 2001
Zeigefinger in der Talsperre
− Klasse, so ein Dichter! Thomas Kling will nicht Schneewittchen sein. −
„Ein dummes Mißverständnis wäre, meine Literatur als eine geschredderte aufzufassen. Das ist vollkommen daneben“, sagte Thomas Kling im April 1994 in einem Gespräch mit Hans-Jürgen Balmes und Urs Engeler. Dieses Dementi ist vielleicht die literaturstrategisch wichtigste Äußerung in Klings neuem Buch Botenstoffe – nämlich die spontane Reaktion auf eine Bemerkung von Botho Strauß, wonach die „geschredderten Formen der Gegenwartslyrik“ keinen Halt böten, wohl aber Rilkes Elegien.
In der Tat ist den „Sprach-Installationen“ Thomas Klings vorgeworfen worden, sie lösten die Worte in Silben und Laute auf und zerstückten jedwede dichterische Gestalt. Übersehen, vor allem überhört wurde dabei, mit welcher Sprachlust und welchem Anspielungsreichtum dieser Poet seit Anfang der achtziger Jahre seine Dialektik von Schrift und Rede betreibt. Für die „hymnische Schönheit“, nach der es Botho Strauß verlangt, hätte er vermutlich nur Hohn übrig. Aber Klings obsessive Beschwörung von Sprache hat manchmal jene Faszination, die den Begriff Schönheit nicht ausschließt.
Das entscheidende Argument gegen den Vorwurf des Schredderns aber steckt im Titel des im Vorjahr erschienenen Gedichtbandes Fernhandel. Er zielt auf das Hereinholen der ältesten und entferntesten Traditionen in die aktuelle Poesie. Diese Tendenz teilt Kling mit Durs Grünbein und Raoul Schrott – freilich ohne die klassizistischen Neigungen des einen und die enzyklopädischen des anderen. Schrott wie Kling haben Catull übersetzt. Zum metropolitanen „street talk“ des Römers ein zeitgenössisches Analogon zu schaffen ist Klings Ehrgeiz. Überhaupt hat ja die gegenwärtige Avantgarde ihre Stoßrichtung umgekehrt. Sie sucht das Neueste im Ältesten. Sie erobert Tradition.
Die Essays und Glossen der Botenstoffe sind pro domo geschrieben. Sie plädieren für eine „offene Hermetik“, bieten poetologische Abgrenzungen und Plädoyers, verzichten aber auf explizite Theorie und bürokratische Dogmatisierung. Die Experimentellen und Konkreten der sechziger Jahre sind ausgeblendet: Gomringer, Heißenbüttel oder Mon kommen bei Kling nicht vor. Die neuen Bezugsfiguren sind H.C. Artmann, Konrad Bayer, Friederike Mayröcker und Reinhard Priessnitz. Dazu holt Kling sich aus der Zeitentiefe als Stifterfiguren Catull und Horaz, aber auch Oswald von Wolkenstein, ja sogar die Mitglieder der barocken Sprachgesellschaften. Harsdörffers vielgeschmähter Nürnberger Trichter (1647) findet wegen seiner antimimetischen Tendenz vor Kling mehr als bloß Gnade. Der Poet, so zitiert er, soll sich „in solchen Erfindungen sinnreich erweisen und seine Sachen auf nicht gemeine Weise vorzutragen wissen“. Womit sich Kling selbst getroffen fühlen dürfte.
Einen neuen „Trichter“ dagegen hat er nicht im Sinn, obwohl er selbst schulbildend geworden ist. Er zeigt Verständnis für die Angst des Horaz vor „fitten Nachrückern“, scheint aber von vergleichbaren Befürchtungen nicht geplagt zu sein. Dennoch beklagt er im Einleitungsaufsatz „Zu den deutschsprachigen Avantgarden“ das allgemeine „Avantgarde-Bashing“. Doch natürlich möchte auch Kling den Kanon verändern und verzichtet nicht auf Polemik. Er nennt Enzensberger einen „Museumswärter“, und er mokiert sich über Ingeborg Bachmanns „artifizielle Schneewittchenhaftigkeit“. Dagegen empfiehlt er uns die tatsächlich verkannte Christine Lavant, wogegen wiederum nichts zu sagen ist. Wie auch immer. Man freut sich über eine befreiende Bemerkung wie diese: „Ich finde das richtig klasse, Dichter zu sein: Dichter müssen spekulieren.“
Überhaupt ist es die gute Laune, die für Kling einnimmt. Dabei weiß auch dieser Poet, auf welch schwankendem Boden die Poesie ihre Triumphe feiert. Er sieht sehr deutlich das Schwinden der Bildungsvoraussetzungen, das Wegbrechen jener Tradition, die er zu erobern auszog. Kling dichtet zwischen dem allgemeinen Wissensschwund und dem weißen Rauschen der Information. „Um so tragikomischer“, so meint er, „kommen da Versuche rüber, mit dem Zeigefinger die geborstene Talsperre abdichten zu wollen.“ Wie wahr: der didaktische Zeigefinger wird es nicht leisten. Aber – das ist wohl auch Klings credo quia absurdum – vielleicht die Poesie selbst.
Harald Hartung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.11.2001
Der surfende Hermes
− In seinem Essayband Botenstoffe spiegelt sich Lyriker Thomas Kling in Hermetikern aller Zeiten. –
Poesie ist göttlicher Botenstoff. Sie bringt einzigartige Mitteilungen aus dem inneren Kosmos des Menschen. In gut zwei Dutzend Essays, die in den letzten Jahren entstanden sind, sortiert und kommentiert Kling unter dem Titel Botenstoffe sein Quellenmaterial und arbeitet sein poetisches Umfeld nachrichtenmäßig auf. Die einzelnen, scheinbar zersprengten Themen fügen sich zu einem deutlich erkennbaren Raum, der nicht nur bislang wenig betrachtete literaturgeschichtliche Zusammenhänge deutlich werden lässt, sondern gleichzeitig die Poetik Thomas Klings beherbergt. Kling räumt mit Missverständnissen auf, indem er historisch weit ausholt. Seine Kritiker werfen ihm oft vor, hermetisch zu schreiben, meinen wohl aber eigentlich unverständlich. Der Dichter rückt den Begriff ins rechte Licht, in die unmittelbare Nähe zur mythologischen Hermesfigur. Der Götterbote funktioniert in seiner steten Reise- und Übersetzungstätigkeit zwischen Oben und Unten und zwischen Licht- und Schattenreich als „Teilchenbeschleuniger, als Beschleuniger von Sprachteilchen“, als Vermittler der Sphären. Den Vorwurf des Bildungsfetischismus, der gegenüber Kling oft geäußert wird – und den er mit diesem oft witzigen, zwischen den Zeiten zappenden Essayband entschieden entkräftet −, hat es längst zu anderen Zeiten gegeben. Auch T.S. Eliot musste auf ähnliche Weise Ezra Pound verteidigen, jener wies darauf hin, dass die Verwertung von Bildungsstoff nicht heiße, ihn gleichermaßen beim Leser vorauszusetzen. Lesen sollte auch nach Klings Verständnis Herausforderung bleiben: „Das Gedicht ist ein feuriges Plädoyer, zunächst einmal für die Benutzung des Verstands. „Der gleiche Vorwurf wurde übrigens schon der Barockdichtung gegenüber erhoben. Das lässt Klings Affinität zum 17. Jahrhundert verstehen. Barockdichter wie Johann Michael Moscherosch zählen zu den ersten Benutzern von Rotwelsch in der Poesie. Rotwelsch ist nach Kling die schnelle Rhetorik randständiger Sprachen, offene Hermetik, von Orpheus im Studio eingesprochen. Für Kling ist der Slang schon immer ein notwendiges Gegengift zum hohen Ton gewesen, der nur in homöopathischen Dosen dem menschlichen Gehirn zumutbar sei. Eine diesem Band zu verdankende Wiederentdeckung ist die mexikanische Ordensfrau Juana Inéz de la Cruz. Eine hochgebildete Solitärin im nicht gerade bildungsgleichberechtigten 17. Jahrhundert, die mit Interesse naturwissenschaftliche Entwicklungen verfolgte. Mit fast prophetischer Gabe verfasste sie das schon formal faszinierende Langgedicht „Erster Traum“. Der Mensch wird bei ihr zur Maschine, zur Wundermaschine, sein Herz ist mit einem „Blasebalg verbunden – Lunge oder Magnet des Windes heißt er“. Kling sieht in dieser Annäherung an den Körper in seiner Funktionsweise erste Vorboten der modernen Gehirnphysiologie. Im Essay „Avantgarde-Bashing“ zur Verprügelung der Avantgarde, befreit der Autor den Expressionismus rigoros von einem „pappig-zuckerwattigen Nachgeschmack“, den zu lange schon die noch immer als maßgeblich gewertete Anthologie von 1919 unter dem Titel Menschheitsdämmerung mit ihren „ekstatischen Parfümiertheiten“ erzeugte. Kling bedauert das Desinteresse zeitgenössischer Autoren am Expressionismus. Dieser bleibe eine extrem materialintensive Periode und sei zu Unrecht fast völlig aus dem zeitgenössisch-literarischen Botenstoffarsenal verschwunden. Ebenso entbindet Kling Christine Lavant vom Stigma der unbefriedigten hinterwäldlerischen Außenseiterin und weist nach, dass sie eine „gezielt Randalierende in einer reaktionären Nachkriegszeit“ war, die die historische Sprache ihrer engeren Umgebung genau gekannt und eingesetzt hat. Als „Schriftbenutzer“ weiß Kling um die Herausforderungen der neuen Medien an die alten. Er weist „smarte Beweglichkeit“ schon bei Merkur nach, bei Hermes den Hang zum Vielfliegen, zum Hacken und zum Surfen. An der Figur des ägyptischen Mond- und Schriftgottes Thot verweist Kling auf den Zusammenhang von Zeitverwaltung und Schrift. Thots Aufgabe, Hüter schriftlich festgelegter Gesetze zu sein, verband sich mit der Umlaufbahn des Mondes – auf seine regelmäßige Zu- und Abnahme bauten die Ägypter ihre Zeitdefinition auf. So wurde der Herr der Schrift auch zum Herr der Zeit. Thomas Kling arbeitet nicht nur in seinen Gedichten, sondern auch in diesen Essays gegen ihre Verselbstständigung als pure Gegenwart.
Cornelia Jentzsch, Berliner Zeitung, 21.7.2001
Orpheus im Aufnahmestudio
− Ein Historiker unter den Dichtern: Thomas Kling und seine wundersamen Botenstoffe. −
Hermes, in der griechischen Mythologie der Götterbote des Olymps, überbringt den Menschen Nachrichten und Geschenke, ist ein gewandter Überredungskünstler, zeigt Wege auf und geleitet die Seelen Verstorbener sicher bis zum Boot Charons, das sie zum Hades übersetzt. Von Hermes stammt auch der listenreiche, auf dem Meer hin- und herschwenkende Odysseus ab. Eine Affinität zu diesem besonderen Stammbaum lässt Thomas Kling in seinem neuen Band mit dem Titel Botenstoffe ahnen. Es ist diesmal kein Gedichtband geworden, vielmehr umreißt Kling das, was zu den Gedichten hinführt, unter ihnen lagert, ihre Substanz ausmacht. In gut zwei Dutzend Essays, die in den letzten Jahren entstanden sind, sortiert und kommentiert er sein Quellenmaterial und arbeitet sein Umfeld nachrichtenmäßig auf.
Poesie ist ja von ihrer Wesenhaftigkeit her zunächst selbst göttlicher Botenstoff. Sie bringt einzigartige, vollkommene Mitteilungen aus dem inneren Kosmos des Menschen. Zuvor muss sie Material aufnehmen, sich füllen, anreichern und im Dichter hin- und herbewegen, ehe sie Gestalt zeigen kann. Gemäß einer Verszeile aus dem Gedichtband Fernhandel – „Gedicht ist immer Ahnenstrecke, Fotostrecke“ – nutzt Kling das Moment des Fotografischen auch als Methode für seine Essays. Sie lesen sich wie kurzzeitig beleuchtete Felder, Probebohrungen zu Schriftschichten im Entstehungsmoment.
In zunächst ungeordneter Formation tauchen zahlreiche Namen und Bezüge auf, sie reichen vom Barock über Stefan George, Peter Huchel, Totentanzdarstellungen, Horaz, Christine Lavant, Friedericke Mayröcke , den Ersten Weltkrieg bis hin nach Ascona. All das fügt sich aber, bei genauem Lesen, rasch zu einem klar erkennbaren Raum, der nicht nur bislang zu wenig betrachtete literaturgeschichtliche Zusammenhänge deutlich werden lässt, sondern gleichzeitig die Poetik des Thomas Kling beherbergt.
Seine Kritiker werfen ihm gern vor, hermetisch zu schreiben, meinen wohl aber eigentlich unverständlich. Der Dichter verschwendet sich nicht in nutzloser Polemik, er rückt das Wort ins rechte Licht, in die unmittelbare Nähe zur besagten Hermesfigur. Das ist zwar etymologisch nicht völlig korrekt, logisch aber allemal. Denn der Götterbote funktioniert in seiner steten Reise- und Übersetzungstätigkeit zwischen Oben und Unten und zwischen Licht- und Schattenreich als „Teilchenbeschleuniger, als Beschleuniger von Sprachteilchen“, wie es gleichermaßen der Dichter tut.
Und Kling beruft sich auf eine lange Tradition dieses „verseuchten“ Begriffs. Als Nebenzeugen erteilt er Poeten aus verschiedensten Zeitschichten das Wort. Unter ihnen Salvatore Quasimode – neben Ungaretti oder Montale Vertreter des sogenannten italienischen Hermetismus −, Abraham a Sancta Clara, der 1680 die vor allem in schlagfertiger Umgangssprache verfasste berühmte Totentanzschrift Mercks Wienn veröffentlichte, und der Barockdichter Johann Michael Moscherosch, der im 17. Jahrhundert zu den ersten Benutzern von Rotwelsch in der deutschen Sprache zählte. Rotwelsch ist, Kling zufolge, die schnelle Rhetorik randständiger Sprachen, offene Hermetik, von Orpheus im Studio eingesprochen.
Für Kling, und nachweislich nicht nur für ihn, sei der Slang schon immer ein notwendiges Gegengift zum hohen Ton gewesen, der nur in homöopathischen Dosen dem menschlichen Gehirn zumutbar sei. Es blieben fast ausschließlich österreichische Dichter, hier vor allem die Wiener Gruppe, die nach 1945 wieder die Kraft der Dialekte, Argots, Sondersprachen und die Dichtung des Barock entdeckten. Und schließlich erneut die orale Energie des Live-Auftritts: „ohrenbetäubend, diese menschlichen Sprachen“! Dies spricht für Kling deutlich gegen den damaligen Mainstream in der bundesdeutschen Literatur, der solches weitgehend ignorierte. Die Folgen für deren Entwicklung waren für ihn absehbar: „Umgangssprache: n’ gefährlich Dingen für die Lyrik, die deutsche zumal, wenn sie im Aschenbrödelfetzen des Alltagsgedichts nach 1968 längsschleicht, depressiv, schlecht gearbeitet, sprachschlampig, sackförmig schlackernd in ostentativer Schlechtdraufität.“ Spätschäden bis heute selbstverständlich nicht ausgeschlossen, weder in der Dichtung, noch in der Rezeption.
Gerade letzterer konstatiert Kling einen grassierenden Verlust an Assoziations- und Unterscheidungsfähigkeit, wobei er sich daran erinnert, dass schon Nietzsche „die Nuance als Merkmal von Modernität erkannte“. Und es werde noch schlimmer kommen, lautet seine Prognose. Mit zunehmendem Verlust an Voraussetzbarem, man denke nur an Latein oder Altgriechisch, werde bald auch die klassische Dichtung des Hermetischen verdächtigt werden können.
Einen weiteren Link zur Dichtung des Barocks gibt es für Kling an jener Stelle, wo sie ihre Aufmerksamkeit nachdrücklich der dunkel eingefärbten Nachtseite des Menschen widmet und mit ihren Gesichten und Visionen die Areale des Traumes besichtigt und untersucht. Kling sieht in den Gedichten der mexikanischen Ordensfrau Juana Inéz de la Cruz, die den Körper in seiner Funktionsweise deuten, erste Züge der modernen Gehirnphysiologie. Auch hier lässt sich der Bogen zur Hermesfigur zurückbiegen, der das Geleit in die Unterwelt, also auch metaphorisch in das Unbewusste, Schattenhafte gibt.
Den Vorwurf eines sogenannten Bildungsfetischismus, der auch Kling gegenüber geäußert wird und der gleichermaßen in die Richtung von vorsätzlich Unverständlichem zielt, hat es längst zu anderen Zeiten und ebenso der Barockdichtung gegenüber gegeben. Das lässt noch einmal mehr Klings Hinwendung zum 17. Jahrhundert und dessen schriftlicher Hinterlassenschaft verstehen. Man will dem Dichter rein gar nicht widersprechen, wenn er schreibt: „Das Gedicht hat kein Lehrer-Lämpel-Institut zu sein, es ist didaktikfrei, seine resthumanistische Fracht ist als Konterbande zu betrachten.“ Thomas Kling hält überhaupt scharfe Verteidigungsreden gegen unzulängliche Betrachtungsweisen, gegen, wie er formuliert, verbissene bis verbitterte Aburteilungen von Dichtern, Künstlern und Theoretikern aller Epochen, die noch heute einen allgemeinen Konsens selbst bei hochgeschätzten Dichterkollegen bestimmen.
Im Essay „Avantgarde-Bashing“ befreit er den Expressionismus rigoros von einem „pappig-zuckerwattigen Nachgeschmack“, den zu lange schon die noch immer als maßgeblich gewertete Anthologie von 1919 unter dem Titel Menschheitsdämmerung mit ihren „ekstatischen Parfümiertheiten“ erzeuge. Kling bedauert das ihm unverständliche Desinteresse heutiger Autoren am Expressionismus.
Auch in seinen Essays zeigt sich Thomas Kling als der unermüdliche Historiker unter den Dichtern. Der Geschichts- und Schichtenforscher arbeitet mit einem feinen Ohr für den Nachhall von Sprachpartikeln, die aus den sich überlagernden, überlagerten Zeitformationen wie arbeitende Gase aufsteigen. Kling arbeitet gegen den sogenannten Zungenschwund. Das heißt, viele Dinge werden zwar überliefert, jedoch ändern sich ihre Bedeutungen und verblassen. Vermutlich kann dieses Verlorengehende allein die poetische Sprache in sich einschließen und aufheben. Einzig sie bietet die nötige Offenheit, da sie alles in seinem mythischen Ursprung anerkennt und belässt. Der Rest, meint Kling, sei im Begriff, Archiv zu werden und in Rauch aufzugehen.
Spätestens an dieser Stelle entdeckt man in den Essays weitere für Kling prägende Verwandschaftsverhältnisse, die er begründet und analysiert. Neben Friederike Mayröcker und Konrad Bayer ist es der kürzlich verstorbene H.C. Artmann, der wie Kling selbst ein Zeitendurchtaucher und Liebhaber historisch wie räumlich abgelegter Sprachschichten ist: „Aus der inszenierten Wahrnehmung des Dichters wird das Wahrnehmungsinstrument Gedicht aufgerufen und hervorgebracht. So entsteht, wie Reinhard Priessnitz es für Artmann formuliert hat, ‚fiktive stellungnahme zur wirklichkeit‘. Was erweiterbar wäre: wenn ich die Installation des Dichters – sein Rollen-Bewusstsein – gleichfalls als eine solche begreife.“
Im Grunde genommen lässt sich das bis auf den Leser hin fortführen, der sich im Bewusstsein dieser Lektüre einer fiktiven Stellungnahme zur Wirklichkeit nicht entziehen kann. Der Botenstoff des Götterboten Thomas Kling ist angekommen.
Cornelia Jentzsch, Frankfurter Rundschau, 21.3.2001
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Alexander Müller: Apologie der Avantgarde aus dem Barock
literaturkritik.de, August 2001
Stimmung und O-Ton
− Zum Lob Thomas Klings. Zur Verleihung des Ernst Jandl-Preises 2001. −
Sehr geehrte Damen und Herren,
lieber Thomas Kling
Soweit ich sehe, stimmt hier und heute so gut wie alles. Deshalb beginne ich mit dem, was nicht stimmt. Sprachorientierte moderne Dichtung, so eine verbindliche Rede, zerstöre Verbindlichkeiten, löse Herkunftslinien auf, entferne von Ursprüngen, vor allem sich selbst, und – so wahr ein destruktiver Charakter in ihr wirke – zerstöre sie, was an Literatur noch einen Resthalt verspreche in medial haltlosen Zeiten.
Und nun erst die Avantgarden, nun erst Thomas Kling: unter den zeitgenössischen modernen Zerstörern das viel beschworene Vorauskommando. Schon sind die meisten Kombattanten wieder auf dem Weg in den bergenden Hafen, wo Brot und Sinn zumindest das Überleben sichern, da kreuze er – ein Mann allein – um so heftiger Richtung Bermuda und anderen Weltgegenden, wo es tief und gierig zugeht. Schon verbindet sich das elidierte ,e‘ der früheren Texte mit der Wohnanschrift von Thomas Kling und Ute Langanky: ,Raketenstation‘, so als ob der Buchstabe einfach herausgeschossen worden wäre aus dem Text – und ein falsches Bild ist da in seiner ganzen stabil umrissenen militanten Prächtigkeit.
Was hingegen stimmt, ist am exakt entgegengesetzten Ende jener imaginären Skala zu suchen, die Wärmeströme der Tradition und des historischen Rückhalts mißt. Kaum ein dezidiert moderner Dichter versammelt in solchem Maße Stimmen anderer, zumal früherer in seinen Texten wie Thomas Kling; kaum einer speist seinen Haushalt, seine Ökonomie, so weitgehend mit ergangenen Reden, die alle, so fremd die Sprachgestalt auch sein mag, wie aktuell eingesprochen wirken. Man könnte von Kling-Gedichten als Synchronisierungsräumen für heterogene Stimmen reden, wenn man begründen würde, wie hier räumliche und zeitliche Verhältnisse konjugiert werden. Das will ich gleich auch tun.
Doch zunächst geht es mir um die Herkunft und die Stimmigkeit hier und heute. Kling hört Stimmen. Vor allem hört er solche aus Österreich. Er hat sie schon gehört, als er noch nicht ,vor Ort‘ war, wie man sagt. Deshalb konnte auch, anstatt Geschichte in Düsselsdorfer Hörsälen weiter zu studieren, Anfang der 80er Jahre Wien studieren und einen weiteren Begriff von Universität entwickeln. Er reiste in eine gelebte Sprachform, die er in einem Maße aufnahm, daß er bei seiner Rückkehr die rheinischen Melodiker aufschreckte mit harsch hingehauenen Austriazismen, ja sich verwandeln konnte in einen liebedienerischen Herrn Geheimrat, um dann plötzlich mit glorioser Gnadenlosigkeit einen apodiktischen Nackenschlag anzusetzen. Schweigen, staunen, lachen – ,siehst Du mein Lieber‘: So führte er sich als einverleibtes Österreich im postpreußischen Rheinland auf, als Sprech-Event versteht sich. Aber wie man inzwischen sogar aus seinen Essays weiß, auch bekleidungstechnisch: Mit Trachtenjanker in weiland Düsseldorfer Lederjacken-Pogokreisen.
Nicht daß es keinen Spaß machte – ,was haben wir gelacht!‘, würde Kling hier sagen −, es hatte und hat aber auch System. Diese überwältigenden Einschlüsse von Fremdmaterial in ein laufendes Geschehen kennen wir ja bestens aus den Gedichten, also aus dem Textgeschehen, das sich eben, so ist das mit andauernden Einschlüssen, nach und nach verwandelte zu einem wienerisch geprägten, und: wenn man es schriftlich haben will, zu einem österreichisch-rheinischen durchwebten Textus.
Womit wir in bezug auf den in Bingen am Mittelrhein geborenen, die meiste Zeit in Düsseldorf und Köln und dazwischen lebenden formal fortschrittlich und also traditionsskeptisch operierenden Dichter Thomas Kling schon einmal zwei starke Herkünfte behauptet hätten. Das Wort Herkunft im Plural klingt ziemlich modern und ein wenig relativistisch. Deswegen sagen wir mit Nachdruck, daß es sich hier um echte, d.h. bedeutsame Bindungen handelt. Eine gegeben und eine gewählte. Zwei Wurzelsysteme, der weiteren Wahl entzogen. Also stabil, zur Grundversorgung des persönlichen und dichterischen Systems nötig und wesentlich. Zum ersten Mal also: von wegen traditionsstürzende Moderne. Zum zweiten – und zum zweiten Grund, warum hier und heute so gut wie alles stimmt: Eine Tradition ist dauerhaft überhaupt nur dann in Geltung, wenn sie befragt wird, wenn man operativ in ihre Geschichte einsteigt. In einem anderen Jargon spräche man hier von der Dialektik von Genesis und Geltung. Man könnte jetzt einwenden, daß in sogenannten traditionalen Gesellschaften gerade die Nichtbefragung des Überlieferten Granat ist der Stabilität. Aber dann wären wir allzu schnell bei der zur Zeit schmerzhaft heiklen Frage, in welchen Maße die Befragung dann nach und von außen erfolgte, in Form von Überfall und Krieg beispielsweise, auch wenn solche bewaffnete Frage ans Eigene dann geradezu extraterrestrisch entfernt wird: „der große Satan“ oder, säkularer, „übersteigt alles Vorstellungsvermögen“ wären die Formeln hierfür.
Thomas Kling – wir kehren zurück zum Dichterplaneten – Thomas Kling jedenfalls eignete sich das längst schon Seinige fürderhin auf eine aktive Weise an. Natürlich hatte er Technik und Sound der Konrad Bayer, H.C. Artmann und Ernst Jandl längst schon drin, im Gehörgang zumindest, als er sich daranmachte, es auch daraufzukriegen: Dazu mußte er allerdings raus aus dem Dichtungsgeschehen, wie er es zu seiner frühen Zeit, den siebziger Jahren sah: sprachvergessen und ichverliebt: immer schon zwei Seiten einer Sache – und rein in ein Sprachenstudium der intensiven, aber auch kalten Art: Bei aller Liebe: Es gilt eben immer auch Funktionsweisen herauszukriegen. Dabei mußte leider auch der Kölner Stadtgänger- und sammler Rolf Dieter Brinkmann links liegen gelassen werden. Zu viel Emphase, auch negative, stört beim Aufbau eigener Formkapazitäten und ihrer Ausdehnung in den performativen Raum.
Dafür war Kling natürlich bei Ernst Jandl an der richtigen Adresse. Hatte ihn bei H.C. Artmann die Aufnahme des Volkssprachlichen, also des mündlichen, also auch des in literal geprägten ,Herrschaftszeiten noch einmal‘ sozial Deklassierten schwer gereizt, das Anknüpfen an eine unterdrückte Geschichte, zu der so schöne Tradionals wie das Wienerlied gehören, infolgedessen wir beim so modernen Kling immer auch Soundbites einer Geschichte der Unterdrückung vernehmen – soviel nebenbei zum Vorwurf der idiomatischen Esoterik – ….. haben wir also den H.C. Artmann in Kling als Vergangenheits- und zugleich Fremdheitsverstärker ausgemacht, so ergibt sich die Funktion Jandl in Kling zwanglos als analytische Abkühlung und anschließende oral-performative Wiedererhitzung.
Bei Jandl haben wir beispielweise den Slang auf ein Kernsyntagma reduziert und dieses dann in Erweiterung, Variation zugleich rhythmischer Gliederung zu einer mündlich-schriftlichen Einheit gefaßt, deren geschlossene Wucht erst beim Vortrag das intellektuelle Vergnügen am Bauplan so richtig übersteigt. So ist es im Nachhinein gesehen richtig und gut, daß Jandl erst mit dem leibhaftigen Vortrag seiner Gedichte – und dessen technischer Speicherung – der wurde, den sein Name heute unabweisbar evoziert: ein Textdichter als Sprechereignis, oder, mit einem bei Thomas Kling geklauten Oxymoron: ein ,Sprech-steller‘. Den Namen Jandl hören heißt seitdem Jandl hören: eine Stimme, eine akustische Halluzination. Ein Hörereignis aber auch als Erkenntnismittel, darunter sollte man den Genuß nicht ansiedeln. Und Thomas Kling tut es am wenigsten. Denn auch er will wissen, bevor er es wissen will. Soll heißen: Lust macht nicht dumm, und Erkenntnis Lust, was man denn auch zusammenschreiben kann (Erkenntnislust).
Zum zweiten mal also: Wir loben einen Dichter, der seine Herkünfte pflegt, statt sie zu demolieren, der seine Väter evoziert, im oralen Sinne des Wortes, statt sie zu exorzieren, der sie heraushört aus und hineinhört in die Literaturgeschichte, und zwar mit Liebe, deren Erklärung praktischerweise die Form der Poesie hat. Deshalb – und jetzt verstehen Sie vielleicht, was anfangs gemeint war, stimmt hier und heute im Großen und Ganzen fast alles.
Wenn ich nebenbei die kleine Einschränkung ,im Großen und Ganzen‘ erläutern darf: Es wäre natürlich wunderbar, wenn Ernst Jandl, der wahrlich, weil stimmlich leib-haftige Dichter, die heutige Traditionsstimmigkeit, die Feier der Filiation, in die er, mehr streng väterlich als versöhnlich gestellt ist, mit seiner Anwesenheit hätte verstärken können. Zumal es gleichsam in Erweiterung der hier beschworenen Stimmigkeit nun dazu kommen wird, daß Thomas Kling in einigen Tagen wiederum das Lob spricht für Friederike Mayröcker, deren literales Gewicht zeit Dichterlebens die lakonisch-strenge Leichtigkeit der Jandl-Verse auszutarieren vermochte in einem für beide zwingend notwendigen Arbeitsprozess.
Doch bekanntlich erzeugen die sogenannten unterhaltsamen unter den technischen Medien eine Gegenwärtigkeit der besonderen Art, zu der die Buch-Schrift nicht in der Lage ist, weshalb sie manche für unterlegen halten, was wir hier natürlich nicht mitmachen, aber – und ich rede jetzt von Tonträgern in Gestalt von Bandkassetten und Compact-Discs wir können doch zur fortgesetzten Stimmigkeit des Abends, der auch ein Abend der Jandl-Geschichte ist, uns wünschen, daß der Ausgabe der gesammelten schriftlichen Werke, die von Kaus Siblewski eingerichtet wurde, eine ebenso umfangreiche der Tonträger folgt. Schließlich war Jandl der erste Dichter der Geschichte, der ein großes Publikum traf, indem er mit der Schallplatte das Buch übertraf. (Ich sage nur leise Laut und Luise.) Ein Superlativ übrigens, der sich in naher Medienzukunft erst recht plausibel machen wird. – Die Gegenwart der Stimme als Editionstat. Aber vielleicht wird ja bereits an solcher Edition gearbeitet, zumindest geplant. Die Rundfunkarchive warten sowieso auf Nutzung, und Jandl zu senden kommt bis heute immer gut, selbst bei politischen Programmdirektoren .
Damit komme ich nach den kurzen genealogischen Überlegungen zur Stimmigkeit lobreicher Abendveranstaltungen im Namen Klings und Jandls noch zu einem strukturellen Merkmal der Poesie beider. Der Rundfunk hat mich darauf gebracht, genauer: der Hörfunk. Nichts geht mehr ohne O-Ton, und das wird im österreichischen Rundfunk nicht anders sein als im deutschen. Wurde noch bis in die achziger Jahre Vieles, vor allem Kulturelles vom Blatt gelesen, gemäß den schriftlichen Instituten Essay und Kritik, wird heute so gut wie alles verfeaturet, d.h. mit O-Ton angereichert. Kein Buch, bitte, wenn möglich, ohne die Stimme des Autors. Die Begründung liegt auf der Hand, bzw. im Wort: weil wir es im O mit dem Original zu tun haben, dem Echten, einem Stück Welt ohne den Filter der Schriftlichkeit und also der Linearität, Selektivität und a fortiori der Reflexivität. Etwas soll stimmen im Sinne von wahr gesagt sein. Von der akustischen Frequenz, der real im Raum übertragenen, wird unbewußt auf urheberschaftliche Wahrheit im Symbolischen geschlossen. Ein Mißverständnis, über das uns kaum etwas besser aufklären kann als eine Dichtung, die sich häufig des alltäglich neu verknautschten O-Ton bedient, dessen also, was uns so im Allgemeinen und Speziellen ständig von den ,pidginlippen‘ quillt: von Fach- und Szenesprachen bis Ausländerdeutsch.
O Gott, O Mensch, O-Ton – das wäre in unserer Perspektive die kürzeste Beschreibung des Säkularisierungsprozesses einschließlich Individualisierung, denn was (ein Hinweis für schlaflose Innenminister) ist individueller als die Stimme? Und zudem wäre es eine Literaturgeschichte in nuce, würde man noch das ,O je‘, das auf den Tod Gottes folgte, am Anfang der modernen Dichtung hörbar machen. Kurzum: am O-Ton und im O-Ton und um den O-Ton herum hat eine Dichtung ihre Freude, die das Echte aufgreift, um es anzugreifen, die sprechende Seelen in seliges Sprechen verwandelt und die ,him hanflang‘ statt Gottes Atem vor allem Buchstaben sieht: die Dichtung Jandls nämlich und die Thomas Klings.
Doch die Sache hat, wie jede Münze, zwei Seiten. Was beim häufigen lautschriftlichen Hineinholen von Stimmen in den Kling-Text geschieht und sich beim Vortrag dann so wuchtig durchsetzt, ist nichts weniger als Ursprungszauber in Alltagsnähe, sondern im genauen Gegenteil ein topologisches Abtasten der ergehenden Reden und deren Nutzung als quasiorales Emblem: ,Hasse ma ne Maak‘. Das ist eine soziale Münze, ein stabiles sprachliches Tauschmittel, hochallgemein, paradigmatisch, ein starres Schema, das nur im Gedichtkontext zu verflüssigen ist. ,Is nix‘ mit sprachlicher Authentizität, sozusagen. Im Gegenteil. Indem sich das Gedicht über solche Sprech-Fundstücke beugt, nimmt es deren unterstellte situative Kraft und verwandelt sie in eine der Reflexion zugängliche Form.
Doch – und hier gibt es ein Anderseits: es bleibt ein Rest von Magie. Wie bei der Tequila-Flasche auf einem Voodoo-Altar. Sie ist schon dem Heiligen zugeordnet, doch ein Rest von Rausch und Erbrechen bleibt. Eine Aufrauhung der transzendenten Bewegung durchs kernige Zitat. Insofern ist der O-Ton als Anleihe beim Außerlitarischen eben immer auch ein Stück ,Transzendenz nach unten‘ wenn diese Inversion erlaubt ist. Der sogenannte O-Ton im Gedicht ist kein Input des Realen, er ist eine abstrahierende Schematisierung vorgefundener Rede. Aber er bewirkt auf der anderen Seite eine Störung der erhebenden Bewegung, er ist ein Antidot gegen die der Poesie eigenen Erhabenheitsdrift. Und deshalb steht der O-Ton mit nichts so in Spannung wie einem anderen großen O in der Dichtungstradition: dem expressiven O-Mensch-Pathos.
Einem gar nicht vom Sinn verunzierten O-Ton literarisch zu begegnen, ist allerdings eine Seltenheit. Jandl war es Mitte der 80er Jahre in einer noblen Düsseldorfer Einkaufspassage vergönnt. Eben dort, und zwar auf einem Mode-Laufsteg, über zwei goldene Aufzüge gelegt, den auch Thomas Kling schon in fremde Schwingung versetzt hatte, trug er seine vokalfreie lautpoetische Materialschlacht „schtzngrmm“ vor. Als er dabei so richtig ins Rollen des r(rrrrrrrrr) geraten war, antwortete ein aufgeschreckter Schäferhunde mit heftigen Bellen. „Ja“, rief Jandl daraufhin, „ja, ja, ja, er hat mich verstanden“.
Eine Hermeneutik der paradoxen Art. Wo der Sinn sich bricht, tritt das Material hervor. Stimme, Buchstabe, historischer Sinn: in dieser Entstehungszone der Bedeutsamkeit arbeitet auch Thomas Kling. Blitzschnell, sozusagen ,wespenlike‘ sind seine Vorstöße vom Gegenwärtigen ins Historische, an den Rand der Bedeutung, weiter – und vor allem: zurück; in die hochaufgeladenen Ordnungen des Gedichtes wo alles stimmt, in Stimmung gerät.
Ein Kapitel in Klings Gedichtband brennstabm trägt die Überschrift „stifterfiguren, charts-gräber“ und versammelt kürzeste Künstler- und Poetenporträts. Ernst Jandl gehört hierhin. Nicht weil er stiftet, was bleibt, sondern weil er weiter arbeitet, zum Beispiel in Thomas Kling. Weshalb wir diesen selbst von jeder Stiftungsaufgabe entlasten und nur betonen wollen, wie sehr seine hochauflösende Spracharbeit Verbindungen und Verbindlichkeit erzeugt, und also Tradition. Wie man jetzt hören (respektive lesen) kann ……..
Hubert Winkels, manuskripte, Heft 154, 2001
Zinken schneiden – oder: Thomas Kling
Der Thesaurus im Computerprogramm Word kennt den Namen Kling nicht. Statt dessen bietet er als Alternative die Worte: Klinge, Klingt, Klang, King an. Vermutlich wäre Thomas Kling mit diesem Angebot nicht ganz unzufrieden. – Die genealogische Tiefenschichtung von Poesie, der Thomas Kling in seinem Vortrag innerhalb der Reihe „Merkmal-Gedichte des 20. Jahrhunderts“ nachgegangen war (abgedruckt im Essayband Botenstoffe unter dem Titel „Spracharbeit, Botenstoffe. Berliner Vortrag über das 17. Jahrhundert“), läßt sich gleichermaßen am Werk von Thomas Kling selbst und nicht zuletzt an seinem Namen, nomen est omen, nachvollziehen. „Wenn der Mensch etwas benennt“, schreibt Sartre, „so nicht nur, um begrifflich zu fixieren, was stets Gefahr läuft, in Verzückung auszuarten; im Benennen erfüllt er seine Aufgabe als Mensch“.
Im Telegrammstil könnte man das, was die fünf Buchstaben des Nachnamens beherbergen, etwa folgendermaßen kurz beschreiben: Im Wort klinge wird die im Ohr vibrierende Möglichkeitsform eines wohlgestalteten Lauts hörbar; Klinge beschreibt aber auch das metallische Instrument, welches scharf trennt. Jede Dichtung klingt; die von Thomas Kling in seinen Sprachinstallationen vorgetragene auf eine besondere Art und Weise, sie bleibt mit ihrem Klang, ihrem Sound nachdrücklich im Ohr haften. Und als King, als anerkannter Würdenträger unter den mit dem Wort Arbeitenden bezeichnet zu werden, ja sogar von einem aus gefühls- und sprachneutralen Chips zusammengesetzten Apparat in der Meisterschaft seiner Dichtung wahrgenommen – wem schmeichelte es nicht?
Doch aus dem Echoraum des sprechenden Dichternamens klingt es bei weitem nachhaltiger, als soeben nur in einer groben Hörprobe umrissen werden konnte. Peter Waterhouse charakterisiert seinen Dichterkollegen in offensichtlicher Abstimmung mit dem Word-Thesaurus:
Mit Klingen (sogenannten Thomasklingen) die ursprüngliche Sprache freikratzen? Was ist die ursprüngliche Sprache? Schönheit, Wonne, Verzückung? Mit der Klinge das Klingende finden? Klinge: „der name musz aufgekommen sein von der schwertklinge, denn er ist gegeben von dem singenden klange des auf den helm geschlagenen schwertes“.
In seinem Essayband Itinerar spricht Thomas Kling den Zusammenhang des rotwelschen Wortes Zinken mit dem lateinischen Wort signum, Zeichen, an. Beides sind materiable Grundstöcke unterschiedlicher Sprachen. In der Gaunersprache gibt man, indem ein Zinken gesteckt wird, einen Wink oder ein Zeichen. Mit scharfen Gegenständen wie eben Messerkling(!)en schnitt oder kerbten die Welschen (was nichts weiter als die Unverständlichen heißt) ihre Botschaften in den entsprechenden Untergrund. Zinken steht für Übertragungselement, Buchstabe oder moderne Keilschrift. Feine etymologische Fäden spannen sich von hier bis zum Sorbischen, wo das Wort zynk so etwas wie Klang, Laut oder Ton bedeutet.
Was macht ein Dichter wie Thomas Kling denn anderes als Zeichen einzuritzen, Signale ertönen zu lassen, Botschaften zu überbringen? Wenn man so will, in einer Geheimsprache: der Poesie. Man lese geheim, aber hier eher im Sinn von verborgen oder: nicht unmittelbar zu entdecken. Die Zeichen und Buchstaben der Poesie sind wie die Zinken überall deutlich sichtbar, aber nur jene, die sie ebenso aufmerksam wahrnehmen wie die Dichter, können sie als Botschaft erkennen. Allerdings bestehen Unterschiede zwischen dem Gebrauch beider Sprachen: Mit Hilfe der Poesie wird keinem etwas geklaut und niemand wird durch sogenannte Zinker verraten, sondern im Gegenteil, die Poesie dient der allgemeinen Anreicherung. Deshalb unterscheidet sich die dichterische Sprache ein wenig von der Alltagspoesie der Gauner, zum Überleben dienen beide allemal.
Es gibt, sprachhistorisch betrachtet, noch unzählige andere verborgene Kanäle zum Nachnamen des Dichters und zu seinem besonderen Umgang mit Sprache. Man kann soweit man mag dafür in der Zeit zurückgehen. Das Altgriechische hält verblüffend eindeutige Hinweise für den Zusammenhang teilender Sprach-Klingen mit dem poetischen Ursprung der Welt parat. Das Wort τομοζ ( [tomos] meint schneidend, scharf, ihm verwandt ist τομη [tomäh], welches Schneiden, Sägen, Schnitt, Hieb, Stumpf oder Ende bedeutet; α τομοζ [a tomos] heißt neben nicht gemäht vor allem aber: unteilbar. Aus dieser Ahnenreihe stammt der in der modernen Physik gebräuchliche Begriff des Atoms, da man im Atom zunächst das kleinste, nicht weiter teilbare Weltelement vermutete. Auch der Buchstabe ist eine kleinste, nicht mehr teilbare Einheit, die der Sprache. Beide, Atom und Buchstabe, hängen deutungsgeschichtlich unmittelbar zusammen.
Den Buchstaben bezeichneten im Altgriechischen zwei Worte, die bereits von ihrer Anwendung her die enorme geistige wie materielle Wirkung von Sprache und Schrift anschaulich machen. Das erste Wort, το γραμμα [to gramma], stand nicht nur für Buchstabe, sondern darüber hinaus für ein ganzes Universum an Möglichkeiten: Alphabet, Anfangsstadium, Grundkenntnisse, Grundstoff, Element, Prinzip und sogar Elementargeister und Himmelskörper. Im zweiten Wort, το οτοιχειον [to stoicheion], fächert sich das Ganze in eine etwas andere Richtung auf, neben Buchstabe bedeutete dieses Wort auch Alphabet, Schreiben und Lesen, Literatur, Wissenschaft, Schriftstück, Buch, Brief, Urkunde, Dokument, Verzeichnis, Inschrift, Zeichnung, ja selbst Gemälde.
Der Schritt vom Buchstaben zum Atom war ein geringer. Lukrez habe stoicheion durch elementum übersetzt, aber den Begriff des Atoms damit gemeint, schreibt der Philosoph Hans Blumenberg in Die Lesbarkeit der Welt. Diese schräge Anlandung des Übersetzers wird begreiflich, da man von Blumenberg weiterhin erfährt, daß stoicheion ursprünglich den Laut und den Buchstaben als unselbständige Teile eines Zusammenhangs, als Glieder einer Reihe. stoichos, bezeichnete. „Es sei mehr als eine geistreiche Metapher, mit dem Ausdruck für Buchstaben auch die Atome zu benennen.“ Im Begriff des Atoms führten die griechischen Philosophen die Wirklichkeit auf wenige letzte Einheiten zurück, es sei, so Blumenberg, ein echtes Alphabetverfahren, ein richtige Buchstabieren der Welt.
(Daß übrigens ein so ausführlich bezeugtes Interesse an etymologischen Deutungen schwarz auf weiß hier zu lesen ist, verdankt die Autorin dieses Textes nicht zuletzt Dichtern wie Thomas Kling oder Peter Waterhouse, die immer wieder auf diese sprechenden Zeichen, Zinken, Geheimbotschaften verweisen, deren Entschlüsselung zu einem anregenden Sprach- und Denkspiel von besonderer Anziehungskraft wird und die Sinne für jegliche Art von Ge- wie auch Mißbrauch der Sprache enorm schärft.)
Auf das Buchstabieren der Welt folgt logischerweise das Zusammensetzen der Buchstaben zu Worten, zu Namen. Der Dichter benennt, gibt belebten und unbelebten Dingen den ihnen jeweils zugehörigen Eigennamen, er bringt das Wesen ihres Seins an die Oberfläche, ermutigt wie der französische Dichter Francis Ponge die unbelebten und nicht zum Laut fähigen Dinge zum Vortragen ihrer eigenen Angelegenheit.
In der „Einführung in den Kieselstein“ schreibt Ponge, daß jemand zum Dichter werde, um die anderen überraschenden Stimmen des Zufalls zu übertönen. Kling beschreibt das auf seine Art so:
Ich wende meine Aufmerksamkeit schon einem geographischen Geschichtsraum zu, wo es für mich dann egal ist, ob es das Rheinland ist als deutsches Thema, was aber im ,mittel rhein‘ ja auch schon wieder in einem kulturhistorischen Rundumschlag gezeigt wird, was das für ein melting pot gewesen ist. Und genauso interessiert mich jede andere Land- oder Stadtschaft… Eben als eine riesen-summende-Insektengesellschaft, wo man die einzelnen Stimmen dann herauspräparieren muß.
Für Thomas Kling verwandelt sich die Land-und Stadtschaft vom optischen Geländebild zum hörbaren Mund, zur Mundschaft, zum „Manhattan Mundraum“. Klings Produktionsprinzip erläutert Waterhouse:
Mund und Stadt, Mund und mundus sind hier nicht voneinander abgegrenzt, sie sind durchlässig… Der Sprechende selbst ist Teil der Naturgeschichte der Poesie… Das vor dem Mund Liegende ist Teil des Munds, der große Mundraum ist unabgegrenzt vom Mund; Welt und Sprache sind unabgegrenzt.
Mit weit aufgespannten Ohren horcht Kling in die Landschafts- und Stadtschluchten, in die Erdspalten, aus denen es unablässig brodelt, dampft, köchelt und zischt. Er hört die heißen Buchstaben daraus aufsteigen, ins Wort stürzen und in der Poesie erkalten. „wachsluft, diesiger, untätiger mund. das ist, aufgerauht, / in lederner ruhe, der ätna.“, die Lava eine „walze // letzte sprachwalze in der, kurz über der brandung, sich die / stimme evakuiert, der mundkrater: wachsluft; wölkchen, das steht.“, so beschreibt Kling im Gedichtband morsch den heißen, brüchigen, bereits sehr „morsch“en Boden unter den Füßen des antiken Philosophen Empedokles, der dem Sog dieser eruptiven Geheimsprache nicht wiederstehen konnte und sich ihrem tieferen Ursprung zu nähern versucht. Er geht den umgekehrten Weg wie Kling: Empedokles setzt sich nicht an den Schreibtisch, sondern stürzt sich in den weit geöffneten Kratermund und verschwindet darin. Allerdings auch nur, um letztenendes doch in einem Buch, nämlich Klings Gedichtband zu landen.
Die Welt interpretiere sich im Gedicht, ergänzte vor einigen Tagen Waterhouse in einem Fernsehporträt, zufällig eingeschaltet. Sie ändere sich durch Worte; die Worte seien aber nicht jene des Dichters. Denn nicht er spräche Worte über die Welt, sondern die Welt spricht eigentlich über sich selbst und verändere sich fortwährend dabei. So sähe auch der Dichter die Sprache: als ein stetes Werden und Zurückfallen.
Mit welch ungeheurem Fassungsvermögen Buchstaben die Welt speichern, übergibt man ihnen genug an Material, an heißem Stoff, macht Kling deutlich, wenn er Nietzsches Entzücken beim Lesen von Horaz zitiert:
Dies Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft ausströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum an Energie der Zeichen.
Für den gut einhundert Jahre später lebenden Kling birgt dieser Satz noch immer die wesentliche Charakteristik der Moderne. Kling vollendet den Bogen zu Mallarmé, der grundsätzlich alles Existierende für poesieverwendungsfähig hält. Doch Poesie zu entdecken, heißt Schwerstarbeit. Weil sie das Allgegenwärtigste, das Alldurchdringendste sei, wie der Schlegel-Bruder August Wilhelm in seinen Betrachtungen zur Poesie schrieb. Deshalb, weil die Luft, in welcher wir atmen und leben, auch nicht insbesondere von uns wahrgenommen würde.
Daß das Gehör – ein Sinnesorgan, welches im Zeitalter der Bilderflut zunehmend in den Hintergrund gespült wird – für den „Ursprung der Sprache“ zuständig ist, erklärte bereits Johann Gottfried Herder:
Jeder Sinn wird sprachfähig… So wird das, was man sieht, so wird, was man fühlt, auch tönbar. Der Sinn zur Sprache ist unser Mittel- und Vereinigungssinn geworden; wir sind Sprachgeschöpfe.
Im Jahr 1770 hatte die Berliner Akademie eine schon längst fällige Preisaufgabe ausgeschrieben: En supposant les hommes abandonnés à leurs faculteés, sont-ils en état d’inventer le langage et par quels moyens parviendront ils d’eux-mêmes à cette invention? (Haben die Menschen, ihren Naturfähigkeiten überlassen, sich selbst Sprache erfinden können? Auf welchem Wege hat der Mensch sich am füglichsten Sprache erfinden können und müssen?) Abgabetermin sollte der erste Tag des neuen Jahres 1771 sein. Johann Gottfried Herder schrieb an seinen Verleger, das sei eine vortreffliche, große und wahrhaftig philosophische Frage, die so recht für ihn gegeben zu sein scheine – und daraufhin in nur wenigen Wochen die Schrift Über den Ursprung der Sprache.
Herders Leistung wird noch verständlicher, wenn man weiß, daß ihn damals ein Augenleiden hinderte, sich in Bibliotheken ausgiebig umzutun und Recherchen anzufertigen. Er mußte, um die Schrift zu verfassen, mit einigen wenigen verfügbaren Reisebeschreibungen auskommen. Und dennoch war dieses Handicap, wie sich im Nachhinein herausstellte, für das entstandene Werk kein Verlust. Da Herder nicht durch Lesen abgelenkt wurde, konnte er vermutlich besser in sein und der Welt Inneres horchen.
Das Gehör ist der mittlere Sinn in Betracht der Zeit in der es wirkt, und also Sinn der Sprache. Das Gefühl wirft uns alles auf einmal in uns hin: es regt unsere Saiten stark, aber kurz und springend; das Gesicht stellt uns alles auf einmal vor, und schreckt also den Lehrling durch die unermeßliche Tafel des Nebeneinander ab. Durchs Gehör sehet! wie uns die Lehrmeisterin der Sprache schonet! Sie zählt uns nur einen Ton nach dem anderen in die Seele, gibt und ermüdet nie, gibt und hat immer mehr zu geben – sie übet also das ganze Kunststück der Methode: sie lehret progressiv! Wer könnte da nicht Sprache fassen? Sich Sprache erfinden?
Das Gehör ist der beweglichste und der flüchtigste Sinn von allen, gerade deshalb verlangt er, etwas festzuhalten, in eine unbewegliche, bleibende Form zu geben. Vielleicht liegt hier auch der eigentliche Ursprung der Geschichte als eine ebenso aus einem Konservierungsbedürfnis heraus entstandene Geste.
Das Gesicht ist für den Spracherfinder unaussprechlich; allein was brauchts so gleich, ausgesprochen zu werden? Die Gegenstände bleiben! sie lassen sich durch Winke zeigen! Die Gegenstände des Gehörs aber sind mit Bewegung verbunden: sie streichen vorbei; eben dadurch aber tönen sie auch. Sie werden aussprechlich, weil sie ausgesprochen werden müssen, und dadurch, daß sie ausgesprochen werden müssen, durch ihre Bewegung, werden sie aussprechlich – welche Fähigkeit zur Sprache!
In seinem Gedicht „-paßbild“ bezieht sich Thomas Kling auf das Bild „the copyist“ von Sigmar Polke, es zeigt einen mittelalterlichen Mönch, der ein Buch verfaßt. Jedoch arbeitet der Mann nicht wie damals üblich im Scriptorium des Klosters, sondern Polke setzte den Mönch in die freie Natur hinaus, in eine Wiese. „so zückt die nachtigall das blei, die schrift“, heißt es in einem anderen Gedicht, was aber nicht minder treffend diese Situation umreißt.
„Diese schreibenden, am Schreibpult dargestellten Apostel der karolingischen Kunst recken ja oft ihr Ohr zum Himmel“, zum Gedicht, „und oben sind dann die Erzengel und die diktieren den Text, sie folgen dem Diktat… Man darf nicht vergessen, daß in der Zeit der St. Gallener Mönche oder Ottfrieds oder der Reichenauer Mönche die Schrift dem Ohr folgt, die Schrift absolut dem Klangprimat unterliegt. Das Ohr ist also wirklich ein so wichtiges Organ, weil der Schreiber in dem Moment, wo der Text diktiert wird, sich vergegenwärtigen muß, wie er den Körper dieses Wortes aufs Papier bringt. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Das heute oft behauptete Primat der Bilder hat damals noch nicht bestanden. Und es ist auch die Frage, ob es heute stattfindet.“
Wie Ponge, der den Dingen zu ihrer Sprache verhilft, sieht sich auch Kling als Übersetzer und damit Vermittler von bereits Vorgefundenem. Entgegen landläufiger Meinungen ist der Dichter niemals ein Erfinder, Phantast oder Fabulierer, sondern er bleibt allein von der Natur der Dinge her immer ein Realist. Für andere manchmal unverständlich werden läßt ihn nur, daß er die mikrofeinen Verästelungen sämtlicher Abläufe, ihre zeitlichen Verschiebungen, räumlichen Ver- und Umverteilungen sehr genau und adäquat – und nur überschaubar für den, der die inneren Zusammenhänge mindestens ebenso kennt oder wenigstens ahnt – am eigenen (Sprach-)Leib mitvollzieht.
Dichtung ist die fixierte Spur dieser Bewegungen, die oszillografischen Ausschläge der Schreibhand, die getreulichen Notate, die Archivierung der Weltbewegung am einzelnen Fall.
… wie Welt das Ohr angreift, wie die Welt als Ungestaltes auf das Ohr des Schreibenden eintrifft, einprasselt, durchaus in einem aggressiven Angriff. In dem Moment ist der Übersetzungsprozeß bereits voll im Gange.
Ein zweiter Übersetzungsprozeß folgt notwendigerweise hernach im Leser.
Selbstverständlich gewann damals Herder den von der Akademie ausgeschriebenen Preis. Bevor Herder Ende Dezember die Reinschrift an die Akademie abschickte, hatte sie Heft für Heft auch rasch noch sein damaliger gelehriger Schüler Goethe studiert.
Aus all dem bisher Gesagten heraus ist es nicht weiter verwunderlich, daß Thomas Kling auch in der Wiedergabe der Gedichte besonderen Wert auf die vernehmliche, akustische Variante legt.
Mir ging es von Beginn an um das Hörbarmachen der Texte, also in der Performance, in der actio der Sprache. Die ja erstmal überhaupt im Gedicht selber stattfinden muß, sonst ist ja dem Text nichts abzugewinnen.
Außerdem, behauptet Kling, müsse der Dichter für seine Leser immer auch anfaßbar sein, sich ganz und gar verausgaben „und nicht irgendwie so ein Howard-Hughes-Dasein wie ein Botho Strauß führen“. Das wäre eine Sache, die „absolut von doofster Inhumanität ist“.
Als der Begriff der Performance so recht in Mode kam, verabschiedete sich Kling allerdings auch gleich wieder davon, seine Auftritte nannte er ab 1985 Sprachinstallationen. Dies geschah nicht nur, um sich deutlich vom „Label Performance“ zu distanzieren:
Ein Seitenblick auf die Geschichte des Wortes performance… zeigt, daß in der älteren Bedeutungsschicht nicht nur ausgesprochen köperbezogen-handwerkbeherrschend Durchführung gemeint ist, Bewerkstellung, Vollziehung, Leistung, weiterhin eine Handlung, Unternehmung, That. Arbeit von Entscheidern: Augenöffnung, Mundstellern… Der Performer als Sprachinstallateur ist Konzeptkünstler.
Daß Dichtung Tat ist, wußte übrigens niemand besser als der Minnesänger, der zum Fenster seiner Angebeteten eilte.
Installation, das bedeutet Fest-Stellung, Einbau, Fixierung im Raum. Durch die tatsächlich anwesende Stimme des Dichters, durch das akustische Erlebnis wird das Buch zum räumlichen Gebilde. Die Stimme fächert die auf die papiernen Seiten flachgelegte Sprache wieder auf, faltet sie auseinander und schwingt sie zurück in ihre ursprünglichen Dimensionen. Sie weitet die sprachlichen Angriffsflächen direkt auf den Körper aus und bringt die Worte nicht nur dem Seh-, sondern auch dem Gleichgewichts-, dem Tast- und dem Hörsinn zurück. Damit kann sich die Sprache neue Wirkungsfelder erschließen oder genauer gesagt, zurückerobern.
Hans-Jürgen Balmes nannte in einem Interview mit Thomas Kling das aus dem Gedichtzyklus über den ersten Weltkrieg stammende Wort „Kehlgräben“ eine „Rückführung der Sprache auf ihr nacktes Körperinstrument“. Das poetische Pixel Kehlgraben setzt exakt am Ursprungsorgan der Stimme an, genau dorthin zieht es Körper, Krieg und Sprache zusammen und verdeutlicht die eigentliche Ausschließlichkeit dessen, was es gleichzeitig in einem einzigen, verlautbaren, absurden Moment bindet.
In heutiger Zeit ist jeder gut beraten, der sich auf seine eigenen fünf Sinne verläßt, bevor die Werbung die empfänglichen Organe in Besitz nimmt und dermaßen zupflastert, daß für authentischen Eigen-Sinn kaum noch Platz bleibt.
Daß die menschliche Sprache mehr als nur Töne wiederzugeben vermag, daß sie alle Saiten in demjenigen, der ihre Resonanzwellen aufnimmt, schwingen läßt, weiß man. Daß dafür aber der Grund im Menschen selbst liegt, beweist Herder:
Wie hat der Mensch, seinen Kräften überlassen, sich auch erfinden können? Wie hängt Gesicht und Gehör, Farbe und Wort, Duft und Ton zusammen? Nicht unter sich in den Gegenständen; aber was sind denn diese Eigenschaften in den Gegenständen? Sie sind bloß sinnliche Empfindungen in uns, und als solche fließen sie nicht alle in Eins? Wir sind Ein denkendes sensorium commune, nur von verschiedenen Seiten berührt – da liegt die Erklärung.
Umso schmerzlicher müßte es in den Ohren klingen, daß dieses In-Eins-Sein durch die teilweise einseitige Ausrichtung der neuen Medien inzwischen stark korrodiert und der sprachliche Gleichgewichtssinn Stör- und Zerrtönen ausgeliefert ist. Die Poesie Thomas Klings wirkt durch ihre bloße Anwesenheit dem entgegen. Sie schärft die Aufmerksamkeit ihrer Leser für sprachliche Zerfallserscheinungen, versetzt die Zuhörer in Alarmbereitschaft. Der Satz Sartres, „da sprechen Menschsein ist, spricht er, um sprechend dem Humanen zu dienen“, gilt für Dichter wie für Leser gleichermaßen.
Schon die Antike kannte die Lötstelle zwischen Gehör und Dichtkunst. Mit seiner betörenden Stimme befreite Orpheus seine Gattin Eurydike aus der Unterwelt. Des Sängers Augen, die sich umdrehen und sehen wollen, zerstören allerdings, was zuvor seine Stimme erreichte. Orpheus wird als der Erfinder der Lyra überliefert und in einigen Versionen gilt er sogar als der Urheber der Schrift, bei beidem spielen Klang und Rhythmus eine Rolle. Doch was genau sang Orpheus, mit welchen Worten konnte er die dunklen Mächte des Schattenreichs betören?
Kling hat darauf eine genial einfache Antwort, er zitiert T.S. Eliot:
Die Musik im Vers… muß eine Musik sein, die in der gewöhnlichen Redeweise ihrer Zeit latent vorhanden ist.
und spielt damit auf Gebrauch von Umgangssprachen, von Alltagsstimmen, von Slang in der Dichtkunst an.
Slang war immer mein Wort für Umgangssprache, in der die Hebräischreste, Jiddischreste, die Schattenreste leben.
Kling weiß, daß die Tradition, aus der man lebt und sich speist, nicht nur die Ergänzung zum Bestehenden bildet, sondern daß sie keinesfalls „außen vorgelassen werden darf, weil sonst gar nichts dastehen könnte“, er fordert: „sing neues – das alte – dem hörer ins ohr“.
Die Sprache besitzt apriori ein Gedächtnisvermögen, und das mit einer erstaunlichen Speicherkapazität. Orpheus rief solange seine Erinnerungen nach Eurydike an, ließ seine Stimme immer wieder um die Verlorene kreisen, bis sie aus dem Dunkel des Vergessens als lebendige Erscheinung auftauchte. Hätte Orpheus das aus dem Gedächtnis heraufgeholte Bild im Klang seiner Stimme belassen, hätte er Eurydike wohl nie ganz verloren. Aber da er sie sehen, anfassen, haben wollte, zerstörte er das feine Gespinst des erinnerten Bildes, und es verschwand auf Nimmerwiedersehn im Bewußtsein, daß Eurydike endgültig tot ist.
Phoinikéia grammata bezeichnete man die Buchstaben des griechischen Alphabets, die Phönizischen Buchstaben, weil sie der Überlieferung nach aus Phönizien, dem Ursprungsort aller westlicher Buchstabenschriften, geliehen waren. Es gibt aber noch eine andere Deutung, darin wird von der athenischen Prinzessin Phoinike, der Palmenprinzessin, erzählt. Sie starb jung, daraufhin benannte ihr Vater voller Trauer die Buchstaben des Alphabets nach seiner Tochter: Phoinikéia. Solange ein Mensch von Stund an diese Buchstaben aussprach, sollte der fremde Mund an den Namen und damit an die Prinzessin erinnern. So konnte der Vater die verlorene Tochter am Leben erhalten, wenn auch nur in der Erinnerung.
Die Geschichte einer Trauer ohne Ende und eines geschickten Kults, der sich des Mediums von Schrift und Stimme bedient. Der Wortstamm aus Phoinikéia verweist etymologisch neben dem Vogel Phönix auch auf die purpurrote Farbe, mit der die ersten Grabinschriften gezeichnet wurden, sowie auf die Dattelpalme, Symbol des Sieges und der Langlebigkeit. Grabinschriften zählen zu den ältesten überlieferten Zeugnissen menschlichen Schrifttums, ihre Historie liegt ähnlich jener Sage: sobald ein Lebender den Namen eines Verstorbenen auf den Marmorsteinen buchstabiert, leiht er diesem seine Stimme.
Jeder Leser läßt die Toten auferstehen, holt sie zurück, indem er sie in die Sprache, in die Dauer unendlicher Wiederholung hinein konserviert. Die Sprache des Menschen ist „Merkwort des Geschlechts, Band der Familie, Werkzeug des Unterrichts, Heldengesang von den Taten der Väter, und die Stimme derselben aus ihren Gräbern“, schreibt Herder.
Das Interesse des Dichters an der Sprache geht über ihre Fähigkeit, Personen, Ereignisse oder Dinge aufzubewahren, hinaus. Thomas Kling untersucht nicht nur das Überlieferte, sondern auch den bizarren Aufbau, das eigentümliche Material und die verborgene Funktionsweise dieses enormen Gedächtnisspeichers. „Ich pflege von jeher eine Etymologiebegeisterung“, sagt Kling, „die der des 19. Jahrhunderts, als die Aufbruchstimmung in den Humanities hochschlug, in keiner Weise nachsteht. In der Ethnologie werden solche Leute als Memorizer bezeichnet: sie sind die Gedächtnisverantwortlichen unter den Clanmitgliedern. Kapazitäten der Sprachwirklichkeiten.“
An anderer Stelle seines Essaybands Itinerar schreibt er über die Klingen, die er an der Sprache ansetzt:
dieses Zerlegen, um zu rekonstruieren, ist das brennstabmhafte der Sprache, von der ich rede. Es ist eine Art Wildzerlegen, -teilen, ist die Arbeit des Zerteilens, konzentriertes Zergliederungswerk, kunstreiche Öffnung von Körpern, Ausübung des Pathologenberufs am Körper der Geschichte; Sprachkörperbetrachtung, Benutzung von Sprachkörpern ist Teil des dichterischen Prozesses – vom ,Sprachleib‘ ist schon bei Kaspar Stieler die Rede.
Mit dem Wort „Benutzen von Sprachkörpern“ setzt Thomas Kling jedoch nicht Sartre außer Kraft, der behauptet, daß Dichter Leute seien, die sich weigerten, die Sprache zu benutzen. Sartre verwendet benutzen im Sinn von: sich ihrer zu illegitim eigenen Zwecken bedienen, ausnutzen, vielleicht auch im Sinn von: aussaugen. Wird eine Sprache ihrer poetischen Kraft entleert, bleibt ein vertrockneter, abgenutzter, häßlicher Rest, bleiben Sprachmüll, Floskeln, Losungen und Phrasen zurück. So hebt Sartre mit diesem Satz die sprachmoralische Integrität eines jeden Dichters hervor, der sich weigert, die Sprachgeister allein als willfährige Hausknechte in den Dienst zu nehmen.
„Der sprechende Mensch steht jenseits der Wörter, bei dem Objekt; der Dichter steht diesseits der Wörter. Für ersteren sind die Wörter Diener, für letzteren bleiben sie in einem Zustand der Wildheit“, meint der Philosoph.
Thomas Kling spielt in seinem Zitat im Gegensatz dazu auf die Geschichtlichkeit von Sprache an und darauf, daß er als Dichter Schicht um Schicht von der Sprachoberfläche, dem Sprachkörper abträgt, um ihre Struktur und Beschaffenheit freizulegen. Spracharchäologische Arbeit halt, wie er es zu verschiedenen Anlässen immer wieder genannt hat. Er benutzt den körperlich-faßbaren Aspekt von Sprache, um hinter ihre Magie zu schauen. Der Frontalzusammenstoß der Zitate von Sartre und Kling an der Schnittstelle benutzen gibt nebenbei ein Beispiel für die Tragfähigkeit und Widerstandskraft von Worten gegenüber Kräfteherausforderungen.
„Die Kunst ist keine Sache irgendeiner zufälligen Begabung eines Menschen in seinen Fingern… Sie ist durchaus eine geistige Situation der Kultur aller Menschen“ gab 1920 der Maler und Dichter Gert H. Wollheim zu überlegen. Wollheim war Kölner Expressionist und Fatagaga-Dadaist, einer speziell im Rheinland fabrizierten Tönung des Dada, mithin also soetwas wie ein regionaler Geistesverwandter des rheinländischen Dichters Thomas Kling. Was Wollheim auf die Malerei münzte, gilt nicht minder für die Dichtung.
Jede Poesie ist stets mehr, als der einzelne Dichter darstellt oder auszusagen vermag. Sie ist, wenn ein Dichter sich zu entfalten ihr ernsthaft Raum gibt, Summe aller vorangegangener Poesien und dennoch immer wieder authentisch und einzigartig.
Die Erfindung der Sprache selbst gehöre der poetischen Anlage an, schreibt Schlegel, die Sprache sei ein „immer werdendes, sich verwandelndes, nie vollendetes Gedicht des gesamten Menschengeschlechtes“. Es ist zu vermuten, daß Mallarmé Schlegels Satz nie begegnet ist, hätte er sonst den von vornherein zum Scheitern verurteilten Versuch noch unternommen, das Buch der Bücher zu schreiben, jenes ultimative Werk des Wortes? Im Grund aber definiert genau das den Dichter: immer wieder von vorn am Sprachwerk zu beginnen, den Stein wieder hinaufzurollen.
Das Gedicht ist ein „paradoxes Instrument der Distanzüberwindung wie –gewinnung“, schreibt Thomas Kling, es „macht sich nicht vor, daß es heute, am Beginn einer weitgehend postliteralen Gesellschaft, kein Luxus ist. Vor allem aber: es besorgt weder das Geschäft des Schweigens, noch das des Verschweigens, da dies der Sprache bekanntlich unmöglich ist.“
Cornelia Jentzsch, die horen, Heft 205, 1. Quartal 2002
AN THOMAS KLING FÜR SEIN BUCH BOTENSTOFFE
in der Armbeuge die Gratifikation der Bienenstock
sage ich, vollkommen unbeweglich, Kalender vom Vorjahr
Feldhase, bin ohne Maquillage aus dem Haus, nieselt
Schmerzen, früher April. Rollstuhl im Schneeregen völlig
durchnäßt (vom Flurfenster aus) auf der Terrasse von
gegenüber habe gelobt keine Augenbrauen
1 Waterloo oder Waterhouse steht an verschlossener
Haustür kritzelt gegen die Scheibe, dezenter Leibniz
was machst du mit Caroline ist sie tot, ich hab sie 700 x
angerufen, goldenen Flußnote Fußnote, wollte immer schon
1 Riesen Buch mit vielen Fußnoten schreiben (auf rosa
Seidenwimpel oder geknittertes Seidenpapier). Bin
wieder nur (fast) VERBLÜFFUNG, Bleistift auf weißem
Hygiene Papier für den Toilettensitz, usw., trage Flieder-
stämmchen im Ärmel, kneife zu, Vierecke mit 1 sagenhaft
schwarzen Tinte, schreibt James Lee Byars an Joseph Beuys,
bin 1 Lexikonleser, sitze in NY als in sehr viel
Schweiß gebadet, dokumentiere dunkelroten Wollfaden
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(Ataxie jeden Morgen −)
REQUIEM
Einmal rief Thomas Kling mich an, als ich in Berlin lebte,
auf Zeit in einem Raum mit aufblasbarem Bett
und Telefon, zweiter Hinterhof, lebendig begraben.
Keine Ahnung, woher er die Nummer hatte. Mensch,
ich muss mit dir reden, dröhnte der Meister. Und redete.
Ich nickte, ein Kind, das magisch denkt.
Er war es leibhaftig, ich kante die Stimme –
ich hatte ihn einmal lesend erlebt: Er saß beim Buchhändler
verdeckt von einem Stapel Wälzer am Verkaufstisch
und skandierte mit Verve seine Verse.
Immer wieder drehte er die Augen auf Weiß.
Nach einer Stunde fuhr er hoch: Alles Ärsche, zischte er,
die verstehen mich nicht. Und hatte Recht.
Ich kam nicht dazu, irgendetwas zu sagen
oder zu fragen, wie es ihm geht, wo er ist. Kling:
Ich beobachte, was du so machst. Dann legte er auf.
So schweigt er, wie er spricht mit Menschenstimme.
Was hatte er gesagt? Nimm deine Zunge und geh.
Hendrik Rost
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest Oh Nacht [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


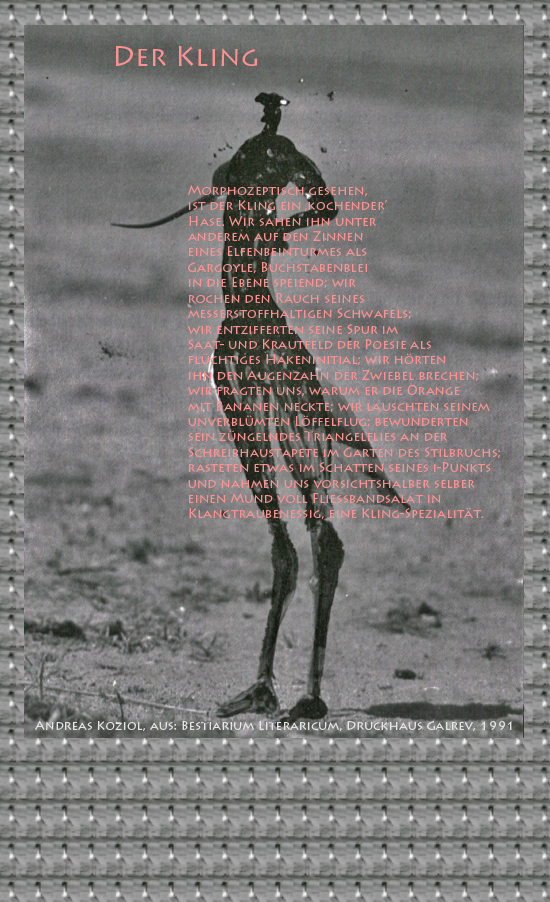












Schreibe einen Kommentar