Thomas Kling: Gesammelte Gedichte
JAGDSTÜCK
wä-
hrnd di jagdhunde
über den himmel eilen,
vorübereiferndes stern-
bild; di lefzn schaum-
gelb was
aaaaaaafür geschwindigkeitn
in der fremde. kaldaunen, di
blase, blut.
Editorische Notiz
Die vorliegende, zum ersten Todestag von Thomas Kling erscheinende Ausgabe Gesammelte Gedichte stellt eine erste Sicherung des zwischen 1981 und 2005 entstandenen dichterischen Werkes dar. Sie versammelt sämtliche in Einzelbänden und bibliophilen Gemeinschaftspublikationen mit der Künstlerin Ute Langanky veröffentlichten Gedichte in der von Thomas Kling als gültig angesehen Gestalt.
Dies bedarf einiger Erläuterungen: Seine erste Buchveröffentlichung, den 1977 erschienenen, fünfunddreißig Gedichte umfassenden Band der zustand vor dem untergang (Düsseldorf: Schell-Scheerenberg 1977), hat Thomas Kling lange Zeit selbst Freunden gegenüber nur unter Vorbehalt erwähnt. Dem Ansinnen einer Neuausgabe stand er immer ablehnend gegenüber. Bezeichnend auch, daß sich im – von der Stiftung Hombroich betreuten – Nachlaß kein Exemplar dieser Publikation findet. Was den Bogendruck amphate (Köln: o.V. 1983; hrsg. Von Andreas Kelletat und Bernd Rüther; = stattplan 1) betrifft, so haben neun Gedichte daraus Eingang in erprobung herzstärkender mittel gefunden. Den nicht übernommenen Text „gasberg“ hat Thomas Kling möglicherweise als Kurzprosa oder Prosagedicht betrachtet.
Die fünf gemeinsam mit Ute Langanky veröffentlichten Bände und Mappenwerke, von denen erstere Reproduktionen, letztere Originalgraphiken enthalten, nehmen eine Sonderstellung im Werk sowohl des Dichters wie der Künstlerin ein. Mit ihnen wird eine Form der langjährigen engen Zusammenarbeit von Ute Langanky und Thomas Kling dokumentiert, die in ganz unterschiedlichen Bereichen ihren Ausdruck gefunden hat: Thomas Klings Katalogbeiträge und Gedichte zu Wandarbeiten von Ute Langanky, die Umschlagabbildungen Ute Langankys auf den Schutzumschlägen von nacht. sicht. gerät. und morsch, die Ausstellung und Lesung kombinierenden Auftritte der beiden. Daß unsere Ausgabe das Ineinanderwirken von Gedicht und Bild nicht in der ursprünglichen Gestalt reproduzieren kann, ist ohne Frage ein Verlust. Der Zyklus „Mahlbezirk“ im letzten zu Lebzeiten von Thomas Kling erschienenen Buch Auswertung der Flugdaten gibt hier wenigstens ein Beispiel.
Die Abfolge in Gesammelte Gedichte entspricht den Publikationsdaten der Einzelveröffentlichungen. Zu den mitunter davon abweichenden Entstehungsdaten sei auf den Anhang verwiesen. Einige – wenige – Druckfehler wurden korrigiert, wobei auch der Sammelband erprobung herzstärkender mittel. geschmacksverstärker, brennstabm. nacht. sicht. gerät. Ausgewählte Gedichte 1981-1993 (Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994) herangezogen wurde. In Zweifelsfällen galt der Text der jeweiligen Erstausgabe.
Marcel Beyer und Christian Döring, Nachwort, Februar 2006
Inhalt
Zum ersten Todestag von Thomas Kling am 1. April 2006.
„Jeder Greis, der stirbt, heißt es in Afrika, ist eine brennende Bibliothek“, hat der Dichter Thomas Kling einmal geschrieben. Greis? Thomas Kling wurde 47 Jahre alt. Aber die Bibliothek, die brennt. Hier ist ein Bild- und Sprachspeicher gestorben, ein Historiker, ein Medienbewanderter und Menschenkenner wie nur wenige. Sein unbestechlicher Blick, sein Scharfsinn, seine Bildmächtigkeit: Fortan werden wir uns an sein Werk halten müssen, an den kompakten Präsenzbestand von knapp zwanzig Gedichtbänden, Essaysammlungen, Editionen, Künstlerbüchern, Übertragungen, und Tonträgern mit Auftrittsaufzeichnungen aus fünfundzwanzig Jahren – ein Werk, das Thomas Klings Dichterkollege Marcel Beyer und sein langjähriger Lektor Christian Döring in Gesammelte Gedichte erstmals zusammenhängend bergen.
Thomas Klings Stimme ist verstummt, aber es gibt den Echoraum seines Werkes. Und da ist wenig – lässt sich jetzt schon sagen – an europäischer Dichtung der Gegenwart, was auf derselben Regalhöhe steht.
DuMont, Ankündigung
Thomas Kling: Gesammelte Gedichte
Vor etwas mehr als einem Jahr ist Thomas Kling gestorben. Im April erschienen nun die Gesammelten Gedichte, herausgegeben von Marcel Beyer und Christian Döring. Enno Stahl sprach mit Christian Döring, der Kling seit den 80er Jahren als Lektor betreute.
Thomas Kling war einer der größten Lyriker deutscher Sprache in den 80er und 90er Jahren, das kann man bedenkenlos sagen. Und da die Eigenkanonisierungen möglicher Konkurrenten um diesen Titel, links vom Kanzler, rechts vom Kanzler, eher peinlich sind, sparen wir nicht mit dem Superlativ, sagen wir es frei heraus: Kling war der größte deutsche Dichter der letzten zwei Dekaden. Thomas Kling ist sich selbst treu geblieben, Thomas Kling hat sich nicht angepasst, Thomas Kling hat seine Lyrik konsequent weiterentwickelt – von den punkig angehauchten Versen seines Erstlings erprobung herzstärkender Mittel aus dem Jahr 1986 hin zum mythologie-kritischen und geschichtsphilosophischen Spätwerk. Seine Dichtung hat einen erstaunlichen Wandlungsprozess erfahren, ohne je ihre ureigene Diktion aufzugeben. Dennoch erscheint es ungewöhnlich, dass der Dumont-Verlag bereits zum ersten Todestag mit einer Ausgabe der Gesammelten Gedichte aufwartet. Sein langjähriger Lektor Christian Döring, Mitherausgeber des Buches, sieht das anders:
Christian Döring: Ich weiß gar nicht, ob das ungewöhnlich ist. Ich empfand das mit dem Mitherausgeber Marcel Beyer als eine Verpflichtung, eine Selbstverständlichkeit, zumal in dem jetzt erschienenen Band der gesammelten Gedichte bei diesen 950 Seiten ja nur die Gedichte zu versammeln waren, die in den erschienenen Büchern, wenn auch teilweise nur in sehr kleinen Auflagen, vorlagen. Und wir haben ja keine historisch-kritische Ausgabe veranstaltet und im Nachlass von Thomas Kling Ausschau gehalten nach Unbekannten.
Eben das ist verwunderlich. Wenn Beyer/Döring im Nachwort von einer „ersten Sicherung“ sprechen, muss man dagegen halten, dass Klings Bücher letztlich greifbar sind, wieso also ein solch eiliges Projekt, wäre es nicht doch sinnvoller gewesen, das Kling’sche Archiv mit einzubeziehen und gleich eine wirkliche Gesamtausgabe seiner Lyrik vorzulegen?
Döring: Es gibt vergriffene Bücher, gerade diese Bücher, die mit Ute Langanky zusammen entstanden sind, diese Kunstbücher, und das waren ja teilweise auch Kleinauflagen, Kleinstauflagen unter 100 Exemplaren, so dass man da dann oder der ein oder andere Gedichte lesen kann, die er von Thomas Kling noch nicht kannte, aber Sie haben grundsätzlich recht, es ging um eine Bestandsaufnahme des vorhandenen Werkes.
Für Döring erschließt sich der Sinn dieser Publikation jedoch allein schon aus der Bedeutung des Lyrikers Thomas Kling, die er als gar nicht hoch genug zu veranschlagen sieht:
Döring: Ich glaube, das liegt auf der Hand, und darüber kann es keinen Streit geben, er hat mit seinen Gedichtsprachen die junge Generation enorm beeinflusst, und jedes von ihm erschienene Gedichtbuch hat eine neue Rezeption ausgelöst, er war ein Impulsgeber im Bereich des Lyrischen.
Döring hat Thomas Kling nahezu seine gesamte Schaffenszeit lang betreut, wie gestaltete sich das Verhältnis zu diesem schwierigen Autor, der vielen Menschen, gerade auch Veranstaltern, nicht zuletzt durch lautstarke Ausbrüche bekannt gewesen ist.
Döring: Thomas Kling war ein sehr impulsiver, ein, das wissen wir, liebenswerter, geradezu zärtlicher Autor, sowohl im Umgang mit nahezu täglichen Anrufen, Telefonaten, Erkundigungen nach dem Wohlbefinden, dem Durchsprechen von Kritiken, Büchern anderer Autoren, das Sichten sozusagen der Konkurrenz, das auf der einen Seite. Nehmen wir sein Schreiben, den Schreibprozess, das Entstehen seiner Manuskripte, so war er hier ein Lyriker, mit dem man auch sehr leicht umgehen konnte, in dem Sinne, dass er aller Kritik gegenüber sehr aufgeschlossen war, sehr hellhörig war. Und er hat niemals um ein Gedicht gestritten, wenn ich der Meinung war, das passt hier nicht rein, oder das fällt ab oder das ist schwächer.
Wie schätzt Christian Döring die erstaunliche Bandbreite der Kling’schen Lyrik ein, die auffällige Fortentwicklung dieses Schreibens?
Döring: Ich glaube, es ist vor allem eine Historisierung, die da stattgefunden hat. Gleichsam von den Oberflächen der Gegenwartsphänomene, denken wir an Geschmacksverstärker hin dann zu den Gedichten, erster Weltkrieg, ein zentrales Thema, die Erkundung von Geschichtsräumen und die Erkundung von Landschaftsräumen, ein Weg also, der in immer größere Tiefen geführt hat, in gewisser Weise dann auch das ganze Wilde des Anfangs abgestreift hat.
Christian Döring weist noch auf einen anderen Zug der späten Werkphase Thomas Klings hin:
Döring: Es kommt zu dieser Historisierung auch eine immer stärkere Rezeption von Kollegen aus der deutschen Lyriktradition hin zu dem, was Thomas Kling dann das Bildgedicht nannte, und dann auch immer stärker auch die, wenn man das überhaupt so sagen kann, Einbeziehung seiner Selbst bis eben dann zu seinen letzten Gedichten, in denen er die Krankheit zum Thema macht.
Thomas Kling, der an Lungenkrebs litt, hat sein Siechtum in diesen letzten Gedichten ebenso schonungslos wie unprätentiös dargestellt, ja, auch dieser Erfahrung gewann er kühne Bilder ab: „schraffuren erzeugend im blau / yves-klein-pigment? Sei’s drum. / wenn diagnose ersma’ steht – frantic. // wie man eintäufte in meine Brust, / rumfuhrwerkte darin und loren proben / abtransportierten, nix von gemerkt – frantic.“
Souverän klang die Stimme Klings. Gerade in seinen letzten Gedichtbänden hatte seine Diktion an Reife gewonnen. Ja, so seltsam sich das bei einem einstmals geradezu „ungehörigen“ Poeten anhört, auch ein Zuwachs an Weisheit ist da zu vernehmen, ein Zug, der ja bei vielen Autoren fortgeschrittenen Alters auftritt.
Döring: Dieses Weiserwerden gibt es in der Literatur. Thomas Kling ist davon nicht ausgenommen, ich finde bloß, dieses Weiserwerden kann sich verschieden ausdrücken und oft bedeutet es ja ein Konventionellerwerden, eine Art dann auch wieder Konservatismus, das kann man Thomas Kling gewiss nicht nachsagen.
Hier kann man Döring nur zustimmen.
Enno Stahl, satt.org, Juni 2006
Ein Nachruf zum ersten Todestag
Weinreben bluten aus…
wenn man sie im Frühling zu spät schneidet. Der dies wie nebenbei bemerkt, ist Johann Lippet, während er mit Thomas Kling durch die Weinberge rund um Edenkoben spaziert. Interessiert horcht Kling auf und zieht ein Notizbuch aus der Tasche. Das ist mein „Sprachspeicher“, schmunzelt er und notiert den Satz vom Ausbluten.
aber die sprache,
aber die sprache,
aber die sprache,
dies ständige, ständige,
vollständige fragment
Ich kenne einen, der ihn gekannt hat… Ist dies nicht der klassische Nährboden, auf dem Legenden wachsen? Vor einem Jahr starb Thomas Kling, „die brennende Bibliothek“. Vielleicht wird die kleine Episode von oben irgendwann zur Legende. Noch hat sie Anekdotencharakter, aus erster Hand erzählt. Von Johann Lippet, der Thomas Kling in Edenkoben begegnet ist. Seine Erinnerung an jene Tage im Spätsommer 1998 hat er für diesen kleinen Nachruf freigegeben.
Ich kannte alle worte
für kralle, magen, mund und kopf.
für bärenkralle, bärenmagen,
bärenzungenspitze,
für meinen bärenkopf.
die kenn ich nun nicht mehr.
die brauch ich nun nicht mehr.
Der Wort-Winzer Thomas Kling ist tot, doch sein Weinberg liegt als enormes poetisches Werk vor uns. Der Sprachspeicher ist voll, der Sprachschatz, den Kling gehoben hat, muss ausgewertet werden. Von all jenen, die ihn gekannt oder nicht gekannt haben, die ihn schon immer gelesen oder noch nie gelesen haben. Die ihn jetzt erst entdecken. Für alle wird es viel Arbeit geben, begleitet von Klings Working Song:
von eisen der bach,
und wie er uns antrieb!
antrieb, flüssig, das mühleisen, das uns begleitet.
knirschend der stein, knirschend begleitender stein.
und die mühle sprach.
sprang.
ihre mühlensprache sprach sie: flüssig,
in zerkleinerungsform.
sprach wie im rausch.
DuMont brachte jetzt die Gesammelten Gedichte heraus, einen kompakten Band von fast tausend Seiten. Schön aufbereitet, mit Lesezeichen, auf feinem Papier, wo man die Seiten auch mal drehen muss, um manche Gedichte im Querformat zu lesen. In den Botenstoffen schrieb Thomas Kling zu Ingeborg Bachmann: „Lest ihre Prosa, mit wem sie wann schlief, daß sie nach drei Bissen wieder rauchte, sodann ihre Kippe im Spiegelei ausdrückte – vergeßt das, lest ihre Schriften.“ Dieses Zitat versteht sich hier als Aufforderung und Paraphrase auf Thomas Klings Gedichte selbst.
Dorothea Gilde, poetenladen.de, 14.4.2006
Gesammelte Gedichte
− Thomas Klings Lyrik. −
Kling war ein Sprachbesessener. Er liebte das Wortspiel und das Spiel der Visualisierung von Wörtern. Nun haben seine Autorenkollegen Marcel Beyer und Christian Döring seine Gesammelten Gedichte aus den Jahren von 1981 bis 2005 herausgegeben.
Er sei ein „Poesie Gratwanderer“, ein „Poesie Lunatiker“, ein „Magier einer ins nächste Jahrtausend weisenden Sprachverwirklichung.“ Mit diesen Worten hat die Grande Dame der deutschsprachigen Literatur, Friederike Mayröcker, den Dichter Thomas Kling beschrieben. Kling ist 2005 im Alter von 47 Jahren verstorben.
Nun haben sich seine Autorenkollegen Marcel Beyer und Christian Döring gemeinsam auf den Weg gemacht und im DuMont Verlag Klings Gesammelte Gedichte aus den Jahren von 1981 bis 2005 herausgegeben. Was da auf den fast 1000 Seiten Lyrik zum Vorschein kommt, gleicht einem Œuvre, das sich einem langen Leben verdankt.
Ein Sprachbesessener
Kling als „Poesie Lunatiker“ war kein mondsüchtiger Schöngeist, der dann und wann an einem Gedicht feilt, sondern er war ein Sprachbesessener. In seinem lyrischen Werk arbeitet er mit Ellipsen, verfremdeten Zitaten, er liebt das Wortspiel und das Spiel der Visualisierung von Wörtern. Manchmal zersägt er förmlich die Worte, so dass nur noch kleinste Bedeutungselemente übrig bleiben.
Aber Kling ist auch ein echter Natur- und Liebeslyriker, der sogar in seinen Gedicht-Zyklen Geschichten erzählt. Außerdem hat er seine eigene Tradition ganz bewusst zusammengestellt: Sie reicht von Catull über den spätmittelalterlichen Minnesänger Oswald von Wolkenstein bis zu Expressionismus und Dadaismus, bis zu Autoren wie Ernst Jandl und Friederike Mayröcker.
Zyklus „Bildprogramme“
Kling hat seine Jugend in Düsseldorf verbracht und zeitweilig in Köln und Wien gewohnt. Deswegen schätzt er den rheinischen Dialekt-Singsang genau so wie den Wiener Slang mit seinen oft poetischen Wortbildungen. Überhaupt setzt Kling stark auf das gesprochene Wort, also auf die Rezitation der Gedichte.
Das Gedicht „Zwischnbericht“ zum Beispiel stammt aus dem Zyklus „Bildprogramme“. Es sind Bildbeschreibungen oder Beschreibungen von historischen Räumen. Man befindet sich irgendwo in Italien, möglicherweise in Siena, und glotzt im wahrsten Sinne des Wortes auf ein gotisches Meisterwerk. Zwar gibt es Begriffe wie „heraldik“ und „weißestn marmors parade“, aber der Betrachter dürfte wohl eher ein „Kölscher Jung“ sein, dem die Bild-„ALLEGORIEN“ nur eines sagen: „nix wie mädels / mit blanken möpsn auffe reliefkacheln“.
Da prallen im Gedicht sprachlich zwei Welten aufeinander, die nichts gemeinsam haben – außer einem Sachverhalt: „säuberlich schädeldecken (caput mortuum)“. Denn gestorben wird zu jeder Zeit. Und daher kann Kling sein Gedicht auch am Schluss als „grabungsbericht“ bezeichnen.
Wenig Spielraum für Interpretation
Thomas Kling macht es den Lesern seiner ersten Gedichtbände nicht immer leicht. Die Sprachexperimente und die Assoziationsbreite vieler Texte lassen wenig Spielraum für klare Interpretationen. Doch in den 1990er Jahren wendet sich Kling Motiven aus der klassischen Dichtung zu.
Seine Nachdichtungen von Catulls Liebeslyrik gehören sicher zum Feinsten, was bislang an Übersetzung angeboten wurde. Die enorme Sinnlichkeit Catulls – die auch ganz schön derb sein kann! – holt Kling mit großer poetischer Kraft ins Deutsche hinüber. Völlig entstaubt kann so das Lesen lateinischer Dichtung echten Lustgewinn bringen.
Aber Thomas Kling widmet sich auch der lateinisch-römischen Mythologie. So hat er einen Gedicht-Zyklus zu „Actaeon“ geschrieben. Der Jäger Aktaion beobachtet Diana beim Nacktbaden. Als die Göttin dies merkt, verwandelt sie Aktaion in einen Hirschen, der sodann von seinen eigenen Hunden zerrissen wird. Ein schlimmes Ende für einen schlichten Voyeur.
Das Publikum verzaubern
„Das Gedicht baut auf die Fähigkeiten der Leser / Hörer, die denen des Surfens verwandt zu sein scheinen, Lesen und Hören – Wellenritt in riffreicher Zone.“ Mit diesen Worten hat Thomas Kling einmal das Wesen seiner Dichtung beschrieben. Wie nur wenige Lyriker baut er von vornherein auf seine Leser- und Zuhörerschaft. Man kann sagen, dass seit den 1990er Jahren der Dichter Lyrik schreibt, die sein Publikum verzaubern soll: Man selbst soll das „Sprach-Surfen“ erlernen, um sich so geschickt auf den reichen Flutwellen der deutschen Sprache zu bewegen.
Lyrik, so Kling, ist „kennungsdienst“. Der Autor bietet seine Dienste dem Leser an, damit er die „kennung“ seiner eigenen Sprache besser begreife. Mehr kann man von einem Dichter nicht verlangen! Thomas Klings Gesammelte Gedichte sind ein prallvolles Schatz- und Schmuckkästchen deutscher Sprache, das man besitzen sollte. Auch deswegen, weil man mit dieser Geste den toten Dichter ehrt.
Österreichischer Rundfunk, 23.7.2006
Direkt in den Himmel
− Wenn die Sprache des Alltags Einzug hält in die Lyrik, kann es schnell langweilig werden. Wer mag schon Gequassel im Gedicht, das ja bekanntermaßen verdichten soll? Bei Thomas Kling ist das zum Glück ganz anders, denn mit den alltäglichen Ausdrücken beginnt bei ihm eine Reise durch die Zeit. −
Fast eineinhalb Jahre ist es her, dass Thomas Kling im Alter von 48 Jahren an Lungenkrebs verstarb. Er war ein Lyriker, der vor allem mit der Sprache der jüngeren Menschen gearbeitet hat, mit einer Sprache, die der ständigen Erneuerung unterworfen ist, deren Sprecher den Drang zum Lakonismus und der enormen sprachlichen Verkürzung verspüren. Kling hat diese neumodischen Formen der Reduktion für seine Lyrik fruchtbar machen können, und seine Genialität – um es emphatisch zu sagen – lag in der Fähigkeit, sprachlich die Zeiten zu überbrücken. „CNN Verdun“ heißt es in einem Gedicht, und plötzlich wird einem schwindelig: Der Erste Weltkrieg ist eines der Lieblingsthemen von ihm. Das Interesse daran rührt vermutlich von seinem Großvater her, der 1886 im gleichen Jahr wie Gottfried Benn geboren wurde und der für Kling die Rolle eines Lehrers übernahm. „CNN Verdun“, in diesen wenigen Buchstaben steckt das Prinzip von Thomas Klings Literatur: Das Vergangene heranzuziehen, es zu vergrößern und unter die Lupe zu nehmen, es zu übertragen auf unsere Verhältnisse. Aber geht das? Wie blicken wir von heute aus auf die Gräuel des Ersten Weltkrieges? Den Krieg kennen wir als Medienereignis; Kameras sind vor Ort, wenn heute geschossen wird. Aber wie war es damals? War es nicht die Feldpost, die die Medien ersetzte? War nicht auch jeder Soldat gleichzeitig Kriegsberichterstatter?
Verschiebung der Perspektive
Wenn man Kling genau liest, gelangt man unweigerlich zu einem Knäuel von Fragen und die historischen Verschiebungen der Perspektiven sorgen für neue Erkenntnisse. Die Geschichte rückt uns auf die Pelle, lässt uns nicht mehr los, denn Kling setzt sie sprachlich in einen Bereich, der bislang unserem Alltagsdasein vorbehalten war:
Die Schrift – Echtfoto; gehts jetzt nach Verdun? ins friendly fire?
direkt in den himmel? Frierend vor nässe. Verdreckte sägende
ärzte, übermüdet. verdreckte verbände. frisch und vollgesogenan
die front verlegt, um von verdreckten sanitätern – gehts hier
ins studio Douaumont? stäubchen unter scheinwerferkehlen in
bewegung. CNN Verdun. es tut sich wochenlang, wiedermal,
nichts. dann gehts ab, tierisch. tierhafte, gebückte schatten, vom
verfolgerspot erfaßt. alarm und gebildete rufe: mehr licht! holz vom
wäldchen, am splittern. zustoßtechniken. in schnellem wechsel
geschehen jetzt die schnitte. dann abpfiff, wieder trillerpfeifen, nacht
-aufschriften, beschriftete nachthimmel. die fans schießen jetzt
leuchtraketen ab; geht das gut. (…)
Da kommt die ganze Schrecklichkeit des Krieges ungemein rasant auf den Leser zugeschossen. Das Gedicht wirkt hastig und atemlos wie das, was dort auf diesem Kriegschauplatz geschildert wird. Dies ist aber nur ein Text aus der von Marcel Beyer und Christian Döring klug edierten Werkausgabe Gesammelte Gedichte. Ein voluminöser Band mit über 950 Seiten liegt vor – ein notwendiges Buch, denn Thomas Kling war ein Lyriker, der stark für den historischen Moment gearbeitet hat, der die geschichtliche Situation auf die verwendeten sprachlichen Mittel hin überprüft und sich gewehrt hat gegen ein allzu einschmeichelnden, verharmlosenden Ton in der Lyrik.
Thomas Combrink, titel-magazin.de, 17.9.2006
Am Bauch der Sprache
„Magier einer ins nächste Jahrtausend weisenden Sprachverwirklichung“ nannte ihn die ebenfalls hoch geschätzte Kollegin Mayröcker. Der 1957 geborene und früh gestorbene Kling wird hier mit einem opulenten Œuvre von beinah 1.000 Seiten präsentiert. „walzer heißt pogo. vulkan fiber / wieder PVC! merkts euch! ihr säcke mit den verrutschten kathetern“ – so hörte sich das Mitte der 80er-Jahre an.
Kling hatte das Ohr am zischenden und gurgelnden Bauch der Sprache. Es kommt vor, dass man diesen Band um 90 Grad drehen muss, um ein Gedicht lesen zu können. Oder man muss es querlesen.
Im letzten Teilband setzt er sich unter anderem anrührend mit seiner tödlichen Lungenkrankheit auseinander, etwa in „Inhalator“.
hervorgestossenes atemmail, wie metal aim
gezähnte lüfte. so lautet inhalt, kurz-hall-mail,
so inhaliert uns der dichter.
Ein Lyrik-Band für die, die’s wirklich wissen wollen.
Thomas Lang, zehn.de
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Walter Delabar: Klingwerke
literaturkritik.de, Juni 2007
Maria Renhard: „sekundn bonsai“
Die furche, 3.1.2008
Thomas Klings „gewebeprobe“
Für Thomas Kling (1957–2005) ist das Gedicht ein „optisches und akustisches Präzisionsinstrument“, das „der genauen Wahrnehmung von Sprache“ sowohl „entspringt“ als auch „dient“.1 Mehrmals definiert Kling das Gedicht als „Wahrnehmungsinstrument“2 und seine eigenen Arbeiten werden dieser Definition gerecht. Klings Gedichte beobachten durch die Sprache und sie beobachten die Sprache. Gegenstand der dichterischen Beobachtung sind Landschaften und geschichtliche Ereignisse im weitesten Sinne; dazu gehören bestimmte Orte in der Stadt, das Rheinland, Bräuche und gesellschaftliches Geschehen, Tiere, Persönlichkeiten aus der Wissenschaft, der Kunst und der Literatur. Viele Gedichte gehen von Gemälden, Fotografien oder alten Texten aus. In fast allen wird eine Beobachterposition mitthematisiert, die sich ihrer Sprachgebundenheit bewusst ist. Etymologische Recherchen sowie die Verwendung von Fachtermini und Jargon führen dazu, dass ein Thema sprachlich aus mehreren Perspektiven beleuchtet oder vielmehr aus ihnen heraus erst konstituiert wird.3 Viele der zusammengefügten oder übereinander gelagerten Bruchstücke aus Anekdoten, historischen Dokumenten und Bildungsgut sind für den Leser schwer zugänglich. Hermetisch im herkömmlichen Sinne sind die Gedichte nicht; nie geht es darin um Sprachelemente, die auf unhintergehbare Weise metaphorisch sind. Hermetisch sind sie allenfalls in Bezug auf die Eigenschaft, die Kling selbst mit Hermes verbindet: Hermes als „Türhüter“, „Botenstoffbeförderer“, „Wirklichkeitsmixer“ vermittelt zwischen heterogenen Sprechweisen und Sprachschichten.4 Der Eindruck des schwierigen Gedichts, der auch von Klings eigentümlicher Schreibung ausgeht, ist eigentlich nicht in dieser begründet. Denn die besondere Schreibweise lässt sich beim lauten Lesen und auch bei der leisen Lektüre, bei der für das geistige Ohr Laute realisiert werden, ohne weiteres entziffern. Sie ist kein triviales Verfremdungsmittel, sondern ein Hinweis auf die Stimme – ein Hinweis wohlgemerkt, der auf demselben arbiträren Darstellungskodex der Übersetzung von Lauten in Buchstaben beruht wie die orthografisch korrekte Schreibung.
Drei ausgewählte Landschaftsgedichte bzw. Auszüge aus diesen veranschaulichen die Schichten der Sprachreflexion, die Kling mit seinem Idiolekt erreicht.
GESTOKKTES BILT5
im grunde di naturgewaltn; ein grun-
zn aus dem untergrund, durchwatete
delirien;
aaaaaaüberkreuz-
geratne geratn da natürlich überkreuz, des
öfteren, öfter noch als früher: marterln
an der autobahn, improvisierte biltstökke,
flüchtig zustaubendes randstreifngeblü; zur
seite gesprochner truckersatz (ein stoß-
gebet), bei kurzem halt bei -planknsalat („da
hats sie weggefetzt“) nur keine KURVN-
DISKUSSION;
aaaaaaaapestackerrant, so monochrom;
dahinter einfamilienhäuser, breiige le-
bnzversicherun’
STROMERNDE ALPMSCHRIFT6
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadi alpm?
also, grooßformate drramatischster vrr-
kettungen; so dämmrunx-lilienstrahl in
riefenstahlscher lichtregie. christiani-
sierte gipfel […]
[…] TOP OF JUROPP / DA GLÜÜN DI AGENTUREN-
SCHÄDEL. hochtourign auxx. augn als, äh,
freeclimber di sich, also di loshangeln,
sich über eine gebräunte ansichzkarte hang-
eln, di is von zirka neunzehn-zwanzich: keuch!
keuchende männchn („ne, di is älter“) […]
nach münzeinwurf zielvorstellungn; di gi-
pfl im unterzukker, abgesuchte vrrktngn
aaaaaaaaa[…] wir legn di tageslichtspule
„super-x“ ein, 1938 (münznachwurf): erst!
durchsteigun’! die eiger trepaniert! indi
„retina“ lächelnde haknkroizfane.
GEWEBEPROBE7
der bach der stürzt
ist nicht ein spruchband
textband weißn rau-
schnnz;
aaaaaaaaschrift schon;
der sichtliche bach di
textader […]
aaaaaaaaabruchstücke,
ständig überspült; über-
löschte blöcke, weiße schrift-
blöcke und glitschige, teils,
begreifbare anordnungn: ein un-
unterbrochn ununterbrochenes.
aaaaaaaaaaaa[…] guß,
megagerinnsel, hirnstrom.
In diesen Beispielen sind die orthografischen Verfremdungsmittel erkennbar, die Klings Idiolekt zu Grunde liegen. Eine andere als die konventionelle Schreibweise bei dennoch gleicher Aussprache haben die Wörter „gestokktes“, „biltstökke“, „unterzukker“, „ansichzkarte“, „zwanzich“ und „kroiz“ (in „haknkroizfane“). In einigen Wörtern – „bilt‘‘, „biltstökke“, „pestackerrant“ – wird die im Deutschen übliche Auslautverhärtung grafisch kenntlich gemacht: ,b‘, ,d‘ und ,g‘ werden im Auslaut [p], [t] und [k] ausgesprochen. Ein „morphologisches Prinzip‘8 führt aber dazu, dass der Aussprache-Unterschied schriftlich nicht ausgedrückt wird; die Schreibung entspricht dem Wortstamm.9 Kling weicht hier von diesem Prinzip ab und folgt der Grundtendenz: Der Buchstabe bezeichnet den Laut. Die Aussprache wird somit in den Vordergrund gerückt und hat Vorrang vor der semantischen Zugehörigkeit. Schon diese winzigen Kennzeichen suggerieren: Es geht vor allem um die Sprache, in der beobachtet wird.
Mit dem Verhältnis von Phonemen und Graphemen spielen auch die Wörter „grooßformate“, „GLÜÜN“, „di“, „geblü“ und „haknkroizfane“: Langvokale sind im Deutschen entweder gar nicht oder durch verschiedene Mittel10 gekennzeichnet und diese werden hier im Gedicht entgegen dem üblichen Gebrauch hinzugefügt oder weggelassen. Die auffälligste und häufigste Metalepse in Thomas Klings Gedichten ist die Verschleifung des unbetonten ,e‘, vor allem an Wortenden auf ,-en‘. „naturgewaltn“, „geratn“, „gesprochner“, „augn“, „männchn“, „weißn“ und „anordnungn“ sind nur einige Beispiele aus den oben angeführten Auszügen. Diese Schreibung ist eindeutig eine Angleichung an die gesprochene Sprache, in der das [ǝ] sehr oft kaum hörbar oder überhaupt nicht ausgesprochen wird. Ein Schritt in Richtung Umgangssprache ist die Elision in den Wörtern „gipfl“ und „alpm“. Letzteres imitiert eine im Umgangssprachlichen vorkommende Zusammenziehung von ,-ben‘ oder ,-pen‘ zu einem Mischlaut, bei dem die Lippen geschlossen gehalten werden. Die artikulatorische Nähe der drei bilabialen Konsonanten ,b‘, ,p‘ und ,m‘ motiviert zu diesem Ton.11 Die Auslassungszeichen in „lebnzversicherun’“ und „durchsteigun’“ lassen den Leser ein ,g‘ für die Aussprache des [ŋ] ergänzen. Eine hypertrophierte Aussprache wird bezeichnet in „dämmrunx“ (,-ungs‘ – ,-unks‘ = ,-unx‘), in Wörtern mit verdoppelten Konsonanten („drramatischster vrr- / kettungen“, „auxx“) bis hin zum vollständigen Vokalschwund in „vrrktngn“ und lautmalerisch in „rauschnnz“. Diese Beispiele zeigen, dass Kling die Standardschreibung nicht beliebig verändert, sondern immer so, dass dadurch auf den Schriftkörper und seine mögliche Aussprache aufmerksam gemacht wird. Durchgehend sticht hervor, dass gesprochen wird. Die umgangssprachlichen Begriffe und die Aussprüche in direkter Rede – „stromernde“, „(„da / hats sie weggefetzt“)“, „(„ne, di is älter“)“ – machen deutlich, dass es sich um spezifische Sprechsituationen handelt. Auch der Modejargon und die fachsprachlichen Ausdrücke – „mega[…]“, „trucker […]“, „freeclimber“, „di tageslichtspule / „super-xx“, „die eiger“12, „trepaniert“ – zerstören auf sichtbar gemachte Weise die Illusion, es gebe einen neutralen Standpunkt, von dem aus gesprochen werden könnte. „TOP OF JUROPP“, die deutschen Schriftzeichen für eine englische Bezeichnung, vermitteln einen fremdländischen Blick auf dieses europäische Gebirge, einen Blick, der seinerseits aus dem deutschsprachigen Alpengebiet heraus betrachtet wird.13 Ähnlich wirken die in Klammem eingelagerten Kommentare und die zahlreichen Unterbrechungen, die Ausrufe, das Zögern und die abwägenden Wörter auf die Perspektivierung: „zur / seite gesprochner truckersatz (ein stoßgebet)“, „also“, „äh“, „keuch!“, „so“, „im grunde“, „natürlich“. Die Einleitungsfrage zum Zyklus „stromernde alpmschrift“ ist da besonders aufschlussreich: „di alpm?“ fragt jemand, der weiß, dass seine Zuhörer oder Leser auf eine Beschreibung warten, und der dann eine Definition der Alpen gibt, oder eben jemand, der eine Dialogsituation simuliert.
Die Schreibweise ist kein Ziel an sich. Die orthografische Verfremdung dient zusammen mit den Interjektionen und Fachausdrücken dazu, zu einem Gegenstand viele Perspektiven und Sprechweisen vorzuführen und diese als solche zu kennzeichnen. Klings Wörter sind im Sinne von Roland Barthes doppelte Zeichen: Sie vermitteln ihre Bedeutung und verweisen zugleich auf ihre materielle Existenz.14 Dies betrifft alle Ebenen und geht über den Idiolekt im hier definierten engeren Sinne (als individuelle Verfremdungsmethode auf Wortbildungsebene) hinaus. Bei Kling zeigen auch Bilder, Metaphern und Tropen, dass sie Bilder, Metaphern und Tropen sind, dass ihr Status sprachgebunden und also relativ ist; sie spiegeln keine Realitätsillusion vor: Die Gegenstände dieser drei Gedichte – die Bildstöcke am Straßenrand, die Alpen und der Sturzbach – sind bildlich ein Anstoß zu Reflexionen über die Sprache, in der sie dichterisch beschrieben werden. Der Titel „gestokktes bilt“ ist ein Wortspiel mit „marterln“ und „biltstökke“. Diese mit Hilfe eines ,Stocks‘, d.h. auf einem Pfahl oder einem Sockel am Straßenrand aufgestellten Heiligenbilder oder Kruzifixe erinnern an ein Verkehrsunglück. Das Sprechen über einen Fernfahrer, sein Stoßgebet und den Halt an einer wegen „-planknsalat“ sichtbaren Unfallstelle kreist um diese „biltstökke“. Die ganze Landschaft wird von ihnen ausgehend betrachtet: Die Einfamilienhäuser sind angesichts so häufiger Unglücksfälle (vgl. Vers 6) nur der Ausdruck eines sinnlosen Strebens nach Sicherheit, sind „breiige le- / bnzversicherun“‘. Ein „gestokktes bilt“ ist auch das Gedicht selbst. Es ist eine Momentaufnahme und ein sprachliches Bild, mit dem, gemäß der Bedeutung von ,stocken‘, das beobachtete oder imaginierte Geschehen auf der Autobahn kurz stillgestellt wird. Es gibt nicht die Geschwindigkeit der Fahrzeuge filmisch wieder, sondern hält ein Stocken fest, „(ein stoß- / gebet) bei kurzem halt“. Ein „bilt‘‘ ist dieses Gedicht zudem, weil es eine Sicht einfängt, um deren Bildhaftigkeit die lyrische Sprecherinstanz weiß. Diese nicht persönlich auftretende Aussageinstanz reflektiert den Kunstcharakter des Gedichts nämlich mit einem metalyrischen Augenzwinkern:
im grunde di naturgewaltn; ein grun-
zn aus dem untergrund, durchwatete
delirien;
aaaaaaüberkreuz-
geratne geratn da natürlich überkreuz […]
Das gefährliche Wetter, das die Autobahnbenutzer vom ,geraden‘ Weg abbringen kann, wird mit einem Chiasmus dargestellt („im grunde“ – „naturgewaltn“ – „grunzn“ – „untergrund“), bei dem „im grunde“ sowohl ,eigentlich‘ als auch den „untergrund“ bezeichnen kann, aus dem die Unwettergeräusche und die Wassermassen („durchwatete / delirien“) zu kommen scheinen. Die Konstruktion „überkreuz- / geratne geratn […] überkreuz“ benutzt diese syntaktische Kreuzstellung erneut und benennt sie dabei wörtlich. Auch hier gehen die Sprachmittel – der Idiolekt, die Polysemie und die Tropen – einher mit Hinweisen darauf, dass und wie sie benutzt werden.
Ähnliches leistet „stromernde alpmschrift“. Die Alpen werden wie Schriftzeichen ,gelesen‘, fotografische Abbildungen werden betrachtet. Und die „[…] schrift“ über die Alpen ist eine „stromernde“: Sie streift umher, sie treibt sich – nach dem mittelhochdeutschen Wort ,Stromer‘ aus der Gaunersprache – herum. Sie wandert durch verschiedene Milieus und mit Hilfe von Medien durch die Zeit. Die personifizierte „schrift“ weiß darum, dass die Alpen nicht neutral beschreibbar, sondern immer schon durch Diskurse vermittelt sind. Sie evoziert den Tourismus. Sie artikuliert den Wunsch des Menschen, den Berg zu bezwingen: Sie spricht von der abenteuerlichen Durchdringung der Eigerwand, wobei eine Assoziation mit Lilienthals Erfindergeist möglich ist („lilienstrahl“ als Verschmelzung von ,lilien‘, ,sonnenstrahl‘ und ,Lilienthal‘). Aus der Beobachtung macht die „schrift“ eine leicht ironische Charakterisierung: Wegen ihrer Gipfelkreuze sind die Berge „christianisiert[]“. Die Schrift verdeutlicht auch Zusammenhänge: Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage „di alpm?“ kommen dem Ich (hier in Zeile 14 im „wir“ präsent) Leni Riefenstahls Bergbilder in den Sinn. Das lyrische Ich denkt wahrscheinlich vor allem an den 1932 uraufgeführten Bergfilm Das blaue Licht, bei dem Riefenstahl erstmals Regie führte. Er wurde tatsächlich besonders wegen der „lichtregie“ (Vers 4) gelobt und lieferte den Anstoß für Hitlers Interesse an Riefenstahl und für deren Zusammenarbeit mit dem Propagandaministerium des nationalsozialistischen Regimes. Vermittelt werden im Gedicht durchgehend Bilder, die ihrerseits aus medial Vermitteltem hervorgegangen sind. Statt von Kletterern, die sich über die Berge hangeln, ist die Rede von den „augn […] als freeclimber“, die sich über ein Bild, eine sehr alte „gebräunte ansichzkarte bang- / eln“. Der „münzeinwurf“, der eine persönliche Beobachtung durch ein Fernglas erwarten lässt, öffnet die Sicht auf 1938 und eine Hakenkreuzfahne: Es beobachtet der Geschichtsinteressierte, nicht der Wanderer. Besprochen wird, wie die Alpen betrachtet und wozu sie, auch ideologisch, benutzt werden. All diese Blickwinkel zusammen ergeben eme Definition der Alpen.15 Dass diese ihre Sprachgebundenheit reflektiert und zum Hauptthema macht, konnte an den kleinsten sprachlichen Einheiten bereits nachgewiesen werden.
Metaphern funktionieren in „stromernde alpmschrift“ ähnlich wie in „gestokktes bilt“: Die Wendung „gi- / pfl im unterzukker“ etwa verfremdet das abgegriffene Bild vom Schnee, der wie Zucker ist. Überzuckerte, mit Zucker bedeckte Gipfel befinden sich rein logisch unter Zucker, also „im unterzukker“. Aus dem Klischee wird eine Konstruktion, die wie nonchalant hingeworfen klingt. In „gestokktes bilt“ werden die Bildstöcke „randstreifngeblü“ genannt. Die ebenfalls hochstrapazierte Blumen-Metaphorik wird somit benutzt und zugleich lässig beiseite geschoben. Analog zu ,Gewächs‘ ist ,Geblüh‘ ein morphologisch korrekt gebildetes Wort; im Unterschied dazu hat es einen pejorativen Beiklang. Die Marterln, „improvisiert[]“ und „flüchtig zustaubend[]“, schießen eher wie Unkraut aus dem Boden, um das sich keiner kümmert, als dass sie schönen Blumen glichen. Von den drei gewählten Gedichten ist „gewebeprobe“ am stärksten metaphorisch aufgeladen. Sturzbach, Sprache und Körper werden zu einem poetologischen Bildkomplex. Die Gleichung ,Bach= Text‘ wird in den ersten vier Zeilen verneint und danach bejaht. Möglicherweise steckt darin eine Differenzierung. Der Bach ist „nicht ein spruchband / textband weißn rau- / schnnz“, weil er nicht die klare Botschaft der Spruchband-Slogans verkündet, weil er, obwohl er weiß schäumend rauscht, auch nicht die völlig unverständlichen Töne produziert, die synästhetisch ,weißes Rauschen‘ genannt werden – weil er stattdessen eine Schrift ist, die sich zwischen diesen beiden Polen bewegt: „schrift schon“, heißt es, und erklärt wird die Parallele zwischen Bach und Text. Die „bruchstücke“, die „blöcke“, sind Steine im Bach, die „ständig überspült“ werden, „glitschig[]“ sind und also nur stellenweise und vorübergehend Halt bieten. Bezogen auf die Sprache, die „schriftblöcke“, geht es wieder um die Verständlichkeit: „glitschige, teils, / begreifbare anordnungn“ bilden einen Text und auch auf das vorliegende Gedicht trifft diese Definition zu. Es besteht typografisch und semantisch aus „bruchstücke[n]“ und Zusammenhängen, stockt und fließt. Selbst Widersprüche sind darin integriert: „ein un- / unterbrochn ununterbrochenes“ ist eine paradoxe Tautologie. Man kann sie selbstbezüglich lesen: „un- / unterbrochn“ ist durch Trennungsstrich und Zeilenwechsel im Schriftzug unterbrochen; genau umgekehrt verhält es sich mit dem so entstandenen Wort „unterbrochn“.
Eine Gewebeprobe ist eine kleine Menge von Gewebe, die die Beschaffenheit eines Ganzen erkennen lässt.16 Hier ist sie eine Textprobe (lat. ,textus‘ = ,Gewebe‘), aus der heraus die Sprachstruktur zu ersehen ist. Poetologisch ist sie, weil die Aussage dieses Textes für Thomas Klings Gedichte im Allgemeinen charakteristisch ist. „gewebe“ bezeichnet auch das Körpergewebe, „textader“, „megagerinnsel“ und „hirnstrom“ verbinden Text und Körper oder Körper und Fließgewässer. Das Wort ,Gerinnsel‘ enthält auf den Körper bezogen die Bedeutungskomponente ,geronnen, fest geworden‘, als Gewässer aber das Sem ,fließend‘. ,Gerinnsel‘ im Sinne von ,Rinnsal‘ ist veraltet und steht von der Wortwahl her im Kontrast zu der wieder in Mode gekommenen Partikel ,mega-‘. Das Qualifizieren des Baches/Textes als „megagerinnsel“ vereint somit gleich mehrfach konträre Bedeutungen. Der ,Sprachfluss‘ – um im Bild zu bleiben – ist an den Körper gebunden. Wichtig ist, wie oben gezeigt, das Mündliche und also die Stimme. Als wesentlich wird in „gewebeprobe“ schließlich das Organ hervorgehoben, das für die komplizierte Lyrik von Thomas Kling als Symbol dienen kann, nämlich das Gehirn: „hirnstrom“ lautet das letzte Wort des Gedichts.
Die Bezeichnung von Sprache und Text als „hirnstrom“ bedeutet bei Kling genaues Observieren und Nähe zu Sprache und Gegenstand eher als kühle Distanz. Es stimmt zwar, dass Klings Gedichte „den sprachn das sentimentale / abknöpfn“, wie es in einem seiner Texte heißt.17 Die Hirn-Metapher greift als Kontrast zu dem Bild von Lyrik, das traditionell mit ,Herz‘ konnotiert wird. Eine Abneigung gegen einfache, naiv gefühlsbetonende Gedichte sprechen auch Klings zahlreiche Invektiven gegen die Lyrik der Neuen Subjektivität aus und seine Gedichte können als Gegenreaktion auf diese gewertet werden. Ihr radikal unsentimentaler Charakter sollte aber nicht emotionslos genannt werden. Ein beeindruckendes Beispiel für die emotionale Kraft ist der „Gesang von der Bronchoskopie“,18 in dem Kling seinen bevorstehenden Tod thematisiert und die Lungenkrebsbehandlung im Krankenhaus mit denselben Bildern beschreibt, die in „gewebeprobe“ vorkommen:
griesbach unhörbar, als schleiernder, ab-
schleiernder striem: sichtbar.
das helle eben – eben das nichttextband.19
Es geht nun um einen schleierartigen, einen leisen, sogar geräuschlosen Bach; „das vieltonige Getöse des Baches, der stürzt“, ist nicht zu hören.20 Der „griesbach“ vereint orthografisch zwei Wörter: Er schleift Grieß mit sich und macht grieseln.21 Er ist der unter Schmerzen erzeugte und schwache Luftstrom, „hervorgestossnes: atemmail“, die Botschaft des Dichters, der schonungslos die Dichterstimme entmythisiert: „so inhaliert uns der dichter“, lautet der letzte Vers des Zyklus.22 Der „griesbach“ ist das Sprechen des beschädigten Körpers, den sich das Ich als ein Bergwerk vorstellt:
wie man eintäufte in meine brust,
rumfuhrwerkte darin und loren proben
abtransportierten, nix von gemerkt – frantic.23
Wie in „gewebeprobe“ ist die Rede von Proben, die aus dem Körper entnommen werden. Das Ich, das sich selbst als „lungen- / schacht“24 bezeichnet, verwendet auch für das medizinische Material Fachwortschatz aus der Bergmannssprache, wie „loren“ oder „gezähe“.25 In dem Wort „frantic“, das im ersten Gedicht dreimal auffällig am Versende steht, steckt konzentriert das, was in den Bildern und der beherrschten Sprechweise sehr unsentimental zum Ausdruck kommt. Das englische „frantic“ bedeutet ,verzweifelt‘, ,rasend‘, ,außer Fassung‘, ,fast wahnsinnig‘. Der Rückgriff auf eine andere Sprache ist hier ebenfalls ein Mittel der verdeckten und unpathetischen Artikulation.
Klings Gedichte reflektieren vor allem darüber, dass, wie und aus welchen Perspektiven in ihnen Sprache benutzt und erzeugt wird. Der Leser kann den schwierig erscheinenden Idiolekt mit Hilfe von Wörterbüchern, Techniken aus der Linguistik und thematischen Recherchen entziffern und nach dem konventionellen Schema den Zeichen ein ihnen entsprechendes Bezeichnetes zuordnen. Die Sprache funktioniert in diesem Sinne auf herkömmliche Weise und wird trotz ,idiolektaler‘ Verfremdung nicht unverständlich oder referenzlos. Die Sprachmittel, die aus verschiedenen Sprachregistern, Fachbereichen und Zeiten stammen und die Kling zu einem als typisch erkennbaren Idiolekt zusammenfügt, werden im Gedicht zugleich vorgeführt und kritisch wahrgenommen. Sebastian Kiefer spricht in der bisher tiefgründigsten Gesamtwertung zu Thomas Klings Werk von „inszenierte[r] Bedeutung“. Kling habe die Bauformen der Rede der Tradition benutzt, aber den Versuch des Bedeutens inszeniert, anstatt einfach etwas ,bedeuten‘ zu wollen; das Gedicht sei kein Aussagen, sondern eine Inszenierung von Aussageversuchen.26
Kiefer lehnt in seinem Essay die drei letzten Gedichtbände von Thomas Kling ab; er wirft ihm vor, dort zu „parlieren“.27 In den betreffenden Bänden setzt Kling die Lautschreibung mit Ausnahme der e-Elision sehr sparsam ein.
Dass er den Anspruch der Vielzüngigkeit dort aber keineswegs aufgegeben hat und eine den ersten Bänden vergleichbare Reflexionstiefe erreicht, zeigen die soeben zitierten Ausschnitte aus Auswertung der Flugdaten und vor allem die ausführliche Analyse eines späten Zyklus in Kapitel VI dieser Arbeit, die Kiefers Urteil also widerlegt.
Indra Noël, in Indra Noël: Sprachreflexion in der deutschsprachigen Lyrik 1985–2005, Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2007
Noch einmal: Thomas Kling
– Eine persönliche Erinnerung zum 50. Geburtstag von Thomas Kling. –
Dutzende Szenen wären aufzurufen, mit Musik, Wetter und Bienengesumm, mit Fliedergeruch, Donnergewölk und Fluggeräusch im Hintergrund, zu viel, zuviel für eine Seite der Erinnerung.
Wenn ich nun die Augen schließe und es einfach auf mich zukommen lasse, dann sind da zunächst die herzbeschwerenden Begegnungen im langen Jahr seines Abschiednehmens. Ein Fingerlegen in die Wunde, auf das implantierte Chemiedepot. Doch was kommt dahinter, was will ich sehen hinter dem Schirm von Leid und angespanntem Willen? Welches Bild stellt sich ein?
Ich sehe Thomas Kling mit meinem Vater, und ich sehe ihn mit meinem kleinen Sohn. Ich sehe den Dichter, über dessen Arbeit wir zusammenkamen, wie er in meiner Familie Platz nimmt, wie er als ET in die Familiengeschichte hineingerät – ein Schritt bewußt, ansonsten unwillkürlich, ohne Plan und Programm.
Zu einer Ausstellung der künstlerischen Arbeiten von Thomas Klings Frau Ute Langanky in Grevenbroich kommen meine Eltern, die ganz in der Nähe wohnen. Weder mit zeitgenössischer Lyrik noch mit bildender Kunst haben sie sonderlich viel zu tun. Sie sind Nachbarn, und es ist ein sonniger Sonntagmorgen. Thomas Kling sucht sofort die Nähe zu meinen achtzigjährigen Vater, begrüßt ihn mit einer solchen barocken Lobrede auf den Sohn, als ob er alte Gattungskonventionen neu beleben wollte. Den braven Vätern, so konnte ich heraushören, müsse jetzt endlich einmal gesagt werden, dass ihre zwieschenzeitlich wild mißratenen Söhne es in der Kunst denn doch zu was gebracht hätten: Das alles hier, die Bilder und die Dichtung und die Kritik, das sei doch was, was Richtiges! Auch in Grevenbroicher Perspektive. Es war auch höflich und launig, und es war eine ästhetisch vermittelte Bestätigung von Freundschaft. Eine Überforderung des Zuhörers zweifellos, wie so oft. Thomas psalmodierte, er sprach sich hinein in eine Genealogie. Geschmeichelt und konsterniert ließ er den alten Herrn zurück, und den Sohn rätselnd über die Szene wie über ein live inszeniertes Gedicht. Thomas konnte solche performative Dichtung aus dem Stegreif wie kein anderer, er brauchte und liebte es. Er kam damit heraus aus der mittleren Plauder- und Konversationslage. Aber das war nicht alles. Er wollte auch irgendwo hinein; in die Genealogie, ins Wesentliche. Die Szene ist sofort Teil des nichtschriftlichen Familiengedächtnisses. Schattenhafte Anwesenheit für lange Zeit.
Eine andere Ausstellung. Blumenbilder von Ute Langanky im Museum für europäische Gartenkunst in Benrath. Wir sitzen alle im Café und oszillieren zwischen draußen und drinnen, da drinnen die Bilder von draußen hängen, und draußen die Bilder von drinnen blühen. Nur Thomas ist nicht dabei. Er hat meinen siebenjährigen Sohn an die Hand genommen und geht mit ihm spielen. Draußen, am Schloß, im Gras. Ganz lange. Und als sie wiederkommen, ist das so selbstverständlich, als wären zwei Siebenjährige aus einem muffigen Café mit bleichen talking heads ausgebüchst, um im Hellen Fußball zu spielen. Seitdem ist Thomas ein Bild in meinem Sohn, so gut wie für immer – „dein Freund mit den Schwänen da am Schloß“. Ich weiß nicht, was da mit den Schwänen war, aber Thomas mochte diese Tiere, und er konnte Schwärmen bis zum Bezirzen.
Sohnschaft, Vaterschaft, Filiation – warum fallen mir zuerst Begegnungen ein, die haarscharf an mir vorbeiziehen und mich doch meinen? Thomas war diskret bis zur Weißglut. Er wollte alles wissen, alles, und er wollte niemanden bedrängen. Das ist ein innerer Kampf und eine heikle Balance. Und wenn er verlorenging, der Kampf, weil eine Empörung siegte, eine Auflehnung, dann konnte er andere überfallen mit einer Heftigkeit, dass ihnen Hören und Sehen verging. Bis zur geballten Faust. Thomas wußte das und zog sich auch deshalb immer mehr zurück; weil er andere mit sich verschonen wollte. Diese Neugier, dieses moralische Brennen, diese Vorsicht und diese Zuwendung. Jeder spürte das in seiner Anwesenheit. Es war für alle schwer, aber es war etwas! Es war selten, anders, besonders. Dabei wollte Thomas nicht als sensibler Dichter angefaßt werden. Überhaupt war dem lodernden Wissen-woller intime Kommunikation verhasst. Bis zur Weissglut eben. Deshalb fing sein gesamtes Dichten an mit der Wut auf die Epoche gewordene Innerlichkeit der siebziger Jahre. Doch worauf ist man wirklich wütend?
Danach setzte ein kurzer Gedichtwechsel mit meiner Tochter ein. Thomas schrieb ihr ein Herbstgedicht und bat sie, die Zehnjährige, um den Frühling. Wie er kreuz- und endreimen konnte, wenn er wollte, herzliche Verbindungen herstellen, schöne Momente, einfach so. Ein lieber Junge – nein, das kann man kaum lesen!: ‚ne leve Jong‘, so geht’s! wie er sich einlassen konnte auf ein ganzes Lebensverhältnis, so dass dem anderen warm ums Herz wurde… aber auch mulmig, aber auch ängstlich. Hätte man nicht lieber etwas weniger preisgegeben? Wer bist Du? Woher kommst Du? Wie echt bist Du? Auch das hat fast jeder sofort gespürt: er ging direkt auf den Grund zu.
Dies alles geschieht im zwielichtigen Raum der Psychologie, der komplizierten Motivationlagen, fatalen Attraktionen und schönen Konjunktionen. Augenblicke einer komplizierten Freundschaft. Doch beim Nachsinnen kommt noch etwas anderes zum Vorschein, etwas längst schon Gegebenes, Tatsachen von einer Unwahrscheinlichkeit, die Unheimlichkeit mit sich führt, so dass man zum Schicksal greifen will, um sich mal eben kurz daran festzuhalten.
Thomas lebte sein letztes Jahrzehnt zusammen mit Ute Langanky auf der Raketenstation, zur Kunstinsel Hombroich gehörig, zwischen den Dörfern Kapellen und Holzheim. In Holzheim ist meine Mutter geboren und aufgewachsen, in Kapellen lebt ihre Schwester mit Familie. Mit sieben Jahren haben meine Mutter und ihre vier Geschwister beide Eltern bei einem Unfall mit einem Pferdefuhrwerk auf der Holzheimer Gell’schestraße verloren. Das Waisenmädchen wurde von einer kinderlosen Bauernfamilie auf derselben Straße aufgenommen. Das Kind mußte statt zur Schule zum Ernteeinsatz. Wenn es spielen durfte, dann in den Erftauen nebenan, dort wo die Kunstinsel Hombroich ist, wo Thomas und Ute später wohnten. Der Besitzer des rosa Hauses, heute ein Hombroich-Museum, hat die Kinder mit einem Knüppel in der Hand davongejagt. Die Raketenstation liegt an der Verlängerung der Gell’schestraße. Wir fuhren oft hierher zur Großmutter. Von dort über die Dörfer weiter, von Holzheim nach Kapellen.
Fünfzig Jahre später bekommen Ute und Thomas Besuch von Marcel Beyer und Norbert Hummel. Sie fahren gemeinsam nach Gohr, einem kleinen Dorf in der Nähe der Raketenstation, in der anderen Richtung. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Sie besuchen die schöne romanische Dorfkirche mit den Resten des alten Kirchhofs. Eine Wallfahrtskirche, der heiligen Odilia geweiht. Dort gibt es Odilienwasser gegen Augenkrankheiten. Und eine Madonna von Gabriel Grupello. Sie schicken mir eine Postkarte von der Kirche mit dem Brunnen von Pastor Hubert Weidenstraß davor, der mich getauft hatte. „Schöne Grüße von zuhause“.
Wenige Jahre später fahren der kranke Thomas und Ute regelmäßig zur Therapie von der Raketenstation ins Kreiskrankenhaus Dormagen. Sie nehmen den Weg über Gohr, die Bergheimerstraße Richtung Anstel, wo ich meine erste Disco besucht habe. Sie sehen meine Mutter im Garten arbeiten und erzählen vom Spargel, vom Weizen auf jenen Feldern, auf denen ich gespielt habe, wenn sie abgeerntet waren.
Schließlich wird Thomas im April 2005 auf dem alten Holzheimer Friedhof begraben, neben der Gell’schestraße. Das Haus meiner Großmutter grenzt mit seinem alten Baumgarten an diesen Friedhof. Dort liegen alle Verwandten meiner Mutter, ihre natürliche Familie, die Hilgers, und die Adoptiveltern. Bei der Beerdigung biege ich hinter dem kleinen Wagen mit der steinernen Urne in den Friedhofweg ein, an dem das Grab für Thomas schon ausgehoben ist. Mehrere Hilgers liegen in Thomas’ Reihe, liegen gleich neben ihm auf dem alten Holzheimer Friedhof. Ich pflücke einen Apfel auf dem Grundstück der Großmutter und werfe ihn über den Zaun und die Hecke zu den Gräbern, dorthin wo Thomas liegt.
Wenige Wochen nach Thomas’ Tod wird mein Vater mit notärztlicher Verordnung ins Kreiskrankenhaus Dormagen eingeliefert. Wegen Bettenmangel in der Orthopädie wird er einige Tage in der Onkologie untergebracht. Es ist der Flur, an dem auch Thomas am Ende gelegen hatte, und wo ich ihn besucht hatte. Ich mag es kaum sagen, weil kaum glauben: er lag im selben Zimmer wie Thomas zuletzt.
Und noch eine kurze Wendung, eine letzte Windung zurück – fast möchte man sich für eine Realität entschuldigen, die soviel Dichte zuläßt. „BRENNSTABM ist meinem großvater und lehrer Dr. Ernst Matthias (1886-1976) in dankbarer erinnerung zugeeignet“ lautet die Widmung in Thomas Klings Gedichtband brennstabm von 1991. Sofern man so etwas überhaupt wissen kann, nahm in Thomas’ Leben der gebildete und belesene Großvater die Stelle des abwesenden Vaters ein. Dr. Ernst Matthias war Volksschullehrer in Düsseldorf. An der Gutenbergschule im Stadtteil Grafenberg. In diesem Stadtteil lebte er auch, und Thomas verbrachte viel Zeit bei ihm. Seit 17 Jahren lebe ich mit meiner Familie in Grafenberg. Von den meisten Fenstern unseres Hauses schauen wir auf den Schulhof. Um zwanzig vor zehn beginnen die Schüler zu lärmen. Abends im Sommer spiele ich mit meinem Sohn oft Tischtennis an den Betontischen vor der Turnhalle. Beide Kinder, vier Jahre auseinander, haben die Gutenbergschule besucht, acht Jahre in Folge.
Doch immerhin: An jedem Schultag fahren die Kinder heute am Humboldtgymnasium im Pempelfort vorbei zum Görresgymnasium an der Kö. Thomas Kling hat das Humboldtgymnasium besucht.
Kürzlich, bei einer Ausstellung von Werken Ute Langankys und Thomas Kling (ihrer Photos und Künstlerbücher, seiner Gedichtinstallationen) in Ratingen, sprach mich ein ehemaliger Lehrer vom Humboldt an. Es war Thomas’ Deutschlehrer. Er erzählte von Thomas’ Theaterleidenschaft, die ihn schon als Primaner an die Uni geführt habe, zu einem Theaterworkshop mit Rainer Seek. Mit Rainer Seek, vor einigen Jahren plötzlich eines Morgens vor dem Rasierspiegel gestorben, habe ich an der Uni Düsseldorf ein Heiner Müller-Seminar besucht, und als wir zu einer Aufführung von Der Auftrag nach Essen fuhren, trug er frei aus der Hamletmaschine vor, ein überartikulierter, ein scharf gezackter Sound, den wir heute als Muster im Ohr haben, aus dem Mund eines anderen Dichters. Rainer Seek sprach Heiner Müller wie Thomas Kling.
Hubert Winkels, aus Hubert Winkels: Kann man Bücher lieben? Vom Umgang mit neuer Literatur, Kiepenheuer & Witsch Verlag, 2010
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest Oh Nacht [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


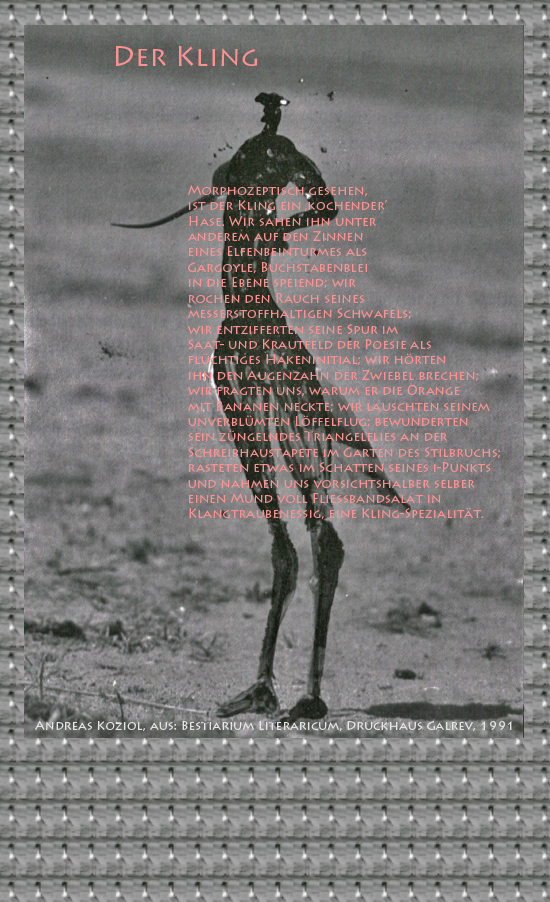












Schreibe einen Kommentar