Thomas Kling: Itinerar
SPRACHINSTALLATION 2
Marie: Mon Dieu, Sie sind ja meschugge.
Puller: Sie machen Überredungskünste.
Serner, Posada (1926)
1
Bei Jean Paul findet sich folgendes Exzerpt: „Mit dem letzten Athemzug gehen die vorher geschlossenen Augen und Mund wieder auf. Autenrieth.“ Nun war der Medizin-Professor und Klinikchef Ferdinand Autenrieth 1806 der Arzt Hölderlins, und er behandelte seinen Patienten wohl mit der von ihm zur Stillstellung Tobsüchtiger entwickelten Gesichtsmaske; Prognose: noch drei Jahre Lebenszeit. Laut Rezeptbuch erhielt der Dichter Belladonna- und Digitalispräparate, beruhigende, aber auch: herzstärkende Mittel.
„… gehen die vorher geschlossenen Augen und Mund wieder auf.“ Ich lese das Notat des Psychiaters als Aufforderung zum Weiterhinsehen, zur weiteren Sprachenfindung; zum Fortsetzen dichterischer Traditionslinien im Rückgriff auf teils weit zurückreichende Rhizomanordnungen und als Aufruf zu exzessiven Recherchen philologischer wie journalistischer Art, die vor jeder Niederschrift, vor dem Schreibakt – stehen seien sie nun literal oder oral bestimmt. Die Einbeziehung aller existierenden Medien ist gefragt. Die Augen des Dichters gehen auf, der Mund öffnet sich, um nach Gegebenheiten zu fragen, Phänomene zu registrieren, Erkundigungen über Lebensläufe einzuholen; mitgemeint sind selbstverständlich Lebensläufe auch von Worten, von Soziolekten. Ich pflege von jeher eine Etymologiebegeisterung, die der des 19. Jahrhunderts, als die Aufbruchsstimmung in den Humanities hochschlug, in keiner Weise nachsteht.
In der Ethnologie werden solche Leute als Memorizer bezeichnet: sie sind die Gedächtnisverantwortlichen unter den Clanmitgliedern. Kapazitäten der Sprachwirklichkeit. Die Memorizer am Mittelsepik, einer Flußlandschaft in Papua New Guinea, beispielsweise, wissen in ihren totemistischen Gesängen, dem „Gesang an den Fliegenden Hund“, diesen und anderen der Fauna entstammenden Clangründern ihre Referenz wie selbstverständlich zu erweisen: „Der Fliegende Hund ist ein wichtiger Vorfahr!“ Hier gibt es keine wesentliche Differenz zu Nietzsches Ahnenverehrung, im Falle von Horaz, den er in der Götzen=Dämmerung („Was ich den Alten verdanke“) pflegt. Nietzsche empfindet bei dessen Oden „artistisches Entzücken“. Ich zitiere die berühmte Stelle: „Dies Mosaik von Worten, wo jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff, nach rechts und links und über das Ganze hin seine Kraft ausströmt, dies Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen, dies damit erzielte Maximum in der Energie der Zeichen.“ Eine für mich akzeptable Charakteristik von Moderne überhaupt! Hier setzt Mallarmé an, der Barthes Maxime, die ,Lust am Text‘ beachte keine Ideologie, antizipiert. Grundsätzlich hält Mallarmé alles Existierende für poesieverwendungsfähig, was ihn zwang, wagnerianisch ins Großformat zu gehen: mit seinem utopischen, hochinteressant-verführerischen Megalo-Konzept „le livre“, dem wohl ehrgeizigsten Projekt der poetischen Moderne, dem das Scheitern inhärent war. DAS BUCH kam nie zur Ausführung; in seinem von der Materialfülle diktierten Umfang wäre es ein Fall für die CD-ROM gewesen… Des Dichters Resümee lautet denn auch resignativ: „Die Zerstörung war meine Beatrice.“
2
Seit etwa Mitte der 80er Jahre können wir ein erhöhtes Interesse in der sprachkritisch-avancierten deutschen Lyrik an oralen Traditionen feststellen. Ich spreche hier weder vom trostlos-vergrübelten Alltagsgedicht, wie es sich bis weit ins vergangene Jahrzehnt hinein gerettet hat, noch soll die Rede sein vom in den 90ern zu beobachtenden Beatnik-Revival, das unter der trademark ,spoken word‘ einer neuen alten Unbekümmertheit das Wort redet. Das haben weder Olson noch Brinkmann verdient. Diskreditiert ist der Popbegriff, der für einen Teil der heute verfaßten und (teils elektronisch) publizierten Literatur durchaus zu überdenken wäre, seit längerem; spätestens seit das Zeit-Magazin eine populistische Spalte ,Helden der Popkultur‘ eingerichtet hat, in der u.a. der lyrischer Verfasserschaft gänzlich unverdächtige Altminister Genscher zum Zuge kommt. Pop?
Ich für meinen Teil habe spätestens seit 1983 mich für eine Neuformulierung der Dichterlesung eingesetzt. In diesem Jahr erschien in Köln (Stattplan), mein Privatdruck AMPTATE, der bereits zehn Gedichte aus erprobung herzstärkender mittel (Düsseldorf, 1986; vergriffen) enthielt. Dazu gehörten und gehören im wesentlichen Auftritte mit dem Performer und Schlagzeuger Frank Köllges, gehören Auftritte wie die legendäre SPRACHINSTALLATION im Op de Eck, Düsseldorf-Hafen 1985, aber auch Soloevents, wie „detlev von liliencron. performance“, Ateliers Münsterstraße, Düsseldorf 1984. In der Poesie-Poetikanthologie Proë (Berlin 1992) habe ich mich in einem knapp gehaltenen Statement unter dem Titel „DER DICHTER ALS LIVEACT. DREI SÄTZE ZUR SPRACHINSTALLATION“ zur Renaissance der Dichterlesung geäußert.
Seit Beginn meiner Auftrittstätigkeit konnte mir der durch Mainstream-Einflüsse unbrauchbar gewordene, kontaminierte Begriff der Performance nicht mehr genügen. Ein Seitenblick auf die Geschichte des Wortes performance – ich benutze das erste Vollständige Wörterbuch der Englischen Sprache für die Deutschen…“ von Johannes Ebers (2 Bde., Berlin 1793 / Leipzig 1794) – zeigt, daß in der älteren Bedeutungsschicht nicht nur ausgesprochen körperbezogen-handwerkbeherrschend Durchführung gemeint ist, ,Bewerkstelligung, Vollziehung, Leistung‘, weiterhin ,eine Handlung, Unternehmung, That‘. Arbeit von Entscheidern: Augenöffnung, Mundstellungen. Das bis zum Rastellihaften gesteigerte, hochgereizte histrionische Element, etwas, das einmal einen gewissen Typ Dandy ausmachen konnte, kommt, deutlicher, in der ursprünglichen Wortbedeutung Performer zum Ausdruck: dieser Tatenvollbringer und Restheros ist auch „derjenige, welcher seine Geschicklichkeit öffentlich zeigt; z.B. ein Musicus, ein Tänzer etc.“. Der Performer als Sprachinstallateur ist Konzeptkünstler. Serner vor allem, Ball und Vertreter der russischen Avantgarde der 20er Jahre repräsentieren auch frühe Performanceformen. Das aufs gesellschaftlich Randständige weisende, dem Histrionentum Zuzurechnende trifft die nach wie vor gültige Position der Dichter und Dichterinnen gerade auch dort genau, wo er und sie zu den Hofnarrenehren des Staatskünstlertums mehr oder weniger willentlich hinaufgestolpert sind, „ich han mîn lehen…“. Das schon bei den altwalisischen (brythonischen) Dichtersängern zweifelhafte Privileg, siebenfarbige Kleidung tragen zu dürfen, hieß zugleich, neben dem König an der Tafel Platz zu nehmen, und muß – eine Binse – nicht unbedingt für die Dichtung selbst etwas bringen.
Kurz, ich bezeichnete das, was ich unter Lesung verstand, früh als Sprachinstallation; auf einem copyzierten flyer taucht das Wort 1986 in Vaasa/Westfinnland auf, wo ich eine Zeitlang lebte und ein paar Auftritte hatte; Sprachinstallation, gleich dreisprachig, Schwedisch und Finnisch kamen dazu. Im Lauf der Jahre ist das Wort herumgekommen und wurde auch anderenorts benutzt – von anderen Autoren, für literal-multimediale mit live gesprochener dichterischer Sprache gekoppelte events, beispielsweise; die Sekundärliteratur nimmt sich nun seiner an.
3
Es sprachen Papuas, die sehr genau zwischen E- und U-Literatur zu unterscheiden wissen; in nicht endenwollenden Performances sprechen ihre Memorizer, deren Publikum auch so etwas wie Einschaltquoten kennt (siehe hierzu: Douglas L. Oliver, Native Cultures of the Pacific Islands, University of Hawaii Press, Honolulu 1989), von Welterschaffung – von Weltschaffung durch Sprachewerden. Nichtendenwollende Litaneien, stolze Antiphone ihrer Rede von Spracherwerb:
… und dann wurde dein Oberkiefer zum Himmel-i-e
dein (Oberkiefer mit dem) Krokodilszeichen wurde zum Himmel…
Apotheotisch ist ihre Rede von der „Energie der Zeichen“: Gedicht ist immer Evokation; und: Gedicht ist, spätestens seit Baudelaire, Mallarmé, George („und für sein denkbild blutend MALLARMÉ…“) Konstrukt. „Poetische Rede ist konstruierte Rede“, hat Šklovskij in seiner fundamentalen Studie Kunst als Verfahren (1916) festgestellt. Gedicht ist Gedächtniskunst und steht als Schrift naturgemäß vor der Performance des Textes, der in vorklassischer Epoche bereits aus dem rhetorischen Kanon ausgeschalteten actio; ist schon Rhetorik, die prononciert memoria miteinschließt, das ,Gedächtnis(vermögen)‘, die ,Erwähnung‘, also das, worauf gedeutet wird. Das Gedicht als literales Ereignis ist die Sprachinstallation vor der Sprachinstallation.
4
Bekanntlich verschwinden die kleinen Sprachen, tonlos sozusagen; sie werden überrollt von den Verkehrssprachen. Die Dichtung, die Literaturen dieser kleinen Sprachen werden, soweit aufgezeichnet – im Deutschen ist das der Fall- zur Angelegenheit von staatlich subventionierten Folkloreinstituten, wo sie mehrheitlich in Gefangenschaft gehalten bzw. totgepflegt werden. Die deutschsprachige Literatur ist, im internationalen Vergleich, heute bereits Orchideenfach. Ist das schlimm? Ist es, schlimm, daß das Gedicht, das Orchideenfach der Literatur, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte Orchideenfach war? Ist das schlimm? Daß das Gedicht relativ kurze Zeit nur, während die beweglichen Drucklettern für Textvervielfältigung sorgten, dem Bürgertum als unverzichtbares Spielzeug galt, erscheint heute als Schönheitsfehler; der dem Gedicht aber, dies zur Beruhigung, nicht weiter geschadet hat. Wir haben schließlich zuletzt den vorübergehenden didaktischen Schwächeanfall der Enzenbergers (uns zur Kenntnis gebracht in trostlosen ,Meldungen vom lyrischen Betrieb‘, FAZ vom März 1989) überstanden – ich darf getrost den Ball, zeitverzögert sozusagen, mal eben zurückspielen. Ferner wurde überstanden: die durch die 70er wallenden, nun sprachlich völlig verwahrlosten Bauchnabelbetrachter, Fußlahme des Denkens, insgesamt ein unerfreuliches Lazarett von potentiellen New-Age-Fällen, die, sprechen wir vom Naturgedicht, meilenweit hinter die Droste zurückfallen; nach 1968 wurde die westdeutsche Lyrik zum Agnes-Miegel-Gedächtnishäkeln. Hier waren Reanimationsversuche für mich nicht angezeigt!
Mein Wienaufenthalt 79/80 war Programm; ebenso wie meine frühen Lektüreerfahrungen; mit 13: Menschheitsdämmerung; Benn, vor allem Trakl. Mit 15: Beschäftigung u.a. mit den Technopägnien der Konkreten, die zu diesem Zeitpunkt, Anfang der 70er Jahre, bereits Literaturgeschichte waren und deren eifrige Didaktik, in der sie den Brechtnachfolgern keinen Deut nachstanden, mich abstieß. Der Konkreten Poesie, aus deren Umfeld sich das Bielefelder Colloquium rekrutiert, hat Reinhard Priessnitz (1945-1985), der zweifellos bedeutendste Dichter seiner Generation, einmal völlig zu Recht ein „etwas naives Programm“ bescheinigt. Priessnitz, Autor der legendären und in ihrem Einfluß kaum zu Überschätzenden Gedichtsammlung vierundvierzig gedichte (1978), ist sicherlich höher als Brinkmann zu bewerten, dessen Berufsfuror einem doch ziemlich auf die Nerven gehen kann. Mir lagen gewisse Arbeiten aus dem Montagebereich der Wiener Gruppe näher, besonders Bayer und Wiener, ein Ingenieurstum, das sich Dr. Benn vielleicht so nicht hatte träumen lassen.
Poesie und Didaktik operieren auf gänzlich differenten Feldern, und die Pointe ist Sache des Kabaretts, das bekanntlich in der Mordmaschinerie der Nazis sein beklagenswertes Ende gefunden hat. Geduld, dochdoch, die haben wir wirklich bewiesen: die heute relevanten Dichter und Dichterinnen deutscher Zunge im Alter zwischen 30 und Anfang 40 schreiben und publizieren fast alle seit wenigstens eineinhalb Jahrzehnten.
5
Die Komprimierung in die „Energie der Zeichen“, die Nietzsche so enthusiastisch in den Oden des Horaz begrüßt – „jedes Wort als Klang, als Ort, als Begriff“ −, dieses Zerlegen, um zu rekonstruieren, ist das brennstabmhafte der Sprache, von der ich rede. Es ist eine Art Wildzerlegen, -teilen, ist Arbeit des Zerteilens, konzentriertes Zergliederungswerk, kunstreiche Öffnung von Körpern, Ausübung des Pathologenberufs am Körper Geschichte; Sprachkörperbetrachtung, Benutzung von Sprachkörpern ist Teil des dichterischen Prozesses vom „Sprachleib“ ist schon bei Kaspar Stieler die Rede. Den zu begreifen ist eben auch eine Frage des Timings: nun, Timingspezialisten – in jeder Hinsicht – sollten sie schon sein, die Dichter und Dichterinnen. Dichtung ist ja, von seiner Herkunft, Rhythmus. Was die notorische Irritation anbelangt – vor allem auf akademisch geprägter Seite −, die von metrischer Synkopierung, einem der Kennzeichen nicht erst des zeitgenössischen Gedichts, herrührt, so kann mit Gleichmut auf John Donne verwiesen werden, den sein Kollege Ben Jonson zwar als einen der Bedeutendsten bewunderte, ihn aber für seine „unebene Metrik“ des Strickes würdig befand – abgesehen davon, war Jonson überzeugt, daß ob seiner Kompliziertheit das Donnesche Werk dem Vergessen anheimfallen müsse; verwiesen werden kann ebenfalls auf Goethe, den der frühe Schlegel der Athenäum-Fragmenten vor Anwürfen, welche die „metrische Sorglosigkeit“ des Lyrikers betrafen, mit Hinweis auf Konsequenz und Charakter der Goetheschen Poesie abschmetterte.
Um bei den Gegnern von neuer Dichtung zu bleiben, die gemeinhin als ungewöhnlich, fremd und, da nicht durch Kanonisierung abgefedert, nicht selten als Bedrohung empfunden wird, hier eine von circa 1920 stammende anonyme Zeitungsreaktion auf den tatsächlich sensationellen Erfolg der Anna Blume des Kurt Schwitters. Es heißt darin:
Deutsche Jünglinge und deutsche Jungfrauen! Streicht aus euerem poetischen Schatze Schillers Glocke, Goethes Erlkönig und Uhlands Balladen und setzt, stolz auf den neuesten deutschen Aufschwung an deren Stelle die Anna Blume von Schwitters. Wie wir früher schon feststellten, hat unser Dichter die unleidliche Logik längst zum Tempel hinausgeworfen. Der Grammatik und dem gesunden Menschenverstand ergeht es ebenso. Die glückseligen zehntausend Leser, die sich in solche Poesie versenken, werden bald nach geistiger Lähmung eine beneidenswerte Seelenruhe finden. Vielleicht ist dies der Weg für das deutsche Volk, um für seine vielen Leiden gefühllos zu werden. O, Kurt Schwitters! Du deiner dich dir, ich dir, du mir. – Wir?
Angefügt sei ein Auszug aus einem Leserbrief der 90er Jahre an das Feuilleton der FAZ, der sich, von einem Dr. med. aus 8182 Bad Wiessee verfaßt, mit meinem in dieser Zeitung abgedruckten Gedicht „gewebeprobe“ (enthalten in morsch, Frankfurt a. M. 1996), sagen mir mal, ,auseinandersetzt‘; dieser Brief wurde mir von der Redaktion kommentarlos zugestellt. Ein rhetorischer Refrain deutscher Modernefeindlichkeit wird angestimmt:
… und frage Sie also: dieses Gedicht, ist das ein literarisches Erzeugnis mit Kunstanspruch? Vielleicht typisch für moderne Lyrik? Oder hat es insgeheim mit transcendentaler Meditation zu tun? Oder mit Drogen? Soll man versuchen, seinen tieferen Sinn zu deuten, oder ist es einfach das Produkt einer freien Assoziation von Bildern und Worten, könnte also nur von einem Psychoanalytiker gewürdigt werden?
Absatz, der Leserbriefschreiber fährt fort; man beachte das avantgardistisch gesetzte, geradezu den Gesetzen phonetischer Schreibweisen gehorchende doppelte b:
Als langjähriger Abbonent Ihrer Zeitung begegnen mir immer wieder solche aus dem Rahmen herkömmlicher Denk- und Ausdrucksweise fallende Gedichte und jetzt möchte ich einmal wissen: Bin ich, aufgewachsen mit Goethe und Shakespeare, Brecht und Enzensberger, einfach zu dumm? (…) Sprach-Chaos zur Verschleierung der Tatsache, dass es da gar keinen mitteilenswerten Gedanken gibt?
Das Gedicht baut ja auf Begegnung, die in vorliegendem Fall eher einer Kollision gleichkommt. Das Gedicht ist Begegnung. Nicht nur im Brocaschen Zentrum, dort, wo die Sprache sich anbahnt, das Gedicht ist nicht nur „synapsnslang“, oder nach der „Anabasis“ des Saint-John Perse:
mathematik von salz-packeis hängend! am
wahrnehmbaren punkt meiner stirn, wo das gedicht sich festsetzt,…
Für die Verfasserschaft des zeitgenössischen Gedichtes bleibt nach wie vor zu fordern: „die unabdingbare Vielstelligkeit des Ausdrucks“ (Celan). Ebenso bedenkenswert wie die Maxime des Horaz (in seiner „Ars Poetica“), daß die Sprache des Gedichts mit der Sprachsituation des Dichters sich zu decken habe. Könnte dies gelingen, dann: „gehen die vorher geschlossenen Augen und Mund wieder auf.“
Itinerar:
Straßenverzeichnis, die Stationenliste aus der Zeit der römischen Kaiser, die Wegeaufnahmen der Forschungsreisenden.
Der Dichter Thomas Kling, der mit seinen bisherigen Gedichtbüchern als Spracharchäologe bekannt und für eine nachwachsende Autorengeneration stilbildend geworden ist, stellt sich nun als Archäologe des Poetischen vor:
Itinerar heißt sein Essay über historische Sprachvorführungen von Dichtung.
Itinerar sichtet das Material, aus dem sich die Dichtung des Sprachrechercheurs Thomas Kling speist.
Itinerar bereichert das Verstehen zeitgenössischer Dichtungssprache.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1997
Von allen Büchern,
die mich bisher eingeschüchtert haben, ist dieses das dünnste. Knapp 60 Textseiten hat Thomas Kling (1957–2005) dafür gebraucht. Man selber bräuchte – und darin liegt der passabel gelungene Einschüchterungsversuch begründet – ein halbes Leben, dem nachzugehen, was hier gelegentlich ausgeführt, meist nur angedeutet, gar nur so eben gestreift wird. Ob die „Sprachkörperbetrachtung“ in John Donnes „unebener Metrik“ besser funktioniert? Wie der sprachliche Weg des Zeichens als Zinken (Rotwelch-Graffiti) sprachlich vonstatten ging? Und wie ökonomisch? Weht darum auch das, was sprachlich übern Gartenzaun kommt, hinein in Klings Gedichte? Was haben altwalisische Dichtersänger mit Leseperformances im Düsseldorfer Hafen Mitte der 1980er zu tun? „Sprache unterwegs, die den treffenden, schlagenden Begriff im Mund führt.“
In den Itinerar-Texten widmet sich Kling vor allem der gesprochenen Sprache. „Slangs sind das traditionelle Reservoir der Dichtung.“ Er fragt, wie sie in ein Textgebilde hineinkommt. Wie man das dann präsentiert. Ohne auch nur einen Halbsatz lang banal zu werden. Im Gegenteil: Bei der Lektüre seiner Überlegungen zu Dada und Fachsprache, zu barocken Permutationen und Wiener Gruppen hat man dauernd das Gefühl, etwas nacharbeiten zu müssen. Eine Hartnäckig- und Übermütigkeit, für die man Thomas Kling dankbar sein muss. Wie jene antiken Reisebeschreibungen, von denen Kling seinen Titel geborgt hat, die Möglichkeit einer Reise nahe legen, deuten seine Essaybände Bibliotheken an, Forschungsgebiete. Neue Texte. Dass Kling bisweilen schnoddrig erzählt, dabei stets präzise in seinen Mutmaßungen – „Relaunching“ für spracharchäologische Wiederaufnahme-Verfahren! Konstruktivismus als gängige Praxis seit je! – und so selbstbewusst, dass man froh ist, nur das Buch vor sich zu haben und nicht ihn, gehört zum (dann schon wieder etwas weniger eingeschüchterten) Lesevergnügen dazu. Wie die gelegentlich große Geste und die bisweilen beängstigende Überschriftensicherheit: Itinerar – da war Kling vierzig. Als er starb, war gerade ein weiterer Gedicht/Essayband erschienen – Auswertung der Flugdaten…
Tim Schomacker, readme.cc
Das Bühnenbild der Wirklichkeit
− Der Dichter Thomas Kling. −
Im Rekurs auf die gesprochene Sprache gewinnt der Lyriker Thomas Kling dem Gedicht nicht nur verlorene kommunikative Bastionen zurück, sondern auch Energie, Beweglichkeit, Geistesgegenwart – und eine ganz neue Form der Autonomie.
Das Fremde ist die verspiegelte Kehrseite des Eigenen. Fremdbestimmungen sind Selbstbestimmungen. Bei Thomas Kling tauchen an der Nahtstelle zwischen poetischer Subjektivität und lyrischer Tradition keine gegnerischen Schulen, keine ablösungsreifen Stile, keine Antipoden auf. Und doch macht er Front.
In einem Vaudeville, das alles in einem ist, Drehtür, Karussell, Kaufhaus, Zoo, Baustelle, Tropfsteinhöhle, Bunker, Operettenbühne und Vorratskeller, ziehen sie als Geisterbahngrusel vorüber: Dichterzombies, die bei Neumond dreimal um den Erlenbaum ziehen, hangelnde Primaten, Sumsemänner, Kastraten, Prothesen und schliesslich, in Person, neben Geibel Wilhelm Lehmann und Rilke als Einweckgläser und Kompottmarken.
Das Couplet ist frech, ein Sturm auf die Tradition ist es nicht. Den Friseuren, den Wurzelheiligen und Oberpriestern unter den Lyrikern gilt die Attacke – den Klassizisten, nicht den Klassikern. In seiner Form als Comic strip unterläuft das Vaudeville die erhabene Lächerlichkeit, die es angreift, und ist Gegenrede. Mit dem Spottlied, das aus seinem zweiten, 1989 erschienenen Gedichtband geschmacksverstärker stammt und den Titel „Direktleitung“ trägt, gibt sich Thomas Kling als Lyriker zu erkennen, der die kunstsprachliche Tradition erneuert, indem er auf die Strasse geht.
Im Rekurs auf gesprochene Sprache gewinnt er dem Gedicht nicht nur verlorene kommunikative Bastionen zurück, auch Energie, Vitalität, Ausdruckskraft, Beweglichkeit, Geistesgegenwart – und eine ganz neue Form der Autonomie. Sein künstlerischer Wegbericht Itinerar nennt an erster Stelle den Aktionismus der Wiener Gruppe, den er kennenlernte, als er 1979 nach Wien ging. Aber wenn er von seinen frühen Lesungen und Sprachinstallationen spricht, verweist er auf die Histrionen, ursprünglich etruskische und griechische Tanzpantomimen, später gesellschaftlich randständige, schlecht beleumundete Redner und Schauspieler, die an der ursprünglichen Einheit von Aktion und Rhetorik festhielten und ihre Texte in Gesten, die Rede in Körpersprache übersetzten.
Unwegsames Gelände
Zu seinen Vorläufern zählt er den spätmittelalterlichen Minnesänger und Sprachweltreisenden Oswald von Wolkenstein, die mittelalterlichen Volksprediger und ihre barocken Nachgeborenen Quirinus Kuhlmann und Abraham à Santa Clara. Hugo Balls Spracherweiterungsprogramm, die Etymologie als Spracharchäologie, das freie, undogmatische Experiment, das Gedicht als plastisch handgreifliches Zeichen und „hochkomplexes (,vielzüngiges‘, polylinguales) Sprachsystem“, das sind die Stichworte einer Kunst, die Erbin der grossen Traditionen des Gedichts ist. Redenähe, das Rotwelsch der Strasse, inszenierte Authentizität, das sind die Stichworte einer Vermittlungskunst, die das Distanzierungsmittel Gedicht um seine Achse dreht und in ein Medium verwandelt. So sichert er die Selbstbehauptung des Fremdkörpers Gedicht in der Unterhaltungsgesellschaft; so hütet er das dichterische Kunstwerk. Hermes ist in seinem Fall nicht der spätantike Esoteriker. Thomas Kling wählt Hermes, den archaischen Hirten- und Wegegott, den Plato als „Vater der Dolmetscher“ bezeichnet. Südeuropareisende begegnen heute noch seiner von den Schafhirten übernommenen Kunst, mit Steinhäufchen die Wege durch unwegsames Gelände zu markieren.
… unwegsames Gelände, das Gedicht ist eine Verschlusssache, dabei bleibt es. Wenn er sie preist, „die illegitime, weitgereiste Sprache der Strasse. Das bastardisierte, verdreckte, unter freiem Himmel wie in der Kaschemme gesprochene, das geflüsterte und gegrölte Wort“, dann nennt er als Gewährsmann Baudelaire: „Baudelaire, der die Stadtgeschwindigkeit als Nervengeschäft“ erkannt und das Erhabene garrottiert habe. Das Erhabene garrottieren hiess in Baudelaires Fall die Doppelnatur der Schönheit erkennen, ihre Zeitlosigkeit und Zeitverfallenheit, ihre Grösse und ihre Misere. Sie ist demnach nicht vorbei, die Zeit ästhetischer Autonomie. Das absolute Gedicht, das sein Material unabhängig von der Wirklichkeit organisiert, lebt. Aber seine Methode, den sinnlichen Gegenstand zu verdrängen, seine materialauflösende Transzendierungstechniken haben ausgedient.
Thomas Kling ersetzt sie durch die Befreiung der Bildsprache aus den Regularien der Abbildung, die das Beziehungsgeflecht zwischen Aussen- und Innenwelt festlegte. In einer Kernfusion verschmelzen die Schönheit und Sinnlichkeit der Dinge mit dem Wort zu einem Bild, das gegenständlich, aber nicht gegenstandsbezogen ist. Sein vielsprachiges, vielstimmiges, vielteiliges, vielheitliches Gedicht verlässt sich auf die Aussagekraft der Dinge und ist beides zugleich, sinnliches Scheinen der Idee und konkrete Poesie, Sinnstiftung und ein Gegenstand, „ein modernes Totem“ (Gottfried Benn).
erprobung herzstärkender Mittel und geschmacksverstärker lauteten 1986 und 1989 die Losungen Thomas Klings, lauteten seine programmatischen Signale, als er mit den gleichnamigen Gedichtbänden den Grundstein für sein Werk legte. Aber der Begriff „Geschmacksverstärker“ verwandelt sich im Schlussvers des Gedichts „Stollwerck: Köln 1920“ in eine banale Bestellformel, die sich auf den „letzten konkreten Kalauer“ bezieht: „Bitte mit Geschmacksverstärker.“ Die Programmfahne wird nicht gehisst, sie wird entwertet und demontiert. Ein bedeutender Lyriker des 20. Jahrhunderts meldet sich zu Wort, aber er ignoriert, was die Geschichte der modernen Kunst prägt: ihr Fortschrittspathos, die Dynamik von einander ablösenden Kunstevangelien, die bis in die sechziger und siebziger Jahre hineinreicht, als Enzensberger und Rühmkorf gegen das hermetische Gedicht mobil machten und die Konkreten ihre Materialschlachten gegen die Mimetiker führten, zuletzt noch vor wenigen Jahren als Nachhutgefecht Franz Josef Czernins gegen Durs Grünbein. Der Moderne als Stilprozess kehrt Thomas Kling den Rücken. Wenn er den Begriff in den Mund nimmt, zitiert er Nietzsches Äusserung über die „Energie der Zeichen“ in den Oden des Horaz. Er ist ein Neutöner, aber er ist kein Sezessionist.
Seine Manifeste sind seine Gedichte, mit denen er sich als Gestalt der künstlerischen Synthese zu erkennen gibt, als bündelnder, verschmelzender Wortgeist. Zum Beispiel „Öffentliche Verkehrsmittel“, ein Gedicht aus dem Band geschmacksverstärker. Sein Schauplatz vor dem Hintergrund eines bundesrepublikanischen Ballungszentrums ist ein Bus oder das Tram während der Rush-hour eines Novembertags. Aber nicht ein „Gedicht im Handgemenge“ (Jürgen Theobaldy) entsteht, keines der seinerzeit für die Lyrik typischen Banalgebilde, die mit der transzendierenden Kraft des poetischen Worts das Sublime aufgaben. Thomas Klings Gedicht montiert Schnittflächen, deren Wirklichkeitsmaterial so präzise getroffen und deren Textmaterial so kunstreich gegeneinander geschnitten ist, dass sie in der Totale zu einem körperhaften Schnittzeichen verschmelzen.
Über die Blickreisen zu den Passanten draussen und nach drinnen zu den Passagieren des rollenden Gefährts, über den Wirklichkeitsprospekt und seinen inventarisierenden Sachlichkeitston legen sich als geschlossene Bildkomplexe der Vorgang der Wahrnehmung und der eingearbeitete Akt der Textinszenierung. So verwandelt sich die rollende Sardinenbüchse voll „knalliger pärchen“, „amphetamindandys“, freundlich gebrechlicher Punks und Dosenbier trinkender Fans, die am Hauptbahnhof losgrölen, so verwandelt sich der Realfilm in einen Faust-Film mit dröhnendem Blocksberg und dealenden Hexen. Das moderne Gretchen ist das Scharnier zwischen dem „goethesubstrat“ und dem, was Kling als „underground“ bezeichnet, zwischen kognitiver und sinnlicher Wahrnehmung. Von der „Rasiermessertotale“ des Anfangs, einem Buñuel-Zitat, durchläuft ein geschlossenes Motivband das Gedicht mit durchschnittenen Augen, badenden Rasierklingen, Stechäpfeln, der durchschnittenen Menge, Gretchens aufgeschnittenen Pulsadern.
So ist das Gedicht ein Bühnenbild der Wirklichkeit, das die Genauigkeitstugenden des Räumlichen nutzt, und doch spricht es von nichts anderem als subjektiver Befindlichkeit. Das Schmerzbild, das jenseits der Buchstaben entsteht, zeigt, in der nackten Haut seiner Sinne, den Wahrnehmenden nach einer Liebesnacht und ist zugleich die Wahrheit über den Zusammenhang von Erkennen und Schmerz. Das Leitmotiv des Schnitts als blutige Wunde, erotisches Signal, Todesart und als Regieanweisung des Textmonteurs nimmt das Gedicht in seine Form auf als filmische Schnittechnik. In der vollkommenen Einheit von rhetorischer Organisation und freier Erlebnisform, von Formritual und Intensität, von methodischer Arbeit und vitalen Schreibimpulsen vollzieht das Gedicht den Brückenschlag zwischen rationaler und magisch spiritueller Ästhetik.
Ein Gedicht beispielhaft für ein Werk, das beides ist, konkrete Lautpoesie und Sinndichtung, die Innerlichkeit nach wie vor als Bewusstsein innerer Freiheit über äussere Natur versteht, aber anders als in naturbeseelter und naturmagischer Zeit nicht mehr als Projektionsfläche des menschlichen Bewusstseins verdrängt. „Beseelte Natur“, das Schlagwort der Klassik, Romantik und Hegel-Zeit, taucht in Klings „Öffentlichem Verkehrsmittel“ auf, als blödelnde Weisung an die Löcher, aus dem Käse zu fliegen. Kunst gewinnt ihre Stärke nicht mehr als utopisches Versöhnungsprogramm oder Gegennatur. Kunst ist Materialaneignung und freie Verarbeitung widerständiger Natur. „landschaftsdurchdringun’“ überschreibt er ein Gedicht, das den Künstler im Atelier der Natur zeigt. Die Annäherung führt zur Umarmung, nicht aber zur Verschmelzung. Das Gegenstück aus der Zeit empfindsamer Naturaneignung, das Bild vom August, der sich durchs Föhnfenster lehnt, ist als Intarsie eingearbeitet, eine zur Idylle ästhetisierte Natur. Ihr setzt Kling die Ansicht eines fieberhaft aufnahmebereiten Rechercheurs entgegen, der sich dem Sommer handgreiflich, stoffhungrig, materialsüchtig nähert, sensuell, nicht sentimental:
ich lecke di
achsel des sommers; der sommer ist eine frau.
Sprachatlas
Zu seinen Materialien gehört die Kernseife wie das Werk des amerikanischen Kunstmetaphysikers Barnett Newman, der Verkehrsfunk wie der Minnesang, die Busladung, Matratzen, Jogger, Altenpflegeheime, Tierlabore wie der kranke Hölderlin, wie Trakl, Paul Celan, das Bildnis der hl. Lucia, Joseph Beuys’ Rheinüberquerung oder die Bilder Palermos. Auf Reisen findet er es, die immer auch Sprachreisen sind, Reisen zu Sprachen, ob sie in die nächste Türkenkneipe oder nach Rom führen, auf die Uferauen des Rheins, Schrebergartenfeste, unter die Silberpudel und Regenhäute auf der Düsseldorfer Kö oder vor den Isenheimer Altar, in die Flick Collection oder die St. Petersburger Eremitage.
Der enge Zeitbezug macht sein Werk zu einem schier unerschöpflichen, zwischen Groteske, Karikatur und grosser Schönheit schwankenden Bilderbuch zeitgenössischen Lebens und zu einem immens reichen Sprachatlas der Gegenwart. Aber je hiesiger, dem Moment, dem Flüchtigen, Zufälligen, Banalen zugewandt seine Gedichte sind, desto radikaler ist der künstlerische Umwandlungsprozess. Wahrnehmung und die Konkretheit des ästhetischen Werks trennt ein Transformationsprozess, der den Augenblicksstoff härtet, indem er ihn, internen Kunstgesetzen gehorchend, tomographisch zerlegt, verbrennt, seziert. In seinem jüngsten Gedichtband, morsch, stellt er die Latenzphase künstlerischer Produktion dar. Aber der Kunstakt verwandelt sich in ein Naturschauspiel. Die Intensität der Übertragung verschmilzt die entgegengesetzten Bildbereiche von Atelier und Landschaft.
Der Wirkzusammenhang aus expressiven Energien, Gedächtnis und Bildidee, Erinnerung und Imagination, kurzum der Aufstieg der Wahrnehmung zur gesteigerten Wahrnehmung des inneren Auges verwandelt sich in einen Bach, der vom Felsen herabstürzt. Aber noch ist die Textader dünn, ausgetrocknet die Quelle, leer der Speicher, bis sich ein stämmeführender Hang in Bewegung setzt, bis schmelzende Eiszeitgletscher zu singen beginnen, bis der in der Papierwüste Schneeblinde in einem Augenblick höchster Erregung den ersten Strich setzt. Die Darstellung des Kunstakts ist selbst ein Kunstwerk, das demonstriert, wie sinnreich und sinnenreich neben ihrem Modell die imaginäre Wirklichkeit des Werks ist.
Wo, wie in der Kunstbetrachtung, der Gegenstand diese Eigenschaft selbst hat, können formal schlichte, monologische Gebilde entstehen. Das Bildnis einer Nonne aus der Schule Piero della Francescas etwa, es wird nicht angetastet. Aber wie im versunkenen Selbstgespräch der Betrachter förmlich mit sehenden Händen Kopf, Gesichtszüge, Figur erfasst und wie er Wahrnehmung und Erkenntnis in zwei Begriffen engführt, Gelassenheit und Ernst, wie er erkennend selbst kenntlich wird und ihr seinen Respekt erweist, der Frau, der Augustinerin, da ist sie geradezu mit Händen zu greifen, die Aura des Kunstwerks, sein Zurückweichen bei der Annäherung. Kunst im Spiegel grosser Kunst.
Sibylle Kramer, Neue Zürcher Zeitung
Poetische Kartographien
Ein „Itinerar“ ist ein Reisebuch mit Stationen, ein Straßenverzeichnis der römischen Kaiserzeit. Thomas Kling, der mit den Sprach- und Sprechvorführungen seiner Gedichte nochmals dem Avantgarde-Begriff zu Ehren verhalf, gibt über die Stationen der Lyrik Auskunft, in deren Traditionen er sich einklinkt: Neben den Autoren der Wiener Gruppe nennt er Walter Serner, Reinhard Priessnitz, den Dadaisten Hugo Ball mit seinen Lautgedichten, den sowjetrussischen Dichter Welemir Chlebnikow mit seiner „Za-um“-Sprache. Daß der Dichter sich aus allen erreichbaren Fach- und Sondersprachen versorgt, gehört zum Berufsverständnis; zumal Slang und Rotwelsch helfen dem Gedicht, sich dem Bann der überkommenen Sprache zu entziehen. Nichts nutzt sich schneller ab als der poetische Ausdruck, schließlich wird einem schon bei dem Wort „poetisch“ blümerant. Die etymologische und spracharchäologische Begeisterung teilt der Autor übrigens mit Zsuzsanna Gahse und Raoul Schrott; daran ist nicht Verwunderliches: Die Genauigkeit im Umgang mit den Wörtern schließt das Wissen um ihre Herkünfte und das Oszillieren der Bedeutungen ein.
Kling gibt eine Vielzahl von Hinweisen, allein er hält keine Vorlesung, sondern präsentiert sein Material fast stichwort- und katalogartig: Was er für das Kriterium eines gültigen Textes hält – mit einem „Minimum in Umfang und Zahl der Zeichen“ ein „Maximum in der Energie der Zeichen“ zu erreichen –, das scheint er auch für dieses Verzeichnis seiner Poetik zu beanspruchen. Daß er den Begriff „experimentelle Lyrik“ zurückweist, erstaunt nicht, assoziiert experimentell doch nicht zuletzt „Vages, Provisorisches, Vorläufiges, Unabgeschlossenes“. Demgegenüber gilt: „Gedichte sind hochkomplexe („vielzüngige“, polylinguale) Sprachsysteme. Kommunikabel und inkommunikabel zugleich: Hermes als Hüter der Türen und Tore, in diesen Eigenschaften des Doorman, Schleusenwärters und Botenstoffbeförderers tritt er in Erscheinung, ein Wirklichkeitsmixer, Reaktionsfähigkeit ist gefragt.“
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 516, November/Dezember 1997
Ein super Buch,
schmissig, kampflustig, von blitzender Intelligenz, höchst anregend, herzstärkend – ein Fressen für Sprachbegeisterte. Anders als der lateinische Titel und die unpopuläre Aufmachung (unifarbenes Cover mit hässlich plakativer Schrift) vermuten lassen, ist das hier kein Minderheitenprogramm, denn neben seiner sprachkünstlerischen Begabung besitzt Kling nicht zuletzt auch die Gabe des Entertainers. – Fast Food at its best.
Neben Texten zur Sprachinstallation – Klings Weiter- und Neuentwicklung dichterischen Sprechens in der Öffentlichkeit – stehen Essays zu einer frühen Performance Hugo Balls, zur Ars Poetica des Horaz, zum Slang (Umgangs-, Gauner-, Fachsprache, Dialekt) und zum Hermetismusbegriff, der nicht erst seit den 90ern dazu verwendet wird, moderne Dichtung als esoterisch, unverständlich und letztlich sinnlos zu brandmarken. Kling betont demgegenüber die kommunikative Absicht des Dichtens:
Das Gedicht baut ja auf Begegnung…
Mein 2002 gekauftes Exemplar stammt noch aus der ersten Auflage von 1997, die bei schätzungsweise Tausend gelegen haben dürfte. Kling wäre der letzte, der sich über die schwache Position des Gedichts (und seiner Poetik) im Lektürehaushalt der Leser aufregen könnte: „Ist es schlimm, dass das Gedicht, das Orchideenfach der Literatur, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte Orchideenfach war? Ist das schlimm?“
Ein Kunde, amazon.de, 8.5.2002
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Stephan Sprang: Ich mit Jodelgesicht
Rheinischer Merkur, 19.7.1997
Jörg Drews: Zinker, Memorizer, Sprachinstallateur
Süddeutsche Zeitung, 6./7.12.1997
Auch in: ders.: Luftgeister und Erdenschwere
Suhrkamp, 1999
Zum 1. April 2007
Des Todes Buchstaben
Deß Todes Anfang zwar bringt mit ein hartes T;
Das Ende zeucht nach sich alsdann ein lindes D;
Das Mittel ist ein O: es ist ein Augenblick,
So kümmt für harte Pein ein immer sanfftes Glück.
Friedrich von Logau
Meine Erinnerung hat die Stimme im Ohr, flüsternd lind, aufgerauht hart: „atemgelegramme“. Gedächtnis wird mir zum Speicher der Stimme, jener verlöschenden der letzten Tage des März vor zwei Jahren am Krankenbett, jener des sich so brutal plötzlich ankündigenden Todes, Monate zuvor am Telefon: unvergeßlicher Moment, Botschaft des noch unverstandenen Schreckens, Moment unserer lebenslangen Furcht und unseres immerwährenden Nichtwissenwollens. Stimmband, Stimmbruch, Stimmtod: „voice over“.
Vom Stimmkörper wußte er mehr als die meisten. Das leidenschaftliche Verhältnis, das Sprache und Stimme mit dem Gedicht pflegten, hat er unvergleichlich verkörpert. Gegen die dilettierenden Dichter, weil Stümper der Stimmführung, konnte er deshalb so toben. Ohne Anmaßung durfte nur er behaupten: „Die Stimme des Sängers verleiht dem Gedicht seine Autorität“.
Seine Stimme, der Tonfall seiner „vokalen Aktion“ war ihm Instrument, seine Lyra, mit ihr hat dieser moderne Sänger den Tonraum geschaffen für das, was nicht mehr in die Sprache paßt. Erst die Stimme läßt unhörbare Sprache hörbar werden: „Klinggedichte“ (und der Kenner der Barockdichter wusste genießend, dass diese ihre Sonette so ,klingend‘ genannt haben). Und wenn Thomas von der verstummenden Stimme noch einmal sprach, dann hat er nicht nur vom eigenen Tod sondern auch vom Tod des Gedichts gesprochen. In seinem „Gesang von der Bronchoskopie“, in seinen letzten Gedichten, hat er sich selbst ganz konsequent zum Vivisekteur seiner Atem-, seiner Stimmorgane gemacht. Ganz ohne Sentimentalität, ganz kühl und „arnikablau“, Patient seiner selbst, schrieb er seinen Abschied vom Gedicht ins Gedicht. Für uns alle ist er noch ein letztes mal tief ins Bergwerk der Sprache hinuntergestiegen:
Wohinein ins
unvermutete das
liecht sich verliert.
Christian Döring, aus: Heidemarie Vahl und Ute Langanky (Hrsg.): den sprachn das sentimentale abknöpfn, Heinrich-Heine-Institut, 2007
Drei Texte zur Dichtung Thomas Klings
1. Einleitung!
Dichterinnen haben es nicht leicht, müssen sich ständig rechtfertigen, was sie da tun und mit 30 bis 40 bringen sie sich in der Regel um. Ich möchte länger leben. Ich lag mit 21 auf Bahngleisen und dachte, es wäre vorbei. Übrig geblieben ist eine Photographie, gelassen, wie ich das fertig gebracht habe, erzählt Ihnen besser jemand wie Blake, der hatte häufig Visionen in seinem Leben, dann konnte er keine Fliege von einem Engel unterscheiden, und ich bin eine große Verehrerin von Blake. Der Typ, der das Photo gemacht hat, litt an Hyperaktivität und konnte keine 10 Meter von 100 unterscheiden, deshalb mochte ich ihn total. Gedichte sind Lebenserfahrung, und Kinder können irrsinnig gut dichten. Als ich anfing, zu schreiben, las ich Friederike Mayröcker und Thomas Kling wie meine Bibel. Man hatte mich als heranwachsendes Mädchen sehr verletzt, mein Bruder war ein gewalttätiger Spinner, meine Mutter eine furchtbare Moralistin, mein Vater arbeitetet und ich eine schimmernde Discoqueen. Darüber will ich Romane schreiben. Vielleicht drehe ich mal einen Film. Als Kind, egal wie wichtig man sich nimmt, ist man winzig klein im Verhältnis zur Welt, wie Alice. Es ist absurd, wenn Kinder in einer Gesellschaft unter Bedingungen leben müssen, in denen sie keinen Schutz und keine Achtung bekommen. Das ist meine Vision. Es gibt so etwas wie Verrat, das passiert dann, wenn du morgens aufwachst und du lebst immer noch am selben Ort und keiner zeigt dir den Weg da raus. Ich liebe Texte, die das tun. Die zum Angreifen sind und intelligent gemacht. Mayröcker kann ohne Unterlaß von sich erzählen, das besitzt eine Ehrlichkeit, die besticht. Ich mag es, mit ihr zu reden.
Du darfst dich als Mädchen nicht verlieren. Fünfzehn ist zwar ein undankbares Alter, du liest die Droste und Internatsromane, siehst aus wie siebzehn und behandelt wirst du wie dreizehn. Niemand redet darüber, aber irgendwann beginnst du dich zu fragen, warum du solange als Engel und Unberührbare in den Discotheken herumläufst, dabei habe ich Rilke sehr gemocht: eine Kore ist, so könnte man es vergleichen, das Mädchenbild in der griechischen Mythologie schlechthin, sie spielt eine Frau, sie verkörpert sie nicht. Mythologisierte Abbilder derselben gibt es en masse, die Monroe ist Schatten der Göttin der Unterwelt und konservierte Prinzessin par excellence, Leonardo DiCaprio steigt gerade zum ewigen Jüngling auf. Ist die Grausamkeit des Körpers erstmal überwunden, beginnt man umzudenken und verliebt sich nicht mehr, außer in Frauen oder jüngere Liebhaber. Das stülpt die Geschichte um, und du kriegst endlich Herz für die Dinge. Auch ein Gedicht sähe anders aus, substantieller, ehrlicher. Else Lasker-Schüler war freizügig, nicht besoffen. Thomas Kling wird heute von Ute Langanky photographiert, sehr konkret. Ich sah ihn das erste Mal in Wien im Novemer 1997 nach einer Lesung. Man hatte mir zugeraunt, er sei ein guter Dichter. Das wußte ich. Ich dachte, ihn kennenzulernen sei ein Defizit, aber das stimmt nicht. Ich mag ihn wegen seiner Konkretheit. Um neu zu beginnen. Ich sage: mein Leben ist meine Kunst. Eine Kunst der Feier und der Bühne. Eine Kunst der Glaubwürdigkeit und des Trostes. Das muß Spaß machen. Nicht mehr, nicht weniger. Jede(r) kann das. Bei der letzten Dichterlesung habe ich laut gelacht, es gibt so schlechte Literatur. Wenn ich schreibe, meine ich es doch ernst. Und mein Leben ist alles.
2. Binnentext!
1
goebbelz zeigefinger (’… wird
ihnen das freche judenmaul gestopft
werdn’), sein danach cool auspen-
delnder unterarm; erneut schwingt der
hoch, der arm: aus dem handgelenk ge-
schüttelte hand, dem publikum gewiesener
handrücken GREIFHAND NACHTERGREIFUNG, SEINE AUS-
SCHWITZ-GRAZIE: EIN PROPAGANDA-
INSTRUMENT
GOEBBELZ hoch- und nieder-
sausende finger… draht, gas und‘
Sartre schreibt in seinem 1947er Pamphlet „Was ist Literatur?“ es „sei denn die Bewegung der Hand“, die den Prosaisten vom Dichter unterscheidet, anders formuliert: Er ist kein Epigone. Kein Stefan George. Aus der Punkszene entstanden, eifriger Produzent, Besserwisser und Sprachaufreißer, verfolgt er keinen bourgeoisen Anspruch, sondern sich als Kunstwerk. Dichter zu sein, ist sein Merkmal, ebenso ein politisches Kriterium, in der Schwebe zwischen elle/lui & lui-même, Produkt seiner Zeit. Genauso wie es ihn gibt, gibt es ihn nicht, als Zeichenhalter der Öffentlichkeit figuriert er zum Jugendidol: als angry young poet tritt er bei den ersten Kölner Lesungen auf, angefangen hat er im Düsseldorfer Punkszenelokal Ratinger Hof, er ist im Gespräch in der jungen Literaturszene: hast du den schon…? lies mal… etc. Der David Bowie der Literaturszene, Jean Genie Kling hält nicht viel von Dichterlesungen:
Dieses zum Teil aggressive Lesen ist wesentlich daraus entstanden, daß ich mich halt unglaublich geärgert habe über Literaturlesungen, das Glas Wasser, dieses Raunen, dieses absolut Asexuelle. Das ist ja eine Unverschämtheit der Sprache gegenüber. Manchmal muß man bei Lesungen einfach erstmal mit dem Abräumhammer drangehen. (im Interview mit Marcel Beyer, Konzepte Nr. 10, 1990)
Von Edith Sitwell, der Lady der britischen Lyrik, wohl als Exzentriker bezeichnet gewesen, schlägt er im Gegensatz zu Morbus Kirsch avantgardistisch zu. So jemanden braucht die Welt. Wake up your sleepy hand (Bowie). Seine Hand ist der Punkt, von dem aus hier gedacht ist, ein aktiver Körperteil als ein Signifikant für personnage Thomas Kling, die es lohnt, näher in den Blick zu nehmen, als männliche Attitüde auf Lesungen nicht unwitzig, auf vielen Photographien zum Naturell gefroren, seine Schreibhand bleibt den Damen im Bild. Seine Dichterimago eröffnet ihre ganze Raum- und Zeitdimension in Bildern der Presse und des Widerstandes, die sich in Artikeln wie die eines Burkhard Müller in der FAZ (Nr. 78, 2. April 1998) – gemeint ist Klings moderne Catull-Übersetzung Das Haar der Berenice – sehr anschaulich einschreibt. In kleinen Happen wird Kling väterlich demontiert, bis Müller es schafft, privat und schamlos zu werden:
Dem Bändchen beigegeben ist eine Reihe von Bildern von Ute Langanky. Was immer diese abstrakt aquarellistischen Gebilde an sich sein mögen, in diesem illustratorischen Kleinstformat wirken sie diffus und ratlos; sie leisten dem Text von Thomas Kling, der seinen Catull nach Belieben zerschneidet und mißhandelt, kongeniale Gesellschaft.
Es handelt sich um eine Form von Öffentlichkeit, die Klings und Langankys gedoppelte Unnachgiebigkeit etwas uncharmant und nicht sehr vorsichtig umkreist. Die Affinität des deutschen Feuilletons für Verrisse ist Inhaberin eines neuen Objekts, das Lang- und Jahre im Raum voraus ist. Blakes on Mars! (Raketenstation Hombroich)
Die Presse wird den Dichter zu Beginn seiner Entdeckung in unterschiedlichen Posen der zarten Coolness zeigen, Arm vor dem Körper angewinkelt oder auf dem Knie abgelegt, Zigarettenhalter und schlechthin Körperwaffe. Young and useful. The Empire strikes back. Arme in Motorradjacke (mit Zigarette) zeigen ihn auf einer der ersten Photographien für die Presse (Photo: Schiffer-Fuchs). Jahre später zeigt Suhrkamp sein Gesicht, eine Photographie von Ute Langanky. Darauf ist er im Viertelschatten zu sehen, von unten photographiert, klassisch. Kling wirkt und winkt fern zu uns herunter. Sehr gelassen. Die körperlich fragmentierte Imago, Klings, so darf man sagen, Lieblingsimage, so eignet man sich ein Objekt an, reproduziert sich im Feuilletonismus, dieser fährt das Bild des neuen „Rimbaud“ und kühl kalkulierenden Denkers ein:
Die bislang sanften Augen geraten ins Rollen, das blonde Haar fliegt nach vorn. Aus dem nachdenklichen 36jährigen wird ohne Vorwarnung eine Art leibhaftiger Kinski… (Westdeutsche Allg. Zeitung, Nr. 53, 1994); Den sarkastisch kalten Blick hat er an den frühen Gedichten Gottfried Benns trainiert, seine Technik eher an Jandl, Mayröcker und Oskar Pastior… (Kölner Stadt-Anzeiger, Nr. 110, 1989).
Neben den Augen als altes Symbol für die göttliche Allmacht, nach Mattenklott ist besonders der kalte Blick Zeichen der Moderne und für den Protagonisten von E.A. Poes The Tell-Tale Heart ein Mordgrund, Klings Blick wird so mit Gefahr verbunden, kommen große Begrifflichkeiten in Umlauf:
Dem Phänomen [sic!] Thomas Kling versucht nun Detlef F. Neufert in einem ungewöhnlichen Beitrag des Landesspiegel […] auf den Grund zu gehen (Westfälische Rundschau, Nr. 146, 1991).
Besagte PhänoMENe, geht man einmal davon aus, man hat es mit Phänotypen zu tun, somit das Erscheinungsbild eines Organismus, das durch Erbeinflüsse und Umwelteinflüsse geprägt wird, sind, wie bereits festgestellt, einerseits durch biologische Merkmale geprägt, andererseits spielt das kulturelle Feld und dessen Praxis mit dem „Geliebt-Ungeliebten“ eine nicht unentscheidende Rolle, ich zitiere Pierre Bourdieu im Gespräch mit Hans Haacke, welcher dem Künstler, frei von Romantik, eine elegante Form von strategischer Ambition zuspricht:
Es gibt so etwas wie Zensur durch Schweigen. Wenn man eine Botschaft vermitteln will und keine Resonanz bei den Journalisten findet, wenn man es nicht schafft, die Journalisten zu interessieren, wird sie nicht verbreitet. […] Hier ist die spezifische Kompetenz des Künstlers sehr wichtig. Denn man kann nicht Effekte, die Überraschung. Erstaunen, Verwirrung hervorrufen, einfach improvisieren. Der Künstler ist derjenige, der Aufsehen erregen kann. Was nicht heißen soll, daß er auf Sensationen aus ist wie unsere Scharlatane im Fernsehen, sondern daß er Analysen, die den Leser oder Zuschauer durch die Strenge des Begriffs und der Beweisführung gleichgültig lassen, in die Sphäre der Empfindung überträgt, wo die Sensibiliät und die Gefühle hausen.
Gefühlvolle Breaks lassen sich vermehrt finden, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz im horaz’schen Sinne ist Kling in vorderster Reihe daran beteiligt, die Öffentlichkeit zu delektieren. Der Autor zieht öffentlich und bereitwillig auch noch das Register des Ordinären:
Das muß knallen. […] Es soll ins Gesicht spritzen, nicht unbedingt verstanden werden. Das Klima muß rüberkommen, so wie ein Kind heiß, warm oder kalt empfindet… (Westdeutsche Allg. Zeitung, Nr. 53, 1994).
Die Psychonanalytiker/innen und Poetessen unter Ihnen werden ihrer Phantasie freien Lauf lassen können. Sigrid Süss von der Rheinischen Post konstatiert: „Danach ist man ganz erschöpft“, und meint damit die Folgen einer Live-Performance, die Kling in seiner 1997 erschienenen Poetik Itinerar, souverän begründet, „Sprachinstallation“ nennt, um dem Begriff „Performance“ eine Alternative anzubieten. Süss folgert aus dem A/E – ffekt:
[…] Kling ist kein Lehrling der Zauberei, er ist ein Meister.
Und zitieren wir an dieser Stelle doch direkt einmal den hier verklausulierten Goethe:
Der Zauberlehrling.
[…] Seht, da kommt er schleppend wieder!
Wie ich mich nur auf dich werfe,
Gleich, o Kobold, liegst du nieder;
Krachend trifft die glatte Schärfe.
Wahrlich! brav getroffen!
Seht, er ist entzwei!
Und nun kann ich hoffen,
Und ich atme frei!
Wehe! Wehe!
Beide Teile
Stehn in Eile
Schon als Knechte
Völlig fertig in die Höhe!
Helft mir, ach! ihr hohen Mächte!
Und sie laufen! Naß und nässer
Wird’s im Saal und auf den Stufen.
Welch’ entsetzliches Gewässer!
Herr und Meister, hör’ mich rufen! −
Ach, da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd’ ich nun nicht los.
Master Kling bringt es fertig, die flüssigen Urgewalten und G.punkt’s steife Peepshowgeister (Kobolde), wir haben es hier mit einem Höhepunkt zu tun, sprachlich zu besänftigen, der Effekt bleibt nicht ungenannt:
Man fühlt den geblümten Rock, sieht die behaarten (!) Augen, hört die Kröten krächzen. Mitfühlen, Mitgefühl, Mitdenkfreude werden geweckt.
Das spricht von einer gelungenen Katharsis ganz im Sinne des Pop, würde Kling einen Rock tragen, Haare auf den Augen haben und wie zehn Kröten aussehen. Aber wie man ja aus dem Märchen weiß, Sigrid, haben Tiere aus der Familie der Froschlurche die Fähigkeit zur Verwandlung. Ziemlich irre. Wow!
Der Dichter Thomas Kling ist 1957 im Rheinland (Bingen) geboren, schreibt seit 1986 offiziell, seine Stationen waren: Düsseldorf, Wien, Finnland und Köln, jetziger Standort ist die „Raketenstation Hombroich“ bei Neuss. Die Reproduktionsmaschinerie registriert eine „Furcht vor Festlegung plus einen Studiumabbruch (Germanistik // osteuropäisch Geschichte), zuvor hieß es in selbigem Artikel (Kölner Stadt-Anzeiger, Nr. 24, 1994), Klings Gedanken zur Schriftstellerei, auch wenn er sich gelegentlich theoretisch äußere, fügten sich niemals zur „festen Poetologie“, was heute als überholt gelten kann. 1990 erhielt er das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln, 1994 den Else-Lasker-Schüler-Preis, 1996 den Peter-Huchel-Preis. Die Vermeerung der Sprache bei Thomas Kling von der Friederike Mayröcker ja bereits geschrieben hat, geschieht durch die weitgefächerte Splittung Klings der Sprache in Slangs, einer genauen Registratur von Natur & Moderne, zu Fuß reisend wie ein 24-jähriger Hopkins, und Körperlichkeit, da lächelt Barthes’ Lust am Text mit, vor allem in dem 1996 erschienenen morsch zu lesen. Was bei dieser Brechung (Cut-up) entsteht, ist ein neuorganisches Gerüst von Sprachfetzen, ich sage: eine wirkliche Bereicherung und genaue Hingabe an fühlsichtbarer Literatur. Space Oddity. Die Zukunft dieses modern-naturalistischen Verfahrens läßt sich nicht abstreiten. Im Interview mit Beyer kommt ein Zorn über die Verrißpraxis eines großdeutschen Pressekonzerns dann auch deutlich zur Sprache (zugetragen im Cafe Laumer, Buchmesse 1989):
Joachim UnseId war auf 180, weil der Schirrmacher (FAZ) ihm wieder mal angedroht hatte: „Am Montag wird ein Suhrkamp-Autor verrissen“, so nach dem Motto, ,aber ich sag noch nicht, wer‘. Und da hatte ich die Nase voll. Schirrmacher saß im Lokal mit zwei intellektuellen Body-Guards in einer schummrigen Nische. Da bin ich zu ihm hin und habe gesagt: „Entschuldigen Sie, sind Sie der Herr Dr. Schirrmacher?“, schon so in einem Waffen-SS-Ton, und er fragte seine Jungs panisch: „Wer ist das? Wer ist das?“ Da habe ich gesagt: „Hören Sie zu, ich spreche jetzt mal für die jüngeren Suhrkamp-Autoren, und ich wollte Ihnen mitteilen, wir haben uns schlossen, Sie ernstzunehmen.“ Dann habe ich mich auf den Absatz umgedreht und bin gegangen. Da ist natürlich für alle Zeit der Ofen aus.
„Statt dessen sind es die Schärfen einer ausgefeilten Sprachartistik, mit denen Thomas Klings Lyrik in kompromissloser Expressivität zubeisst“ (Neue Züricher Zeitung, Nr. 1991). Mehr ist dem nicht hinzuzufügen, außer das Gedicht selbst, gemeint ist Goebbels, nämlich Hitlers Propagandamaschine, dessen Sprache der Dichter im Mundraum aufhören läßt, aus dem Herrschaftsdiskurs und Literaturmarkt ausgetreten, mit noblesse, die Simulation vollzieht sich am eigenen Beispiel, im Interview wie folgt:
Kling: Ich bin einfach jahrelang der angry young poet gewesen. das werde ich mit 60 anscheinend noch immer sein.
SZ: Aber diese angry young men werden irgendwann auch gesetzter.
Kling: Dann zeigt sich eben die Absurdität solcher feuilletonistischen Simulation.
und:
2
gebisse.
3. Schlußmonolog auf Stoff!
oh ja, see everything through your magnifying glass… man muß eine wahnsinnige Toleranz besitzen, mit den Taxifahrerinnen! Eben kaufte ich mir Itinerar. Ja, „Spracharchäologie“ scheint das richtige Wort zu sein, Schneearbeiter & -räumer, plus, plus, „Guten Tag meine Damen und Herren, willkommmen im Autoreisezug nach […], unsere Schneearbeiter servieren Ihnen kleine Snacks & Ketchupschläfe! am Platz“, weshalb ich Ihnen im Zug schreibe, sehen Sie denn ab und zu Tracey Emin? David Hockney? Pop. Weiße Herzhüllen. Polaroid-Reliefs! Nicht die verrotteten Bahnhöfe, die rot-weiß gestreiften Häuserfronten, Mosaikbeton! -raus! Dort hatten sie sich verteilt, aus dem Fenster gelehnt. Ins Naturkarrée! Ladies am Bahnhof! Alte, einsame Typen und Bahnhofstussis! Outiders. Mich als Gräfin in einer alten Bahnhofsvorstadt, das träumte ich! Fluxkondensator in Raum und Zeit, Flyer! & einen Schnupfen holt man sich bei dieser Geschwindigkeit, fast reading speed & lowering down! WILDISCH! Berge: ran! & ranzoomen! rennendes Gallopp & Haar, verwundbar, die Ketchupwunde an der Schläfe nimmt man mit (schrieb F.M.), und Priessnitz, das auch: Rehhaare, Gallopp & Finnisch! helle Letter, weiße, glühende, phosphorisierende Letter! Ja, da schlägt nichts, kühl bis ans Herz hinan, da glüht nur der klinische Herzstrang, Verstärker! Baum! Krone! Vermeer!… look at this: schon graues Haar? Maria! Flanellhosen, kariert, trag ich nicht, nee, der is älter, aber hübsch wie eine Discoqueen… Eine Hagelkornkindheit, klein, klein, Alice, in der geöffneten Handtasche, hinein! dann wächst was in Ihnen: Reliefe! Bord-Service! geht wagnerianisch voll ins Großformat, nur Annette & ihre Hopkinstiraden: man hatte mir Reakreation gewünscht für diesen Sommer und den kleinen Tod… dies ein Sprachbewußtsein, da lebt es rot und roter im Karton, Zeichen Himmel, Schneeflocken, Scherenschnitt! Kindheit! Hinauf! Im Karrée! Karréehimmel! Knallige Postkartenintimität! Oh ja, manche dieser Wörter hätte ich gern selbst geschrieben. Sie FLUXKONDENSATOR! Ja. Da sitzen wir nun. Im Gebirge. Ziemlich einsam. Jetzt sind wir mittendrin, auf der Strecke geblieben. In den Alpen. Im Gedicht: mein Poesiereservat. Dunkel. Farbig. dancing queen! Wild! Weit hinaus. Unverzichtbares TIMING. Noch o.k.? Zungenkrone. Warteraum. Binnenraum Text. Binnentext. & ihre Brauen! im Schnee. stromernde alpmschrift. Sieh nur. Klangzipfel. Rhythmus! Pay! Pay! -inz: rocking! Aquädukt über den wir fahren, der Zug darüber, holpert um die Kurve, blau, balau, blaues Zimmer der Jugend & eine blaue Tür: wohin? Azurplastiktütengrün! Die Sentimenz war damals immens (Brinkmann). Sinnlichkeit im Glanzformat, Schneecke anstatt -flocke, da schreckt man nicht zurück. Kleine Wolke kam auf, dann Wiederholungston: freeze frame. Stiller Atem. Stilles Gold, was das glitzert unter dem Text. Ich seh’s. Sehen Sie hin: Licht! Einfallhöhe! Augennähe! Die Elemente der Sprache in Evokation: I wanna have an appartment in here: 40 qm², Küche, Bad, starwoman in the sky… Alleinige Weiterfahrt: im Tunnel. Türen & dunkel. Nr. 117 passiert. Timing? Dänisch. Ich wachse da hinein, sage ich Ihnen. Letter! Palimpseste! & 3 xxx für den ganzen Kitsch von Sprache. Diese falschen Tatsachen. Immer noch nichts passiert, keine STORY, I’m sorry, nur Schlittenspuren von Hufen im Schulkinderalter, DIE ARME NOCH GANZ STEIF VOM LANGEN FLUG, begonnen hat er mit Ranzenlyrik. Dafür bin ich ja da, als Dichterin, um aufzumachen. Zug, bunt, real! Eine alte Autobahn nebenan. Exquisite Montour! Kühles Flanier. Gelände. Silbenplan. Tag! Nacht! Typ mit Regenschirm, Marke KNIRPs. AN: habe ich da irgendwann mal angedockt? Wie Püppchen im Schlafrock? Jeanskragenaufstellung in weiß? Nur alter Trick. Radierung! Zorn! Laß uns so weiterleben, im Kunstwagen durch die Wüste, durch die Hotels, durch die Welt, um so besser zu verstehen, lebendig zu sein und nicht so furchtbar ernst wie Schopenhauer… the exploration of the soul! the awakening red, red flower of life! All die jungen Künstler/innen leben meilenweit und mit Herz, sagt sie, meine Gräfin, so long, long, ja.
Annette Brüggemann, manuskripte, Heft 140, 1998
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


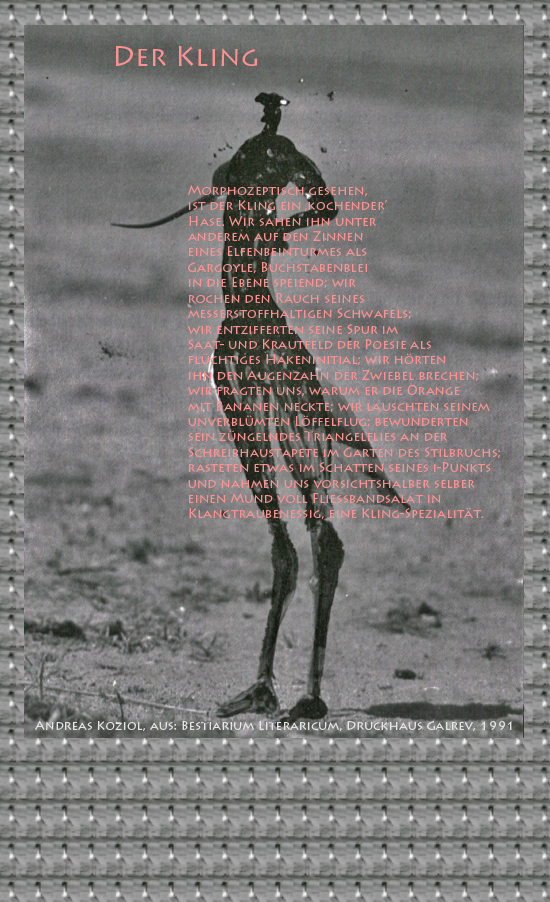












Schreibe einen Kommentar