Thomas Kling: morsch
GEWEBEPROBE
der bach der stürzt
ist nicht ein spruchband
textband weißn rau-
schnnz;
aaaaaaaschrift schon;
der sichtliche bach di
textader, einstweilen
ein nicht drossel-, nicht
abstellbares textadersystem,
in rufweite; in auflösnder
naheinstellun’.
aaaaaaaaaaaabruchstücke,
ständig überspült; über-
löschte blöcke, weiße schrift-
blöcke und glitschige, teils,
begreifbare anordnungen: ein un-
unterbrochn ununterbrochenes.
am bergstrich krakelige unruhe
und felsskalpell. schäumendes
ausschabn.
aaaaaaaaabezifferbarer bach,
der bach der stürzt: guß,
megagerinnsel, hirnstrom.
Wir verbinden mit morsch das Brüchige,
das Mürbe und Zerfallende. Wortverwandt ist der ‚Mörser‘, das Gefäß zum zerstoßen und zerkleinern von harten Stoffen; verwandt ist ebenso ‚Mörtel‘, Bindemittel zum Bauen. Über all das belehrt das Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache, und der „polylinguale“ Dichter Thomas Kling kennt den Reichtum unserer Sprachspeicher: „Die Sprache meinen und von der Sprache gemeint werden.“ Die Gedichtbücher des Spracharchäologen Thomas Kling, die ein „textadersystem“ eint, sind für eine nachwachsende Autorengeneration stilbildend geworden. Und daß Sprache Haltung ist, Wahrnehmung und Weltsicht, darauf verweist auch das neue Gedichtbuch morsch. In dessen Gedichten „auffächernder sprachgenerationen“ wird die Ordnung der Worte manipuliert – um neu zu erstehen. Dem Gestus des Sprachzertrümmerers begegnet die Dichtung des Thomas Kling souverän: die Freilegung der Sprachgründe und Abgründe ‚bindet‘ die Worte neu, begründet unser Sprechen. Das „verschriftlichte blickn“ der Gedichte aus morsch empfiehlt sich als „vorbildliche demontage“ wenn in der „rangeschraubtn ferne“ von Geschichte und Geographie, intimen Szenarien, Literatur und bildender Kunst der kalkulierende Rechercheur Thomas Kling unsere Erkenntnis bereichert.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1996
Semantik im Mundraum
„den sprachn das sentimentale / abknöpfn“. Das hat er uns in seinem vorletzten Gedichtband (brennstabm, 1991) versprochen und angedroht. Unerbittlich und kompromisslos ist er inzwischen den Weg der sprachlichen Demontage und Entzauberung gegangen. In nacht. sicht. gerät. (1993) liess er uns Augen und Zungen schulen für den ächzenden, zischenden, stammelnden Konsonantensturz seiner Lyrik. Nun legt er seinen neusten Gedichtband vor und schreibt darüber – programmatisch – morsch.
Der 1957 geborene und in Köln lebende Thomas Kling gehört fraglos zu den herausragendsten deutschsprachigen Lyrikern. Mit dem nur ein Jahr älteren Kurt Drawert verbindet ihn ein sublimer moralischer Impetus, während er mit dem um fünf Jahre jüngeren Durs Grünbein den unbedingten ästhetischen Intellektualismus teilt. Doch sein sprachlicher Rigorismus lässt keinen Zweifel daran, dass das Epizentrum seiner Lyrik in Wien liegt.
Ein bei Reinhard Priessnitz entlehntes Motto weist hier den Weg: „die rede, die in schrift flieht, / kein entkommen“. Das Wort als gesprochenes in die Schrift zu retten und dort als immer wieder zu sprechendes bewusst zu halten: damit könnte der Kern von Thomas Klings Lyrik bestimmt werden. Seine Gedichte lassen sich wohl lesen, aber man muss den Sprachklang vor allen Dingen hören und das Schriftbild anschauen. Es sind sinnliche Ereignisse. Das Verfahren zur Rettung des gesprochenen Worts in der Schrift hat Kling bei Ernst Jandl gelernt: „PRRVRRS!“ schrie er uns in geschmacksverstärker (1989) entgegen. „abstrrzz“ hören wir nun, stolpern über das ungewohnte Schriftbild und spüren auf der Zunge den Aufprall: Semantik im Mundraum.
Nun also morsch. Von der damit angedeuteten Zersetzung ist womöglich weniger die Sprache selbst als vielmehr die Artikulation und die Wahrnehmung betroffen. Man würde den erkenntnisreichen Impuls von Thomas Klings analytischer Lyrik entschärfen, sähe man darin bloss den Ausweis eines jüngst wieder in Mode gekommenen, metaphysisch verklärten Sprachskeptizismus. „AUGNROST“ und „BLICKKORROSION“ sind Symptome einer Wahrnehmungskrise. Und wo Kling „morsche palisadn“ im „mund raum“ lokalisiert, macht er allerdings beim Sprechenden eine Funktionsstörung namhaft. „mundfäule“, „maulsperre“ oder gar „zungnverlust“ nennt er nun, wofür er im letzten Gedichtband die Formel „ke-, kehlenaas“ geprägt hatte. Selbst ein „vermorschtes rohrsystem“ kann nicht als Indiz einer verrotteten Sprache genommen werden: es weist lediglich darauf hin, dass in der Semantik nicht Verhältnisse kommunizierender Röhren, vielmehr solche der Osmose herrschen. Manche möchten da die Sprache insgesamt verwerfen, denn wäre so nicht „das schreim, zuletzt, verbenloser / rauch“? Kling hält dieser gekränkten Eitelkeit ein eigenwilliges und durchaus paradoxes Programm entgegen: „schrifterosion, damit kein / missverständnis entsteht“.
Die „schrifterosion“ ist komplementär zur „BLICKKORROSION“: sie provoziert natürlich das Missverständnis. Sie nimmt es aber nicht in Kauf, wie die esoterischen Rauner, sondern beteiligt die Lesenden an dessen Beseitigung. „WIR INSTALLIEREN HIRN VOGELHERD.“ Wer „HIRN“ als phonetische Umschrift von „hier einen“ entschlüsselt, vollzieht zwar, wozu das Gedicht verführt: „fangherd, also, von di augn“ – und entgeht doch dem in der Falle ausgelegten (zweideutigen) Köder; nur „vögel fliegn drauf“. So führt das Gedicht vor, dass das erodierte Schriftbild zwar das Auge in die Falle lockt, doch zugleich den Leser (bzw. dessen „Hirn“) zur hermeneutischen Leistung (ver)führt, die das Missverständnis klärt. Im sinnlichen Ereignis, wo Schrift und Laut kollidieren, hat sich ein Sinn freigesetzt.
Thomas Klings Gedichte sind hochartifizielle Konstrukte, die die Bedingungen ihrer Produktion und Rezeption stets mit reflektieren. Da werden Sätze zerlegt, Worte seziert, Redensarten blossgelegt, verklommene Figuren zu Palimpsesten überschrieben: die Verfremdungen wecken im Wiedererkennen – irritierend – Erinnerungen. Wie auch immer Thomas Kling seine Sprache benennen mag (die Auswahl reicht von „synapsn-slang“ über „nicht / abstellbares textadersystem“ zu „poly- / linguales geschau“): es ist keine neue Sprache, die uns lehrt, aber er lehrt uns einen neuen Blick auf die vertraute, doch im Grunde so fremde, befremdliche Sprache.
Die sich ergebende „stimmstörung“ ist das Gegenstück der im Schriftbild geronnenen Verstörung, hervorgerufen durch das Gegenständliche, das diese Lyrik dann durchaus und allerdings benennt: die Ermordung Walter Serners im Konzentrationslager; der Selbstmord Ernst Trollers im „mundraum“ New York; im Gedicht „schmerzzentrum kolmar“ ein Epitaph für die ermordete Schriftstellerin. Anstrengungslos freilich ist diese Lektüre nicht zu haben. Das Gedicht „dermagraphik“ zeigt Archäologen bei ihrer Arbeit über zerstückelten Tierhautinschriften. Ihr Verfahren ist ohne Einschränkung übertragbar auf die Lektüre dieser Gedichte:
blindflug in den palimpsest-
wust
Die leise Selbstironie macht uns Thomas Klings Lyrik – neben der Bewunderung, die wir für sie hegen – liebenswürdig.
Roman Bucheli, Neue Zürcher Zeitung, 1.10.1996
Aufbruch der Zeilen
Spätestens seit den 50er Jahren zieht es die Dichter entweder in die karge Wüste linguistischer Selbstbezogenheit oder nach New York City; warum auch immer. Thomas Kling ist Dichter, und Thomas Kling war in New York. Und wie es bei Dichtern so Brauch ist, bringen sie Gedichte mit:
die stadt ist der mund
raum. die zunge, textus;
stadtzunge der granit:
geschmolzener und
wieder aufgeschmo-
lzner text.
„Manhattan Mundraum“ – die Ouvertüre zum Eingangszyklus in Thomas Klings neuem, mittlerweile sechsten Gedichtband morsch. Der Klappentext und eigentlich der Kluge belehren uns, daß hier nicht nur das Brüchige, Poröse und Tote mitschwingt, sondern dass in „morsch“ auch der Mörser am Werk ist, der zermahlt, zerstößt und zerreibt, um schließlich aus all dem Pulverisierten einen Mörtel zu gewinnen, mit dem sich trefflich Neues bauen läßt. Und so wird auch die Wahrnehmung der Stadt New York zunächst bedingungslos dem Mörser überantwortet, wobei die Wahrnehmung zuallererst als eine akustische erscheint: „die heizkörper keuchn“; der Klang als Material, „eine mindere menge / tritt aus ausm ventil, kocht dort, verkocht und / geht in luft auf: textus.“ Der Titel ist natürlich Programm und formuliert, wie jeder einzelne der Texte Klings, die grundlegende Poetologie gleich mit als „textband weißn rau- / schnnz; // schrift schon;… nicht / abstellbares textadersystem“ („gewebeprobe“).
Mit morsch, so scheint es, hat Thomas Kling sein Schreiben im „synapsn-slang“ perfektioniert. Mit beeindruckender Souveränität verfügt er über sein Arsenal an poetischen Gestaltungsmitteln: Kaum einer bricht derzeit virtuoser Zeilen auf- und um, bewegt sich leichter durch das permanente Wechselspiel von Demontage und Rekonstruktion, dem Beschaben und erneuten Überschriften verwirrender Palimpseste. Was dabei in seinen frühen Arbeiten leicht in den Verdacht einer effekthascherischen Marotte geriet, die annähernd phonetische Schreibweise, das Ausstanzen der Vokale, das Trommelfeuer der Konsonanten, steht mittlerweile gänzlich ausgebildet da, als personaler und methodisch plausibler Stil. Die Texte erschließen sich erst, wenn man auch hört, was man da liest. Nicht umsonst hat sich Thomas Kling in Lesungen immer wieder vor allem als eines dargestellt: als begnadeten Performer. Gerade morsch aber zeigt, wie sehr es ein Trugschluß ist, zu denken, Kling operiere in seiner Lyrik primär mit der Mündlichkeit, der Lautgestalt einer gesprochenen Sprache (gänzlich verfehlt wäre es, ihn – à la mode, der hierzulande wie immer etwas verspäteten – in den Kneipenhumus der slam poetry zu verpflanzen). Die lautliche Umschrift ist nur ein Werkzeug unter anderen, die stumpfe, verkrustete Oberfläche der Sprache aufzubrechen, um in die Tiefenstruktur einer nahezu unabsehbar verzweigten Textur hinabzutauchen. Für den Raum des Gedichtes bedeutet dies, was es immer schon bedeutet hat – und Kling versichert uns aufs neue einer solchen, wenn auch in einer radikal gewandelten techné, noch immer aktuellen Möglichkeit des Schreibens −, daß nämlich der lyrische Text immer auch Selbstvergewisserung seiner eigenen Geschichte ist, bis hin zur alten und ältesten Schrift.
So schreibt sich auch wie selbstverständlich, ohne den leisesten Anflug von Prätention, in Klings höchsteigenem Idiom ein Gesangsfragment der Sappho neu, schleicht sich ein behutsam ironisierter Pastoralenton in die scheinbar so eiskalten Konstrukte, oder es findet von den fernen Bergen des Libanon das biblische Hohelied herüber in ein sehr gegenwärtiges und beinahe schon zärtliches Liebesgedicht:
helles schattnzeug
der stimmen, es regnet jetzt, getriefe, goldlack (wi gesacht) der
frühe, so redn wir. das licht jetzt, deiner augn,
wie ein ritz im granatapfel.
Es ist eben „stimmschur“, der zentrale Abschnitt des neuen Bandes, der Thomas Kling in einem bisher kaum bekannten Tonfall sprechen läßt: Unter das zynische Bellen, das vor allem aus dem wirkungsvollen geschmacksverstärker (1989) tönte, hat sich ein hochsensibles Flüstern gemischt, das zuvor nur zu erahnen war, sich aber schon jetzt um einiges hartnäckiger im Ohr festgesetzt hat.
Nicolai Kobus, literaturkritik.de, Februar 2000
Zungenkunst
Noch Gottfried Benn konnte meinen, das moderne Gedicht sei primär Schrift, nämlich schwarze Letter auf weißem Grund. Vorlesen galt ihm als magerer Ersatz. Heute, vierzig Jahre nach seinem Tod, stellt sich das Problem doch wohl anders. Bei mehr oder minder spektakulären Auftritten versuchen Poeten, das marginalisierte Gedicht in der Konkurrenz der Medien zu behaupten. Lyrik ist damit auch eine Sache der Stimme, ja des Körpers geworden. Wird das Gedichtbuch demnächst durch die Lyrik-CD, den Lyrik-Clip ersetzt? Werden die „Slam Poets“ und die „Spoken-Word-Gemeinden“ den schreibenden Dichter und das lesende Publikum verdrängen?
Das sind Fragen, die gegenwärtig durch die etwas schüttere Lyrik-Diskussion geistern. Doch noch immer erscheint das meiste an ernstzunehmender Lyrik in Druck und Buch, hängen Ruf und Ruhm der Dichter von den traditionellen Medien ab. Andererseits gibt es ja Dichter, die faszinierende Vorleser sind. So Ernst Jandl als furios-witziger Schulmeister oder der hintergründig-spielende Oskar Pastior, dessen Exerzitien man auf Anhieb zu verstehen glaubt. Jedenfalls solange er vorliest. Warum also die Sache nicht gleich vom Mündlichen her aufzäumen? Vor allem unter den jüngeren Autoren zeigt sich die Neigung zu einer neuen Oralität, werden Lyrik-Lesungen zu veritablen Performances, scheinen sich die alten Prioritäten zu verkehren.
Star dieser experimentellen Lyrikszene und selbst schon schulbildend geworden, ist Thomas Kling, heute ein Mann Ende Dreißig. Anfang der achtziger Jahre sensationierte er die Zuhörer durch seine ersten Auftritte, und noch immer wirken seine Lesungen mit ihrer weiten Skala zwischen Brüllen und Flüstern, Ekstase und Ironie wie die einzig authentischen Interpretationen der Sprach-Partituren seiner Gedichtbücher. Erprobung herzstärkender mittel war 1986 sein Debüt. brennstabm von 1991 zeigt seine Schreibweise voll entwickelt. Morsch, sein neuestes Buch, ist bereits sein fünfter Gedichtband. Was verrät er uns über die Entwicklung des Autors – was über die Frage von Schrift und Laut?
Thomas Kling hält seine von Anfang an geübte Dialektik von Schrift und Rede auch in seinen neuen Gedichten offen. Zunächst schon typographisch durch die Beibehaltung einer quasi phonetischen Schreibweise mit ihren Kontraktionen und Eliminierungen, wie sie von Anfang an zu Klings „Sprachinstallationen“ gehört. Wir lesen, was wir hören. Also etwa diesen Gedichtanfang:
SELEKTIERENDE ANLAGN: gesichzkreis,
im nahbereic’ fahndnde augn.
Freilich gibt es in dem neuen Buch auch Zeilen, die – abgesehen von der obligaten Kleinschreibung – völlig ohne „schrifterosionen“ auskommen.
Daß Klings Welterfahrung vor allem oral und auditiv vermittelt ist, demonstriert schon das Eingangsgedicht „Manhattan Mundraum“, das die Stadt als ungeheuren Kosmos von Sprache und Geräusch auffaßt. Darin das entscheidende Organ:
dies ist die organbank von manhattan. seht
ihre zunge: geschwärzter eingeschwärzter o-ton.
Auch im Schlußzyklus, in „romfrequenz“, ist es die Lingua, die ihn interessiert:
dies abgekochte rom; dem geben wir, zart,
seine zunge zurück. di wächst rom zwischn
den zähnen heraus.
Doch in allen Texten Thomas Klings gibt es ein kaum minder starkes gegenläufiges Moment, das Moment der Schrift. Die älteste etruskische Schrift – so zitiert er Mommsen –, kenne die Zeile noch nicht und winde sich, „wie die schlange sich ringelt.“ Damit möchte auch etwas vom Ideal unseres Lyrikers getroffen sein. Wie Klings Zeilen sich ringeln und winden, wie er mit Enjambements, mit Sprüngen und Zersplitterungen umgeht, virtuos, auch maniriert, das wird man kaum hören, man muß es schon nachlesen. So holt die Schrift den Dichter ein. Oder mit einer Formulierung von Reinhard Priessnitz, die einmal als Motto erscheint:
die rede, die in die schrift flieht,
kein entkommen.
Auch die „KLING-GEDICHTE“ – so des Autors selbstironischer Terminus – zeigen die Schrift, den festen Buchstaben als Zufluchtsort.
Morsch – so lautet der Titel des Bandes. Das möchte Befürchtungen in bezug auf seine Haltbarkeit wecken. Aber der Klappentext verweist darauf, daß nicht bloß das Brüchige und Zerfallende von Sprache gemeint ist, sondern auch die Potenz des „Mörsers“ und die Nützlichkeit des „Mörtels“. In den neuen Gedichten überwiegt der Mörtel, das Konstruktive, gibt es eine gewisse harmonisierende Tendenz. Deutlicher als früher benutzt Thomas Kling Themen und Elemente der Tradition. Der Zyklus „vogelherd“ versteht sich als eine Folge von „microbucolica“. Und hinter Kürenberg und Vergil geht Kling noch weiter zurück. Die wenigen Zeilen von „sapphozuchreibun’. nachtvorgang“ erweisen sich als Paraphrase von Sapphos wunderbarem Fragment, dessen Anfang Herder so wiedergab:
Der Mond ist schon hinunter.
Hinab die Siebensterne.
Und da schon Natur und Eros angespielt sind, möchte ich sagen, daß der Leser, den Klings Virtuosität auf Distanz hält, hier und da Zeilen findet, aus denen Zartheit und Zärtlichkeit spricht. So gibt es in dem bukolisch getönten Text „stimmschur“ Verse, die eine erotische Situation zeichnen:
in nässe zungnredn, eindringlicher gesang. das
is doch nich zu laut oder?
Nein, das ist nicht zu laut. Es zeigt diskretes Gefühl. Nicht immer also hält sich Kling an die Bennsche Maxime, das Material „kalt“ zu halten. Mir scheint: nicht zum Nachteil seiner Leser.
Harald Hartung, als: Es ringelt sich ein Gedicht, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.11.1996
Die Dresdner und die Kölner Kunstausübung
die stadt ist der mund
raum. Die zunge, textus;
stadtzunge der granit:
geschmolzener und
wieder aufgeschmo-
lzner text…
So gehen die ersten Zeilen des längeren Textes „Manhattan Mundraum“. Thomas Kling, der gleich Durs Grünbein mit einem New-York-Gedicht urbaner Moderne seinen Tribut zollt, beginnt mit ihm seinen fünften Gedichtband. Zeilen, die symptomatisch sind für das Sprach-Welt-Bild des Autors wie für seine Wort-Bild-Schaltungen. Bevor dies im einzelnen, wenn auch in gebotener Gedrängtheit, zu erörtern ist, noch ein paar Beispiele. Der stürzende Bach im Gedicht „gewebeprobe“ wird u.a. benannt als „ein nicht drossel-, nicht / abstellbares textadernsystem“, als „guß, / megagerinnsel, hirnstrom“. Im Zyklus „Vogelherd“ hören wir von „SPRACHSTRÄHNEN, LEIM; die lockere ge- / fangnschaft“; thematisiert wird hier wohl auch, auf Reinhard Prießnitz eingehend, das Verhältnis von Rede und Schrift. Von der Vogel- in die Unterwasserwelt:
silbngezappel zappelndes silber im
bodenlosn, gehievt. schleppnetz zunge; richtig glitschig alles.
(„schlick“)
Welchen Gegenständen sich Kling auch widmet, häufig werden wir rückverwiesen auf den Text selbst, auf die Sprache, genauer: das Sprechen. Denn dieser Lyriker betreibt kein Sprach-Werk, sondern ein Sprech-Werk; die (gemäßigte) phonetische Schreibweise seiner Gedichte hält uns an, sie vor uns hin zu sprechen. Dieses Sprechen ist nicht kontinuierlicher Redefluß, nicht Ausdruck einer quasi ganzheitlich fühlenden Individualität; hier wird vielmehr Fraktur gesprochen, und schon die typographische Gestalt der Gedichte bietet die Ansicht des Abgehackten und Zerstückelten. Nicht die Fertigkeit der Sprache wird ausgestellt, sondern die Unfertigkeit des Sprechens demonstriert, seine Sprung- und Ursprunghaftigkeit. Kling agiert als Zung(e)nzeuge einer Wirklichkeit, die als Zeugnis mehr oder minder heftig aufeinander einwirkender Kräfte, als Gewirktes und Verwirktes im Text erscheint.
Die Kontinuität der (geschichtlichen) Realität ist eine der Brüche und Schnitte; die Formel „tomographie-im-zeitraffer“ („Manhattan Mundraum“) beschreibt Klings poetisches Verfahren in einem wesentlichen Punkt. Der sich schichtenweise ablagernde „Abrieb der Geschichte“ wird gemustert, vergangenes Geschehen wird als Stückwerk und Wort-Bruch im Text archiviert. Im Unterschied zur Erlebnislyrik, die dem Leben und Erleben eines Ichs nachsinnt, sind wir mit groß- und weiträumigen Prozessen konfrontiert, in denen das Individuum nur Partikel im Geschiebe ist. (Allerdings kommt dem Menschen die Potenz der Erkenntnis zu, der Text selbst ist Zeugnis dafür.) Die Funde und Befunde werden oft in kurzen Wort-Bild-Notizen wie in einem Protokoll mitgeteilt, in gleichsam stenographischen (Geschichts-)Abrissen. Man könnte von einer Art wissenschaftlichem Verfahren sprechen, wären nicht die Schlüsse, die der genau beobachtende und recherchierende Augenzeuge zieht, Kurz-Schlüsse, die sich dem poetischen Hirngewitter von Assoziation und Imagination verdanken. Die Kompaktheit des Mitgeteilten, seine mehrfache Kodierung, die Überblendungen der Sach- und Sprachbereiche verleihen manchem Gedicht einen fast hermetischen Zug. Zusammen- und Ineinanderfaltung der Bild-Gedanken charakterisieren sie, zur Entfaltung und Entzifferung ist der Leser angehalten, zugemutet wird ihm die Anstrengung forschenden und nachforschenden Spuren-Lesens, lexikalisches Nachschlagen inbegriffen.
Gesellschaftsgeschichte verläuft sich in Naturgeschichte, jedenfalls ist sie alles andere als Heilsgeschichte ständiger Vervollkommnung, sie wird vornehmlich im Verkommen, im Modus des Verwitterns und Verfallens wahrgenommen. (Erinnert das Titelwort „morsch“ nicht an mors?) Auch die das Ganze und Heile ausstellenden Kunstwerke führen nicht zur Levitation, sondern unterliegen der Schwerkraft historischen Untergrunds; das Stilleben beispielsweise – nomen est omen – ist dem Tod verschwistert; die andere Seite der Kunst – „die hungerndn sind nicht im bild“ – scheint auf im Röntgenblick [„GOYA, LACHSSCHEIBEN (,notlachs‘)“]. Keine Aussicht auf Lösung und Erlösung von zerstörender Geschichte, nicht erheben wir uns, Schmerz und Schwere hinter uns lassend, ins Reich des Geistes. Die Signatur derjenigen, die sich in die Geschichte eingeschrieben haben, ist ein Zeichen der Gewalt. Von Pizarro, der Peru „abkehlte“, ist die Rede:
dem man, dem don,
auf schriftstücke ein blechstück pla-
zierte, die namensschablone pizarro
ein kratzn, kratznder kiel.
Der Bogen wird geschlagen zu einem Kriegs- und Eroberungsschauplatz neuester Geschichte im Gedicht „nordkaukasische konsonantn“, der Tod als „zungnbrecher“.
Daß Kunstausübung nicht allein ein geistiges Unternehmen ist (was zumal in der Wortkunst gern vergessen wurde), demonstriert Kling in praxi: auf der metaphorischen Ebene („blickspeichelinstallation“, „schnappnde netzhaut“, „augn-nadelkissen“ reißen schmerzhaft die Dimension des Dinghaften und Instrumentellen auf) wie im Vortrag selbst in mechanisch-unpersönlichem, nicht organisch-persönlichem Sprechen. Der Weltinnenraum ist verlassen, die Welt in ihrer Faktizität, ihren Zuständen und Abfolgen ist der Fall; so verdanken sich die Draufsichten und Naheinstellungen der Gedichte Klings vielen und unterschiedlichen Gelegenheiten und Realitätsbezirken. Die Texte haben mithin auch unterschiedliches Gewicht, weisen verschiedene Verdichtungsgrade auf. Doch die Konsequenz, mit der Verfahren und Botschaft in Klings Wort-Zeugenschaft einander gehören, ist einem jeden abzuhören.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 511, Januar/Februar 1997
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Basse, Michael: Ezechiel, ich, wirr in der Leinwand
Süddeutsche Zeitung, 1.10.1996
Jürgen P. Wallmann: Erneuerte Sprache
Rheinische Post, 12.10.1996
Thomas Linden: Manhattan wird zum riesigen Mund
Kölnische Rundschau, 31.12.1996
Augensprache, Sprachsehen
− Thomas Kling im Gespräch mit Hans Jürgen Balmes (Mai 1998). −
Hans Jürgen Balmes: In einer Notiz zu deinen Texten zu Wolkenstein, aus Wolkenstein und von Wolkenstein aus, schreibst du von einem „hörtext, der texte und textsequenzen des – wörtlich zu nehmen! – weltreisenden wolkenstein einbezieht… Sprachaufnahmen, langzeit- und doppelbelichtungen: meine annäherungen an den erfahrenen einäugigen dichter und scharfblicker im gegenlicht retrolenten Sprachsehens“. „hörtext“ und „sprachsehen“, das Akustische und das Visuelle, welche Beziehung besteht zwischen beidem?
Thomas Kling: Die Begriffe der Doppelbelichtung und das, was sich alles fachsprachlich den neueren modernen visuellen Medien verdankt – von der Daguerreotypie angefangen bis zum Film mit seinen Schnitten, Video usw. −, sind mir insofern wichtig, als das, was ich in den 80er Jahren als Sprachpolaroids bezeichnet habe, über die Augenblicksaufnahmen eines Brinkmanns hinausgeht. Es geht mir nicht um eine Aneinanderreihung, also das, was der Fotodokumentarist eine Strecke nennen würe, sondern tatsächlich um diese Doppelbelichtungen, also tief in die Sprach- und Wortgeschichte, in die Kulturgeschichte hinein.
Balmes: Dieses Sprachsehen wäre dann vor allem ein akustisches Wahrnehmen und ein in der Schrift reflektiertes Erkunden.
Kling: Richtig. Das Sprachsehen würde bedeuten, daß der Dichter das, was er schreibt, nicht nur semantisch durchleuchtet, sondern daß ihm die ganze Rhythmik klar ist.
Balmes: In dem Gedichtzyklus „Manhattan Mundraum“ gibt es zwei Begriffe, die diese Doppelbedeutung aufspannen, der „palimpsest“ aus den übereinander geschriebenen Stadtsprachen von Lorca und Majakovskij, also etwas Visuelles, und der „textus“, das Evaporierte der Poesie, das den Heizkörpern entweicht, also etwas Unsichtbares.
Kling: Der Textus als direkter Hinweis auf das Evangeliar – also Schrift als ein, profan gesagt, ursprünglich Heiliges: der Text, der sich in seiner Geschichte verdampft, aber spürbar und behandelbar bleibt. Und das Palimpsest ist das direkt Manuelle dieses Abkratzens in jeder Hinsicht, es bedeutet das Abgekratzte wieder aufzunehmen, die darunterliegenden Schichten wiederum in Doppelbelichtungen aufzunehmen, das, was der Vorschreiber benutzt hat.
Balmes: In den Gemäldegedichten, und von ihnen gibt es inzwischen in deinen Büchern eine ganze Serie, fällt mir auf, daß das Visuelle den Aggregatzustand ändert, flüssig wird. Wenn ich zum Beispiel an „GOYA, LACHSSCHEIBEN (,notlachs‘)“ denke, dann kommt es mir vor, als wenn in der Ansprache des Bildes die Ansprache möglicher Betrachter, die Goya über die Schulter geschaut haben könnten, mit einbezogen wird, und damit der Vorgang des Sprechens in das Bild hineingelegt und das Bild dynamisiert wird.
Kling: Man könnte sagen, daß diese Form des Sprachsehens im Gemäldegedicht durchaus etwas Reportagehaftes hat. Durch die Möglichkeiten, die sich durch den Abstand von mehreren Jahrhunderten ergeben, müssen wir uns einen klaren Blick auf den Verfasser des Gemäldes verschaffen. In nacht. sicht. gerät war Sigmar Polke der zeitlich jüngste bildende Künstler, um dessen Arbeit ich mich gekümmert habe: um sein Bild aus den 80er Jahren mit dem Titel The Copyist – ein kopierender Mönch, der in der freien Landschaft sitzt, aber zurückgezogen an seinem Schreibpult sich direkt in den Text hineinkniet, die Vorlagen direkt abschreibend, kopierend – das ist etwas völlig anderes als eine Zitatenhuberei, die so oft in der bildenden Kunst und Literatur thematisiert wird.
Balmes: Es ist ein Motiv der Gemäldegedichte, daß die Sprache über das Gesehene in Gang kommt, das statische Bild aber nicht in einer Überschau gezeigt wird. Auf ähnliche Weise werden in morsch Blickfragmente zu konstituierenden Elementen der Verse, ich denke vor allem an „vogelherd mikrobucolica“, wo etwas Auseinandergestreutes nicht zusammengefaßt – es gibt keine Überschau über die Vitrine Vogelherd −, sondern jedes Detail für sich sprachlich untersucht wird.
Kling: Ja, es werden verschiedene Themen in diesem komplizierten längeren Gedicht untersucht, die von Teil zu Teil ineinander übergehen, sie sind ja von 0-12 durchnumeriert. Wie zumindest bei allen längeren Texten hatte es dazu vorher eine Recherche zum Motiv des Vogelherds gegeben, also der Vogelfangstation und ihrer Fachsprache. Dabei hatte ich einen Text von einem Heimatschriftsteller der rheinisch-bergischen Region zur Verfügung, der in den 20er Jahren noch aufgezeichnet hat, wie er mit seinem Vater auf Vogelfang gegangen ist – ein ethnographisches Thema, heutzutage nicht nur für Städter, sondern auch für die Leute, die auf dem Land wohnen, auf dem Dorf lebt ja kein Mensch mehr. Das war der Ausgangspunkt. Heinrich de Vogeler spielte da natürlich mit hinein, der Rückgriff auf den Minnesang. – Zum Gesangsaspekt gibt es in einem Text eine Parallelaktion, wo in der linken Spalte kursiv aus Brehms Tierleben ein Ornithologe, ein oder zwei Generationen vor Brehm, zitiert wird, der, was ja sowieso schon absurd ist, die Sprache der Nachtigall beschreibt, und rechts läuft dazu, wieder von einem Ornithologen oder Brehm selber, eine Beschreibung dieser onomatopoetisch wiedergegebenen Gesangsstruktur der Nachtigall, also des ungreifbarsten Lieblingsvogels spätestens seit dem Mittelalter. – Dazu kommt Albrecht Haller mit seiner Anatomie, also nicht nur der Begründer des Alpentopos in der Literatur Anfang des 18. Jahrhunderts, sondern auch der Zergliederung des Körpers, und das bedeutet hier die Zergliederung des Gedichtkörpers, was, und das muß in aller Deutlichkeit gesagt werden, nie etwas mit der Zerstörung des Gedichtes und seiner möglichen Sprachen zu tun hat oder hatte.
Balmes: Ich sehe darin eher eine Freilegung, genau das, was man unternimmt, wenn man einen archäologischen Vogelherd in Schichten abträgt, um zu rekonstruieren, was zu welcher Zeit hier wie gefangen wurde.
Kling: Vollkommen richtig. Was uns nur noch von barocken Speisekarten ein Begriff ist wie zum Beispiel der Krammetsvogel, ist ja ein Nahrungsmittel gewesen, und nicht etwas, was wir nicht erkennen könnten – es kann ja kein Mensch mehr eine Drossel von einer Ulme unterscheiden.
Balmes: Ich hatte bei den Nachtigallen-Passagen in „vogelherd“ den Eindruck, daß der Vogel sich durch seinen Gesang selber röntgt – vielleicht als Assoziation zu dem Gedicht von Ted Hughes, in dem er darstellt, daß eine Lerche eigentlich aufgrund des krassen Mißverhältnisses zwischen Körper und Lautstärke an ihrem Gesang zerplatzen müßte. Dieselbe verzweifelte Wucht, mit der gesungen wird, und der poetisierte Empfang, auf den wir uns eingestellt haben, werden in deinem Gedicht gegeneinander geschoben, damit eine Reibung entsteht, die Nähe herstellen kann zu diesem Vogelherd.
Kling: Neben der Vogelthematik wird das Synthetische des Arrangements am Bild des Food-Stylisten bzw. einer Potjemkinschen Installation, quasi eines Filmsets, hineingebracht. Es geht um eine „abtastbare“ oder „eingescannte“ Heide, in der der Text, also das, was mal Naturgedicht war, heute ausschließlich nur noch stattfinden kann; es geht also nicht um eine Wiederbelebung eines naturmagischen Ansatzes Marke Lehmann, sondern um diese Schnittstellen, um diese Übergangssituationen oder das, was als Gesichtskreis mit allen seinen Organen, also wohlgemerkt auch der Sprache und des Sounds, gemeint ist. Artaud spricht einmal im Zusammenhang mit Coleridge vom Gedicht als einem hübschen Schluckauf.
Balmes: Diese Freilegung ist als Arbeit dem entgegengesetzt, was du an anderer Stelle einmal den „Zungenschwund“ genannt hast: „Alles ist Archiv, alles ist im Begriff, Archiv zu werden und in Rauch aufzugehen. Es ist ein Pidgin des Sehens, das auf den immer fremden, auch den vermeintlich eigenen Gegenstand fällt. Das Sprechen über Gesehenes ist Verkehrssprache, die sich aus zahlreichen Sprachkanälen, alten wie neuen, speist“. Zahlreiche Sprachkanäle, das bedeutet, daß immer zahlreiche Sprachen ineinandergeschnitten werden müssen, um den Punkt zu erreichen, wo Sprache präzise wird, damit man heute noch über die Nachtigall reden kann, ohne bei der Schalmei zu landen.
Kling: In „vogelherd mikrobucolica“ – also einem Text mit Vergil, von dem die Beschreibung der Bienen stammt, die aber einen ganz anderen Code der Verständigung pflegen – wird ja auch der Begriff des „null-quellbezirks“ eingeführt, was nichts mit der nach 1945 von der Gruppe 47 steif und fest behaupteten Stunde Null des neuen westdeutschen Schreibens zu tun hat, sondern der „null-quellbezirk“ ist der Schreibausgang meiner Generation ab den 70er Jahren gewesen. – Eigentlich kommt die Generation eines Waterhouse, eines Czernin oder eines Schmatz aus einer toten Zone des Bilderverbots. Auf der einen Seite begrenzt von der platten Alltagssprachlichkeit, auf der anderen Seite von den konkreten Exerzitien. Wir mußten uns da ein neues Gebiet freischlagen, jeder auf seine Art.
Balmes: Bei deinem Ansatz habe ich immer das Gefühl, daß du im Quellhorizont selbst arbeitest. Es gibt ja auch andere Autoren, die den gleichen Druck des Materials empfinden, aber erst anfangen zu schreiben, wenn es als Gerinnsel schon wieder unten im Tal ist, sich Bilder angeheftet haben und sich die Konvention in die Sprache eingeschlichen hat. Das ist das Radikale an deinem Ansatz, der anders radikal ist als zum Beispiel der von Peter Waterhouse, der mit seinen Bildern eine positive Subversion erfunden hat, wenn er aus Autorücklichtern Blumen macht und die Ampel in die Naturlyrik bringt.
Kling: Ja, bei mir ist es tatsächlich ein zielgerichtetes Herumstapfen zum und ins Quellgebiet hinein, und da darf man keine Sorgen haben, daß man sich nasse Füße holt. – Peter Waterhouse hat ja nun wirklich diesen Übergangsraum zwischen Stadt, Vorstadt und Restnatur beschritten und sich und uns eröffnet als einen Raum des Sehenswerten.
Balmes: Wobei der Rhythmus, dem er folgt, ganz anders funktioniert als der Rhythmus, den du in diesem Quellgebiet als Wünschelrute benutzt. In unserem ersten Gespräch 1994 hatten wir das erzählend-rhythmische Element von deinen frühen Gedichten besprochen, nun habe ich den Eindruck, daß sich dieses Element auf der Ebene des Bildaufbaus wiederfinden läßt – in der Art, wie du Details des Vogelherds ins Gedicht nimmst, sie ablauschst, vor Augen führst. Es entsteht eine hermetische Struktur, die immer neue Bilder, immer neue Fundstücke auffindbar macht. Da ist etwas Neues entstanden, das die Referenz an Vergil noch einmal radikalisiert, denn Vergil ist der Erzähler der Biene, der erste Imker. Mich hat der Aufbau von „vogelherd“ sehr stark an Catull erinnert, an die großen Gedichte wie „Das Haar der Berenice“, das du übersetzt hast, wo auch von einer schwer nachvollziehbaren Position aus gesprochen wird – die Locke im Firmament, die berichtet, wie sie zum Sternbild wurde – und wo ganz langsam Details aufscheinen, Bilder konstruiert werden, um diese Verwandlung und ihre Vorgeschichte darzustellen. Bei „vogelherd“ hatte ich so das Gefühl eines Umspringens – von dem erzählenden, in einem anderen Sinn von der Reportage angeregten Hören zur Rekonstruktion eines Sehens, wobei der Blick die Distanz nicht überbrückt: es sind keine emphatischen Gemäldegedichte in romantischer Tradition. Dieses Verfahren hat sehr viel von der Arbeit eines Restaurators, der sich verschiedene Beleuchtungsverfahren bereitstellt, um die übereinanderliegenden Malgründe auseinanderzudividieren und die ganze Komplexität des Gemäldes in verschiedenen Schichten abbildbar zu machen.
Kling: Es geht mir in jedem Fall, um das komplexe Bild des Restaurators aufzugreifen, um die Auffindung einer ersten Untermalung mit Entwürfen, die oft schon fertige Stücke sind. Und wir haben nun einmal alle diesen einen Untergrund, auf dem wir zu arbeiten haben – als Dichterinnen und Dichter.
Balmes: Der Vorwurf der Zerstückelung wird deinen Gedichten gegenüber oft von Leuten erhoben, die selbst normativ arbeiten und für die das „Sprachkunstwerk“ ein Stück Tortenguß ist. Sie merken gar nicht, daß sie damit, so sprachkritisch-reflektiert sie auch auftreten, zu Totengräbern der Moderne werden, weil sie konstruktiv nichts beitragen. – Du sprachst von dem „Untergrund, auf dem wir alle zu arbeiten haben“ – ist der vergleichbar mit dem „disegno“, der Vorzeichnung für ein Fresko auf der gerade gekalkten Wand, auf der jetzt der Rhythmus das Sprechen und das Schreiben langsam in Gang setzt, unterwegs zu einem Gedicht?
Kling: Ja, das ist die eine Möglichkeit, und dann geht es ein in eine Arbeit des Restaurierens. Vor allem in einer Epoche der Restauration, an deren Anfang wir jetzt stehen mit all ihren literarischen Gemütlichkeitserscheinungen; es ist wichtig, solche alte Stellen auf den Wänden wieder freizulegen, das heißt, es muß Putz abgeschlagen werden, man kann da nicht in einer rigiden Richtung denken und weiterarbeiten, wie das in den beiden Deutschland nach 1945 der Fall gewesen ist. Wir haben es ja im Ganzen bloß mit Brecht und Benn und deren Wurmfortsätzen zu tun, wobei ich bemerken möchte, daß mich die wirklich aufgeräumten Petitessen à la Enzensberger nie interessiert haben – ich war ja bekanntermaßen eher nach Österreich ausgerichtet −, genausowenig wie, um dem Herrn Erwähnung zu tun, Peter Rühmkorf nämlich, der es mit der Eleganz eines Kartoffelsacks immer geschafft hat, die Kellertreppe hinunterzupoltern. – Wir müssen also verschiedene Traditionsstränge heute beachten, wenn wir dem Gedicht überhaupt noch eine Chance lassen wollen, und das ist an meiner Arbeit von je her der Sprachansatz der verschiedenen Völker und Zeiten gewesen, also durchaus ein Herderscher Sammleransatz unter Ausklammerung der Didaktik.
Balmes: Das beschreibt die Konstruktion und das Kalkül deiner Herangehensweise, auf der anderen Seite leben deine Texte sehr von der Unmittelbarkeit, mit dem der Moment des Gedichts erfahren wird, und zwar so, daß er nicht als abgeschlossener Schnappschuß vor einem liegt, sondern daß man beim Lesen dem Prozeß des Schauens über die Schulter blickt – ganz deutlich bei dem Gedicht „Manhattan Mundraum“, wo es keinen Rahmen gibt, in den das nur allzu bekannte Bild von Manhattan hereingeschwenkt würde, sondern wo Manhattan nachgestellt wird. Die Unmittelbarkeit entsteht aus der Prozeßhaftigkeit des Dichtens und nicht durch die vermeintlich unmittelbare Einschaltung eines wie immer lyrischen Ichs – die Szene gehört dem „Memorizer“, dem Palimpsest, den Abkratzungen und Restaurierungen.
Kling: Womit die sogenannte Freiheit des Individuums in den Blick kommt. Beim Memorizer, der mit vorgeformtem Material arbeitet, ist die Freiheit die Art und Weise oder der Stil, und zwar nicht nur der Wortwahl, sondern auch der Gestik, der Mimik der Sprache, mit der diese Plots bearbeitet werden.
Balmes: Unmittelbarkeit wäre dann die Rückkopplung zwischen dem Memorizer, seinem Material und dieser Gegenwart, in der jetzt, hier beides zusammen spricht…
Kling: … und der Leser- und Hörerschaft, wäre zu ergänzen.
Balmes: Womit wir dann bei den letzten Sätzen aus Itinerar wären: „Kopfjägermaterial Gedicht. / Wobei Augen, Mund, Ohren in die Netze gehn.“ – Das setzt ein anderes Konzept von Synästhesie voraus als das der symbolistischen Tradition, hier bedeutet es eine Aktivierung der Wahrnehmungsfähigkeiten des Lesers oder Hörers, die mir eher verwandt scheint mit der Schärfung der Bewußtseinsebenen, wie sie die Kunst der siebziger und achtziger Jahre angestrebt hat – Turrells Entdeckung des „leeren“ Lichts als Gemälde, Robert Morris und der Raum, um einige Beispiele zu nennen, die mir deiner Arbeit näherzuliegen scheinen als die Verschränkung von Adjektiv und Substantiv um eines synästhetischen Effekts willen. Dem white cube, der in der Arbeit der Künstler in seinen Dimensionen transparent und als Raum erfahrbar gemacht werden sollte, entspräche bei dir der vielschichtige Sprachinnenraum des Gedichts, der sich an den Leser/Hörer wendet.
Kling: Es geht sicherlich nicht darum, dem Publikum erratische Blöcke vorzuknallen, was den Symbolismus kennzeichnen würde, in dem man das Gedicht als Schmetterlingsflügel hat – wenn der Leser da drankommt, verfällt das Material zu Pulver. Darum kann es nicht gehen. – Die Worte sollen vollkommen unhermetisch ein Eigenleben beim Leser entfalten, in allen Valenzen, die durch den Zusammenhang vorgegeben sind und die sich aus dem Forttreiben des dichterischen Textes ergeben. Also auch von Buch zu Buch.
Balmes: Die Unmittelbarkeit des poetischen Aktes ließe sich dann als eine Form der Offenheit bezeichnen, in der man der in Gang gesetzten poetischen Arbeit der Worte folgt, ihr eine Gegenwart gibt und diese Gegenwart als Einheit dem hinzuaddiert, was bisher als Werk vorliegt. In diesem Sinn sind deine Bücher jeweils für sich stringente Einheiten und gleichzeitig Kapitel eines großen Buches. So wie in morsch die „Stadtpläne, Stadtschriften“ von „Manhattan Mundraum“ den einen, die kritischen Nach- und Nahaufnahme des Nachtigallentopoi in „vogelherd“ den zweiten Pol bilden, die zu einer komplimentären Einheit zusammentreten und den Band deutlich von dem letzten unterscheiden: nacht. sicht. gerät, wo einer der Schwerpunkte das Rheinland als Herkunftsland, als Sprach- und Kunstraum war, daneben stand dann die „stromernde alpmschrift“.
Kling: Ja, eben durchaus als künstlicher Sprachraum, als künstlicher Reflexionsraum, das ist eine Folie, auf der aus der Erinnerung heraus gearbeitet werden kann. Für nacht.sicht.gerät bin ich auch zu einzelnen Orten gefahren und habe wieder recherchiert. So kann eine Textinszenierung erst geschehen, durch eine Ortsbegehung, durch eine Geistesraumerfassung, die durch Archivarbeit gesteuert ist. Wenn von mir über einen Ort wie New York, hier speziell Manhattan, gesprochen wird, so mit einem naturgemäß europäischen Blick. Ich würde es mir nicht zutrauen, etwas über Harlem oder Brooklyn zu sagen, wenn ich es einmal so eingrenzen soll, das heißt, ich weise auf Traditionen eines modernen europäischen Sehens an den Beispielen des Spaniers Lorca oder des Russen Majakovskij hin. In einem Amerikatext von Majakovskij gibt es die Sicht auf den Querschnitt eines Skyscrapers, eine Durchsicht auf das, was in den einzelnen Etagen synchron passiert, und das halte ich für eine äußerst zeitgemäße, auch jetzt zeitgemäße Art, eine Parallelität zumindest ansatzweise zu schildern, ohne in das sich verselbständigende Quellgemurmel des weiland „stream of consciousness“ zu verfallen.
Balmes: Mit der Spracharbeit des Restaurators ähnelt deine Herangehensweise sehr der von Paul Celan, der ebenso eine Vorliebe hatte für abgelegene Fachsprachen, für seltene Wortfügungen, wir finden Anleihen an Jean Paul – auch bei dir. Dein Umgang damit ist aber eher trocken zu nennen, „brütt“.
Kling: Ja, und um tiefer noch zurückzuschreiten, da ist das kulturgeschichtlich, sprachgeschichtlich unglaublich interessante 17. Jahrhundert, dem sich ja heute auch zunehmend – Stichwort Kryptographie – die Philosophen annehmen, das wird jetzt sehr aufgearbeitet. Nichts ist so angesagt wie das 17. Jahrhundert, und da kann man nur sagen, daß ein H.C. Artmann, der sich bereits vor 1960 mit den Themen des „Barock“ befaßt hat, schon da natürlich äußerst modern war. Denn was in den 60er Jahren als Skurrilität eines Außenseiters gesehen wurde, der einen Fanclub um sich versammelt hatte, wird nun in seiner Bedeutung sichtbar, da die Zeit und Raum übergreifenden Leistungen eines H.C. Artmann klar zutage liegen, dessen Bedeutung ja auch ein Jandl frei genug ist einzuräumen als den Stern nach 1945 in der deutschen Dichtung.
Balmes: Dieses Wiederaufleben des Interesses am 17. Jahrhundert hängt eng damit zusammen, daß Text, Bild und Mathematik als Unendlichkeitsspiegel, als Unendlichkeitsgeneratoren diskutiert worden sind und man damit einen Punkt markiert hat, der sich heute in der medialen Vervielfältigung von Wirklichkeit widerspiegelt. Die Polarisierung der Geschichte der deutschen Lyrik nach dem 2. Weltkrieg auf die Schlagzeile Benn gegen Brecht greift zu kurz, wenn sie diesen Ansatz Artmanns übersieht oder die Spracharbeit von Celan nur unter biographischen Gesichtspunkten verkürzt betrachtet und die Spracharbeit der Wiener überhaupt nicht mehr vorkommt. Artmann und Celan haben Knoten geschaffen, an denen man ansetzen kann, sie haben Möglichkeiten eröffnet, die zu wenig genutzt wurden. – Diese Unendlichkeitsdiskussion des 17. Jahrhunderts fand ja in einer Atmosphäre statt, in der Sprache auch eine ganz virulente Wirkkraft hatte, wie zum Beispiel bei Totentanz…
Kling: … bei Totentanzdarstellungen bzw. bei mementomori-Texten oder metaphysical poets im England des 17. Jahrhunderts. Wobei damals die große Zeit der Totentänze schon vorbei gewesen ist, man hatte schließlich den Dreißigjährigen Krieg, da erübrigten sich solche Darstellungen. Da sind dann die splatter-movies eines Grimmelshausen wichtig geworden. Die Totentänze ab dem 14./15. Jahrhundert – ich habe jetzt gerade eine Kompilation aus dem Berliner und dem Lübecker Totentänzen gemacht und einige Sachen für mich übersetzt sind ja lebensgroße Monumentalgemälde der Gewalt des Endlichen. Die gaben durchaus ausgezeichnete Bühnenbilder ab für die DJs des Spätmittelalters, also die Spitzenwanderprediger, die ja mit einem ganzen Staff unterwegs gewesen sind, Ort für Ort ihre tränengesättigten Raves abgefahren haben und den Leuten in ihren Bußpredigten so an die Nerven gegangen sind, daß zwischen Veitstanz und Massendepression alles abgearbeitet werden konnte.
Balmes: Kennzeichnend für diese Kunst war die Überblendung von volkstümlichen Bildern, direkten individuellen Ängsten und der Eschatologie des Religionshorizonts. In der Mischung von verschiedenen Ebenen oder Bildmöglichkeiten – high and low – liegt auch deine Sprache, wenn du zum Beispiel im Catull das Latein, die vermeintlich hohe Sprache, als „Stadtschrift“ liest und ein Äquivalent für sie schaffst, damit auch sprachlich Gegenwärtigkeit hergestellt werden kann.
Kling: Wie sich jede Generation um die Handbarmachung mißgedeuteter und vergessener Klassiker bemühen sollte. Es ist natürlich nicht rechtens, die Catull-Übersetzung eines Mörike mit einer heutigen zu vergleichen, um zu sagen, daß Mörike gegen eine zeitgenössische Übersetzung abfallen würde, das ist einfach unseriös. Und es wäre auch ein Wunder, wenn im Fall meiner Catull-Übersetzung nicht zumindest in Frankfurt ein hysterischer Lateinlehrer einen Rumpelstilzchentanz hingelegt hätte. In dieser nicht eben inspirierten Catull-Kritik zeigt sich deutlich, wie hysterisch gewisse Leute werden, wenn sie sehen, daß ein Kanon a) nicht mehr existiert und b) von unakademischer Seite nun eine Anschärfung eines anderen Bildes dieses Dichters Catull, nämlich der positive Rückbezug auf den hellenistischen Catull, kommt; das wird in den Bohnerwachsinstituten der deutschen Philologie nicht gern gesehen.
Balmes: Wobei dabei noch übersehen wird, daß dieser hellenistische Rückbezug die Rettung eines Originals bedeutete. Catulls „Das Haar der Berenice“ basiert auf der Übersetzung eines Gedichts von Kallimachos, das bis auf wenige Verse verloren ist und nur dank Catulls Aneignung erhalten blieb. Jeder Kanon kann nur durch solche lebendige Übersetzung weiterbestehen, sonst löst er sich auf, und dann müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob wir einen Kanon brauchen – wir haben dann keinen mehr.
Kling: So sieht’s aus.
aus: manuskripte, Heft 140, 1998
Der Dichter unterm Wachturm
Der Interview-Termin mit Thomas Kling ist ein Bild, das ich nie vergessen werde: Thomas lag auf einer Matratze draußen auf der Terrasse vor seinem Heim auf der Raketenstation von Hombroich. Ein Bandscheibenvorfall hatte ihn dahin gestreckt. Von seiner Matratze aus – Heine lässt grüßen – gab er mir seine Antworten für ein Interview, das später im Feuilleton der Rheinischen Post abgedruckt wurde. Das war 2001, Thomas hatte gerade den Ernst-Jandl-Preis erhalten.
Kennengelernt hatten wir uns drei, vier Jahre eher. Ich arbeitete damals noch in Neuss. Karl-Heinrich Müller, Gründer des Museums Insel Hombroich, machte mich zum ersten Mal auf Thomas Kling aufmerksam. Müller schien sehr glücklich zu sein, dass es ihm gelungen war, den jungen Dichter mit seiner Frau, der Künstlerin Ute Langanky, von Köln weg auf die Raketenstation gelockt zu haben. Aber er ließ gleichfalls durchblicken, dass der Umgang mit dem Dichter „schwierig“ sei, vor allem für Journalisten. Gerade habe Thomas Kling zwei Leute vom Stern rausgeschmissen. Später habe ich auch den Grund erfahren. Sie wollten Thomas mit dem Wachturm im Hintergrund fotografieren lassen – der Dichter und sein Elfenbeinturm. Auf solche Klischees reagierte Thomas nun mal allergisch.
Wenn der Dichter die „großen Kollegen“ aus Hamburg so abkanzelt, wie wird er dann auf einen Journalisten der Lokalzeitung reagieren? Unsere Annäherung klappte vorsichtig bei einer Ausstellung auf der Raketenstation – über seine Frau Ute Langanky. Dann das erste Interview auf der Raketenstation – draußen an einem Tisch wie im Biergarten. Meine Bedenken im Hinterkopf verflogen nach wenigen Minuten, als wir feststellten, dass wir beide Schüler des Düsseldorfer Humboldt-Gymnasiums waren. Schnell war Thomas’ Fragespiel – wer interviewte eigentlich wen – auf den Punkt der Schulzeit gekommen. Wir deklinierten die Erinnerungen an gemeinsame Lehrer durch. Auf der Schule haben wir beide uns nie wahrgenommen: Ich war eine Klasse über ihm, für die „Kleinen“ interessierte man sich kaum.
Aber schnell waren wir bei unserem gemeinsamen Kunstlehrer Hans Walter Kivelitz angelangt. Da ich noch immer Kontakt zu Kivelitz hatte, war spontan die Idee für ein Wiedersehenstreff geboren. Der gemeinsame Abend in meinem Kaarster Heim war filmreif. Thomas lief zur Höchstform auf, sprang auf, um alte Lehrer nach zu machen, oder um auf Wienerisch zu rezitieren. Unsere drei Frauen fanden das Abendessen überhaupt nicht langweilig, auch wenn sie bei den Geschichten aus unserem alten Jungensgymnasium gar nicht mithalten konnten. Am Ende hatten wir drei Jungs viel zu viel Rotwein getrunken, was die Runde nur noch abgedrehter machte.
Die spontanen Einlagen von Thomas im kleinen Kreis waren sowieso immer wunderbare Höhepunkte. Gerne erinnern wir uns an die Nacht der Museen, als meine Frau Ulrike und ich Thomas und Ute zufällig im Schloss Benrath trafen. Das damals noch sehr neue Museum für Europäische Gartenkunst hatte zu einer Theateraktion mit „Parterre à manger“ geladen. Diese fast surreale Performance lud die Situation auf. Entladen hat sie sich dann später im Benrather „Palmengarten“. Museumsleiterin Gabriele Uerscheln war mitgekommen. Gemeinsam haben wir Tränen lachen müssen. Überhaupt war Thomas immer der brillante Mittelpunkt jeder Tafelrunde, ob nach seiner Lesung bei der Buchhandlung Müller, ob privat beim „Viereressen“ auf der Raketenstation, oder beim Italiener in Münster, nach dem Hängen der Ausstellung von Utes und Thomas gemeinsamer Publikation „Zinnen“ in der Galerie von Kleinheinrich, dem kleinen und feinen Verlag.
Das letzte Mal sahen wir uns in Köln bei Utes Ausstellung im Frühjahr 2005 in der Deutschen Bank. Es muss für ihn ein großer Kraftakt gewesen sein. Die gesamte Zeit hielt er sich im Hintergrund, das Sprechen fiel ihm schwer. Er konnte nur noch flüstern. Trotzdem dachten alle, dass es Thomas überstanden hätte. Der Anruf von Ute wenige Wochen später, dass Thomas für immer verstummt ist, hat uns erschüttert. Die kleine Urne, die wir dann vor zwei Jahren auf dem Holzheimer Friedhof zu Grabe getragen haben, begleitet vom monotonen Trommelschlag seines Freundes Frank Köllges, ist nur mit seiner Asche gefüllt. Thomas Kling lebt weiter, in unseren Erinnerungen und in seinen Worten. Die sind unsterblich.
Heribert Brinkmann, aus: Heidemarie Vahl & Ute Langanky (Hrsg.): den sprachn das sentimentale abknöpfn, Heinrich-Heine-Institut, 2007
Thomas Kling: New York State of Mind
– Vortrag im Rahmen der Ausstellung „geschmolzener und / wieder aufgeschmo- / lzner text“ im Universitätsmuseum der Universität Bonn am 29. November 2013. –
I
In seiner unnachahmlich affigen Art meldet Der Spiegel in der Ausgabe 46 vom Montag, dem 13. November 1995, unter der Überschrift „Poeten / Goethe-Rap in Alphabet City“:
Die Wände des Lofts in der Avenue B sind aus Ziegel, und auch die Gegend gilt nicht als die feinste. Aber natürlich ist ein Viertel, das Alphabet City heißt, der richtige Ort, um Gedichte herauszuschreien. Hier, im New Yorker Nuyorican Poets Café, wo sich Weiße, Latinos, Asiaten, Indianer und Schwarze allabendlich zur Lyrikergemeinschaft versammeln, beginnt am Dienstag The Deutsch-Nuyorican Poetry Festival, organisiert von dem Café und dem Goethe-Institut. Deutsche Poeten wie der Büchner-Preis-Gewinner Durs Grünbein und der Bremer Rapper Bastian Böttcher reisen an, um mit den Nuyoricans (Abkürzung für: New York Puerto Ricans) zu wetteifern – beim Slam, wo es um den besten Vortrag geht; oder beim Jam, wo die Lyriker in Drei-Minuten-Spurts Verse rezitieren. Das Ziel, so die Veranstalter, sei der „Austausch künstlerischer Extreme“, der endlich der „deutschen Monokultur die Maske abreißen“ soll.
Am selben Montag, dem 13. November 1995, beginnt Thomas Kling mit Einträgen in sein Notizbuch „AUGN ZEUGN. NYC, MANHATTAN“, ein Notizbuch übrigens nicht aus dem Schreibwaren-, sondern aus dem Malerbedarf, wie es Schriftsteller verwenden, die mit Bildenden Künstlerinnen zusammenleben, handelt es sich doch eigentlich um ein Skizzenbuch, aus unliniertem, festem Papier mit rauher Oberfläche: Graphitstiftgrund.
In den Händen von Thomas Kling wird es ein Reise- und damit, wie immer bei ihm, Recherchenotizbuch, angelegt während seines ersten Aufenthalts in New York, auf seiner ersten und einzigen Reise in die USA. Zwanzig Blatt, vierzig Seiten umfassen diese Skizzenbücher beim Kauf, Thomas Klings Exemplar allerdings nur mehr achtzehn Blatt, also sechsunddreißig Seiten – möglich, er hat die letzten beiden Blatt, deren Abrißkanten in der Reproduktion deutlich sichtbar sind, benutzt, um in New York seine Adresse weiterzugeben – zumindest wird er sie nicht nach Abschluß der Reise herausgerissen haben. Denn als er die letzte Seite – die Schrift, meint man, wird gegen Ende von Seite zu Seite kleiner, der Zeilenabstand geringer, die Worte werden enger gesetzt, als sollte der Raum in „AUGN ZEUGN. NYC, MANHATTAN“ auch nach der Rückkehr noch eine Weile vorhalten – als er also die letzte Seite mit Notaten bedeckt hat, setzt Thomas Kling das Datum des 29. November 1995 darunter, wobei er sich zunächst im Monat irrt und den Oktober angibt, als läge die Reise noch in der Zukunft.
Ende November aber hält die Zukunft ganz anderes bereit: Die Ausarbeitung eines bereits im Notizbuch weitgehend formulierten und dort vermutlich nach Abschluß der endgültigen Fassung mit „FERTIG“ markierten Gemäldegedichts, das auf einen Besuch in der Frick Collection zurückgeht, „PIERO DELLA FRANCESCA (schule): AUGUSTINERIN“ – genauer: Die Heilige Monika, Mutter des Augustinus, dargestellt als Augustinerin, wobei das „weiß der textrolle, [/] die sie in händn hält und vorweist“, dem Weiß der Notizbuchseite in dem Augenblick entspricht, ehe Thomas Kling dazu ansetzt, eine Skizze des Gemäldes anzufertigen, mit Worten.
Die Zukunft führt zur Bestätigung des in New York zunächst für eine Abteilung, dann jedoch offenbar nahezu im selben Moment für einen ganzen Gedichtband anvisierten Titels morsch, so wie es bei der New Yorker Entscheidung bleiben wird, in morsch – wie schon im Vorgängerband nacht. sicht. gerät. – eine Abteilung mit Gemäldegedichten einzurichten.
Keine Zukunft allerdings hat, soweit bekannt, ein beim Besuch der Frick Collection ins Auge gefaßtes Gedicht zu Goyas spätem Werk „Die Schmiede“, mit drei von Dunkelheit umgebenen, sich über die Esse beugenden Schmieden, die, Thomas Klings Vorstellung vom Schreiben entsprechend, gut auch Allegorien der Arbeit am Gedicht sein könnten: Der glühende Rohstoff Sprache wird, abgewandt vom Rest der Welt, im Dunkeln geformt, unter erheblichem Kraftaufwand. Ja, Sprache braucht mitunter Schläge, um schön zu werden – von den Schweißperlen auf der Stirn aber muß angesichts gelungener Schmiedearbeit am Ende niemand wissen.
Ebensowenig wird Thomas Kling im Zusammenhang mit Goyas Gemälde wohl eine Übersetzung des mittelenglischen Gedichts „The Blacksmiths“ anfertigen, dieses von Stabreimen und Klangwörtern getriebenen, von einem unbekannten Verfasser um 1425 gedichteten Sound- oder Lärm-Wunderwerks, in dem die Tag und Nacht von Schmieden bei der Arbeit ausgehende akustische Belästigung in Klang umgeschmiedet, nämlich vom ungerichteten Krach in eine Dichtungsform gebracht wird – Kakophonie wandelt sich zu Phonie, einfach, indem sie ins Gedicht einfließt: „Tik, tak! hic, hoc! tiket, taket! tyk, tak! [/] Lus, bus! lus, das!“, so geht das Lied der Waffenschmiede in dieser Klage eines Schlaflosen, und bald sechshundert Jahre später würde mancher sicherlich in sie einstimmen wollen, zu Besuch in der Stadt, die niemals schläft.
Den Platz eines Gedichts zu oder mit Goyas lärmiger „Schmiede“ und „The Blacksmiths“ wird in morsch ein Gemäldegedicht zu Goyas – schöner Dezibelkontrast! – Stilleben mit den drei Lachsscheiben einnehmen, das in Winterthur in der Sammlung Reinhart hängt – kaum mehr als ein leises, appetitliches Schmatzgeräusch, und längst verklungen, da sich der Maler sein Motiv zurechtgelegt hat und mit der Arbeit beginnt. Jetzt nichts weiter als: konzentrierte Stille. Drei rosa schimmernde Lachsscheiben ersetzen drei von einem glühenden Stück Eisen in rötliches Licht getauchte Schmiede. Was jedoch nicht darauf schließen läßt, das Motiv der Schmiedekunst habe seinen Reiz verloren, das heiße Eisen sei vor den Augen des Dichters erkaltet – nur finden wir das Zusammenhören von Schmieden und Sprechen eben nicht in morsch, sondern in dem im Frühjahr 1996 entstandenen alchemistischen Triptychon „GELÄNDE camouflage“.
Die sich an die New York-Reise anschließende, aus den Notizen hervorgehende nähere Zukunft führt nicht nur in den Zyklus „Manhattan Mundraum“, sondern auch in die letzte Abteilung des Bandes morsch, die „romfrequenz“ – ja, der Weg von New York nach Rom wird um so kürzer, wenn man sich vergegenwärtigt, daß sich die Grabstätte der Heiligen Monika, deren Porträt Thomas Kling in Manhattan betrachtet, in einer Seitenkapelle der Kirche Sant’ Agostino in Marzio in Rom befindet. Daß es von dort in der Wirklichkeit wie im Gedicht nur ein Katzensprung ist bis zur Heiligen Cäcilie am anderen Tiberufer, der im Gedicht „s. caecilia [keyb.)“ ein Zitat aus der New York Post angehängt wird, versteht sich für Leser Thomas Klings natürlich fast schon von selbst. Der ans Romgedicht ,angeklebte‘ New Yorker Zeitungsausschnitt läßt sich zudem als kleine Hommage an John Dos Passos verstehen, der dieses Verfahren schon 1925, also vor Döblin in Berlin Alexanderplatz, anwandte, in Manhattan Transfer, von dem der Titel „Manhattan Mundraum“ abgeleitet ist.
New York bildet zudem, und das ist nicht zu unterschätzen, den Fluchtpunkt in Thomas Klings erstem längeren, 1996 entstehenden poetologischen Essay, „Itinerar“: Die Herleitung des eigenen Werks aus verschütteten Traditionen der Mündlichkeit führt dort direkt ins Nuyorican Poets Café: „Ein gestreckter Ziegelbau mit Stahltür und Doorman“, so Thomas Kling, „in dem manierlich getobt werden darf, gesteuert von einem häufig rotaufleuchtenden Applausschild. Eine klasse Muppets-Show, bei der ich sofort Lust bekomme mitzumischen.“ Und im nächsten Augenblick sehen wir ihn auch schon im „Nieselregen mühselig ein zweites Hardekopfgedicht memorieren, weil ich unversehens in die zweite Runde gekommen bin“. Zum Slam antreten, das heißt für Thomas Kling auch: sich mit Historie wappnen.
New York weist darüber hinaus, wie wir wissen, weit in die Zukunft hinein, in den „Manhattan Mundraum Zwei“, der nach den Anschlägen vom 11. September 2001 entsteht. Und noch weiter, wie ich meine, bis in Thomas Klings letzte Arbeitsphase mit den Übertragungen von „The Seafarer“ und von Ezra Pounds „Cantus Planus“, mit den Pound-Verweisen in Form von Zitaten und den für Pound charakteristischen eckigen Klammern in Auswertung der Flugdaten – denn niemand anderes als Ezra Pound dürfte gemeint sein, wenn Thomas Kling auf einem Manuskriptblatt aus dem Umkreis von „Manhattan Mundraum“ notiert: „der wahnsinnige rassist von meran“.
Ein gehöriges Maß an Zukunft, das in diesem sechsunddreißig Seiten umfassenden Notizbuch mit der Aufschrift „AUGN ZEUGN“ steckt, wobei „AUGN“ und „ZEUGN“ nicht das Kompositum bilden, sondern Einzelwörter bleiben, so daß man sich fragt, um wessen Augen es hier geht [die Augen Thomas Klings? die Augen der Heiligen Monika? die Augen der Stadt?), wer oder was hier wovon Zeugnis ablegt. Die Neue Welt von der Alten, vermute ich.
Lauter Spuren der Alten Welt, auf die Thomas Kling in New York stößt, denen er in Manhattan folgt: von Ernst Toller bis Piet Mondrian, von Majakowskis „Broadway“ bis zu Lorcas Poeta in Nueva York, von Cleopatra’s Needle bis zu imaginierten Stylitenwäldern. Mit seinen europäischen Werkzeugen schließt er sich die Hauptstadt der Neuen Welt auf. Und stößt auf noch ältere Zeugnisse, Augenzeugen: So vergißt Thomas Kling beim Besuch des American Museum of Natural History nicht, im Souvenirshop auch die Kinderabteilung zu begutachten, wo er auf ein reich bebildertes Buch über Dinosaurier aufmerksam wird – aus der Reihe Eyewitness Books, die ungefähr der deutschen Was ist Was-Reihe entspricht: „schlüpfendes saurierbaby, kindsäugig [braun) bernstein“, notiert er da.
In einer merkwürdigen Gegenbewegung also: Ein gehöriges Maß an Zukunft, an Arbeitszukunft, das aus dem New York-Aufenthalt hervorgeht – und ich hätte eingangs die Spiegel-Notiz zum „Goethe-Rap in Alphabet City“, so wahnsinnig aufgekratzt und so ängstlich um Hipness bemüht, kaum in voller Länge zitiert, zeigte sich in den Recherchenotizen vom November 1995 nicht ein völlig anderer Thomas Kling als jene Figur des aufgekratzten, seine Gedichte „herausschreienden“ Hipsters, mit der man Thomas Kling seinerzeit verband: Auf den Seiten des Notizbuches begegnen wir einem stillen, innigen Beobachter, wie er im späteren Werk dann, für die Leser sichtbar, auch in den Gedichten zum Vorschein kommt. Achtunddreißig Jahre alt ist Thomas Kling, als er nach New York reist – der Aufenthalt in Manhattan läßt sich als Schwelle zur zweiten Lebenshälfte begreifen. Selbst wenn es sich dabei um eine zweite Lebenshälfte handelt, die der Tod auf knapp achteinhalb Jahre zusammenstauchen wird.
II
Thomas Klings „Manhattan Mundraum“ und „Manhattan Mundraum Zwei“ gehören zu den Gedichten in seinem Werk, die umgehend nach ihrer Veröffentlichung große Aufmerksamkeit erfuhren und bis heute erfahren, was zum einen natürlich damit zusammenhängt, daß sie jeweils die Gedichtbände morsch und Sondagen eröffnen, zum anderen aber sicherlich auch damit, daß Leser hier bei Thomas Kling auf einen Materialraum stießen, den sie mit eigenen Erfahrungen, eigenen Bildern abgleichen konnten. – Eine Aufmerksamkeit, die ich, wie zuzugeben mich keine Überwindung kostet, lange nicht geteilt habe, ja, die erst mit der vorbildlichen Edition und Kommentierung dieser Gedichtstrecken durch Kerstin Stüssel und Gabriele Wix im Band Zur Leitcodierung. Manhattan Schreibszene geweckt wurde. Erst seit dem Herbst dieses Jahres also ist mir der „Manhattan Mundraum“-Komplex, ist mir die Schreibszene, der Schreibraum, in dem er sich vollzieht, nah. Dafür jedoch, mit einem Mal, um so näher. Mit einiger Rasanz hat mich der Mundraum Manhattan eingesogen.
Beides – die lange Zeit lediglich schwache Aufmerksamkeit wie die plötzliche Erkenntnis, es hier, wie bei so vielen anderen Gedichten Thomas Klings, mit einem Werkzeug zu tun zu haben – läßt sich, wie nicht anders zu erwarten, auf biographische Hintergründe zurückführen.
Als der Gedichtband morsch Anfang September 1996 erschien, hatte ich mich eben vom Westen abgewandt, vom engeren Westen des Rheinlands als Lebensraum wie vom weiteren Westen der ,westlich geprägten‘ Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich war in den Osten aufgebrochen. In morsch fiel mein Augenmerk unmittelbar auf den zweiten größeren Gedichtzusammenhang, „vogelherd. mikrobucolica“, der eine weitaus stärkere Ausstrahlung hatte: Nicht nur überraschte mich Thomas Kling hier – und ich war es gewohnt, von ihm überrascht zu werden, jedesmal wieder, ja, ich erwartete es – mit seiner Konzentration auf die Fauna, auf die Natur als historischen Raum: Thomas Kling war uns allen immer einen Schritt voraus. Daneben versprach it mehr Geheimnis als ein Eröffnungsgedicht, das ,Manhattan‘ im Titel führte. Ich wandte mich also aus eben denselben Gründen von „Manhattan Mundraum“ ab, aus denen sich Rezensenten und Leser ihm vermutlich zuwandten: Mit meinen eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Bildern abgleichen wollte ich zu jener Zeit, was ich, von Dresden aus schauend, in Mittel- und Osteuropa zu Gesicht bekam.
Im Herbst 1996 wäre – anders als für gleichaltrige Dresdner – New York für mich der letzte Raum gewesen, in dem ich Entdeckungen erwartet hätte. Alles in Dresden wollte nach New York. Ich aber wollte nach Ljubljana, nach Tallin, nach Krakau. Die Zeit, in der ich auf den Spuren von William S. Burroughs durch die Lower East Side gelaufen war, lag, mitsamt den Entwürfen einer Dissertation zu seinem Werk, sicher verpackt und verschnürt hinter mir.
Der Ort, von dem es Abstand zu gewinnen gilt, da es heißt, in neue geographische, historische, sprachliche Gegenden aufzubrechen: Ich erinnere mich sehr genau daran, wie Thomas Kling und ich Ende 1995, zwischen den Jahren, also einen Monat nach seiner New York-Reise, in Köln gegenüber seiner Adresse Am Thürmchenswall in einem Lokal zusammensaßen. Er erzählte von der Raketenstation und davon, daß er eben im Begriff sei, seine Kölner Wohnung aufzulösen, und ich erzählte, ich könne mir vorstellen, nach Dresden zu gehen. Ganz gleich, ob man nun zwanzig oder sechshundert Kilometer zwischen sich und die Stadt bringt, in der man jahrelang präsent war, in deren ,Szene‘ oder ,Szenen‘ man sich bewegt hat: Wir waren uns darin einig, daß für uns diese Präsenz, von den täglichen Reibungs-, Energieverlusten einmal ganz abgesehen, im Blick auf die eigene Arbeit nicht mehr von Bedeutung war. Über diesem Gespräch im Dezember 1995 sind wir Freunde geworden.
In einem anderen Zeitalter, nämlich im März 2011, unterhalte ich mich einen sonnigen Nachmittag lang im Washington Square Park in Manhattan mit dem Schriftsteller Johann Reißer, der einen Teil seiner Dissertation dem Werk Thomas Klings widmet. Unversehens, merke ich im Verlauf unseres Gesprächs, habe nun ich mich in einen Augen-, einen Zeitzeugen verwandelt. Aber aus welcher Zeit erzähle ich jemandem des Jahrgangs 1979, wenn ich Thomas Klings Düsseldorf-, Köln- und Wienbezüge auffalte, Rolf Dieter Brinkmann aus dem Bild schiebe, Reinhard Priessnitz in den Fokus rücke und versuche, Thomas Klings schnelles Urteilsvermögen zu schildern, die Auftrittsatmophäre, die ihn und seine Arbeiten immer umgab, ganz gleich, ob es sich um Bühnenauftritte oder um Auftritte im publizistischen Rahmen handelte?
Ich berichte vom dem, wie mir an diesem Nachmittag aufgeht, kulturhistorischen Raum, den Thomas Kling durchmessen hat, in seinen Gedichten, versteht sich, daneben aber eben auch als ein Mensch, den sein Gespür konsequent an Orte, in Milieus geführt hat, an denen zukünftige Kulturgeschichte sich vollzog. „Legendäre“ Szenen nennt man sie behelfsmäßig, weil sie zu ihrer Zeit weitgehend aufzeichnungslos blieben – Zeitzeugengebiete, aus denen Thomas Kling zu berichten wußte. Und ich erzähle natürlich, hier in New York, aus der Zeit vor dem Krieg, aus der Zeit vor dem 11. September 2001 und seinen Folgen, zu denen eine beispiellose Normierung moralischer und damit ästhetischer Werte auch im deutschsprachigen Raum gehört. Im Washington Square Park berichte ich aus einer vergangenen Epoche, als NATO-Raketenstationen in Lebensräume für Künstler verwandelt wurden, während sich heute Künstler ohne Wimpernzucken dazu bereitfinden, uns in die Adenauer-Ära zurückzubomben.
So nähere ich mich „Manhattan Mundraum“ und „Manhattan Mundraum Zwei“ nicht erneut, sondern erstmals, an.
III
Der New York-Besuch Thomas Klings, erkenne ich nun mit einem zeitlichen Abstand von achtzehn Jahren angesichts der vor meinen Augen im Faksimile ausgelegten Manuskripte und Notizbuchseiten, war weit mehr als eine Lese- oder Recherchereise, war mehr als etwa der Aufenthalt in Moskau und Sankt Petersburg, aus dem die Rußland-Gedichte in nacht. sicht. gerät. hervorgehen sollten oder die Aufenthalte im Vinschgau, die in wände machn mündeten. New York, das waren, in großer räumlicher Distanz, zehn Tage, die, als Mikroprozeß, das innere Abstandnehmen vom Lebensmittelpunkt Köln in Arbeitsnotizen wie im Gedicht „Manhattan Mundraum“ vorführen. Hier können wir dabei zuschauen, wie sich Thomas Kling aus Köln und allem, was mit dieser Stadt zusammenhängt, herausschreibt, Wort für Wort – auch wenn in diesem Prozeß, kaum überraschend, im jeweiligen Augenblick jedoch um so überraschender, Köln Präsenz einfordert, unmittelbar, zum Beispiel in Form eines Kinoerlebnisses.
Soweit ich es überblicke, ist in der Rezeption von „Manhattan Mundraum“ bislang nicht darüber spekuliert worden, ob neben der Stadt New York im Gedicht noch ein zweiter Ort eine Rolle spielt. Dank der so unendlich einladend aufbereiteten Materialien in Zur Leitcodierung nun meine ich eine Spur zu entdecken, die darauf hindeutet, daß hier nicht ,bloß‘ eine Stadt ins Visier genommen wird, sondern daß dies vor dem Hintergrund einer anderen geschieht. Die Kombination dreier völlig verschiedener Indizien weist mir dabei den Weg: Erstens der auf Seite 9 in Zur Leitcodierung reproduzierte Abriß einer Kinokarte, zweitens eine Notiz auf einem mit „NYC TEXTUS“ überschriebenem losen Manuskriptblatt, bei dem es sich wohl um eine während der Arbeit angelegte Übersicht über die für das Gedicht ins Auge gefaßten Szenen, Abschnitte, Motivkreise handelt, und drittens eine Formulierung im Eröffnungsteil von „Manhattan Mundraum“, die man nach den Anschlägen vom 11. September 2001 fast als prophetisches Moment lesen möchte:
aaaaaaaaaaaaaabeiseite-
gesprochen,abgedun-
kelt von der hand: die
ruinen, nicht hier
Ich glaube allerdings, daß diese Formulierung im Gegenteil weit in die Vergangenheit zurückweist, und zudem auf genau den Ort, von dem aus Thomas Kling angereist ist: eben nach Köln.
Auf dem Abriß der Kinokarte, gültig für die Achtzehnuhrvorstellung am 19. November 1995 im Walter Reade Theater im Lincoln Center, steht, in Versalien und mit einem Ausrufezeichen versehen: „EPEDEMIC!“ Ein Film dieses Titels ist mir nicht bekannt, doch ich schätze, es wird sich um Epidemic gehandelt haben, den 1987 veröffentlichten Mittelteil der Europa-Trilogie von Lars von Trier, der in Deutschland erst 2005 in den Kinos laufen sollte. Die auf Anhieb im „Manhattan Mundraum“-Zusammenhang kryptisch wirkende Notiz auf dem losen Manuskriptblatt unterstützt diese Vermutung. Da heißt es, mit einem Pfeil versehen: „Kino: Lars von Trier [Pfeil nach rechts] Aachener Weiher / Udo Kier“.
Epidemic ist ein Film, in dem ein Regisseur und ein Drehbuchautor, zwei Figuren, die vom Regisseur Lars von Trier und vom Drehbuchautor Niels Vørsel dargestellt werden, fünf Tage Zeit haben, um das Drehbuch für einen Film zu schreiben. Ein Film, in dem nicht nur das Schreiben eine zentrale Rolle spielt, sondern in dem sich das Script, die Schrift, noch während ihres Entstehens auf die Wirklichkeit auswirkt, in die Wirklichkeit hineingreift: Die Arbeit an einem Drehbuch über die Ausbreitung einer Seuche wird vom Ausbruch eben dieser Seuche gestört.
Der für „Manhattan Mundraum“ relevante Erzählstrang hat damit aber nur mittelbar zu tun: Lars von Trier und Niels Vørsel reisen nach Deutschland, ins Rheinland, passieren Düsseldorf und Neuss und erreichen Köln, wo sie auf den Schauspieler Udo Kier treffen, der von der Bombardierung Kölns im Zweiten Weltkrieg erzählt. Die von den Phosphorbomben in Brand gesetzten Menschen, so Kier in seinem Monolog, der auf Kriegserinnerungen seiner Mutter zurückgeht, hätten versucht, ihr Leben zu retten, indem sie in den Aachener Weiher sprangen.
„die [/] ruinen, nicht hier“, nein, natürlich nicht im New York des Jahres 1995, fünfzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in einem Kinosaal, auf dessen Leinwand „beiseite gesprochen“ wird, wie es im Theater- und Filmjargon heißt. Aus der Alten Welt stößt Thomas Kling in die Neue Welt vor, oder: in der Neuen Welt wird er unversehens mit der Alten Welt konfrontiert, in Form eines Filmmonologs, von dem sich nicht sagen läßt, ob er auf einer Fiktion oder auf realen Erinnerungen beruht.
Demnach würde Köln zur Folie, vor deren Hintergrund sich Manhattan ,öffnet‘, und die „stadt“ im ersten Abschnitt des Gedichts „Manhattan Mundraum“ ließe sich als etwas lesen, das zwischen Köln und New York oszilliert, als „geschmolzener und [/] wieder aufgeschmo[/]lzner text.“
Ich stelle mir vor, daß in dieser Überlagerung zweier Städte anläßlich eines Kinobesuches am 19. November 1995 überhaupt der Impuls lag, „Manhattan Mundraum“ zu schreiben. In einem in spitzen Klammern mit „MANHATTAN“ überschriebenen, auf den 23. Februar (zweifellos 1996) datierten Gedichtentwurf heißt es: „zur antwort den augapfel aufbrodelte ZISCH, [/] zuruf gebrüll, heulend“ und „weil alles, was eindrang (verschabte?). zu- [/] gleich licht. alles licht dem da ausging“ und:
ein nachtthier erst wurd der im schweiß und
in ängstn: in todesschweißangst
so löschnd. verdecknd: ein reingeredeter schattnfilmri-
sss.
– Als würde hier Udo Kiers Phosphorbomben-Schilderung mit dem Anblick des Schauspielers Udo Kier auf der Leinwand überblendet.
Der Entwurf setzt ein mit: „mein spann. tritt. reingelallerter abspann [/] im feinzugestaubtn, im fallerbäumchn- [/] dekor.“ Eindeutig also eine Kinosituation, und der Spann, der Tritt könnten ein Echo der von Lars von Trier in Epidemie geäußerten Überzeugung sein, ein Film sollte sein wie ein Stein im Schuh.
Am Rande: Neben dem hier von mir konstruierten – wenn nicht phantasierten – Bezug zu Köln findet sich im Abschnitt 10 von „Manhattan Mundraum“ ein sprachliches Moment, das auf die Gegend verweist, in der die New York-Reise ihren Ausgang genommen hat: „fühl ich mein mund [/] raum, morsche palisadn, du.“ Im Rheinland nämlich stehen die ,Palisaden‘ für schadhafte Zahnreihen, Gebißruine und bilden so einen Kontrast zu den im ersten Abschnitt genannten „weißn gebissn“. – Da sind sie also, „die ruinen“, doch „hier“.
IV
Zum Verhältnis von Umgangs- und Schriftsprache, zum Verhältnis von Ohr und Hand gibt es in Thomas Klings Notizbuch eine geradezu atemberaubend aufschlußreiche Einzelwortstrecke, und zwar von den Seiten 23 bis 26, teils zentral auf der Seite plaziert, teils andere Notizen flankierend. Und mit dieser aus sieben Einheiten bestehenden Strecke hält man ein Lehrbuch, ein Praxisbuch der poetischen Vorgehensweise Thomas Klings in der Hand, wie man es konzentrierter nirgendwo sonst finden wird.
Es beginnt am Kopf der Notizbuchseite 23 mit zwei, wie soll man sie nennen: Kugelschreiberlinienballungen, die man auf den ersten – und noch auf den zehnten – Blick für Kuliminentests halten mag. Tatsächlich erscheinen sie in der Transkription als in eckige Klammern gesetztes: „[Gekritzel“]. Die Herausgeberinnen werden damit nicht glücklich gewesen sein, wissen wir doch, daß in Thomas Klings Schriftuniversum so etwas wie bloßes Gekritzel schlichtweg nicht existiert. Tatsächlich stammen die zwei Einträge auch gar nicht von Thomas Klings Hand – und es ist nur allzu verständlich, daß Gabriele Wix und Kerstin Stüssel vor ihnen kapituliert haben, erfordert doch die nach einiger Einübung fließend entzifferbare Handschrift Thomas Klings eine solche Konzentration, ja, Identifikation des Entziffernden, daß man sich, ist sie einem einmal geläufig, kaum mehr in der Lage sieht, fremde Handschrift überhaupt als Schrift zu erkennen. Hinzu kommt, daß in einem Reisenotizbuch der Schriftduktus variiert: Es gibt die langsame und die hastige Notiz, gibt den Eintrag im Sitzen, im Stehen, im Gehen, mit einer Tischplatte als Untergrund, mit dem Knie, mit der linken Hand als einziger Stütze des Notizbuchs: So wird der Entziffernde auf die Handschrift eingeschworen.
Das „[Gekritzel]“ auf Seite 23 mag zunächst die Anmutung arabischer Handschrift haben, hier scheint von rechts nach links geschrieben worden zu sein. Arabische Worte sind es natürlich nicht – doch die Ahnung, man könnte es hier mit Kalligraphie zu tun haben, führt auf die richtige Spur: Es handelt sich um tags, um Signaturkürzel, wie sie Sprayer im öffentlichen Raum hinterlassen. Die Unterschrift nimmt eine individuell stilisierte Gestalt an, so daß der Name des Graffiti-Künstlers und die Form seiner Signatur in eins fallen: Der Name ist das Bild, das Bild ist der Name. Eine entschieden stumme Schrift, eine Schrift jenseits der Mündlichkeit. Ein Schrift-Bild. Schriftschrift, könnte man sagen. Und wer hier die Notizbuchseite Thomas Klings getagged hat, ist niemand anderes als „Bostion“, also offenkundig Bastian Böttcher, der ebenfalls zum Deutsch-Nuyorican Poetry Festival eingeladene Slammer.
Auf Bas Böttchers tags folgen Formulierungen unter der Überschrift „on beowulf“, anscheinend der Ansatz zu einem Gedicht. Und so mag man sich auf einer mittel- oder altenglischen Fährte glauben, wenn einem auf der nächsten Seite drei fremdartig wirkende, mit Betonungszeichen versehene Wörter begegnen: Exzerpte vielleicht, Vokabeln einer toten Sprache, vor denen das lesende Auge versagt, obwohl es keine Schwierigkeiten bereitet, sie zu entziffern. Es muß erst der Mund zu Hilfe kommen, damit man begreift: Hier schreibt der Rheinländer, die schreibende Hand vollzieht die lautliche Gestalt eines regionalen Zungenschlags nach. Und zwar:
hömmadú
klapsmann
ékallich
Oder, für diejenigen, denen das rheinische Ohr fehlt: „Hör mal, du Klapsmann (also: leicht verrückter Kerl) – ekelig!“
Auf Seite 25 dann Thomas Klings Titelfixierung für seinen nächsten Gedichtband, morsch. In dieser Notiz tritt nun Schrift neben Schrift, ohne daß sich daraus Konsequenzen für Mund und Ohr ergäben: Unter dem Wort „morsch“ in Thomas Klings üblicher Schreibschrift steht, noch einmal: „MORSCH“, in Versalien. Daß der Titel am Ende auf dem Buchumschlag eben in gedruckten Lettern und nicht etwa in Thomas Klings Handschrift erscheinen wird, versteht sich – seine Wiederholung in, wie wir sie nennen, Druckbuchstaben lese ich da als Probe darauf, in welcher Gestalt er welche Wirkung entfaltet.
Die Seite 26 schließlich führt gleich vier in unterschiedlicher Weise auf das unablässige, im fremdsprachigen Umfeld zusätzlich befeuerte Wechselspiel zwischen Auge und Hand, Mund und Ohr referierende Momente vor. Zunächst eine Reihe von Personennamen – Taxifahrer, die Thomas Kling in ihren Yellow Cabs durch Manhattan chauffiert haben:
MURAT, jean-pierre
Carlos Hurtado
Louis Grippo
Morton Gotcliffe
Zu jedem Namen notiert Thomas Kling außerdem die vermutete oder im Gespräch verifizierte Herkunft des Fahrers – und das heißt hier insbesondere: seine sprachliche Herkunft, die Herkunft seines Zungenschlags im Englischen: „Haiti“, „Mexiko (?)“, „Italo“. Die Namen selbst aber, da bin ich mir sicher, wird Thomas Kling, während er sich vielleicht mit den Fahrern unterhielt, nicht erfragt, sondern von der, so ist es Pflicht, in jedem Taxi für den Fahrgast gut sichtbar angebrachten, gedruckten Taxifahrerlizenz abgelesen und ins Notizbuch übertragen haben. Gedruckte Schrift wird in Handschrift überführt – so wie umgekehrt der Titel morsch kurz zuvor an der Schwelle von der Handschrift zur gedruckten Schrift imaginiert wurde.
In direktem Anschluß folgt, zweitens, eine den Initialen „E. E.“, also Elke Erb zugeschriebene Kombination von mündlichem Englisch und Dialekt: „windohs fimmerwinzich“ – „windows“ mit Dehnungs-,h‘ statt schriftsprachlichem ,w‘, so wie „winzich“ mit seinem Auslaut ,ch‘ – statt dem Buchstaben ,g‘ versehen wird. In „fimmerwinzich“ steckt eine schöne Erinnerung daran, daß Elke Erb ihre ersten elf Lebensjahre in der Voreifel verbrachte, also im sprachlichen Sinne rheinischer Herkunft ist, wo ,fimmer‘ einen Bereich zwischen dem Substantiv ,Schimmer‘ und dem Verb ,flimmern‘ umreißt: lichtstörung, unbeständige Lichterscheinung, Anhäufungen winziger Lichtpartikel – in ihren Nuancen so vielfältig wie die Dialekte selbst, und kaum weniger schwierig zu fixieren. „windohs fimmerwinzich“ flimmert, flackert selbst: Zwischen Fremdsprachenbeherrschung, Dialekteinschlag und Privat-Kompositum.
Drittens notiert Thomas Kling eines der wenigen Lehnwörter aus dem Deutschen: „UBER“, und vermerkt dazu: „[das 95er schlagwort)“. ,Uber‘ hat sich im Englischen bis heute gehalten, auch wenn es mittlerweile vielleicht seltener gebraucht wird als Germanismen wie ,zeitgeist‘ und ,angst‘. Thomas Kling wird das Wort sowohl gehört als gelesen haben, denn er verzichtet, der englischen Schreibpraxis entsprechend, auf die zwei Punkte über dem ,u‘. Und ich habe keinen Zweifel, daß Thomas Kling noch im unverfänglichsten Sprechzusammenhang die sprachhistorische Kontamination von ,uber‘ präsent war: Ohne ,Übermensch‘ und ,… über alles, über alles in der Welt‘ hätte es vermutlich kaum Eingang ins New Yorker Hipster-Vokabular gefunden. Möglich sogar, er wurde in Manhattan Ohrenzeuge eines sprachlichen Dekontaminationsprozesses, fünf Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung.
Das letzte für das Verhältnis zwischen Auge und Ohr aufschlußreiche Einzelwortprotokoll auf der Notizbuchseite 26 findet sich am Ende einer aus vier Wörtern bestehenden Liste,
party
transvestite
bike
dike
steht da in einer Kolumne, das Wort „dike“ mit einem ,i‘ geschrieben, woraus sich schließen läßt, daß Thomas Kling es aus einem Gesprächszusammenhang notiert, auf keinen Fall jedoch aus einem schriftlichen Kontext exzerpiert hat: Denn ,dyke‘, wie es hier gemeint ist, schreibt sich mit ,y‘, und das ihm vorangehende „bike“ verrät, es war von dem lesbischen Motorradclub Dykes on Bikes die Rede, nicht aber von Deichen oder Fahrdämmen oder Entwässerungskanälen oder Gesteinsgängen oder Auffangwannen, wie man sie im chemischen Labor verwendet und die man, wie Thomas Kling es tut, mit ,i‘ schreibt.
Von einem tag über „hömmadú klapsmann“ zu „fimmerwinzich“ und den Dykes on Bikes: Auf vier Notizbuchseiten wird hier ein enormes Sprachterrain abgesteckt, und sollte noch immer irgendwer meinen, Thomas Klings Arbeit sei vom ,Ergötzen am Sprachverfall, an der Sprachzerstörung‘ geprägt, möge diese Notate einmal in Ruhe unter die Lupe nehmen. Aufmerksamer kann man sich der Sprachumgebung, also den Menschen, wie sie sich durch ihre je individuell geprägte Sprache auszeichnen, kaum widmen. Nichts deutet hier auf Zerstörung, alles auf Hochachtung vor der Vielfalt sprachlicher Milieus, sprachlicher Praxis, Herkunft und Selbstvergewisserung.
„poly- [/] linguales geschau“, wie es in „Manhattan Mundraum“ genannt wird. Um so interessanter, daß in morsch das ,polylinguale geschau‘ zwar konstatiert, viel seltener aber als noch im vorangegangenen Gedichtband nacht. sicht. gerät. auch vorgeführt wird in Form protokollierter Mündlichkeit, als Figurenrede oder inszenierter O-Ton. Einzig der Crackhead in der U-Bahn darf sich in „Manhattan Mundraum“ zu Wort melden, und er spricht: deutsch! Aber nicht nur das: seine Zunge – „(rauch nur so einma [/] die woche; zwoma höchszns.‘)“ – wurde nicht etwa in Hamburg oder in München, sondern im Rheinland geformt, aller Wahrscheinlichkeit nach am Kölner Ebertplatz. Die Sprachen reisen, und sie reisen, scheint es, aus eigener Kraft.
Ob man also, wie Der Spiegel das Programm des Goethe-Instituts zitiert, „endlich der ,deutschen Monokultur die Maske abreißen‘“ muß? Du liebes bißchen – nö, nö, keine Lust.
V
In der Neuen Welt auf die Alte stoßen? – „Kenne ich mich aus in Gelsenkirchen?“ gibt Thomas Kling im November 1995 einmal zurück, als jemand aus der Gruppe um Elke Erb, Bas Böttcher, Christian Uetz und Durs Grünbein ihn gefragt hat, ob er wisse, wie sie auf kürzestem Weg zu einem verabredeten Treffpunkt in der Stadt kämen.
„Kenne ich mich aus in Gelsenkirchen?“ – Durs Grünbein erinnert sich daran, als wir Ende September dieses Jahres an der Houston Street am Straßenrand stehen, um eine Zigarette zu rauchen, während in der Bar hinter uns Aris Fioretos – es handelt sich um seine Lieblingsbar in New York – die Jukebox füttert. Acht Jahre lebt Thomas Kling nun schon nicht mehr, doch in den Gesprächen ist er immer wieder anwesend.
So auch heute, am 29. November 2013, auf den Tag achtzehn Jahre, nachdem Thomas Kling den letzten Eintrag in seinem Notizbuch „AUGN ZEUGN. NYC, MANHATTAN“ vornahm.
Marcel Beyer, Sprache im technischen Zeitalter, Heft 209, März 2014
Peter Huchel Dankabstattung1
„Die Wespen singen drüber wild“
1
Peter Huchel hat in seinem letzten Lebensjahrzehnt zahlreiche Lesungen absolviert. Ich stelle mir das als eine große Belastung vor. Nach all den Jahren einer staatlicherseits erzwungenen hermetischen Abgeschlossenheit in einem anderen Staat einer gespannt lauernden Öffentlichkeit mit ihrer – uns heute eher belustigend harmlos erscheinenden – Medienwelt in die Hände zu fallen, wovor den Dichter auch kein Mäzen schützen konnte. Derbes Nachfragen westdeutscher Medienleute nach seinem Schicksal in der DDR hat Huchel mit einem „Lassen wir das“ weggewischt, um vielmehr die Unterstützer, die Freunde seiner Arbeit zu nennen. Auf eine Planstelle für Berufsdissidenten wollte der Dichter sich nicht rücken lassen. 1974 hat Huchel in einem Interview deutlich gemacht, wie fremd ihm die Dichterlesung überhaupt ist; darin fällt der bekannte Satz, „er fahre herum und knalle den Leuten manchmal ein paar Hundert Metaphern ins Gesicht.“ Die darauf folgende, nicht minder sarkastische Aussage, die Huchels Resignation und Erbitterung kaum kaschiert, ist für mich kaum weniger interessant. Sie lautet:
Aber sie ertragen dies sehr geduldig.
Und natürlich hat Peter Huchel gewußt, warum in hellen Scharen das Publikum seine Auftritte besuchte. Er war eine Berühmtheit, die sich, wie in seinem Fall, neben einem hochpotenten, wenn auch schmalen lyrischen Werk, den zynischen Umständen deutscher Geschichte verdankte. Was, und wie, der Dichter liest – sekundär; die große Mehrzahl des Publikums will den Prominenten vor sich sehen, wird zum Saugnapf, den es nach dem Andocken an die öffentliche Person verlangt. Das sind die Spielregeln, und kein Künstler hat sich da zu beschweren.
2
Huchel, ein Preuße, ist auf dem Land aufgewachsen. Ich bin Städter, Rheinländer, was in seiner besseren Ausformung für flotten Zungenschlag bürgt; gemischte Umgangssprache auf niederdeutscher Basis ist mein Ausgangspunkt. Huchel, der im März 1920 siebzehnjährig in Potsdam am Putsch des Generallandschaftsdirektors a.D. Kapp teilgenommen hatte, ging mit Anfang 20 für ein Jahr zur Fortsetzung seines Studiums nach Wien. Auch ich war Anfang 20, als ich nach Wien kam, freilich unterbrach die Stadt mein Universitätsstudium. Huchel wohnte Florianigasse, im 8. Bezirk; ich auf der Lerchenfelder Straße, im 7.; diese Straße trennt die beiden Bezirke. In Wien hat Huchel sich ausgiebig mit Trakl befaßt, und die Beschäftigung mit Georg Trakl ist Huchel Gedichten auch anzumerken: Ich nenne den sprichwörtlichen Reichtum differenzierter Farbsymbolik; überhaupt die Schreibgrundhaltung der Wortkargheit bei Vieldeutigkeit, die des Risses, der Vermorschung, kurz: der Scherbe. Trakl hat zu meinen frühesten und intensivsten Lektüreerlebnissen gehört, mit vierzehn fünfzehn, angeregt durch meinen Großvater. In Wien las ich ’79 Huchels letzte Gedichtsammlung, die gerade erschienene Neunte Stunde. Ein Gedichtbuch, das zahlreiche Anstreichungen aufweist, wie wenige andere meiner Gedichtbücher. Ich kannte bereits Gedichte von ihm. Celan und Huchel, zwei Dichter also, die mit westdeutschem Gedichteschreiben nichts zu tun haben, waren um 1980, neben den neu dazugekommenen Nachkriegs-Österreichern, ich nenne Bayer und Mayröcker, meine großen Lektüre-Herausforderungen.
3
Es ist der Huchel der „Fangnetze“ und „Stacheldrahtreusen“, der späte Huchel des sublim eingesetzten Reims, der mich in seiner – alles andere als wortkargen, vielmehr hochaufgeladenen – Knappheit fasziniert. Der Huchel des genauen Wortlautes. Und: der (zeit-)geschichtsschreibende, gedächtnisraumerfassende Dichter, der gesagt hat:
Nicht wir rufen das Vergangene an, das Vergange ne ruft uns an.
Polybios, den hellenistischen Universalhistoriker, einen Taktierer, hat Huchel für sein Gedicht aktiviert, wo es heißt:
Funksprüche
durchtickten den Schlaf.
Der, will man ihn verstehen, zu immer wiederholter Lektüre zwingt, die, heute zumindest, und von jüngeren, städtischen Lesern zumal, durchaus unter Zuhilfenahme von Geschichtsschreibung und Wörterbüchern geschehen muß. Wie es ebenfalls bei der Droste der Fall ist, deren Werk in manchem dem Peter Huchels gleicht – man denke an die Transformation von genauer Geschichtskenntnis und genau gekanntem und übersetztem Landschaftspräparat ins Gedicht. Für seinen Tschechischübersetzer hat Huchel einmal eine erläuternde Wortliste erstellt, präzise, idiotikonartige Lexikonartikel sozusagen, die botanisches und landwirtschaftliches Vokabular erfassen. Bei beiden, bei Droste und Huchel, finden ausgefeilte Gegenschnittechniken Verwendung, die mitunter drastische Bilderfolgen entstehen lassen. Beide arbeiten mit Mikro- und Makroaufnahmen: Sprachen der Schärfe, der Präzision, entstehen so; kein Runenschutt.
Huchels Gedichtbücher sind für mich Wörterbücher – gute Wörterbücher, das ist für mich so geblieben, „schwarzes Eis“. Huchelgedichte: Füchsisches Glacis der Worte, enorm rhythmisch und klangbewußt, wenn sie auch, wie verkleinernd gesagt wurde, zum Glück kein „Klangmagier“ geschrieben hat. Keine Lossprechung bieten seine Gedichte. Keine. Eine Menge an teils ausgestorbenem Vokabular, das einer rigid traditionsgebundenen vormodernen Gesellschaft entstammt, Berufssprachen der Bauern, Viehzüchter, Fischer, oft dem unmittelbar regionalen Raum Huchels, der Mark, entnommen. Märkische Sprachscherben, ein preußischer Scherbenmann, der es am Ende seines Lebens ins Breisgau geschafft hat. Vorher dahin, wo es deutsche Künstler klarerweise immer hin gezogen hat: nach Italien. Nach Rom. Der Titel meines letzten Gedichtbands, morsch, ist mir übrigens auf der Straße eingefallen, in New York.
4
Die Illusionslosigkeit, die Strenge, die huchelsche Erbitterung. Huchel: kein Moralist im Sinne eines Andreas Gryphius, wie einmal behauptet wird. In den 30er Jahren wurde er, der nachmalig mutige Sinn und Form-Verantwortliche, wie Gottfried Benn, Josef Weinheber, Franz Turnier, vom Inneren Reich gedruckt. Den NS-Machthabern scheint der Dichter, natürlich als Heimatdichter, gut ins Programm gepaßt zu haben. Noch 1941, in der zweiten Auflage, wird der Kolonne-Preisträger im Autorenlexikon Die Dichter unserer Zeit aus dem Kröner-Verlag als „ausgesprochene Funkbegabung“ geführt.
Ein Wespenkenner (er durfte in seinem Spätwerk wahrhaftig die Hornisse nennen!). Gehört Huchel, frage ich, letztendlich einer preußischblauen Romantik an, zusammen mit Kleist, mit Müller? Wie erwähnt, haben Huchel-Leser und -Leserinnen immer wieder Gelegenheit, sich dem Genuß lexikalischen Nachschlagens zu widmen – also einer Art Nahaufnahme des Textes –, wenn es darum geht (wir zoomen mal eben ran), was ein „Stoppelsturz“ ist (ein „pflügend aufgebrochener Acker“), ein „Luch“ (eine „sumpfige Wiese“) oder eine „Lanke“, nämlich laut Grimm „bei den märkischen fischern eine seite des wassers wo man fischen kann“. Wie umgehen mit semantischen Barrieren à la „Stoppelsturz“ und „Hungerhinke“? Für eine zeitgenössische Leserschaft sind das längst Archaismen geworden. Muß ich deren genaue Bedeutungen kennen oder darf ich mich der Richtigkeit des Sounds des Gedichtes anvertrauen? Davon abgesehen, ist dichterische Arbeit mit Archaismen seit der römischen Antike legitimes rhetorisches Mittel; auch ich greife, als Spracharchäologe, darauf zurück. Huchel hatte, aus Anschauung, das Sprachmaterial zur Hand, das Vokabular seiner unmittelbaren, quasi-archaischen Umgebung. Celan, als Spracharchäologe, arbeitet artifizieller. Benn wollte das Sprachmaterial kalthalten, Huchel bringt das Sprachwerkzeug, allen Vereisungschiffren zum Trotz, zum Glühen. Kommt ein Buch bei ihm vor, so liegt es unter Lumpen, kriegsverkohlt. Oder Schrift ist Rindeneinschnitt, ist durch Wachstum und Alterung, auf natürliche Weise, unlesbar geworden: un-heil.
5
Auch meine Gedichte haben geschichtlichen und zeitgeschichtlichen Hintergrund; allerdings auch mediengeschichtlichen: schon der Dichter der 80er Jahre hat an den elektronisch bedingten Wahrnehmungsveränderungen nicht vorbeisehen können. In „brandenburger wetterbericht“, das ich Anfang der 90er Jahre geschrieben habe, hat Natur hauptsächlich in Form eines gartenarchitektonischen Pflanzplanes vom Schloßpark Sanssoucis, also als Präparat, als Objet trouvé, quasi naturbelassen, ihren Auftritt.
Noch einmal zum sprachlichen Regionalismus, zum Slang.
Hierin trifft Huchel sich mit T.S. Eliot, der die Auffassung vertrat, es sei „Sache des Dichters, sich der Redeweise zu bedienen, die er in seiner Umgebung vorfindet und die ihm die vertrauteste ist“, während im Gegensatz dazu Seamus Heaney, der, wie Peter Huchel aus bäuerlicher Umgebung stammend, es ablehnt, seiner Leserschaft Wortschatzpartikel der nordirischen Provinz Ulster zuzumuten, um ja verstanden zu werden. Ein solches Schielen nach Breitenwirksamkeit – was wäre das bei einem Dichter heute? Schierer Eigennutz – ein solches Schielen hätte den klarsichtigen Huchel nur befremdet.
Wenn ich von Huchels Sprachvermorschung spreche, so hat dies den Grund in seiner Sprachskepsis, die freilich nichts mit den sprachphilosophischen Ansätzen Wiener Provenienz zu tun hat, obwohl der Satz des späten Wittgenstein: „Die Atmosphäre des Wortes ist seine Verwendung“ in irritierender Nähe zu Huchels Gedichten gelesen werden könnte. Huchels Distanz zum Aus-Sprechen, sein Entlangschrammen am Schweigen – sein Schweigen empfinde ich als lauthals. Sein Gerade-noch-Sagen hat vielerlei Gründe, die ich hier nicht diskutieren kann und möchte. Festgehalten sei an dieser Stelle nur, daß Huchel, von dem es ja, programmatisch, kaum poetologische Äußerungen gibt, in seiner berühmten Selbstauskunft, den „Winterpsalm“ betreffend, deutlich sagt, er „biete keine Prophetie“ und „kein Verschlüsseln aus Manier“. Dies verstehe ich als unbedingtes Gegenteil zu seinem, interview- oder gesprächshalber Gesagten, er „raune“ seine Verse meist vor sich hin. Das nenne ich dem Affen schamanistischen Zucker geben; das ist Selbstinstallation. Ist Huchel hermetisch? Für mich ist seine Schrift gut zu entziffern, nicht im landläufigen Sinne hermetisch und nicht abgeschlossen.
Jetzt noch, wie versprochen, Huchel und „morsch“. Ich nehme den Dichter Peter Huchel beim Wort: man kann in seinen „Gedichte(n)“ vom berühmten Gedichtband-Jahrgang 1948 an zahlreichen Stellen auf morsch stoßen: Huchel hat dort u.a. den „morschen Rost“, die „morsche(n) Dielen“, „die morsche Schwell“, „des morschen Boots Gerippe“. In den 60er Jahren, Zeit seiner Isolation und bedeutender Huchel-Gedichte, verwendet er es ein letztes Mal. Und versuchen Sie zu hören, mit diesen Tieren zu hören, die der Dichter herbeizitiert und die über ein so unglaubliches Orientierungsvermögen verfügen. In „Exil“ steht das Bild der
… Eiche, mächtig gegabelt,
die den Donner barg –
in morscher Kammer des Baums
schlafen die Fledermäuse.
drachenhäutig.
Thomas Kling, aus Thomas Kling: Botenstoffe, DuMont Verlag, 2001
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.1997
Was ist es, das Gedichte schreibt?
– Zu Peter Huchel und Thomas Kling. –
Zur Erinnerung an Hans Cymorek (17. Mai 1965–3. Mai 2021)
Ich bin, in der Gegend von Hannover, auf dem Land aufgewachsen. Peter Huchel habe ich entdeckt, als meine Kindheit mir auf dem Gymnasium in der Kreisstadt fremd und fern wurde, eine Epoche, der ich mich noch diffus und dunkel zugehörig fühlte, die mir jedoch zunehmend als Eigengestalt gegenübertrat. Zu dieser ersten, frühen Selbsthistorisierung, wie sie für die Jugendzeit typisch ist, hat Huchels Lyrik entscheidend beigetragen. Seine frühen, seine Kindheitsgedichte haben mich als Jugendlicher in eine verstörende Ambivalenz gestürzt: Sie haben mich traurig, schwermütig gestimmt und zugleich beglückend getröstet. Die existentielle wie ästhetische Wucht, mit der mich Huchels Gedichte trafen, hatte ihren Grund in einer Vergleichbarkeit der Erfahrungen des Dichters und des Lesers, die mir half, die eigene, in Jahren kurze, jedoch schon als sehr lang empfundene Lebensgeschichte zu verstehen. Mir wurde beim Lesen bewußt: Bei allen Unterschieden konnte ich auf eine ähnliche Kindheit zurückblicken, in Weizenfeldern und auf Eichen, mit Rebhuhn und Kammolch, bei Treibjagd und Kartoffelfeuer, mit spielerischen Erkundungen in Schmiede und Scheune. Und so wie Huchel in seinen Gedichten die eigene Kindheit so eindringlich beschwor, weil sie unwiderruflich vergangen war, so wußte ich als Schüler, der seine Gedichte las, daß auch meine Kindheitsparadiese gründlich und ein für allemal abgeräumt worden waren. Die Zäsur in der Gestaltung und Wahrnehmung der Natur, der Landschaft, von Grund und Boden war nicht der Krieg, der unausgesprochen noch alles Denken und Empfinden der Erwachsenen bestimmte. In der Bonner Republik wurde dieser Einschnitt durch die flächendeckende Flurbereinigung markiert, die die Landschaften in den sechziger und siebziger Jahren für wirtschaftliche Effizienzzwecke komplett neu zurichtete. In der DDR fand eine parallele Entwicklung durch die Umstellung der bäuerlichen Betriebe und Gutshöfe auf die riesigen Industrieflächen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften statt – von Huchel übrigens, wie ich später sah, in seinem fragmentarischen Zyklus „Das Gesetz“ als sozialistische Bodenreform gefeiert, mit der der „wahre Tag“ des neuen Menschen anbreche. Ironie der Geschichte: Was damals auf beiden Seiten der Elbe im Selbstverständnis der technokratischen Protagonisten vermutlich als autonome Ausübung politischer Gestaltungshoheit wahrgenommen wurde, stellt sich in heutiger Sicht wie das Walten eines Schicksals dar, das in der übermächtigen Verbindung von Technik und Wirtschaft Systemgrenzen ignoriert.
„Vermengt mit aller Namen Aschen, von Wind und Regen fortgewaschen“ – Huchel läßt, durchdrungen von der „schmerzhaften Nähe des Entzogenen“, wie Heidegger die Trauer nannte, Namen und Bilder sprechen, um in der Form des Gedichts tröstlich gegenwärtig zu halten, was von der Menschengeschichte bereits vernichtet wurde oder jeden Moment ins Nichts zerplatzen kann. Gedichte, so die bis heute prägende Leseerfahrung, speichern das sinnlich Wahrnehmbare in seiner unerschöpflichen Einzigartigkeit und Schönheit, bevor es verschwindet oder nachdem es verschwunden ist. Seitdem kehre ich zu Huchels Werk immer wieder zurück, weil Gestalt und Geist seiner Lyrik sich in zahllosen Lebenssituationen bewährt haben. Diese Lesegeschichte ist der Grund, warum es mich freut, daß mir für meinen Gedichtband Vogelwerk der Peter-Huchel-Preis zugesprochen wurde.
Die Nachricht hat mich jedoch auch in Verlegenheit gestürzt, irritiert und in produktive Unruhe versetzt. Mit dem Preis stellte sich mir vehement die Frage, an wen er adressiert sei. Denn ich mache beim Schrebben von Gedichten eine Erfahrung, die ich vorläufig so beschreiben möchte: Der, der schreibt, ist ein anderer – jedenfalls ein anderer als der, der eine Familie und Freunde hat; ein anderer als der, der einem Beruf nachgeht; ein anderer als der, der täglich Lyrik liest oder ab und an eigene Gedichte vorträgt; ein anderer als der, der fast nichts lieber tut, als zu warten und dem Spiel von Licht und Schatten, Tagträumen und Gedanken nachzuhängen; ein anderer auch als der, der stundenlang zu Fuß durch Berlin oder auf Juist umherstreift. Dagegen könnte man die Antwort setzen, ich würde den Preis eben als der Lyriker erhalten, der das Vogelwerk geschrieben hat, und der Preis adressiere mich also in meiner sozialen Rolle als Dichter. Aber nun ist diese Rolle – die Summe der Tätigkeiten und Verhaltensweisen, mit denen sich jemand für andere, öffentlich als Dichter zu erkennen gibt – bei mir kaum ausgebildet, und zwar mit Bedacht. Ständiges Lesen, etwas Schreiben, ein paar Publikationen, wenige Fachfreundschaften – das ist alles, was mich als Dichter erkennbar macht. Aber selbst wenn ich akzeptierte, den Preis in meiner marginalen öffentlichen Rolle als Dichter erhalten zu haben, läge meiner Selbsteinschätzung zufolge gleichwohl ein fundamentales Mißverständnis vor. Der Dichter, der in dieser Rolle wahrgenommen werden kann, der den Preis erhalten hat und diese Dankesrede schreibt, würde immer sagen: Der die Gedichte geschrieben hat und wahrscheinlich noch weitere schreiben wird, ist ein anderer. Wer ist es also, der das Gedicht schreibt? Oder besser: Was ist es?
Huchel, ein Preuße, ist auf dem Land aufgewachsen. Ich bin Städter, Rheinländer, was in seiner besseren Ausformung für flotten Zungenschlag bürgt: gemischte Umgangssprache auf niederdeutscher Basis ist mein Ausgangspunkt.
So radikal Thomas Kling das lyrische Ich mit Bann belegt hat, so entschieden und betont selbstbewußt hat er von seinem Leben in der ersten Person Singular gesprochen, wie hier in seiner „Peter Huchel Dankabstattung“ von 1997 – mit dem überlegt überlegenen Gestus: Ja, ich weiß, woher ich stamme; ich weiß, wer ich bin; ich weiß, was ich kann. Als wenn semantisch eindeutige Selbstbeschreibungen nicht immer auch von einer besonderen historischen oder psychologischen Problematik wären, weil der, der spricht, sich selbst nie restlos durchsichtig sein kann, hat Kling sich nicht gescheut, vor allem in Interviews in auffallend einfachen Selbstaussagen prägnant über sein Leben Auskunft zu geben. Daher kann sich der Hörer oder Leser ein deutliches Bild von den Grundzügen dessen machen, was diesen Dichter geprägt hat. Und das ist: Bildung, Bildung, Bildung. Kling stammt aus einer Familie von „Lehrern und Pastören“, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, wie er gelegentlich hervorhob; sein Großvater war promovierter Historiker, seine Mutter hatte Geographie studiert, sein Patenonkel war promovierter Geologe. Er „wurde zu Hause gebildet“, ist „als Leser aufgewachsen“. Dazu kam das ungeliebte altsprachliche Gymnasium, in dem er griechische und römische Autoren kennenlernte. Geschichte, Geographie, Geologie, Antike – in der Konfiguration früher Einflußkräfte nicht zu vergessen ist Düsseldorf, die Stadt der extrovertierten Sichtbarkeit und Geselligkeit, der Werbung in Bild und Wort, der Kunstaktion, der Installation. Es ist unschwer zu erkennen, wie der Lyriker und Essayist Kling aus diesem lebensgeschichtlichen Fundus von Anschauungen, Geschichten, Kenntnissen schöpft, wenn er an seinem Sprachmaterial arbeitet. Die Möglichkeiten, die sich dem jungen Kling als Lyriker im heimischen Düsseldorfer Kraftfeld eröffnen, verdanken sich einer privilegierten sozialen Konstellation, die bis heute für die deutsche Geschichte typisch ist. In der Bildungswelt seiner Familie drehte sich gut protestantisch alles um das Wort, um Sprache, Lesen, Schreiben, Gesang, Texte, Wissen, Reflexion, Witz. „Ich brauche die individuelle Recherche, und die kann nur vom kleinsten, familiären Kreis ausgehen, das ist zumindest meine Erfahrung“, sagt Kling in einem späten Interview.
Zugleich bleibt klar: Was aus dem Speicher der Biographie einfließt in den Klingschen Sprachkosmos, spielt überhaupt keine Rolle für den ästhetischen Wert der Gedichte. Klings Lyrik vor dem Hintergrund seiner sozialen Herkunft zu lesen, wäre plumper, ihm wie mir verhaßter Biographismus. Denn damit ist noch gar nichts über seine Lyrik als Form, als Werk, als Gebilde gesagt – ein Begriff, den Kling übrigens für das Gedicht ebenso wie Gadamer verwendet, der gemeinsame Bildungshorizont läßt grüßen.
Für das Gedicht ist entscheidend, was durch es selbst verstanden werden kann – und dafür mag es gelegentlich hilfreich sein, ein Formdetail durch Fakten und Themen aus dem Leben des Autors oder durch eine historische Prägung zu erläutern. Aber es zählt nur, was dazu beiträgt, das Gedicht als „hochkomplexsinnliches, intelligentes, abstrahlendes Sprachding zur Vergegenwärtigung“, wie Kling es nannte, im Lesen nachzuschreiben, es in eine neue, die eigene Lesart zu überführen. Jeder Dichter hat zwar eine individuelle Biographie, aber eine Biographie schreibt keine Gedichte. Was ist es dann?
Der Aplomb, mit dem Kling in den späten Achtzigern die literarische Bühne betrat, verdankte sich seinen Texten und seinem Auftreten, seinen Büchern und seiner in Praxis und Reflexion vollzogenen Neudefinition der sozialen Rolle des Dichters. Mit der ihm eigenen, oft angestrengten und daher gelegentlich etwas kruden Begrifflichkeit hat Kling den Zusammenhang im Statement „Der Dichter als Live-Act. Drei Sätze zur Sprachinstallation“ so auf den Punkt gebracht: „als theil dichterischer arbeit ist der mündliche vortrag schriftlich fixierter texte vor einer zuhörerschaft zu begreifen, die möglichst durch den verfasser selbst geschehen soll“ – das Relativpronomen bezieht sich auf die Arbeit. Kling hat durch „die actio, das performative Auftreten bei Dichterlesungen“ („performativ “ hätte Huchel als Redakteur vermutlich gestrichen) eine kaum zu überschätzende Wirkung entfaltet, wie es Zeitzeugen beglaubigen und wie es Die gebrannte Performance, eine Sammlung von CDs mit seinen Lesungen und Interviews, auch für die nachvollziehbar macht, die nicht dabeiwaren. „Wer je eine der frühen Lesungen Thomas Klings anhörte“, so erinnert sich Norbert Hummelt, „mit denen er ab Mitte der achtziger Jahre zuerst im Raum Köln/Düsseldorf bekannt wurde, wird die völlige Verausgabung des Autors im Auftritt so stark in Erinnerung behalten haben wie die Breite seiner artikulatorischen Möglichkeiten: vom vernehmlichen Flüstern über den klassischen Bühnenton bis zum kontrollierten Wutausbruch, vom Wiener Schmäh über den rheinischen Dialekt und Szenejargons bis zum Kasernenhofton.“
Kling hat die soziale Rolle, die ihm als Dichter wie auf den Leib geschnitten war und die er absolut tritt- und stilsicher ausfüllte, auch in anderen Zusammenhängen angenommen. Er hat junge Dichter und Dichterinnen angezogen, gefördert und entdeckt, mit ihnen gearbeitet, über sie geschrieben – für viele war er „der Meister“, der einen, wie Hendrik Rost in seinem Gedicht „Requiem“ erzählt, aus heiterem Himmel anrufen konnte. Durch Klings dröhnende Stimme wird der Sprecher darin zum „Kind, das magisch denkt“; Kling erscheint als poetische Überinstanz, die dekretiert, „Ich beobachte, was du so machst“, und dann auflegt. Rosts Gedicht formuliert die kreative Verstörung, die der Anruf auslöst und deren lyrische Verarbeitung nicht nur an Kling, sondern kontrastreich auch an Tomas Tranströmer anschließt, womit ein Minimum an Emanzipation signalisiert wird:
Nimm deine Zunge und geh.
In seiner sozialen Rolle als Dichter wirkt Kling nicht zuletzt als eminent kenntnisreiche, ständig einsatzbereite, auf klar unterschiedliche Alternativen programmierte Sortiermaschine, die bei der Lektüre oder im Gespräch blitzschnell anspringen kann: Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Denn als major poet hat er keinen geringeren Anspruch als den, die Literaturgeschichte in seinem Sinne zu reformulieren – auch die Kritik und Umschreibung des Kanons übrigens eine intellektuelle Haltung, die sich historisch dem Protestantismus verdankt und dort systematisch kultiviert wurde. Die Dadaisten und Expressionisten, Oswald von Wolkenstein, Hugo Ball, Christine Lavant auf der einen Seite – Autoren, die in seinen persönlichen Sprachspeicher gehören –, auf der anderen Seite etwa Rilke, Bachmann, Enzensberger, die er abkanzeln oder, gnädiger gestimmt, auf bezwingende Weise kritisieren, nein: auf der intellektuellen Bühne bis zur Verunglimpfung vorführen kann. Klings Furor speiste sich aus einer tiefen Abneigung gegen die Lyrik der neuen Subjektivität der siebziger Jahre, „depressiv, schlecht gearbeitet, sprachschlampig, sackförmig schlackernd in ostentativer Schlechtdraufität“, wie er einmal schrieb.
Sein größter Coup jedoch, für die Geschichte der Lyrik in Deutschland bis heute ein Einschnitt: Er hat unsere Auffassung von dem, was Sprache ist, neu und nachhaltig bestimmt. Auch wenn Dichter wie Franz Mon den Boden schon bereitet hatten, hat erst Thomas Kling in einem klar konturierten und überragend impulshaltigen Auftritt in Text und Tat dafür gesorgt, daß lyrische Sprache maßgeblich als „Material“ verstanden wird, wie er es in unzähligen Anläufen und Metaphern beschwört und wiederholt. Sprache, wie Kling sie versteht, ist ein Körper, der einen Sound hat, der zum Klingen gebracht werden kann; die Sprache ist Archiv, speichert Geschichte, kann in Schichten abgetragen werden, damit Verschüttetes sicht- und lesbar wird, durchscheinend durch die anderen Lagen; die Sprache ist eine Installation, ist Recherche, ist nicht eine Sprache, sondern ein Mix aus verschiedenen Sprachen, Rotwelsch, Fachsprache, Slang, Umgangssprache, Wissenschaftssprache; Sprache ist Schrift, ist Textraum, ist Rhythmus des Realen. Und weil die Sprache Material ist, wird sie im Gedicht belichtet, operiert, freigelegt, zerschnitten, montiert, geröntgt, entwickelt, gefräst, zergliedert, durchleuchtet, geschichtet, präpariert, auf jeden Fall intensiv bearbeitet – und das ist nur eine kleine Auswahl der einschlägigen Verben, die die Tätigkeit des Dichtens beschreiben und nicht von ungefähr, was Kling vermutlich gefallen hätte, nach einem Baumarktprospekt oder Medizintechniksprech klingen. Die Sprache muß splittern. Nur so, unterstellt Kling, kann das Gedicht als Produkt, als Form funktionieren. Seinem Werk liegt eine voraussetzungsreiche, jedoch nicht genauer durchdachte Annahme zugrunde, die weniger ästhetisch als ethisch motiviert ist (wie jede Ästhetik von ethischen oder metaphysischen Voraussetzungen lebt): Nur das kalt Beobachtete und Gezeigte, nur das Ungeschönte, Brutale, nur „das Zerreißen und das Wieder-Zusammensetzen der Einzelglieder“ verbürge im Gedicht Präzision, Form, Wirkung.
Kling hat, was ich ungemein bewundere, seine soziale Rolle als Dichter nur und ausschließlich in bezug auf das Gedicht wahrgenommen. Nie ist er, obwohl er wie kein zweiter das Zeug dazu gehabt hätte, als Repräsentant irgendeiner Kultur, als kommentierender Zeitzeuge, als seine Bildung zur Schau stellender Praeceptor aufgetreten. Diese Konzentration macht seinen einzigartigen Rang aus. Performance; ein eigener, exklusiver Kanon; Sprache als Material, das im Gedicht mit größter Präzision bearbeitet wird – die von Kling gesetzten Koordinaten bestimmen bis heute das Selbstverständnis einer Lyrikszene, für die es das Maß der Dinge ist, avanciert zu schreiben und aufzutreten. Nicht nur die Werke von Barbara Köhler, Ulf Stolterfoht und anderen, die der Generation von Kling angehören, auch viele lyrische Werke der jüngeren Gegenwart, etwa die von Anja Utler oder Nico Bleutge, können vor dem Hintergrund von Klings Poetik besser verstanden werden.
Auf den ersten Blick scheint das, was einen Dichter in seiner sozialen Rolle sichtbar macht, direkt durchlässig zu sein für sein Schreiben. Das wird an der Figur Thomas Kling exemplarisch erkennbar, weil er mit maximaler Emphase öffentlich aufgetreten ist und Wirkung angestrebt hat. Aber ist es auch die soziale Rolle, in der er seine Gedichte geschrieben hat? Wird Klings Werk treffend adressiert, wenn man es dem Dichter zuschreibt, der den Kanon neu sortierte, der überwältigende Auftritte hinlegte, der unsere Anschauung von dem, was Sprache ist, genauer: was sie auch ist oder zumindest sein kann, prägte? Ich bin mir nicht sicher, ob das Problem damit gelöst wäre. Es gibt zwar Dichter – und Kling gehört als Dramatyp, als Histrione, wie er es gewählt nannte, zweifellos dazu –, die ihr Gedicht und ihren Auftritt in actu, in der Performance zu einem Kunstwerk verschmelzen; und insofern könnte man dem agierenden Dichter sein Gedicht zu Recht zuschreiben. Aber es bleibt doch das Prae des Gedichts, die schlichte zeitliche Tatsache, daß der Dichter es geschrieben hat, bevor er es vorträgt oder aufführt. Mit Klings Worten:
Gedicht ist Gedächtniskunst und steht als Schrift naturgemäß vor der Performance des Textes (…).
Wenn er seine Lyrik vorträgt, in einem Interview über seinen Kanon Auskunft gibt, eine Dankrede hält, ist er daher jedesmal ein anderer als der, der das Gedicht geschrieben hat, das diesem sozialen Austausch vorausliegt und ihn erst ermöglicht.
Ted Hughes hat 1988 T.S. Eliot in einem Essay mit dem Titel „The Poetic Self: A Centenary Tribute to T.S. Eliot“ gewürdigt, der in deutscher Übersetzung in dem Band Wie Dichtung entsteht (2001) erschienen ist. Der Aufsatz geht der Frage nach, worin die so unterschiedlichen Stimmen in Eliots lyrischem Werk und ihre eindrückliche Präsenz ihren Grund haben. Hughes findet ihn im „poetischen Selbst“. Damit meint er etwas anderes als die Denkfigur, die in Gedicht oder Prosa entworfen oder konstruiert wird. Hughes lokalisiert das poetische Selbst, wie er es versteht, nicht als Teil des Gedichts, sondern in einem Ensemble von Instanzen, die in ihrem Zusammenspiel den Dichter bilden. Die traditionelle, antike Auffassung versteht, wie Hughes schreibt, das poetische Selbst als „jene andere Stimme, die in den frühesten Zeiten zum Dichter kam wie ein Gott, von ihm Besitz ergriff, das Gedicht übergab und ihn dann verließ“ – also ähnlich wie Kling in dem Gedicht von Hendrik Rost auftritt. Das poetische Selbst kann göttlich inspiriert sein, es wird von der Muse berührt, von guten oder bösen Geistern besucht und verlassen. Es lebte, so Hughes, „sein eigenes Leben, getrennt von der normalen Persönlichkeit des Dichters, ja überwiegend versteckt vor ihr“. Dieser kann es nicht kontrollieren, es ist übernatürlich und seine Aktionen und Inspirationen sind nicht vorhersehbar. Hughes denkt sich das poetische Selbst, wie er es in Eliots Lyrik am Werk sieht, doppelt historisch: Es ist variabel und unterliegt Wandlungen; und es absorbiert, was man den Zeitgeist nennen könnte. Für Hughes ist das die Erklärung für Genese und Geltung von Eliots Gedichten – sein poetisches Selbst entscheidet „über seine einzigartige Stellung in der Geschichte der Poesie“. Grundlage dafür war Hughes zufolge die Erfahrung des Ersten Weltkriegs, die für Eliot zur absoluten Bedeutungslosigkeit und zum Verlust aller überkommenen Möglichkeiten führte, Sinn zu finden oder zu stiften:
Mit einem Lidschlag (…) war das ganze metaphysische, sich um Gott drehende Universum von seinem angestammten Platz verschwunden. Es hatte sich, mit all seinen Bedeutungen, einfach in Luft aufgelöst.
An seine Stelle sei die psychologisch ausgedeutete Wirklichkeit des Ich getreten, „das als maßloses, wenn nicht unendliches Fragezeichen zurückbleibt“.
Hughes hat mit dem „poetischen Selbst“ etwas benannt, das zur lyrischen Kreativität gehört, aber als Größe aus eigenem Recht selten in den Blick kommt. Es steht zwischen dem biographisch erfaßbaren Leben und der Autorschaft, es fungiert, ähnlich wie die Seele im Platonismus, als eine Art Medium, das für das wechselseitige Ein- und Zusammenwirken dessen sorgt, was es verbindet. Es ist das Selbst des Dichters, der eine Biographie hat, und es ist das Selbst des Autors, der schreibt. Das poetische Selbst ist eine Art Relaisstation, in der Signale empfangen, verbunden und wieder verschickt werden.
Diese Instanz entscheidet, so kann man Hughes weiterdenken, ob aus jemandem ein Dichter wird oder nicht. Wenn das poetische Selbst zum Leben erwacht, geschieht das ansatzlos, aus heiterem Himmel, in welchen gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen auch immer. Damit es sich die Augen reiben und zu Wort kommen kann, braucht es nur eines: Schrift. Denn die Geburt des poetischen Selbst verdankt sich nicht einer Tätigkeit, dem Schreiben, sondern einem Schock. Am Anfang steht die Lektüre oder das Hören eines Gedichts, mit einer doppelten Wirkung: dem Eindruck einer überwältigenden, bisher nicht gekannten Erfahrung von Schrecken und Schönheit und dem Impuls, selbst etwas zu schaffen, das diese zweifache Wirkung auslösen kann. Daher beginnt das poetische Selbst nachahmend. Es arbeitet sich sein Leben lang daran ab, jenen ersten Schock als die Bedingung seiner Möglichkeit in Form zu fassen. Einmal zu sich gekommen, bildet es sich weiter aus, durch Lektüre, durch Schreiben, vor allem durch genaue Beobachtung. Es wird geformt durch das Leben des Dichters, seine Kindheit und Herkunft, seine Familie und Bildung, seinen Lebensort und seine Reisen, seine Vorlieben und Abneigungen, seine Freundschaften und Feindschaften, und vielleicht, wie bei Benn, durch seinen Beruf, aber es geht darin nicht auf, all das ist nur Stoff, Material. Und wie jedes Selbstverhältnis differenziert es sich: Es erkennt, „Eins und doppelt“ zu sein. Es hat eine offensichtliche Seite, die auf Konstanz angelegt ist, auf kontinuierliche Beschäftigung, eine Seite, die dem eigenen Gestaltungswillen unterliegt und durch Übungen und Routinen habituell gebildet werden kann. Und es hat eine verborgene Seite, die der Selbstbestimmung entzogen ist, auf die es beim Schreiben jedoch maßgeblich ankommt. Das poetische Selbst braucht nämlich den externen Schock, die Verstörung, die es ins Leben gerufen hat, immer wieder, um zu sich zu kommen und mit dem Gedicht zu beginnen. Das kann bei der Lektüre geschehen, beim Hören von Musik, beim Betrachten von Kunst, bei der Arbeit an Notizen oder Gedichten, in Geselligkeit, im Garten, beim Staunen über Himmel und Erde oder bei der Beschäftigung mit dem Menschenwerk und seinen unüberschaubaren, seit kurzem auch digitalen Abbildungen und Verwandlungen. Das Element des poetischen Selbst ist die Unterbrechung – die kurze, akute durch das Staunen, das ein Teebeutel auslösen kann, ebenso wie die Verunsicherung durch ein Trauma, eine unaufhörliche Lebensfrage, ein geistiges Problem, oder durch den Verlust der Annahme, daß die Sprache sich von selbst versteht. Entscheidend ist: Es braucht das, was die Alten Inspiration nannten und was man nüchtern als externen, kreativen Impuls bezeichnen mag, um das poetische Selbst zur Tätigkeit zu erwecken – sei es für eine blaue Stunde, für ein paar Tage oder Wochen, sei es in einer ständigen Umwälzung des eigenen Lebensverständnisses. Es hängt viel, sehr viel an dieser Differenz und an der Bereitschaft des arbeitenden poetischen Selbst, auf die Inspiration zu warten – fehlt sie, wird der geübte Lyrikleser unschwer sehen und im Detail aufzeigen können, daß einem Gedicht auch das Pendant in der Sprache fehlt: die Form, die etwas Eigenes darstellt, weil sie aus dem gelebten Leben kommt. Die Annahme eines poetischen Selbst, wie ich sie skizziert habe, könnte zunächst wie ein psychologisches Konstrukt erscheinen, das unnötig und unhaltbar ist. Die Vorstellung hat jedoch einen heuristischen Wert – man denke an die irritierende, biographisch nicht erklärbare Differenz von Schreib- und Lebenszeit bei Arthur Rimbaud. Und sie hilft, eine absurde, historisch gesehen sehr spät aufgekommene Lesart zu vermeiden, die Resultat einer persönlichkeitsfixierten Methodik ist, in der sich letztlich einer der vielen Herrschaftsansprüche des späten 19. Jahrhunderts artikuliert: das Werk eines Lyrikers aus seiner Biographie und deren „Entwicklungen“ zu deuten. Dagegen ist die antike Vorstellung erklärungskräftiger. Die für das Dichten maßgebliche Bezugsgröße ist nicht die Biographie des Autors, sondern sein poetisches Selbst. Je nachdem wie es sich deutet, wenn es seiner gewahr wird, und in Tätigkeiten kultiviert, wird das Auswirkungen auf das Leben des Dichters und seine Selbstauslegung haben. Das poetische Selbst, wie Hughes es sieht, hat jedenfalls eine fatale, letale Tendenz. Es versteht sich als das eigentliche, das wahre Ich des Dichters, das ihn schrittweise okkupieren, steuern, kontrollieren und schließlich auslöschen will. Es will die Macht, es duldet keinen zweiten Herrscher neben sich. Daher das Leiden unter Schreibkrisen, daher das peinigende Gefühl, nicht bei sich zu sein, wenn man nicht schreibt, daher der Versuch, alles auf das Schreiben des Gedichts auszurichten, ohne zu wissen, ob das nicht, mit Eliot gesprochen, „a mug’s game“ ist, pure Zeit- und Lebensvergeudung.
Das poetische Selbst unterscheidet sich nicht nur vom Leben des Dichters, sondern auch von seiner Autorschaft. Diese gibt es nur akut, momentan, sie realisiert sich im Vollzug des Schreibens und geht in dessen Ergebnis auf. Der Dichter, der ein Gedicht schreibt, ist schon wieder ein anderer als der, der zuvor eines verfaßt hat, und er verschwindet in dem, was er geschrieben hat, sobald es abgeschlossen ist – denn jedes Werk, als Schrift, hat einen relativen Abschluß, selbst wenn es offen bleibt, Fragment, seine eigene Unabschließbarkeit zum Thema macht. Die poetische Autorschaft endet mit jedem Werk. Wenn jemand, der Gedichte geschrieben hat, Essays verfaßt oder Interviews gibt, ist er kategorial ein anderer. Daher wirkt es so bizarr, wenn Lyriker als „Autoren“ öffentlich Meinungen äußern, weil sie dann nicht mehr die Autoren sind, deren Werke das Interesse an ihrer gesellschaftlichen Person geweckt haben. Der Lyriker taugt nicht zum Repräsentanten. Felix Philipp Ingold hat das zugespitzt formuliert: „Der wahre Autor des Werks existiert einzig in seinem Werk, um nicht zu sagen: als sein Werk; und das heißt auch: Er ist nicht nur der Produzent, er ist auch das Produkt dessen, was er schreibt.“ Das poetische Selbst ist nichts anderes als die Instanz, die Autorschaft in Gang setzt. Wer Dichter ist, lebt aus dem doppelten poetischen Selbst, der ständigen Lektüre, dem Schreiben, dem Übersetzen, dem Wahrnehmen, dem Warten – und aus der Inspiration, die einen mit der Erscheinung der Form anspringt, die sich als Maß in der Sprache offenbart, als Rhythmus, als Melodie, als Klang.
Das poetische Selbst nimmt seinen Stoff, seine Themen, seine Gegenstände aus dem, was es in den verschiedenen Rollen und Geschichten vorfindet, die der Schreibende mitbringt. All das fließt dem Autor zu, der im Gedicht wiederum viele andere Instanzen, lyrische Sprecher, Sprecherinnen schafft, die ihrerseits verschiedene Stimmen haben können, mit anderen im Gedicht sprechen. Das ist das Gedicht: ein Ensemble von Stimmen und Masken, die lyrische Sprecher, Sprecherinnen erschaffen haben und die in der Form bleiben (auch: die in Form bleiben), nachdem der Autor in ihr aufgegangen ist. Nur die Stimmen und Masken, die Vielzahl der Sprecher, die unterschiedlichen Bilder, Töne und Rhythmen sind das, was im Gedicht ästhetisch wahrgenommen und beurteilt werden kann. Zugeschrieben aber wird das Gedicht, sieht man es so, einer Instanz, die verborgen bleibt, und ein von der Antike und der Religion geprägter Dichter wie Czesław Miłosz kann, wenn er die Gefährdung ahnt und demütig ist, nur hoffen, „ein Instrument der guten und nicht der bösen Geister zu sein“ (Ars poetica).
Thomas Klings letzter Band Auswertung der Flugdaten (2005), kurz vor seinem Tod erschienen, ist ein auffallend persönliches Buch und kann in seiner Genrevielfalt als Vermächtnis gelesen werden. Es enthält neben Gedichten auch Fotos von Ute Langanky sowie drei Gruppen poetologischer Essays. Deren Herzstück bilden die assoziativen, erratischen Überlegungen mit dem Titel „Bakchische Epiphanien I–IV“. Sie sind dem letzten Drama des Euripides und dem gleichnamigen Gedicht in 38 Strophen von Rudolf Borchardt gewidmet, einem „Hauptwerk der hermetischen Poesie in deutscher Sprache“, wie Kling es klassifiziert. Ihm geht es jedoch nicht um Borchardts Gedicht im besonderen, obwohl dessen metrische und rhythmische Überorchestrierung, seine überspannte semantische Aufladung und der ostentative, um nicht zu sagen präpotente Kunstanspruch eine Auseinandersetzung erwartbar gemacht hätten. Er wendet sein Interesse einer Basispoetologie zu, dem, was „der Dichter“ ist, was ihn ausmacht, was er als Dichter macht.
Überraschenderweise kommt Kling dafür nicht auf die bekannte Metapher vom Sprachinstallateur zurück, die er in Analogie zur Sprachinstallation, dem Produkt seiner Arbeit, dem Gedicht, geprägt hat. Indem er die „Bakchen“ des Euripides und ihren Dionysos-Mythos für sein Schreiben ausdeutet, greift Kling radikaler und weiter aus. Wenn er das griechische Drama und den historischen Mythos auslegt, zeigt er zugleich, wie Borchardts „Bacchische Epiphanie“, die sich auf beides bezieht, eine „Vorzeitbelebung“ darstellt, mit der „der Dichter seine Annäherung, sein übersetzerisches (und translatorisches) Andocken an antike, vornehmlich griechische und hochmittelalterliche Literaturen zu umkreisen sucht“. Der Grundgestus des poetischen Selbst wird damit als hochreflektiert historisch beschrieben. Der Dichter bezieht sich nicht einfach auf Stoffe, Figuren und Motive aus der Antike – das wäre in Klings Augen billig, und daher rührt sein starker Widerwille gegen die unterkomplexe Art und Weise, wie sich Dichterkollegen gelegentlich in der Antike bedienen. Bei Kling wird die Schraube weitergedreht. Das poetische Selbst bezieht sich auf die Geschichte, indem es sich selbst historisch wird und sich historisch versteht. So wie Euripides, der im 5. Jahrhundert v. Chr. mit dem Dionysos-Mythos in den „Bakchen“ einen jahrhundertealten Stoff bearbeitet, ganz von seiner eigenen Zeit, der Attischen Demokratie, durchdrungen ist, so steht auch Borchardts „Vorzeitbelebung“ und Anverwandlung im Zeichen seiner Zeit, ist „wilhelminisches Ausflippen“ im „Titanic-Untergangsjahr 1912“. Klings Conclusio ist naheliegend: Wenn sein poetisches Selbst, das, was dichtet, sich auf die Antike bezieht, so geschieht das gleichfalls im Horizont der eigenen Zeit, und zwar bewußt, explizit, reflektiert. Und es geht noch eine Windung weiter. Der Dichter, der im Bewußtsein der eigenen historischen Position das Gedicht aus dem Sprachmaterial formt, kennt auch die Versuche seiner Vorgänger, die sich die gleichen Motive, Stoffe, Figuren poetisch angeeignet haben. Um ein Gedicht über Dionysos zu schreiben, braucht Klings poetisches Selbst nicht nur valide, wissenschaftliche Kenntnisse und die Reflexion der eigenen zeitgenössischen Schreibposition, es weiß auch um die Versuche anderer, die sich derselben Doppelaufgabe gestellt haben. Kling besaß ein intensives historisches Bewußtsein, hatte „Gefühl für Geschichte“ – davon ist sein poetisches Selbst in hohem Maß durchdrungen.
In seinen „Bakchischen Epiphanien“ umkreist er den Kern des Dionysos-Mythos und sucht obsessiv nach dessen Entsprechungen in anderen Gestalten, bei Ovid, im „Formenkreis Medusa“, in der nordischen Skaldendichtung. Dabei geht es ihm primär gar nicht darum, daß Dionysos der „Geräuschgott“ ist, der „Gott des Akustischen“, ein „nonverbaler Kommunikationsgott“ – eine Deutung, an die sich Klings Verständnis vom Gedicht als Performance nahtlos anschließen könnte. Sein Interesse gilt statt dessen vor allem dem Gewaltsamen „einer auffällig blutrünstigen Mythenwelt“, wie sie sich im Ritual artikuliert:
Bei Euripides wird der Voyeur des dionysischen Rituals von den Bakchen mit dem Tode bestraft. Er wird schlicht zerrissen, zerstückelt – zur Unkenntlichkeit deformiert.
Das Motiv – die „disiectio membrorum“, Verstreuung der Glieder – findet Kling auch in der Diana-Episode in den Metamorphosen des Ovid, die davon erzählt, wie der Jäger Aktaeon auf Geheiß der Göttin von seinen Hunden zerrissen wird, nachdem sie ihn in einen Hirsch verwandelt hat. In diesen Motivkreis gehört für Kling zudem das Haupt der Medusa, das Perseus im Auftrag Athenes abschlägt und der Göttin überbringt – was Kling über Perseus’ Ausrüstung mit Sichel und Schild zu gewagten, gelegentlich unhaltbaren Vergleichen mit der nordischen Sagenwelt führt, wo Schilde „Lichtfänger und Lichtmultiplikatoren “ sind. Er liest den Mythos, seine Rituale und Bestandteile als Gleichnis für sein Dichten. Der Dichter „frönt der Kopfjagd, wie es ihm in der Antike, und viel früher noch, in der Vorgeschichte, vorgemacht worden ist“, er „bezieht sich auf Realien“, wenn er die „scharfe Waffe“ benutzt, „den etwas anderen Botenstoff“. Der Dichter wiederholt in der Sprache, was im Mythos präfiguriert ist: „Disiectio membrorum: die schamanistische Gliederverstreuung. Eben auch: Die Wortauswerfung. Sowie: Die Wortverwerfung. Die unausgesetzten, immer zu wiederholenden Arbeitsvorgänge: die des Wortaufklaubens, nicht: Worteklaubens; die des Wortemachens, ja.“ Für Kling geschieht im Mythos genau das, was für ihn der Inbegriff des Dichtens ist:
Das Zerreißen und das Wieder-Zusammensetzen der Einzelglieder – Das Schreiben.
Sein poetisches Selbst hat eine starke Affinität zu der im Mythos aufbewahrten archaischen Energie. In einem späten Interview hat er den bemerkenswerten Satz gesagt:
Die Kontemplation glüht das Material vor.
Nicht das lyrische Ich, nicht der Autor, nicht Thomas Kling – die Kontemplation ist es, eine Metapher, die auf einen Akt des poetischen Selbst verweist: Es bereitet das Sprachmaterial zu, damit es bearbeitet und zur Form gebracht werden kann. Klings poetisches Selbst ist ein archaischer Handwerker, ein platonischer Demiurg, der die Worte „nach dem gewünschten Vor-Bild“ aufbereitet und zurechtlegt. Indem er das tut, setzt er „stets ins Bild“, „betont stets“, „was in der Fantasie des Lesers – der Wandelbarkeits-Maschine, dem Transformations-Apparat – sich abspielen kann oder abspielen könnte“.
Klings geschmeidig starke, weit ausgreifenden Schritte in diesen kurzen Essays haben ein leises, versöhnliches Ende; als blicke die Brutalität, die Destruktion auf ihre eigene verwundbare Rückseite. Er formuliert den Gedanken, das konstruktive Komplement des Schreibens, das „Wieder-Zusammensetzen“, das „Zurechtlegen“ könne auch ein Akt der „Heilung“ sein. Das tröstliche Gegenbild findet sich wiederum im Mythos. Denn „Dionysos, das neugeborene Kind, von den Titanen in Stücke zerrissen“, wird von seiner Großmutter wieder „heil zusammengesetzt“. Kling versteht auch das als Gleichnis für das Dichten:
Die gesprochene, hin auf die Einzelteile gesprochene Schrift. Die Schrift – Die Heilung.
Man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man feststellt: Das klingt eher nach Rilke als nach Kling. Vielleicht hat er sich in diesem letzten Buch die Verletzlichkeit und Angreifbarkeit gestattet, die ihm an der zeitlosen Erscheinung, dem Mythos, imponiert hat. „Das unausgesetzte, das naturgemäß vollständige Ausgesetztsein im Schreiben, mit der – und haargenau – in der Schrift“. Nur jemand, der ideologisch und in Lagern und Gegensätzen denkt, würde es als unpassende Pointe bezeichnen, daß Kling so mit einer Anspielung auf Rilkes berühmte Zeilen schließt:
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe, wie klein dort,
siehe: die letzte Ortschaft der Worte, und höher,
aber wie klein auch, noch ein letztes
Gehöft von Gefühl. Erkennst du’s?
Der Anklang ist nicht unpassend, er ist anrührend.
Henning Ziebritzki, aus Sinn und Form, Heft 2, 2022
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit“. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest „Oh Nacht“ [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


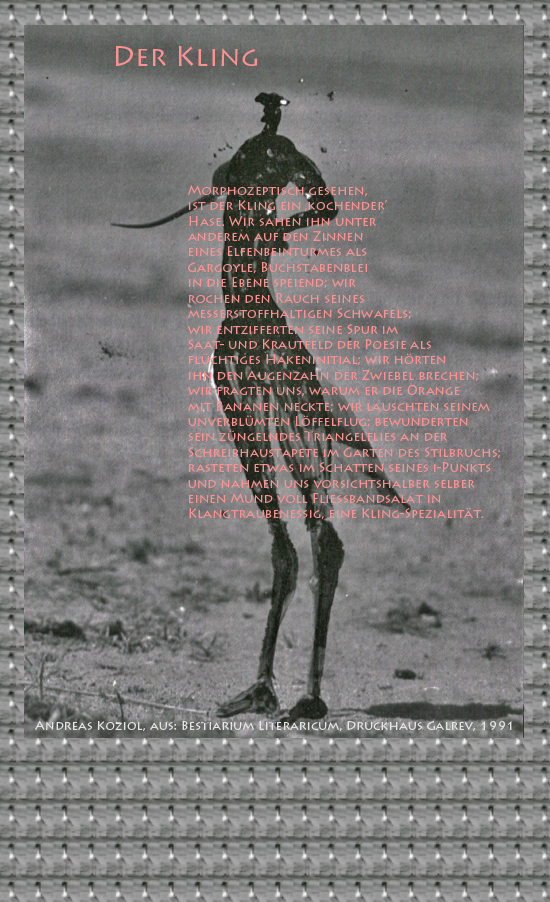












Schreibe einen Kommentar