Thomas Kling: nacht. sicht. gerät.
GEGNSPRECH
anlage. jedes der bakelit-
telephone wog. hatte das gewicht
von, sagen wir. halbiertes, „elephant“-
nhaupt, u. grau aufgestelltes ohrenpaa’
als er auf sein geburzhaus (wies?,
zu sprechn?, kam?). grubnpferd g-
dächtnis. weimar II, ein unbetretner
fremdnplan
Thomas Kling,
der provokante ,poeta doctus‘ unter den jungen deutschsprachigen Lyrikern von Rang, stellt seinem neuen Buch nach. sicht. gerät. listig ein Motto des Otfrid von Weissenburg, Verfasser der ersten großen althochdeutschen Reimdichtung, voran: Die deutsche Sprache „ist zwar nicht so geformt, nicht so sehr geregelt, und doch geht sie ihren rechten Gang in schönem Ebenmaß“.
Mit den Regularien und Konventionsformen der Sprache spielt Thomas Kling auch in seinen jüngsten Gedichten, das „röntgen der sprache“ verfolgt von Anbeginn dieses lyrische work in pgrogress. Aber immer stärker öffnet sich Thomas Klings „sprachraum“ in den sechs Kapiteln dieses neuen Gedichtbuches dem Landschafts- und Historienraum.
„di alpm? / also, grooßformate drramatischster vrr- / kettungen; so dämmrunxlilienstrahl in / riefenstahlscher lichtregie“
In enormem Tempo durchreisen Thomas Klings Gedichte die Tage und die Nächte, von Rußand ins Rheinland, von den Alpen ins Museum, von Brandenburg bis Thüringen. Wenn im „brandenburger wetterbericht“ die Ufa, Otto Gebühr, die Nationale Volksarmee oder die Mythen des Alten Fritz auftauchen, wird jedweder „locus amoenus“ sogleich zersägt, alle Annäherungen an Geschichte werden zur gewalttätigen Gegenwärtigkeit hin aufgebrochen. Und ganz im Zeitzeugenhaften bewegt sich der dieses Buch eröffnende „russische digest“.
Das Desaster unserer zerstückelten Wahrnehmungen – „die ganzn bildvereinzelungen“ – bilden Thomas Klings Gedichte in virtuos eingesetzten Multivisionstechniken ab. Thomas Klings Gedichte unternehmen Angesichts der in unseren Köpfen zu Informationssplittern zerborstenen Sprach-Welt den verzweifelten doch rotzig-zarten Versuch, die Teile des allzu Getrennten noch einmal im poetisch-subjektiven Blick zusammenzuhalten.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1993
Klings Rolltreppn
Wollte man der Lehre von den Temperamenten folgen, wäre Hodjak der Melancholiker, Thomas Kling der Choleriker, von gelber Galle stimuliert, dem Element des Feuers, wie es im Funkengestöber seiner Worte und „brennstabm“ prasselt. Nicht der sanfte Zerfall der Zusammenhänge wird nachvollzogen, sondern das Zerfallen und Zerspellen der Kontinuität vorgenommen. Freilich gibt es immer auch die Gegenbewegung, wie sonst wäre von einem Text zu sprechen. Hodjak stiftet ironisch als Bleibendes den Zusammenhalt des Zusammenhanglosen, bei Kling „bleibt“ die Montage des Disparaten, das Stück aus Bruchstücken.
Das Gedicht als Bummelzug hatte ausgedient. Mich interessierten Zentrifugalkräfte; Bedächtigkeit, um es vorsichtig zu formulieren, konnte nicht mehr in Frage kommen.
So schrieb Kling in einem „Brief“, den Ulrich Janetzki und Wolfgang Rath in ihre unter dem Titel Tendenz Freisprache edierte Text-Sammlung zu einer „Poetik der achtziger Jahre“ aufnahmen (Suhrkamp 1992). Gleich der erste Abschnitt von Klings drittem Gedichtband (nach geschmacksverstärker und brennstabm), „russisch digest“, gibt ein Beispiel für den lyrischen Geschwindigkeitsrausch des Autors:
rolltreppe russland runter,
in teile zerborstenes wr
akk, gut sichtbar deutlich ver-
nehmbar leningrad airport unweit der landesbahnen russ-
land landunter rolltreppe runter u.
in wasfürnemtempo.
Bilder leuchten nicht auf, sie blitzen auf, die Realität wird zum flirrenden Bildschirm, ein optisches und akustisches Reizgewitter entlädt sich. Ohne Unterlaß stoßen wir auf Verfremdungen in Orthographie und Interpunktion, im typographischen wie im Hör„bild“: „ruzzlant“, „kriixxteilnehmer“, „herzschlakfinale“, „im blikkfelt rennende rekrutn“… Der Kling-Klang ist – Vokale werden immer mal ausgeblendet – nicht gedehnt, sondern geballt, harte statt weiche Laute werden gewählt, Verschluß- und Reibelaute bevorzugt. Herkömmlicher Sprachgebrauch dämpft tendenziell die Heftigkeit, mit der uns Realität begegnet, mit der wir ihr begegnen. Wird dieser Mechanismus gestört, wie eben bei Kling, werden wir der Wirklichkeit schonungsloser ausgesetzt, Sprache wird gleichsam mit Aggressivität aufgeladen, die uns verstört, weil sie uns aus den Gewohnheiten des Sprechens und Hörens reißt. Ohne Zweifel entsprechen Klings Textverschnitte mit ihren scharf gesehenen Einzelheiten, mit ihren sich jagenden Ifos und Assos moderner Wahrnehmung. Die grundsätzliche Frage ist, ob solch Detailflimmern nicht einem auf Sensationen ausgerichteten TV-Sensorium, sprunghaftem Zeitgeist willfährig ist. Wo doch Literatur eher als „langsame“ ein Gegengewicht zur Verflüchtigung des Geistes zu schaffen hätte (vgl. „Langsame Literatur“, in: ndl 1/94), Solches Bedenken provoziert auch Klings „bildpool“, Texte, in der die Zeitlosigkeit etwa von Gemälden nicht von einer Kunstbetrachtung bekräftigt wird, die gemächlich Zusammenhänge entfaltet, sondern vielmehr mit dem gewalttätigen Seh-Akt dessen konfrontiert wird, der mit irrendem Blick die Details aus dem Zusammenhang ins gegenwärtige Empfinden reißt.
Dem Bedenken, das lyrischem Blitztourismus gilt, ist allerdings entgegenzuhalten, daß uns mit den Bildsprüngen von Klings Sprach-Bildern Geschichte in einer Weise auf den Leib rückt, die sie zu freundlicher Unterhaltung, zu der Betrachtung von Geschichte trotz (oder wegen) all ihrer Schrecken gern gerät, ungeeignet macht. Wenn in „brandenburger wetterbericht“ der Park von Sanssouci „besichtigt“ wird, dann läßt das militärische Vokabular eine hintergründige historische Dimension augenscheinlich werden:
blutbuche Seyn Park, langer
kerls schatten über der begonien-schlachtordnung;
zum augnangriff jährlich 70000 stiefmütterchen in formation.
Die Erinnerung an mittelalterliche Judenpogrome (nicht progrome, wie zu lesen steht) werden durch die Überschrift des zum Zyklus „mittel rhein“ gehörenden Gedichts „tornister, agenturenberichte“ quasi zum zeitgenösssichen Fakt. Nicht als Panoramen, in denen der Blick ruhig wandert, werden Thüringen, die Mark Brandenburg und der „mittel rhein“ in Klings Texten erfahrbar, sondern als historischer Abriß; das Gedicht wird zum Geschwind- und Gewaltmarsch durch ihre Geschichte. Die Landschaften eröffnen sich im „testbild“ und „textbilt“ zugleich als Sprachräume. Aus historischem Wortgut, der Sprache moderner Zivilisation, Spezialjargons, nicht zuletzt sprachlichen Verformungen, assoziativ gesteuert, werden bizarre Textgebilde geschaffen. Wenn die Qualität einer Literatur nicht zuletzt daran gemessen werden kann, welche Sprachen in sie eingehen (denn in einer Gesellschaft werden entsprechend ihren vielfältigen Gliederungen zur gleichen Zeit zahlreiche „Sprachen“ gesprochen) und wie sie diese schöpferisch verarbeitet, dann ist Klings Namens- und Wortkunde ein faszinierendes lyrisches Ereignis. (Das sage ich ungeachtet dessen, daß mich „die ganzn bildvereinzelungen“ gar nicht selten hilflos im Wortgeröll und Bilderschutt stapfen ließen, ohne in der Gedicht-Landschaft auf die erhofften Einblicke oder Ausblicke zu stoßen. Das Rauschen des Gedichts, manchmal war es ein Vorbeirauschen.)
Bilder der Katastrophen und des Todes, wie sie häufig begegnen, entsprechen einer Erfahrung von Geschichte ohne Sinn und Ziel, die in dem Gedicht „autopilot. phrygische arbeit“ ihren suggestiven Ausdruck findet. Phrygische Arbeit ist ein Begriff für die Nadelkunst, die dem Volk der Phrygier zugeschrieben wird. Hier sind die zitternden Armaturennadeln gemeint, die ihre Entsprechung in Hodjaks sich wie verrückt im Kreis drehender Kompaßnadel hat.
ohne lande-
erlaubnis di geschichte. ein irgendwie
alles, nix wissn groß. orient irgndwi,
stadtgründungen staatsgründungen wir
überfliegen das, hams schon überflogn.
cockpit völlig ohne orientierun’, bei
zitterndn zunehmnd gezittertn armaturn-
nadeln
(…)
ein blutstrom
scheint auf (und verschwindet): ent-
seelte heere mit sich führend, leibert-
eile, glitschiges entgleitendes treib gut.
dann wieder wolknbänke, weiter nullsicht…
Das ist eines der Gedichte Klings, Zynismen und Sarkasmen kehren es nur hervor, vom blutigen Ernst des Gewaltmarschs Geschichte; Sprachspiel verhindert nicht Geschichtserfahrung, sondern macht sie wieder möglich. Eine Draufsicht von anderer Art bietet die „stromernde alpmschrift“:
di alpm?
also, grooßformate drramatischster vrr-
kettungen; so dämmrunx-lilienstrahl in
riefenstahlscher lichtregie. christiani-
sierte gipfel…
Kling stellt sich in eine – siehe Albrecht von Haller – erhebende Tradition der Lyrik, deren gewaltige Inszenierungen ironisch unterlaufen werden: Bildwelt- und Weltbild-Kritik einer Hochästhetik. Mag Kling zur Postmoderne gezählt werden, ihren Drang zur Erhabenheit teilt er nicht.
Jürgen Engler, neue deutsche literatur, Heft 494, März/April 1994
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Friederike Mayröcker: Löschblattlosigkeit
Die Zeit, 12.11.1993
Michael Braun: Aufgerissene Sprachräume
der Freitag, 19.11.1993
Sibylle Cramer: Großartige lyrische Verkettungen
Süddeutsche Zeitung, 5./6.2.1994
Heinrich Detering: Voodoo im Wohnzimmer
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.2.1994
Ernst Nef: Bildvereinzelungen
Neue Zürcher Zeitung, 12.4.1994
Sieglinde Geisel: Röntgenbilder im Zeitraffer
Der Tagesspiegel, 22.5.1994
Materien und Martyrien
– Die Gedichte Thomas Klings. –
Wohl kaum ein anderer Lyriker deutscher Zunge hat sich im Verlauf der achtziger Jahre so durch seine Kunst des Vortrags, die eine Lesung in eine sprachartistische Aufführung verwandelt, bemerkbar gemacht wie Thomas Kling, Die Auftritte in den Wiener Margarethen-Sälen, im Düsseldorfer Ratinger Hof und im Kölner Stollwerk haben ihm seit 1983 Rang und Ruf verschafft. Zugleich stellt jedoch kein anderer seine Zuhörer und Leser so vor weitverzweigte Rätsel und Rebusse wie er, der in Düsseldorf geborene und in der Nähe von Köln lebende poeta doctus.
Seine Texte sind gewiß keine eingängigen Schlager, die die Spatzen von den Dächern pfeifen. Die „Sprachinstallationen“ sind fraktale Gebilde, kaum aber schulbuchnormierte Gedichte mit Metrum, Reim, Refrain. Im Ausruf zerfallen Sätze in Worte, Silben in Lettern, und mitunter scheint das geltende Dudendeutsch in ein lyrisches Esperanto zersprengt. Aber: Thomas Kling hat ebenso Zeilen von hoher Anmut geschrieben. Tiefsinnliche Verse wie „heißhungrig, rauh: so essen wir / den November auf“ oder „ich lecke di / achsel des sommers, der sommer ist eine frau“ bleiben trotz oder gerade wegen der zersprengten Sprache im Gedächtnis haften.
Beim Hören von Klings Gedichten, die, im Grunde ein Anachronismus, immer noch in Buchform und nicht als CD erscheinen, ist die Überwältigung wohl der bleibendste Eindruck. Wer feinere Unterscheidungen schätzt, wird in der Lektüre die extreme Polarisierung der rein technisch, also durch Montage entstandenen Metaphern und poetischen Bilder registrieren. Die Schwankungen zwischen eiskalt und brennend, Tag und Nacht, Sommer und Winter, verleihen den Texten ihre Intensität. Rein sprachlich fügt sich zu den eingängigen Versen wortwörtlich Ungereimtes, etwa Eindrücke einer Reise nach Finnland und Schweden. Was man landläufig Skandinavische Impressionen nennen könnte, hört sich in einem Gedicht mit dem Titel „polares piktogramm“ zunächst so an:
1
aaaaaaaaaavor der post der apo-
theke (quengelnd köter draußn
angeleint) so laufende motoren auch
vor kamin das weiße deutlich weg-
gespreizt; (…)
Das Szenario endet nach vier, mit fast erfrorenen ,,pidginlippen“ gesprochenen Strophen in:
5
(…) arktischer nadeleinsatz: gespickte wange
nasnknistern, die wimpern zugestiemt; ich
krakel KA-KEL-UGN, VED-SPIS, KAMIN, KA-
KEL-UGN
aaaaaaaawo manche kranke mit der karre
über eis nach schweden brettern .. mensch
schneemensch!, dreißich minus! ich
ganztags ofnheinz.
Die burleske Figur des Heinz, der hier den Ofen heizt, schreibt keine geheimen Silbenkodes; er krakelt wohl mit klammen Fingern nur etwas von „keine Erkältung“ und landet beim Kamin, griechisch ,kaminos‘ und schwedisch ,kakelugn‘ (Kachelofen) und ,ved-spis‘ (Holzfeuerstelle). Diese kunstvoll-chaotische Sprachinstallation thematisiert sich selbst als Sprachrand, als Rahmen eines poetischen Bildes. Deswegen die insgeheimen Beziehungen zur Kehlung des Rahmens und zum nächsten kakemono, japanisch ,Aufzuhängendes‘. Wen wundert’s, daß das anschließende Gedicht ,petersburger hängun‘ heißt.
Wenn Klings Gedichte bis an die Ränder kommunikativer Sprache vordringen, so schreiben sie nur auf, daß Verstehen keine Norm, sondern die Ausnahme beim Hören und Sehen ist. Kommunikation, es sei denn sie wäre Eingebung oder Verkündung, erfolgt erst durch telematische Apparate: Übertragung selbst auf große Distanz. Trotzdem ist auch eine total vernetzte Welt allererst Geräusch oder, technisch gesprochen, weißes Rauschen, bevor sie Wort wird.
Diese Art von Lyrik operiert folglich im Grenzbereich der Sinne, dort wo, wie Nietzsche einmal so treffend sagte, ein drittes Ohr wachsen sollte. Dabei sind Klings Texte keineswegs dunkel im Sinne der hermetischen Tradition oder heraklitscher Versonnenheit. Vielmehr überrascht ihre Offenheit, ihre thematische Weite, ihr Blick nach draußen, auf Landschaften, Personen, Bilder und Alltagsgespräche. Es ist überdies erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit nicht das Dunkel, sondern die Belichtung und das Licht umschwärmt werden.
Mit dem ersten offiziellen Gedichtband erprobung herzstärkender mittel (1986) wird die Außenwelt, nämlich die Köln-Düsseldorfer „Szene“ sowie Ostberlin ins Auge und in Worte gefaßt. Während hier in Gedichten wie „fotophoto“ die Dia-Abende zur Besichtigung der rheinischen „heimat“ in knappen Sprachaufnahmen ironisch vor- bzw. nachgestellt werden, findet sich im Folgeband geschmacksverstärker (1989) ein Ausschnitt der Rederituale aus einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung mit dem Titel „psychotische polaroids“. Ähnlich brutal wie weiland in Rilkes Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge lauten die Anweisungen („gradehaltn!“) und Kommentare über die Patienten („nidergespritzt“).
Im Klartext heißt das: In Zeiten einer, noch einmal Nietzsche, „medizynischen“ Vernunft ist „hochempfindlich“ nurmehr die Eigenschaft von Filmen. Die zweite Veröffentlichung geschmacksverstärker evoziert neben Eindrücken einer weitläufigen Reise von Wien, Italien bis nach Finnland vor allem auch die prägenden Einschnitte der Biographie wie den Zivildienst und den Tod des Großvaters, der seinen Enkel erzog und ihm Grundkenntnisse der modernen Poesie vermittelte. Auffälligerweise ist schon mit den ersten beiden Publikationen Thomas Klings eigenwilliges Idiom völlig entwickelt.
Der umfangreiche und thematisch dichteste Band, brennstabm (1991), konzentriert sich auf die mittlere Rheingegend und Tirol, eine kulturgeschichtliche Bestandsaufnahme, die in nacht.sicht.gerät (1993) zwar ihre Fortsetzung findet, aber um die scharfäugige Musterung von Petersburg, Berlin, Weimar, Gotha, Padua und den touristisch bestiegenen Alpengletschern ergänzt ist. Immer wieder geht es um das Verschwinden von Arten, Idiomen und Sprachen, unablässig wird gegen die Rotüre polemisiert, deren spießige Wohnkultur der Schrebergärten, Stammtische, Silberpudel und Gartenpastoralen samt Rasenmäher. Dem Kleinbürgeralltag und Alpentourismus stehen die Massaker auf den Autobahnen und Bundesstrassen oder in den abendlichen Fernsehnachrichten gegenüber. Diese Außenwelt wird in all ihren Jargons, Tonlagen, Volkstümeleien und kleingärtnerischen Sprachblüten aufs Korn genommen.
Der Weg führt also nicht nach innen, zu Freude, Wut und Wunden eines empfindsamen Ich. Thomas Kling hat die Ära der ,Neuen Sensibilität‘ gründlich überwunden. Seine Gedichte sind vielmehr alarmierende Lageberichte über zeitgenössische und historische Sprachzustände, sie sind nichts anderes als Angriffe auf Sinn und Verstand, aber auch auf den landläufigen Geschmack. Schnoddrige, grobianische, süffisante Töne kollidieren mit abgelegen-fachsprachlichen Wendungen. Einmal ist es sogar Goebbels Schreistimme, wie im erschreckenden „mann aus reit (rheinland)“, dann wieder ein eiskaltes Flüstern, das in die Ohren dringt. Bilder von Schlachten, brennenden Schiffen und malträtierten Körpern fallen wie Nachtmahre ins Bewußtsein.
Bringt man die Lese- und Hörerfahrung auf den Punkt, so verlangen die Gedichte nicht mehr oder weniger als das Vorsprechen und Nachbuchstabieren – nichts anderes als Alphabetisierung. Die Sprachinstallationen sind damit durchaus auf der Höhe der Zeit. Denn nichts anderes schreibt uns das Pathos der Epoche der Computer vor: durch Programmiersprachen möge ein neues, nachmodernes Lesen und Hören, die „Zeit der anderen Auslegung“ (Rilke), kommen. Exakt nämlich werden erstens Daten, zweitens Orte, drittens Namen angegeben. Um das gedichtete Leben – „lehm“ heißt das in „effi b., deutschsprachiges polaroid“ – zu harten Fakten zu machen, braucht Kling nur noch die Adresse, d.h. Widmung, beizusteuern, um sie in namentlich bekannten Lesern und Leserinnen eintreffen zu lassen.
Trakl, Celan und Priessnitz
Versetzt man sich in die Situation Ende der siebziger Jahre zurück, so ist klar, daß Thomas Kling wie andere west- und ostdeutsche Poeten dieser Umbruchzeit und Erschöpfungsphase des Gedichts gegenüber dem verbrauchten parlando-Ton nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten suchte. Symptomatisch dafür ist nicht nur die frühe Orientierung an dem Geschehen in Wien, wo Artmann, Bayer, Jandl und Mayröcker unter erschwerend kulturkonservativen Bedingungen die Moderne fortgesetzt hatten und im lauterprobenden Gedicht verschwindende Jargons konservierten; vielmehr und insbesondere ist die Ersetzung Rolf Dieter Brinkmanns durch den „Generationsgenossen“ Reinhard Priessnitz als wahlverwandten Vor-Dichter anzuführen.
Doch das Kennenlernen spezifischer Techniken der Wiener Gruppe, z.B. Konrad Bayers Wortstockexperimente, verdeckt den Umstand, daß der Weg zum Gedicht als Kunstwerk vor allem über eine ganz andersgestaltige Dichtung verlief, nämlich diejenige Paul Celans und damit die via Trakl zu Hölderlin zurückverlaufende Höhenlinie. Das ist zu beachten, weil bei der beharrlich angestrengten Suche nach vermeintlichen Vorbildern der avancierten Dichtung immer wieder Namen von experimentellen Autoren fallen, die zwar als Positionsbojen wichtig waren, deren Lyrik aber kein schulebildendes Wirkungspotential hatte. Man denke an Schwitters „Anna Blume“ oder Hausmanns „fmsbw“.
Frappierend sind die Resonanzen zu Celan vor allem in kurzen, kompakt gepreßten Gedichten wie „der insel inselin“ oder „fang“ aus dem fulminanten Band brennstabm. Wörtliche Korrespondenzen finden sich sporadisch, etwa zwischen „die tödin“ und „Zur Rechten“ aus Celans Fadensonnen. Gegenüber dem kunstvollen Gedicht der Stilartisten Rilke und George und dem in mythische Metaphorik aufgehenden Naturgedicht der Nachkriegsjahre, wie es Kling an Lehmann und Britting verhöhnt, entdeckt er an der Lyrik des jüdisch-rumänischen Dichters die tiefen Einschläge in Sprache und Leben. Sie verweisen aber nicht auf die grauenvolle Wunde der Shoah; dazu ist Klings Idiom zu sehr auf die Trennung von Erinnerung und Schmerz angelegt, vielmehr ist es die gesinterte Erfahrung des heimatlichen Sprachraums und die Durchforstung der verlorenen Czernowitzer Umgebung mit Hilfe eines präzise benennenden botanischen Vokabulars.
Glanzstück dieser tiefreichenden Auseinandersetzung ist sicherlich das vielschichtige „DAS HEIL. (,paulum, ein wenig‘)“, das sich genauestens auf Heilkräuter und Gewürzpflanzen zur Charakterisierung des jüdischen Dichtens bezieht. Leicht wird ja vergessen, daß eine Anzahl von Celans hermetisch-neologistischen Metaphern nichts anderes als fachwissenschaftliche und spracharchäologische Termini sind. Genau darauf beruht paradoxerweise auch die Anästhetik der Klingschen Texte; es ist wohl Wissen um das Leid, aber Erinnerung ohne Schmerz, die den unterkühlten Ton, gleichsam den inneren Kältepol oder die „herzumlederun“, dieser Gedichte erzeugen.
Das auffälligste Merkmal der Sprachinstallationen ist ihre zerstückte Gestalt. Vorsichtig formuliert könnte man sagen, daß der Schnitt oder die Okulation. die primäre Operation am Sprachmaterial ist. Sätze werden in Worte, Worte in Silben, Silben in Lettern zerschnitten, neu gepfropft und geäugelt. Als halluzinierte Gesprächsfetzen und sprecherlose Stimmen bildet die „Rede, die in Schrift flieht“ (Kling über Priessnitz) in der Tat eine Installation, insofern jedes Partikel räumlich mit den anderen vernetzbar bleibt. Das ist nicht zuletzt eine Strategie, um das auktoriale Subjekt zu verbergen, zu vergraben oder im Text als Inschrift zu verstreuen.
In den Text schreiben sich die Klinge, das Klingen, der geklinkerte Kopf als sinnige Verweise auf das Phantom „Ich“ ein; diese Motive arbeiten an der Erstehung eines Körpers, der nur durch das organische Medium der Stimme (Kehle, Rachen, Zunge, Lippen) vertreten ist und mit den nach modernen Medien konkurriert (Vocoder, Voice Recorder). Erst Aggression und Lust als animalische Instinkte lassen den Körper wieder spüren. Was also die Subjektivität betrifft, so müßte man von einem ,lyrischen Es‘ sprechen. ,Es‘ spricht, wie es schon Martin Heideggers Philosophie auf den Begriff bringt.
Dieses anonyme Sprechen hat unmittelbar mit der mündlichen Tradition zu tun. Die Korrespondenzen mit romantischen Liedern und noch älteren Weisen schlagen sich in Kontrafrakturen von Volksliedern nieder, wie die Zeilen aus „die gottverdammtn fotoapparate“ verraten:
bewölkungs ring an fettn fingerlein. da sag
aaaaa& singe ich
nur mehr blümlein blau blümlein
blau, blümleinblümleinblümlein blau (…)
Die Echolalie weist auf den Anfang des Volksliedes „Die Blumen“ zurück („Weiß mir ein Blümli blaue / Von himmelblauem Schein / Es steht in grüner Aue / Und heißt Vergißnitmein.“). Es sind keineswegs Bottroper Protokolle, sondern alte Volksmärchen und -lieder, die einfließen oder, die im Falle von „stazion“, zum gedichttragenden Thema werden:
STAZION
the end. dies
fiepn u. rauschn; ab-
drehende pflegersandale.
tannendreher! Der wald,
kabelwald (,verstehnsi?‘), ni-
chz mehr zu drehn, tannendreher.
den restn erhaltender rede gelauscht;
di viehmännin spricht nich mehr;
viehmännins austherapierter rest, ihr unter-
suchter tropnkopf. jakob schaltet das mikro ab,
wilhelm den
tropf.
Die Konstruktion einer anonymen Märchenstimme durch die Aufzeichnungen der Gebrüder Grimm wird grotesk parodiert, indem die „Viehmännin“, eine Bäuerin aus dem hessischen Niederzwehren, in einer modernen Klinik am Tropf und am Tropin (oder auch Belladonna) hängend, nach volkstümlichen Sprachwendungen befragt wird. Jakobs und Wilhelms Suche nach Wendungen oder Tropen mündet wahr und wahrhaftig in eine sinistre Tropenmedizin, um die sterbende Stimme zu konservieren.
Besonders prägnant treten in Klings Werk die blitzartigen Doppelbelichtungen hervor, durch die mehrere Zeitebenen und historische Figuren miteinander verschränkt werden. Das offenkundigste Beispiel ist die Überblendung in dem Zyklus „stromernde alpmschrift“ aus nacht.sicht.gerät, in dem unter dem „blaulicht“ der Alpen eine „indi / ,retina‘ lächelnde haknkroizfane“ anvisiert wird, während irgendwo kein Jägerlatein, sondern eine „arnikalitanei“ erklingt.
Der Bezug auf Celan ist evident: Das berühmte ,Todtnauberg‘ („Arnika, Augentrost,…“) schrieb dem Philosophen Martin Heidegger mit bewundernswerter Deutlichkeit die Klage um das versäumte „Wort“, nämlich die Kenntnisnahme jüdischen Leidens, ins Gästebuch. Im melancholischen Spaziergang nimmt Celan noch botanische Einzelheiten wahr. („Waldwiesen, uneingeebnet, / Orchis und Orchis, einzeln“). Im Gegenzug hält Kling in „stromernde alpmschrift“ an der Bergwelt ihre mediale Inszenierung fest. Die Alpen lassen sich nicht ohne Erinnerung an die Bilder und Sprachzustände der Vergangenheit wahrnehmen:
1
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadi alpm?
also, grooßformate drramatischster vrr-
kettungen; so dämmrunx-lilienstrahl in
riefenstahlscher lichtregie. Christiani-
sierte gipfel, meinethalbn, freie fälle;
(…)
Paradoxerweise überlagert sich in „stromernde alpmschrift“ die Anspielung auf Leni Riefenstahls frühen Bergfilm Das blaue Licht (1931), der noch von der Filmästhetik des Alpenfilmers Arnold Franck beeinflußt war, mit Friederike Mayröckers ersten Gedichten in Blaue Erleuchtungen (1973), worin im celanesken Ton z.B. von der Wiederkehr der singenden Toten zu Falun die Rede ist. Durch diese gegenstrebige Fügung erweist sich die Natur zugleich als Medium der Geschichte und Ort der Mediengeschichte.
Die anvisierten Landschaften sind in den Sprachinstallationen sowenig real erfahrene Umgebung wie die Metropolen. Erst als Sprachräume und halluzinierte Begegnungsstätten von Figuren gewinnen sie ihre (fraktalisierte) Kontur. In „berlin. tagesvisum“ aus dem frühen Band erprobung herzstärkender mittel wird eine Tagesreise nach Ostberlin, die in den Siebzigern Anlaß zu einem prosaischen Gelegenheitsgedicht gewesen wäre, in eine historische Perspektive gerückt. An einem winterkalten, verschneiten Dezembertag begibt es sich, daß die Besucher nahe des Grenzübergangs Heinestraße zwischen Prenzlauer Berg und Kreuzberg Impressionen in (sich) hineinfraßen“.
akkurat drei lettern
akkurat drei lettern an einem drei-
zehnten, am himmelblauen heinrichstag
im 12. monat, lies heinrich dezember („wir
halten das pulver, unseren pulli, trockn“)
Die berolinische Atmosphäre verdichtet sich durch Datenübertragung: Der Düsseldorfer Heinrich Heine wurde an eben dem Tag (dem 13.12.) geboren, als sein Namensvetter Heinrich IV., König von Navarra, das Licht der Welt erblickte. Letzterer war nicht nur in den Krieg der drei Heinriche verwickelt, sondern er spielte auch eine maßgebliche Rolle für die Hugenotten, die dann schon hundert Jahre später ein gutes Fünftel der Berliner Bevölkerung ausmachen sollten. In wenigen Worten kennzeichnet das Gedicht eine historische Passage, die tief in die Geschichte hineingesprengt wird. Schon Celan hat übrigens in Gedichten wie „Pau, nachts“ – Heinrich IV. wurde 1553 in Pau, dem Ort mit ,,akkurat drei lettern“, geboren – die Verfolgung der Hugenotten thematisiert und kryptisch mit dem Schicksal deutscher Juden parallelisiert.
Dem Düsseldorfer Heine gesellen sich Wiener Stifterfiguren hinzu. In einem zweistrophigen Nachruf auf Konrad Bayer findet sich eine ganz ähnliche Doppelbelichtung, die diverse Sprachbilder miteinander amalgamiert.
1
helden gedenk tage. (fahren lassn.)
immer wenner am bayerkreuz vorbei-,
vorbeikam & also abfuhr, sagt er,
zur orz-, zur herzangabe: dein
2
gas, konradin (1252–1268)!, bayerwerk das dich ent-
facht, enthauptet hat, erzengel; fla-
mmenschriftn ausm I. bezirk! und
steht. bedengx, dahinfahrend
Das Gedicht ruft das Leben und den jähen Tod des Wiener Neoavantgardisten durch evokative Stichworte herauf; die Abfahrt vom ,,bayerkreuz“ der Autobahn gemahnt an das chemische Bayerwerk im 1. Bezirk Wiens. Dann rücken nicht nur die gasabfackelnden Schlote ins Bild, sondern auch ein Namensvetter, der Landshuter Konrad IV., Herzog von Schwaben und letzter Staufer, den man in Neapel schmählich hinrichtete. Erst der zweite Hinweis schließt dann die assoziative Vernetzung der Namen und stellt ruckartig das Bild vom tragischen Freitod Konrad Bayers durch Gasvergiftung her.
Die „Bilder“ in Klings Gedichtbänden können tatsächlich materialisieren, nämlich in Form von Photographien. Bildserien wie „aufnahme mai 1914“ aus brennstabm operieren mit einer parallelen Einzelbildschaltung zum Text, allerdings so, daß jedem Bild ein lakonischer Einzeiler in die Parade fährt und auf diese Weise ironisch ein Gegenbild aufbaut. Die Laien-Photographien von Schlachtschiffen und den an einem wiesigen Ufer lagernden Matrosen stehen im Kontrast zu den Notaten, die die Photographie des kriegs- und drogengeschädigten Georg Trakl beschreiben, der mit gefalteten Händen, fast andächtig, vor der Kamera sitzt. Die Diskrepanz zwischen dem katastrophalen Innenleben Trakls und seiner äußeren Erscheinung teilt sich den Lesern am Gegensatz von Bild und Text mit. Man sieht, wie Thomas Kling ganz entschieden das Schnappschußprosagedicht à la Rolf Dieter Brinkmann verabschiedet, indem er historische Photos zur Evokation einer für ihn wichtigen „Stifterfigur“ verwendet und auf diese Weise, trotz oder gerade wegen der hier minimalistisch erscheinenden Sprachinstallation, den Kunstanspruch von Lyrik aufrechterhält.
Georg Trakl gehört zweifellos zu den wichtigsten Stifterfiguren der Klingschen Dichtung. Schon im Zyklus „wien. arcimboldeisches zeitalter“ aus geschmacksverstärker fällt der Name des Österreichers, dem durch den Hinweis auf ,,strangulierte (,in b?‘) märtyrien“ in einer Kirche, die Trakl besucht hatte, Referenz erwiesen wird. Das Motiv der abgeschnürten Stimme wird dann im vierten Teil des Zyklus kryptisch variiert, indem das Rabelais-bonmot für Landsknechte „’lans tringue!“ nicht nur durch Lautvertauschung das ,Strangulieren‘ aufnimmt, vielmehr behutsam an Trakls Aufenthalt auf der Hohenburg zwischen Lans und Igls erinnert.
Hirsch und Wespe
Zu den altertümlichen Stifterfiguren, wie sie auf Altargemälden posieren, kommen häufig auftretende, aber deutlich verschwiegenere Bilder hinzu. Thomas Kling setzt als heraldisches Hoheitszeichen und urheberrechtliches Erkennungssignal seiner Sprachinstallationen zwei in die Gedichtzyklen versenkte „Wappen“ ein. Zur Geschichte der Medien gehört eben auch das Verschwinden dieser Wappenkunst, die nahe der Malerei anzusiedeln ist.
Als Heroldsfiguren dienen ihm Hirsch – eine „hirsch-heraldig“ wie es in brennstabm heißt – und die Wespe. Vor allem in brennstabm kommt dem schon in erprobung herzstärkender mittel (,,hirschmotiv“) auftretenden Damwild programmatische Bedeutung zu, indem er den Band eröffnet und beschließt. Als Wappentier des Bandes verkörpert der Hirsch nicht nur die angepeilten Regionen von Landschaftsgedichten, nämlich die Alpen und das Rheinland als Sprachreviere, sondern sozusagen den poetischen Hoheitsbezirk dieser Lyrik, insofern sich im Hirschmotiv die unverwechselbare Bildlichkeit und Sprachform des Klingschen Gedichts verdichtet.
Als Trophäe des denaturalisierten Städters – „GARAGENWANT ALS HIRSCHWANT!“ – schießen im Hirschmotiv die trivialen Aspekte mit kulturhistorischen zusammen, etwa dem Seelenmythos wie in S. Giovanni in Laterano oder der Verfolgung Christi, und münden in das profanisierte Martyrium („des hirschkopfs augnfleisch / koptunter“). Doch diese ältesten Bedeutungen des Hirsches werden gleichsam erlegt, wenn seine Körperlichkeit als Wesensmerkmal blitzartig hervortritt. Im heraldischen Zeichen zeigt sich unverhohlen die männliche Brunft, das Äugen der Begehrten, wie es der Artemis-Mythos mit großer Insistenz tabuisiert.
Konrad Weiß bannte diese unheilvolle Jagd auf Aktäon in die triftigen Verse „er ist im reinen Tonentzwei, / er trägt den Blitz wie ein Geweih, / nun wird er selbst gejagt“. Man könnte den plötzlichen Umschlag von Augenlust in Todesangst, den „Blitzschlag mit Hirsch“, kaum prägnanter formulieren. Doch Kling geht als Operator am Sprachmaterial einen entscheidenden, entmythisierenden Schritt weiter als Konrad Weiß. Was nämlich Leser und Hörer an Klings okulierten und amputierten Texten erleben, ist der Übergang von Martyrien in Materien; so erleben sie am Corpus des Gedichts, was sich eigentlich nur halluzinieren läßt, Phantomschmerzen und Männerphantasien. Der brünftige Hirsch steht uneindeutig im Zeichen der Orches.
Die Wespe ist das heraldische Zeichen der poetischen Verfahrensweise, der Überkreuzung von Stichworten. Dutzendfach wird in den Gedichtbänden auf ihre Signalfarben, Gelb und Schwarz, angespielt und in anderen Objekten aufgesucht, sei es in einer russischen Flagge, der Amsel, dem Pirol oder dem Salamander. Gelb und Schwarz signalisieren den Angriff auf die Sinne, womit die Wespe zu einem Sinnbild der Stickattacke wird, zugleich aber auch – wie der Hirsch – zum „Wappentier“ sexuellen Begehrens.
Gilles Deleuze hat auf eine symbiotische Verbindung der Wespe mit der hodenförmigen Orchidee hingewiesen, die exakt dem Rhizom der Klingschen Texte entspricht. Beide, Blume und Insekt, bilden eine rhizomatische Formation, indem sie beide als Relais eines biologischen Kreislaufs fungieren, ohne aber auf irgendeiner Ebene gleichartig zu sein.
Dem Rhizom entsprechend, basieren Klings Texte auf sprunghafter Übertragung und Modifikation, wie in der Beziehung zwischen Orchidee und Wespe. Mit größter Aufmerksamkeit für kryptische Zusammenhänge hat schon Paul Celan die Orches als Knotenpunkt erkannt, an dem sich das Verschlüsselte „in Wappengestalt“ kreuzt und zusammenfügt. Die Wespe gehört der Welt der Gärten an, so wie sie schon in Stefan Georges Dichtung prominent hervortreten, denkt man an Zeilen wie „Die Wespen mit den goldengrünen Schuppen / Sind von verschlossenen Kelchen fortgeflogen“; es war aber erst Hugo von Hofmannsthal bzw. sein alter ego Clemens, der, gleichsam in den Weihekreis Georges tretend, diese Welt der Gärten begrifflich einfaßte und als sentimentale Halluzination umriß: Clemens, im bekannten „Gespräch über Gedichte“, sieht vor sich eine Landschaft seiner Kindheit.
Gerade solch seh- oder sehnsüchtig herbeigewünschten Bilder aus vergangenen Zeiten, den goldenen fünfziger Jahren, treten als verschroben-kleingärtnerische Idyllen ins Licht der Klingschen Gedichte, jedoch nur, um dort in scharfen, stechenden Tönen attackiert zu werden. Von den sorgsam gepflegten rheinischen Gärten wendet sich das Auge unablässig den weiten, befreienden Naturräumen zu, vor allem den Alpen, um aber auch hier nur die immer schon zweite Natur einer touristisch bestiegenen Bergwelt zu entdecken. In einem der anmutigsten Gedichte des Bandes brennstabm, dem jambisch anhebenden „wir habn im sommer in horvathschen / gärtn“, endet ein Julitag im Gartenrestaurant mit dem Angriff der Wespen:
(…) wespn, ein zweites und drittes schwellendes
wespengelächter, schwarzgelbes stechn ein
klatschn und fallen in linddreckign kies
und weiterhin ziehende wespengespräche etc.,
e t c
Angesichts des lapidaren Endes wird man wohl zunächst an rein spielerische, ,experimentelle‘ Dichtung erinnert sein, vor allem an Christian Morgensterns geläufigen Wortwitz in „Die Trichter“. Und doch, je länger man die Worte anstarrt, desto mehr starren sie als Augen zurück. Nicht anders als in Gedichten Paul Celans, in denen eine Reizvokabel wie „Tiefimschnee“ sukzessive zum vokalischen „I-i-e“ verblaßt, verspricht selbst ein „etc“ noch Sinn, ohne das Versprechen indessen wirklich einlösen zu können. Wer Worte als Augen liest, dem fügen sich die Lettern „etc“ im Wahn zum flimmernden Stichwort Wespenstich zusammen.
Durch die entmythisierten Embleme der Wespe und des Hirschs weisen die Gedichte den Naturkitsch der fünfziger Jahre zurück. In geheimer Allianz mit Klings Stifterfiguren – hier vor allem Beuys und Mandelstam – verkörpern die Wappentiere eine aggressiv-erotische Haltung zur Sprache als Kunst. Hinter der poetischen Heraldik ist ein verantwortliches Subjekt nur schwer auszumachen. Walter Seitter hat gerade diesen Umstand auf beeindruckende Weise in seinen Erläuterungen zum „Wappen als Zweitkörper“ und seiner spezifisch „vormodernen Symbolik“ herausgestellt.
Seinem Ursprung nach dient die eigentümliche Zeichensprache des Wappens dazu, die Wappenträger an der Körperperipherie wiedererkennbar zu machen; zugleich erfolgt eine entscheidende Spaltung, nämlich die Unterscheidung von Körper und Repräsentation, denn Wappen machen ihre Träger zur doppelten Person. „Als Inhaber eines Wappens verfügt der Wappenherr über die Möglichkeit, nicht nur da zu sein, wo er ist, sondern auch dort, wo er nicht ist. Er verdoppelt sich selbst in eine physische und eine juristische Person.“ Das Wappen repräsentiert aus der Ferne, es zeigt sich in den Wappenfarben (eigentlich Metall und Pelzwerk) und den Heroldsfiguren, „die in sich schon ihre Bedeutungen haben und aneinander fügen“, um auf diese Weise „die Geheimnisse ihrer Seele mit Hüllen (zu) umschließen“:
Nur im Schutz eines solchen Vor-Körpers, nur im Sich-Stützen auf einen solchen Zweit-Körper kann nämlich der Erstkörper sich halten und in der Distanz seines Hinterhaltes den Spielraum zum Aushalten der anprallenden Dinge bewahren.
Diese Charakteristik der heraldischen Funktionen stimmt mit neueren Versuchen, die Maskierung des Ich auf eine neusachliche Kälte zu beziehen, genauestens überein. So hat etwa Helmut Lethen in einer überaus anregenden Studie plausibel die Facetten eines schmerzunempfindlichen „gepanzerten Ich“ herauspräpariert und auch das Ziel dieser Abkühlung formuliert: „Macht gewinnt der Geist nur, indem er der Kälte des Negativen ins Angesicht schaut, bei ihr verweilt.“ Es sind Charaktermasken wie der Hirsch oder die Wespe, durch die das subjektum im Text verschwindet und aus der Ferne seine poetische Macht über das Sprachmaterial aussübt.
Martyrium und Medium
Somit ist das Zurücktreten des Ich weit mehr als ein formales Spiel. Den Lesern dürfte kaum entgehen, daß die unzähligen Schnitte durch den Sprachcorpus der genaue Abdruck einer Obsession sind, von der eine Vielzahl der Gedichte geprägt ist. Unübersehbar sind die Hinweise auf Martyrien und Torturen der abendländischen Geschichte. Zweifellos sind einem aus einem Pastorenhaus stammenden Rheinländer, der abendländische Kunstgeschichte studiert hat, die zahllosen Martyrien in der Malerei innigst vertraut.
Es sind aber nur noch Namen, die von den Legenden bleiben, so wie sie als Namenstage im Kalendarium erscheinen. Ihre vitae sind kein Thema, ebensowenig wie ihr namenloses Entsetzen vor der öffentlichen Exekution. Der Märtyrer bezeugt die Bedeutung der Erlösung durch die Vergegenwärtigung von Christi Tod; er ist, wie das Wort besagt, tatsächlich privilegierter „Zeuge“, dem Freude im Leiden gewährt ist. Im Martyriumsbild, spätestens seit dem Konzil von Trient, existiert ein klares Programm, um die entfesselten Emotionen zu bändigen und die Beschauer zur Devotion zu führen. Bildgewordene Martyrien konstituieren ein Dispositif der Macht, im Sinne Michel Foucaults, und zwar durch eine Überwältigung der Sinne. Die Zeugenschaft der Märtyrer wird durch einfallende Stichworte mit großer Eindringlichkeit hervorgehoben.
Mit den Heiligen Antonius von Padua, Florian, Laurentius, Lucia, Magdalena, Veronika und immer wieder Sebastian werden in den Gedichtbänden nicht nur Namenspatrone angeführt; vielmehr werden heilige Zeugen benannt, die für eine ganze Geschichte von Straf- und Folterpraktiken stehen und damit die humanistische Tradition der christlichen Tafelmalerei als Horrorvision entblößen.
Demgegenüber versinken die alltäglich vorbeiflimmernden Bilder in den Nachrichten, z.B. die Berichterstattung eines be- oder „erstattungsunternehmers“, nämlich „unseres nah-korrespondenten paul broca“ vom Nahostkrieg, im weißen Rauschen nach Sendeschluß. Die mangelnde Anteilnahme am Kriegsschrecken eines x-beliebigen Zuschauers resultiert aus dem Anschluß an die Telemedien, denn die Bilder und Stimmen treten nicht ins Innere, sie bleiben nicht erinnerbar. Die täglichen minutenlangen Televisionen vom Schrecken der Welt hinterlassen ein abgestumpftes Subjekt.
Welche Funktion nehmen all diese Märtyrer also in Klings ausgesprochen unsakraler Poesie ein? Zwischen Martyrium und Medium entspinnt sich eine sublime Beziehung. Man könnte sagen, vormoderne Martyrien sind das genaue Gegenteil der nachmodernen Medien: Die ersteren zeugen von der Erlösung, die letzteren erlösen von der Zeugenschaft. Nichts wirft ein stärkeres Schlaglicht auf die radikale Umwertung der Werte, die Kling durch derartige subthematische Gegenüberstellungen im Material Sprache vornimmt. Ohne daß irgendein lyrisches Ich wirklich einmal sagte, was es meinte, werden subtile Dinge sondiert, die keine Medienanalyse klarer herauszustellen wüßte.
Durch die rhizomatische Verflechtung des Wortmaterials ist eine auktoriale Grundhaltung nicht mehr auszumachen. Klings Installationen, wie die avancierte deutschsprachige Lyrik der jüngsten Gegenwart überhaupt, geben keine andere intellektuelle Position als die des Wissens zu erkennen. Politische Attitüden, vormals Erkennungszeichen der poetischen Selbstverständigung, sind dem Sprachartisten bei der Suche nach einer künstlerisch anspruchsvollen Formsprache gründlich vergangen.
Doch die poetischen Spreng-Sätze, wollen sie ihrem Namen gerecht werden, sind gerade im Gesellschaftlichen brisant, weil sie den Verfall der politischen Kultur(en) aufzeichnen. Es gibt zwar keine einzige eindeutige Fluchtlinie (um mit Deleuze zu sprechen), es gibt „keinen Dualismus oder keine Dichotomie, noch nicht einmal in der rudimentären Form von Gut und Böse“, Klings Gedichte archivieren jedoch, mittels Gefrierschnitten durch verschiedene Epochen einer Region wie Tirol oder dem Rheinland, die Szenen der Gewalt und machen sie als Sprachzustände, als gefrorenen Haß, faßbar.
Läßt man sich spielerisch auf die komplexen Sprachinstallationen ein, so entdeckt man, daß sie den Begriff der subjektiven Erfahrung ins Abseits führen. Denn als zerschnittene Gewebe oder fraktale Gebilde verdanken sie sich keinem tiefen Erlebnis, sondern sie sind durchweg okkasionell bestimmt. Die verdichteten Texte mögen zwar noch gut goethesch „durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregt“ sein, doch ihren Ursprung haben sie definitiv nicht mehr „im unmittelbaren Anschauen irgendeines Gegenstandes“, wie der Weimaraner seine klassische Bestimmung okkasioneller Lyrik ergänzt. Was schon, wie man sich erinnern wird, in den frühen sechziger Jahren von Günter Grass gegen die Labordichtung der ,Konkreten Poesie‘ vorgebracht wurde, verdankt sich dem Unbehagen an einer Strukturschwäche dieser Lyrik, nämlich der Sterilität des seriellen Verfahrens.
Nun setzt auch Kling auf das Brio des Gedichts, freilich nicht in der lapidaren, alltagssprachlichen Notiz, sondern dem recherchierten Wortfeld, das das Leben („lehm“) als Sprachmaterial (Lehm) bildbar macht. Es war übrigens Hans Georg Gadamer, der in seinem berühmten opus magnum Wahrheit und Methode als einer der ersten wieder auf das Moment des Okkasionellen aufmerksam macht, um die – damals von Käte Hamburger vertretene – Erlebnisästhetik zu torpedieren und die rein biographische Deutung ins Abseits zu stellen.
Diese Polemik aufgreifend kann man nur betonen, daß es eben nicht darum geht, private Lebensaugenblicke des Kölner Lyrikers zu rekonstruieren. Das sprachsensitive Gelegenheitsgedicht, wie es sich durch Situation, Widmung und Datum auszeichnet, ist durch und durch äußerlich, es bindet das Intime an das Öffentliche, an die gesellschaftlichen Rollen. Weil es das subjektive Erleben nicht mehr gibt, finden sich auch keine klassischen Liebes- und Naturgedichte in seinem Werk. „brandige blüthe. (als zaunkönig)“ aus brennstabm, eine derbe Pastorelle in der Tonart eines Catull oder Oskar von Wolkenstein (man lese seine „Graserlieder“) lautet so:
brandig schon deine blüthe; rostig ro-
stig gewordene MAGNOLIE. ränder von
liedschattn, schwer. du di du den dein ab-
schied gibst und hältst; das gibt hundefeuer,
gelb herstrahlend am stamm, lakonisch ries-
elnde pisse; dies im abend licht APRIL, zur
nacht.
aaaaaja. schon brandig, skorbutig am fleisch
des kaffeehauses, nacht-mensch & stummer honig.
diener am stamm! HILFSGEIST MORGENRÖTHE!
aaaaaaus to
nnen hohler ton: servus, kunst. „ober, ein tablett
flieger!“
aaaaaaaoh, karthia/ herzas mein ganzes spiel (ich
besitz, klar, di flöte..). heraus herzas, heraus als
zaunkönig „tun wirs, servierlady!“
An sprachlicher Dichte ist diese Strophe kaum überbietbar. Die Gelegenheit zur Liebe ergibt sich in einer Aprilnacht in einem Kaffeehaus, vor dem die Gäste körperliche Erleichterung suchen. Am Stammtisch, während des Kartenspiels, ergeht dann eine anzügliche Aufforderung an die Kellnerin. Die Dame, über deren Alter und Blüte man nur soviel erfährt, daß sie, wohl als Zaungast oder -könig der Gespräche, versucht, ihre Gesichtsfarbe durch rostig-karthaminfarbene Schminke aufzufrischen. Lautstark flöten die Zecher mit hohler Stimme diese Eos wie aus einer Okarina an; sie aber, der Hilfsgeist und das „herzas“ des Lokals, bringt keine Katharsis. Der weite Bedeutungshof des Gedichts umgibt zunächst einmal das sinnlose Lautzentrum o-a / e-a („oh, karthia/ herzas“); was erst wirklich Sinn macht, sind dann allerdings Aufpfropfungen der Wortstämme und die Augen der Leser.
Klings bemerkenswerter Beitrag zum zeitgenössischen Schreiben von Gedichten dürfte wohl vor allem darin liegen, daß er durch seine höchst eigenwilligen poetischen Verfahren eine Linie der deutschsprachigen Lyrikgeschichte wiederbelebt hat, die in Westdeutschland durch die seriellen Mutationen der ,Konkreten Poesie‘ und die kunstarme ,Neue Sensibilität‘ einen Abbruch erfuhr. Diese spielerische Linie hatte hingegen in Österreich durch den lebendigen Bezug zur tatsächlich gesprochenen Sprache und modernen lautschöpferischen Artikulation bei Mayröcker, Jandl, Bayer, Kaser und Priessnitz eine Fortsetzung gefunden.
Es ist die Erkenntnis einer Wahlverwandtschaft mit diesen Autoren, wodurch Kling früh sein eigenes Idiom entwickeln konnte und schließlich, was seine Wirkung auf jüngere Autoren betrifft, zum wichtigsten Impulsgeber für die avancierte Lyrik wurde.
Erk Grimm, Schreibheft, Heft 47, Mai 1996
Dioskurenklage
1
Und dann kam Thomas Kling, eine Stimme von schneidender Schärfe, sein Gedicht ein Glasschneider, der die Oberflächen deutscher Gegenwartssprache auftrennte, sie in scharfkantige Zacken und Splitter zerlegte. Das Phänomen seiner Ausdruckskunst: bei ihm war (zunächst) alles auf Destruktion angelegt, nonkonformistisch, später kam der Schulgründer in ihm durch, ein Tribut an die Fortentwicklung der eigenen Poetik, das war die Phase der Dekonstruktion. In einem ganz buchstäblichen Sinne ritzte und kratzte da einer an den vertrauten Worten herum, brach den lyrischen Satzbau auf, erhöhte die Konsonanten-Dosis, indem er Vokale herausschnitt, Endungen wegfräste, Effekte des Stotterns forcierte, der alogischen Echolalie. Der Titel eines Sprachhandwerkers wäre für Kling alles andere als beleidigend gewesen, im Gegenteil, er selbst hatte die Vorstellung vom Installateur aufgebracht, als er seine Gedichte Sprach-Installationen nannte. Hier war einer mit dem absoluten Gehör für Deformationen des gegenwärtigen Deutsch, ein Gutachter der idiomatischen Schäden, an denen ablesbar war, was Sozialgeschichte und Naturzerstörung an ihr hinterlassen hatten. Sein Vers zielte von Anfang an auf die mentale Vergegenwärtigung solcher ,Kaputtheit’ durch die Störung des Lautbildes, den zerbrochenen Klang, das graphische Äquivalent für den Sprung in der Platte. Es war, als hätte ein kräftiger Raucherhusten Einzug gehalten in die wohlbehütete Kleinkunst der Gegenwartspoesie. Thomas Kling gehörte zu den seltenen Stimmen, die man sofort im Ohr behält. Ich kann sie mühelos abrufen aus den Tonarchiven hinter dem Trommelfell, metallisch und klar in ihrer Diktion, und manchmal sucht sie mich in der Erinnerung heim.
2
Unsere erste Begegnung ergab sich 1988 auf der Frankfurter Buchmesse. Wir waren beide Neulinge in den weitläufigen Bücherhallen, als wir in jenem letzten Jahr vor dem Mauerfall gemeinsam dem Verlag beitraten, der unsere ersten Gedichtbände einem größeren Publikum vorstellte. Eine Weile lang wurden wir damals als Dioskuren gehandelt, ungeachtet der schroffen Unterschiede, als das ungleiche Vorzeigepaar einer neuen deutsch-deutschen Dichtergeneration. Einmal besuchte ich ihn in Köln, wo er mir in seiner winzigen dunklen Bruchbude im Bahnhofsviertel, in Bergschuhen und Trenchcoat auf dem Bett liegend, seine jüngsten Arbeiten vom Blatt vortrug. Ein andermal fiel ich in einer Bar in Berlin-Kreuzberg beinah vom Hocker, als ich ihn in Begleitung zweier falscher Spießgesellen einrücken sah und er mich kaum grüßen konnte vor Scham, so geheimpolizeimäßig abgeführt zu werden. Erst auf der Herrentoilette, man stand nebeneinander und hielt die Blicke gesenkt, kam etwas Licht in die Sache, die Irritation aber ist seither geblieben. Ich hatte begriffen, dass meine Zuneigung allzu einseitig gewesen war. Ich hatte ihn gern gehabt, doch equal affection kommt selten vor, also hielt ich es mit Wystan Hugh Auden: ,Let the more loving one be me‛. Ich mochte seine großspurige Art, die reine Verletzlichkeit war und ihn vor Zudringlichkeit schützen sollte. Zigarette im Mundwinkel, und die große Lippe riskiert. Den herzensträgen eine kalte Dusche verpassen, den faulen Lyrik-Schwärmern, das war die Devise. Man sah, wie er in jenen Jahren den Ruf regelrecht genoß, als offenes Messer herumzulaufen. In Wahrheit war er eher zerbrechlich und unendlich empfindsam. Unsere Ansichten über Dichtung gingen weit auseinander, aber wer weiß, ob sie sich nicht im unendlichen weiter treffen. Einmal bat er darum, Heiner Müller vorgestellt zu werden, das war im Trubel eines der messeüblichen Verlagsempfänge in einer Frankfurter Theaterkantine. Er war etwas verblüfft, als der Fürst des historischen Pessimismus ihn wie selbstverständlich auf die Wange küsste wie einen Satansbruder. Doch da er als Dichter, was Marotten, Weltanschauungen, Künstlerallüren anging, nie zimperlich war, hat ihn auch das gehörig befeuert. Mir sind die schnellen Wechsel in seinem Gesichtsausdruck unvergeßlich, das jungenhafte Komplizengrinsen, wenn ihm plötzlich etwas aufging. Überhaupt konnte man in dem feingeschnittenen, blassen Angryyoung-man-Gesicht wie in einem offenen Buch lesen. Er war auf eine seltene Weise begeisterungsfähig und folglich oft hin und hergerissen zwischen widerstreitenden Ansichten. Er liebte die flotten Sprüche und teilte gern blitzartig aus, aber er war auch im einstecken großzügig. Ich könnte schwören, daß er niemals imstande war, hinterrücks zuzuschlagen – den einen oder anderen unkontrollierten Nebensatz, Anthologie-Kommentar einmal beiseite. Das Wort Pop jedenfalls, soviel Würde besaß er, wäre ihm nie über die Lippen gekommen. Später kreuzten sich unsere Wege noch oft, bei mancher Privatlesung wie auf Internationalen Poesiefestivals, die Beziehung wurde verwickelter, angespannter auch. In unserer Branche wird mit harten Bandagen gekämpft, Trunkenheit im Dienst ist keine Seltenheit, und schnell riecht es nach Prügelei. Eines schönen Tages aber fanden wir uns als erwachsene Autoren wieder, Inspektoren in Sachen Poesie, die für ihr Kontrahentendasein nur ein Verschwörerlächeln übrig hatten. Bei einem der letzten gemeinsamen Auftritte trat der Dichter Rühmkorf an uns heran, er war eben von der hohen Bühne herabgestiegen, taxierte uns beide herablassend und sagte: „Nun übernehmt ihr mal, Jungs“ – worauf wir uns ansahen und uns wie brave Musterschüler unisono bedankten für diese Überdosis an Jovialität.
Einmal zogen wir durch die Düsseldorfer Altstadt wie in alten Tagen. Er, wie immer die Hände in den Taschen, in einem anderen Trenchcoat, bewegte sich federnd auf diesen Straßen, vorbei an den vertrauten Galerien und Kneipen, es war sein Revier. Er zeigte mir den ,Ratinger Hof‛, jenen Ort, an dem er sein coming out gehabt hatte als stimmgewaltiger Vortragskünstler, mit einem Sprung auf den Klavierdeckel – ,alle mal herhörn!‛, so die Legende, breitbeinig aufgepflanzt, direkt unter den Augen des ehrlich erstaunten Joseph Beuys.
3
Vor kurzem geschah dann das Unerwartete: ich glaube, man nennt so was ein Schockerlebnis. Im Arbeitszimmer meiner Frau neben dem Schreibtisch ist ein Platz an der Wand reserviert, den seit langem ein feiner, rechteckiger Schatten umrahmt. Jährlich wechselnd, wird an dieser Stelle, einem Gedenkritual folgend, das typisch ist für einen Leserhaushalt, der Arche-Literaturkalender aufgehängt. Da springt mich an einem Sonntagabend beim Umblättern, ohne Vorwarnung, ein Photo von Thomas Kling an. Und während ich noch mit meiner Beklommenheit kämpfe, fällt mir der vertraute rabauzige Ton ein, mit dem er einen nach langer Abwesenheit begrüßen konnte. Dazu muß man wissen, daß nur toten Autoren die Ehre widerfährt, in diese Galerie aufgenommen zu werden, und auch nur unter ihrem Todesdatum. Lauter Tode, jede Woche eine andere Verlustanzeige, doch das Konzept erschöpft sich nicht in der Trauer, es zielt auf Erleuchtung, und siehe da, die Rechnung geht auf. Beim Anblick des jungen Mannes, der mich von oben herab anblickte (mit einem leicht ironischen Zug um den Mund), blieb mir die Spucke weg. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich wieder den Stich, der einem sagt, wie unzuverlässig und vorübergehend diese Realität ist. Da ist einer eben noch da gewesen, hat im gleichen Rhythmus wie du Buch um Buch herausgebracht, Beleidigungen und Preise hingenommen, seine ganze Kraft in die Arbeit an kleinen Sprachkunstwerken gesteckt – und im nächsten Moment ist er einfach fort, und du kannst zusehen, wie er von der anderen Seite her auftaucht, liebenswürdiger denn je, von einem milden, aus den Pressearchiven strömenden Jenseitslicht umstrahlt. In diesem Jahr wäre er Fünfzig geworden. Und so kam es, daß ich auf einen Zettel den Anfang zu einem Portrait dieses letzten jungen Wilden unter den deutschen Dichtern schrieb, im Stil einer Kalenderbildlegende. Thomas Kling: Rheinländer wie Stefan George, Extremsprachmodernist, Bergwanderer, seine Dichtung war die eines hellsichtigen Großvaterkindes, eines Auferstandenen aus dem ,schtzngrmm‛ des Ernst Jandl und den lyrischen Granattrichtern des August Stramm, der im Ersten Weltkrieg als Kompagnieführer in Rußland fiel.
Durs Grünbein, aus: Heidemarie Vahl & Ute Langanky (Hrsg.): den sprachn das sentimentale abknöpfn, Heinrich-Heine-Institut, 2007
„Thomas Kling ist tot“
− Notizen zu einem deutschen Dichter. −
LITERATUR UND TOD
d literatur, des wisz jo
ist a gaunz a diaffs grob
wo kaana drin waas
ob a jemoes a r aufaschdehung hod
Ernst Jandl
Sonntagnachmittag, 3. April 2005. Übermütiger Sonnenschein schon den ganzen Tag. Ich bin erschöpft von einem Spaziergang von Steinfeld nach Urft hinunter und zurück den Berg nach Steinfeld hinauf. Dröhnende Motorräder – blühende Osterglocken. Nach einer exorbitanten Tasse Darjeeling sitze ich in meinem Lieblingssessel und lese in Dieter Fortes Das Haus auf meinen Schultern, der Romantrilogie, die den 2. Weltkrieg und vor allen Dingen den Luftkrieg aus Sicht der Bevölkerung schildert. Ein Buch, von dem W.G. Sebald annahm, es existiere gar nicht. Während ich die Wörter aufnehme, blicke ich bisweilen hoch und betrachte die Blumen – Osterglocken und Primeln −, die im Garten blühen. Ich beobachte das Spiel der Schatten mit den Ästen der Bäume. Das Bild des am Vorabend verstorbenen Papstes erscheint vor meinem geistigen Auge. Ich warte auf das Schlußresultat der Begegnung zwischen den Münchner Löwen und den Kölner Geißböcken hier geht es am 27. Spieltag um den Aufstieg in die Bundesliga. Ich lese: „Am anderen Morgen, als alle den Raum verließen, lag er immer noch da und bewegte sich nicht und starrte in den Himmel und war tot. Der Junge sah noch lange diesen dunklen, bewegungslosen Klumpen, für den sich keiner interessiert hatte, das Lied und den schreienden Gesang vergaß er nie mehr.“ Einige Seiten zuvor wurde Louis Armstrong erwähnt (die Amerikaner sind in das Städtchen einmarschiert), und ich suchte die entsprechende CD heraus, um „C’est si bon“ zu hören. Wenige Sekunden später – gegen halb fünf – klingelt das Telefon. Das ist selten geworden an einem Sonntagnachmittag. Ich unterbreche die Musik. Das Display auf dem Hörer verrät, nichts außer: Unbekannt! Es ist Axel Kutsch.
EIN ÜBERAUS SCHÖNES UND BLAUES MANÖVER /
LILIEN AUF DIE BRUST GEMALT /
FÜR THOMAS KLING
in den Haaren die Lindenbaumfächer
nordafrikanischer Knötchenfrucht
springen im funkelnden Wind nämlich
zu Boden geschüttelt vom zaubrischen
Schopf oder Duft oder Hölderlins Jugendlocke
oder es steigt ein Hündchen schwammig
ins herbeigerufene Taxi
oder es stehen weisze Tennisschuhe zum Trocknen
in der Sonne am offenen Fenster
oder man liegt ausgestreckt mit wächsernen
Ohren auf einer Bank im Halbschatten des Baumes
welcher die Herzschläge zählt
/ einer heiligen Caterina von Siena
mit dem Lilienstab vor den weiszen, vor den
halbgeöffneten Augen
Friederike Mayröcker
Ich wundre mich, denn wir haben doch alles Notwendige in mehreren Mails während der letzten Tage besprochen. Es ist klar, daß er anruft, um etwas Außerordentliches mitzuteilen. Ich rechne mit einer guten Botschaft. Doch er sagt nach einer kurzen Begrüßung: „Thomas Kling ist tot.“ Er hatte es soeben von Markus Peters erfahren. Da wir Karfreitag, also vor einer guten Woche erst, so lange beisammen gesessen und u.a. über Thomas Kling und dessen neues Buch Die Auswertung der Flugdaten gesprochen hatten, war es nur konsequent, daß er mich gleich informieren wollte. Ein so intensives, ja, rauschhaftes Gespräch über ein Buch, das sich im ersten Kapitel radikal mit dem Tod auseinandersetzt – und jetzt diese Mitteilung. Ein Schlag. Wir reden vier Minuten lang über Thomas Kling, den wir zu den drei wesentlichen Vorreitern der Lyrik der letzten 20 Jahre zählen. Ein herber Verlust. (Ich weiß, Herr Wittgenstein, die Wörter versagen: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen.“) Ich bin Thomas Kling, der stets betonte: „Gedichte sind immer vom Rhythmus geprägt, sonst sind es keine Gedichte“, nie persönlich begegnet, wir haben nicht einmal telefoniert oder auch nur einen Brief gewechselt. Aber seit knapp 10 Jahren befasse ich mich intensiver mit seinem Werk als mit dem der meisten Autoren, von denen ich Gedichte gelesen habe. Nach Rolf Dieter Brinkmann besetzt er einen der nächsten Plätze. Meine Rezeption Thomas Klings gleicht einem Kämpfen und Ringen, Kling ist ein Dichter der „eckn kantn“ und „anmut und rohheit in stückn“. Wenn ich seine Gedichte lese, bin ich notwendigerweise totalissi me konzentriert, aber gleichzeitig distanziert, abgekühlt [Hier geschieht − natürlich − was beim Lesen aller guten Dichter passiert: Die lyrische Tiefenstruktur der Texte überträgt sich umgehend auf den Leser. Kling ist als Autor der Installationsmeister, ich als Leser (zwangsläufig) sein (souveräner) Geselle, seine Gedichte nennt er nicht Gedichte, sondern – „Sprachinstallationen“, anarchisch, bissig, knochig, hier „glitscht“, „spült“ und „bröckelt“ es − horizontal und vertikal.] während Rolf Dieter Brinkmanns Gedichte mich bekanntermaßen mitreißen. Ich habe großen Respekt vor der Leistung dieses lyrischen Schwerarbeiters Kling, dieses Hauers und Steigers in Personalunion, empfinde aber – außer dem höchsten Respekt vor der großen lyrischen Leistung – bei weitem nicht das, was ich für das Werk Brinkmanns empfinde. Dazwischen liegen tatsächlich Welten. [Schwer zu erklären das, ich weiß, aber hier geht es natürlich auch um Neigungen und Vorlieben, die über das Intellektuelle hinausgehen.] Allerdings – ohne die Auseinandersetzung mit Thomas Kling fehlt Dichtern, die in der Welt der deutschsprachigen Lyrik mitreden und mithalten wollen, ein entscheidender Pfeiler in der poetologischen Argumentation. [Gleiches sage ich, wie bekannt, von Rolf Dieter Brinkmann. Überhaupt spricht nichts dagegen, Thomas Kling und Rolf Dieter Brinkmann in einem Atemzug zu nennen. Beide haben am selben Stamm geschnitzt − jeweils am anderen Ende. Kling (der 1990 das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln erhielt) beschleift die Wörter, Brinkmann hämmert die Wörter durch dröhnende monotone Wiederholungen in die Köpfe. Beide wollen so die morsch (!) gewordene Sprache: aufmöbeln − aktuell, modern, konkurrenzfähig, zeitgenössisch (…) machen. Kling hatte, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten mit Brinkmann, als ihm lieb waren. Wo er sich mit George gern identifizierte, distanzierte er sich von Brinkmann. Beim Lesen der Neuausgabe von Westwärts 1 & 2 fällt mir auf, daß auch Brinkmann gelegentlich − der gesprochenen Sprache angepaßt − Vokale ausläßt. Wir wissen, daß kein Dichter gesprochene Sprache / Slang / Jargon so konsequent in lyrisches Argot verwandelt hat wie Thomas Kling, dessen Gedichte ich beim Lesen immer wieder vor mich hinflüstere: So gewinnen sie eine zusätzliche Qualität, die Kling gewiß auch vorschwebte − wobei ich eingestehe, daß mir Klings mündlicher Vortrag seiner Gedichte nicht liegt (ich weiß, er gilt als großer Performer), weshalb ich in diesen Notizen auch nicht näher auf diese gewichtige Komponente Klingscher Klangkunst eingehen kann. So findet jeder Leser seinen Weg zum Werk eines Dichters.] Ich sitze wieder im Sessel. Versuche weiterzulesen. Lese eine Seite, blicke hoch, lese, höre, Köln habe sich ein mageres torloses Unentschieden erspielt (damit werden auch Politycki und Seiler nicht zufrieden sein), die Sonne ist hinter dem Haus verschwunden, ich müßte mich jetzt ins Eßzimmer setzen, um auf die sonnenüberflutete Wiese zu blicken, auf der die vielen noch blattlosen Bäume und Sträucher stehen, die ich im Laufe der Jahre angepflanzt habe. Wieder klingelt das Telefon. Es ist für meine Frau. Ich gehe die Treppe hinunter in den Raum, den Axel Kutsch „Lyrikkabinett“ nennt und in dem zwischen all den Büchern der Rechner steht, den ich hochfahre. Ich lege einen neuen Ordner und eine neue Datei an und beginne diese Zeilen. Ich stehe auf und gehe an das Regal mit den Bänden der Autoren, die mit K beginnen: Kästner, Kavafis, Kirsch, Kirsten, Klabund, Kühn, Kunert, Krechel, Krolow, Kutsch und greife das Dutzend Bücher von Kling heraus.
Zunächst blättre ich in erprobung herzstärkender mittel, geschmacksverstärker, brennstabm, nacht.sicht.gerät, dem 1994 bei Suhrkamp erschienenen Sammelband, der die vier ersten Lyrikbände Klings umfaßt, in denen es immer wieder auf ätzende, bellende, auch sarkastische, wenn nicht sogar zynische Sprachart und Sprechweise zur Sache geht, [erprobung herzstärkender mittel ist Thomas Klings Debütband. Er erschien Mitte der 1980er Jahre in der Eremiten-Presse (Düsseldorf), dem feinen Kleinverlag, den Victor Otto Stomps 1949 gründete.] sodann in geschmacksverstärker, das ich zusätzlich als Einzelausgabe besitze (mein erstes Buch von Kling überhaupt); [Mit Thomas Klings Gedicht „sendeschluss“
SENDESCHLUSS
aaaaazackn, faltnwürfe, ge
tränkter nabel; unterm geweihten
hirschn vermischt sich der speichel,
ein entstehendes nach mitternacht
zungenbild;
aaaaaaaaaflackernde couch,
darüber geht das schattenrangeln,
bündige umklammerung; überm kleider-
berg (dunkler bausch) gestöhnte
schrankwand: unüberhörbares weis-
ses rauschn, gebauschtes dunkel,
hingehuscht
und dem kurzen Kommentar über das Buch endet der Hauptteil von Ohne Punkt & Komma: „Und überhaupt, womit wurde die Lyrik der 90er Jahre denn eigentlich eingeläutet? Nein, nein, nicht in diesem globalen Sinne, der Ihnen jetzt vielleicht in den Kopf schießt, ganz konkret will ich mich festlegen, auf ein einziges Buch: Ich habe mich für Thomas Klings geschmacksverstärker von 1989 entschieden. Hier sind Gedichte aus den Jahren 1985/88 versammelt, die Vorreiter sind für (s)einen dominanten repräsentativen Stil der 90er Jahre, mit dem eine Reihe von Dichtern sich besonders intensiv auseinandergesetzt hat: Marcel Beyer, Dieter M. Gräf, Norbert Hummelt, Ingo Jacobs, Enno Stahl sind Namen, die mir in dem Zusammenhang spontan einfallen.“] ich lege das Bändchen aus der Hand, nachdem ich hier und dort ein Wort, ein paar Verse gelesen, nein, wohl in erster Linie die graphische Gestaltung der Gedichte und die Anordnung der Verse betrachtet habe, und greife zu einem meiner Kling-Favoriten: wände machn, das Buch mit Aquarellen und Gedichten, das er gemeinsam mit Ute Langanky gemacht hat und das – in buchkünstlerisch anspruchsvoller Aufmachung – 1994 bei Kleinheinrich in Münster erschienen ist. Meine bevorzugte einzelne Sprachinstallation von Thomas Kling (in dessen Werk Gottfried Benns Diktum „Man muß das Material kalt halten“ eine entscheidende Rolle spielte) – das 12strophige Urbangebilde Manhattan Mundraum, gespickt mit „granitplattn“, „organbank“, „hotelheizkörper“, „nachtthier“, „satellitnphotos“, „nagelschluchtn“, „schwirrflügler“, „morsche palisadn“, „rostplackn“, „schwarzglühende suppe“, „steinbrei, der dickt“, das auch wieder das Klingsche Forschen nach dem Ursprung der Wörter, das Ausschwärmen und Eindringen in alle Schichten der menschlichen Existenz, das Zerhacken und Zerbröseln, Zentrifugieren und Amalgamieren präsentiert steht im hochmodernen, metaphorischen, katachresischen, synästethischen, onomatopoetischen, simultanischen Gedichtbuch morsch, 1996 bei Suhrkamp publiziert, aus dem ich die erste von zwölf sich ständig steigernden Strophen zitiere:
MANHATTAN MUNDRAUM
1
die stadt ist der mund
raum. die zunge, textus;
stadtzunge der granit:
geschmolzener und
wieder aufgeschmo-
lzner text. beiseite-
gesprochen, abgedun-
kelt von der hand: die
ruinen, nicht hier, die
zähnung zählung der
stadt!, zu bergn zu ver-
bergn! die gezähltn, die
mit den weißn gebissn,
die aus den blickn ent-
fertn: die gesperrtn.
maulsperre, mundhöhle
die stadt.
Hören wir Nicolai Kobus:
Mit morsch, so scheint es, hat Thomas Kling sein Schreiben im SYNAPSN-SLANG perfektioniert. Mit beeindruckender Souveränität verfügt er über sein Arsenal an poetischen Gestaltungsmitteln: Kaum einer bricht derzeit virtuoser Zeilen auf und um, bewegt sich leichter durch das permanente Wechselspiel von Demontage und Rekonstruktion, dem Beschaben und erneuten Überschriften verwirrender Palimpseste.
Dabei gelingen Thomas Kling unterschiedlichste Tonarten, und so überrascht er mich mit diesem vollkommen anders als „manhattan mundraum“ klingenden Gedicht:
DER MÖNCH VON MONTAUDO:
PLAZER
und es gefällt mir sehr im sommer
an quelle oder fluß mich aufzuhaltn;
und grün di wiese, blumenflor unds
singn sanft die kleinen vögel;
und meine geliebte, insgeheim,
es schnell mal mit mir macht.
Lyrikdoktor Jakob Stephan (das ist Steffen Jacobs) stellt in Lyrische Visite (Haffmanns, Zürich 2000) allerdings keine günstige Diagnose für Thomas Kling: „In MORSCH nun fallen wohlfeile Pose und höherer Sinn ein ums andere Mal auseinander.“ Dann wissen wir das auch.
Die beiden gleichartig gestalteten, gleichsam wespengelben Gedichtbücher Fernhandel (1999) [Thomas Kling überrascht in Fernhandel mit Formen, die ich so bislang von ihm nicht kannte. Die seit spätestens 1989 präsente, immer wieder auf ihre Haltbarkeit erprobte typische „Klingform“ (gleichsam seine poetische Haut) ist − natürlich − durchscheinend, aber die langversigen Dreizeiler auf den ersten Seiten und am Ende des Buches sind etwas so bei Kling noch nicht Gelesenes. Und daß (und wie!) er sich u.a. mit dem letzten mittelalterlichen Minnesänger Oswald von Wolkenstein beschäftigt, macht diesen (in der Öffentlichkeit mitunter unnahbar wirkenden) Kling auf einmal verblüffend zugänglich − auch sprachlich: Da sieht man, wie kongenial nachzuempfinden dieser hypersensible Typ in der Lage ist. Prosahafte Simultancollagen, extrem rhetorische attributive Kombinationen zu Bildern aus dem Ersten Weltkrieg − kühle Elegien? Kling zu lesen heißt sich die totale lyrische Dröhnung geben: Diese antikisierende, assoziative, dichte, hommagierende, intensive, kritische, lautmalende Art zu dichten, Wort zu Wort zu setzen, cool, selbstgewiß, kompromißlos („es tut mir leid: gedicht ist nun einmal: schädelmagie“), läßt mich zum einen nicht los und beeinflußt mein weiteres Tagesprogramm enorm, von der Nacht ganz zu schweigen. Diese forcierte Lyrik empfinde ich wie eine bewußtseinserweiternde Droge (die anscheinend nicht jedermanns Sache ist − immer wieder kommen mir geradezu feindselige Töne von Autoren zu Ohren, die offenbar überfordert sind mit dieser gleichsam sprachsprengenden Poesie). „Das Gedicht duldet nur keine Unduldsamkeit.“ (O-Ton-Kling)] und Sondagen (2002) fallen mir in die Augen: Sie sind in der gewichtigen Lyrikreihe, die Christian Döring seit einigen Jahren bei DuMont herausbringt und in der Thomas Kling (vor allen Dingen, wenn wir die außerhalb dieser Reihe erschienenen Titel hinzurechnen) die erste Geige spielt. Thomas Kling wird − über seinen Tod hinaus − das lyrische Zugpferd im Literatur und Kunst Verlag DuMont sein und bleiben. Bei DuMont hat Thomas Kling endgültig seine Verlagsheimat gefunden, und ich bin sicher, daß hier in einigen Jahren die Werkausgabe eines der bedeutendsten deutschsprachigen Dichter seit Ende der 1980er erscheinen wird.
Thomas Kling hat die Lyrik der 1990er Jahre in ihrer Aufbruchstimmung und Vitalität maßgeblich geprägt und sein dichterisches und essayistisches Werk, das er in seinem letzten Buch endgültig ineinander verschränkt, bis zu seinem Tod im Jahre 2005 konsequent vorangetrieben und perfektioniert. Das beweist er auch mit seinen gleichsam polyglotten Sondagen, [Mit Fernhandel, Sprachspeicher, Botenstoffe sowie Auswertung der Flugdaten gehört Sondagen zu den fünf ausgefallenen lyrischen bzw. essayistischen Büchern, die zeigen, wie stark sich der DuMont Buchverlag für den Dichter Thomas Kling einsetzt. „Manhattan Mundraum“ gehört, wie erwähnt, zu meinen absoluten Favoriten unter den Sprachinstallationen Thomas Klings. Nun lese ich in Sondagen die Fortschreibung dieses grandiosen Gedichts, die mich zunächst weniger anspricht. Thomas Kling, der sein Lebtag an seinem Konzept, die deutsche Lyrik habe sich seit ihren Anfängen konsequent auf ihn hin entwickelt, gefeilt und gewirkt hat, zeigt aber auch in Sondagen − beispielsweise mit inkomparablen komplexen Wortklanggebilden wie „Kiel“ und „villa im rheinland“ − erneut, was er auf der Pfanne hat, indem er seine eigenen Forderungen einlöst: „Gedichte sind immer vom Rhythmus geprägt, sonst sind es keine Gedichte. Wenn jetzt offenbar in den letzten, in den allerletzten Jahren wieder betont werden muß, daß ein Gedicht aus Rhythmus und Musikalität besteht, dann ist das ein Armutszeugnis. Das ist absolut die Voraussetzung, da verliere ich kein Wort darüber, außer im Moment.“] die Heinrich Detering so umschreibt:
Sehr weit hinab geht diese Fahrt, aus den Nato-Bunkern in den Hades der Eurydike, zu Mars und Minerva, zu Sprüchen Anaximanders und des delphischen Orakels, die Kling der „Griechischen Anthologie“ nachdichtet, und in die dionysischen Lavaströme unterhalb aller Geschichte. Immer tiefer, von der Gegenwart im ersten Kapitel bis in die antiken Anfänge des vorletzten, senkt sich das poetische „bleilot“ in jenen „brunnenbereich“, den man wohl unergründlich nennen sollte. Wer mit Kling in die Schlünde der Vergangenheit hinabgefahren ist, sieht nach dem Wiederauftauchen die Gegenwart mit anderen Augen – die erstarrten Basalte in den lichten Gehölzen der Eifel beispielsweise, hinter der aufgegebenen Raketenstellung von Hombroich, dort, wo Kling heute lebt: „bröckelig eine ausgeglühte / vom besenginster bald / schon beleuchtete gegend“. Bis zur Verschmelzung durchdringen sich die Zeiten und Medien, die Kriege der angelsächsischen Helden und die der Nato, die Pergamente und die Tonbänder, der Kiel der archaischen Boote und der gleichnamige Reichskriegshafen.
Kling gehört zu denen, die die zeitweise etwas verschnarchten 1980er Jahre überwinden halfen und nach vorn – „ins Offene“ – in die Totale der Jetztzeit drängten. Statt nun gleich zu Anfang – als Vorreiter – vorgestellt zu werden, spielt er in Theo Elms bei Reclam erschienener Jahrzehntanthologie Lyrik der 90er Jahre (siehe „Wir sammeln, bis uns der Tod abholt“) nur eine Nebenrolle. Kling gehört zu den exzentrischen lyrischen Gestalten der gesamten 90er Jahre und taucht doch erst ganz am Ende des Bandes mit gerade mal drei Gedichten auf – den Altmeistern Mayröcker, Pastior und Jandl nachgeordnet, von denen Kling bekanntermaßen viel gelesen und erfahren hat, die er aber mit seinem Prototyp der 1990er Jahre gleichsam überwindet (ohne sie hinter sich zu lassen!), aber Thomas Kling ist nun einmal derjenige, der die entscheidenden Akzente setzt. Und das sage ich als jemand, der vor allen Dingen die Gedichte von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl bis über alle Gipfel und Wipfel hinaus anhimmelt, was bei Thomas Kling ja wohl ähnlich gewesen ist: Er war es beispielsweise auch, der Benachbarte Metalle – die ausgewählten Gedichte von Friederike Mayröcker – ediert hat.
Ohne die Essaybände Itinerar und Botenstoffe wäre Thomas Klings lyrisches Werk (und dessen ganz und gar tiefgehende Wurzeln) nur höchst unvollständig vorgestellt. Itinerar (Suhrkamp 1997) wird – nach einem mißglückten ersten Abschnitt, in dem Kling in der von ihm so bewußt gepflegten Attitüde von oben herab und pauschal mehrere lyrische Jahrzehnte verunglimpft – zu einem poetologischen Leseabenteuer mit immer wieder feurig formulierten Gedanken, die den Leser derart verzaubern, daß dieser schließlich sogar zum Surfer im Atlantik bzw. Pazifik mutiert: „Gedichte lesen und hören wird zum Wellenritt in riffreicher Zone.“
Neben wände machen ist der Essayband Botenstoffe von 2001 ein weiteres Buch von Kling, das ich mit ganz besonderem Interesse und intensiver Leselust zur Kenntnis genommen habe. Ich habe Botenstoffe, das Buch des lyrischen Spracharchäologen Thomas Kling, der in Essay und Gespräch – begeisternd, belustigend, kapriziös, (meistens) extrem kenntnisreich, polemisch – über die biographischen, historischen, phänomenologischen und poetologischen Wurzeln seiner Gedichte schreibt, nicht nur von der ersten bis zur letzten Zeile mit intensivstem Interesse und größtem Gewinn gelesen, sondern das Buch immer wieder zur Seite gelegt, um in zitierten Büchern einzelne Gedichte nachzulesen oder einen kompletten Lyrikband von Kling – wände machen – wiederzulesen, der mir anschließend nachts Träume bescherte, von denen manch einer wohl bloß träumen kann. Leser, was willst du mehr, Autor, was willst du mehr? Dichtung werde von allen gemacht, betonte einst Lautreamont, und Thomas Kling gehört zu den (auch kongenial übersetzenden) Dichtern, die nicht nachlassen, zu betonen, wie wesentlich vorgefundene Sprache und Dichtung für den Dichter ist: „Ohne Kenntnis der Sprache, der Sprach- und Literaturgeschichte ist nichts zu machen“, macht Kling deutlich und hält gleichzeitig fest, gegen welche Riege von Reimern er sich unmißverständlich verwahrt. Was Lautreamont im tiefsten Sinne meint, ist wohl, daß Dichtung von der ganzen Menschheit gemacht wird und sich der einzelne Dichter zur Menschheit verhält wie das Körperteil zum Organismus – eins durch alles, alles durch eins. Oder mit einem anderen Bild: Der Dichter ist das schamanisierende Mitglied der Gesellschaft, die permanent – in allen Nischen und Schichten – Dichtung: hervorruft. Thomas Kling habe ich als Dichter kennengelernt, der die Entwicklung der Lyrik in den 1990er Jahren mit seinen komplexen Wortklanggebilden entscheidend vorangetrieben hat. Botenstoffe ist kein Gedichtbuch, sondern (in erster Linie) ein Buch über Gedichte und Dichter. Engagiert und leidenschaftlich beschäftigt sich Kling essayistisch mit dem Gedicht, und er tut es in der ihm eigenen facettenreichen, bissigen Art. Ich frohlocke, wenn ich beispielsweise solche Formulierungen lese:
Oswald von Wolkenstein tut das, was des Dichters ist – er läßt Namen für sich arbeiten. Das Gedicht verzichtet auf anekdotische Nacherzählung, zieht Knappheit vor, durch diese Wirkung erzielend. Das Gedicht reicht seinen Lesern und Hörern das Instantpulver, das wir, lesend, zum Getränk aufschäumen lassen können. So löst der Dichter sich auf im eigenen Produkt.
Oder – verblüffenderweise im ersten Teil beinahe wörtlich so, wie ich es in Ohne Punkt & Komma schrieb, wie ich überhaupt eine ganze Reihe von grundsätzlichen poetologischen Gedanken und Formulierungen finde, die ich in der Vergangenheit so oder ähnlich verwendet habe −:
Kurz: der zeitgenössische Dichter, die Dichterin, sollte ruhig aufs Ganze gehen – also keine Zugeständnisse an die zehn Leser mehr, tatsächlich muß das Gedicht auf einer Ebene voll funktionieren – mit dem nicht augen- und ohrenfälligen, dem submaritimen Teil des Eisbergs kann sich, so sie nichts Besseres vorhat, die Taucherriege der Philologie befassen.
Thomas Kling wurde seit etlichen Jahren von der feuilletonistisch-medialen Welle getragen (und zumeist gehätschelt): Unter den Lyrikern bleibt er ein heftig umstrittener Star, der polarisiert. [Wesentlicher aber ist, was Kling alles an Gutem für das Gedicht getan bzw. darüber geäußert hat: „Mallarmé betont, der Vers und alles Geschriebene müsse, weil aus dem gesprochenen Wort hervorgegangen, imstande sein, die Prüfung durch das Gesprochenwerden und den Vortrag zu bestehen. Zunächst einmal sind meine Gedichte aber sehr vom Skripturalen abhängig. Sie kommen aus dem Gelesenen, nicht aus dem Gehörten, wobei die semantischen Mehrfach-Aufladungen, die bei der wiederholten Lektüre augen- und ohrenfällig werden, nur der schriftliche Text leisten kann. Natürlich ist das Live-Erlebnis für den Vortrag eine hochwichtige Angelegenheit. Und da komme ich eben wirklich von der Auftrittsebene, also von einer Genealogie, die letztendlich in die Vorschriftlichkeit zurückgreift. Das Live-Erlebnis war schon bei einem Stefan George, um die Zeit um 1900, eine ganz wichtige Erfahrung. Natürlich steckt auch wieder der Gedanke des Dichters als Blutzeuge und zugleich Erlöserfigur dahinter, und heute, in dieser Umbruchzeit, die wir erleben, Richtung Mitte, geht das auch wieder ein bißchen zu diesem Religionsersatz hin, obwohl das keiner zugeben würde. Das ist klar. Der Dichter zum Anfassen.“] Die kontroverse Diskussion wird ihm sehr recht gewesen sein. Wer war Thomas Kling, dessen Werk so mancher aus dem Weg geht? Geht uns das überhaupt etwas an – außerhalb seiner Gedichte und Essays? Immerhin verrät er in Botenstoffe ganz unverblümt Details aus seinem Leben. Einige bedeutende Preise hat er gewonnen, in den ganz wichtigen Anthologien ist er vertreten. Dennoch: Er ist eher der Typ, der sich rar machte; manche Einladung zu Anthologien und Zeitschriften schlug er aus. Kling berichtet auf regelrecht schwärmerische Art von seinem Idol Stefan George (mit dem er den Geburtsort Bingen teilt), wie rar der sich stets machte! Überhaupt denke ich, daß Kling, wenn er die Gedichte von Horaz, Quasimodo, Bayer, Huchel, Lavant, Mayröcker, Dieter Roth, Sabine Scho, Marcel Beyer u.a. lobt und subtil interpretiert, seine Einschätzung der eigenen (phonetisch markanten, semantisch frappanten) Gedichte bzw. Standpunkte mindestens mitschwingen läßt. Auf diese Weise wird Klings poetische Basis immanent deutlich. Erneut denkwürdig: Zahlreiche Dichter äußern sich (zum Teil extrem) geringschätzig, wenn Thomas Klings Name fällt. Mißgunst? Neid? Angst? Was genau meinen sie, wenn sie behaupten, alles, was Kling gemacht habe, sei nichts Neues, sei eh langweilig, spreche einen nicht an. Damit kann ich nichts anfangen, und ich behaupte auch, daß diese Dichterkollegen sich kaum die Mühe machen, sich wirklich mit Kling auseinanderzusetzen, seine Gedichte in ihrer durchgeplanten (durchaus dramatischen, epischen oder dokumentarischen) Tiefenstruktur mit möglichst allen Sinnen −: wahrzunehmen. Ja, diese ziselierten vielschichtigen Kopfgeburten bereiten, vor allem beim ersten Lesen, Mühe. (Kling schlüpfte selber oft in die Rolle des kläffenden Pinschers, wenn er wiederholt seine Ablehnung der Gruppe 47 und der Lyrik nach 68 betonte. Wir wußten das doch längst von ihm. Was bringt es, derart undifferenziert einen Rolf Dieter Brinkmann anzupöbeln und dessen Werk niederzumachen? Der Tiefenstruktur des chaotisch krachenden Collagenbuchs Rom, Blicke wird er mit seinen läppischen Bemerkungen alles andere als gerecht. Das fällt auf ihn selbst zurück. Wenn wir über andere reden und schreiben, reden und schreiben wir in Wahrheit über niemanden als uns selbst. [Der Mensch lehnt nur ab, wen er als ebenbürtigen Konkurrenten in Erwägung zieht. Kein Riese kommt auf die Idee, sich zu einer Kritik an Zwergen herabzulassen. Zu Thomas Klings auffälligen Eigenarten als Dichter gehörte es unbedingt, radikal abzulehnen. Bissig, herblassend, polemisch, vehement kanzelte er nicht bloß einzelne Dichterexistenzen ab, nein, ganze Dichterdekaden wurden von ihm im Handstreich erledigt. Interessant in diesem Zusammenhang der Auftakt zu seinem Aufsatz „Zu den deutschsprachigen Avantgarden“ in Lyrik des 20. Jahrhunderts (Sonderband text+kritik, München 1999): „Im Rahmen des allgemeinen Kassensturzes ist nichts so billig geworden wie das Abqualifizieren der ästhetischen Avantgarden.“ Vom Prinzip her tat Kling nichts anderes, auch wenn es sich bei ihm oft − aber nicht nur − um Nachhut oder Etappenhasen usw. handelte. Axel Kutsch betont immer wieder, daß ein funktionierendes Ensemble nicht nur aus Stars bestehen darf. Was für die Musik und den Sport gilt, gilt gleichermaßen für die Poeterey.] Daß der so hochgelehrte – und sich, bei aller total intendierten Saloppheit, durchweg intellektuell inszenierende – Thomas Kling plötzlich derart auf stammhirngelenkte Reaktionen zurückgeworfen wurde, macht mich mißtrauisch. Gönnte er hier dem 1975 im Alter von 35 Jahren tödlich verunglückten Dichterkollegen Ruhm und Kultstatus nicht?) An erfolgreichen Dichtern, die nicht dem Mainstream folgen, reibt man sich. Aber ist das, was Kling vorgemacht hat, nicht längst Teil des Mainstreams geworden? Lügen so manche Feuilletonisten, wenn sie Kling in den Himmel heben? Loben sie ihn sich vom Schreibtisch: Denn wer liest Kling wirklich – mit Hingabe und Interesse? „Wer wird nicht einen Klopstock loben? / Doch wird ihn jeder lesen? – Nein.! Wir wollen weniger erhoben, / Und fleißiger gelesen sein.“ (Lessing)
Wer überhaupt liest Gedichte? Und dann auch noch „knorrige“, „abstruse“!? Und Abhandlungen über Gedichte? Verkauft sich ein solches Buch? Wo bleibt dann eine von den Kritikern zu rechtfertigende Breitenwirkung? Hat Lyrik überhaupt noch etwas im Kulturteil der Zeitungen verloren, wenn nur ein winziger Bruchteil der Leserschaft das liest? Vergebliche Liebesmüh? „Keine Zeit bedarf so sehr des Dichters wie jene, die ihn entbehren zu können glaubt.“ (Jean Paul) Glaubt unsere Zeit, auf die Dichter verzichten zu können? Immerhin gab es lange nicht mehr so zahlreiche und unterschiedliche interessante lyrische Stimmen wie nach 2000 (und Lyriknächte wie vor einiger Zeit im ZDF sind doch auch schon mal was, wenn auch nichts richtig Gutes). Sind es trotzdem immer noch nur Enzensbergers berüchtigte 1354 Leser (Kling spricht übrigens von: 300!!!), die die merkwürdige Gestalt Lyrik zur Kenntnis nehmen? Und noch einmal: Wie viele von diesen lesen die Bücher Thomas Klings? Ich habe einiges von ihm gelesen und meine: Der archäneologistische Thomas Kling bleibt vorläufig einer der auffallenden zeitgenössischen Dichter, mit immer wieder brillant umgesetzten Gedichtideen, assoziativ, leidenschaftlich, formbewußt; seine Lyrik ist systematische Auseinandersetzung mit Welt, Mensch, Sprache, Geschichte, Gesellschaft; seine kaltgeschweißte Gedichtinstallation ist ästhetisch, linguistisch, historisch, soziologisch fundiert. Nur hilft es weder ihm noch uns, wenn manche ihn dermaßen überproportioniert darstellen, daß von dem, was er ist (nämlich einer, der sich das Gedicht hart erarbeitete, ein recherchierender, mnemosynischer, etymologischer Monteur, ein sinnlicher Sammler), nicht mehr viel übrig bleibt. Er war ein dichtender Mensch – kein mythischer Held. Dichter sind keine Helden (man lese hierzu Archilochos, den man einst zum Kämpfen zwang). Wer die wenigen über- und die vielen unterschätzt, wird der Lyrik als Gestalt nicht gerecht. Zum Gedicht führen viele poetische Wege, was Thomas Kling als Eiferer (der auch die Lyrik der 50er Jahre mit einer törichten Äußerung glaubt vom Tisch wischen zu können) bisweilen vergaß.
Als großen Glücksfall möchte ich es bezeichnen, daß es Thomas Kling in seinem viel zu kurzen Leben vergönnt war, „seine“ Lyriksammlung herauszugeben: Sprachspeicher. 200 deutsche Gedichte vom 8. bis 20. Jahrhundert hat. der hochgelehrte Dichter versammelt. Hemmungslos eigenwillig, viele wesentliche Dichter radikal verwerfend bzw. ignorierend (dafür sehr wenige – vor allen anderen: Stefan George – glorifizierend) wählt er aus, radikal nichts außer den eigenen lyrischen Blick gelten lassend, den er (auch apodiktisch und herablassend) in kapiteleinleitenden Artikeln verdeutlicht: Sprachspeicher ist Klings absolutes, persönliches, lyrisches Hausbuch. Es ist begeisternd, die vielen mir unbekannten Gedichte bekannter Dichterinnen und Dichter zu lesen, die Lektüre dieser exzentrischen Auswahl ist ein Rausch. Wie er Außenseiter, Unterschätzte oder (fast) Vergessene einbringt: Norbert C. Kaser, Christine Lavant, Reinhard Priessnitz. Daß ich mich dabei immer wieder am Herausgeber reibe, liegt auf der Hand und macht das Lesen dieses Sammelbandes zu einer Achterbahnfahrt. „Daß Ingeborg Bachmanns Stärke eher nicht im Gedicht zu suchen ist, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben“: Hier haben wir ihn wieder, diesen Thomas Kling, seine lyrische Einäugigkeit zum besten gebend. [Lassen wir die Dichter auch Menschen sein, denen wir gerecht zu werden versuchen. Im Kapitel „Tür zum Meer“ heißt es: „Einer offenbar stark vom Thanatos beherrschten Lyrik Ingeborg Bachmanns beispielsweise werde ich das nur, wenn ich ihre Gedichte, die besonders Motive des Untergangs, des Aufbruchs, des Widerstands behandeln, u.a. auch aus der deutschen Nachkriegszeit heraus lese, in der sie größtenteils geschrieben wurden − als lyrische Dokumente einer insbesondere für sensible Menschen höchst fragwürdigen, schwierigen Zeit.“ Zu betonen ist hier natürlich ihre Rolle als offensive Lyrikerin, die − wie ein Paul Celan, wie ein Werner Riegel − aus dem Kokon der Naturlyrik ausbrach. Ein Bekannter meinte in ähnlichem Zusammenhang, natürlich wisse er Bobrowski als großen Lyriker zu schätzen, dennoch werde er das Gefühl nicht los, daß dessen Art Lyrik einfach passe sei. Ob ich ihm in diesem Fall zustimme oder nicht, sei dahingestellt – generell gilt: Es gelingt nur wenigen Gedichten bzw. Dichtern, schadlos die Zeiten zu überleben, ohne wenigstens einen Hauch Patina anzusetzen. Zeitlose Gedichte von zeitlosen Dichtern eben − ein seltenes Phänomen. Ein paar Gedichte von Ingeborg Bachmann gehören für mich zu diesem Repertoire, und ich lese diese Gedichte auch jedesmal wieder neu, wenn ich sie in Anthologien entdecke. Ich gehöre nicht zu den Elitisten à la Kling, die bei Gedichten, denen es gelungen ist, einige Popularität zu erlangen, nicht nur die Nase rümpfen, sondern diese vielleicht auch bewußt zu ignorieren − von kleinen Ausnahmen (Gottfried Benn, „Einsamer nie“ oder Else Lasker-Schüler, „Mein blaues Klavier“) abgesehen. Sprachspeicher oder auch seine Lyrikauswahl in dem text+kritik-Sonderband Lyrik des 20. Jahrhunderts (1999) sind gute Beispiele dafür. Immerhin, in beiden Bänden taucht je ein Bachmann-Gedicht auf! Sensationell, wenn ich bedenke, daß beispielsweise kein einziges Gedicht von Karl Krolow in Sprachspeicher zu finden ist, der 1999 84jährig verstarb und eins der größten Werke der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts überhaupt hinterlassen hat.] Erstaunlicherweise hat der poeta doctus Kling ein Gedicht des poeta doctus Rudolf Borchardt in Sprachspeicher aufgenommen, in die ja nur wenige Dichter des 20. Jahrhunderts Aufnahme gefunden haben: Ist das wirklich Zeichen einer aktuellen Wertschätzung (für die Adorno gleichsam die Begründung liefert: „Das Werk Rudolf Borchardts hat alle dichterischen Gattungen umfaßt und als Gattungen sie gepflegt. Schlüsselcharakter hat die Lyrik: nicht darum bloß, weil seine Produktion vom lyrischen Gedicht ausging, sondern weil seine bestimmende poetische Reaktionsform die lyrische war“)? Jedenfalls verbeißt sich Kling in seinem letzten Buch derart in die Existenz Borchardts, daß diesem Hören und Sehen vergehen würde.
Schließlich greife ich zu diesem letzten Buch Auswertung der Flugdaten (mit lyrischen und essayistischen bzw. auch lyrisch-essayistischen, also genreüberschreitenden Texten), das ich in der vorletzten Woche gelesen habe. Das Buch läßt mir keine Ruhe. Die Verse und Zeilen wühlen mich auf. Eine fieberhafte Vitalität wird spürbar. Hier schreibt einer um sein Leben. Hier arbeitet einer an seinem Vermächtnis. [Auswertung der Flugdaten ist ein atemberaubendes Buch, das ich betont bedächtig lese, Vers für Vers, Gedicht für Gedicht. Thomas Kling lesen ist im besten Sinne harte Arbeit. Thomas Kling zu lesen ist nicht das Lesen, das der Mensch sich − landläufig vorstellt, wenn er das Wort „lesen“ hört, das geht nicht „aus der lameng“ (O-Ton Kling). Genauso wie Kling ein lyrischer Schwerarbeiter war, ein Bergmann, der im Flöz hing und Schicht um Schicht abschlug, um an das Innere zu geraten, lebensbedrohliche Teufelsbrocken um sich herumfliegen ließ, muß auch sein Leser bereit sein, ihm dorthin zu folgen. Hier gibt es nix für umsonst. ABER: Der Titel Auswertung der Flugdaten deutet zunächst auf ganz anderes Terrain als Untertage. Hier muß es einen Totalabsturz gegeben haben, die Black Box hat der Dichter offenbar gefunden, und nun geht es mit letzter Leidenschaft an die Auswertung der Flugdaten. Ist Thomas Kling der reinkarnierte Ikarus, der den Fall überlebt hat? Es sieht ganz danach aus: Wenn auch zum Denkmal auf dem Sockel erstarrt (scheinbar in die Ferne schauend − hat er hier „Mailand, Ambrosianische Litanei 2“ − ein Gedicht, das ich heute mit stummer Anteilnahme lese − nachgestellt?), sehen wir den Dichter hoch vorm (allerdings zerfallen wirkenden) efeu bewachsenen Knusperhäuschen. „Auf nichts kommt es an als darauf, Atem zu haben, atmen zu können, zu wissen und am Leben zu bleiben.“ (William Faulkner, „Absalom, Absalom!“) Erstes Kapitel: Vorhölle mit den endlosen weißen Gängen und den schwarzen offengelegten Innereien – Dichter, Patient, Steiger und Hauer (außer sich, rasend wild). Zweites Kapitel: Es plappert die Mühle, mahlt, malt und spricht. Echt Kling! Echt gut! Lesen Sie statt meiner lediglich hinweisenden Worte diese alliterativen, (binnenreimenden) ma(h)lenden Bildgedichte im Gesamtzusammenhang des Buches: „das licht steht staubig − / stäubchen-strömung in der tür. // die sonne, feuermühle / die euch gemahlen hat, geht scharf. // so steht das licht − / steht staubig in der tür“ – und alles weitere an Gedichten, Aufsätzen und Vorträgen!) „Was bleibt, ist ein vielsagender Vers, der dann doch zu wenig sagt.“ (Thomas Kling)] Der fragmentarischen Vorstellung in der Fußnote 19 will ich noch Hubert Winkels feinen Kommentar hinzufügen: „Der neue Kling-Band beginnt also mit einer fulminanten Reihe von K-Gedichten: K wie Krankenhaus und Krieg, der in ihm herrscht – wie Körper und Konkretion, die ihn zum Datum macht, wie Kälte und Kunst, die jedes Wehleid einfrieren in Wort und Bild.“ Jetzt gilt es, selber zu lesen.
Thomas Kling starb am 1. April 2005, an einem Tag, an dem ich – beseelt von der Lektüre seines Buches Auswertung der Flugdaten, das viele Tage lang stets greifbar hier neben dem Keyboard gelegen hat – der festen Überzeugung war, er hätte den Lungenkrebs – vorübergehend wenigstens – gebändigt. Nun lese ich die Todesanzeigen, die mir jemand freundlicherweise ausgeschnitten hat, und ich sehe es schwarz auf weiß: Der 1957 in Bingen am Rhein geborene Thomas Kling ist tot. Es lebe Thomas Kling.
MAILAND. AMBROSIANISCHE LITANEI 2
auf eine halbsäule hin gemalt
steht ein junger mann: lebensgroßer
melancholiker – typ aus untersicht gesehen.
athlet, der auf die zweiten blicke sich entpuppt.
betrachten ist schmerzforschung.
kahlheit nackter bildprogramme.
sirrendes, singendes, zuletzt ein
stummgemachtes fleisch.
dies ist der heilige mit der eignen haut (attribut);
In kniehöhe sein schopf: dort
baumelt die apostelhülle, struppig,
ein ziemlich totes angesicht.
so stehen dulder. ein geschundenes bild.
der haut entkleidet. mit rosigem kopf: ein
bartholomäus, die haut überm arm wie
regenhaut. dazu die patientenglatze – sieht aus
wie von der chemotherapie.
die vorgewiesenen attribute: ein messer, keine spritze.
und muß mit links, mit eleganz, sein lebensgroßes hautbild
halten, den lebensnahen, totengrauen skalp.
der aderzeichen zeigt: das bild das ihm
sonst runterrutschen würde von der schulter.
der nimmt das hin; ist schinderwerk.
ein bildprogramm, termingerecht geliefert −
ein sonderbarer heiliger, seitlich angebracht.
ein weihrauch-echo. (fresko)
Aus: Thomas Kling, Fernhandel, 1999
Theo Breuer, aus: Theo Breuer: Aus dem Hinterland, Edition YE, 2005
Unter dem Titel „New York. State of Mind“ richtete der Autor Marcel Beyer auf Einladung von Professorin Dr. Kerstin Stüssel einen Abend zu Thomas Kling aus. Die Lesung/Performance fand statt im Universitätsmuseum, wo parallel eine Ausstellung zu Thomas Klings Werk gezeigt wurde, welche Studierende der Germanistik erarbeitet hatten.
Marcel Beyer und Frieder von Ammon im Gespräch über den Lyriker und Essayisten Thomas Kling.
Hubert Winkels: Die zwei Körper des Dichters. Am Beispiel Thomas Klings und Peter Handkes zeigt sich die Art, wie Schriftsteller sich selbst unsterblich machen wollen.
„Am Anfang war die ‚Menschheitsdämmerung‘“. Interview mit Thomas Kling.
„Ein schnelles Summen‟. Interview mit Thomas Kling.
„Gegen die Lehrer-Lempelhaftigkeit‟. Interview mit Thomas Kling.
„Augensprache, Sprachsehen‟. Interview mit Thomas Kling.
Gespräche mit Thomas Kling:
Thomas Kling VideoClip. Der junge Thomas Kling äußert sich zur Literatur und liest Oh Nacht [aus der aspekte-Produktion 1989, gefunden im VPRO Dode Dichters Almanak]
Detlev F. Neufert: Thomas Kling – brennstabm&rauchmelder. Ein Dichter aus Deutschland
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
PIA + Hommage + Symposion + Dissertation + DAS&D +
Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Keystone-SDA +
Galerie Foto Gezett + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Thomas Kling: FAZ ✝ Der Freitag ✝ Perlentaucher ✝
NZZ ✝ Die Welt ✝ FR ✝ KSTA ✝ einseitig ✝ text fuer text ✝
Der Tagesspiegel ✝ Berliner Zeitung ✝ Neue Rundschau
Weitere Nachrufe:
Julia Schröder: gedicht ist nun einmal: schädelmagie
Stuttgarter Zeitung, 4.4.2005
Thomas Steinfeld: Das Ohr bis an den Rand gefüllt
Süddeutsche Zeitung, 4.4.2005
Jürgen Verdofsky: Unablenkbar
Tages-Anzeiger, 4.4.2005
Norbert Hummelt: Erinnerung an Thomas Kling
Castrum Peregrini, Heft 268–269, 2005
Zum 10jährigen Todestag des Autors:
Hubert Winkels: Sprechberserker
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Tobias Lehmkuhl: Palimpsest mit Pi
Süddeutsche Zeitung, 30.3.2015
Theo Breuer: „Auswertung der Flugdaten“
fixpoetry.com, 31.3.2015
Tom Schulz: Dichter auf der Raketenstation
Neue Zürcher Zeitung, 13.4.2015
Vertonte Faxabsage zur Vertonung seiner Werke zur Expo 2000 von Thomas Kling.
Thomas Kling liest „ratinger hof, zettbeh (3)“


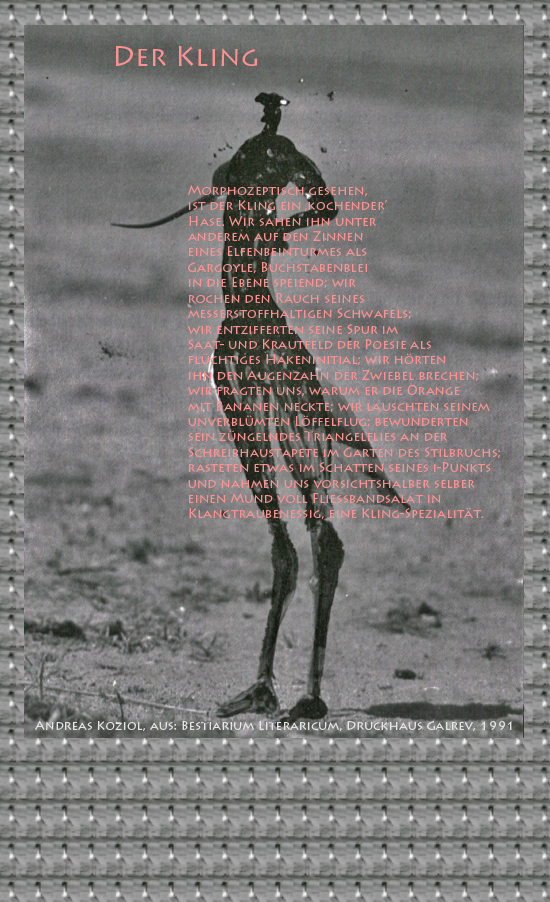












Schreibe einen Kommentar