Tomas Venclova: Gespräch im Winter
NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA
zum Gedenken an
Konstantin Bogatyrjow
Mich ereilte die Jahrhundertmitte.
Ich lebte, doch ich lernte, nicht zu sein.
Der Tod war mir wie ein Familienmitglied
Und nahm den größten Teil der Wohnung ein.
Ich hab ihn mit der Zeit etwas gezähmt,
Bat ihn zudem, er soll mich nicht berühren,
Frühmorgens sah ich eine Stadt, so schön
Wie keine sonst in Osteuropa, schien mir,
Wo stets das Eisen auf der Lauer liegt,
Im Nebel Schilfrohr raschelt und vermodert,
Wo es den Schlagring, Steine, Dampfloks gibt
Und bestenfalls vielleicht Benzin auflodert.
Ich schlief und ich trank und ich aß im Tod,
Versuchte, Zweck und Sinn in ihm zu sehen,
Vergaß ihn sogar ab und zu. Und doch
Kann sich der Mensch an ihn fast nicht gewöhnen.
Ich schloß die Tür zu meiner Wohnung auf.
Mein Herzschlag stockte, in der Brust ein Stein.
Der Tod in diesem Staat, man glaubt es kaum,
Er konnte wirklich reiner Zufall sein.
Versiegelte Zeit
Um mit einem starken Wort zu beginnen: die vorliegenden Gedichte, die man mit gutem Gewissen ein gelungenes Lebenswerk nennen kann, gehören zum Unzeitgemäßesten, was die zeitgenössische europäische Poesie zu bieten hat – und gerade darin besteht ihre Größe. Es sind die Gedichte eines besonders seltenen Vogels mit einem heraldisch besonders ausgeprägten Profil. Man wird lange suchen müssen in den Weiten Osteuropas, um auch nur eine annähernd so abgeklärte Stimme zu finden, eine Stimme von so lakonischer Schwere, so unerschütterlicher Gefaßtheit. Gedrängtheit des Ausdrucks bei größter Seelenruhe aber ist nicht nur das Stilmerkmal seiner Verse, sie ist weit mehr noch der ethische Imperativ ihres Verfassers. Die Gedichte selber gehen, wie bei jedem interessanten Poeten, oft ihre eigenen, überraschenden Wege. Äußerlich zeigen sie sich scheinbar streng an das Metrum gebunden – mit Vorliebe Daktylus und Amphibrachys; geradezu aufreizend ist die Betonung des Regelhaften in dieser Verskunst, die zu Recht stolz ist auf ihren langen und verzweigten Stammbaum. Im Innern dagegen rebelliert ein sprungbereites Subjekt, das so heftig nach Freiheit verlangt wie nur jemand, dem sie von früh an vorenthalten wurde. In dieser Spannung liegt die Eigenart von Venclovas Dichtung, ihre aufwühlende Paradoxie.
Es gibt kaum ein Gedicht, in dem nicht wenigstens einmal an den unsichtbaren Gitterstäben von Raum und Zeit gerüttelt wird – als müßte der Autor, wie das gebrannte Kind, dem niemand Glauben schenkt, immer wieder auf sein Urtrauma zurückkommen. Als wäre, nach allem, was ihm von Geburt an widerfuhr, die gesamte Umwelt ihm verdächtig geworden, unheimlich bis in den letzten Winkel: angefangen mit der sogenannten Natur, einer Landschaft, von der man als Heimat kaum sprechen konnte, einer bedrohlichen Fauna und Flora, Städten, die nur noch Schatten ihrer selbst waren, Geisterstädte, im Krieg bis zur Unkenntlichkeit retuschiert, bis hin zum eigenen unzuverlässigen Körper, der nur ein Gefäß war für diesen kostbaren Spiritus (Geist oder Seele), der sich wie Alkohol jederzeit verflüchtigen konnte, wenn man den Korken aufzupfropfen vergaß. Dieser Korken aber, ein winziges Detail, leicht zu übersehen zwischen den Zeilen, er ist es, der seinen Gedichten ihre Lebendigkeit erhält, ihr existenzielles Aroma über Jahrzehnte. Er ist das Erkennungszeichen, das seine Dichtung unverwechselbar macht.
Tomas Venclova: wenn der Name einem breiteren Publikum hierzulande bisher verborgen blieb, hat das mit der besonderen Eigenschaft dieser Gedichte zu tun, ihrer erfreulichen Reserviertheit gegenüber Tagesaktualität und ästhetischer Mode. Venclova ist ein dezenter Dichter, Effekthascherei, wie sie in der modernen Poesie zum guten Ton gehörte, war nie seine Sache. Seit dem Jahr 1977 lebt er in den Vereinigten Staaten, wo er Jahrzehnte als Professor in Yale unterrichtete. Und doch hielt die Aufmerksamkeit, die ihm im Westen zuteil wurde, sich in bescheidenen Grenzen. Verwunderlich ist das insofern, als Venclova zu einem Freundeskreis von Dichtern gehörte, die auch der oberflächlichste Zeitungsleser kennt. Es sind Namen, die bei aller vergleichbaren Herkunft, nicht zuletzt dank des Nobelpreises, heute als besonders klangvoll gelten. Und es ist kein Zufall, sondern Familienzugehörigkeit, daß darunter ein Pole und ein Russe sich finden. Erst mit Czesław Miłosz (geboren 1911 in Seteiniai/Litauen) und Joseph Brodsky (1940 in Leningrad zur Welt gekommen) ist das Trio komplett. Durch ihre lebenslange Verbundenheit ergab sich ein Dreieck aus russischen, polnischen und litauischen Traditionen, auf dessen Grundriß Venclovas Dichtung sich geographisch und literaturgeschichtlich entfalten konnte. Nicht nur spielt die Drei in seiner persönlichen pythagoreischen Zahlenlehre eine bestimmende Rolle – als Dreiklang und Bild vom Dreiweg, europäische Dreiländereck-Konstellation, Dialektik des Dreischritts und Idee der christlichen Trinität schlägt sie überall durch.
Polnisch und Russisch sind die Sprachen, die Venclova als Übersetzer am intensivsten erforscht hat. Sie standen ihm, als alternative Muttersprachen, von Anfang an zur Verfügung, prägten sein Denken, formten seine Poetik. Von den Polen ließ sich so etwas wie katholische Standhaftigkeit, ein religiös fundiertes Durchhaltevermögen erlernen. Den Russen lauschend, ererbte man ein System verstecktester Anspielungen, trainierte eine Akrobatik der Verskunst, von der die wenigsten Ausländer bis heute auch nur die leiseste Ahnung haben. Von Puschkin bis Blok und Belyj, von Achmatowa, Mandelstam, Pasternak bis hin zu Brodsky und seinen Leningrader Dichterkumpanen, von Jazzmusik inspiriert, war das ein einziger großer Metaphernspielplatz. Die Kunstfertigkeit, in wenigen Akkorden eine Welt hervorzuzaubern, all die verstechnischen Kniffe von taktvoller Assonanz, hintergründigster Paronomasie, hier konnte man sie studieren. Die Auslösung psychisch intrikater Wirkungen mit sparsamsten sprachlichen Mitteln war eine der ältesten Methoden, die man sich unmittelbar von einem Puschkin oder Chodassewitsch, von dem alogisch quirligen, arielgleichen Pasternak oder der gedankenstrichschnellen Zwetajewa abschauen konnte. Zum lebenslangen Vertrauten aber, zum eigentlichen Gesprächspartner der Dichterseele ist vor allem einer geworden, jener Ossip Mandelstam, auf den viele seiner Gedichte ausdrücklich Bezug nehmen. Von ihm kommt die Ermunterung, jeglichen Austausch zwischen den Dichtern und Denkern, durch alle Zeiten hindurch, über alle Räume hinweg, als einen persönlichen Dialog zu betrachten. Venclova beruft sich wörtlich auf Mandelstam und seine Vorstellung vom sobesednik (Gesprächspartner) als metaphysischen Adressaten für die eigene Produktion, wie jener sie in seinem Essay „Gespräch über Dante“ als Modell einer neuen Poetik entwickelt hat.
So entstand, in der lebenslangen Auseinandersetzung mit dem lyrischen Kosmos seines Vorgängers Miłosz und dem des fast gleichaltrigen Brodsky, der geheime Kanon, der seiner Dichtung als Tiefendimension zur Verfügung steht. Was für westliche Leser, nach dem Bruch mit jeder humanistischen Bildung, exotisch erscheint, war diesen Osteuropäern, von Geschichte entwurzelt, der natürlichste, naheliegendste Halt. Wo sich auf nichts mehr bauen ließ, wurden Hellenismus und Christentum zur inneren Bastion, in der man die modernen Barbaren, Atheismus und Materialismus, und ihre flächendeckende Herrschaft souverän überdauern konnte. In solcher Autonomie, in der überzeitlichen Freiheit ihres historischen Sinns, liegt der Schlüssel zu Venclovas Dichtung. Er ist der traditionelle Dichter par excellence, wie ihn T.S. Eliot, sehr allgemein, für die Neuzeit reklamiert hat. Gegenwart und Vergangenheit, das Zeitlose und das allzu Zeitliche, Vorübergehende, mit demselben aufmerksamen Blick wahrgenommen, finden bei ihm auf einem Negativ, in Form einer Doppelbelichtung, zusammen. Venclova hat, mit der Offenheit eines Gnostikers, seine radikale Frontstellung zum Zeitgeist einmal so formuliert:
Zeitgenossenschaft, die nichts anderes ist als wahre Unsterblichkeit, läßt sich auf zweierlei Weise erreichen: Entweder unterwirft man sich dem Kommando der eigenen Zeit oder man trotzt ihr und wird zur Gegenkraft seiner Epoche.
Wer die Gedichte liest, weiß, wofür Venclova sich entschieden hat. Einer wie er hat es verschmerzen können, daß er als ausgebürgerter Emigrant, in den Jahren des erzwungenen Exils, von den Stalinisten daheim als Kosmopolit beschimpft wurde. Ich nehme an, er hat es als Auszeichnung empfunden. Seinen Gedichten ist abzulesen, wie Verachtung gegen Verunglimpfung standhielt, wie wenig er zu beirren war in seiner einmal getroffenen Wahl. Die Erfahrung des Sozialismus, diese Melange aus vulgärem Realismus und grober Repression, hatte ihn abgehärtet, das Leben in der Fremde, im Kapitalismus der harten Währung, gab ihm die Ausdauer, seinen persönlichen Kampf durchzustehen.
Man hat seine Poesie mit allerlei abschreckenden Etiketten versehen. Dunkel sei sie, schwer faßlich, hermetisch, gedanklich abstrakt, monoton. Selbst engen Gefährten fiel das Zurückhaltende seiner Intonation auf. Hier sei eine Stimme, die erst in der Erschöpfung zu sprechen beginne, am äußersten Ende der anthropologischen Skala, wo alle Seelenkräfte verbraucht sind. In Wahrheit ist es wohl so, daß hier einer bewußt mit dem Schalldämpfer arbeitet. Es scheint so, als wollte der Dichter sich selbst für die wenigen Buchstaben noch entschuldigen, die er gezwungen war, dem Papier zuzumuten. In diesem eigenartigen Taktgefühl liegt seine Anziehungskraft. Es ist eine Kunst des Unaufdringlichen, die hier geübt wird, eine Modulation von Graustufen, die viel mit den Lebensräumen des Autors zu tun haben. Das Zinkgrau der Ostseewellen ist darunter, das bläuliche Grau der baltischen Himmel, die grauen Seiten der Prawda, die Industrietönung der vorherrschenden Betonarchitektur zwischen Warschau, Vilnius und Moskau, jener grauen Standardblocks, die ihre Bewohner in graue Mäuse verwandelten. Was leicht als zwanghaft erscheinen könnte, ist im Falle des Dichters aber Resultat einer hochbewußten Entscheidung. Wir kennen eine Ästhetik wie diese aus anderen Bereichen der Kunst als Minimal art. Bei Venclova steht sie ganz im Dienst der Ausdruckssteigerung. Für ihn heißt die Lösung der problematischen Dichterexistenz in einer fremdbestimmten Gesellschaft: Zurücknahme aller verbrauchten Expressivität, Vermeidung des peinlich Persönlichen, Intensivierung durch Kammerton. Würde bewahren bedeutet für diesen Dichter, eine endgültig abgekühlte Materie zu durchqueren. Von daher die Atmosphäre des Postumen, die seinen Gedichten die bleiche Färbung von Grußpostkarten aus einem Totenreich verleiht. Anders gesagt, dies ist eine Dichtung, die von der Gegenwart wenig, von der Nachwelt alles erwartet. Auf seine Art ist Venclova einer der letzten Akmeisten (er selbst nannte sie einmal die fröhliche Schule des Akmeismus), Vertreter einer wohl begründeten Klassizität, die sich die Aufgabe gestellt hat, Zeugnis abzulegen vom Verschwinden des Einzelnen im Grau einer versiegelten Zeit.
Venclova hat, in seiner lapidaren Art, einmal die Ansicht vertreten, die Menschen in jenen Breiten hätten das Weltende bereits hinter sich. Aus seiner Dichtung spricht der Symbolismus einer verschwiegenen Bruderschaft. Mit ihrer doppelten Sehnsucht nach Transzendenz und Weltkultur schossen er und die wenigen seinesgleichen über alles hinaus, was ihnen das Zeitalter an künstlerischen Idealen noch zubilligte. So gerieten sie in ein neues Niemandsland, gleich weit entfernt von der Gleichschaltungskunst ihrer Länder und einer formauflösenden Moderne, wie sie die westliche Nachkriegskunst zelebrierte. In diesem Niemandsland endlich konnten die erstaunlichsten Gedichtzeilen erblühen. Es war der fruchtbare Boden für eine Poesie von großer synthetischer Kraft, die ihr Zeitalter seelenruhig überleben wird. Für diese Versprengten war der Kommunismus ein Sündenfall, die größte ethische Katastrophe in ihren Herkunftsländern. Theoretisch hätte es einen Dichter wie Venclova gar nicht geben dürfen, und die Praxis gab sich auch alle Mühe, ihn zu verhindern. Vom Publikationsverbot bis zum Ausschluß vom Hochschulstudium war alles dabei, was der Staat für verlorene Söhne wie ihn bereithielt. Das Soll war erst mit der Ausreise des Dichters erfüllt, der seit 1977 in den USA lebt, als Professor für russische Literatur an der Universität Yale. Ein Rätsel aber bleibt, und es läßt sich kaum auflösen, auch nicht mit noch soviel Soziologie. Die Geschichte hat ihn zum Dissidenten gemacht, eine weit höhere Instanz aber berief ihn zum Dichter. Nicht nur einer der besten litauischer Sprache, wie einige meinen, sondern als solcher einer der großen, unbestechlichen Beobachter unserer Zeit.
Tomas Venclova wurde 1937 in Klaipeda geboren, einem Ort, der unter den Ostpreußen seit den Zeiten Friedrichs des Großen Memel hieß, benannt nach dem gleichnamigen Fluß, der dort in die Ostsee mündet. Am gegenüberliegenden Ufer beginnt die Kurische Nehrung. Die Eltern verließen Klaipeda mit dem Zweijährigen, als Hitlers Truppen Stadt und Umgebung besetzten. Seine Kindheit, die mit der deutschen und sowjetischen Besatzung im Baltikum zusammenfiel, verbrachte er in Kaunas, der vormaligen Hauptstadt Litauens, eines zwischen den Kriegen noch unabhängigen Rumpfstaates, der von den totalitären Großmächten jener Zeit in einer langsamen, aber sicheren Zangenbewegung zermalmt wurde. Hitler und Stalin waren die düsteren Paten, die ihre langen Schatten über das weitere Leben des litauischen Knaben warfen. Mit Kriegsende stieg der Stern der Familie, dank der prorussischen Einstellung des Vaters. Venclova wuchs in den behüteten Verhältnissen eines Vertreters der Nomenklatura auf „Meine Familie war ein Teil der sowjetischen Elite.“ Der Vater war selbst Poet, Stalin-Preisträger, von ihm stammte der Text der Nationalhymne der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Antanas Venclova war so etwas wie der Johannes R. Becher des neuen Litauen, ein wenig populärer „Dichter des Volkes“, lange Zeit Kulturminister. Der Sohn machte sich mit einer so privilegierten Herkunft nicht nur Freunde. Um so erstaunlicher ist sein Werdegang bis zum Abtrünnigen und intellektuellen Staatsfeind.
Die Studienzeit verbrachte er an der Universität von Vilnius. In der Mehrsprachigkeit seiner Bevölkerung war dieser Ort, das alte Jerusalem des Nordens, über Jahrhunderte eine Sonderzone, dem bukowinischen Czernowitz des Paul Celan vergleichbar. Hier studierte er russische Literatur und Lituanistik und lehrte später selbst an der Alma Mater Literaturgeschichte und Semiotik. Früh schon zog es ihn ins Zentrum des Großimperiums, und nach regelmäßigen Blitzbesuchen in Moskau und Leningrad, richtete er sich dort für längere Zeit ein. Zwei Einschnitte sind es, die sein weiteres Leben bestimmten, ihnen verdankt er seine Geburt als Dichter. Da war zum einen die Bekanntschaft mit Anna Achmatowa, der verfemten Poetessa aus dem Silbernen Zeitalter der russischen Dichtung vor der Oktoberrevolution, einer Königin ohne Reich. In ihr sah er das lebende Beispiel für die Widerstandskraft der Worte, es war sein erstes Erwachen. Auch Boris Pasternak hatte den so viele Jahre Jüngeren mit der Herzlichkeit eines Blutsverwandten empfangen. In Moskau und Leningrad geschah es, den Städten seiner poetischen Lehrmeister, daß der Dichter in ihm geweckt wurde, daß Verskunst ihm plötzlich zum eigenen Spielraum wurde in einem sonst vollkommen fremdbestimmten, vom Staat verordneten Leben. „Und fast genau dort erlebte ich, wie eine Verszeile strahlt / Und um Mitternacht Bäume und Schnee erhellt.“
Es war der Ungarnaufstand, plattgewalzt unter den Ketten russischer Panzer, der seinen Freiheitssinn weckte. Joseph Brodsky, der Dichterfreund, liefert mit der Formel von der Generation 1956 das Schlagwort für jenes historische Erweckungserlebnis. Es war die Zeit eines radikalen Umdenkens, der Bruch mit allen liebgewordenen linken Überlieferungen. Der Marxismus der Väter war hiermit bankrott. Gründlicher hätte keine Psychoanalyse mit den familiären Illusionen aufräumen können. Ein harmloser Widerstandsakt, Venclovas Glückwunschbrief an Pasternak, als dieser den Nobelpreis erhielt und auf Druck der sowjetischen Kulturbürokratie ablehnen mußte, machte ihn endgültig zum Konspirateur in den Akten der Staatssicherheit. Zur Erinnerung: Pasternak war der Mann, der mit seinem Roman Doktor Schiwago (1957) den Frieden des Kalten Krieges störte, absichtslos, in unschuldiger Aufrichtigkeit. Sein Buch, unabhängig von literarischen Qualitäten, war das Signal für eine neue Generation von Stürmern und Drängern, die nichts anderes kennengelernt hatten als das Gefängnis des Sozialismus. Ihre Erfahrung war die einer allumfassenden Repression und. Totalüberwachung des Alltagslebens. Aus Solidarität mit dem verehrten Autor gerieten sie über Nacht in die Rolle von Opfern, vereinsamt im Osten, vom Westen im Stich gelassen. Von da an ging es mit schnellen Schritten in die Isolation. Die logische Folge, für einen politisch agilen Geist wie Venclova, bedeutete Illegalität: ein Leben auf der Rutschbahn in den Rachen des Klassenfeinds. Diverse Aktionen in der literarischen Untergrundarbeit (Samisdat), sein heftiges Engagement in der litauischen Bürgerrechtsbewegung, danach waren Haft oder Abschiebung nur eine Frage der Zeit. Venclova zog das letztere vor, ein Leben im Exil, um den Preis sprachlicher Einsamkeit und Heimatentfremdung. Dabei war er, auf seine zurückhaltende Weise, in den Zeiten des Kalten Krieges der bessere Botschafter Litauens – Vertreter eines besseren Litauen im Ausland. Daß er bis heute nicht der Typ ist, der zum Regierungsberater taugt, und erst recht nicht zum Neonationalisten, spricht für ihn.
Zehn Jahre nach Pasternaks Tod, zu Beginn der siebziger Jahre, brachte Venclova in Litauen seinen ersten und einzigen Gedichtband heraus, die Sammlung Zeichen der Sprache. Bei aller Nähe zur überlieferten litauischen Bildwelt von Donelaitis bis Radauskas, verweist der Titel, unabhängig vom vielschichtig-lyrischen Inhalt des Buches, deutlich auf die theoretischen Ambitionen des Autors. Vergessen wir nicht, die Sowjetunion, ein Land, das im Weltall mitspielte, brachte auch eine Wissenschaftskultur hervor, in der semiotische und computergestützte Metrikstudien zum Know-how gehörten. Nicht einmal vor Puschkin machte das neue Pathos der Kybernetik halt. Vitaler als derlei Textanalytik aber war es die kindliche Leidenschaft für die Poesie selbst, die solchen akademischen Hokuspokus mühelos überstand. Für Venclova war es eine Schule der Resistenz, nützlich darum, weil sie sein Bewußtsein für das Metier eher schärfte. Nicht nur ist ihm die klassische Metrik geläufig, er ist auch ein profunder Zeichentheoretiker. Er kennt seinen Jakobson, seinen Eichenbaum, er hat in Tartu bei Lotman studiert und von den Strukturalisten gelernt, daß man Gedichte rein sachlich als Sprachobjekte betrachten, sie zerlegen kann in ihre semantischen und grammatikalischen Bestandteile. An seiner Grundhaltung hat das wenig geändert. Poesie, solange sie als solche kenntlich werden will, ist ein Abenteuer von Lexik und Psyche: der Flirt der gebundenen mit der ungebundenen Rede. Wenn Vers und Sprache einander bis heute nicht müde wurden, liegt das an ihrem uralten Spannungsverhältnis, ihrer erotischen Dauerbeziehung. Der Vers sehnt sich nach Fesseln, die Sprache hat ihren eigenen Willen.
Aber nicht nur Gedichte gehören zu seinem Werk, auch eine umfangreiche Sammlung von Essays, Übersetzungen aus sechs Sprachen, ein bezauberndes Buch über Vilnius (Untertitel: Eine Stadt in Europa), das als unorthodoxer Reiseführer jeden Baedeker schlägt. Entstanden ist das meiste davon in den Jahren, da man ihn zu Hause abgeschrieben hatte. Es waren, entgegen mancher Thesen, die in den Hirnen politischer Rechthaber herumspuken, schriftstellerisch seine fruchtbarsten Jahre.
Für Venclova war die Erziehung zum Fatalismus eines Tages beendet. Er kehrte seinem Geburtsland den Rücken, den Freunden und Vorbildern folgend, und ließ sich in den Vereinigten Staaten nieder. Als Dichter war er in seiner Heimat unüberhörbar geworden, den Menschen hätten die Machthaber leicht in einem der Lager verschwinden lassen können. Wie so viele vor ihm, nahm er den umgekehrten Weg des Revolutionsführers Lenin und zog das Exil den strafrechtlichen Konsequenzen eines Lebens im Sozialismus, einem Versauern bei vollem Bewußtsein vor. Seine Existenzform als Emigrant verglich Venclova einmal mit einem Leben nach dem Tode. Das klingt nach Verbitterung, Undank, bei ihm hat es mehr mit einer prinzipiellen Haltung gegenüber Schicksalsschlägen zu tun. Venclova ist erklärter Platoniker: Es erfüllt ihn mit Zuversicht, daß es auch jenseits des schwindelerregenden Daseins eine Ideenwelt gibt, die im Geist Heimatgefühle erweckt. In seinen Gedichten ist viel von der Wiedersehensfreude in jenen platonischen Sphären die Rede, von der Sehnsucht nach den ungestörten Gesprächen, fern von Geschichte und Zeit, die ihn dort erwarten. Man kann das gelebte Metaphysik nennen, von ihr kann ein Mensch genauso sich tragen lassen wie vom Strom der unaufhaltsamen Globalisierung. Vermutlich ist sie der Grund dafür, daß er in den letzten dreißig Jahren ein geradezu manischer Weltreisender wurde. Venclova ist mittlerweile, wie ein zweiter Schlehmil, auf allen fünf Kontinenten gesichtet worden, zumeist inkognito, mit wenig Gepäck, unter Benutzung der primitivsten Verkehrsmittel, ein wahrhafter Pilger. In seinem Umherwandern steckt etwas von der Unrast des Vertriebenen, der nirgendwo mehr ankommt, nachdem er die Zelte ein für allemal abgebrochen hat. Auch seiner alten Heimat hat er in den Jahren nach der demokratischen Wende immer wieder Besuche abgestattet. Davon zeugen einige besonders bewegende Stücke aus der jüngsten Schaffensphase, die ein eigenes Genre ergeben: das der Heimkehrer-Gedichte, von denen die Auswahl reichlich Zeugnis ablegt. Dabei ist Venclova nie wirklich heimgekehrt, aber das ist ein anderes Kapitel seiner Biographie und gehört zu den stillschweigenden Lebensentscheidungen dieses Mannes.
In einem Rückblick unter dem Titel „Ein Dichter in Stalins Winter“ zeichnete Venclova einmal das Himmel-und-Hölle-Bild jener Epoche, die ihn geprägt hat. Von dorther kommt der Fluchtreflex, den die Gedichte als Diagramm nachzeichnen. Ihr verdankt er die wichtigste Lektion, die noch einmal auf das hinauslief, was James Joyce die Grundtugenden jedes echten Künstlers nannte: Schweigen, Verbannung und List. Aus ihm folgt die minimale Bedeutungsverschiebung, das Graphem seiner Verssprache, der unverwechselbare Zug von Venclovas Dichtung.
In den späten Fünfzigern war ich Student an einer provinziellen sowjetischen Universität. Es gab einige, mich und ein paar Freunde, die an Literatur und Geschichte interessiert waren. Das gesamte Universitätssystem war so eingerichtet, daß wir so wenig wie möglich von authentischer Geschichte und authentischer Literatur erfahren konnten. Aber allmählich, unter großen Schwierigkeiten und mit nicht geringem Risiko, begannen wir einiges davon auszugraben und zu heben und zu verstehen. Bücher, die die Zeit der Stalin-Pogrome überlebt hatten, maschinengeschriebene Kopien von Gedichten, Exilausgaben – alle wurden von Hand zu Hand gereicht … Im gleichen Maße, in dem die Geschichte alptraumatisch war, war die Literatur großartig. Die einzigen Wirklichkeiten in dieser unwirklichen Zeit waren die ermordeten Schriftsteller.
Ein letztes Wort noch zur vorliegenden Auswahl. Das Litauische, eine der kleinsten europäischen Sprachen, was die Zahl ihrer Teilnehmer angeht, gehört zugleich zu den archaischsten, schwierigsten. In ihrer strengen Grammatik, dem kompakten Satzbau ist sie, wie Kenner meinen, dem Lateinischen enger verwandt als die romanischen Sprachen. Selbst Elemente des Sanskrit werden in ihr vermutet. Ihre innere Architektur macht sie für jeden Übersetzer zur harten Nuß. Wer sich in dieser Sprache an Gedichte heranwagt, macht die Erfahrung des Prokrustes. Viele der Enjambements konnten glücklich „hingebogen“ werden, manches, was überstand, mußte, wenn auch blutenden Herzens, abgehackt werden. Venclova selbst hat bei seinen Übersetzungen Rilkes als Semiotiker für sich das Recht der Umgestaltung in Anspruch genommen: ich übersetze die innere Struktur. In diesem Sinne hoffen auch wir auf den Segen des Autors. Ideal wäre eine Übertragung im literalen Sinn gewesen, das heißt so wahrheitsgetreu, nüchtern und trocken wie nur möglich. Bloße Genauigkeit aber, dafür gibt es manch verunglücktes Beispiel, ist das sicherste Einschläferungsmittel für die so behandelte Poesie. Das Buchstäbliche führt hier zur buchstäblichen Vernichtung des Zaubers oder, mit einer schlagenden Bemerkung von Robert Frost: das erste Opfer bei jeder Übersetzung ist die Poesie selbst. Was damit anklingt, ist das alte Thema von der Vergeblichkeit jeder Übersetzung. Nach Shelley kommt Übersetzen dem Versuch gleich, ein Veilchen in einen Schmelztiegel zu werfen, um das formale Prinzip seiner Farbe und seines Duftes herauszufinden. Das mag für manche Dichter übertrieben klingen, bei Tomas Venclova ist es leider nur allzu wahr. Im Falle so formbewußter, anspielungsreicher Gedichte ist eine akkurate, verlustlose Wiedergabe unter Beibehaltung der Reime – mathematisch unmöglich. Man hat dies schon öfter als faule Ausrede gehört. Aus dem Munde eines besonnenen Fachmanns wie Vladimir Nabokov, der sich gut zehn Jahre mit seiner Übertragung von Alexander Puschkins Eugen Onegin ins Englische herumschlug, ist es eine klare Diagnose. Wenn hier dennoch nicht vollständig auf Reime, Apophonien und Assonanzen verzichtet wurde, so deshalb, weil es sich einem Dichter wie Venclova gegenüber gehört, nach seinen Regeln mitzuspielen so gut es geht. Was die Aufgabe des Übersetzers betrifft, seinen geringfügigen Beitrag, das Zufallsglück des Gelingens, so hat Puschkin den Nagel wohl auf den Kopf getroffen. In seiner unbekümmerten Art verglich er die Übersetzer einmal mit den Pferden, die man an jeder Poststation der Zivilisation wechseln könne. Die beiden Herausgeber dieses Bandes können sich glücklich schätzen, wenn sie für ihre treuen Dienste nicht den Lohn der Esel erhalten. Ich danke Claudia Sinnig, meiner Führerin durch die Labyrinthe des Litauischen, für die anregende Zusammenarbeit und ihre unschätzbare Hilfe.
Durs Grünbein, Nachwort, 2007
„Berühre das Gras nun, das kühle, der Kindheit. /
Willkommen daheim. Im Dreiton rauscht dort das Meer / In der Muschel der Nacht. Daß die Gnade dich finde: / Einer neuen Epoche, die keine Posten mehr braucht, / Einer Luft, die sich sehnt nach der einzelnen Stimme.“ Ein Dichter kehrt nach Jahrzehnten der erzwungenen Abwesenheit zurück in das polnisch-litauisch-weißrussische Grenzgebiet und blickt über eine Landschaft, in deren von Geschichtsgewalt verzerrten Zügen das zarte Gesicht des im Wassers sich spiegelnden Kindes kaum mehr zu ahnen ist.
Wie seine Freunde Joseph Brodsky und Czesław Miłosz zählt Tomas Venclova zu den großen osteuropäischen Lyrikern des 20. Jahrhunderts, deren Werk zu einem erheblichen Teil im amerikanischen Exil entstand. Trotz Übersetzungen ins Englische, Russische, Polnische und Deutsche ist dieser größte Dichter litauischer Sprache bisher nur Kennern ein Begriff. Mit Brodsky, der ihn bis zu seinem Tode unermüdlich propagierte, teilt er die Liebe zu den metaphysical poets, zur Dichtung Mandelstams – vor allem aber die Verpflichtung, so zu schreiben, daß man von den Vorgängern, die einen die poetische Rede gelehrt haben, verstanden wird.
Die vorliegende Auswahl folgt den Epochen von Venclovas Dichterbiographie vom Ungarnaufstand 1956 bis zur erzwungenen Emigration aus der Sowjetunion 1977, den Jahren des Exils von 1977 bis 1990; der Zeit der Wende. Venclovas Erkenntnisorgan sind Ohr und Augen. Metrum, Reim, Klang und eine raffinierte Strophenstruktur sind seine Ausdrucksmittel. Durs Grünbein und Claudia Sinnig stellen sich den Herausforderungen einer Übersetzung, die dem formalen Reichtum dieser Dichtung gerecht zu werden versucht.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 2007
Ganze Leben in Gedichten
Tomas Venclova wurde 1937 im litauischen Klaipeda geboren. Die Stadt (zu Deutsch Memel) wurde 1939 unter nationalsozialistischem Druck an Deutschland zurückgegeben. Venclova floh mit seinen Eltern nach Kaunas. 1944 marschierte die Sowjetarmee ein und beendete den Traum von einem unabhängigen Litauen für die nächsten 46 Jahre. Venclovas Vater war lange Zeit Kulturminister des sozialistischen Satellitenstaats und im Unterschied zu seinem Sohn ein uneingeschränkter Befürworter der Sowjetunion. Von Antanas Venclova stammt auch der Text der Nationalhymne. Tomas Venclova studierte in Vilnius und es waren die Begegnungen mit Anna Achmatowa und Boris Pasternak, die ihm die Poesie als selbständigen Spielraum in einer sonst so totalitär überwachten und bestimmten Welt eröffneten. Der Ungarnaufstand und die Niederwalzung haben Venclova 1956 in den geistigen Widerstand getrieben, wohl auch seine Freundschaft zu den beiden Nobelpreisträgern Czesław Miłosz (1911-2004) und Joseph Brodsky (1940-1996). Während eines Lehrauftrags in den USA wurde ihm 1977 die Staatsbürgerschaft aberkannt. Seit 1980 unterrichtet Tomas Venclova an der Yale University. Er ist Professor für russische und osteuropäische Literatur. – Venclovas Lyrik kommt unscheinbar und vordergründig in einem klassischen Gewand daher. Die lakonische Atmosphäre gibt sich reserviert gegenüber dem Tagesgeschehen. Es zeigt sich hier sehr schön, dass die Kunstfertigkeit, in wenigen Strichen eine mehrdeutige Welt entstehen zu lassen, zu den Rückzugsmöglichkeiten des Intellektuellen in sozialistischen Staaten gehört hat. Umso klassischer und bewahrender ist Venclovas Dichtung im Grunde genommen. Die vornehme Zurückhaltung, der gedämpfte Ton und der Versuch, „Zeugnis abzulegen vom Verschwinden des Einzelnen im Grau einer versiegelten Zeit“ (Durs Grünbein im teilweise etwas gestelzt wirkenden Nachwort), bringen einem den Dichter näher in seiner Intention. Das Buch bietet einen Querschnitt durch Venclovas Schaffen von 1956 bis 2003, ist neben dem erwähnten Nachwort auch mit Kommentaren zu den einzelnen Gedichten angereichert und ich kann es Interessierten, die Lyrik gerne auch biographisch und im geschichtlichen Kontext lesen, ohne Vorbehalte empfehlen.
… im dunkel im dunkel im dunkel im dunkel im dunkel
wird unsre luft dünner und unsre materie zerstreut sich
ist alles bereit für den tod wenn eine silbe hervorbricht
und schwarz schimmern lettern auf nicht existentem papier
hier in diesem dunkel hier in dieser blindheit hier
(aus: „im feuer“, 1980)
Andreas Gryphius, amazon.de, 22.2.2009
Ungemein schwierig, vielfältig, schön
Dies ist eines der wenigen Bücher von Tomas Venclova, die im Deutschen vorliegen. Seine Gedichte können grob mit den von mir oben gewählten Schlagwörtern umschrieben werden, da sie komplexe Strukturen in Syntax und Metaphern-Wahl aufweisen. Sie kreisen um Trauer, Tod, Verlust und Momente der Freundschaft. Viele sind Venclovas Weggefährten gewidmet, viele seinen Aufenthaltsorten. Sie sind ein lyrischer Schatz, zweifelsohne, machen eigentlich Appetit auf mehr vom Autor und zeigen auf, wie sich Lyrik im Laufe des 20. Jh. entwickelt hat.
Michael Pietrucha, amazon.de, 22.9.2012
Sekunden der Ohnmacht
Seit über vierzig Jahren ist das poetische Werk des 1937 im litauischen Klaipeda geborenen Tomas Venclova von den gesellschaftlichen und politischen Verwerfungslinien in Osteuropa geprägt. Dennoch gehören seine Gedichte nach Durs Grünbein „zum Unzeitgemäßesten, was die zeitgenössische europäische Poesie zu bieten hat“. Wenn dieser offensichtliche Widerspruch eine der Ursachen für die dichterische Bedeutung des „Odysseus aus Vilnjus“ sein sollte, dann sind Topoi und Verfahrensweisen zu benennen, die dieser Dichtung durch die semantisch-syntaktischen Übersetzungskonturen hindurch eine solch nachhaltige, bewundernde Rezeption in Europa und Nordamerika verleihen.
Der vorliegende Band, nach Venclovas Gedichtband Vor der Tür das Ende der Welt im Hamburger Rospo-Verlag 2000, (vgl. die horen, 202/2001) die zweite umfangreiche Gedichtauswahl im deutschsprachigen Raum, kann in mehrerer Hinsicht eine Antwort darauf geben. Er umfasst rund ein Drittel des poetischen Werkes von Venclova; seine inhaltlichen Assoziationsfelder reichen von der tragischen Niederschlagung der ungarischen Republik im Jahr 1956 bis zu philosophischen Reflexionen „im friedlichen Winkel Europas zwischen Wannsee und Potsdam“ im Jahr 2003. Auf diesen Feldern zeichnen sich die Ereignisse um den Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei 1968 ebenso ab, wie die Werftarbeiterstreiks im Dezember 1970 in Polen.
Die Ermordung des russischen Dissidenten Konstantin Bogatyrjow im Jahr 1976 erfasst Venclova unter Verweis auf die berühmte erste Strophe aus Dantes Göttlicher Komödie; die durch Mauer und Stacheldraht geteilte Stadt Berlin im Jahr 1979, zwei Jahre nach seiner erzwungenen Emigration, gerät in das Visier des nunmehr ruhelos reisenden Dichters und Essayisten: in zahlreichen Subtexten setzt er sich mit Anna Achmatowas und Joseph Brodskys Poemen über Petersburg auseinander; in seinen hoch verschlüsselten Texten über die in Grautönen gehaltene litauische Landschaft tauchen Partisanen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit auf, in einem Drei-Strophen-Poem wagt Venclova im Winter 1991, während der militärischen Auseinandersetzungen um Vilnjus, nach einem Vortrag an der Yale-University eine Prognose über die Zukunft Litauens; in einer urbanistischen Reflexion aus dem Jahr 2000 über eine „Neue Postkarte aus der Stadt K.“ zeichnet er die materialen und psychischen Verwüstungen im einst ostpreußischen Königsberg auf.
Worin besteht nun, angesichts der intensiven, tief greifenden Diagnosen der Zeitenläufe in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das „Unzeitgemäße“ der Poetik von Venclova? Aus welchen Quellen speist sich „eine Stimme von so lakonischer Schwere, so unerschütterlicher Gefasstheit“ (Durs Grünbein)? Auf welche Weise bildet sich in diesen Gedichten eine oft abgeklärte, beinahe elegische Stimmung in enger Verbindung mit strengen metrischen Strukturen heraus? Wo sind die Ursprünge der philosophisch und poetologisch aufgeladenen Texte zu suchen?
In seinem Nachwort verweist Grünbein zu Recht auf die enge geistige und dichterische Verwandtschaft Venclovas mit Joseph Brodsky und Czesław Miłosz, mit denen er „ein Dreieck aus russischen, polnischen und litauischen Traditionen“ bildet. Von den Russen, nicht nur von seinem langjährigen Freund Brodsky, habe er ein System verstecktester Anspielungen und eine Akrobatik der Verskunst erlernt, sei von der klassischen Poetik (Puschkin) wie auch der frühen Moderne (Mandelstam, Blok, Achmatowa) inspiriert worden und nicht zuletzt auch vom Jazz der Leningrader Szene der frühen 70er Jahre.
Natürlich sei ihm auch die „gedankenstrichschnelle“ Marina Zwetajewa ebenso vertraut gewesen wie das poetologische Konzept des dichterischen Zeitgenossen, wie es Mandelstam entworfen habe. Und wo dieses dichte und zugleich zarte Geflecht nicht ausreichte, da habe er auch aus antiken und christlichen Quellen geschöpft, um die geistige Verlorenheit der Sowjetära, die urbane verödete Landschaft im Osteuropa der 50er bis 70er Jahre mit einem neuen, geheimen Kanon aufzuladen.
Daraus habe sich eine doppelte Belichtung von Vergangenheit und Gegenwart entwickelt, die Venclova in eine Gegenposition zum Zeitgeist treten lassen, die ihn gleichsam zu einer Gegenkraft seiner Epoche machen. Die sich dabei herausbildende Zähigkeit im Umgang mit den gigantischen Torheiten des kommunistischen Systems und der vielstimmigen zeitgenössischen Alogik der liberaldemokratischen und starrsinnigen republikanisch-nationalen Ordnungen, so könnte man hinzufügen, bilden weitere Quellen der Poetik Venclovas.
Wer sich aufmerksam in die Tiefendimensionen der vorliegenden, von Claudia Sinnig (Interlinear- und literarische Übertragungen aus dem Litauischen) und von Durs Grünbein übersetzten Poeme einliest, der wird vor allem in den Abschnitten I und II einprägsame, wenn auch manchmal schwer zu entschlüsselnde Bild- und Gedankenmuster von politischen, geologischen und geisteswissenschaftlichen ost- und ostmitteleuropäischen Landschaften erhalten. Mit dem Blick auf den durch die Rote Armee blutig niedergeschlagenen Budapester Aufstand im Spätherbst 1956 notiert das lyrische Ich eine Geschichte überschreitende Agonie:
Nur eine Sekunde der Ohnmacht.
Nun kommen wir nie mehr dorthin,
o blutrot im Wasser der Donau
Das Bild des Novembers verschwindet.
Im September 1968 widmet Venclova in „Gedicht über die Freunde“ der auf dem Roten Platz mit einigen Freunden gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings protestierenden russischen Dichterin Natalja Gorbanewskaja eine fast gnostische Hymne:
Und wieder, mit rührender Großmut, Herbst,
Über Häusern und Gleisen der fremden,
Von ein paar Seelen erretteten Stadt
Beginnt in dieser Stunde der September.
Im „Gespräch im Winter“ gedenkt er von Litauen aus der Opfer der Werftarbeiterstreiks in Stettin und Danzig, wobei er aus großer zeitlicher Distanz von einer „Gravitation des Todes“ spricht, die „an den Pflanzen, Menschen / Und Dingen“ zerrt. 1979 markiert ein kollektives Ich den politisch-geographischen Standort Berlin:
Wir sehn den umgestülpten Himmel, Soldaten patrouillieren.
Blaulicht, das peitscht. Ein Fleck prangt herrisch an der Mauer.
Die Leere, richtungslos.
Venclova, in den 80er und 90er Jahren nicht nur in Europa unterwegs, reflektiert 1996 bei einem Besuch in Peking den Zustand der chinesischen Gesellschaft nach der Niederschlagung der Studentenrevolte auf dem „Platz des Friedens“:
Hundert oder fünfzig Meter von hier
stand der unbewaffnete Mann, der einen der nahenden Panzer
für kurze Zeit zähmte. Irgendwo ist er noch, nicht gefangen,
und weiß nicht, dass seine unfassbare Geste der Welt den Atem raubte.
Dass Venclova den Status eines Dichters aufweist, der historische Zusammenhänge über große geographische Distanzen hinweg erfassen kann, ohne freilich eine überzeugende sachlogische Erklärung für die nachhaltige Wirkung von welthistorischen Ereignissen liefern zu können, verdeutlicht das Poem „Die Dünen in Watemill“. Es setzt ein mit einer einfachen Naturbeschreibung („Long Island“) und beschreibt dann die in der Tat bedeutende Rettungsaktion des japanischen Konsuls Chiune Sugihara in Vilnjus des Jahres 1941. Er versorgte – gegen die konsularischen Vorschriften – Tausende litauischer Juden mit Transitvisa für Japan und rettete ihnen damit das Leben, wie in den Kommentaren zu diesem Band von Claudia Sinnig zu lesen ist.
Einen besonderen Aspekt bilden in den Poemen Venclovas die zahlreichen zoomorphen Wesen, die als Metaphern die psychischen Befindlichkeiten der Protagenisten markieren. Einige Beispiele mögen solche Verfahren verdeutlichen. In „Emigrantin“ aus dem Jahre 2000 setzt er sich mit dem schweren Los einer möglicherweise aus Litauen ausgewiesenen Frau auseinander, die in dem US-amerikanischen Exil in wachsende Isolation gerät. Die dort auftauchenden Tiere (Waschbär, Eichhörnchen, Ameisen) versinnbildchen deren Annäherung an die Großstadtwelt der Menschen, die in einer offensichtlich immer größeren Entfremdung voneinander leben:
All diese Ströme ins Nichts. Ein Waschbär schleicht um die Garage,
Klopft mit der Schnauze ans Tor. Eichhörnchen lodern im Nadelgestrüpp.
… Unter Blättern erschauert der Zweig.
Ameisen schuften.
Ebenso bildmächtig beschreibt ein kollektives lyrisches Ich – auf der visuellen Wahrnehmungsebene – in dem Gedicht „An den Seen“, das Claudia Sinnig gewidmet ist, die Seenlandschaft um Potsdam. Doch in den Tiefenschichten von Natur- und Kulturraum lauert auch dort die totalitäre Vergangenheit:
Die Ebene ist angefüllt mit dem Wasser
des Todes des Lebens,
…
ein Schatten liegt auf
der Vergangenheit (wie auf der Gegenwart),
im Licht der ersten heiteren Wochen.
Und nur wenig später erweist sich das nachdenkende Ich als hilflos bei der Bewertung der Vergangenheit, aus der die Phänomene Riefenstahl, Häftling, schwarze Namenszüge oder Flüchtling auftauchen:
Die Vergangenheit bringt keine Erleuchtung, doch versucht sie,
etwas zu sagen. Vielleicht begreift ja die Krähe uns
und den Schmutz der Geschichte besser als wir.
Es zeichnet sich also, je mehr wir in die Tiefenstrukturen dieser so sinnmächtigen Poesie vorstoßen, eine eigenwillige, „unzeitgemäße“ Beleuchtung eines Jahrhunderts der Kriege, Massenerschießungen, Vertreibungen und eines nicht auslotbaren psychischen Leids ab. Sie wird von einem Scheinwerfer ausgelöst, der gleichsam tastend die sichtbare Wirklichkeit erfasst, um deren Rätselhaftigkeit mit gnostischen Erläuterungen zu versehen. Dieser „Mangel“ an Effekthascherei, wie sie vor allem die postmoderne Poesie pflegt, erweist sich als die Wirkmächtigkeit von „Bildern“, die sich auch nach einer Schichten-Analyse nicht in phänomenologisch verdichteten Aussagen auflösen, sondern als gleichsam menetekelhafte Schlaglichter unser Unterbewusstsein aufscheuchen.
Dass in der vorliegenden Ausgabe zahlreiche, für den einfühlsamen, aber ahnungslosen Leser „dunkle“ Felder beleuchtet werden, ist einer vorbildlichen editorischen Arbeit zu danken. Zahlreiche Gedichte sind mit Erläuterungen versehen, die den biographischen und geschichtlichen Hintergrund mancher lyrischen Protagonisten aufhellen. Das Nachwort von Durs Grünbein zeugt von einer fundierten Kenntnis einer eigenwilligen Poetik, die durch die sprachliche Vermittlung von Claudia Sinnig und manches Gespräch mit dem Autor eine deutende Vertiefung erfahren hat.
Es ist deshalb zu wünschen, dass die Botschaften einer bedeutenden europäischen Dichterpersönlichkeit aus dem amerikanischen Exil von einer größeren deutschsprachigen literarischen Öffentlichkeit aufgenommen werden. Vielleicht war die Lesereise von Tomas Venclova durch Deutschland im November 2008 ein anregender Auftakt zu einer eingehenden Begegnung mit seiner Poesie.
Wolfgang Schlott, die horen, Heft 233, 1. Quartal 2009
Weiterer Beitrag zu diesem Buch:
Ralf Willms: „Einer Luft, die sich sehnt nach der einzelnen Stimme“
fixpoetry.com, 22.6.2009
Die Sowjets 1939–1941
Ellen Hinsey: Können Sie die Situation Ihrer Familie unmittelbar vor der ersten sowjetischen Okkupation Litauens schildern?
Tomas Venclova: Wir waren von Klaipėda nach Kaunas gezogen. Petras Cvirka und meine Tante Marija wohnten in Großvaters Haus, also mieteten wir ein kleines Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft. Mein Vater fand eine Anstellung als Lehrer an einer Oberschule, die er aber Anfang 1940 wieder verlieren sollte, weil er ein pazifistisches und vorsichtig prosowjetisches Gedicht in der Presse veröffentlicht hatte. Es zog die Aufmerksamkeit von Präsident Smetona persönlich auf sich, der den Bildungsminister anrief und empfahl, Maßnahmen gegen diesen politisch verdächtigen Autor zu ergreifen. Derlei war Usus im autoritären Litauen, obwohl das Land von einem Faschismus weit entfernt war, auch wenn die Stalinisten das Gegenteil behaupteten. Mein Vater fand einige Zeit später eine Stelle bei einer linken Zeitung, aber unsere Familie steckte in großen Schwierigkeiten.
Hinsey: Der Krieg rückte näher und das unabhängige Litauen befand sich in einer nicht eben beneidenswerten Lage.
Venclova: Litauen unterhielt aufgrund der Vilnius-Frage keine diplomatischen Beziehungen mit Polen. Nazideutschland, der westliche Nachbar, war eine echte Bedrohung. 1938 hatte die polnische Regierung die sofortige Aufnahme von diplomatischen Beziehungen verlangt, was in Litauen als Aufforderung zum Verzicht auf alle Ansprüche auf die Hauptstadt verstanden worden war. Nach einigem Zögern gab die litauische Regierung nach – sie hatte auch keine andere Wahl, denn ein polnisch-litauischer Krieg hätte mit der Niederlage Litauens geendet. In der Folge verlangte Hitler Klaipėda und das Memelland. Die Regierung wusste, dass Widerstand zwecklos war, weil Hitler das Land ohne weiteres in wenigen Tagen hätte besetzen können. Diese Kalamitäten hatten eine enorme psychische Wirkung auf die Bevölkerung. Man darf nicht vergessen, dass Smetona mit einem Staatsstreich an die Macht gekommen war und ein autoritäres Regime errichtet hatte. Jetzt wirkte er hilflos, den umliegenden Mächten ausgeliefert. Im nationalen Bewusstsein war Vilnius das Herz von Litauen und Klaipėda – der einzige Hafen des Landes – die Lunge. Es schien unwahrscheinlich, dass das Land ohne beide überleben könnte.
Hinsey: Dies berührt die komplexen geopolitischen Beziehungen vor dem Zweiten Weltkrieg.
Venclova: Im Licht der damaligen Situation machte die Sowjetunion, zumindest auf einige, nicht den allerschlechtesten Eindruck. Eine gemeinsame litauisch-sowjetische Grenze gab es damals noch nicht; sie entstand erst, nachdem Nazideutschland und die UdSSR Polen gemäß dem Molotow-Ribbentrop-Pakt unter sich aufgeteilt hatten. Die Sowjetunion unterstützte Litauens Anspruch auf Vilnius, wenn auch nur deshalb, weil Polen der Erzfeind Russlands war. Freilich, die Sowjets waren brutal, aber das ganze Ausmaß ihrer Verbrechen war in Litauen damals noch nicht bekannt, übrigens auch nicht in den anderen europäischen Staaten. Jene, die versuchten, in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, ließen sich leicht als „Kämpfer für eine hoffnungslose Sache“ oder als „unverbesserliche Rechte“ abtun. Jene, die sich für eine Verbesserung der durchaus ernsten politischen und sozialen Bedingungen in Osteuropa engagierten, neigten dazu, den Kommunismus für ein Patentrezept zu halten – gegen diese Verlockung waren auch mein Vater und Cvirka nicht immun, ebensowenig wie Miłosz, der sich in Polen davon angezogen fühlte, jedenfalls eine Zeit lang. Mein Vater und Cvirka hatten in den dreißiger Jahren zusammen mit einer Gruppe von litauischen Kulturschaffenden die Sowjetunion besucht. Sie bekamen dort die üblichen potjemkinschen Dörfer zu sehen und verließen das Land unter dem Eindruck, dass es sich um eine brauchbare Alternative zum Kapitalismus handelte.
Das sind zumindest die Gründe, die zur Rechtfertigung jener Linken der Zwischenkriegszeit vorgebracht werden, die dem Kommunismus Stalinscher Prägung erlegen waren. Diese Argumentation mag auf Westeuropäer und Amerikaner zur damaligen Zeit überzeugend gewirkt haben, doch sie hatten die Sowjetherrschaft nicht selbst erlebt, die über Litauen und die beiden anderen baltischen Staaten hereinbrach, (Lettland und Estland waren kleiner, etwas wohlhabender und demokratischer, doch ihre Erfahrung unterschied sich wenig von der litauischen.)
Hinsey: Sie haben gerade den Molotow-Ribbentrop-Pakt erwähnt. Da dieses Abkommen für Litauen und das Leben Ihres Vaters weitreichende Auswirkungen hatte, sollten wir vielleicht an dieser Stelle darüber sprechen.
Venclova: Dieser Pakt wurde Ende August 1939 von Deutschland und der Sowjetunion unterzeichnet. Er beinhaltete, wie hinreichend bekannt ist, ein geheimes Zusatzprotokoll, dessen Existenz von der Sowjetunion bis zur Gorbatschow-Ära vehement bestritten wurde. Dieses Protokoll teilte Polen in „Einflusssphären“ der Nazis und der Sowjets auf; die territoriale Aufteilung ähnelte der Teilung Polens von 1795, war aber brutaler, dem brutaleren Zeitalter entsprechend. Lettland und Estland sollten an Stalin gehen, während Litauen, das eine gemeinsame Grenze mit Deutschland hatte, Hitler zufallen sollte. Der deutsche Botschafter in Kaunas machte den Vorschlag, die Litauer sollten sich im Gegenzug zu einem Militärbündnis mit Deutschland und unterstützt von der vorrückenden siegreichen Wehrmacht ihre Hauptstadt Vilnius wieder angliedern. Litauen würde Vilnius von den Polen zurückerobern, die von der militärischen übermacht der Deutschen bereits geschwächt waren.
Hinsey: Wie hat das unabhängige Litauen darauf reagiert?
Venclova: Präsident Smetona lehnte klugerweise ab, obwohl einige litauische Sympathisanten in politischen Kreisen das Angebot für ein Geschenk des Himmels hielten. Nach diesem Affront gab Hitler den Gedanken an Litauen als möglichen Bundesgenossen auf und überließ das Land Stalin im Tausch gegen anderthalb Provinzen von Polen: die Wojwodschaft Lublin und den Ostteil der Wojwodschaft Warschau. Nach der Eroberung Polens durch Deutschland und die UdSSR im September 1939 nahm Stalin Vilnius ein und übergab es mit großzügiger Geste dem noch immer unabhängigen und neutralen Litauen. Es war eine schicksalhafte Entscheidung, die Stalin und sogar die Sowjetunion überdauert hat: Vilnius gehört bis heute zu Litauen, als seine Hauptstadt.
Hinsey: Wir neigen zu der Annahme, dass Litauen bereits infolge des Feldzugs im September 1939 seine Unabhängigkeit verloren hatte…
Venclova: … was nicht richtig ist. Nach dem Kriegsbeginn in Polen verfügte Litauen, ebenso wie Lettland und Estland, für weitere neun Monate noch über ein Mindestmaß an Unabhängigkeit. Im Oktober 1939 forderte Stalin die Genehmigung zur Einrichtung von Militärbasen in allen drei Ländern, angeblich, um sie und die UdSSR vor westlichen Aggressoren oder, allgemeiner, vor den Unbilden des Krieges, zu schützen. Selbstverständlich wurde seiner Forderung entsprochen. Der Druck von Seiten des neuen Bündnispartners Sowjetunion war so groß, dass ein Nachgeben unausweichlich war. Einige hofften – beteten, dass diese noch erträglichen Bedingungen andauern würden. Andere bereiteten sich heimlich auf die Flucht vor, während die litauischen Kommunisten, eine verschwindende Minderheit, eine echte und endgültige sowjetische Besatzung kaum erwarten konnten.
Hinsey: Doch das sollte sich im Juni 1940 radikal ändern.
Venclova: Im Juni 1940 stellte Stalin Litauen ein Ultimatum, mit dem er die Stationierung einer unbegrenzten Zahl sowjetischer Truppen sowie einen Regierungswechsel durchsetzen wollte. Gleichlautende Forderungen ergingen an Lettland und Estland. Die litauische Regierung erkannte, dass Widerstand zwecklos war, und kapitulierte. Smetona, der dagegen war, wurde zum ersten und letzten Mal während seiner Herrschaft überstimmt. Er floh, zuerst nach Deutschland, dann in die.USA – eine glückliche Entscheidung, wenn man bedenkt, dass die Präsidenten von Lettland und Estland, die nicht geflüchtet waren, in Straflagern endeten. Die Invasion erinnerte stark an Hitlers Einmarsch in der Tschechoslowakei im März 1939 und war ihm eindeutig nachempfunden. Obwohl es sich technisch gesehen eher um eine Annexion als einen Kriegszustand handelte, hatte sie auf die Situation unserer Familie fundamentale Auswirkungen.
Hinsey: Was meinen Sie damit?
Venclova: Die neue litauische Regierung, die von den Sowjets eingesetzt worden war, bestand aus Personen, die gegen Smetonas Herrschaft opponiert hatten, darunter einige respektable Liberale, die das Geschehen vielleicht nicht vollständig durchschauten, während die Kommunisten alles sehr gut verstanden. Mein Vater, zu jener Zeit vierunddreißig Jahre alt, befand sich gerade als Vertreter des litauischen Schriftstellerverbands in Estland.
Am 17. Juni 1941 las er im Zug von Tallinn nach Kaunas in der Zeitung, dass er zum litauischen Bildungsminister ernannt worden war, zweifellos auch aufgrund des Ansehens, das er sich in linken Kreisen erworben hatte, nachdem er als Lehrer gefeuert worden war. Nach einigem Zögern nahm er den Posten an: andere Mitglieder der Regierung hatten ihm zu verstehen gegeben, dass jegliche Ausflucht undenkbar war. Alle Schulen in Litauen, die Universität, die Theater und so weiter waren jetzt ihm unterstellt – nominell, natürlich. (Petras Cvirka, sein Freund und Schwager, erhielt keinen Posten in der Regierung, begrüßte das neue Regime aber trotzdem.)
Innerhalb von anderthalb Monaten wurde Litauen zu einer dem Standard entsprechenden Sowjetrepublik und gnädig in die UdSSR aufgenommen. Mein Vater fuhr mit anderen Mitgliedern der Regierung zur offiziellen Unterzeichnung der entsprechenden Dokumente nach Moskau. Zusammen mit einigen wenigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Litauen wurde er zu einem Treffen mit Stalin eingeladen. Diese Begegnung dauerte etwa zwei Stunden.
Es ist eine traurige Geschichte, komplizierter, als es den Anschein hat. Auf dieses Jahr gehen meine frühesten Erinnerungen zurück (mein dritter Geburtstag fiel auf den 11. September 1940, einen Monat nach der sowjetischen Annexion).
Hinsey: Bleiben wir bei diesen frühesten Eindrücken Ihres Lebens.
Venclova: Die früheste Erinnerung – war es die Beerdigung von Pranas Masiotas, einem alten, von Generationen von Menschen geliebten Kinderbuchautor? (Er war im Gebäude des Bildungsministeriums aufgebahrt, und ich wurde zu ihm gebracht, um mich von ihm zu verabschieden.) Oder war es die Großkundgebung, auf der mein Vater eine Rede gehalten hat? Ich erinnere mich noch deutlich an die Menschenmenge, die roten Fahnen und die Porträts der sowjetischen Staatsführer. Ein Moment jedoch hat sich ganz besonders in meinem Gedächtnis festgesetzt: Meine Eltern mussten eines Abends aus dem Haus gehen, und ich war außer mir, weil ich nicht wollte, dass meine Mutter mich verlässt. Sie sagten, dass mir das Dienstmädchen (wir hatten schon ein Dienstmädchen) die Tauben auf dem Dachboden zeigen würde. Ich ging neugierig hinauf, doch es waren keine Tauben zu sehen, und als ich zurückkam, waren meine Eltern gegangen. Ich verstand zum ersten Mal im Leben, dass man betrogen werden kann. Von diesem Augenblick an habe ich Täuschung von ganzem Herzen gehasst.
Meine erste wirklich bedeutsame Erinnerung kommt aus jener Zeit, als wir nach Vilnius zogen. Nach dem Beginn der sowjetischen Besatzung sollten einige litauische Ministerien von Kaunas nach Vilnius umziehen, 1940 wurde zunächst nur das Bildungsministerium umgesiedelt. Die Stadt war damals fast ausschließlich polnischsprachig und nicht allzu begeistert von den Litauern, ganz zu schweigen von den Sowjets. Mein Vater erhielt eine Wohnung in einem wohlhabenden Stadtviertel, in dem sich auch andere litauische Neuankömmlinge, zumeist Untergebene oder Freunde von ihm, niederließen.
Einer dieser Freunde war Kazys Boruta, der hier eine Erwähnung verdient. Er war ein Klassenkamerad meines Vaters, auch er ein linker Schriftsteller. In den zwanziger Jahren war er der illegalen Partei der Sozialrevolutionäre beigetreten, die das Smetana-Regime mit allen erdenklichen Mitteln bekämpfte, Terrorismus eingeschlossen. Den Kommunisten waren sie zutiefst verhasst, die Sozialrevolutionäre zahlten es ihnen mit gleicher Münze heim. Boruta musste nach Wien fliehen (das Haus, in dem er damals wohnte, wurde vor kurzem ausfindig gemacht; es soll eine Gedenktafel erhalten). Als er nach Litauen zurückkehrte, wurde er von Smetana ins Gefängnis gesteckt, dann freigelassen, er überlebte die sowjetische und die Naziokkupation, landete 1946 in einem stalinistischen Gefängnis und wurde wieder freigelassen, nicht ohne die Hilfe meines Vaters. Ich habe ihn gut gekannt und in meiner Jugend verehrt. Er war ein ziemlich guter Dichter – Miłosz hat ihn ins Polnische übertragen – und ein ausgezeichneter Prosaschriftsteller, vor allem aber ein sehr ehrlicher, wenn auch etwas naiver Mensch.
Jedenfalls, Boruta hatte eine Tochter, Eglė. Das bedeutet „Fichte“ und ist der Name einer mythologischen Frauengestalt, die in einen Baum verwandelt wird, wie Daphne. Sie besuchte uns oft in unserer Wohnung und spielte mit mir. Sie war schon sieben und deshalb meine etwas herablassende Beschützerin. Eines Tages beschloss Eglė, mir das Lesen beizubringen. Sie war eine geborene Pädagogin. Zuerst zeigte sie mir die Buchstaben „m“ und „a“, schrieb das Wort „mama“ und sagte dann:
Und jetzt werde ich ein anderes Wort schreiben: „Amerika“.
Doch anstelle von „Amerika“ kritzelte sie wieder „mama“. Da ich, wie gesagt, sehr empfindlich war gegen jegliche Form der Täuschung, rief ich:
Nein, das ist dasselbe – „mama“!
Eglė lachte zustimmend. Ich hatte blitzartig das Wichtigste begriffen: man darf sich nicht auf einzelne Buchstaben konzentrieren, sondern muss ganze Wörter erfassen. Von diesem Augenblick an lernte ich sehr schnell; auf einem Spaziergang durch Vilnius verblüffte ich meine Eltern. Ein wenig beunruhigt stellten sie fest, dass ich die Aushänge von Geschäften lesen und verstehen konnte: „kepykla“ (Bäcker), „kirpykla“ (Friseur) und so weiter. Einige waren in Polnisch oder Hebräisch und mir unverständlich- die überging ich.
Jedenfalls begann ich, fast alles zu lesen, was mir in die Hände fiel, darunter Borutas Gedichte, aber auch Antigone und Das Dekameron, das ich natürlich nur teilweise verstand. Aber das war etwas später, mit fünf oder sechs. Mit drei Jahren las ich vor allem die Kinderbücher von Mašiotas und anderen. Bis auf den heutigen Tag erinnere ich mich an ein Geschenk meines Vaters – das Buch, das ich am ersten Tag des Krieges las. Es war eine litauische Übersetzung der Onkel-Remus-Geschichten, die ich lange besessen habe, obwohl sie schon völlig zerfleddert war.
Hinsey: Was haben Sie damals über die Position Ihres Vaters und das Leben Ihrer Eltern gewusst?
Venclova: Natürlich hatte ich kaum eine Vorstellung von seiner Arbeit, doch ich erinnere mich daran, dass ich in einer Kinderzeitschrift sein Bild neben den Bildern der sowjetischen Führer gesehen habe und als Dreijähriger ziemlich stolz darauf gewesen bin. Er trat zunächst nicht der Kommunistischen Partei bei – das geschah erst nach dem Krieg – und blieb ein typischer linker „Weggefährte“, der vor liberalen und „bürgerlichen“ Illusionen nicht gefeit war. Selbstverständlich hatte er keinen Einfluss auf den Gang der Ereignisse. Langsam und unerbittlich wurden die strenge stalinistische Ordnung, Ideologie, Rhetorik und Zensur eingeführt, mit dem Ergebnis einer erbärmlichen Verwahrlosung, Eintönigkeit und Uniformität – einer Gleichschaltung, um es auf Deutsch zu sagen. Allmählich wuchs die Angst, obwohl sich in den ersten Monaten der sowjetischen Herrschaft die kommenden Katastrophen noch nicht abzeichneten. Doch wurden einige – nicht alle – Mitglieder der Regierung Smetona und der alten Führungsschicht verhaftet und nach Sibirien deportiert; manche von ihnen wurden ohne auch nur den Anschein eines Gerichtsprozesses erschossen, über ihre Verhaftung und Ermordung wurde nicht berichtet. Obwohl willkürliche Verhaftungen und Mord nie legitim sind, betrachteten bestimmte Linke diese Gewalt damals als Vergeltung, weil auch Smetona seine Feinde verhaften und bisweilen hinrichten ließ.
Hinsey: Wie hat Ihr Vater diese Entwicklungen beurteilt?
Venclova: Ich denke, mein Vater hat dies, wie viele in seinem Umfeld, als das Wirken einer höheren Gewalt gesehen. Er versuchte sich einzureden, dass die Dinge nicht ganz so schlimm stünden, dass manche Veränderungen vielleicht sogar positiv sein könnten, dass ein Minimum an Normalität erhalten bleiben würde. Auch ich glaube, dass es ihm in diesen ersten Monaten durchaus gelang, sich nützlich zu machen, wenngleich sein Einfluss begrenzt war. Neue Schulen wurden eröffnet, und selbst wenn sie vor allem stalinistischen Lehrstoff vermittelten, so halfen sie doch, das Analphabetentum zu reduzieren – wenn man lesen kann, dann kann man im Prinzip lesen, was man will. In der Säkularisierung des Schulsystems ließ sich der Geist der Demokratie erkennen. Andererseits jedoch wurden Schulen von Minderheiten – polnische, jiddische usw. – geschlossen.
Obwohl er Atheist war, hat mein Vater einigen katholischen Priestern zu helfen versucht; er ließ sie Latein in den Schulen unterrichten, die beste Methode, um zu überleben. Interessant ist auch der Fall von Juozas Miltinis, einem Schauspieler und Theaterregisseur, der seine prägenden Jahre in Paris verbracht hatte, wo er bei Charles Dullin studierte (mit Artaud verband ihn eine Freundschaft – sogar mehr als das). Er kehrte kurz vor der sowjetischen Annexion nach Litauen zurück. Dies hätte außerordentliches Pech sein können, aber mein Vater, der mit Miltinis gut bekannt war, half ihm, ein Theater in dem Provinzstädtchen Panevezys zu gründen, wo die ideologische Konformität weniger strikt war. Miltinis gelang es, eine Truppe von jungen, begabten Schauspielern zusammenzustellen. Sein Theater hat die Naziokkupation und die darauffolgenden sowjetischen Jahre überstanden, wenn auch mit moralischen Kompromissen. In den sechziger und siebziger Jahren war es wahrscheinlich das einzige westlich orientierte Theater in der gesamten Sowjetunion. Miltinis brachte halb verbotene Dramatiker wie Strindberg und Dürrenmatt auf die Bühne, und seine Schauspieler, die bekannt waren für ihre europäische Ausbildung, wurden überall in der Sowjetunion zu Filmstars. Ich hatte mehr als einmal das Privileg, dem großen alten Mann und seiner Schauspieltruppe zu begegnen.
Hinsey: Die Ereignisse jener Zeit hatten vermutlich tiefgreifende Auswirkungen auf Ihre Eltern. Können Sie sich noch an den Alltag damals erinnern?
Venclova: An unser Familienleben während der ersten sowjetischen Besatzung von 1940 bis 1941 habe ich kaum noch Erinnerungen. Wie bei den meisten Menschen sind auch meine frühen Kindheitserinnerungen durchaus idyllisch. In meinem Fall jedoch stehen sie in scharfem Kontrast zu den Kriegstraumata, die folgen sollten. Zu jener Zeit wurde unsere Alltagsroutine in Vilnius oft von Besuchen im Haus meines Großvaters in Kaunas unterbrochen. Wir waren eng mit Petras Cvirka befreundet, der ausgelassen und geistreich war, ganz anders als mein ruhiger Vater. Zu jener Zeit verfasste Cvirka zahlreiche Artikel, in denen er das neue System anpries, aber das einzige Buch, das er publiziert – und mir präsentiert – hat, war eine hervorragende Märchensammlung für Kinder; es ist bis heute in Druck. Tante Marija bekam einen Sohn, Andrius, meinen Cousin; er war ein Kleinkind, als der Krieg begann.
Hinsey: Doch dieses „Minimum an Normalität“, von dem Sie sprachen, sollte zwei Wochen vor dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 abrupt enden.
Venclova: Was damals geschah, hat die Litauer nachhaltig geprägt. Ich war noch nicht einmal vier Jahre alt und verstand die zusammenhänge erst später, während der Naziokkupation, aber es war ein furchtbarer Schock für meine Familie und für die gesamte litauische Bevölkerung. Zum ersten Mal seit der Annexion des Landes zeigte das stalinistische Regime sein wahres Gesicht. In den frühen Morgenstunden des 14. Juni 1941 suchte die Geheimpolizei unter Mithilfe von örtlichen kommunistischen Aktivisten Tausende von Wohnungen auf. Die Familien, die sie ins Visier genommen hatten, bekamen etwa eine Stunde, um die wichtigsten Sachen zu packen, wurden dann auf Lastwagen getrieben, zu Bahnhöfen gefahren und in Viehwaggons geladen – die Männer getrennt von den Frauen und Kindern. Die Deportationen kamen völlig unerwartet. Sie dauerten zwei oder drei Tage. Die Menschen in den Viehwaggons gehörten meist, aber nicht ausschließlich, zur Elite des Landes: Lehrer, Offiziere der Armee, Beamte, Priester, wohlhabende (und nicht ganz so wohlhabende) Bauern, sogar Arbeiter, wenn sie Mitglieder von nicht kommunistischen Parteien waren. überhaupt waren alle Parteien von Beginn der Sowjetherrschaft an verboten. Trotzkisten, Sozialrevolutionäre und andere Linke galten als die Verdächtigsten, gefolgt von rechtsgerichteten Parteien. Deren einfache Mitglieder waren bis dahin im Großen und Ganzen nicht belangt worden. Dies hatte sich völlig geändert. Außerdem sollten alle Personen, die jemals Auslandskontakte gehabt hatten, Esperantisten und Philatelisten eingeschlossen, en masse von der Polizei abgeholt werden. Die festgenommenen wurden nach Sibirien deportiert, manche kamen in Arbeitslager, die meisten aber in gottverlassene russische Dörfer, wo sie bei null anfangen mussten. Viele starben schon auf dem Weg, noch mehr starben im Laufe des ersten Jahres. Nur wenige haben überlebt, sie schafften es, sich der rauen Umgebung anzupassen, und konnten nach Stalins Tod zurückkehren. Aber das waren Ausnahmen. Sie haben von den Sowjets nie eine Entschädigung erhalten.
Die Ereignisse im Juni 1941 glichen in ihrer Brutalität den Deportationen der Nazis. Die Gestapo übrigens hat Deportationen und Hinrichtungen öffentlich angekündigt. Hier fand alles stillschweigend statt – keine Aufforderungen, die öffentlich angeschlagen waren, keine Zeitungsmeldungen, gar nichts. Die Menschen verschwanden einfach spurlos. Die Nazis hatten vor allem Juden im Visier, die Sowjets „Klassenfeinde“ – einschließlich der Juden natürlich, insbesondere jener, die der bürgerlichen Schicht angehörten-, für ihren ethnischen Hintergrund, ihre Religion oder Rasse interessierten sich die Sowjets kaum. Im heutigen Litauen werden die Deportationen oft als „Genozid“ bezeichnet. Ich halte diesen Begriff für unzutreffend: „Stratozid“ wäre passender, denn tatsächlich hat Stalin jene Schichten der Gesellschaft ausgerottet, die er für eine mögliche Bedrohung seiner Herrschaft hielt. Aber Terror bleibt Terror, egal, wie man ihn nennt.
Hinsey: War Ihre Familie gefährdet?
Venclova: Wir blieben verschont. (Stalin veranlasste zu jener Zeit keine Säuberungen innerhalb der sowjetischen Regierung, was sich jedoch in der Nachkriegszeit ändern sollte.) Erwähnt sei auch, dass man viele Menschen, die für die Deportationen bestimmt waren, vorerst entkommen ließ. Doch es war gewiss auch für meine Eltern und Großeltern eine bedrückende Erfahrung. Vielleicht verstand mein Vater damals zum ersten Mal, in welch schreckliche Sache er verstrickt war. Die Lehrer, die ihm nominell unterstanden, hatten vermutlich am schlimmsten zu leiden. Ich weiß mit Sicherheit, dass er versucht hat, einigen von ihnen zu helfen. Als ich heranwuchs, haben wir nur selten über diese Ereignisse gesprochen; wenn wir doch einmal darauf kamen, war er immer sichtlich angespannt.
Hinsey: Kurz darauf, am 22. Juni 1941, erklärte Deutschland der Sowjetunion offiziell den Krieg und brach damit den Nichtangriffspakt der beiden Staaten.
Venclova: Das geschah auf dem Höhepunkt der sowjetischen Deportationen. Aus diesem Grund haben manche Leute im Kriegsbeginn und in der sich anschließenden Naziokkupation einen Ausweg aus der sowjetischen Herrschaft sehen wollen – wenigstens anfänglich. Der Krieg bereitete den Deportationen ein jähes Ende. Nach heutigen Schätzungen wurden etwa siebzehntausend Menschen deportiert. Weitere hätten ihr Schicksal geteilt, wenn die Sowjets an der Macht geblieben wären. In den beiden kleineren baltischen Staaten, Lettland und Estland, waren die Zahlen nicht ganz so hoch, aber doch auch beträchtlich. Dasselbe ereignete sich in der Westukraine und im Westen Weißrusslands, Gebiete, die vor dem Zweiten Weltkrieg zu Polengehört hatten.
Hinsey: Wie hat die Sowjetunion auf die deutsche Invasion in Litauen reagiert?
Venclova: Die Sowjets waren nicht darauf vorbereitet zu kämpfen, sie flüchteten überstürzt und lieferten Litauen den Deutschen aus; in Lettland und Estland konnten sie ihnen wenigstens etwas Widerstand entgegensetzen. Die litauische Sowjetregierung zog sich, in Auflösung begriffen, zusammen mit den Truppen zurück. Am ersten Tag der deutschen Invasion erschienen auf den Straßen bewaffnete Gruppen von antisowjetischen Aktivisten – oder Aufständischen, wie sie im heutigen Litauen immer häufiger bezeichnet werden. Sie bereiteten den Vormarsch der Deutschen vor, hatten aber auch eine eigene Agenda, die sich von jener der Nazis unterschied. Diese Gruppen, allgemein bekannt als Baltaraiščiai, „Weiße Armbinden“, waren vor allem in Kaunas und kleineren Städten aktiv, deutlich weniger in Vilnius, wo die Bevölkerung ihrem Engagement recht gleichgültig gegenüberstand. Sie griffen die sich zurückziehenden sowjetischen Truppen an, besetzten den Kaunaser Radiosender und riefen dort die Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit aus- auf Litauisch, Deutsch und Französisch, wie man mir viele Jahre später erzählt hat. Die Macht lag mindestens einige Tage lang in ihren Händen, die litauischen Randgebiete haben sie monatelang kontrolliert.
Hinsey: Wie haben Ihre Eltern von der deutschen Invasion erfahren?
Venclova: Meine Eltern, die ja nicht ahnten, dass die Deutschen an jenem Tag einmarschieren würden, waren nach Trakai gefahren, einem beliebten Städtchen an einem See mit einer mittelalterlichen Burg, ungefähr dreißig Kilometer von Vilnius entfernt. In Trakai wurde mein Vater von einigen Studenten, die den Bildungsminister erkannt hatten, zu einer Bootsfahrt eingeladen. Meine Eltern nahmen gern an. Draußen auf dem Wasser sahen sie einige nicht sowjetische Flugzeuge am Himmel, schenkten ihnen aber keine weitere Beachtung. Zurück in der Stadt erfuhren sie, dass Deutschland die Sowjetunion überfallen hatte. Molotow hielt eine Rede im Radio und versprach einen schnellen Sieg, während Stalin Todesängste ausstand und erst wieder Anfang Juli in der Öffentlichkeit erschien. Im Radio hieß es, dass die Rote Armee die Deutschen bereits auf deren eigenem Gebiet bekämpfe, Königsberg und Berlin bombardiere und so weiter. In Wirklichkeit bombardierten die Deutschen in jener ersten Nacht Vilnius, und zwar heftig. Eine Bombe explodierte neben unserem Haus; durch einen Splitter barst ein Fenster in der Wohnung unter uns, wo der Stellvertreter meines Vaters, ein ehemaliger Sozialdemokrat, lebte. Das hereinstürzende Fenster schnitt seiner jungen Frau im wahrsten Sinne des Wortes die Beine ab. Meine Mutter, damals neunundzwanzig Jahre alt, eilte ihr zu Hilfe und tat ihr Bestes, um sie zu verbinden. Es war umsonst, sie starb zwei Stunden später.
Nach dieser Nacht beschloss mein Vater, unsere Familie aus dem Zentrum von Vilnius in einen Stadtteil namens Jeruzalė zu bringen. Es war eher ein Dorf, er hoffte, es würde nicht angegriffen werden. Jeruzalė, also Jerusalem, hieß der Stadtteil, weil es in der Nähe eine katholische Kirche und ein Kloster mit einer Via Dolorosa gab. Mein Vater quartierte uns im Haus des Bürgermeisters von Vilnius ein, ebenfalls ein Linker und Weggefährte, der einer ganzen Gruppe von Intellektuellen Unterschlupf gewährte. Dann kehrte mein Vater zurück in sein Büro im Zentrum von Vilnius – als Minister hatte er ein Auto und einen Fahrer – und versuchte, seiner üblichen Arbeit nachzugehen. Das Gebäude des Ministeriums war fast leer. Auf den Straßen waren nur einige Baltaraiščiai zu sehen. Unter großen Schwierigkeiten kontaktierte mein Vater Kaunas, wo sich die restlichen Regierungseinrichtungen befanden, und erhielt die Weisung, sich – zeitweise – nach Minsk zu begeben, zweihundert Kilometer weiter östlich. In Minsk überlebte er ein zehnstündiges Bombardement, das die Stadt dem Erdboden gleichmachte. Zu jener Zeit rückten die Nazis bereits auf Vilnius vor, ein paar Tage später war er durch die Front von seiner Familie getrennt. Kurz darauf erreichte er Moskau, wo die Regierung von Sowjetlitauen sich allmählich versammelte – eine Art Exilregierung.
Hinsey: Und was wurde aus Ihnen und Ihrer Mutter?
Venclova: Wir blieben in Jeruzalė und hatten keine Ahnung, wo mein Vater war. Wir wussten nicht, was vor sich ging. Aus dieser Zeit stammt eine meiner lebhaftesten Kindheitserinnerungen. Wir stehen auf einer Veranda und beobachten einen Luftkampf am Himmel über Vilnius. Die Deutschen hatten ein sowjetisches Flugzeug abgeschossen, der Pilot und sein Navigator waren abgesprungen. Der Anblick ihrer sich öffnenden Fallschirme ist mir unvergesslich – sie sahen so klein aus, fast wie Spielzeuge. Dann kam das deutsche Flugzeug zurück und feuerte eine Maschinengewehrsalve in ihre Richtung ab. Das waren die neuen Regeln für die neuen Zeiten.
Hinsey: Wie verlief der deutsche Vormarsch?
Venclova: Innerhalb von zwei oder drei Tagen nahmen die Deutschen Kaunas ein und wurden von den Baltaraiščiai sowie einem beträchtlichen Teil der Einwohner willkommen geheißen. Vilnius fiel ein oder zwei Tage später. Als die ersten Kämpfe abgeflaut waren, machte sich meine Mutter zu Fuß auf den Weg von Jeruzalė ins Zentrum von Vilnius, eine Entfernung von etwa zehn Kilometern, Busse oder Autos gab es keine. Sie ging auf den Markt und hin und wieder in unsere Wohnung, sie hatte ja immer noch die Schlüssel. Die Stadt war im Großen und Ganzen intakt und stand unter Kontrolle der Baltaraiščiai. Die deutsche Wehrmacht war kaum zu sehen, sie kämpfte weiter östlich, bei Minsk. Mutter kam immer wieder nach Jeruzalė zurück. Doch eines Tages wartete ich vergeblich: Sie war in unserer Wohnung von mehreren Baltaraiščiai verhaftet worden. Einen von ihnen hat sie erkannt: Es war einer der Studenten, die meine Eltern erst eine Woche zuvor in Trakai zu der Bootsfahrt eingeladen hatten.
Sie wurde in das Gefängnis von Lukiškės – polnisch Lukiszki – gebracht, wo sie eine Zelle mit einigen Prostituierten und mit Frauen teilen musste, die zufällig auf der Straße verhaftet worden waren. Die Wachen waren Einheimische, die ihren Dienst auch schon in der polnischen, der litauischen und der Sowjetzeit versehen hatten. Meine Mutter wurde von einem Litauer verhört. Er nahm ihre Personalien auf und fragte dann:
Sind sie Jüdin?
„Nein“, antwortete meine Mutter, was der Wahrheit entsprach: Sie war eine ethnische Litauerin und katholisch getauft.
„Aber der Vorname Ihres Vaters ist Merkelis, also Melchior.“
„Es ist ein katholischer Name – einer der drei Könige.“
„Nun, Ihr Ehemann ist ein Kommunist, und die Kommunisten heiraten ja bekanntlich jüdische Frauen.“
Darauf wusste meine Mutter nichts zu erwidern.
„Gehen Sie zurück in Ihre Zelle“, sagte der Untersuchungsführer, „wir werden uns später mit Ihnen befassen.“
Hinsey: Wie lange war Ihre Mutter im Gefängnis?
Venclova: Sie hat anderthalb Monate in Lukiškės verbracht, unter harten Bedingungen, aber überlebt. Ihre Hauptsorge galt mir, ihrem vierjährigen Sohn, von dem sie keine Nachricht hatte. Sie wusste auch nichts über den Verbleib ihres Mannes, obwohl ihre Vernehmer glaubten, er würde sich irgendwo in Litauen verstecken, und von ihr erwarteten, dass sie seinen Aufenthaltsort preisgäbe. Sie hörte, dass viele ihrer Mitgefangenen-vornehmlich, doch nicht ausschließlich Juden – erschossen worden waren. Ein oder zwei Mal wurde sie einer Gruppe jüdischer Frauen zugeteilt, die auf einem Lastwagen warteten, um an ein unbekanntes Ziel gebracht zu werden. Doch dann wurde sie aus der Gruppe herausgerufen und zu weiteren Verhören gebracht. Im August lösten die Deutschen die Baltaraiščiai aufund übernahmen die Verwaltung des Landes, einschließlich der Gefängnisse. Nachdem sie sich die Akte meiner Mutter angesehen hatten, entschieden sie, dass es sinnlos sei, sie weiterhin in Lukiškės festzuhalten. Weil sie arisch war, wurde sie freigelassen, stand aber weiterhin unter polizeilicher Beobachtung. Vor dem Gefängnistor wartete ihre Mutter in Begleitung des Bruders von Merkelis. Sie bemerkten, und erst dann fiel es auch ihr auf, dass eine Locke in ihrem Haar vollkommen ergraut war. Sie ließ sie so, wie sie war. Nach dem Krieg haben die Leute gesagt, dass sie ihr eine elegante Note verlieh; sie war bis ins hohe Alter eine sehr schöne Frau.
Hinsey: Was geschah mit Ihnen, während Ihre Mutter im Gefängnis war?
Venclova: Als meine Mutter verschwunden war, kümmerten sich die Leute im Haus in Jeruzalė um mich, vor allem unser Dienstmädchen. Einige Zeit später gestattete man uns, in unsere Vilniuser Wohnung zu gehen, um einige meiner Spielsachen zu holen; die Wohnung war einem deutschen Offizier zugeteilt worden, ich erinnere mich, dass mein Spielzeug verstreut herumlag. Dann wurde ich nach Kaunas gebracht, wo mein Großvater Merkelis lebte, aber ich kam in ein Haus im Stadtzentrum, direkt am Bahnhof, das einem sehr guten Freund meiner Großmutter gehörte. Aus zwei Gründen, glaube ich: Zum einen waren Petras Cvirka und Tante Marija aus Kaunas geflohen und bereits in Moskau, wie mein Vater. Ihr Sohn Andrius, damals erst anderthalb Jahre alt, blieb bei der Großmutter – vorläufig, natürlich. Diese „vorläufige“ Trennung sollte, wie bei uns, drei Jahre dauern. Da Großmutter mit einem Kleinkind vollauf beschäftigt war, konnte sie nicht auch noch mich aufnehmen. Zum anderen versuchte sie herauszufinden, was mit meiner Mutter geschehen war, um dann ihre Freilassung zu erreichen. Das Dienstmädchen war verschwunden; später hörte ich, dass sie erkrankt war und starb, bevor die Sowjets zurückkehrten. Die ältere Frau, die mich in ihre Obhut nahm, war sehr freundlich. Aber beide Eltern innerhalb weniger Tage zu verlieren, ist nicht die beste Erfahrung, die man sich für einen Vierjährigen vorstellen kann. Ich war ziemlich frühreif und konnte bereits lesen, aber ich verstand nur sehr wenig von dem, was um mich herum geschah. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich mich beim Spielen in einem Garten an den Eisenbahngleisen plötzlich vollkommen verlassen fühlte. Aber das hielt nicht lange an.
Hinsey: Wohin kamen Sie, nachdem Sie bei der Freundin Ihrer Mutter gewesen waren?
Venclova: Man brachte mich in die Wohnung von Karolis, dem älteren Bruder meines Großvaters. Über ihn muss ich ein wenig mehr sagen. Mein Großonkel Karolis war etwa 1905 nach Amerika ausgewandert, nach Pennsylvania – dort lebte bereits eine große litauische Diaspora, die meisten von ihnen waren Bergarbeiter. Er gab in einer Kleinstadt – war es Scranton oder Shenandoah? – eine litauische Zeitung heraus und schrieb unter dem Pseudonym Karolis Vairas. Da er sich rasch das Englische angeeignet hatte, verdiente er bald seinen Lebensunterhalt als Übersetzer. Im Laufe seines Lebens hat er Dutzende Bücher übertragen, von James Fenimore Cooper und Henry Wadsworth Longfellow bis hin zu H.G. Wells und John Steinbeck. Bevor er die USA verließ, übergab er seine Sammlung seltener litauischer Bücher der New York Public Library, wo sie sich noch heute befindet. In der Zwischenkriegszeit ins unabhängige Litauen zurückgekehrt, trat er in den diplomatischen Dienst und wurde zunächst nach London entsandt, später war er ein paar Jahre Konsul in Kapstadt. Vor einiger Zeit habe ich Südafrika besucht und dank eines alten Telefonbuchs das Haus am Hang des Tafelbergs gefunden, in dem er gelebt hat. Selbst auf die Gefahr hin, unbescheiden zu wirken, möchte ich erwähnen, dass er George Bernard Shaw und Winston Churchill begegnet ist und die Eltern von Nadine Gordimer, litauische Juden, während seiner Zeit in Kapstadt unter seinem Schutz gestanden haben. Da er gute Verbindungen hatte, war er maßgeblich an der Entlassung meiner Mutter aus dem Gefängnis beteiligt. Er war ein Linker, ein unabhängiger Kopf. Aufgrund seiner Kontakte nach Amerika und England befand er sich sowohl während des Krieges als auch danach in einer prekären Lage, aber er hat es geschafft zu überleben. Während der deutschen Besatzung leitete er die Stadtbibliothek, zu Sowjetzeiten war er Direktor eines Literaturmuseums, nicht unwahrscheinlich, dass die Verbindung zu meinem Vater ihm zu dieser Stelle verholfen hat.
Hinsey: Können Sie noch mehr von Ihrer Zeit bei Karolis erzählen?
Venclova: Karolis und seine Frau Nina, die mindestens dreißig Jahre jünger war als er, pflegten den Lebensstil der europäischen Mittelklasse, eigentlich sogar der oberen Mittelklasse, aber ein Kinderbett hatten sie nicht. Ich musste auf zwei zusammengeschobenen Sesseln schlafen, was mich ziemlich amüsiert hat. Dafür hatten sie zwei Hunde – den deutschen Schäferhund Billy und den Pekinesen Cheeby, mit denen ich mich auf der Stelle angefreundet habe. Onkel Karolis brachte mir das englische Lied „A, b, c…“ bei und zeigte mir Fotos von Elefanten und das Puzzle einer Landkarte von Afrika, das ich bald zusammenzusetzen lernte. Mein Leben verbesserte sich erheblich, als meine Mutter aus dem Gefängnis entlassen wurde. Zu Beginn hatte ich Angst, sie könnte jederzeit wieder verschwinden, und so verfolgte ich sie auf Schritt und Tritt, sogar ins Badezimmer. Ein paar Tage später zogen wir zu Großvater Merkelis auf der anderen Seite der Memel. Meine Mutter kümmerte sich auch um Andrius und entband Großmutter von ihren Pflichten. Wir wuchsen wie Brüder auf. Andrius nannte meine Mutter „Mama“, auch dann noch, als seine richtige Mutter, meine Tante Marija, aus Russland zurückgekehrt war. Er hat Marijas künstlerisches Talent geerbt und wurde in den sechziger und siebziger Jahren als Karikaturist bekannt, der auch außerhalb von Litauen veröffentlicht wurde.Unser Leben bekam einen Anschein von Normalität, obwohl meine Mutter noch immer unter polizeilicher Beobachtung stand.
Hinsey: Lassen Sie uns über die Tragödie der Juden von Kaunas und Vilnius sprechen.
Venclova: Die jüdische Gemeinschaft machte vor dem Krieg etwa acht Prozent der litauischen Bevölkerung aus. Unter ihnen waren wohlhabende Geschäftsleute und Intellektuelle, aber auch viele arme Menschen, üblicherweise Orthodoxe. Meine Eltern unterhielten freundschaftliche Beziehungen zu zahlreichen jüdischen Familien. Mein Vater hatte eine Zeit lang litauische Sprache und Literatur an einer jüdischen Schule unterrichtet; es gab sowohl religiöse als auch säkulare Schulen, mit den Unterrichtssprachen Jiddisch, Hebräisch oder Litauisch. Vilnius war zu fast fünfzig Prozent jüdisch (die andere Hälfte war polnisch), in Kaunas lag der Anteil der jüdischen Einwohner vermutlich bei zwanzig Prozent. Viele jüdische Familien lebten auch in Kleinstädten, die katholischen Litauer hingegen wohnten zumeist auf dem Land. Die litauisch-jüdischen Beziehungen waren gutnachbarlich, Pogrome praktisch unbekannt – darin unterschied sich Litauen von der Ukraine, Moldawien und Polen. Juden haben sich hier im Allgemeinen wohler gefühlt als an vielen anderen Orten. Bernard Berenson, Jacques Lipchitz und Emmanuel Levinas kamen aus Litauen und haben zum Ansehen des Landes beigetragen.
Doch während der Naziokkupation sind in Litauen mehr Juden ermordet worden als irgendwo sonst in Europa. Eine ganze Welt wurde ausgelöscht. Auch viele Polen aus Vilnius sind verschwunden, und in Klaipėda gibt es keine Deutschen mehr, aber die meisten von ihnen sind weder verfolgt noch ermordet worden. Viele Juden wurden in den ersten Tagen der deutschen Besatzung bei Massenhinrichtungen von den Baltaraiščiai und anderen litauischen Kollaborateuren erschossen, vor allem in den Kleinstädten, aber auch in den beiden Metropolen. Nachdem die Deutschen die Verwaltung unter ihre Kontrolle gebracht hatten, wurden die Juden, die noch am Leben waren, in Ghettos eingesperrt, zu schwerer Arbeit gezwungen und nach und nach von den Nazis und ihren litauischen Kollaborateuren vernichtet.
Das sind altbekannte Tatsachen, doch in der Sowjetzeit war sich ein Großteil meiner Generation ihrer nicht bewusst. Die stalinistischen Säuberungen und Deportationen wie auch der Holocaust waren verbotene oder teilweise verbotene Themen, die in der Presse und den Schulen mit keinem Wort Erwähnung fanden. Trotzdem war es nicht möglich, sie vollständig zu unterdrücken: Jeder, auch ich selbst, hatte von Verwandten und Freunden davon gehört, wenngleich wir das Ausmaß der Tragödie nicht kannten.
Hinsey: Können Sie sich in diesem Zusammenhang an konkrete Ereignisse erinnern?
Venclova: Einmal, es war wohl im zweiten Jahr der deutschen Besatzung, trafen meine Mutter und ich in Kaunas einen Mann mit einem gelben Stern auf der Kleidung. Er ging nicht auf dem Bürgersteig, sondern neben der Straße. Mutter grüßte ihn – vielleicht haben sie sich gekannt –, und als ich sie fragte, was der Stern zu bedeuten habe, erwiderte sie:
Er ist Jude. Den Juden ist befohlen worden, sie zu tragen.
Dem Wort „Jude“ begegnete ich auch in einer Kinderzeitschrift aus der Zeit der deutschen Besatzung. Der Autor des Artikels behauptete, dass die Juden und die sowjetische Geheimpolizei im Grunde ein und dasselbe seien – Kriminelle nämlich, die Litauer deportiert und abgeschlachtet hätten. Ich erinnere mich sogar noch an den Namen dieses Kinderbuchautors; nachdem ich emigriert war, stieß ich ab und zu in der Exilpresse auf seinen Namen, inzwischen ist er gestorben.
Meine Mutter hat mir erst nach dem Krieg von ihrer eigenen Gefängnishaft erzählt, und wie gefährlich es sein konnte, ein Jude zu sein.
Hinsey: Aus der Rückschau betrachtet – was hat Ihrer Meinung nach diesen virulenten Antisemitismus hervorgebracht?
Venclova: Antanas Smetona und seine Generation waren gegen antisemitische Ressentiments weitgehend immun. Doch in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre trat eine neue Generation von rechten Politikern in Erscheinung, die an jene Rumänen erinnert, die Ionesco in seinem Drama Die Nashörner beschreibt. Ihrer Ansicht nach war Smetona zu nachgiebig, und sie verfolgten mit großem Interesse, was in und um Berlin geschah. Sie waren nicht unbedingt deutschfreundlich, weil Litauen mit Deutschland in einem territorialen Streit über den Status des Memellands lag, doch Hitlers Diskriminierung der „Ausländer“ erschien ihnen nachahmenswert. Für „Ausländer“ hielten sie die Polen und, ironischerweise, die Deutschen in Klaipėda, vor allem aber die Juden, die keinen Staat hatten, der hinter ihnen stand, und daher schutzlos waren. Die litauischen „Nashörner“ suchten alte antisemitische Stereotype und jenes für Agrargesellschaften nicht untypische, primitive Misstrauen gegen Intellektuelle und gebildete Menschen zu instrumentalisieren. Es gab noch einen weiteren bedeutsamen Faktor. Wie in vielen Ländern damals setzte man auch in Litauen die Juden mit den Kommunisten gleich. Die im Untergrund befindliche litauische kommunistische Partei war winzig, und einige ihrer Mitglieder waren gewiss Juden, doch hatte Stalin die Schlüsselpositionen bevorzugt mit ethnischen Litauern besetzt.
Hinsey: Die Juni-Deportationen und die Ermordung der Juden – diese Ereignisse werden in Litauen noch immer mythologisiert?
Venclova: Die sowjetischen Deportationen im Juni 1941 sind ein kollektives Trauma, das bis zum heutigen Tag nicht verarbeitet ist. Viele Litauer hängen noch immer dem Irrglauben an, nur ethnische Litauer seien betroffen gewesen. Sie glauben auch, die Sowjets hätten die Litauer als ethnische Gruppe vernichten wollen, was glücklicherweise durch die deutsche Invasion verhindert worden sei. Viele Historiker und Journalisten kultivieren auch heute noch diesen Mythos durch Auslassungen und falsche Akzente. Tatsächlich hat Stalin, wie bereits erwähnt, in den baltischen Staaten einen Stratozid, keinen Genozid verübt. Darunter hatten alle ethnischen Gruppen, einschließlich der Juden (sowie Polen und Russen), in einem ähnlichen Ausmaß zu leiden. Aber den „Nashörnern“ ist es gelungen, die Deportationen als Ergebnis einer finsteren jüdischen Verschwörung gegen das litauische Volk darzustellen. Als Argument diente ihnen die Präsenz von Juden in der Geheimpolizei, die natürlich auch Litauer, Russen und Polen beschäftigt hat – und hätte es in Litauen Marsmenschen gegeben, hätte Stalin ohne zu zögern sicherlich auch einige von ihnen verpflichtet. Aber dies wurde aus Bequemlichkeit übersehen.
Hinsey: Die Aktionen der Baltaraiščiai sind bis heute ein schwieriges Kapitel der litauischen Geschichte…
Venclova: Die Ereignisse zu Beginn der deutschen Okkupation 1941, als die Baltaraiščiai die Macht übernahmen und die Wiederherstellung der litauischen Unabhängigkeit deklarierten, werden als Juni-Aufstand bezeichnet. Ich glaube, es war legitim, gegen die stalinistische Unterdrückung zu den Waffen zu greifen, und notwendig für Litauen, die Unabhängigkeit wiederherzustellen. Aber er hat von Anfang an eine furchtbar falsche Wendung genommen. Der Aufstand wurde in weiten Teilen von den jungen „Nashörnern“ vorbereitet und kontrolliert, die ihre Zentrale in Berlin hatten und mit den Nazi-Behörden kollaborierten. Gewiss, ihre Ziele stimmten nicht völlig mit denen von Hitler überein: Sie wollten ein neues Litauen gründen, das an der Seite der Nazis kämpfen würde, wie die Slowakei, Kroatien – oder besser: Finnland. Hitler jedoch hatte keinerlei Absichten, solch einen Staat zu schaffen, und behandelte Litauen wie jeden anderen Raum1 für eine deutsche Kolonisierung. Im August 1941, als die Deutschen die selbsternannte litauische Regierung und deren Baltaraiščiai-Einheiten auflösten, traten einige der Baltaraiščiai in die Einsatzgruppe A ein – ein mobiles Mordkommando der Nazis –, andere hingegen nicht, einige Regierungsangehörige wurden sogar von den Nazis verhaftet.
Hinsey: Es ist eine schmerzhafte Episode…
Venclova: Ich verurteile nicht jene, die für ihr Land gekämpft, aber nicht an Pogromen teilgenommen haben, auch solche Menschen hat es gegeben. Doch es ist schwer, nach so vielen Jahren zwischen ihnen und den Kollaborateuren zu unterscheiden – und die Unterschiede waren selbst zum Zeitpunkt des Aufstands nicht klar. Eine Regierung aber, die antisemitische Gesetze verkündet und bereit ist, einen Großteil ihrer Bevölkerung im Namen einer illusorischen Unabhängigkeit zu opfern, verdient nicht mehr Respekt als beispielsweise die Anhänger von Petain in Frankreich. Wenn eine Nation mit solchen Mitteln gerettet werden soll, dann würde sie in der Konsequenz das Recht verwirken, sich als Nation zu bezeichnen.
Als Litauer muss man in der Lage sein, über all diese Dinge mit vollkommener Offenheit zu sprechen. Es ist nicht leicht für mich. Ich liebe mein Volk und mein Land; ich weiß, dass seine Geschichte kompliziert und voller Widersprüche ist, wie jede Geschichte; und viele seiner Traditionen sind ehrenwert. Das Litauische Großfürstentum war für seine Epoche ein toleranter und vergleichsweise demokratischer Staat. Was Architektur, Poesie und Wissenschaft betrifft, so ist Vilnius anderen großartigen Städten Europas ebenbürtig. Litauens Kampf gegen die deutschen Ordensritter und die Wiedergeburt nach den Jahren des „Presseverbots“ sind außerordentliche und oft berührende Geschichten. Dasselbe gilt für die Unabhängigkeitsbewegung in den achtziger und neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Selbst unter der deutschen Besatzung haben viele Litauer – Priester, Intellektuelle, Ärzte und einfache Menschen – ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Juden zu helfen und sie zu verstecken. Außerdem liebe ich mein Land dafür, dass die litauische Sprache nicht nur archaisch ist, sondern auch reich und klangvoll, wie das Griechische von Homer und Aischylos. Für mich als Dichter ist es ein Geschenk. Aber die Geschichte der nazifreundlichen Regierung und ihrer bewaffneten Einheiten muss vollständig erzählt werden, ohne Ausflüchte und Rechtfertigungsversuche. Andernfalls wird dieses dunkle Kapitel unserer Vergangenheit niemals überwunden werden.
Hinsey: Sie haben schon vor 1989 darüber geschrieben.
Venclova: 1975 oder 1976, da galt ich in der Sowjetunion schon als Dissident, habe ich einen Essay darüber geschrieben, obwohl es noch immer schwer war, an Informationen über die Kriegsereignisse in Litauen zu kommen. Der Text wurde im Samisdat veröffentlicht und löste eine heftige Debatte aus. Nach meiner Emigration erfuhr ich, dass rechtsgerichtete Angehörige der Diaspora darüber nicht besonders glücklich waren – einige von ihnen hatten sich persönlich an den antisemitischen Aktionen und der Propaganda beteiligt, wie jener Kinderbuchautor, den ich erwähnt habe. Doch es gab andere, liberale, Emigranten, die meine Auffassung teilten. Als Litauen wieder unabhängig wurde, war ich zutiefst beunruhigt, dass die rechtsgerichtete Version dieser Ereignisse fast überall vorherrschte – in der Presse, in den Schulbüchern, in der öffentlichen Meinung. Die Baltaraiščiai wurden als Helden der Nation gefeiert, und es gab Versuche von offizieller Seite, die nazifreundliche Regierung als legitim und ruhmreich darzustellen. Darin bildet Litauen übrigens keine Ausnahme: Ähnliche Versuche wurden in Kroatien und der Slowakei unternommen, ganz zu schweigen von Lettland, Estland und der Ukraine. Das kommunistische Regime war so verhasst, dass jeder Antibolschewismus willkommen war, ungeachtet der Tatsache, dass Hitler wohl der eifrigste Antibolschewik aller Zeiten gewesen ist. Vielleicht ist dieser Trend ein wenig abgeflaut. Aber ich halte es weiterhin für geboten, sich, wann immer es möglich ist, dagegen zu verwahren.
Als sich der litauische Präsident Algirdas Brazauskas in einer Rede in der israelischen Knesset für das entschuldigt hat, was vor einem halben Jahrhundert geschehen war, wurden seine Worte von allzu vielen Menschen in Litauen als nationale Demütigung verstanden. Doch Reue ist keine Demütigung. Die Wahrheit ist keine Demütigung. Die Wahrheit auszusprechen ist der einzige Weg, Würde wiederherzustellen.
Aus: Tomas Venclova: Der magnetische Norden. Gespräche mit Ellen Hinsey. Erinnerungen. Suhrkamp Verlag, 2017
2007-11-26
I
Im Wiener Hotel Wandl macht mich Kurt Neumann mit dem litauischen Dichter Tomas Venclova bekannt, mit dem zusammen ich in der Alten Schmiede eine Lesung absolvieren soll. Da Venclova Deutsch nicht spricht und kaum versteht, unterhalten wir uns auf Englisch. Es stellt sich heraus, dass Venclova zur selben Zeit in Moskau gelebt hat wie ich, also in den mittleren 1960er Jahren; er als innerer Migrant aus der Sowjetrepublik Litauen, ich als Student der Universität Basel. Beide bewegten wir uns unter den Poeten von Lianosowo – Igor Cholin, Genrich Sapgir – und den Künstlern um Ilja Kabakow und Andrej Monastyrskij; wir waren im Literatendorf Peredelkino zugang, hatten Kontakt mit sowjetischen Philosophen, Kritikern, Theaterleuten. Dass es dennoch nie zu einem Zusammentreffen kam, dürfte einen einfachen Grund gehabt haben: Unsre gemeinsamen Freunde standen unter ständiger Beobachtung des Staatssicherheitsdiensts und wollten verhindern, dass Ausländer, die als potentielle ideologische Gegner oder gar als Spione ebenfalls beobachtet wurden, in ihren permanent überwachten Wohnungen sich trafen, weil solche Treffen leicht als Konspiration inkriminiert werden konnten.
Ferne Zeiten. Dazwischen liegt ein ganzes Leben, die Hälfte des seinen, die Hälfte des meinen und –
– nun sitzen wir am gemeinsamen Lesetisch, werden eingeführt als „europäische Dichter“, tragen vor aus unsern jüngsten Büchern – er aus dem Sammelwerk Gespräch im Winter, ich aus Tagesform. Venclova, der von seiner deutschen Übersetzerin begleitet ist, schickt jedem Gedicht einen historischen – zeitgeschichtlichen, autobiographischen – Kommentar voraus, ohne den, wie er betont, die Texte nicht zu verstehen seien. Gleichwohl plädiert er, explizit gegen Stéphane Mallarmé, für eine engagierte, strikt wirklichkeitsbezogne und erfahrungsgesättigte Poesie. Die Geschichte, fordert er, gehöre ins Gedicht; das Gedicht, so schliesse ich daraus, ist eine spezifische Form und Weise der Geschichtsschreibung, mithin ein Versuch auch, den unaufhaltsamen Verlauf – das Schwinden – der Welt- und Lebenszeit in einem Bündel von Zeilen und Strophen kurzfristig festzuhalten als Lesezeit. – Auf den Tod seines Dichterfreunds und Präzeptors Joseph Brodsky hat Venclova 1996 mit dem folgenden lyrischen Nachruf reagiert:
Des Winters Quinten und Septimen. Wer notiert, beweist
Das Brausen unsres Herrgotts, vor Sekunden noch zu ahnen?
Sein Fernsein übersteigt das Denken. Die Verbindung reisst,
Ein Brief: Empfänger unbekannt. Kein Zittern der Membranen.
Noch flackert im Kamin, Hellseherin, die kleine Flamme,
Noch klammern Brücken, arme Ewigkeiten, diese Meeresenge.
Die Seele nur – von Nichtsein übervoll – ist wie der Stein,
Die Muschel, von der Einsamkeit zur Form verdammt.
So stehst du vor Gericht, erwachend aus der Zeiten Strom.
Auf jenes Land, das grösser ist als unsre Länder, schwören
Dich Furcht und Blindheit ein, und etwas Weisheit, Ruhm,
Sowie dein Puls, der matte, längst den Aoniden hörig.
Durch Haufen Schutt spriesst Tod, wie jedesmal im März,
Gewalt fegt hirnlos durch die Zeitungsspalten
Und über Fernsehschirme. Das beschwerte Herz
Wird eins mit seiner Umwelt. Und das nennt sich Kunst.
Man steigt doch zweimal in die Lethe. Schwarz der Stuhl,
Nun ruhn die Finger, die einst Welt in lauter Zeichen spalteten
(Nacht Ozean die Sterne Schmetterling Lebwohl)
Auf dass ein Faden bleibt zumindest – sich dran festzuhalten.
Der Nachruf ist Fazit, Verlustanzeige und Huldigung zugleich. Der verstorbne Dichter wird noch einmal vergegenwärtigt in Versen, in Worten, in einer lyrischen Intonation, die von ihm, Brodsky selbst, sein könnten und durch die er, Venclova, den Freund noch einmal echohaft zum Sprechen zu bringen versucht.
Das titellose Gedicht ist für Tomas Venclova exemplarisch insofern, als es ihn (wie alles, was er geschrieben hat) in offenkundiger Abhängigkeit von Brodsky zeigt. Obwohl er um einige Jahre älter ist als Brodsky, bleibt – was auch in der Übersetzung deutlich zu erkennen ist – seine Fixierung auf dessen Vorbild durchweg offenkundig. Der Ältere präsentiert sich gegenüber dem anerkannten Meister in der Rolle des Jüngers und scheint sich in dieser Rolle zu gefallen.
Im vorliegenden lyrischen Abgesang wird Brodsky zu einer quasimythologischen Gestalt überhöht, die nun, nach dem Übergang via Lethe ins Totenreich, nur noch den Musen (Aoniden) „hörig“ ist. Zwar „ruhn die Finger“ des Dichters, der einst die „Welt in lauter Zeichen“ umgesetzt hat, doch sein Werk – die Parzen sind nicht weit! – überdauert als Leitfaden, an dem wir Hinterbliebne uns festhalten, uns orientieren können. Der Glaube an das Überdauern der Poesie in reissender Weltzeit, das Vertrauen auf deren wegweisende, aufklärende, aufbauende Autorität bezeugt eine zutiefst konservative künstlerische Haltung, die heute, da saisonale literarische Kurzwaren den Markt beherrschen, obsolet zu sein scheint. Sicherlich ist diese zukunftsfrohe Haltung mehr der Vergangenheit zugewandt als der Gegenwart, vielleicht gründet sie in der zusehends schwindenden Hoffnung darauf, dass die Vergangenheit irgendwann in der Zukunft erneut virulente Gegenwärtigkeit gewinnt.
Mehr als den schlichten Wörtern, die Duden, Littré oder Webster zu jedermanns Gebrauch bereithalten, gilt Venclovas Vorliebe den grossen Worten, das heisst: einer hochgerüsteten, auch das Pathos nicht scheuenden Rethorik, die der Wortbedeutung vor dem Wort als solchem stets den Vorrang gibt, wobei das Bedeutete in aller Regel nicht einfach benannt, sondern übertragen, mithin metaphorisch verbrämt wird. Einzig der kreuzweise eingesetzte Endreim (den die Übersetzung nur gerade in der ersten Strophe adäquat wiedergibt) macht deutlich, dass Venclova – auch hierin Brodsky verpflichtet – das Wort zumindest in der Reimposition nach primär klanglichen Kriterien einzusetzen weiss. Ansonsten aber lässt er die dichterische Rede als unentwegte Metaphernwucherung sich ausleben, die ein Bild nach dem andern hervorbringt und solcherart das Faktum von Brodskys Tod eher verdunkelt denn herausstellt. Die Übersetzung scheint der Verdunkelung zusätzlich Vorschub zu leisten, indem sie immer wieder unsinnige Verse produziert, die Venclovas klassizistischer Diktion zuwiderlaufen. Man nehme und lese:
Wer notiert, beweist
Das Brausen unsres Herrgotts, vor Sekunden noch zu ahnen?
Sein Fernsein übersteigt das Denken.
Abgesehen davon, dass das „Fernsein“ (Gottes?) als Abstraktum das Denken keineswegs, auch nicht metaphorisch «übersteigen», wohl aber überfordern kann, bleiben die voranstehenden Verszeilen ganz und gar unverständlich; klar ist nur, dass hier eine rhetorische Frage gestellt wird, unklar aber, wer (oder was) als Subjekt zu gelten hat und wie (und ob) die Tätigkeiten des Notierens, Beweisens und Ahnens aufeinander bezogen sind.
Da ich den litauischen Wortlaut nicht kenne, ihn auch nicht verstehen würde, muss ich auf eine textkritische Lektüre des Gedichts verzichten. Auffallend bleibt auch ohnedies dessen durchgehende metaphorische Überwölbung durch Bilder von oftmals fragwürdiger Konsistenz: Brücken, die als „arme Ewigkeiten“ eine Meerenge „klammern“. Ein Schutthaufen, durch den „wie jedesmal im März“ der Tod (doch eher das Leben?!) spriesst, denn wie sollte der Tod «spriessen» und weshalb stets im Frühling? Oder liegt an dieser Stelle ein Übersetzungsfehler vor? Weiter: Die Seele, die gleich einem Stein, einer Muschel „von Nichtsein übervoll“ ist; ein grosses Land (das Jenseits?), auf das der Dichter eingeschworen wird durch „Furcht und Blindheit“, durch „etwas Weisheit, Ruhm“ sowie durch seinen „matten Puls“; die Kunst als ein „beschwertes Herz“, das „eins mit seiner Umwelt“ wird?..
Zweifellos wäre Tomas Venclova in der Lage, diese mir unverständlichen Metaphernbildungen und Vergleiche zu klären, sie zurückzuübersetzen in leicht nachvollziehbare diskursive Aussagen. Ich selbst kann mir allerdings einen Vers wie diesen problemlos erklären:
So stehst du vor Gericht, erwachend aus der Zeiten Strom.
Mit „du“ wird hier Brodsky angesprochen, der eben erst aus dem Zeitstrom seines Lebens erwacht, also gestorben ist und nunmehr im christlichen Jenseits vor dem Obersten Richter oder gar vorm Jüngsten Gericht steht – ein Bild freilich, das in der Folge konterkariert wird durch die Unterwelt (Lethe) des heidnischen Altertums, so dass das gesamte Metaphernkonstrukt in sich zusammenbricht. Doch was bringt mir denn überhaupt, was bringt dem Leser die Erklärung und Erschliessung von Metaphern, die nichts andres übertragen (oder verbergen) als das, was mir, was dem Leser vorab schon bekannt ist und was sich mit gleichem, wenn nicht gar höherm Erkenntnisgewinn auch prosaisch sagen liesse? Bemerkenswert ist allemal, dass Venclova seine Lyrik der politisch und moralisch „engagierten“ Literatur zuordnet, bemerkenswert deshalb, weil sein Engagement durch erlesene Metaphorik durchweg verunklärt, stellenweise ins Absurde verkehrt wird – eine Folge dessen vielleicht, dass er in seiner Heimat lange Zeit gegen die Sowjetzensur anschreiben und den Gegenstand seines „Engagements“ kaschieren musste. Hebt man den metaphorischen Plafond seiner Gedichte ab und folgt man den Erläuterungen, die er dazu gibt, wird denn auch einsichtig, wie tief sie von erlebter Geschichte und realer Zeitgenossenschaft durchwirkt sind.
II
In der Diskussion mit Tomas Venclova plädierte ich dafür, „die Geschichte“ den Journalisten und Historikern zu überlassen, und ich fügte hinzu (unterstreiche es auch hier), Geschichte und Erfahrung könnten – in meinem Fall – das zu schreibende Gedicht wohl imprägnieren, nicht aber mit Stoff versorgen. Geschichte, als geschriebne, baut sich nicht aus Fakten und Ereignissen auf, vielmehr aus Wörtern, durch welche sie dargestellt, vergegenwärtigt werden, wobei Personen- und Ortsnamen als wichtigste Orientierungspunkte fungieren. Auf dieser zunächst rein sprachlichen Ebene kann Geschichte auch für mich, auch fürs Gedicht von Interesse sein. Selbst das Wort „Geschichte“, das gleichzeitig – von seiner gängigen Bedeutung abgesehn – ein reichhaltiges Kofferwort ist, könnte als Impulsgeber einer poetischen Schreibbewegung für mich zum Attraktor andrer, klangähnlicher Wörter werden (z.B. Gesicht, Schicht, Sicht, Gischt, Gicht, Ich u.a.m.), woraus dann allenfalls ein gleichermassen lautliches wie semantisches Beziehungsfeld entstünde, das bei der Entstehung – beim Machen – des Gedichts allmählich angereichert oder auch: heruntergeladen wird. Dabei ginge es mir keineswegs darum, an geschichtliche Ereignisse oder an Selbsterlebtes zu erinnern, daran anzuknüpfen oder mich daran abzuarbeiten. Wie inadäquat Geschichte aus Gedichten spricht, ist durch beliebig viele Verse dokumentiert, die vor Ort, in unmittelbarer Nähe zum Geschehn, verfasst wurden – Gedichte aus dem Krieg, der Diktatur, der Gefangenschaft, der Verbannung. Zur Kunst des Gedichts hat die engagierte Poesie, weder die offiziell noch die oppositionell praktizierte, kaum je etwas Innovatives und Nachhaltiges beigetragen.
(…)
Felix Philipp Ingold, aus Felix Philipp Ingold: Gegengabe, Urs Engeler Editor, 2009
Tomas Venclova: „Ich bin ein historischer Optimist“
− Der Dichter über sein Werk, das Leben im Exil und seine Heimat Litauen. −
Altenbeken. Der Litauer Tomas Venclova zählt zu den großen zeitgenössischen Dichtern. Lyriker Durs Grünbein, der viele seiner Verse aus dem Litauischen ins Deutsche übertragen hat, sagt über die Gedichte des 75-Jährigen: „Sie gehören zum Unzeitgemäßesten, was die zeitgenössische europäische Poesie zu bieten hat.“ Stefan Brams sprach beim Literaturfest Wege durch das Land im Alten Forsthaus von Altenbeken mit Venclova, der 1977 aus seiner Heimat in die USA emigrierte über das Leben im Exil, sein Werk und warum er nicht dauerhaft nach Litauen zurückgekehrt ist.
Stefan Brams: Herr Venclova, was hat Ihre Lyrik geprägt?
Tomas Venclova: Als Hitler 1941 die Sowjetunion und damit auch meine Heimat Litauen überfiel, habe ich meine Eltern zeitweise verloren gehabt. Mein Vater war vor den Truppen Hitlers nach Moskau geflohen. Meine Mutter blieb mit mir allein zurück. Doch sie wurde verhaftet und saß einige Monate im Gefängnis und ich, erst drei Jahre alt, war plötzlich vollkommen allein. Das war ein Trauma für mich. Und vieles von dem, was ich in meiner Lyrik bis heute schreibe, speist sich aus diesem frühkindlichen Trauma auch wenn am Ende alles glücklich ausging, meine Mutter wieder freigelassen wurde und mein Vater 1944 zu uns zurückkehren konnte.
Brams: Ihr Vater war Autor und Kulturminister der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik, deren Hymne er dichtete. Wie sehr hat sie das väterliche Vorbild geprägt?
Venclova: Ja, mein Vater war Schriftsteller, er kannte sehr viele Autoren, die oft bei uns zu Hause zu Gast waren. Diese Atmosphäre hat mich sehr früh geprägt, und schon als Kind wollte ich wie mein Vater auch Autor werden. Das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Nur, dass ich mich von der Art und Weise wie mein Vater geschrieben hat, doch sehr unterscheide. Er war der sozialistisch-realistischen Linie verpflichtet und Funktionär im Schriftstellerverband. Ich schreibe eine hermetische, widerständige Lyrik und musste emigrieren, weil ich das Regime kritisiert habe.
Brams: Welche Dichter haben Sie damals geprägt?
Venclova: Sehr wichtig war für mich Henrikas Radauskas. Er war der wohl beste litauische Lyriker des 20. Jahrhunderts. Radauskas hatte linke Ansichten und war ein Freund meines Vaters, ging bei uns zu Hause ein und aus, emigrierte aber nach der sowjetischen Besetzung Litauens nach Westberlin.
Brams: Und internationale Einflüsse?
Venclova: Vor allem die russischen Lyriker Anna Achmatowa, Ossip Mandelstam und Boris Pasternak haben eine besonders starke Wirkung auf mich ausgeübt. Marina Zwetajewa schätze ich zwar auch sehr, aber sie hat auf meine Dichtung keinen so großen Einfluss gehabt.
Brams: Sie haben Joseph Brodsky gar nicht erwähnt?
Venclova: Auf ihn komme ich jetzt. Er hat mich in der Tat sehr stark beeinflusst. Wir haben uns regelmäßig bei ihm in Leningrad und bei mir in Vilnius getroffen. Aber ich bin so frei zu erwähnen, dass auch ich Brodsky mit meiner Lyrik beeinflusst habe. Er selbst hat es einmal so ausgedrückt.
Brams: War das eine enge Freundschaft zwischen ihnen?
Venclova: Ja, mehr als 30 Jahre waren wir befreundet – auch später im Exil in New York haben wir uns häufig gesehen. In meinem Tagebuch, das ich seit 50 Jahren führe, ist sehr viel über unsere Freundschaft zu lesen.
Brams: Brodsky musste 1972 ins Exil flüchten, sie 1977. Wie stark hat Sie das Exil beeinflusst?
Venclova: Wie andere Exilanten auch hatte ich große Angst, dass ich meine Heimatsprache verliere. Aber Thomas Mann hat im Exil einen sehr treffenden Satz geprägt, als er betonte: „Die deutsche Literatur ist dort, wo ich bin“. Ich habe das schließlich auf mich bezogen und mir immer gesagt, wo ich bin, da ist die litauische Literatur. Das hat geholfen. Neben dem schmerzlichen Verlust der Heimat habe ich das Exil aber auch als Bereicherung erfahren. Ich konnte ganz neue Erfahrungen machen, neue Eindrücke sammeln, einen neue Sprache lernen. Vor allem die Begegnung mit der neuen Sprache hat mein Verhältnis zu meiner Heimatsprache vertieft. Im Exil habe ich begriffen, welch große Vergangenheit das Litauische hat, wie meine Vorfahren es geschrieben und gesprochen haben.
Brams: Haben Sie je damit gerechnet, ihr Heimatland wieder zu sehen und ihren Pass wiederzubekommen?
Venclova: Ich war immer davon ausgegangen, dass ich wohl nie mehr lebend nach Litauen zurückkehren werde. Von daher habe ich es als großes Glück empfunden, als Litauen 1991 unabhängig wurde, und ich meine Heimat nach all den Jahren wiedersehen konnte. Ich denke, dass ich mit meinen Werken auch ein wenig dazu beigetragen habe, dass Litauen wieder ein unabhängiger Staat geworden ist.
Brams: Wir erleben Sie das Land heute?
Venclova: Litauen hat große Fortschritte gemacht, es ist europäischer geworden. Aber es gibt auch die Kehrseite eines stärker werdenden Nationalismus’, zunehmende Selbstbezogenheit und Provinzialität. Das alles ist mir sehr fremd. Aber grundsätzlich bin ich was Litauens Zukunft angeht optimistisch. Doch ich unterscheide immer zweierlei Optimisten. Den Optimisten, der sagt, alles wird gut, und den historischen Optimisten. Der sagt zwar auch, alles wird gut, aber ich werde es nicht mehr erleben. Ich bin eher ein historischer Optimist.
Brams: Haben Sie nie daran gedacht, wieder ganz nach Litauen zurückzukehren?
Venclova: Ich fahre gerne nach Litauen, nehme am öffentlichen und kulturellen Leben teil, fühle mich aber als Europäer und teilweise als Amerikaner und bin mir sicher, ich werde mein Leben als Westler beenden. Letztendlich ist es in Zeiten des Internets und der schnellen Reiseverbindungen gar nicht mehr wichtig, wo man wohnt, man ist doch eh mit allem verbunden.
Brams: Kann Lyrik wie die Ihre etwas bewirken?
Venclova: Auch wenn meine Lyrik eine sehr komplexe, sehr hermetische ist, so glaube ich doch, dass sie eine Wirkung entfaltet. Meine Bücher sind in viele Sprachen übersetzt worden. Ich gelte als der größte lebende Lyriker meines Landes und erlebe, dass in Litauen gerade auch junge Menschen meine Verse lesen und viele in mir ein Vorbild sehen. Das ist doch was, oder?
Neue Westfälische, 19.7.2012
Der Jahrhundertzeuge als Causeur
− Begegnung mit dem litauischen Exildichter Tomas Venclova. −
Der 1937 geborene Dichter und Essayist Tomas Venclova ist der Doyen der litauischen Literatur. Im Exil beschwor er das von der Geschichte gepeinigte Europa. Im Gespräch mit dem gegenwärtig in Berlin lebenden Autor, der lange in Berkeley und Yale lehrte, gewinnt diese Erfahrung zusätzlich autobiografische Kontur.
„Über Europa – Winter. Das weithin asphaltierte Land / Zieht sich zusammen, kräuselt sich, platzt wie Kastanien auf.“ Die Zeilen von Tomas Venclovas Exil-Gedicht galten dem geteilten Berlin des Jahres 1979, und der damals seit zwei Jahren im Westen lebende litauische Lyriker sah wenig Grund für Euphorie auf dem zugigen Bahnsteig vom Halleschen Tor. „Wie in den Bahnhof kriecht, / Der Pappwagon, weit ferner als im Nichts sein letzter Halt.“ In anderen Städten schien diese Gestimmtheit ähnlich, weshalb man sich den 1937 in Klaipeda nahe der Kurischen Nehrung geborenen Poeten lange Zeit als elegischen Schmerzensmann vorgestellt hatte, als einen verschlossenen Hermetiker aus dem sowjetisch okkupierten Baltikum, der an amerikanischen Universitäten lehrte und unter Kennern ein „Geheimtipp“ war.
Persönliche Prägungen
Über drei Jahrzehnte nach dem melancholischen U-Bahn-Gedicht ist Tomas Venclova als Gast des Künstlerprogramms des DAAD nach Berlin zurückgekehrt. Die Gegend um die Stipendiatenwohnung nahe der S-Bahn-Station Halensee ist eine eher unwirtliche, doch könnte die Stimmung des inzwischen weisshaarigen und auf freundliche Akkuratesse achtenden Dichters nicht besser sein. Gerade arbeitet er an der englischen Ausgabe eines Gesprächsbandes, dazu ist eine deutsche Übersetzung seiner Erinnerungen an Anna Achmatowa geplant.
„Willst du’s erzählen?“ – „Nein du!“ Ein schneller Wortwechsel, vom Russischen ins Englische changierend und nahezu zeitgleich von der ehemaligen Reiseführerin ins Deutsche übertragen. „Ich war damals ein junges russisches Mädchen, und er war in Vilnius schon ein aufstrebender Dichter. Als wir uns das erste Mal in einem Café sahen, stellte er ausgerechnet eine Tasche mit verbotenen Samisdat-Gedichten neben meinen Stuhl – o Gott!“ Freilich fand diese Jugendliebe erst Jahrzehnte später ihre Fortsetzung: Im Zuge der Perestroika durfte Tanja in den Westen reisen und gelangte so schliesslich in die USA, wo dann in New York geheiratet wurde (mit Joseph Brodsky als Trauzeugen und dem litauisch-amerikanischen Avantgarde-Regisseur Jonas Mekas als Hochzeitsfilmer). Das Lachen von Tanja und Tomas Venclova widerlegt das gängige Bild vom nordöstlichen Melancholiker.
Es nimmt Venclovas bereits von Czeslaw Milosz hochgelobten Gedichten nichts von ihrem unbestreitbaren Rang, wenn man einen Verständniszugewinn konstatiert, sobald entscheidende persönliche Prägungen sichtbar werden. Denn folgen beim ersten Lesen die Zeilen eines Paris-Gedichts nicht jenem bis heute wirkungsmächtigen Stereotyp von östlicher Tiefe contra westliche Flachheit:
Zum Beispiel ist für dich die Place des Vosges
Um die Ecke kein Geheimnis…
Hier sind die Cafés, der Flaum in der Luft
Die du bereits kanntest, bevor du sie sahst.
Sie sind wohl ein vergebliches Geschenk.
Wenn schliesslich noch der telefonische Anrufbeantworter erwähnt wird – „Das sprechende Band / Will dir die neue Chiffre nicht verraten“ – scheint das beliebte Bild vom technizistisch kalten Okzident wieder einmal komplett. Und doch war und ist Venclovas Resonanzraum ein gänzlich anderer, nämlich Erinnerungstreue und konkreter Beistand für die Freunde anstatt antiwestliche Klagerhetorik. „Das Pariser Telefon hätte mir nämlich damals, es war ebenfalls im Jahr 79, sehr gute Dienste erweisen können“, erinnert sich der Lyriker,
doch meine Französischkenntnisse erwiesen sich als unzureichend – eigentlich eine Schande für den Sohn eines Dichters, der immerhin einst André Gide ins Litauische übertragen hatte. Also war ich unfähig, die angegebene neue Auslandsnummer, die Chiffre, zu verstehen, obwohl ich doch so dringend hinüber in die Sowjetunion hätte telefonieren müssen. Drei meiner Dissidentenfreunde waren gerade zu absurd hohen Haftstrafen verurteilt worden – Victoras Petkus in Vilnius sowie Alexander Ginzburg und Anatoli Schtscharansky in Moskau…
Das Poem, das mit den Versen endete: „Hoffnung gibt es nicht. / Es gibt etwas Wichtigeres als Hoffnung“, wird jetzt im Gespräch ergänzt. „Verpflichtung, die ist noch wichtiger“, sagt Tomas Venclova, ohne indessen der Sentenz einen bedeutungsvollen Altersblick folgen zu lassen oder die Stimme auch nur ein bisschen zu heben oder zu senken. Derlei „Verpflichtung“ kann sich freilich auch als Verknüpfung buchstabieren – Namen, Orte, Geschehnisse – und versehen mit jenem ästhetischen Reiz, wenn Erinnerung und Causerie eine ganze Epoche erhellen.
Von der Anpassung zur Opposition
„Mich hat die Mitte des Jahrhunderts voll erwischt“, heisst es in einem Venclova-Gedicht, und eben das erhält nun zusätzlich Kontur in diesem Berliner Wohnzimmergespräch, in welchem die Figur des Vaters nicht zufällig aufgetaucht war. „Der literarisch frankophile Antanas Venclova war im Litauen der fünfziger Jahre so etwa das, was in der DDR der Lyriker und Kulturminister Johannes R. Becher darstellte – ein hochkultivierter Kollaborateur aus vollster Überzeugung. Interessanterweise waren dazu beide in ihren jungen Jahren Expressionisten gewesen, und tatsächlich hatte mein Vater schon vor dem Krieg Becher übersetzt.“ Worauf eine Anekdote von der Wiederbegegnung der beiden folgt, geschehen anlässlich von Thomas Manns Schiller-Rede 1955 in Weimar, wo Venclova senior das später auch eingehaltene Versprechen abgegeben hatte, das einstige Mannsche Domizil in Nidden/Nida renovieren und in ein Museum umwandeln zu lassen.
Ein halbes Jahrhundert später erzählt sein Sohn davon ohne Tremolo, vor allem aber ohne jene falsche Leichtigkeit, die ein „Tut mir leid, ich schweife ab“ immer schon auf den Lippen hat. Den Erinnerungsmedaillons eignet nämlich nichts Zufälliges oder Eitles; stattdessen machen sie eine Jahrhundertbiografie plausibel.
„Als Jugendlicher war ich ein sowjetischer Bourgeois“, sagt Tomas Venclova, der dann jedoch bereits als 23-Jähriger erstmals vom KGB verhört wurde und späterhin die litauische Fraktion der Helsinki-Bürgerrechtsbewegung mitbegründete. Mochte bei diesem Bruch mit dem Regime womöglich auch die frühe Fremdheitserfahrung eine Rolle gespielt haben, als er sich das erste Mal in der Minderheit gesehen hatte – ironischerweise als Funktionärssohn innerhalb einer antikommunistischen Schülerschar, in deren Familien die Erinnerung an die Deportationen durch die Rote Armee lebendig war.
Ja und nein. Denn auch der Bruder meines Vaters war – wie beinahe die gesamte bürgerliche Elite Litauens nach 1945 – von den Sowjets deportiert worden und starb elendig bei einem Minenunfall in Kasachstan. All das war also auch in unserer Familie präsent – ebenfalls aber die Erinnerungen an die Kollaborationen vieler Litauer mit Hitlers Regime und bei der Shoah. Ich glaube, dass mich dies immun gemacht hat gegen ideologische Aufrechnerei und Unrechtsrelativierung. Und das gilt bis heute, denn jeder hysterische Nationalismus – ob er nun in Litauen, Polen oder Ungarn statthat – ist mir zutiefst suspekt. Dann schon lieber ,wurzelloser Kosmopolit‘…
Freilich hatte bereits damals der junge Mann etliche der vom Regime verbotenen Bücher in der väterlichen Bibliothek lesen können und reiste deshalb gut vorbereitet in die Weiten der Sowjetunion, wo er alsbald merkte, dass sich manch sprach- und nationalbewusste litauische Regimekritiker in einem irrten: Auch in Russland gab es zahlreiche Intellektuelle, die dem Kommunismus kritisch gegenüberstanden.
So lernte ich Anna Achmatowa und Boris Pasternak kennen und, als dieser starb, den jungen Joseph Brodsky. Danach waren es mutige Menschen wie Natalja Gorbanewskaja, die am 22. August 1968 zu der Handvoll russischer Dissidenten zählte, die gegen den sowjetischen Einmarsch in Prag demonstrierten – ein mutiges Grüppchen da auf dem derart einschüchternden, riesigen Roten Platz in Moskau. Natalja wurde deshalb in eine psychiatrische Klinik eingesperrt; heute lebt sie hochbetagt in Paris.
Sich überkreuzende Lektüren
In jenen Tagen hatte ihr Venclova das „Gedicht über die Freunde“ gewidmet, eine Flaschenpost über die Grenzen der Zeit und des Raumes hinweg, die bei der erneuten Lektüre nun ihre hermetische Strenge verliert und sich öffnet: „Wenn selbst die Fremden keine Fremden sind…“ Ein tatsächliches Gespräch, über die faktischen und mentalen Grenzen des Eisernen Vorhangs hinweg: So hatte etwa der 1911 in Vilnius geborene Czeslaw Milosz im amerikanischen Exil ein Gedicht des jungen Litauers ins Polnische übersetzt und es in der legendären, in Paris ansässigen Dissidentenzeitschrift Kultura publiziert. Um seinen gefährdeten Kollegen darüber zu informieren und gleichzeitig die Postzensur zu täuschen, schrieb Milosz in einem Brief, er habe soeben eines seiner Gedichte in einer „kulturellen Hauptstadt“ veröffentlicht. Chiffren, die sofort verständlich waren. Nachdem Venclova schliesslich 1977 die Sowjetunion legal verlassen hatte und kurz darauf vom Regime ausgebürgert wurde, engagierte sich Milosz erneut – sein Empfehlungsbrief half dem im Westen nahezu unbekannten Dichter aus Vilnius, im amerikanischen Universitätsleben Fuss zu fassen.
Und in den bitteren Jahren davor? Hatte Joseph Brodsky, kurz bevor er 1972 aus der UdSSR ausgewiesen wurde, Venclova gefragt, welchen polnischen Dichter es denn im Westen zu treffen lohne.
Da gab es natürlich vor allem einen Namen, obwohl dieser in der weiten Öffentlichkeit ebenfalls noch unbekannt war. „Selbstverständlich Milosz“, sagte ich damals zu Brodsky, nicht wissend, dass später binnen eines Jahrzehnts beide den Literaturnobelpreis erhalten würden. Am wichtigsten aber ist, dass die Gespräche – zumeist Lektüren, die sich überkreuzen – nie abrissen, das Hin und Her der lebendigen Erinnerungen. Und so war es wohl auch kein Zufall, dass Brodsky dann bei seiner Ausreise am Wiener Flughafen von W.H. Auden persönlich abgeholt wurde. Fünf Jahre Jahre später war es dann auch bei mir so weit, da überdies die litauische Helsinki-Gruppe beschlossen hatte, dass es gut sei, einen der Ihren im westlichen Ausland zu haben, um dort auf die Repression in der Sowjetunion aufmerksam zu machen.
Tapfer und glücklich
Auf die Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen neuer und alter Heimat antwortet der Dichter, der längst wieder regelmässig nach Vilnius reist, wo ihn alle verehren, mit einer ironischen Anekdote in eigener Sache:
Immer wenn ich mich müde fühlte, ging ich für eine Nacht in ein kleines Hotel in New Haven nahe meinem universitären Arbeitsplatz und belegte genau das Zimmer, in dem 1951 Hermann Broch gestorben war. Da fühlte ich mich geborgen, schlief ruhig ein – und am nächsten Tag ging es dann schon wieder besser.
Man muss sich den Dichter Tomas Venclova als einen tapferen, glücklichen Menschen vorstellen.
Marko Martin, Neue Zürcher Zeitung, 20.6.2013
BILANZ NACH EINUNDFÜNFZIG SOMMERN
Nach Tomas Venclova
Der Frachter, der einläuft und kurz
den Horizont zum Schaukeln bringt,
spült Müll hoch aus Heraklits Strom,
toten Plunder ans Ufer: eine Matratze,
auf der zwei schliefen und am Morgen
sich liebten, um weiterzuschlafen, oder
Knochen einer Möwe, so leicht, dass
der Wind sie wegtrug. Putain, sagt
der Wind, putain de merde! So
wird uns zwar alles genommen,
aber sehen wir alles wieder, da
nichts je wirklich verlorengeht, ja
überhaupt je verlorengehen könnte.
(Wer sagt das? Das ist nicht der Wind.)
Und fliehen wir in die Schattenkabinette,
in die Pulsflaute, zur allerletzten Adresse,
die sie nicht mehr ändern, nur löschen, es
bleibt ein Versuch, dieses Löschen, das
Totschweigen und Tilgen, denn alles
bleibt, auch das Ausradieren, aber
genauso bleibt stets das Bleiben.
Mirko Bonné
Tomas Venclova und sein Nachdichter Durs Grünbein.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Cornelius Hell: „Wie eine Verszeile strahlt“
Die Furche, 18.10.2007
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + IMDb + Archiv +
Internet Archive
Porträtgalerie
shi 詩 yan 言 kou 口
Tomas Venclova liest seine Gedichte zum 75. Geburtstag am 13.9.2012.
Fakten und Vermutungen zum Übersetzer + Instagram 1 & 2 +
Facebook + KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口


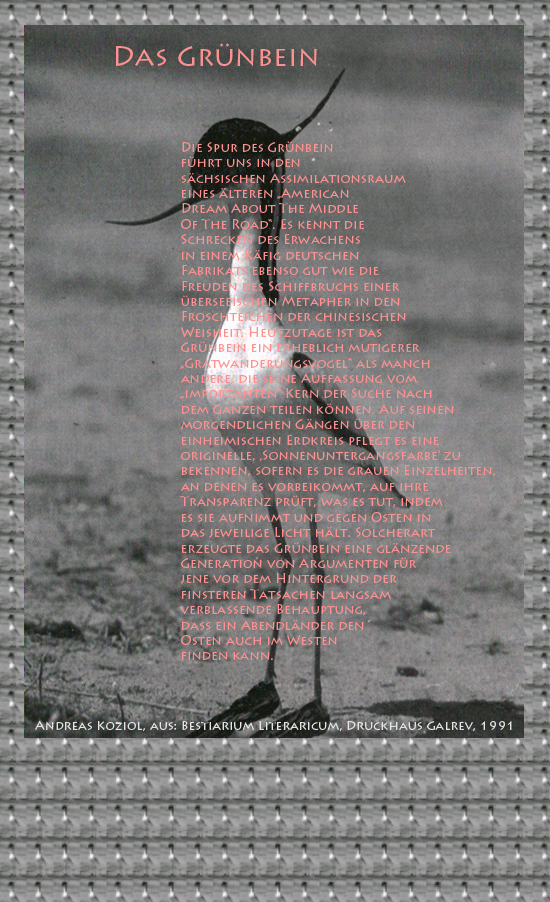












Schreibe einen Kommentar