Uli Becker, Michael Buselmeier, Kerstin Hensel und Helga M. Novak: United Colors of Buxtehude
am Anfang war das Wort
am Anfang auch die Tat
später erst das Paradies mit seinem Apfel
– der eigentlich ein Granatapfel gewesen ist –
mit tausend roten Kernen
als dauerndes Symbol für Fruchtbarkeit
dann kam der Wein – lauter Blut –
von den Oblaten ganz zu schweigen
Sonderangebote und ohne Rabatt
Helga M. Novak
Hej, jongliere mit Granaten!
Zunge satt im Weine baden
Schwarzes Brot anstatt Oblaten
Fliegen fliegen nicht die Maden
Durch das Watt zum Wattwurm waten
Heißen Leib im Eismeer baden
Schuld auf schlappe Schultern laden
Lieber n Schloß als Fischerkaten
Fehlt ein Reim, dann darfst du raten
Worte folgen nach den Taten.
Kerstin Hensel
Sind Worte nicht Taten,
ist Gehen nicht Dichten…
Leben die Bücher nicht?
Folgt nicht aus Gedanken
die Tat?
Unterwegs im Alten Land
zwischen Granatäpfeln,
sprang Lessing zu Jork
an seinem Hochzeitstag,
den Zustand des Landes bedenkend,
in die Wettern.
Michael Buselmeier
Alle reden von Wettern – wir nicht,
wir tun es, wir finden Laute und deutliche
Worte, wie Gewitterwolken dräuend
über unseren Köpfen die Sprechblasen:
Und platsch, die ersten dicken Vokale,
Konsonanten, hinten in den Kragen rieselnd,
Blitz und Donner, es hagelt Ausrufezeichen!
Uli Becker
Alles Chichi, oder was?
Im Anfang war das – denkste, war es eben nicht! Zumindest bei dieser Geschichte jedenfalls war es was anderes: Hier hat alles angefangen mit dem Buchhändler; ohne den guten Winfried Ziemann, das wollen wir mal festhalten, ohne seine Begeisterungsfähigkeit und notorischen Spendierhosen hätte es überhaupt kein Wortemachen gegeben. Schon ein komischer Vogel, mag sich manch Mitbewerber aus der Riege der sprichwörtlichen kleinen-und-mittelständischen Koofmichel beim Inneren Kassensturz denken, da muß einer doch einen ziemlichen Piepmatz unterm schütter gewordenen Pony haben, wenn er sich mitten in der Dauerkrise des Buches als kultureller Spiritus rector am Orte nicht nur versteht, wer täte das nicht, sondern auch dementsprechend zum Handelnden wird – und statt einer ordentlichen Signierstunde sich einem vagen Orchideenprojekt verschreibt, für das er vier Leute von sonstwoher einladen muß, sie tagelang durchfüttern und abfüllen und als entertainerischer Dynamo bei Laune halten (man kennt doch dieses Dichtervölkchen und seine Zicken). Jedoch, liebe Freunde des freischwebend zweckfrei gedruckten Wortes, werte literarische Öffentlichkeit, ohne dieses einen Mannes nimmermüden Einsatz und seine Bereitschaft, sich solch ein unkalkulierbares Experiment ans Spielbein zu binden, wäre das hier jetzt noch ein wüstes, leeres, weißes Blatt Papier, weil das erste gesamtdeutsche Renshi nie blinzelnd das Licht der Welt, jene scheue Frühlingssonne von Buxtehude erblickt hätte damals im Mai 1994.
Das erste gesamtdeutsche Wasbitteschön? Gute Frage, und dazu eine so berechtigte. Man kann sich in Buxtehude nach meiner Erfahrung von fast jedem auf der Straße einen informierten Vortrag halten lassen über Rennhasen und Rennigel, da macht den Eingeborenen so schnell niemand was vor, aber, äh – Renshi? Der eine oder die andere dann, von Weitläufigkeit angekränkelt (Stückchen die Elbe runter schließlich bloß, und ab geht’s ins Offene!), hat vielleicht von ferne läuten hören, daß das was Japanisches und irgendwo was mit Spiel oder Sport oder Spaß in der Gruppe sein soll, und mag es auch vorerst noch keine Sushi-Bar in Buxtehude geben, so wissen diese happy few doch vom typischen Japaner, daß der seine Bücher von hinten nach vorne blättert, gerade entgegengesetzt zur eigenen Gewohnheit beim zerstreuten Stöbern im Laden: Hat also Renshi am Ende auf eine verdrehte Art was zu tun mit – Ski rennen? Und das im Wonnemonat? Und in der norddeutschen Tiefebene? Was sich der Ziemann da bloß wieder ausgedacht hat, um seine kleine Stadt zu beglücken…
Aber hopple, nun mal halblang, mit hals- und beinbrecherischen Schußfahrten hat das gar nichts zu tun, auch nichts mit dem olympischen Geist, man muß es ja nicht gleich übertreiben. Das Mitmachen bei solch einem Rendings, bei dem es ums Dichten miteinander geht, ist für normalerweise schreibtischhockende Klausner aber auch so schon ein glatter Bruch mit der daheim gepflegten Schreibpraxis; unter sportlichem Aspekt ließe es sich am ehesten mit dem Rundlauf beim Pingpong vergleichen: Vier an einem Tisch, spielen, zack, und weiter den Schläger, komm schon, träum nicht, bißchen Tempo, damit der Ball trotz Gedränge in der Luft bleibt… So ein Renshi ist, mit anderen Worten, eine kollektive Kettendichtung, zu der sich ein Häuflein von Individuen für ein paar Tage am selben Ort zu einer Gruppe zusammenfindet – und loslegt. Diese Spielart von Textproduktion hat in Japan eine bis ins höfische 12. Jahrhundert zurückreichende Tradition (Renga), der vor fünfundzwanzig Jahren Makoto Ooka durch eine Modernisierung und weitgehende Dereglementierung zu neuem Leben verholfen hat in dem von ihm so getauften Renshi. Die Glieder der Gedichtkette werden reihum verfaßt, wobei die Möglichkeiten des Anschlusses von der direkten motivischen Weiterführung über die bewußte Gegensätzlichkeit oder das Fortspinnen mehr oder minder versteckter literarischer Anspielungen bis hin zur frei assoziierenden Orientierung am Atmosphärischen des vorhergehenden Kettengliedes reichen. Und hatten die Gedichte, die in der ursprünglichen Gruppe von lange miteinander befreundeten und vertrauten Renshiteilnehmern entstanden, schon die formale Öffnung zum Westen, so wurden in den achtziger Jahren unter Ookas Pinsel- wie Federführung (er ist in bei den Welten zu Hause!) auch Dichter aus dem europäischen und US-amerikanischen Kulturkreis in die Schreibrunden einbezogen, dies von ihm ausdrücklich angeboten als spielerisches Forum einer „Begegnung zwischen Ost und West“.
Das erste derartige Experiment mit deutscher Beteiligung fand 1985 in Berlin statt und ist im Ergebnis dokumentiert in dem prächtigen Band Poetische Perlen, verlegt 1986 bei Franz Greno. Im Anhang dieses Buches finden sich Aufsätze sowohl von Makoto Ooka als auch von Eduard Klopfenstein, einem der beiden den Textprozeß begleitenden Übersetzer, die grundlegend Auskunft geben über die historische Entwicklung und aktuelle Praxis der Kettendichtung. Im Zuge des dritten japanisch-deutschen Jointventure während der Frankfurter Buchmesse 1990, die das Schwerpunktthema Japan hatte, bin dann ich persönlich mit dem Renshi in Berührung gekommen: Und was für ein lustvolles, so vorher nicht gekanntes Schreiberlebnis das war, vom geistesgegenwärtigen Reagieren auf eine unerwartet aus der Tiefe des Raumes servierte Vorlage ebenso lebend wie von der notwendigen Bereitschaft, eine spontane Niederschrift gleich in der ersten Fassung aus der Hand zu geben, roh wie Fisch und ohne jede Chance zum Übergrübeln und Nachbessern. Die berühmten Ideen „auf der Treppe“ sind, wenn nicht für die Weltliteratur, so doch zumindest für das Renshi verloren, da die Runde bereits weitergearbeitet und der nächste am Tisch sich womöglich gerade auf diese Wendung bezogen hat oder jenes Bild, das man selbst gern nachträglich modifiziert sähe.
Diese besonderen, mir neuen Bedingungen unseres gemeinsamen Dichtens zu viert (plus zwei Übersetzer) hatte ich in Frankfurt genossen: Eine Phase gesteigerter Intensität, eine Differenzerfahrung zum sonst oft im eigenen Referenzrahmen befangenen Werkeln und Werkeln am heimischen Schreibtisch, kurz eine wunderbare Lockerungsübung, die ich nur feiern konnte und preisen über den grünen Klee, den vierblättrigen. So erzählte ich gelegentlich auch einem bekannten Buxtehuder Buchhändler vom Drum und Dran des Renshi, gab ihm den entstandenen Text zu lesen – und hatte ihm damit offenbar einen Floh ins Ohr gesetzt, der sich zum regelrechten kleinen Mann auswachsen und keine Ruhe mehr geben sollte, bis – tja, der Rest ist Geschichte.
Was wäre denn, kam da plötzlich der Gedanke auf, wenn wir die Meister aus Japan, die uns das Renshischreiben vorgemacht haben, bei einem neuen Versuch gar nicht extra bemühten, wenn wir die Sache vielmehr mal ganz in deutsche Hände nähmen (Warum in die Ferne etc. pp.)? Sind wir uns selbst nicht fremd genug? Und wir einander sowieso. War nicht bei Ooka-san von einer Begegnung zwischen Ost und West zu lesen? Und konnte dabei nicht der Wegfall der Übersetzungsnotwendigkeit, die sich ab und an doch als retardierendes Moment in den Renshiprozeß eingeschlichen hatte, vielleicht der Dynamik des Ganzen zugute kommen? Na, also dann: Gesagt, getan!
Beim Durchsehen dieses ersten gesamtdeutschen Renshi, nun da es über das Premierenpublikum der Buxtehuder Matinee hinaus veröffentlicht werden soll, stehe ich im Abstand von zwei Jahren natürlich nicht mehr mit heißen Ohren völlig im Bann unseres dreitägigen Ringens (in dessen Verlauf der tatsächlich aufkommende Schwung übrigens nicht immer nur dem Werk dienstbar gemacht werden konnte, sondern phasenweise auch in einer gewissen Engführung als „Gruppendynamik“ sein Recht im Leben verlangte), ich sehe deutlicher das textliche Ergebnis. Abweichend von der japanischen Vorgabe, deren Übereinkunft dahin geht, jedes Glied der Kette sich allein auf das unmittelbar vorausgegangene rückbeziehen zu lassen und narrative Ansätze, einen thematischen Zusammenhang im Sinne jener „Summe von Teilen“ zu vermeiden, finden sich hier doch länger durchgeschleppte Elemente (etwa die Ratte, die Formdebatte, die Worte und Taten).
Und braucht der Text nicht fast schon einen Anmerkungsapparat? Muß man nicht erwähnen, daß es sich bei Elfriede (auf S. 8 und S. 32) um ein Stück Folklore im Buxtehuder Heimatmuseum handelt, eine Kuh nämlich, die zwar vor langer Zeit vom Eis gekommen, doch daraufhin dummerweise im Moor versackt ist und die wir, da sie den Arbeitsraum eh mit uns teilte, kurzerhand als Maskottchen des 1. FC Renshi adoptiert haben (der cadavre exquis läßt grüßen!); erwähnen, daß es bei den Wettern auf S. 40 um den Terminus technicus für die Entwässerungsgräben in eben diesem kuhkillenden Moor geht; daß wir es bei Schwester Adelheid, die auf S. 12 im Wandschrank baumelt, mit einem am Mittagstisch ausgeplauderten autobiografischen Detail zu tun haben (dasselbe Mittagessen, in dessen Verlauf es auch zu der Haarfärbewette auf S. 16 kam, wenn ich mich recht entsinne)? Das damals Titelgeschichte machende Haschischurteil taucht ebenso auf wie der große Rummel mit Musik und Bratwurst vorm Kaufhaus in der Fußgängerzone – hatten die da gerade ihre Neueröffnung nach dem Umbau? Aber ach, was tut das zur Sache, solch ephemeres Detail, im Angesicht etwa jenes vom Hauch der Überzeitlichkeit umfächelten Bildes vom Schäfer, um nicht zu sagen guten Hirten, bei dessen Auftauchen (wenn auch im Jogginganzug, geschenkt!) prompt ein Ruck durchs Renshi geht: Hinan zum Alexandriner, dem artig der Hexameter antwortet, worauf sich ein stirnrunzelndes Haiku meldet und nicht nur Form ist, sondern auch noch darüber reden möchte, was einem Original-Renshi aus dem Reich der Sinne natürlich wesensfremd wäre. Wie überhaupt ja der Anteil an Reflexion, an Metamaterial auffällt gegenüber den japanischen Vorbildern und ihrem „no ideas but in things“ (mit einer kongenialen westlichen Formel). Aber gut, notwendige Selbstvergewisserung vielleicht auf unerkundetem Terrain; dies war ein erster und wirklich nur ein allererster Versuch fernab vom Mutterland. Wie siehr saus, sollen wir weitermachen mit dem Renshi? Alles Chichi, oder was?
Uli Becker, Nachwort
Wo Hase und Igel sich traditionell Gute Nacht sagen,
in Buxtehude, machen sich eines Tages Dichter auf und erkunden die Welt. Entstanden ist so ein Renshi ein Gedicht als Kette – die Quadratur des Kreises ist nichts dagegen.
Faber & Faber, Klappentext, 1996
Fakten und Vermutungen zu Uli Becker
Fakten und Vermutungen zu Michael Buselmeier + Instagram +
IMDb + KLG + Kalliope
Porträtgalerie
Fakten und Vermutungen zu Kerstin Hensel + Facebook +
Archiv + KLG + IMDb + PIA
Porträtgalerie: Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
Keystone-SDA
shi 詩 yan 言 kou 口


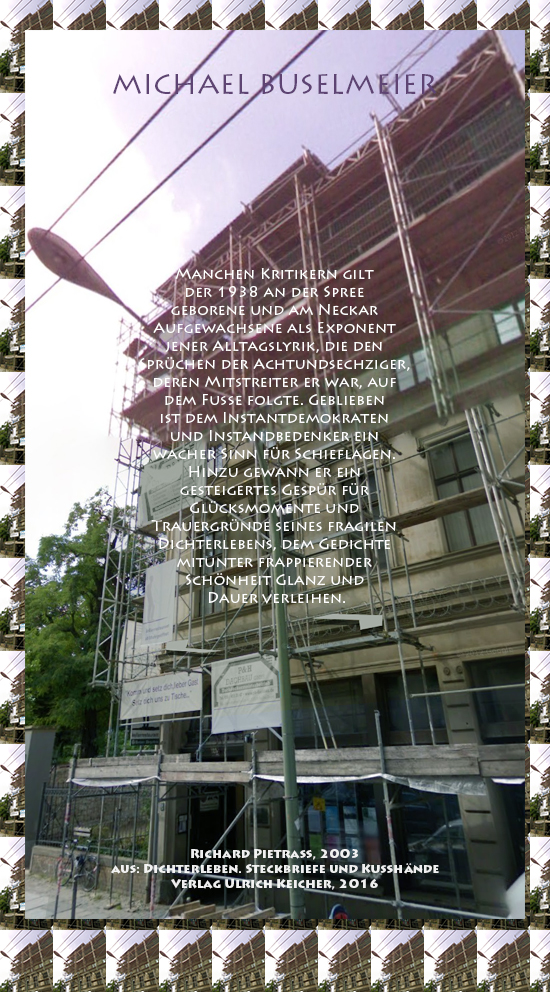
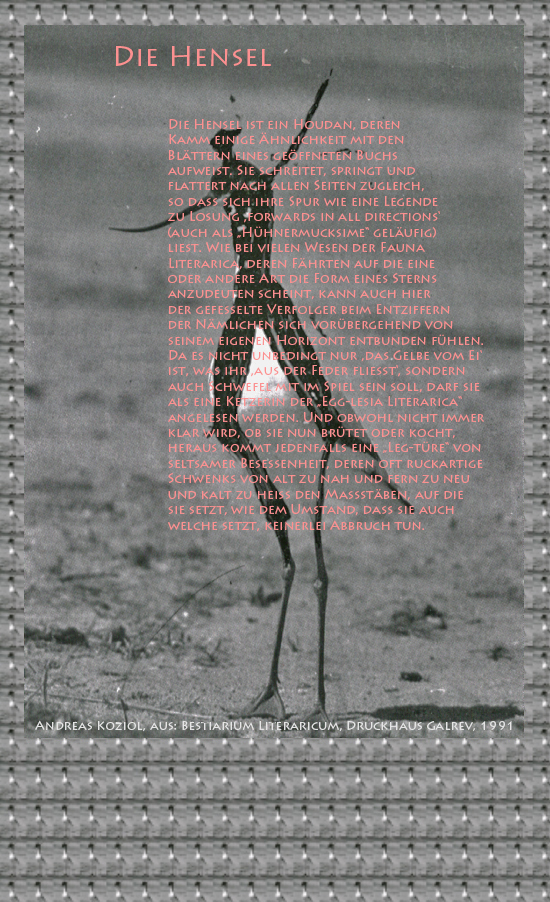
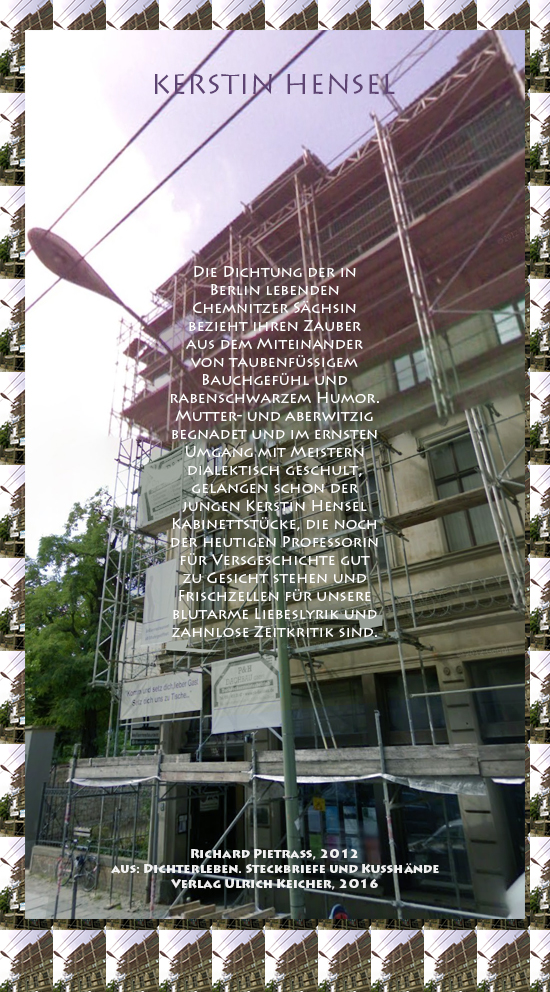












Schreibe einen Kommentar