Ursula Krechel: Mittelwärts
EIN STERN wird auf die Erde stürzen
und ich fang ihn auf. Ein Stein
wird in mein Fenster fliegen
und er trifft mich nicht.
Das ist der große Wind,
der Bäume reißt, der große Wind
leckt an den großen Seen
Wände beben, und die Fensterstürze
knirschen, ein Gartenstuhl weht weg
die Vögel sind schon weggeweht
ein Stern wird auf die Erde stürzen
das schwarze Loch glänzt hell
Der Riss im Gewebe
„Ich feiere mich selbst und singe mich selbst“, beginnt Walt Whitman seine berühmten Grashalme, „und was ich mir anmasse, sollst du dir anmassen, / denn jedes Atom, das mir gehört, gehört auch dir.“ Schauen und lauschen, als sähe und hörte man zum ersten Mal, dies schien für Whitman der Kern des Schreibens zu sein. Im Glauben an ein selbstgewisses Ich und einen alles durchflutenden Weltgeist suchte er zeitlebens nach einem Weg, die Einheit des „Jetzt und hier“ im Gedicht spürbar zu machen. Die motivische Kraft für den langen Vers zog er aus seiner Kindheit auf Long Island, aus Erinnerungen an die salzige Luft und den Blick über die Lagune mit ihren Muschelbänken. Am Ende sollte ein Rhythmus stehen, der dem des Meeres ähnelte.
Gleich im Eingangstext ihres neuen Gedichtbandes hat Ursula Krechel eine kleine Hommage an den amerikanischen Sänger des Lebens versteckt:
er sang, wie das Gras wächst, wie alles, das ihm widerfuhr
Fährboote und Brücken, alles ein kindliches Entzücken
Doch ebenso schnell macht sie klar, was sich seit Whitmans Zeiten geändert hat. Ungebrochen ist hier nichts mehr, nicht das Ich und nicht die Welt, nicht die Wahrnehmung und nicht die Sprache, in die sie übersetzt wird. Der erste Vers spricht vielmehr von einem „Riss“ in der Tasche der Reisenden, einem Riss, der sich schnell ausweitet und selbst das Ich erfasst, das „geteilt nun“ ist:
ein Riss im Gewebe
der die früheren Reisen abtrennt wie nie gewesen
Mittelwärts zieht es Ursula Krechel mit ihren Versen diesmal, quer über den amerikanischen Kontinent, jener klein- und vorstädtischen Atmosphäre zu, an deren Bildwelt sich die Lyrik von Marianne Moore bis zu Lars Gustafsson immer wieder angelehnt hat, „die kleinen Villen der suburb, die Ziegelhäuser, Rhododendren“. Anfang der neunziger Jahre war Krechel für einige Wochen Gastdozentin an der Universität von St. Louis. Aus den sprachlichen Funden und Wahrnehmungsresten dieser Zeit hat sie nun ein fast fünfzigseitiges Langgedicht gebaut. Allen Rissen zum Trotz folgt sie Walt Whitman zunächst einmal in der Fähigkeit des Staunens. Sehen und Gehen sind die beiden Leitstränge ihrer Lyrik, denn „im Staunen sind die Augen bei sich zuhaus“. Gleichwohl bleibt diese Gabe nicht unhinterfragt, zeigt sich das sprechende Ich „beschämt über ein nimmermüdes Sehen, dem Leben ergeben / immer die Kinderneugier“. Nach und nach baut Krechel kleine Brüche in ihre Verse ein, rhythmische Sprünge und Schlenzer, aber auch thematische Verschiebungen. So spielt sie nicht nur das Motiv des Reisens aus, sondern auch die Schlaflosigkeit oder das Fremdsein in einer anderen Welt.
Den eigentlichen Dreh jedoch verleiht sie ihrem Langgedicht, indem sie das sprechende Ich in Erinnerungswelten abtauchen lässt. Die Erkundung der amerikanischen Vorstadtwelt wird zur Suche nach der eigenen Geschichte. In den Zäunen der Gärten oder hinter den Fensterscheiben, selbst in einem „Mädchen in der Morgen – Veranda“ scheint die Vergangenheit auf, Spuren der Eltern und die Entdeckung des Körpers. „Dies schwere Traumgepäck“ droht die Beobachtung der Gegenwart bisweilen fast zu überlagern. Es ist eine „Welt aus schwarzen Erinnerungslücken“, die auch die Historie der USA oder die europäischen Kriege streift.
Nicht ohne Lust schliesst Krechel hier an ihren Zyklus „Stimmen aus dem harten Kern“ an, der im letzten Jahr erschienen ist. Eine vielzüngige Meditation über das Wesen des Krieges, sind die „Stimmen“ zugleich der geglückte Versuch, das Langpoem mit einer strengen Bauweise zu verbinden. Mittelwärts indes hält sich an jenen erzählenden Gestus, der die Tradition des langen Gedichts von jeher bestimmt. Anders als in den „Stimmen“ ist hier alles nur „lose verknüpft“, Beobachtungen und Erinnertes, Details und Reflexionen. Und anders als dort erscheint hier manches tatsächlich in einer „blendenden Überdeutlichkeit“.
So schiebt Krechel immer wieder kürzere Stücke in den Strom der Langverse ein, deren übertriebene Lautspiele nicht so recht zu den erzählenden Teilen passen wollen. Auch das Thema Trennung und Begrenztheit wirkt zuweilen überstrapaziert. Das ist ein wenig schade, zeigt Ursula Krechel doch an anderen Stellen, wie gekonnt sie die ausgestreuten Motive variiert. „Zeilen wie versandete Spuren“ – Walt Whitman hätte es gewiss gefallen.
Nico Bleutge, Neue Zürcher Zeitung, 28.6.2006
Sehen und Erschrecken
– Ursula Krechels Langgedicht Mittelwärts hat einigen Vorlauf. –
Debütiert hat Ursula Krechel Anfang der 70er Jahre – gerade einmal Mitte 20 und soeben dem Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte durch die Promotion entkommen – mit Theaterstücken. Doch bekannt geworden ist sie erst am Ende des „lyrischen Jahrzehnts“ mit dem Gedichtband Nach Mainz (1977). Mal im Stil Günter Herburgers und dessen Forderung nach dem langen Gedicht, das über mehrere Seiten mäandern kann, mal knapp pointiert und lakonisch, wird ein Schwanengesang auf die untergegangenen, zuweilen auch verratenen Ideale der Studentenbewegung angestimmt, wird auch eine Verlustbilanz festgehalten – etwa in dem die Forderungen der Frauenbewegung einklagenden „Jetzt ist es nicht mehr so“, dessen letzte Strophe, nachdem sechsmal darauf hingewiesen worden ist, was alles nicht mehr so ist wie früher, folgendermaßen lautet:
Jetzt haben wir plötzlich Zeit
zu langen Diskussionen in den Betten.
Verschwitzt, aber kalt bis in die Zehen
sehen wir zum ersten Mal das Weiße
in unseren Augen und erschrecken.
Fünf Jahre später und nach der Publikation eines weiteren Lyrikbandes, Verwundbar wie in den besten Zeiten, in dem eine „erbitterte Traumlosikgeit“, die – wie es Olaf Kutzmutz ausgedrückt hat – „von den gesellschaftlichen Verhältnissen bis in die privaten Beziehungen reicht“, liefert Ursula Krechel der Taschenbuchausgabe von Nach Mainz eine poetologische Überlegung nach, worin die „eng begrenzten Experimentierfelder“ der Gedichte verdeutlicht werden, vor allem jenes, das „im Persönlichen das Politische“ aufzeigen möchte.
„Ich habe“, fügt sie schließlich noch hinzu,
kein Passepartout, um meine Gedichte aufzuschlüsseln. Der Zugang ist nicht versperrt. Wer sie lesen will, findet wie der glückliche arbeitslose Dieb den Schlüssel unter der Matte. Für Klugheiten gibt es Schachteln und Mottenkugeln für eine gepflegte Zeitlosigkeit… Empfängerin der Poesie.
Auch im nachfolgenden Gedichtband Rohschnitt (1983) wird der lakonische Tonfall des Alltagsgedichts jetzt zusätzlich angereichert mit sprachspielerischen und sogar kalauernden Elementen fortgesetzt:
Der Engel… das Datum ist falsch ausgedruckt.
Übereinstimmend hat die Kritik festgestellt, dass Krechels Lyrik in eine „neue poetische Dunkelheit“ (Michael Braun) entweiche, die sich seit Ende der 80er Jahre und dem Band Kakaoblau (1989) bis in die aktuelle Gegenwart zeigt. Das verbindet sich nicht zuletzt – und gehört wohl auch zentral zum ästhetisch-poetologischen Selbstverständnis des modernen Lyrikers schlechthin – mit der ständigen Suche nach einer neuen Sprache, nach den einzelnen Wörtern, worunter Krechel „semantisch ungebundene Gesellen, lexikalische Streuner, schwankende Rohre im Wind“ versteht, wie es an einer Stelle in dem Essay „Auslassungen über das Weglassen“ (1995) heißt.
Die Texte des neuen Bandes Mittelwärts, in dem Krechel allerdings nur ein einziges Gedicht sehen will, sind veranlasst worden durch eine Reise in die USA, die die Autorin 1991 zu einer Gastprofessur an die Washington University in St. Louis geführt hat. Und auch hier wieder dominiert in der Tradition der Lyrik der Neuen Subjektivität – und sicherlich in der Tradition von Rolf Dieter Brinkmanns Westwärts 1&2 – der Ton des Gelegenheits- und Alltagsgedichts, fühlt sich die Lyrikerin Krechel gerade von jenen unspektakulären und unauffälligen Details in fremder Landschaft und Kultur angezogen, die – zum lyrischen Bild und Gebilde verdichtet – dem Leser neue Aspekte zeigen.
Das lyrische Ich spricht einmal von der „Kinderneugier“ und einem „nimmermüden Sehen, dem Leben ergeben“. Grundsätzliche Reflexionen über das Reisen („Reisen ist Ausufern und Eindämmen / Reisen rast, und Stunden / auf Flughäfen bleiben stehen. / Zurückgelassene Empfindungen / Wäschestücke, Postkarten / Reisen stürzen weg im Flug“) und ein anderes, verrücktes Zeitempfinden in der Ferne („Sie kommt und geht, ich komme und gehe nicht mehr / schreibe zur Nacht, ritze das Papier, Stunde um Stunde / schnurrt zusammen zu einer seitenlang gedehnten Zeit“) stehen neben pointillistischen Beschreibungen, hinter denen dann immer wieder etwas anderes aufblitzt:
Doch die Wirklichkeit liegt staubig und meilenweit
sechsspurige Wirklichkeit bei abgeblendetem Licht
unwirklich, wäre Dichtung verwirrende Entdeckung.
Werner Jung, Frankfurter Rundschau, 13.6.2006
Fakten und Vermutungen zum Herausgeber + Kalliope
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Andreas Platthaus: Keine Magermilch, und bloß keine Kreide
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.2017
Landesart: Ursula Krechel zum 70.
SWR, 2.12.2017
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram +
KLG + IMDb + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA + IMAGO +
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.


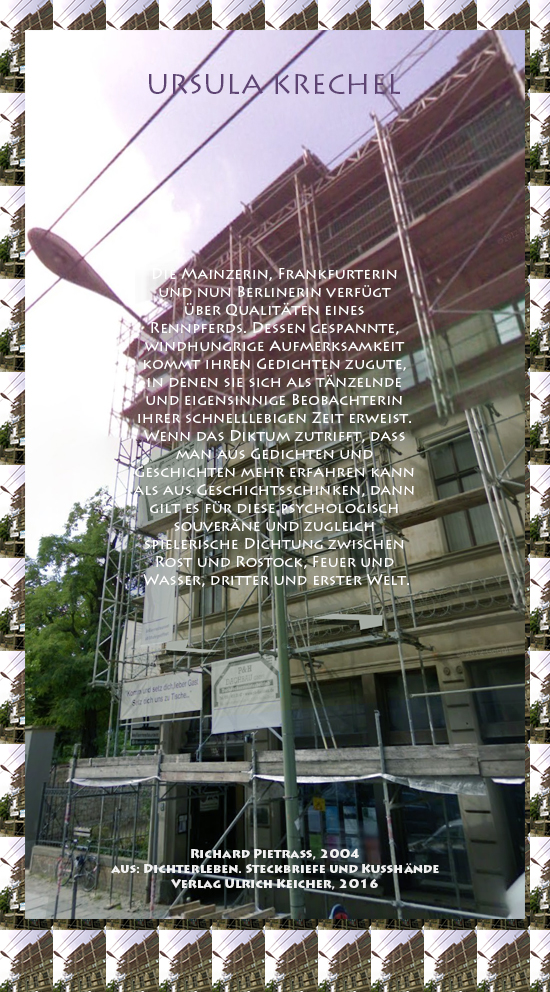












Schreibe einen Kommentar