Ursula Krechel: Verbeugung vor der Luft
QUADERSTEINE MÄREN SICH AUS
Sterne starrten, Mänaden rasten
Hummeln flogen querbeet.
Frauen nestelten in Taschen
Laschen aufgeknöpft, Polster aufgeschlitzt
Menschheit, Heiterkeit
lose Enden, faule Quasten
verstrickt.
Glück ist ein Glaubenssatz.
Wer’s glasklar will
zerbricht.
Scharmützel in Schürzen
– Ursula Krechel übt Verbeugungen. –
Man muss es mögen, das stabreimende Stimmengesumm der stummen Buchstabenverschiebungen, aus denen selten strenge Sätze entstehen. Je nachdem, ob man dieses poetische Verfahren für ein beliebig reproduzierbares Strickmuster hält oder ein heuristisches Mittel, das in der Sprache angelegt ist, wird man Ursula Krechels neuen Lyrikbank beurteilen, in dem die surrealistische Variante der Alliteration zum Strukturelement erhoben worden ist. Als zweites rhetorisches Verfahren wird die Paronomasie eingesetzt, die Nebeneinanderstellung von Wörtern unterschiedlicher Bedeutung, deren Lautstand minimal differiert, wie „gnadenlos knabenlos“. Nimmt man den Binnenreim hinzu, so hat man beinahe das Instrumentarium bereitgelegt, um Stellen wie diese zu beschreiben:
Scherereien gedeihen, schonungslos wie Scherze
kleinwüchsige Schergen schämen sich nicht
mandeln sich auf: man übersieht sie (logisch)
Milchbärte, Scharmützel im Schürzengelände
wo Schürhaken gezückt werden, resp. das Nudelholz
warum?
Der Rezensent, der Wortkunst Friederike Mayröckers nicht unzugänglich, hat sich bemüht, den Blickwinkel zu finden, der die Dimension hinter den Wörtern öffnete: die sanften Kippeffekte und Interferenzen zwischen den Worten, Metaphern und Wendungen. Im Text „Es ist erst drei Tage her“ wird dafür das Wort Ambivalenz mobilisiert:
Ambivalenz im schönen Monat Lenz
gedeiht der Mai noch, wenn es schneit
wo brennt’s? brennt es an diesem Ort?
so weit der Weg, so breit das Tal
am besten Blütenreigen steigen
es steigert sich die Ambivalenz.
Zugegeben, dass darin Heine, Romantik und Weihnachtslied witzig verdichtet sind, dass „Ambivalenz“ zwischen sprachlicher und erotischer Bedeutung changiert, doch erinnern die Reime nicht an Schüler, die im Chemieunterricht die Reize der Verbindung „Brenzkatechin“ über den Kalauer „Brennt’s Brenzkatechin?“ entdecken? Oder bestünde der Witz des Gedichtes darin, uns in die Laune von Halbwüchsigen zu versetzen? Bärbeißigen Lesern wird dies nicht als Werk einer von „Deutschlands großen Dichterinnen“ – so der Klappentext – scheinen, sondern eher als ein regressives Vergnügen.
Gerade wenn man mit der Autorin das Staunen über die Poesie vorgestanzter Wörter wie „barbusig“ und „bärenstark“ teilt, wollen die Texte, in denen Phrasen und Sprichwörter beim Wort genommen werden, nicht befriedigen. Es bleibt ein Spalt zwischen Thema und Durchführung, der die geglückten Wendungen als aufgesetzt erscheinen lässt. Das kann auch an den letzten vier Zeilen von „Wie Pessoa von Piraten genommen“ gezeigt werden. Der Name des portugiesischen Dichters bedeutet bekanntermaßen „Niemand“ und „Person“, was Krechel zum Vergleich verleitet: „Personen sind wie Straßenbahnschienen.“ Vorbehaltlich der unwahrscheinlichen Möglichkeit, dass Pessoa eine solche Banalität unterlaufen sei, wäre das schon schlimm genug. Krechel fährt fort „immer geradeaus bis zur Endstation“. Diese ausgewalzte, für das verwinkelte Lissabon auch falsche Sottise verdeckte beinahe den Lichtblick:
Glück ist ein Beistrich; gesetzt
beidseitig der schwankenden Apposition
Das ist ein geglückter Gedanke, der das Davor und Danach der Zuschreibung einer Eigenschaft oder passageren Identität gegen die nicht genannte Person hält. Doch das Fühlbarmachen von Situationen bis in die Nuancen der Interpunktion, das bleibt der Kunst Pessoas vorbehalten. Bei Krechel ist meist nur die Rede davon, und nur manchmal gelingt es wie hier. Der Rezensent verbeugt sich mit allem Respekt, kann aber nicht umhin, an den Satz zu denken, den Thomas Manns Haushälterin angesichts des Meeres gesagt haben soll:
Es ist hübsch, aber ich hätt mirs hübscher vorgestellt.
Thomas Poiss, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.3.2000
Sprechbewegungen
– Ursula Krechel führt in den „Wald der Wörter“. –
Die Rezeptionsgeschichte der Gedichte Ursula Krechels ist voller Kuriosa. Kritikerohrfeigen wie „weltabgewandtes Wortgezwitscher“ und „kryptische Elaborate“ waren nicht selten. Wem die Themen und Gegenstände oder die feministischen Gesten nicht behagen, der macht die Form nieder – eine nur allzu bekannte Verfahrensweise. Allen Ernstes entdeckte man vor vierzehn Jahren Anklänge an naturmagische Dichtung, gar an die Schule Wilhelm Lehmanns. Wie in Vom Feuer lernen (1985) gibt es allerdings auch jetzt in den Versen Ursula Krechels altmodisch anmutende Personifizierungen von Natur, besonders im ersten Kapitel. Da agieren „der Lindenbaum, der helle Dreisilber“ und die „Kopfhängerin Sonnenblum“. Wolken „gehen aufrecht“ im Luftraum, und bis ins „Nachtarbeit“-Kapitel hinein rauscht Regen, äsen Tiere, rollt der Sonnenball. „Bei Eichendorff“ ist das lyrische Ich im vierten Kapitel angekommen, doch erspürt das so überschriebene Gedicht lediglich das literarische Klima, die Atmosphäre Eichendorffscher Gedichte, die im Wahrnehmen von Flüchtigkeit, Fremdheit und Kälte ein modern anmutendes Lebensgefühl erfassen. Kein größerer Widerspruch als die kalt lachende Sonne am Ende.
Keine Lehmannschen Idyllen also, schon gar nicht, wenn Büchner, Pessoa, Anne Sexton oder Paul Celan zitiert werden – eine eigenwillige Ahnenreihe. Alle „Verbeugungen vor der Luft“ geschehen nicht im harmonischen Einklang von Mensch und Natur, sondern mit der Geste des Narren, der auf Händen spazierengeht und „geordnete Spaziergänger-Ödnisse“ durcheinanderwirbelt. Natur ist in Krechel-Gedichten eine vom Menschen bearbeitete, künstliche Natur, belebt von geschorenen Pudeln und von Ratten, den „genetischen Glückspilzen des Jahrtausends“. Das Naherholungsgebiet gleich hinter dem Flughafen, am Geländer der Welt lehnende Galgenvögel und andere Sarkasmen brechen die Scheinharmonien ins Absurde auf. Schließlich befindet sich der Leser nicht im Wald, sondern im „Wald der Wörter“.
Nach wie vor thematisiert Ursula Krechel Sprache. Wortspiele irritieren und verrücken den Blick auf die Welt seit Rohschnitt (1983), doch mehr denn je tritt das Zusammenspiel von Sprachklängen in den Vordergrund. Das Krechelsche Gedicht als Resonanzkasten für Schwingungen und Tonreihen hat von Christian Morgenstern gelernt, von Ernst Jandl, Gerhard Rühm und Oskar Pastior. Die Dichterin mischt ihre spezifisch weibliche Stimme in den Chor. Anders als noch in Vom Feuer lernen (1985) und in Kakao blau (1989), anders auch als die Texte Friederike Mayröckers lassen die assoziativen Montagen zunehmend Strukturen erkennen, mit Kalkül arrangierte Sprechbewegungen, bei denen man nie weiß, wo sie hinführen. Dennoch folgen sie bestimmten Mustern, selbst in den ausgesprochen verspielten Klangassoziationen des zweiten Kapitels „Legierung und Legende“. Allem öffentlich verbreiteten Unsinn über ihr Schreiben als selbstgenügsame Verrätselung zum Trotz verfolgt die Autorin eine fast kriminalistisch anmutende Schreibstrategie. Das Gedicht „Ein ermordeter Roman“ entfacht einen anarchischen Wirbel anhand eines tragikomischen archetypischen Figurengeflechts um einen Seilhändler, einen Gehängten, dessen Frau und allerlei Nebenfiguren. Nichts wird aufgelöst; mit dem Spannungspotential des Dramas um Leben, Liebe und Tod kann der Leser seinen eigenen epischen Faden spinnen. Die Gedichte „Fahndung nach einem Flegel“ und „Verdeckte Ermittlung“ sind verdichtete Kriminalkomödien, enthalten aber zugleich eine Poetik. Unhaltbare Behauptungen werden mit hinterhältigen Fragen ad absurdum geführt, vertrackte Verwechslungen und jähe Umgruppierungen sorgen für witzige Auflockerungen – und am Ende wird ein Sachverhalt überraschend per Pointe dingfest gemacht. Die subtile Fahndung baut ganz auf Denkprozesse, die durch Akustisches in Gang gesetzt werden. Das Spiel mit Alliterationen, Assonanzen und Reimen treibt die Ermittlungen voran. Zufälle ändern die Blickrichtung. Das sind Fahndungen wie Puzzles, zusammengesetzt aus alltäglichen Beobachtungen menschlicher Verhaltensweisen, sozialen Ritualen, historischen Reminiszenzen und umgangssprachlicher Rede. Irrtümer und deren Korrektur gehören zum Ablaufplan des Gedichts.
Gewißheiten in Frage stellen und vermeintliche Wahrheiten verrücken ist seit je das Metier der Kriminalbeamten wie der Dichter. Was dem einen die Indizien, sind dem anderen die Assoziationen, die an den Rändern der Worte – im Verbund mit anderen – aufscheinen. Einfälle um das stets abwertende und im Ton der Entrüstung gesprochene Wort Flegel etwa blättern eine Skala von Urteilen und Vorurteilen auf, die die Autorin zu einem Wasserfall von Wortflachsereien und zu grotesken Über- und Untertreibungen veranlassen. Schwarzer Humor steckt in den Verzettelungen und Sackgassen der Ermittlungen. Genau so bemerkenswert wie das Arrangement von Sprachfundstücken ist die ironische, auch selbstironische Geste, mit der sie präsentiert werden. „Das Material entzündet sich von selbst“, heißt es programmatisch im Gedicht „Regengewäsch auf Rasengeviert“ – doch muß dieses „Material“ zuvor so gemischt worden sein, daß eine explosive Melange dabei herauskommen konnte.
„Legierungen“ sind diese Verse alle. Wo bei anderen Lyrikern ein Thema im Gedicht dominiert, etwa Landschaft, Natur, Reise, Menschenleben, Alter, Tod, Liebe oder Geschichte, verschränkt Ursula Krechel alle ineinander. Erst wo Disparates aufeinanderstößt, wird es poetisch interessant. Was aber wären die Gedichte Ursula Krechels ohne einen großen Anteil von Worten aus dem gesellschaftlichen Bereich? Herrschte in ihrem ersten Lyrikband Nach Mainz (1977) noch ganz plakative Gesellschaftskritik vor, ging es in den folgenden Bänden eher resignativ oder sarkastisch zu. Bis heute aber gehören Gedichte über die jeweilige deutsche Gegenwart zu ihren bedeutendsten. In Landläufiges Wunder (1995) war es „Rost in Rostock“ mit seiner – anhand gesprochener Sprache diagnostizierten – ostdeutschen Befindlichkeit. In „Auch Dresden liegt unter Wolken“ ist sie wiederum Wandlungen im Osten Deutschlands an hand eines Wortschatzes auf der Spur, der sich aus den Bereichen Zugfahrt, Historie, Kunstgalerie, Natur und Marktwirtschaft zusammensetzt. Entworfen wird ein Milieu, in dem sich nur ein anpassungsfähiger, kaltschnäuziger und geschäftstüchtiger Menschentypus behauptet. Während die frühen Gedichte noch an die Moral einer besseren Welt appellierten, entwerfen die neuen detailversessene Psychogramme von Figuren, vor allem im dritten Kapitel: „Rotlichtphasen der Aufmerksamkeit“. Die „wandernde Elisabeth“ ist der Prototyp der gesellschaftlichen Außenseiter in, die sich den üblichen weiblichen Rollen verweigert und in ein rauhes Abenteuerdasein flieht. Das Motiv des menschlichen Unbehaustseins erfährt hier eine konsequent feministische Variation. Das Gedicht setzt die seit nunmehr zwanzig Jahren in Drama, Prosa und Lyrik betriebenen weiblichen Aufbrüche der Ursula Krechel fort. Statt der frühen – immer schon in den Euphorien mitgelieferten – resignativen Elemente blitzen nun Ironien auf. Die größte und tragischste ist der im Gedicht selbst auftauchende Verdacht, daß die Flucht in ein rauhes, echtes Leben lediglich eine Reise im Kopf bleibt. Ungeschütztes Reisen, Wahrnehmen und Schreiben sind bei Ursula Krechel eins.
Dorothea von Törne, neue deutsche literatur, Heft 528, November/Dezember 1999
Ein Gedicht und sein Autor: Ursula Krechel und Jan Wagner am 17.7.2013 im Literarischem Colloquium Berlin moderiert von Sabine Küchler.
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Andreas Platthaus: Keine Magermilch, und bloß keine Kreide
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.12.2017
Landesart: Ursula Krechel zum 70.
SWR, 2.12.2017
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram +
KLG + IMDb + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA + IMAGO +
Bogenberger Autorenfotos
shi 詩 yan 言 kou 口
Ursula Krechel – Neue Dichter Lieben, Komposition und Klavier: Moritz Eggert, Bariton: Yaron Windmüller, Expo 2000 Hannover.


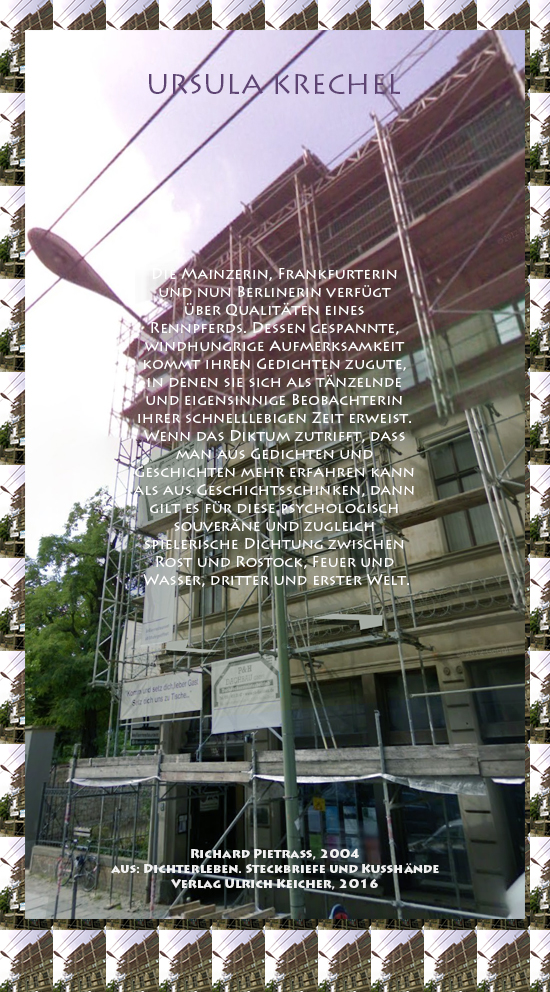












Schreibe einen Kommentar