Wolfgang Hilbig: Abriss der Kritik
… ICH WILL, KURZ VOR DEM ENDE DER VORLESUNG,
noch auf einen Einfluß zu sprechen kommen, der von einer Kritik ausgeht, die man kurz und bündig eine Form der Kritik an der Kritik nennen könnte. Ich erlaube mir Vereinfachungen; es geht mir heute nur darum, etwas anzureißen: dieser Diskurs – jetzt gebrauche ich das Wort wieder, um im Kontext zu bleiben – unternimmt oft genug nichts weiter, als ein bestimmtes Begriffsverständnis von den Füßen auf den Kopf zu stellen… nicht besonders marxistisch, könnte man sagen, aber das will man dort freilich auch nicht mehr sein. Beispielsweise behauptet man, in bestimmten Krankheitsformen ein eigentliches Bild von Gesundheit zu erkennen, gleichgültig, ob ein davon Betroffener daran leidet oder nicht, oder man nennt das Widerstand, was gerade im Begriff ist, sich aufzugeben.
Es wird sich wahrscheinlich nie vollständig aufklären lassen, wie ein Teil der Literatur der DDR – derjenigen, die ich hier die späte DDR-Literatur nennen will: mit Vorbehalt, denn viele Autoren würden sich wohl von einer solchen Einordnung distanzieren – zu einem gefundenen Fressen geworden ist für eine Denkmode, die hauptsächlich aus Frankreich kam. Die neue „Franzosenkrankheit“, wie Jean Amery sie bezeichnete, hatte im letzten Jahrzehnt der DDR, ausgerechnet in diesem hermetisch abgeschlossenen Land, plötzlich vernehmliches Raunen ausgelöst, während dieser Neostrukturalismus in Frankreich längst wieder am Abklingen war; Verspätung in Modedingen aber machte den Leuten in der DDR nicht so viel aus. Es waren Autoren wie Foucault, Lacan, Derrida, Lyotard oder Baudrillard, die auf einmal diskutiert wurden oder vielmehr zur Religion erklärt wurden, ihre Bücher sickerten ein, ohne daß man Anstoß daran nahm; selbst Glucksmann und Henri-Bernard Lévy wurden mir vom Zoll mit achtungsvoller Miene in den Koffer zurückgelegt, obwohl sie doch eigentlich Buhmänner für die DDR hätten sein müssen. Sartre hingegen war noch immer eine Unperson an sich, seine literarischen Werke waren zwar in säuberlichen Auswahlbänden ediert, in exklusiv niedrigen Auflagen, seine philosophischen und politischen Bücher aber wurden weiterhin von den Furien der Literaturpolizei gehetzt und lagen versperrt in den Giftschränken. Der kritische Sozialist Sartre, der Aufklärung verpflichtet, im Namen der Zukunft um Einfluß ringend, war in der DDR die „schreibende Hyäne“ geblieben, als die ihn der Stalinist Fadejew tituliert hatte. Es kann sein, daß ich eine neue Legende in die Welt setze, wenn ich vermute, daß es die Gegenposition zu Sartre war, welche den Strukturalismus in der DDR hoffähig werden ließ, man kann nur darüber spekulieren, denn auf dem Weg dorthin brach die DDR zusammen. Ein Baudrillard, der die gesamte westliche Zivilisation am liebsten zur Simulation erklärt hätte, der mußte einfach für die Ideologen der DDR interessant sein… er hatte noch einen Vorteil, er ignorierte fast vollständig die Zustände im Ostblock: der Sozialismus war schon eine Simulation und brauchte nicht mehr als solche definiert zu werden. Es war ein seltsamer, aber nicht etwa unlogischer Vorgang: in dem Land, in dem der Materialismus zur Staatsdoktrin erhoben war, der Begriff Aufklärung dabei zu einer nur plakativen, sinnentleerten Hülse verkommen war, griffen junge Autoren nach den Werken einer Gegenaufklärung: und dies, anstatt sich mit den Grundlagen der Aufklärung zu beschäftigen. Sie nahmen den Kampf gegen die Vorspiegelung von Aufklärung nicht auf, sie resignierten. Dabei hätte uns nur dies helfen können: es klingt großspurig, aber wir hätten die Aufklärung der Macht entreißen müssen, wir hätten es zumindest versuchen müssen.
Es ist schließlich dennoch geschehen: die Sätze, die auf den Montagsdemonstrationen gesagt wurden, waren Sätze der Aufklärung, sie nahmen den bürokratischen Sprachgebrauch der Macht auseinander, sie widersprachen der Vorherrschaft der Simulation. Aber vielleicht hätten uns einige Irrwege erspart bleiben können: und diese Irrwege machten es dem Westen später allzu leicht, das Ganze zu desavouieren, das im Osten entstanden war.
Es sind Aussagen eines Dichters vom Prenzlauer Berg in Berlin gedruckt worden, die später, nachdem die Verstrickungen des Betreffenden mit dem DDR-Geheimdienst offenbar wurden, als ein verschlüsseltes Eingeständnis seiner Kollaboration gelesen worden sind, diese Sätze lauten: „man hat es gelernt, mit der schizophrenie produktiv umzugehen. ich bin nicht schizophren, sondern ich bin der, der schizophrenie als mittel zur verfügung hat. d.h., ich brauche nicht die zwei welten, in denen ich existiere und mich ausdrücke, und ich kann eine immer sterben lassen. welchen sinn das hat, interessiert dabei erstmal weniger als die möglichkeit. ich verfüge über die mittel der schizophrenie, ohne selbst betroffen zu sein…“ Für mich lesen sich diese Sätze noch anders, sie lesen sich für mich wie eine simplifizierte Apologie aus dem Anti-Ödipus der Strukturalisten Gilles Deleuze und Felix Guattari. Nur daß hier nicht vom Hochschulkatheder aus und in materieller Sicherheit das Krankheitsbild des Schizophrenen zum Widerstand gegen die gesellschaftliche Norm umfunktioniert und schlicht weiterempfohlen wird: hier bezieht dies einer auf sich, hier flüchtet sich einer aus der Wirklichkeit in eine Idee. Die Verwirrungen, die sich hier aussprechen, lassen sich kaum noch durch Logik auflösen: der Schriftsteller, von dem hier die Rede ist, „exterritorialisierte“ sich natürlich keineswegs nur theoretisch, wie er behauptet; er verfügte eben nicht über Schizophrenie als Mittel, sondern ließ sie sich aufzwingen. Die schematischen und letztlich inhumanen Schreibtischthesen von Deleuze und Guattari dienen hier bloß der Rechtfertigung einer Resignation. Es steht mir nicht zu, darüber zu richten, in welchem Moment Resignation verständlich wird und respektiert werden muß: solange sie einer noch mit solchen Winkelzügen zu reflektieren vermag, wie im vorliegenden Fall, darf man jedenfalls weiter mit ihm darüber diskutieren.
Für viele Dichter und Künstler der ehemaligen DDR, die in scheinbarer Aussichtslosigkeit zu verharren gezwungen waren, wenn sie sich nicht kriminalisieren lassen wollten, bot der strukturale Diskurs verführerische Muster an. Das Verführerische dabei war, daß in diesen Diskursen das Ende der Aufklärung und die Entbehrlichkeit der Kritik postuliert wurden: damit war ein Zustand zur logischen Realität erklärt worden, der in der DDR sichtbar und greifbar vorherrschte – nur daß er hier die Folge eines tiefgreifenden Realitätsabbaus war. Bücher wie der Anti-Ödipus stellten sich aufgrund ihrer spektakulären Thesen im stagnierenden Jahrzehnt vor dem Untergang der DDR als ein Mittel zum Widerstand dar, dabei waren diese Werke selbst nur Werke der Resignation. Die scheinbare Kompromißlosigkeit ihrer Gedankenexperimente war eine Form des Rückzugs. Sie empfahlen nicht, die Sprache der Macht beim Wort zu nehmen, was sie nahelegten, waren verschiedene Möglichkeiten, sich durchzumogeln.
Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Kritik −
das ist eines der zentralen Themen der Poetikvorlesungen, die Wolfgang Hilbig im Sommersemester 1995 an der Frankfurter Universität hielt. Es geht ihm nicht allein um die Literaturkritik, die ihn als Schriftsteller natürlich besonders berührt, sondern um die Kritik als Motor der Aufklärung und unserer Kultur schlechthin. Doch Hilbig nimmt die Kritik deshalb keineswegs von der Kritik aus: „Die Aufklärung begann mit der Kritik an der Religion, und das Bewegungselement dieses Zeitabschnitts griff nach und nach auf alle anderen Bereiche über und unterwanderte sie; dies dauerte so lange, bis die Kritik schließlich selbst zu einer Art Religion wurde. Um das ganze metaphorisch zu fassen: dem positiven weißen Gott der Religion wurde die schwarze Gottheit der Negation entgegengesetzt.“
Hilbigs Vorlesungen machen den Leser zum Zeugen einer konsequenten Selbstreflexion: Ein Schriftsteller, der heute zu den wichtigsten Prosaautoren deutscher Sprache gehört, fragt mit der ihm eigenen Hartnäckigkeit und Radikalität nach dem Sinn und Ziel der Literatur der Moderne. Er schreckt dabei weder vor Zweifeln am eigenen Schreiben, noch vor klaren Urteilen über die Rolle der zeitgenössischen Literaturkritik in unserer Bewußtseinsindustrie zurück.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 1995
Abriß ohne Birne
− Wie siech ist die deutsche Literaturkritik? Wolfgang Hilbig beklagt ihren Ausverkauf ans Showbusiness. −
Das unauffällige Bändchen wird gewiß nicht zu den Knüllern dieses literarischen Herbstes gehören; schon der doppelsinnige Titel verheißt alles andere als einen Bestseller-Erfolg: Abriß der Kritik hat der aus Sachsen stammende Schriftsteller Wolfgang Hilbig, Jahrgang 1941, die Buchausgabe seiner Frankfurter Poetik-Vorlesungen benannt.
Hilbigs Bilanz ist niederschmetternd: Längst hätten die Mechanismen der Bewußtseinsindustrie, die Marketingstrategien der Verlage und der geschwätzige Zynismus der sogenannten Postmoderne die Literaturkritik korrumpiert; mit Recht erinnert der Autor daran, daß sie auch in Deutschland einmal das Herz der Aufklärung war.
Nicht die freie Meinungsbildung des Publikums, sondern allein die Auflagenjagd und die Übertrumpfung der Konkurrenz seien der Existenzgrund der Medienunternehmen und der ihnen dienstbaren Literaturkritik. „In fliegender Hast“ reiße diese „einen Star nach dem anderen“ an sich, „um ihn in kürzester Zeit wieder auseinanderzunehmen und den Reißwölfen zum Fraß vorzuwerfen“.
In ihrer Pauschalität ist die Diagnose überspitzt, wie das Beispiel von Deutschlands wirkungsmächtigstem Leser zeigt. Marcel Reich-Ranicki ist der paradoxe, aber lebende Beweis dafür, daß ein unermüdlicher Akrobat des Medienzirkus, der es um nahezu jeden Preis auf Massenwirkung abgesehen hat, außerhalb der Arena ein Kritiker von Rang sein kann.
Auch Hilbig fällt es nicht ein, die Unabhängigkeit der Urteile (und Fehlurteile) von Reich-Ranicki anzuzweifeln. Im Gegenteil: Er ruft ihn als einen seiner beiden Kronzeugen auf, indem er eine bereits klassisch gewordene Diagnose des Großkritikers über die deutsche Literaturkritik zitiert: „Sie liegt darnieder und siecht dahin.“
Der andere Kronzeuge dieses Abrisses ist Hans Magnus Enzensberger, der schon vor neun Jahren in einem Essay voll Eleganz und Sarkasmus die „Rezensenten-Dämmerung“ konstatierte: „Wer fortwährend zwischen in und out in der Drehtür zappelt, von dem wird man kaum erwarten dürfen, daß er die nötige Geduld aufbringt, einen normalen deutschen Satz zu bilden.“
So unnachsichtig Hilbig die morschen Grundfesten der Kritik kritisiert: Er zertrümmert seinen Gegenstand nicht mit der Abrißbirne.
Wie schlecht nämlich die Literatur ohne unabhängige Kritik leben und sich entwickeln kann, das hat der ehemalige Heizer Hilbig als heimlicher DDR-Schriftsteller zur Genüge erfahren. Gerade die noch nicht etablierten Autoren, gibt er zu bedenken, wären auf dem Markt verloren, wenn sie sich nach Enzensbergers unbekümmerter Empfehlung allein der „Mundpropaganda“ einer Elite von 10000 bis 20000 „wahren“ Lesern anvertrauten.
So erweist sich Hilbigs zorniger Protest dagegen, daß „die Aufklärung von nun an im Red Light District verwaltet wird“, zuletzt als ein beschwörender Ruf nach einer Kritik, die diesen Namen verdiente. Noch ist die „Dämmerung“ der Kritik nicht ganz in jene Nacht übergegangen, in der alle Katzen grau sind.
Rainer Traub, Der Spiegel, 1.10.1995
Weitere Beiträge zum Buch:
Richard Herzinger: Samisdat gegen die Autogesellschaft?
Die Zeit, 3.11.1995
Harro Zimmermann: Schwestern im Bedeutungsschwund
Frankfurter Rundschau, 28.11.1995
Marie-Luise Bott: Die Verteidigung der Kritik und das Lob der Arbeiter
Badische Zeitung, 16.3.1996
Der Ort, an dem die Minotauren weiden
Die Angst vor ihm lähmte mich. Kaum dass ich zum Sprechen ansetzte, ja kaum dass ich Luft holte, war er zur Stelle. Und brachte ich dann doch einmal ein Wort, einen Satzfetzen hervor, war mir, als kaute ich Zeitungspapier. So schien es schon ewig zu gehen, und erst als ich aus Erschöpfung und Müdigkeit heraus ruhiger wurde, gelang mir der eine oder andere Satz. Doch je mehr ich sagte, umso deutlicher spürte ich, dass es sich offensichtlich um ein Verhör handelte. „Also nochmal“, insistierte er. „Sie behaupten allen Ernstes, der Dichter Hilbig sei schuld, dass Sie…“
„Von Schuld kann gar keine Rede sein“, sagte ich. „Und ich habe auch nicht gesagt, dass allein der Dichter Hilbig daran Schuld – ich meine, daran Anteil hatte…“
„Aber um den geht es hier, um den Dichter Hilbig.“
„Und um Sie“, hätte ich am liebsten gesagt, aber seine großen braunen Augen fixierten mich mit einer gewissen Wildheit. Ich wollte ihn nicht provozieren. „1987, als ich das erste Mal in die Kreisstadt A. kam“, wiederholte ich so gelassen wie möglich, „um mich am dortigen Theater zu bewerben, sprachen drei Dinge dafür, in diesem Landstrich zu bleiben. Ein Museum, das nicht nur vertraute zeitgenössische Kunst beherbergte, sondern auch 180 frühitalienische Tafelbilder, die es ermöglichten…“
„Schweifen Sie nicht ab!“, rief er.
„die es ermöglichten, zwei Jahrhunderte zu überblicken, die nicht nur für das Schicksal der italienischen Kunst entscheidend waren, sondern für das des europäischen Geistes überhaupt. Der zweite Grund war Gerhard Altenbourg, dieser Bild- und Wortmagier, der sich den Namen der Stadt zu eigen gemacht hatte, doch durch ein eingeschobenes o Nähe und Distanz ausbalancierte. Ich kannte einige seiner Holzschnitte und Lithographien aus einer Ausstellung im Dresdner Kupferstich-Kabinett und aus der Galerie Kühl. Hat man diese Blätter…“
„Zur Sache, zur Sache!“, schnauzte er mich an.
„Hat man diese Blätter einmal gesehen, diese amorphen Landschaften und Figuren, von denen ein milchig-silbriger Schein ausgeht, vergisst man sie nicht mehr, ja sehnt sich nach ihnen zurück. Und dann war da wie gesagt der Dichter Hilbig aus dem zwölf Kilometer entfernten Meuselwitz.“
„Sie hatten doch kaum etwas von ihm gelesen“, sagte er. „Und wie Sie ihn beschreiben…“
„Als Erscheinung war er mir bekannt“, erwiderte ich und nickte. „Ich hatte in einer Jenenser Kirche erlebt (die Veranstaltung stand unter dem Motto: „Solidarität mit Nicaragua“), wie der Dichter Hilbig von der Kanzel herab Gedichte vortrug, die sein sächsischer Dialekt wie eine Seele umhüllte. Zwischen den Gedichten trank er aus einer Milchflasche. Kurz darauf las ich – ergriffen vom ersten bis zum letzten Satz – Franz Fühmanns 1980 geschriebene imaginäre Rede, in der er den Dichter Hilbig eine Begabung nennt, wie sie die Zeit nur von Jahrzehnt zu Jahrzehnt hervorbringt. Den schmalen Band stimme, stimme, der 1983 bei Reclam Leipzig erschienen war, liebte ich wegen einer Handvoll Gedichte. Von einem, das „episode“ überschrieben war, wusste ich immer, dass es sich auf S. 63 befindet.“
„Das liegt vor“, sagte er und zog ein dünnes Blatt hervor, wie auch ich es früher für Durchschläge an der Schreibmaschine benutzt hatte. Stockend trug er vor, wie jemand, der das Lesen gerade erst erlernt. Er betonte auch falsch, sodass der Sinn mitunter verloren ging.
EPISODE
im düstern kesselhaus im licht
rußiger lampen plötzlich auf dem brikettberg
saß ein grüner fasan
ein prächtiger clown
silbern und grün den leuchtend roten reif am hals mit
unverwandtem aug mit dem großen gelben schnabel aufmerksam
zielte er auf mich
aaaaaaaaaaaaaaso war er herrlicher und schöner
als ein surrealistischer regenschirm auf einer nähmaschine
wie er dort saß genau und furchtlos verirrt
auf seinem schwarzen gipfel
konversation fand nicht statt
ich bewegte mich und er flog davon durch die offene tür
doch von weit her den geruch der sonne den duft
seines farbigen gelächters ließ er hier in der nacht
und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen
und als das kausale grinsen meines kopfes
von energie und frost gefressen in die nacht verschwand
glaubte ich nicht mehr an den untergang
der wahrnehmungen in der finsternis.
„Und Sie behaupten, dieses Gedicht wie einen Talisman bei sich getragen zu haben“, fragte er, offensichtlich erleichtert darüber, dass er nicht weiter vorzulesen brauchte.
„Sind denn die Zeilen: glaubte ich nicht mehr an den untergang / der wahrnehmungen in der finsternis keine Verheißung? Jemand, der in die Provinz geschickt wird, der sich fremd und verlassen fühlt, hat Zuspruch nötig. Der Dichter Hilbig war für mich dieser grüne Fasan auf dem Brikettberg.“
„Ihre Antwort bringt uns nicht weiter“, sagte er. „Erklären Sie doch mit einfachen Worten Ihre Behauptung, der Dichter Hilbig habe Sie in dieser Region heimisch werden lassen…“
„Heimisch habe ich nicht gesagt“, erwiderte ich. „Sie ist mir nicht fremd geblieben.“
„Haarspalterei!“, fuhr er mich an.
„Ich sah die Tagebaue und die Braunkohlensteppe anders, nachdem ich ,das meer in sachsen‘ gelesen hatte. Das Altenburger Land war keine sprachlose Landschaft mehr für mich“, sagte ich. Seine Hände raschelten in dem Wust vergilbten Durchschlagpapiers vor ihm.
„Wenn der Wind in Altenburg aus Norden oder Nordosten kam“, fuhr ich fort, „glaubte ich anfangs, in meiner unmittelbaren Nachbarschaft müsse sich eine KfZ-Werkstatt oder Lackiererei befinden, es war aber der Gestank des zwischen Altenburg und Meuselwitz gelegenen Rositzer Teersees, wobei Teersee ein Euphemismus ist. Wie sollte man einem Landstrich, über dem solch ein Pesthauch liegt, anders als mit Abscheu begegnen, wenn es da nicht eine Stimme gäbe, die mir vom Fasan auf dem Brikettberg erzählte.
„Schön der Reihe nach“, sagte er und begann wieder stockend vorzutragen:
„W. spürte deutlich, daß sich ihm alles, was er bisher gedacht hatte, in eine Sprachlosigkeit zurückverwandelte, deren Ohnmacht er immer dann gefühlt hatte, wenn er auf der Suche nach einem wirklich zutreffenden Ausdruck für den Landstrich gewesen war, durch den er jetzt fuhr. Es war eine sprachlose Landschaft, so hatte er sich immer wieder sagen müssen… und von Jugend auf hatte er mit offenem, taubstummem Maul vor dieser Landschaft gestanden.“ Er lachte auf und stieß einen Grunzlaut aus. „Das zum einen, der Vollständigkeit halber. Was aber nützt Ihnen Literatur gegen Kopfschmerzen. Hätten Sie seine Bücher nicht viel eher als Warnung lesen müssen, als nachdrückliche Aufforderung, den Dunstkreis des Leipziger Südraumes zu meiden. Da ist vom höllischen Landstrich die Rede, vom bestialischen Land, von dem er umgeben war, ein Gebiet, das man der Hölle entrissen zu haben schien, und doch glaubte man, in diesen unzähligen Kubikmetern kalter toter Asche, die hier versenkt worden waren, versetzt mit allen Fäulnisresten und allem Überflüssigen aus der nahen Stadt, das symbolische Abbild einer künftigen Erde erblicken zu können.
Er hatte seinen schweren Kopf zurückgeworfen, fuhr sich durch die Mähne und sah mich triumphierend an.
„Können Sie sich immer aussuchen, wo Sie leben?“, fragte ich.
„Weichen Sie nicht aus“, sagte er.
Ich empfand Widerwillen gegen ihn, wagte jedoch nicht, tief durchzuatmen. Dabei wusste ich, dass ich frei war, dass ich einfach aufstehen und gehen konnte, wenn ich nur die Kraft dazu fände.
„Ich bin hier, weil Sie hier sind“, sagte er schroff, als hätte er meine Gedanken erraten.
„Dichtung kann nicht einmal einen bösen Blick verhindern“, sagte ich, „was sollte sie da gegen eine ganze Industrie ausrichten?“ Wieder hatte ich diesen Zeitungsgeschmack im Mund. „Natürlich interessiert mich die Analyse des Teersees durch Chemiker, die Krebsstatistik der Ärzte. Aber wollte ich wirklich jemandem erklären, was dort vor sich geht, müsste ich erzählen…“
„Ausflüchte!“, meckerte er. „Ausflüchte!“
„Der Dichter Hilbig“, rief ich, „hat diesen Landstrich und die in ihm hausenden Gespenster genau beschrieben, er hat ihm Sprache verliehen, denn ohne die Wörter sind die Menschen und Dinge nichts. Er hat Meuselwitz zur griechischen Provinz gemacht, wofür es nicht einmal eines Wortes wie Acheron bedurft hätte…“
Er zuckte zusammen. „Jetzt kommen Sie mir nicht mit Mythos!“
Seine unförmigen Hände fuhren in den Papierhaufen. Er atmete schwer. Ich ahnte, was er mir jetzt wieder vorlesen würde.
„Sie meinen“, sagte ich und zitierte den Vers: „und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen“.
„Ja, ja, aber das meine ich nicht“, sagte er. „Ihr Dichter entlarvt sich selbst, hören sie: „… die Ungeheuerlichkeiten“, zitierte er, „in billige Mystifikationen gekleidet, … billige Mystifikationen, nicht Mythos, ihr Dichter sagt es doch selbst!“
Mit offenem Maul und gesenktem Haupt wühlte er weiter in den Papieren. Warum gerät man nur immer wieder an solche Kerle, dachte ich, wie lähmend sind diese Gespräche, in welcher Müdigkeit und Leere lassen sie einen zurück. Und dann darf man noch froh sein, mit heiler Haut davonzukommen.
„Kunst“, sagte ich, „erkennt man doch daran, dass sie noch anderes bedeutet als das, was sie dem Buchstaben nach zu sagen scheint. Man darf ein Gedicht oder einen Roman nicht mit einem Interview oder einer Rede verwechseln, denn im Zusammenhang des Gedichts oder des Romans gewinnt der zitierte Satz eine ganz andere Aussage. Sie müssten das ganze Gedicht zitieren, die ganze Erzählung, das ganze Buch. Denn wenn da steht: und ich verwarf alle mühe das leben mythisch zu sehen, er aber doch im selben Augenblick ein mythisches Bild entwirft, eben den Fasan auf dem Brikettberg, was heißt es dann? Und sehen Sie nicht im Schatten des Fasans einen anderen Vogel, den Phoenix aus der Asche? Und wenn Rosen auf den Ausscheidungen verendeter Tiere wachsen, kann doch Persephone nicht weit sein!“
„Wer kennt sich denn heute noch aus in diesen Pauker-Geschichten“, erwiderte er. „Außerdem gibt es nichts Langweiligeres als Schriftsteller, die übers Schreiben schreiben…“
„Kennen Sie die Geschichte von Perseus und der Gorgo Medusa?“, fragte ich, ohne aufzusehen, um mich nicht von seinem Anblick einschüchtern zu lassen. „Perseus schlägt ihr den Kopf ab, und ihrem Rumpf entsteigt Pegasus, das geflügelte Pferd. Wie aber konnte er ihr den Kopf abschlagen, wenn ihr grausig fratzenhaftes Haupt doch jeden zu Stein verwandelt, der es erblickt? Weil er ihr Spiegelbild in seinem Schild sah. Deshalb versteinerte er nicht und konnte zuschlagen. Dieses Schild ist die Kunst. Sehen Sie nicht, wie alles um den Erzähler her seine Sprache verliert, erstarrt und versteinert. Und selbst er, der spricht, kämpft gegen diese Lähmung, denn die Anstrengung und die Angst, die es kostet, mit dem Schild voranzugehen, lässt ihn keuchen, sein Atem beschlägt das Schild und er muss es wieder und wieder blank wischen. Merken Sie nicht, wie er unter Aufbietung aller Kräfte die Sprache an sich reißt und sie in einen Wirbel versetzt, der ihn selbst am Leben erhält und rettet? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht“, rief ich, den Blick auf meine Knie gerichtet, „aber im Alltag bewahrt einen doch nur das Verdrängen und Augen Zudrücken vor der Versteinerung. Über das Schreiben zu schreiben heißt doch auch davon zu erzählen, wie man versucht, lebendig zu bleiben. Solange man erzählen kann, bleibt man am Leben, heißt es… schreibt der Dichter Hilbig. Erzähle… erzähle, sage ich mir, sonst wird alles ins Vergessen taumeln. Erzähle, damit der Faden nicht abgeschnitten wird… tausend Geschichten sind nicht genug. Damit der Strom nicht unterbrochen wird, damit das Licht über den Tischen nicht ausgeht. Erzähle, sonst wirst du ohne Vergangenheit sein, ohne Zukunft, nur noch willenloser Spielball der Bürokratie. Du wirst in ihren Datenbanken liegen, abrufbar, eine Berechnung, ein Buchungsfaktor, Teil einer Summe, deren Verlust von Anfang an einkalkuliert ist… du wirst Kanonenfutter sein. Auch der Dichter Hilbig ist ein Bruder von Scharasad“, sagte ich, „die erzählen muss, wenn sie am Leben bleiben will und das Morden ein Ende haben soll.
Und so wie in den Versen und der Prosa des Dichters Hilbig die Zone, das Territorium, der Landstrich, der Kreis ihre Sprachlosigkeit verloren, so gewannen sie auf den Blättern von Gerhard Altenbourg ein Bildnis, so wie die Maler in Siena und Florenz vor achthundert Jahren die Folterknechte Jesu und die Jungfrau Maria malten, den Löwen mit dem Dorn in der Pfote und den staunenden Sultan. Es ist eine alte und befreiende Idee, sagt der Dichter Hilbig, daß die Stimmen der Kunst über die Zeiten hinweg sich das Wort erteilen. Die Stimmen“, sagte ich, „reisen in Geschichten, Gedichten, Bildern, Melodien, sie reisen in der Kunst. Deshalb treten die Bilder aus Siena und Florenz noch heute in ein Gespräch mit ihren Betrachtern ein. Deshalb können wir in den Folterknechten Jesu die Folterknechte auch unserer Zeit erkennen, in der Mutter Gottes das Mädchen Maria, im Löwen die verletzte Kreatur, im Sultan den ratlosen Fremden. Denn es gibt für mich keinen Zweifel, sagt der Dichter Hilbig, daß die Mythen die Essenz ununterdrückbarer Artikulationsdränge sind, so wie sie solche wieder hervorrufen, entstanden auf der Suche nach einer Alternative, die… dem Geist einen Daseinsgrund über dem der Verkettung in die Banalstrukturen des Lebens hinaus zuzumessen sich mühen muß, also schlicht dem Bewußtsein einen Sinn zu erteilen, was immer auch heißt – (…) das Bewußtsein zu erweitern. Dem Bewußtsein einen Sinn zu erteilen“, wiederholte ich, „das Bewußtsein zu erweitern. Einen Satz Franz Fühmanns verlängernd fährt der Dichter Hilbig fort: Wenn immer sich das Schreiben über die Bewegung des Selbsterhaltungstriebes hinaushebt, ist es erst Schreiben. Wenn es dann auch wieder – es ist nicht ein Paradox, sondern einfach eine Reihenfolge – aus Selbsterhaltungstrieb geschehen mag. Über Fühmann führt die Spur zu E.T.A. Hoffmann, den der Dichter Hilbig eine Schlüsselfigur für heutige Literatur nennt, bei dem das Schauerliche von faszinierender als auch erschreckender Aktualität ist. Auch der Dichter Hilbig weiß um die Duplizität allen Seins, wie es Hoffmann sagt, auch er weiß, dass wir die äußere Welt und die innere Welt gleichermaßen beachten und beschreiben müssen, ohne darüber die Trennung aufzuheben, er weiß, wie das eine ins andere reicht und von ihm abhängig ist, und er weiß, dass wir nicht versinken dürfen in der einen oder anderen, aber „diesen Balanceakt“, rief ich gegen das Gebrumm vor mir, „diesen Balanceakt beherrscht der Dichter Hilbig. Dort, wo Natur und menschliche Zivilisation so unerbittlich Krieg miteinander führen, entstehen die Gespenster. Und nicht zufällig ist gerade dort unten, im Labyrinth des Bergwerks, wohin nur der Sklave, der Sträfling oder der ungelernte Arbeiter geschickt wird, die Gespensterfurcht viel erheblicher als das Klassenbewußstsein, sagt der Dichter Hilbig, doch der Gespensterglaube findet sich längst nicht mehr allein dort, wo man über alle selbstgemachten Wahrnehmungen im Zweifel bleibt… Ende der Achtziger Jahre schreibt er ein Poem, das er Erzählung nennt, das „Waste Land“ der deutschen Literatur, eine Höllenfahrt, die mit dem Satz endet: Und endlich an einigen untergegangenen Ruinen vorüber, an Germania II vorüber, wo in der Flut die Sternbilder spielen, wo die Minotauren weiden. Ich war schockiert und ergriffen von dieser Stimme, von dieser Radikalität, von diesem Anderssein. „Hier hatte sich etwas Unerhörtes in meine Gegenwart verirrt“, rief ich gegen das Rascheln und Hüsteln vor mir an. Ich hatte Angst, den Faden zu verlieren, ich starrte weiter vor mich hin, nahm allen Mut zusammen und sprach aus, was mein Gegenüber jetzt oder zu einer anderen Stunde der Lächerlichkeit preisgeben würde, nämlich „dass – vorausgesetzt der Teufel hätte sich in den letzten Jahrzehnten darüber Gedanken gemacht, mit welchem deutschen Schreiber es sich überhaupt noch lohnen würde, einen Pakt zu schließen – er schnell auf den Dichter Hilbig gekommen wäre, weil er auf das Missverhältnis von Begabung und Lebensumständen hätte setzen können, im Altenburger-Meuselwitzer Land hätte er sich wohlgefühlt und sich beim Anblick der Hilbigschen Familie die Hände gerieben, denn dem Jungen vertrat der analphabetische Großvater die Stelle des in Stalingrad vermissten Vaters, und so hätte der Gott sei bei uns ihm einiges offerieren können. ach, wie neidete ich das Leben denjenigen, klagt der Dichter Hilbig, die es sitzend verbringen durften. Spätestens im Sommer 68 musste er auf den Dichter Hilbig durch eine Annonce in der Neuen Deutschen Literatur aufmerksam geworden sein: Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernstgemeinte Zuschriften an: W. Hilbig… Wie sollte man sich denn nicht wundern, wenn da einer nach der 8. Klasse, nach Lehre und Grundwehrdienst sich vom Werkzeugmacher zum Heizer entwickelt und das beste, das ungeheuerlichste Deutsch der Gegenwart schreibt. Dass es da jemand in einem Heizungskeller bei Meuselwitz vermochte, Paris die Stirn zu bieten, und in der Hitze vor den Öfen die Moderne von Breton bis Joyce in sein Idiom umschmolz. Ging es da mit rechten Dingen zu? Oder sollte ich es einfach einen unwahrscheinlichen und glücklichen Zufall nennen, dass es jenem Mann, den wir heute als den Dichter Hilbig kennen, gelang, den Ort und seine Bewohner zu beschreiben, eine Sprache zu finden, lebendig zu bleiben und nicht zu versteinern? Meuselwitz gibt es nicht nur in Meuselwitz. Aber diese Meuselwitze, von Millionen und Abermillionen bevölkert, bleiben stumm, weil kaum einer ihren Höllenkreisen entkommt, um über sie Auskunft zu geben“, sagte ich, und sah, dass der Faden, dem ich folgte, an manchen Stellen fast durchgescheuert war.
Ich sprach über die Verwobenheit seiner Figuren, Orte und Motive über die Bücher hinweg, und darüber, dass ich kein vergleichbar ausgeprägtes Werk kenne, in dem Essay, Prosa und Dichtung sich so durchdringen und ineinander übergehen, eine Stimme, die um das Unzulängliche, um das Vergröbernde wie um das lächerlich Lückenhafte unseres Wortschatzes und unserer Grammatik weiß, als müssten die, die genau sein wollen, verstummen. Ich sagte, dass mich sein Kampf, nicht zu verstummen, an jene Kämpfe erinnert, die wir im „Galeerentagebuch“ beschrieben finden. Und ich sagte, dass ich mich nie des Eindrucks erwehren konnte, der Dichter Hilbig versuche nach seinen Lesungen den Aufruhr zu besänftigen, den sein Schreiben auslöst. Aufmerksam, achtungsvoll, liebenswürdig wendet er sich jeder und jedem zu, als müsse er beschwichtigen. „Mitunter aber breitet sich ein Schweigen um ihn aus, als fordere das Gelesene doch seinen Nachklang, sein Recht und die Konsequenzen ein“, sagte ich und wollte endlich zum Schluss kommen. Deshalb beschränkte ich mich auf die Feststellung, dass man bei ihm glaubt, jedes Buch sei das letzte, nun sei alles gesagt und bis an die Grenze des Schweigens ausgeschritten. Dann aber, wenn man das nächste in der Hand hält, sieht man, wie das neue schon im alten verborgen gelegen hat, als sei es aus ihm gewachsen. Ich bezeichnete das Visum, mit dem man 1985 den Dichter Hilbig gen Westen reisen ließ, als teuflische Finte: „Was wäre er ohne Meuselwitz, ohne den Boden unter seinen Füßen? Wie der Riese Antaios, der immer neue Kräfte aufnahm, sobald er die Erde berührte von Herakles erwürgt wurde, weil dieser ihn in die Luft gehoben hatte, würde der Dichter Hilbig in der Fremde seine Kraft verlieren. Aber auch dieser Versuch, ihn zum Schweigen zu bringen, misslang. Was aber, so fragte ich mich damals, sollte aus dem Dichter Hilbig werden, als die Tagebaue sich selbst überlassen wurden, als die Uranhalden zu Bundesgartenschauen wurden, der Arbeitsplatz ein Privileg. Würde der Dichter Hilbig sich zu Tode erinnern und nun weitermachen im ewigen Plusquamperfekt? Musste man um ihn fürchten? Als im Frühjahr 2000 Das Provisorium erschien, sagte ich, „war ich betört von diesem Buch und wünschte mir barbarischer-, unsinnigerweise, dieses Buch sollte die Auslagen im Buchgeschäft nicht mit anderen ,Titeln‘ teilen müssen. Schon allein der das Buch eröffnende Boxkampf der uns herzlich vertrauten Figur C. mit einer Schaufensterpuppe schenkte der neuen Zeit ihr Bild. Der Dichter Hilbig hatte sich auf den neuen Kontrahenten eingestellt, er war direkter geworden, als fiele ein schonungsloseres Licht auf die Dinge. Doch wie viele Schläge landen in der eigenen Magengrube. Die Rückhaltlosigkeit, mit der hier jemand gegen sich als Autor vorgeht, nimmt einem den Atem. Aber gerade diese Rückhaltlosigkeit macht es überhaupt erst möglich, durch das Nadelöhr des autobiographischen Materials ins Offene zu finden, in die Bedeutsamkeit für andere“, sagte ich, dem Faden folgend. „Das Geschriebene wirkt so unmittelbar, weil es hoch kunstvoll ist. Denn obwohl jederzeit alles klar benannt und ins Bild gerückt wird, beginnen bald die Orte und Zeiten zu flimmern, das fiebrige Reisen des Helden übertr.gt sich mehr und mehr auf den Leser, es ist die alte Fluchtbewegung, die aus der Provinz herausführt, in andere Provinzen und Provinzen, eine Fluchtbewegung, die ihn dann doch wieder in jenem Ungeheuer von Kleinstadt eintreffen läßt. So viel Wut und Hass hat selten einer gegen den Osten geschleudert – und selten wurde so viel Galle und Hohn über den Westen gekippt. In ihrem Bodensatz, da, wo sich die Systeme gegen den Einzelnen richten, verschwimmen Ost und West und werden plötzlich als vergleichbar erlebt, die beiden Deutschlands sind zwei Krüppel, die mit den blutunterlaufenen Fressen gegeneinander gefallen waren. Und auch wenn es eine Selbstverständlichkeit ist“, rief ich, „so wiederhole ich es hier ein weiteres Mal, es ist keine Bitte, kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit, dass der Dichter Hilbig weiter schreibt, der Mythenerzähler, der in der Erstarrung den umstürzlerischen Traum bewahrt, und der die Zusammenbrüche nicht ohne die Idee des Lebens zurückläßt. Wer sonst sollte uns Aufschluss über jenes Territorium geben, in dem die Gespenster hausen. Und wo sonst sollte der Rastlose heimisch werden als bei denen, die ihn lesen“, sagte ich und fügte hinzu „dass ich noch eine Bemerkung über ,das meer in sachsen‘ loswerden muss, selbst auf die Gefahr hin, dass mir mein Sermon dann gänzlich aus der Form und dem Gleichgewicht gerät. Aber wenn schon sachsen sinnt gottes ordnung zu ändern, erlaube ich mir noch den Hinweis, dass ich beim Lesen dieses Gedichts, das mit den Zeilen endet das meer kommt wieder nach sachsen / es verschlingt die arche / stürzt den ararat immer an die stillgelegten Tagebaue denken muss, aus deren Tiefen wieder vorsintflutliches Gewächse sprießen, von denen niemand weiß, woher sie kommen, diese Nahrung der Dinosaurier und Minotauren, auch so ein wucherndes Grün, wie es der Dichter Hilbig liebt, in dem er zu Hause ist und wie er es auch im verwaisten Garten Gerhard Altenbourgs gefunden hat, ein Gedicht, das mir wie die Beschreibung einer Heimkehr vorkommt: Es beginnt mit einem Altenbourg-Titel:
Der Hügel Schatten in dir… sie werden heller
und leiser huschen die flüchtigen Hauche
auf den versenkten Straßen dahin –
das Ungesagte
das Ungestalte: wuchernd nimmt es wieder zu.
Und es endet mit den Zeilen:
Das Ungeformte kehrt zurück das Unterlassne
entsteigt dem grünen Überfluß der Stille –
und am Abend die Hügel hinter uns
bewachen im Schatten ihr Licht.
Damit, sagte ich, will ich enden, und hob nun endlich den Kopf, ein Ende des Fadens in der Hand. Hatte ich mich in das Labyrinth hinein geredet oder aus ihm heraus? Mein Gegenüber war verschwunden. Doch als ich mich endlich erhob, sah ich ihn den Hügel hinabgehen. Auf den ersten Blick schien es, als trage er einen Motorradhelm. Gegen den mondhellen Himmel hoben sich seine Konturen ab: Seine Beine, die fast steif wirkten, weil sie das Gewicht des Oberkörpers kaum zu tragen vermochten, seine breiten Schultern, sein Stiernacken, der schwere zottige Kopf hing auch im Gehen nach vorn, trotzdem zeichneten sich deutlich seine beiden Hörner ab, stark und spitz ragten sie über die gesenkte Stirn hinaus… Merkwürdigerweise flößte er mir keine Angst mehr ein. Oder war ich nur zu erschöpft? Mühelos setzte er über einen Bach. Auf der anderen Seite schien er einen Moment zu verharren. Sah er sich nach mir um? Ich winkte und schämte mich sogleich dafür. Er aber zog weiter, schneller und schneller trabte er jetzt, dorthin, wo die Minotauren weiden.
Ingo Schulze, Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Hilbig kauft sich eine Pistole, die nicht schießt
Eine Pistole braucht man immer, sagt Hilbig. Der laute Russe, mit dem Hilbig nachts am Tresen ins Gespräch kam, bot ihm die Pistole zum Kauf an. Seine Wohnung befände sich direkt gegenüber der Bar. Hilbig ging gleich darauf ein, denn heutzutage, so Hilbig, könne der Besitz einer Pistole nur von Vorteil sein. Es mußte allerdings, nach einigen Stunden dort angekommen, die Tür zur Wohnung des Russen aufgebrochen werden, da der Schlüssel nicht auffindbar war. Auch kannte sich, auf der Suche nach Trinkbarem, der Russe in seiner eigenen Wohnung schlecht aus. Aber das, worum es ging, fand sich, und Hilbig erwarb eine Pistole, von er sich später herausstellte, daß sie nicht funktionierte. Oder daß Munition für diese Pistole nicht beschaffbar war. Hilbig hatte immer wieder darüber geklagt, welche Belastung die nach einer Buchveröffentlichung obligaten Lesereisen seien. Daß er die Nächte in den Hotelzimmern fürchte, die er schon so oft durch die Anspannung, die ihn bei diesen Tourneen nicht verlasse, schlaflos verbracht habe. Nur während des Vorlesens seiner Texte käme er zur Ruhe, während die Zwischenzeiten ihm unerträglich wären. Nur ein Mittel helfe ihm, über die Runden zu kommen. Doch der einzige Arzt, der bereit wäre, es ihm zu verschreiben, sei nicht mehr in der Stadt. Gefragt, ob er es mit einer natürlichen, doch nicht legalen Droge versuchen wolle, die zwar weniger die Schlaflosigkeit, aber die Anspannung beseitige, stimmte Hilbig sofort zu. Zwei Wochen sollten genügen, das Mittel zu beschaffen, so daß man sich vor der nächsten Tour noch rechtzeitig genug verabreden könnte. Doch zum verabredeten Termin war Hilbig schon unterwegs. Hilbig, abgewandt, an seinem Schreibtisch. Auf dem Teil der beleuchteten Tischfläche, die sein Rücken verdeckt, liegt vor ihm, ahnt man, eine angerostete Pistole ohne Munition.
Stefan Döring, Gegner, Heft 21
Kunst als Aufbruch aus der Ausweglosigkeit
– Gespräch mit Dieter Kalka. Dieter Kalka ist Schriftsteller und Liedermacher. Er lebt und arbeitet in Leipzig. –
Karen Lohse: Wie sind Sie auf Wolfgang Hilbig aufmerksam geworden?
Dieter Kalka: Kennengelernt hatte ich ihn, da war er gerade aus der U-Haft gekommen. Das war im Lindenhof und Thomas Franke machte mich mit ihm bekannt. Ich wusste gar nicht, daß es außer Lutz noch jemanden in Meuselwitz gab, der schrieb. Wir konnten uns von Anfang an gut leiden und trafen uns öfter. Einmal kam ich und Fühmann war bei ihm. Er stellte mich vor und sagte:
Das is ooch’n Dichter
Fühmann wollte wissen, was ich schreibe und ich sollte ihm was schicken. Aber ich war damals ganz am Anfang und unsicher.
Lohse: Was war das damals für eine Atmosphäre in Meuselwitz?
Kalka: Das passt schon in diese Zeit, die er auch in den ersten Gedichten von abwesenheit beschreibt: eine Existenz, die sich immer im Kreise dreht. Früh aufstehen, am Wochenende in die Kneipe, gegen den Laternenpfahl rennen. Dieses Lebensgefühl hatten viele: Du kannst machen was du willst, du kommst nicht raus aus der Tretmühle. Ich hatte Abi und studierte und hatte eine andere Aussicht. Hilbig nicht.
Lohse: War das Schreiben für ihn dadurch eine Art Gegenpol zu der Realität, die scheinbar nicht zu überwinden war?
Kalka: Er hat das „stimme stimme“ genannt. Für mich wars so: Bevor die andern mir einreden, wie die Welt sei, will ich notieren, wie meine Welt ist. Ich denke, damit ist das gleiche gemeint.
Lohse: Wie war Ihr Kontakt zu ihm in Leipzig?
Kalka: Wir trafen uns in der Wohnung von Lutz, zu Szene-Veranstaltungen oder im Jugendclubhaus Steinstraße, auch zu Wochenendaktivitäten wie zur „Pyramidenfete“ oder in der Nervenheilanstalt Hochweitzschen zu einer Fete mit Konzert und Lesung. Manchmal sahen wir uns zufällig in der Stadt. Bei ihm in der Spittastraße war ich selten. Silvia Morawetz meinte, er müsse schreiben und wir hielten ihn davon ab. Sie hat uns nicht reingelassen.
Lohse: Wie ist Hilbig damit umgegangen, in der DDR kaum etwas veröffentlichen zu können?
Kalka: Das haben mehr oder weniger alle aus unserem damaligen Freundeskreis durchgemacht. Und alle haben darunter gelitten, wenn sie die belanglosen Texte in Temperamente lasen. Hilbig hatte damit abgeschlossen, dafür aber Westkontakte. Ich nehme an, er traf seinen Lektor während der Buchmesse in Leipzig und gab ihm das Manuskript zu abwesenheit.
Lohse: Als Hilbig freischaffender Schriftsteller wurde, war er ein fast vierzigjähriger Mann, der sein ganzes Erwachsenenleben in den Strukturen der Arbeitswelt verbracht hatte. Wie hat er diesen Wechsel verkraftet?
Kalka: Er ist mit dem Vertrag von Sinn und Form, da waren 5 Texte erschienen, nach Altenburg und hat sich den Stempel „freiberuflich“ ins SV-Buch geben lassen. Wir hatten mal darüber geredet, woraus die Substanz besteht, aus der man schreibend schöpft. Er meinte, dass alles, was man wahrgenommen hat, alle Gerüche, auch die ganz frühen Erinnerungen, wichtig sind. Daraus schöpft man fürs Schreiben. Ist der Vorrat aufgebraucht muss man wieder „ins Leben“ zurück. Das fand ich sehr imponierend. Ich war ja auch Autodidakt und wusste nicht, wie es geht. Hier hatte ich jemanden gefunden, der schon ein paar Schritte weiter war und sich dabei in einer viel aussichtsloseren Situation befand. Über solche Sachen haben wir uns öfter unterhalten, auch über künstlerische Formen wie Alliterationen oder den Reim, den er übrigens nicht mochte.
Lohse: Welche Bedeutung hatte das Boxen für Hilbig?
Kalka: Es gab einen Sportclub in Meuselwitz, in dem Hilbig ein paar Jahre lang regelmäßig trainierte. Aber ich glaube das Boxen an sich hatte in seinem Leben eine tiefere Dimension, es war fast schon ein Symbol: sich durchschlagen oder durchboxen, in einem Kampf solange durchzuhalten, bis der Gegner geschwächt ist und dann zum alles entscheidenden Schlag ansetzen. Das war seine Art, mit dem Leben fertig zu werden.
Lohse: Das sind ja völlig ambivalente Wesenszüge: Einerseits die ästhetische Beschäftigung mit der Literatur und dann diese gewalttätige Sportart.
Kalka: Ja, das ist paradox. Hilbig hatte jahrelang in einer Umgebung gelebt, die extrem kunstfeindlich war. Das Boxen steigerte möglicherweise seine Wahrnehmung dessen bis ins Extrem. Und von diesem Extrem hat er sich mit seiner Kunstsprache abgesetzt.
Lohse: Was war er für ein Menschentyp?
Kalka: Er war ein ganz stiller und auf seine Art sehr gutmütig. Wenn man ihn etwas fragte, überlegte er immer sehr lange und dann kamen Antworten, die man so nicht erwartet hatte, aus einer ganz anderen Richtung.
Lohse: Hat ihn der Medienrummel um seine Person verändert?
Kalka: Ich denke, sein Wesen blieb davon weitestgehend unberührt. Aber er hat es schon genossen, in der Literaturszene Fuß gefasst zu haben. Was die Lesungen und den Literaturbetrieb betrifft, so hat doch die Intellektuellen fasziniert, dass dieser Mann mit der gepressten Stimme, mit dem seltsamen Dialekt, auch noch ein Arbeiter, das geschrieben hat. Damit ist er sich selbst treu geblieben. Er musste sich nicht verstellen.
Aus Karen Lohse: Wolfgang Hilbig. Eine motivische Biografie, Plöttner Verlag, 2008
KEIN ICH. KEIN DU
mit Wolfgang Hilbig unterwegs
heizte oder fährste? / fragte ich naiv / den grimmigen mann / der nie sprach / ein pochen aus stille / sprachbrech im radebruch / nachdem wir uns übel /auf die schultern / geboxt hatten / wollten nie / nie jemand nach / dem weg fragen / auf der suche / nach auswegen / im verstellten land / weil nie etwas / anfing auf / alten fotosilberplatten //
ein schluckschmerz aus / gierigen bechern / bei windigen treffen / alles ödete weiter / in laubenpieperhöllen / mit grantigem obstwein / vom markt vor der uni aus wut wurde text / verlust verrat zweifel / kalte hände aus rost / lachende lügen heulen / regen poliert die trauer / hagel die reue nur / mit luft bekleidet / irrten wir durch / vergessene krummgassen / eine hagere katze mit / dem gesicht von lutz nitzsche / die verbogenen gleise / entlang an grindigen vororten / weil alles dort begann oder weste / überzählig in goldenen städten //
verliefen uns im regen / der einsilben / bechern mit hilbig / in leipzig und berlin an stummen tresen / so viele thesen / vom verwesen / sprachen wie wir sprachen tranken wie wir tranken / ruhm ward keine heimat / rum schon / alles zuviel nie genug / die lebern sangen / im bleichen chor / branntwein aus spucke / alle flüche reichten nie / ungedruckte messer / in der lauten hand / taugenichtse vor jedem staubigen bücherstand / verschwendeten uns //
schritten die toten ab / mahnmale aus nichts / lungerten hinterm zirkuszelt / lichtlos bei den tierjungs / wo es feuer & schicksale gab / schrundige öffnen ihre stullenbüchsen / voller irrwitziger geschichten / die ausreden schlichen in den puff puff wo / heute clemens meyer haust / permafrost im hoden / manuskripte im boden / rostige wölfe bitterkalt / im haus aus sand und blei //
ein blindes auge im paß / zettel im mund / krakeelte beat poet abende / im urschrei koma / warten auf nichts / es gab keine handlung / die sorgen würden uns schon finden / das schweigen war / ein gewissenhafter genosse / die kalten söhne / vagabunden der weigerung //
auf jedem rummelplatz / skat ums deputat / verträge um briketts / würfel um pferde / oder scheinbare sicherheiten / litaneien vor schenkelengen kittelschürzenwahrheiten / von hinten ein zucken / der stummen münder / im taubstummen gedöns / aus schwarzen zungen / im leipziger osten / ein sprechen ins leere / alte jahre später / kopien der erfahrung //
fielen uns nie / in ungesagte worte / das summen der texte / kein versprechen ein paar briefe wie / eine gekrümmte gestalt / am kadaverbrunnen / knochiges treibgut / in einer nacht aus gewalt / untertunnelte schatten / die leere aller tage / die verstummten nächte / die verschattete angst / verzettelte liebesmüh eine / lauernde zerstörung / ein gift das wir / gern nehmen eine kultur des verdachts / einbüßung des ichs / schierlingsbecher aufs leben / ein unstillbarer durst //
trafen uns an den rändern / der felder sächsisches schach / nicht die stadt mitten kornblumblau / an einem rapsgelben tag / unverabredete kaschemmen / in vorgärten aus zufall / scheinheiligen büsten aus / styropor / die sprachlos / stummen nur ihr summen / die trennungsbahnhöfe / wurden uns abschied / das letzte rauchige / notbier bevor es / ins eisgrau fremde ging / an der nächsten haltstelle stieg ich / aus für immer / nie wieder ist eine / ziemlich lange zeit //
als wir uns nach vergorenen / jahren wieder trafen / an den tresen der / bleichen frontstadt / unter grimmigen wettern / konnten wir einfach / wissend weiter fresse / halten lull samt lall / irrläufer einer revolte / im irisierenden geldlicht / eines endenden nichts / notbund unserer biographien / als ob immer alles / weiterginge oder ende / mein mund ward schweigen / deine worte grimmen weiter / zwei paar kalte alte hände / zwei windhunde im / regen endlich allein / ein aufbruch / ein geteilter himmel / voll alter stille / du fragtest du plötzlich / wollen wir gehen?
Ronald Galenza
Pauline de Bok: Der Mann aus Meuselwitz. Prosa und Lyrik von Wolfgang Hilbig – Kommentar und Übersetzung
Leben habe ich nicht gelernt. Jürgen Holtz liest Texte von Wolfgang Hilbig aus Anlass des ersten Todestages von Wolfgang Hilbig. 5. Juni 2008. Eine Veranstaltung der Galerie auf Zeit – Thomas Günther – in Zusammenarbeit mit den Tilsiter Lichtspielen Berlin-Friedrichshain.
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Hilbigs Moderne. Auf die Suche nach den Quellen und Gesichtern von Hilbigs Moderne gehen: die Schriftsteller Peter Wawerzinek (Unangepasstheit als Lebensprogramm) Ingo Schulze (poetische Traditionen), Dieter Kalka (Moderator), Sebastian Kleinschmidt (Hilbigs Lesebiografie – seine Quellen der Moderne), Clemens Meyer (Nacht-Topos bei Hilbig)
Herr Hilbig, bitte Platz nehmen in der Weltliteratur! Mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller (Hilbigs singuläre Poetik), den Schriftstellern Clemens Meyer (Wirkungen in anderen Ländern, von den USA bis Italien), Ingo Schulze (poetischer Anspruch vs. Mainstream), Peter Wawerzinek (Chancen für poetische Eigenart heute), Alexandru Bulucz (Hilbigs Poetik – Fortsetzung bei den Jungen) und dem Verleger Michael Faber (Verlegerfahrungen mit einem Dichter), moderiert von Andreas Platthaus
Wolfgang Hilbig Dichterporträt. Michael Hametner stellt am 3.11.2021 in der Zentralbibliothek Dresden den Dichter vor. Mit dabei am Bandoneon Dieter Kalka.
Helmut Böttiger: Hilbig – die Eigenart eines Dichters. Geburtstagsrede auf einen Achtzigjährigen
Vitrinenausstellung und Archivsichtung „Der Geruch der Bücher – Einblicke in die Bibliothek des Dichters Wolfgang Hilbig“ am 3.6.2022 in der Akademie der Künste
Wolfgang Hilbig am 29.1.1988 im LCB
Wolfgang Hilbig am 26.11.1991 im LCB
Gesprächspartner: Karl Corino, Peter Geist, Thomas Böhme
Moderation: Hajo Steinert
Lesung Wolfgang Hilbig am 13.3.2006 im LCB
Gespräch und Lesung I – Thomas Geiger spricht mit Wolfgang Hilbig über seinen Werdegang, der Autor liest Gedichte aus dem Band abwesenheit.
Gespräch und Lesung III – Gespräch über die Auswirkungen von Hilbigs Stipendienaufenthalt in Westdeutschland 1985, anschließend liest er aus seinem Roman Ich.
Gespräch IV – Thomas Geiger fragt Wolfgang Hilbig, ob er sich von der Staatssicherheit bedrängt fühlte, anschließend führt Hilbig in die Lesung ein.
Gespräch V – Wolfgang Hilbig berichtet von seinen Bemühungen in der DDR an bestimmte Literatur zu gelangen.
Zum 60. Geburtstag des Autors:
Ralph Rainer Wuthenow: Anwesend!
Die Zeit, 30.8.2001
Helmut Böttiger: Des Zufalls schiere Ungestalt. Gespräch
Der Tagesspiegel, 31.8.2001
Welf Grombacher: Ein Jongleur der Elemente
Rheinische Post, 31.8.2001
Horst Haase: Weisheit eines Geplagten
Neues Deutschland, 31.8.2001
Richard Kämmerlings: Geschichte und Geruchssinn
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.8.2001
Zum 65. Geburtstag des Autors:
Gunnar Decker: Der grüne Fasan
Neues Deutschland, 31.8.2006
Christian Eger: Der Mann, der aus der Fremde kam
Mitteldeutsche Zeitung, 31.8.2006
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Jayne-Ann Igel: Das Dunkle oder Die Vordringlichkeit von Tatsachen
der Freitag, 31.8.2011
Ralph Grüneberger: Heute vor 70 Jahren wurde Wolfgang Hilbig geboren
Dresdner Neueste Nachrichten, 31.8.2011
Zum 1. Todestag des Autors:
Hans-Dieter Schütt: „Vom Grenzenlosen eingeschneit“
Neues Deutschland, 2.6.2008
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Jörg Schieke: eisiger regen fressende kälte
MDR, 30.8.2016
Christian Eger: Schriftsteller Wolfgang Hilbig „In Deutschland gibt es keine Dichter mehr“
Mitteldeutsche Zeitung, 1.9.2016
Beulenspiegels literarische Irrf-Fahrt 4: Wolfgang Hilbig zum 75. Geburtstag
machdeinradio.de, 2.9.2016
Wilhelm Bartsch: Am Ereignishorizont von Wolfgang Hilbig
Ostragehege, Heft 87, 5.3.2018
Zum 1o. Todestag des Autors:
Clemens Meyer: „Diese Sprache schneidet mich regelrecht auf!“
MDR, 2.6.2017
Zum 11. Todestag des Autors:
Eine Wanderung zum 11. Todestag von Wolfgang Hilbig durch seine Geburtsstadt.
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Internationales Wolfgang-Hilbig-Jahr 2021/22
Eberhard Geisler: 80. Geburtstag von Wolfgang Hilbig – Paul Celans Bruder
Frankfurter Rundschau, 30.8.2021
Nils Beintker: Einer, der sich nicht duckte: Wolfgang Hilbig
Br24, 30.8.2021
Karsten Krampitz: Als einer den Wessis von der DDR erzählte
der Freitag, 31.8.2021
Wilhelm Bartsch: Warum die Dichtkunst von Wolfgang Hilbig wesentlich für das Werk von Wilhelm Bartsch war
mdr Kultur, 31.8.2021
Ralf Julke: Die Folgen einer Stauseelesung: Am 31. August wird die Gedenktafel für Wolfgang Hilbig enthüllt
Leipziger Zeitung, 29.8.2021
Cornelia Geißler: 80 Jahre Wolfgang Hilbig: Botschaften über die Zeiten hinweg
Berliner Zeitung, 31.8.2021
Cornelia Geißler: Hilbigs Flaschen im Keller und die Schrift an der Wand
Berliner Zeitung, 2.9.2021
Frank Wilhelm: Ein unbeugsamer Poet ließ sich nicht verbiegen in der DDR
Nordkurier, 1.9.2021
Constance Timm: Versprengte nacht – Wolfgang Hilbig zum 80. Geburtstag
MYTHO-Blog, 31.8.2021
Helmut Böttiger: Giftige Buchstaben, brütendes Moor
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
Katrin und Volker Hanisch: Gespräch über Wolfgang Hilbig
Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, 3.8.2021
Zum 15. Todestag des Autors:
Vor 15 Jahren starb Wolfgang Hilbig. Eine Kalenderblatterinnnerung von Thomas Hartmann
Wolfgang Hilbig. Die Lyrik. Anja Kampmann, Nico Bleutge und Alexandru Bulucz erforschen im Literarischen Colloquium Berlin am 4.10.2021 in Lesung und Gespräch den lyrische Kosmos des Autors.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 +
YouTube + KLG + IMDb + Interview + Internet Archive + Kalliope +
DAS&D + Georg-Büchner-Preis 1 & 2
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett + IMAGO +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Wolfgang Hilbig: FAZ ✝ Die Welt ✝ Die Zeit 1 +2 ✝
titel-magazin ✝ Goon Magazin ✝ Spiegel ✝ Focus ✝ der Freitag ✝
Der Tagesspiegel ✝ NZZ ✝ ND ✝ BZ ✝ taz ✝ Süddeutsche Zeitung ✝
Claudia Rusch: How does it feel?
Neue Rundschau, Heft 2, 2008
Christian Eger: Im Abseits arbeiten
Mitteldeutsche Zeitung, 4.6.2007
Sebastian Fasthuber: Wolfgang Hilbig 1941–2007
Der Standard, 4.6.2007
Christoph Schröder: Wie sich das Ich auflöst
Frankfurter Rundschau, 4.6.2007
Uwe Wittstock: Wolfgang Hilbig-Wegweiser ins Unwegsame
uwe-wittstock.de
März, Ursula: Als sie noch jung waren, die WindeDie Zeit, 14.6.2007
Uwe Kolbe: Eingänge, Zugänge, Abgänge
Michael Buselmeier (Hrsg.): Erinnerungen an Wolfgang Hilbig, Der Wunderhorn Verlag, 2008
Günter Gaus im Gespräch mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig. Aus der Reihe Zur Person, gesendet am 2. Februar 2003



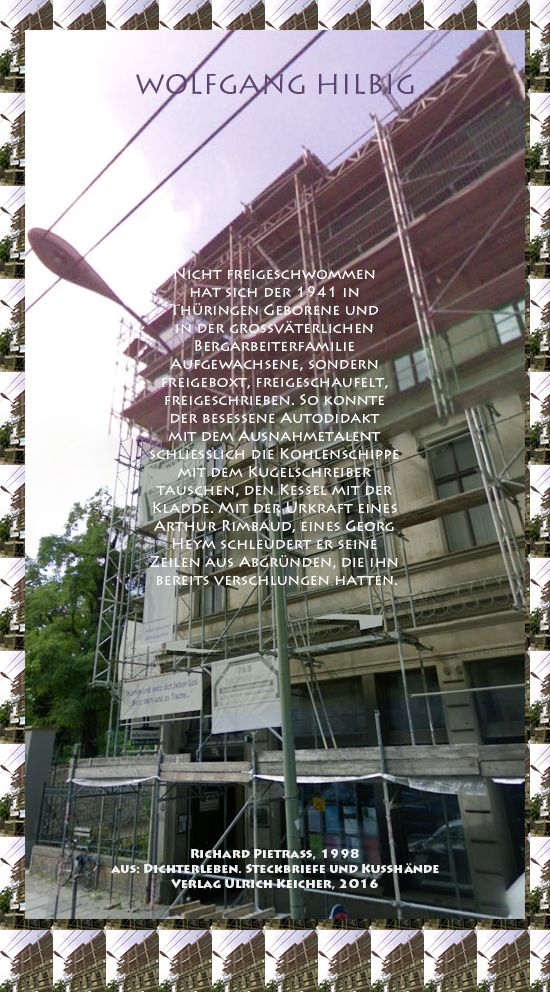












Schreibe einen Kommentar