Wulf Kirsten: der bleibaum
LOB DER DATENVERARBEITUNG
das alphabet verwalten
männlich oder weiblich in zwei spalten
entweder od
bekannt ist nur der hierarchische code
das lochfeld vollkommen ausfüllen
sich dann in schweigen hüllen
ein unter-, ober-, aber-, über-, vor- und hinterloch
ist immer noch der beste koch.
ein a gelocht
ein ei gekocht
ein c gestrichen
die schulden elektronisch beglichen
gestürzt gedreht gepocht
gerüttelt geschüttelt
gerupft gestopft geklopft
mal ausgelocht mal eingelocht
und eingefärbt und angeschwärzt
schließ aus schließ ein beherzt
die kybernetische maus
sieht aus ihrem loch heraus
die nullen immer mit verlochen
wie von der tarantel gestochen
in steter sorge um
rückt an, kreut auf und an
und ab und zu still und stumm
gleicht mann für mann
die achte revision
vom neunten bataillon
jeder sportlehrer hat eine nummer
numerierte figuren haben keinen kummer
der code ist verschlüsselt
der schlüssel vermasselt
schlamassel
alphabet, du assel
Nachbemerkung
Seit dem Erscheinen seines ersten Gedichtbandes satzanfang (1970) hat Wulf Kirsten seinen Lesern bestätigt, daß die vor Jahren ausgesprochene Warnung unseres Freundes Adolf Endler, man möge in Kirsten nicht nur einen begabten Naturburschen sehen, eigentlich überflüssig gewesen war. Kirsten, der erst spät zu publizieren begann, trat mit einer Sammlung hervor, die sofort einen bewußten Einsatz seiner Möglichkeiten verriet. Sein lakonischer, an der Sachlichkeit der Veristen geschulter lyrischer Stil versprach keine „erbauungsstunden“. Von seinen vielfältigen Beziehungen zur bildenden Kunst und seiner genauen Kenntnis der deutschen Naturlyrik von der Droste bis zu Huchel und Bobrowski profitierend, kam es ihm von Anfang an nicht darauf an, Stimmungen zu vermitteln. Viel mehr galt ihm das einzelne Wort, dessen Valenz im Text bestätigt wird. Er entwarf in seinen Gedichten „wortfelder“, deren „langsamer wuchs“ die Geduld verriet, mit der er auf der Suche nach seinem Thema war. „Sein Thema finden heißt zu sich selbst finden“ las man in dem Essay „Entwurf einer Landschaft“, der auch heute noch für Kirstens Lyrik weithin gültig ist. Überlagerte anfänglich noch die Theorie, seine Gedichte von „Grundworten“ her aufzubauen, einzelne Texte, so fand er allmählich zu einer produktiven Vermittlung poetischer Gelegenheiten und deren Umsetzung in eine Sprache, in der ein regional erworbenes Wortgut aufgehoben werden konnte. Die gelegentlich von ihm selbst apostrophierte Gebärde des „Wortsammlers“ wurde mehr und mehr zwangloser. Kirsten entband sich schließlich weitgehend dort von seiner Theorie, wo sie ihm Fesseln anzulegen drohte. Er wurde im Umgang mit seinen Gegenständen zunehmend souveräner und fand einen den Dingen adäquaten Ausdruck in prosanahen Versen. Mit diesem Gewinn an Freiheit stellte sich bereits innerhalb seines ersten Bandes ein Perspektivwechsel ein, der nun in seinen neuen Gedichten – bei aller Vorliebe für das Faktische – eine neue Qualität markiert. Nicht allein die genau ergründete Landschaft, sondern vor allem die in ihr wirkende Geschichtlichkeit, die „gefallene größe“ in ihrem „mahlgang“ als „eine summe staubes“ zurückläßt, dominiert. Gehörten zu den glücklichsten Lösungen, die der Band satzanfang auswies, „märzlandschaft“ oder „Querner“, so weisen die Gedichte dieses Bandes auf ein Problembewußtsein hin, das früheren Arbeiten noch fehlte. Über die meißnische Landschaft, dem Zentrum seiner „poetischen Provinz“, hinaus, setzt sich Kirsten deutlicher in Beziehung zur Welt. Neben der Rückschau in die eigene Vergangenheit („wir gruben uns ein in die erde, / studierten geologie, trichter um trichter, / in freier natur…“), die als erlebte Geschichte auch ein Stück bewältigte Geschichte ist, gehört auch das biographische Material der „Leute ohne Resonanznamen“, wie es in den Gedichten „nachtschicht“ oder „begegnung mit einem alten bauern“ präsent ist, in seine Konzeption. Die Vermittlung von Gegenwart und Vergangenheit stellt zwischen den einzelnen Texten Spannungen her, die der Sammlung ein erzählerisches Gepräge geben. Die so belebte Landschaft schließt jedoch nicht nur jüngste Vergangenheit auf, sondern ist zugleich Ausgangspunkt für die Rückschau in eine geschichtliche Ferne, die in der Gegenwart weiterwirkt. Die „blutspur der erhebungen“ bezeichnet den Weg der Herkunft, dem sich der Dichter verpflichtet weiß, auch in den Porträts jener Wahlverwandten, die „kein bild, kein grab“ hinterließen, jedoch, wie der Orgelbauer Silbermann, im Gedächtnis des Volkes weiterleben. Kirsten bedarf dieser historischen Dimension, um sich über seine Herkunft und seinen Standpunkt in der Gegenwart zu verständigen. Er unterwirft sich dabei aber nie einer Geschichtsschau, die in musealer Zufriedenheit sich selbst genügt. Wenn sich Kirsten auch noch der „Evokation der Provinz“ (Kunert) verpflichtet weiß, die sich von Weimar, seinem Wohnort, über den meißnisch-dresdnischen Raum bis in die Lausitz und nach Mähren erstreckt, so geht es ihm doch um mehr als um die bloße Beschreibung einer solchen Provinz. Und obwohl sich auch jetzt Landschaft als Landschaft der Erinnerung darstellt, aus der der „dinge totes gedächtnis“ aufgerufen wird oder anachronistisch gewordene Zustände ironisch beleuchtet werden, ist Kirstens Blick auf die Wirklichkeit schärfer geworden. Selbst ein vermeintliches Refugium wie das sorbische Niederland „Delany“ ist Teil einer Welt, in der die Natur Veränderungen unterworfen ist, die unser Bewußtsein erreichen. So wirkt Poesie als Ergebnis einer Anstrengung, die Strukturen abbildet, die denen der Wirklichkeit analog sind. Aber erst indem die Sprache des Dichters die „einfachen Wörter“ zu neuen Konstellationen zusammenführt, wird auch das Alltägliche neu gesehen. Von dieser Anspannung der sprachlichen Möglichkeiten her verfremdet sich das Bild der gewöhnlichen Landschaft zu dem einer ungewöhnlichen. Die Wendungen, die Kirstens Sprache vollführt, kehren das Äußere nach innen und führen den Sinn des Allgemeinen in die Tiefe der Bedeutung. So in dem Gedicht „die straße“:
zeitweilig auf erden stationierte
abgas fähnriche sättigen die luft mit blei.
sie schießen den vogel ab
auf der straße des rechts
zwecks betreibung des täglichen brotes.
die maurer auf dem gerüst
rufen lautstark nach kalk,
als gält es, die Caracalla-thermen
an einem tag zu bauen.
Verse wie diese haben keinen appellativen Charakter, aber sie verweisen auf die Wirklichkeit, indem sie das Gegenwartsbewußtsein schärfen. Es erweist sich, daß Kirsten den Gefahren einer thematischen Begrenzung, die Monotonie nach sich ziehen kann, nicht unterlegen ist. Die stärkere Einbeziehung distanzierender und satirischer Momente ist das Ergebnis eines von der genauen Bezeichnung der Wirklichkeit ausgehenden und wieder auf diese zurückwirkenden Prozesses. Kirsten konnte sich seiner Konzeption einer „an Landschaft gebundenen Naturlyrik“ treu bleiben, weil er die in der Landschaft wirkende Geschichte als ein Thema begriff, das er kreativ auszubauen vermochte. „der bleibaum vorm haus“ – Metapher einer Situation, in der die Natur mehr und mehr dem „geist der gesetze“ unterworfen wird, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des technischen Fortschritts kennzeichnen – wird zum Zeichen eines Zustandes, der unsere Anstrengungen zur Veränderung der Welt neu herausfordert. Indem sich Kirsten nicht einer metaphysischen Weltsicht unterwirft, „die auf Entrückung zielt“, sondern seine Erfahrungen auf den Begriff bringt, weist er einer Naturlyrik neue Wege, für die „ein Gespräch über Bäume“ nicht nur wieder möglich, sondern notwendig geworden ist.
Heinz Czechowski, April 1976, Nachwort
Laudatio: Johannes-R.-Becher-Preis 1985
Wulf Kirsten, der heute zu Lobende, und Becher, über dessen Kopf es nicht hinwegzuloben gilt – wie lassen sich beide ins Verhältnis setzen? Ich verheimliche nicht, daß mir diese Frage zunächst einige Not geschaffen hat. Denn ich weigerte mich ja, jene Behelfsbrücken zu benutzen, die sich – als solche – immerhin anboten. So sollte Kirstens editorische Kärrnerarbeit in Sachen Becher zwar benannt, doch keineswegs als Vehikel in Anspruch genommen werden. Und nicht minder widerstrebte es mir, Kirstens Landschaftsbezug mit dem Becherschen Konzept einer „Heimatdichtung“ zusammenzubringen, dessen geschichtliche Prämissen und gedankliche Konturen nur wenig geeignet sein konnten, dem Nachgeborenen einen Ansatz zu liefern.
Mit einemmal aber sah ich eine Verbindung; und ich sah sie, als ich, aus gegebenem Anlaß, erneut in Bechers Verteidigung der Poesie las. Da gibt es diesen Abschnitt: „Tatsachenlehre oder Das Märchen von der Wirklichkeit“. Und Becher handelt hier von einem Ungenügen, von der Erkenntnis eines Mankos, das ihn betroffen macht. Er schreibt:
Unsere Beziehungen zur Wirklichkeit sind mangelhaft und fragwürdig. Jeder kann an sich die Erfahrung machen, daß er kaum imstande ist, die Gegenstände, wie sie uns im täglichen Leben umgeben, einigermaßen genau aufzuzeichnen.
Und weiter heißt es:
Schemen und Wunschbilder sind es, mit denen dein Blick verhängt ist, gespensterhaft zieht an dir der Zug der Ereignisse vorüber, und das Leben, du selbst, wer bist du? Fragen wir nicht weiter. Beginnen wir damit, uns mit dem Gegenständlichen zu befassen und, das Märchen der Wirklichkeit entdeckend, näher an uns selbst heranzukommen.
Man weiß: Becher stand sich kritisch gegenüber. Er kannte den Zweifel an sich. Und immer wieder auch litt er unter seiner dichterischen Mentalität. Im Jahre 1937 diagnostizierte er seine Neigung zum „Zerfluten“; er benannte sein „sprunghaftes, sprengendes Temperament“; er zieh sich einer „hemmungslosen Ausdehnungssucht“. Und damals verordnete er sich die Form des Sonetts, die geeignet sein sollte, ihn selbst „in eine heilsame Zucht“ zu nehmen. 1951 indes, in jenem Abschnitt aus der Verteidigung der Poesie, rief er sich zu nüchternem Erfassen der gegenständlichen Wirklichkeit, zur Hinwendung zum „Reellen“, zur „exakten Aufzeichnung“. Freilich suchte er damit der Literatur seines Landes auch insgesamt eine Richtung zu weisen.
Wir müssen unser Verhältnis zum Wirklichen neu ordnen, wir müssen uns zur Erkenntnis des Gegenständlichen und des Tatsächlichen umerziehen.
In einem solchen Satz sprach sich ein allgemeineres Unbehagen aus – betreffend eine Literatur, die aufs Ganze gesehen wohl doch ein wenig zu hoch über der Realität schwebte.
Nun muß ich an dieser Stelle darauf verzichten, dem von Becher reflektierten Problem – als einem literaturgeschichtlich belangvollen – genauer nachzufragen. Und die Feststellung mag genügen, daß Bechers Forderung entschieden über die Stunde: da er sie formulierte, hinausgriff. Auch er selbst, der sich zu Wandlungen so kategorisch – Und immer wieder – Verpflichtende, war in den Jahren bis zu seinem Tode kaum mehr in der Lage, ihr ernstlich zu entsprechen. Aber die Zeit und die Zeiterfahrung waren es, die schließlich doch für sie arbeiteten. Und nicht zuletzt einige Dichter, die nachwuchsen, verspürten immer dringlicher die Notwendigkeit, beschreibend eine Realität zu erfassen, der die Sehgewohnheit – dies eben bemerkte man erschrocken – mitnichten gerecht wurde. So mußte es denn darauf ankommen, solcher Gewohnheit zu mißtrauen und ihr entgegen das Wahrnehmen neu zu erlernen. Problembewußt hatte Becher befunden, daß der Blick durch „Schemen und Wunschbilder“ verhängt sei – schließlich war es aber Wulf Kirsten, den eine ähnliche Erkenntnis zuinnerst getroffen haben dürfte; und das Stigma dieser Erkenntnis bestimmte fortan wohl alles mit, was ihn in seinem dichterischen Tun leitete.
Dabei war es eine erste Konsequenz, daß sich Kirsten eine umgrenzte Provinz erwählte. Gewiß, die Entscheidung dafür, sich als Dichter der besiedelten Spanne Land zwischen „Constappel und Siebenlehn“ zuzuwenden, hing auch zusammen mit einem unüberwindlichen Gefühl der Fremdheit, das Kirsten überkommen hatte. Die Städte, in die ihn das Leben verschlug, erwiesen sich ihm als unheimlich; und die verlorene Kindheits- und Jugendlandschaft gewann von daher eine starke Anziehungskraft. Im übrigen gab es die Orientierungsgestalt Bobrowski, die eine solche Zuwendung legitimieren konnte, wobei hier zugleich das Beispiel einer nichtidyllisierenden poetischen Landnahme vor Augen stand. Der zum Stadtfremden Gewordene war es aber, der sich nicht weniger auch – und sehr bedacht – die Heimatprovinz zu einem Gegenstand bestimmte, dem, als einem bislang nie ernst genommenen, Gerechtigkeit zuteil werden sollte. Und daraus wiederum erwuchs eine sehr konkrete und verpflichtende Anforderung an die Fähigkeit zu beobachten und zu beschreiben. Denn diese hatte sich ja an einer dörflich-kleinstädtischen Welt zu bewähren, die zwar eine eigene, jedoch unauffällige Physiognomie besaß; und insofern war, um sie kenntlich und gerecht abzubilden, höchste Genauigkeit aufzuwenden. Solch kenntliche und gerechte Abbildung freilich mußte diese Welt auch nicht nur als Zustand, sondern gleichermaßen nach Maßgabe ihrer Biographie erfassen. Der Raum jedenfalls war als Zeit-Raum zu beschreiben – exakte Beschreibung allerdings hatte es zu sein, was der Absicht einzig entsprechen konnte. Kein Über-die-Dinge-Verfügen, sondern sprachliche Reproduktion des Gegenständlichen, Detailgenauigkeit, „Aufstieg zum Konkreten“. Eben die Zeit jedoch durfte so nur durch das herbeizuziehende Faktum ins Gedicht geholt werden, durch ein chronistisch Verbürgtes, das seinerseits vergegenständlicht und der gegenständlichen Beschreibung integriert werden konnte.
Und Kirsten besorgte das, was er sich vorgenommen hatte, mit großer Gewissenhaftigkeit. Man möchte geradezu von Penibilität sprechen, von einem benennenden und beschreibenden Aufzeichnen, dem immer wieder die Furcht dessen im Nacken sitzt, der die verlogen abstrahierende Aussage haßt und der doch weiß, daß auch er selbst der abstrahierenden Über-Sprache teilhaftig ist. Nein, da ist nichts von rhetorischer Gebärde, nichts von Zügigkeit, nichts auch von einer metaphorischen Makrostruktur, die das einzelne beherrschen, es auf seinen Platz verweisen würde. Vielmehr ist es charakteristisch für Kirstens Gedichte, daß sie sich aus dem einzelnen ergeben, wobei jedes für sich seine – mitunter sperrige – Gegenständlichkeit uneingeschränkt behauptet und zur Geltung bringt. Dem wahrgenommenen und aufgezeichneten einzelnen wird derart in diesen Gedichten – denen auch folgerichtig eine prosanahe Diktion eignet – volle Aufmerksamkeit zuteil; ihm strebt der Text gerecht zu werden; gegenüber jeglicher Verfügungsgewalt verteidigt er es. Und so auch – Kirsten verfährt konsequent – tritt das Ich spürbar und deutlich zurück. Dieses Ich (öfters aufgehoben in einem Wir) ist anwesend als beobachtendes, sich erinnerndes, eruierendes, wahrnehmendes Subjekt, aber es macht sich nicht groß und breit: Es leistet die mühsame Arbeit sprachlich konkret bezeichnender Realitätsaufnahme – leistet sie indessen nicht um seiner selbst willen. Oder doch nur insofern, als es natürlich sein Unbehagen ist, das die Bemühung stets aufs neue zustande kommen läßt: das bohrende Unbehagen an der Vergewaltigung. Dieses übrigens artikuliert sich häufig genug auch ganz direkt, so etwa, wenn sich das Gedicht dem vergewaltigten, dem bedrückten und zum Opfer verfügten Einzelleben zuwendet, und nicht zuletzt dann, wenn es eine Natur vergegenwärtigt, die ihrerseits die Male schlimmer, vergewaltigender Zurichtung zu erkennen gibt.
Die Suche nach verlorener Realität: Für Kirsten mußte sie freilich zugleich eine Sprachsuche sein. Und auch dies kennzeichnet die Konsequenz seiner künstlerischen Arbeit, daß er sich mit dem kurrenten Beschreibungswort von Anfang an nicht begnügte. Dem Konfektionswort begegnete er mit gehörigem Mißtrauen; und was aufgefunden werden mußte, war vielmehr ein Wort, das dem Körper auf den Leib geschneidert sein sollte. So aber griff Kirsten vor allem auf alte Benennungswörter zurück, die, häufig landschaftsgebunden, von gegenständlich bezeichnender Sinnfälligkeit sind. „Aufstieg zum Konkreten“ folglich auch und gerade als ein Akt der Namensgebung; und zwar einer solchen, die in der sprachlichen Figur die körperliche zu Geltung bringt. Und nicht zuletzt erwächst die Eigenständigkeit Kirstenscher Gedichte aus eben jener Bildkraft, die so dem Wort selbst innewohnt. Dabei ist dieses Wort in jedem Falle ein widerständiges. Dem Sprachfluß stellt es sich geradezu störrisch entgegen; die unmodische Individualität des Wortes bringt ihn wieder und wieder ins Stocken. Daß sich indes die Syntax durch die sperrigen Nomina zwar aufhalten, doch nicht blockieren läßt, ist gleichermaßen zu beobachten. So kommt der Satz stockend voran, aber er kommt voran. Und in vielen Fällen bewegt er sich damit als ein Vehikel, das, ähnlich einer Kleinbahn, Dorf um Dorf abfährt, überall haltmacht und Insofern eine Verbindung schafft, die ihrerseits allem einzelnen Rechnung trägt und ihm zu Diensten steht. Fast durchweg rahmt Kirsten aus: Das Gesetz einer Satzspannung, die sich das einzelne Glied unterwirft, hebt er mit ziemlicher Entschiedenheit auf. Und fast durchweg auch verzichtet er auf raffinierte Versschnitte; den spannungsstiftenden Effekt des Enjambements – er schlägt ihn aus.
Allerdings gibt es in Kirstens Texten auch den Ausdruck satirisch-ironischer Distanz. Und vor allem in ihr meldet sich das Bewußtsein dessen, der, indem er benennt und beschreibt, seinen kritischen Intellekt denn doch nicht außer acht lassen kann. So überkommt denjenigen, der die dörflich-kleinstädtische Welt aufnimmt, der sich ihr mit melancholisch gestimmter Akribie nähert, gleichwohl das Verlangen, mit dieser Welt räsonierend umzugehen. Und Kirsten wäre wohl auch nicht ehrlich, würde er Ungebrochenheit vorspiegeln und als Subjekt im Vorgang des Benennens und Beschreibens verschwinden. Wie immer also auch die Lektüre seiner Texte an den deutschen Erzvater des Benennens und Beschreibens, an Barthold Hinrich Brockes, denken läßt, Kirsten kann natürlich keiner sein, der nur mehr, indem er aufzeichnet, Zeugnis zu geben vermöchte von einem Irdischen Vergnügen in Gott. Doch wie? Arbeitet der eine Antrieb nicht dem anderen entgegen? Jener eine, der darauf zielt, daß der Gegenstand redlich und getreu erfaßt werde, diesem anderen, der danach trachtet, über den Gegenstand zu befinden? Wirklich ist es ein Widerspruch, der sich derart auftut. Kirsten aber ist weiter nichts als unverlogen, da er diesem Widerspruch sich stellt und ihn einläßt in seine Texte. Auch darin jedoch bleibt Kirsten sich selbst und seinem ureigenen Anliegen treu, daß er behutsam mit ihm umgeht; jedenfalls treibt er ihn nur selten artifiziell auf die Spitze. So ist es charakteristisch, daß das Sprach- und Wortspiel, in dem sich das satirisch reflektierende Subjekt vorzugsweise mitteilt, noch immer auf Wendungen beruht, die einer mundgerechten, ihrerseits plastischen Rede entstammen – wodurch der (oftmals bitter) satirisch-ironische Zugriff in den meisten Gedichten auch keine Konterkarierung bewirkt, die rigoros zu nennen wäre.
Und nur in jenen Fällen, da Erschreckendes vor Augen liegt, da sich ein Bild trostloser Ruinierung von Lebenslandschaft bietet, emanzipiert sich das wahrnehmende Subjekt tatsächlich, und dabei bricht sich auch ein Aufzeichnungsfuror Bahn, der ganz im Zeichen von Zorn und grimmiger Verzweiflung steht.
das dorf,
sieh, wie es verschlungen wird,
am ende verschlingt es sich selbst,
wie es hingeht
gegen die scherbenumkränzte leere!
sieh, wie es ziegel um ziegel
im mahltrichter verschwindet.
Hier auch, in diesem Gedicht „dorf“, versagt sich schließlich jede Ironie, selbst noch elegisch-sarkastische; die deprimiert-wütende Beschreibung mündet ein ins Ecce einer von Erschütterung kündenden Klage; zudem wird das als Zustand Beobachtete nunmehr in bedrohlicher Bewegung gesehen, in einer beängstigend raschen sogar, die aufzuhalten keine Kraft zu existieren scheint. Das Gedicht aber wird derart zum Warngedicht. Und streng gegenständlich bezogen, wächst es über seine Anlage als Beschreibungstext doch hinaus und gewinnt eine ganz unmittelbar auf Beunruhigung und Herausforderung des Lesers zielende Dimension. Freilich ist ein solcher, den Leser direkt einbeziehender Gedichtschluß die Ausnahme bei Kirsten. Daß sich aber dem beobachtenden Subjekt der Gegenstand seiner Wahrnehmung unwillkürlich in Bewegung setzt, dies bezeugt sich in einer größeren Zahl der jüngeren Gedichte. Und dabei also läßt sich das Subjekt von einer assoziativen Wahrnehmungsweise leiten, durch die es mehr erblickt als das, was dem bloßen Auge sich darbietet. Dann geschieht es (wie schon im Gedicht „dorf“), daß das Stück Wirklichkeit in einem verfremdenden Spiegel aufscheint, daß eine bildliche Verquickung zustande kommt, daß sich Gegenständlichkeit und geistig-emotionale Reaktion des Subjekts in der Bildkonstellation spannungsvoll vereinbaren. Keineswegs jedoch verliert die Realitätsbeschreibung dadurch an Gewissenhaftigkeit; vielmehr macht sich das Gegenteil bemerkbar: Eine „unheimliche“ Präzision wird erreicht und eine solche Gewissenhaftigkeit, die sinnfälliger noch als in den anderen Texten ein großes dichterisches Verantwortungsbewußtsein ausdrückt. Und anstatt nun noch davon zu sprechen, daß Kirsten über die Grenzen „seiner“ Provinz ja auch hinausgegangen ist – um doch wieder zu ihr zurückzukehren –, oder davon, daß neben seine Lyrik auch jene Prosa trat, in der er die Chance eines extensiven Aufarbeitens sah, will ich hier ein solches Gedicht, in dem die Beschreibung ganz gegenständlich bleibt und dennoch in der bezeichneten Weise weitergreift, zum Abschluß dieser Laudatio in Erinnerung bringen. Vor knapp acht Jahren, als ich das Gedicht „schloß Scharfenberg“ zum ersten Male las, zeichnete ich es mir an. Des öfteren habe ich es dann wiedergelesen. Heute aber weiß ich, dieses Gedicht zählt, in seiner Kirstenschen Eigentümlichkeit, zum Besten der DDR-Lyrik insgesamt. Und vermutlich wird es Bestand haben.
SCHLOSS SCHARFENBERG
für Heinz Czechowski
ahornbrände
halten umzingelt das schloß.
aus laubschleiern
springen die dächer hervor,
vom Wind skelettiert.
auf hahnenbändern
reitet kühn der kastellan,
ein spreusack sein sattel.
die rittersäle umkreisen den turm,
eh sie abfliegen,
hals über kopf von der klippe,
dem fähnrich nach
und einem kupferstich
von Christian Clausen Dahl.
die eingerollten balustraden
falln lauthals in die seitentäler ein.
am schuttberg lagern
wortmassen und mauerfraß.
im weidenholz versteint
aller dinge totes gedächtnis.
Bernd Leistner, neue deutsche literatur, Heft 393, September 1985
Erwiderung
Es kann hier nicht darum gehen, mein Becher-Bild in toto aufzurollen. Und erst recht nicht möchte ich die Spur meines langen Marsches zu Becher nachzuziehen versuchen.
Ich gehöre einer Lyriker-Generation an, der Georg Maurer ein wegbestimmender Lehrer geworden ist. Ungeachtet aller weiteren prägenden Einflüsse, ich müßte an erster Stelle Johannes Bobrowski nennen, wissen wohl alle, die von Maurers Vorgabe gezehrt haben, daß ihre Entwicklung ohne Becher und Brecht – andere würden sagen: ohne Brecht und Becher – nicht zu denken ist. Nachfolge muß nicht Nachahmung sein. Was mich ganz früh, als Siebzehn-, Achtzehnjährigen für Becher einnahm, ganz naiv und ohne daran zu denken, selbst Gedichte zu schreiben, war das Entree zu dem Roman in Versen Urach oder Der Wanderer aus Schwaben:
Die Rauhe Alb. Von Höhen rings umfangen
Und zu den Höhen wie im Traumverlangen
Aufblickend: Urach… Apfelbäume blühn,
Und tief verneigen sich die Blütenzweige.
Ein Holzfuhrwerk zieht hoch die Ulmer Steige.
Die Burgruine – Fels im Hügelgrün.
…
Und Urach war… Urach klang heimatlich.
Was mich daran anzog, war das Verbundensein mit einer Landschaft als Heimat und wie dieses Gefühl so genau auf den Punkt gebracht wird, geographisch – aber nicht nur das. Die Affinität stellte sich wohl auch über das Atmosphärische her, das aus der lokalen Konkretheit aufsteigt und zwischen den Zeilen mitschwingt. Was wußte ich damals von den Hintergründen – von Bechers Freundschaft zu Karl Raichle, der da von ihm zur Legendenfigur erhoben wurde. Jahre nach dieser Zufallsbegegnung fiel mir der schmale Sonettband Wiedergeburt, der 1947 im Insel-Verlag in spartanischer Aufmachung erschienen war, in die Hände. Damals habe ich mich in Bechers Lyrik eingelesen. Wiederum waren es in erster Linie die landschaftlichen Bezüge, die mich anzogen und näher zu Becher hinführten. Heute würde ich von der Klarheit und Genauigkeit des Heimatgefühls reden, abgesehen davon, daß ich diese Art von Gedichten, die für mich nach wie vor zu seinen gelungensten und schönsten gehören, nun in den großen Entwurf eingebettet sehe, aus welchen Empfindungen heraus er nach 1933 die nationalen Aspekte über die soziale Anklage zu stellen begann. Damals erlitt er am eigenen Leibe, was Hölderlin meinte mit den Versen:
Nämlich sie wollten stiften
Ein Reich der Kunst. Dabei ward aber
Das Vaterländische von ihnen
versäumet und erbärmlich ging
Das Griechenland, das schönste, zugrunde.
Die tiefe Verbundenheit mit einer Landschaft; mit seinem Land, in dem man aufgewachsen ist, eingebunden in ein vielschichtiges Bezugssystem, Geschichte, soziale Bezüge, Politik als etwas Selbstverständliches eingeschlossen, Widerlegt am Ende das „Ubi bene, ibi patria“. In diesem Punkte, der ganz bestimmt mit dem „prägnanten Punkt“ zu tun haben muß, den Becher immer und immer wieder auf die Schärfe des Begriffs zu bringen versucht hat, weiß ich mich mit Becher einig. Zu den entscheidenden Stufen, die in das weiträumige Dichtungs- und Denkgebäude führten, das Becher errichtet hat, zählt eine kleine Arbeit über den Roman Abschied, die ich als Student im ersten Studienjahr schrieb. Ich fand, daß die Vorstufen bis zu den expressionistischen Erzählungen der Jahre 1913/14 zurückreichen, befaßte mich mit dem Motivgeflecht, mit der Fabelstruktur und den Kompositionsprinzipien, mich dabei auf Lukács und Rilla stützend. So wurde der Roman zum Schlüssel, der mir ein Tor öffnete. Der Schlüsselsatz für die auf Selbstgestaltung, auf künstlerische und menschliche Vollendung gestellte lyrische Grundhaltung, die der Dichter für jedes Genre gelten ließ, steht in der Fragment gebliebenen Roman-Umschreibung „Wiederanders“:
Sein ganzes Leben lang muß man an einem Roman schreiben, an dem einen, an dem seinen.
Diesem Ganzheitsdenken, diesem „Pathos der Totalität“, das Keßler an dem jungen Dichter gerühmt hatte, konnte ich guten Gewissens beipflichten. Und dabei bin ich geblieben, wie mir auch heute der vielleicht immer noch unterschätzte Roman und die Deutschland-Dichtung, beide auf einem Holz gewachsen, jene Teile des Werkes sind, in denen ich den Gipfel des Literarischen bei Becher sehe. In diese Sicht sind auch die Lektorenjahre eingegangen, als ich an der achtzehnbändigen Ausgabe saß und mir Becher zum Herausforderer wurde über viele tausend Seiten Text und viele hundert Seiten Kommentar. Ein Herausforderer zur Auseinandersetzung, zum Widerspruch und vor allem zum Weiterdenken.
Mit diesem Gedenkwort für Becher, das nur ein Abbreviatur sein konnte, sage ich ein Wort von Dank für diesen Preis, der seinen Namen trägt.
Wulf Kirsten, neue deutsche literatur, Heft 393, September 1985
Wulf Kirsten, der Bibliotheksfreund
Wenn ein Bibliothekar aufgeboten wird, um den Dichter Wulf Kirsten zu begrüßen, kann das vielerlei bedeuten. Zum Beispiel, dass Bibliotheken für ihn einen besonderen Stellenwert haben. Das ist tatsächlich so. Obwohl der „Autodidakt aus der Runkelprovinz“, wie er sich selber nennt,1 eine eigene legendäre Lyrik-Sammlung besitzt, vergeht keine Woche, in der er nicht mindestens zweimal die Herzogin Anna Amalia Bibliothek aufsucht, meist am späten Vormittag, wenn die ersten produktiven Morgenstunden am heimischen Schreibtisch verbracht sind, mit schwerer Aktentasche, bereit, neue literarische Schätze nach Hause zu tragen, sofern die Benutzungsordnung die Ausleihe erlaubt. Seit 1965 macht Kirsten das so, als das Haus noch Thüringische Landesbibliothek hieß. Wenn er auf Grund des Alters und des Werts der bestellten Bücher gezwungen ist, im Lesesaal zu arbeiten, ist das für ihn möglicherweise beschwerlich, aber für die Literatur und für das Bibliothekswesen ein Segen. Denn im Studienzentrum kommt er zwangsläufig mit Bibliothekaren und Mitbenutzern ins Gespräch, ist entzückt, ärgert sich schwarz, erlebt Geschichten. Da ist ein junger Mann im Lesesaal, dessen Musikgenuss trotz Kopfhörer die anderen Leser stört und der zur Ordnung gerufen werden muss, da ist eine Ägyptologin, mit der man fabelhafte Gespräche führen kann, oder da ist ein Sonderling, der völlig enthemmt jedermann auf Englisch anredet und von Kirsten eine Antwort auf Russisch bekommen muss. Man wird verstehen, dass die Bibliothek vor einigen Jahren die Bestimmungen hinsichtlich der Ausleihe aus dem Haus verschärft hat.
So saß Wulf Kirsten auch am Nachmittag des 2. September 2004 in dem alten, längst zu eng gewordenen Lesesaal des Historischen Bibliotheksgebäudes. Die Bücher, die er gelesen hatte, wurden nach Gebrauch in den Glasschrank für die nächste Lektüre zurückgelegt. Aber diesmal gab es keine Fortsetzung, zumindest nicht an dieser Stelle. Denn am selben Abend brannte die Bibliothek.
Ich sehe diesen einen Feuerwehrmann hoch oben in seinem Korb stehen und den Schlauch auf die Flammen halten und dachte, warum nur dieser eine. Am Eisenzaun der Hochschule für Musik saß ein Feuerwehrmann, der eben aus dem Gebäude gekommen war, sichtlich erschöpft. Ich hatte neben einem Mitarbeiter der Bibliothek gestanden. Ebenso entsetzt, bestürzt, fassungslos, traurig, geschockt wie er und wusste, dass eine Bücher-Rettungsaktion im Gange war oder gewesen war, die aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden musste. Der Feuerwehrmann sagte nur: Alle raus, keiner mehr drin.2
Kirsten hat die Verluste des Brandes nicht nur beklagt, sondern geholfen, die verlorenen Bücher wiederzubeschaffen. Fast 400 Titel sind als Geschenke von ihm verzeichnet, von Gabriele Reuter und Oskar Maria Graf über Johannes Bobrowski und HAP Grieshaber bis Jorge Semprun. Und seine private Lyrik-Sammlung wird, falls Kirsten stirbt, Teil der Herzogin Anna Amalia Bibliothek werden. So gibt es seidene und rote und goldene Fäden, die ihn mit uns verbinden und die keine Maus abbeißen wird.
Bibliotheken sind für Kirsten also unverzichtbares literarisches Zeughaus und Lebenselexier zugleich. Doch kann man fragen, ob ein Autor, dessen Werk unter dem Titel „Landschaft als poetischer Text“ verhandelt wird, nicht einen unmittelbareren Zugang zu seinen Themen hat? Reicht für die erde bei Meißen und die erdlebenbilder nicht die Anschauung der Natur? Braucht der Dichter wirklich die Texte der literarischen Tradition? Muss er so viel lesen? Ja, natürlich muss er. Außerdem: Er weiß auf Erden keine reinere Lust. Kirsten hat, zum Glück für die Leser, mehrfach versucht, einen ihm gemäßen Kanon an vorbildlichen lyrischen Texten aufzustellen, und hat unverwechselbare Gedicht-Anthologien herausgegeben. Und doch fehlen in den gedruckten Auswahl-Sammlungen immer noch viele Namen, die er gar nicht. aufnehmen konnte. Als Beispiel nenne ich nur die fremdsprachigen Autoren, die er selber als besonders einflussreich für sein Werk bezeichnet hat: József Attila, Petr Bezruč, Jiří Wolker, František Halas, Julian Tuwim, Konstantin Kavafis, Antonio Machado, Rafael Alberti, César Vallejo, Ossip Mandelstam, Edgar Lee Masters.3 Bei manchen Namen kommen sogar Bibliothekare, die bekanntlich alle Bücher kennen, weil sie keine lesen, in Verlegenheit. Der Textvorrat der literarischen Tradition dient aber auch der eigenen Produktivität: Er liefert Anregungen, neue Energien und schöne Vorbilder, Leuchtbojen in unerreichbarer Ferne, sagt Kirsten, auf die er zuhalten kann.4 Anverwandeln, abgrenzen, fragen, spielen, das Disparate zulassen – „George und Brecht, Benn und Lehmann“,5 darum geht es. Texte anderer Autoren sind für den Prozess des Schreibens nötig wie der Regen für die Schnecke, die erst bei Feuchtigkeit ihre Spur zieht.
Wenn ein Bibliothekar zur Begrüßung aufgeboten wird, kann das auch bedeuten, dass in den Texten des Autors ganz viel von Bibliotheken die Rede ist. Auch das ist richtig. So schildert Kirsten etwa in seinen autobiographischen Berichten oder im satirischen Stadtportrait Kleewunsch (1984) die langsame Entwicklung der Büchersammlung eines „Gemeinnützigen Vereins“ zur öffentlichen Volksbibliothek der Stadt Kleewunsch. Dortselbst hat sich besonders verdient um Einrichtung und Leitung der emeritierte Kantor Zschuschel, genannt Läuse-Zschuschel, gemacht. Für regelmäßige Ankäufe fehlt das Geld, nur durch Nachlässe kommen Bücher in die Sammlung. Der Bestandsaufbau ist gekennzeichnet durch Titel wie die Ikonographie der Land- und Süßwassermollusken Europas, einen Ratgeber für angehende Vorturner oder Jeder Vogelstimme kund, ein Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.6
Die Anwesenheit eines Bibliothekars kann auch bedeuten, dass das Werk des Autors schon so vielfältig ist, dass es bibliographischer Ordnungskompetenz bedarf, um Durchblick zu schaffen. Schon 2003 hat Anke Degenkolb in ihrer Kirsten-Bibliographie, ohne seine Einzelgedicht-Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften, 20 Gedichtbände gezählt, 10 Titel berichtende und erzählende Prosa, 73 essayistische Texte und 56 von ihm herausgegebene Werke. Und was ist seither nicht noch alles hinzugekommen! Ich erinnere nur an so wichtige Veröffentlichungen wie
• erdlebenbilder. Gedichte aus fünfzig Jahren. 1954–2004. Zürich 2004
• Steinmetzgarten. Das Uhrmacherhaus. Zwei Erzählungen. Warmbronn 2004
• Umkränzt von grünen Hügeln – Thüringen im Gedicht. Jena 2004
• Beständig ist das leicht Verletzliche. Gedichte in deutscher Sprache von Nietzsche bis Celan. Zürich 2010
• fliehende ansicht. Gedichte. Frankfurt am Main 2012
• Der gefesselte Wald. Gedichte aus Buchenwald, hrsg. mit Annette Seemann. Göttingen 2013
Wenn man noch die Sekundärliteratur über sein Werk hinzunimmt, die ebenfalls schon sehr umfangreich ist, ist es gar nicht abwegig, sich diese Menge geordnet zusammengestellt zu wünschen. Der Schritt zu einer Kirsten-Philologie ist nicht mehr fern.
Schließlich markiert der Bibliothekar auch eine dramaturgische Leerstelle. Jeder Leser weiß, dass bei Kirsten Werke der bildenden Kunst und Gespräche mit den Malern, Zeichnern und Bildhauern fast so wichtig sind wie die Texte der Literatur. „Viele Gedichte sind Bilder, gehen von einem Bild aus“, sagt Kirsten.7 Hier aber überlässt der Bibliothekar das Feld lieber den Experten oder, wenn er Lust dazu hat, dem Dichter selber.
Michael Knoche, aus Wulf Kirsten – die Poesie der Landschaft. Gedichte, Gespräche, Lektüren herausgegeben von Jan Röhnert, Stiftung Lyrik Kabinett, 2016
Aufs Brot geschmiert
Christoph Johann Gottfried Haymann aus Pforta stand über Jahre hinweg der weit gerühmten Annenschule zu Dresden als Rektor vor. Doch die Arbeit als geschätzter Erzieher und Philologe allein befriedigte ihn nicht. Weshalb er sich, obgleich bereits im fortgeschrittenen Alter, anschickte, während der wohlverdienten Erholungsstunden auch noch als Schriftsteller aktiv zu werden. Was die Schulbehörde nicht unbedingt wissen musste. Doch aller Heimlichtuerei zum Trotz wurde er anno 1809 – sieben Jahre vor seinem Tode – zum allgemeinen Stadtgespräch der „goldenen Residenz“, nachdem seine Schrift Dresdens teils neuerlich verstorbene, teils jetzt lebende Schriftsteller und Künstler von der Waltherschen Hofbuchhandlung verlegt worden war, ein fünfhundert Seiten dicker Wälzer, in welchem er sie alle „von Ackermann bis Zucker“ mit Namen nannte, die schreibenden Theologen, Philosophen, Juristen, Mediziner und Historiker. Jenen, die wir heute als Literaten bezeichnen würden, war nur ein dürftiges, wenige Seiten zählendes Belletristen-Kapitel gewidmet, in dem Haymann gar sich selbst zu verewigen wusste; der Vollständigkeit halber, denn mit einigem Stolz hatte er in seinem schwungvollen Geleitwort verkündet:
Es werden nur sehr wenige sein, die mir entgangen sind.
Dies eben hatten auch wir uns, Duzfreund W. im Brotberuf Brennserviceangestellter und ich, als ehrenamtlicher Lektor eines winzigen Kleinverlages, vorgenommen: das ultimative Lexikon aller Dresdner Dichter, Denker und Literaten aus sechs Jahrhunderten in die Welt zu setzen. Da unser beider „Erholungsstunden“ recht knapp bemessen waren und das Internet unseren Landstrich noch nicht erhellt hatte, dauerte es schlappe zwei Jahre, bis wir die ersten Exemplare des Wunderwerkes in Händen halten und signiert an Dichter, Denker und Literaten in alle Himmelsrichtungen versenden konnten. Hans-Peter Lühr, Redakteur der Dresdner Hefte riet uns, unbedingt ein Exemplar des frischgedruckten Buches an seinen Freund Kirsten in Weimar zu schicken. Natürlich kannte ich den Autor Kirsten vom Namen her längst. Wohl und Wehe der Klitsche Kleewunsch waren mir buchstäblich ans Herz gewachsen, und als Poesiealbumkonsument hatte ich definitiv achtzehn seiner Gedichte gelesen, von denen ich mich mindestens an drei deutlich erinnern konnte: zwei längere darunter, die von Dörfern, Blauschimmel und Roggenschrot, von Pferdegesichtern und Mondwölfen handelten und ein kurzes, welches mir besonders gefallen hatte, weil in ihm von Kirschdieben, Waghälsen und Schnapsbrüdern die Rede war. Auf der Meißner Albrechtsburg war es in den ersten Einheitsjahren nach einer Lesung sogar zum flüchtigen Wortwechsel zwischen mir, dem Zuhörer und ihm, dem bekannten Dichter gekommen.
Dennoch war ich mir keineswegs sicher, dass dieser sich zwingend für unser Kompilationsprodukt interessieren würde. Doch es dauerte keine zwei Wochen, bis Wulf Kirsten sich zunächst telefonisch bei mir meldete, zum Buch gratulierte, für dessen Erscheinen es längst an der Zeit gewesen sei. Und förmlich ohne Luft zu holen oder die Tonart zu wechseln, fügte er sinngemäß an, dass die geschätzten Autoren W. & W. es schlussendlich denn doch nicht voll und ganz auf die Reihe bekommen hätten, was sie in ihrem Vorwort (den alten Haymann brav zitierend) in Bezug auf die Vollständigkeit ihres literarischen Personalverzeichnisses versichern zu müssen glaubten:
Es werden nur sehr wenige sein, die uns entgangen sind.
Wobei ihn, dies müsse gesagt sein, der Einsatz des steigernden Adverbs „sehr“ doch irritiert hätte, weshalb er sich später hin, will heißen nach der Zweitlektüre, nochmals melden würde.
Waren wir der berüchtigten Goldgräbermentalität erlegen, blindgläubig mit oberflächlich ermittelten Fakten umgegangen oder etwa „mit dem liebevollen Eifer und der verbohrten Hartnäckigkeit, wie sie nur Laien aufzubringen vermögen“ dem von Kirsten in die Welt gesetzten Kleewunscher Wunschhuhn nachgejagt, dem ein kurzlebiges Dasein beschieden war? Die mit gemischten Gefühlen erwartete Rückmeldung in Form eines kompakten, eng betippten Bündels Schreibmaschinenpapier, versehen mit der bedrohlich anmutenden Titelzeile „Ergänzungen. Nachträge. Korrekturen“, bescherte mir dann, völlig unerwartet, ein außergewöhnliches, ja inspirierendes Lesevergnügen. Zunächst konnte erleichtert verbucht werden, dass sich die Zahl der von uns übersehenen Literaten doch in Grenzen hielt. Ausführlicher jedoch fielen die von Kirsten gleichsam aus dem Ärmel geschüttelten Nachträge und Ergänzungen zu den biografischen Einträgen aus: entschlüsselte Pseudonyme, familiäre Verhältnisse, Vor- und Nachfahren, Berichtigungen der Geburtsorte oder Sterbedaten, nebst Präzisierung der Art und Weise, wie dieser oder jener, der oder die aus dem Leben Entschwundenen, verstorben, hingeschieden, umgekommen oder entschlafen waren, ob durch Freitod, als Opfer eines Duells, ausgelöscht nach Bombenangriffen, verschollen nach Naturkatastrophen, im Kriege geblieben. Auch das Verdikt „nicht in Dresden, sondern… zu Tode gekommen bei“, tauchte wiederholt auf. Einmal nur hingegen die bissige Randnotiz des messerscharfen Lektors:
entsetzlicher Vielschreiber – Eintrag überflüssig!!!
Seine mit den Notaten übermittelte trostspendende Hoffnung auf eine baldigst zu edierende überarbeitete Auflage unseres Buches blieb unerfüllt. Dass wir dem im „Kleewunsch“ erwähnten Altachtundvierziger Semmig, der in Dresden mit den Revolutionären Bakunin und Richard Wagner aufrecht in vorderster Reihe stand, keinen separaten Eintrag, sondern nur wenige Zeilen im Artikel über dessen dichtende Tochter Berta gegönnt hatten, pflegte er noch Jahre später als Dresdner Stadtschreiber und Stammtischgast uns zwischen Spätburgunder und Edamer reichlich amüsiert aufs Brot zu schmieren.
Norbert Weiß, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
GLEICHBERG IM MAI
für Wulf Kirsten
Also stiegen wir auf den Gleichberg
Nicht Gleichschritt gleichwie Gleichmacherei
waren uns aufgetragen noch einmal studierten wir
„die Geographie der beiden Halbkugeln“8
Gegen Osten und Westen hatten wir rapsgelbe Flicken
lag Schlag um Schlag Vergangenheit offen zutage
Grabfelder Randlage ein einziges Minenfeld
Auf Römhilds Gräberfeld ließ sich häuslich
unter falschem Namen und echtem Basalt
ein Dichter im Exil nieder
Ein stadtbekannter Eremit
überzeugte seinen Siebenschläfer
für eine Nacht die Maske des Marders zu tragen
Noch einmal von der Steinsburg die Haßberge sehen
„die verkrüppelten, kleingeisterischen, rohen, anmaßlichen,
unwissenden, trägen Jünglinge“9
des uns nachgefolgten Jahrhunderts
zu fühlen plötzlich sind wir museumsreife Kelten
zu wissen dagegen ist keine Hexenzwiebel gewachsen
auch wenn sie blühend den Basaltkegel überwuchert
Noch einmal auf den Gleichberg gestiegen
Nicht Gleichmut gleichwohl Gleichklang
waren uns angetragen
und gleichzeitig zu sehen
„zum Ende meines – unsres – Horizonts“10
Michael Wüstefeld
Lesung Wulf Kirsten am 27.11.1991 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


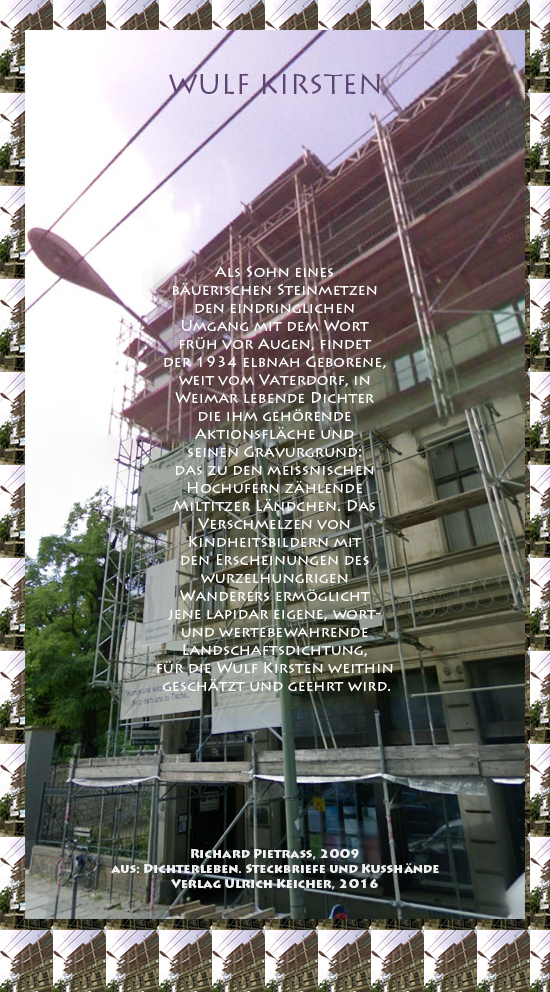












Schreibe einen Kommentar