Wulf Kirsten: die erde bei Meißen
NORDSTERN
die anderen frauen, die anderen männer.
mißlungen die einzige nachgelassene gebärde,
trennstriche, die verborgenen lachfalten,
ach, nordstern, wie unsere tugenden altern!
kehr zu, landein,
in den wassertropfen,
salzlos,
ins sternbild des Kleinen Bären!
dein ungetreues, halbherziges jahrhundert,
südlich,
läßt grüßen.
vergiß nicht:
links der friedhof, rechts davon
ich.
Nachwort
Je persönlicher, lokaler, temporeller,
eigentümlicher ein Gedicht ist; desto
näher steht es dem Zentro der Poesie.
(Novalis)
In den Versen von Wulf Kirsten hat das deutschsprachige Naturgedicht unserer Tage eine seiner selbständigsten und eigentümlichsten Gestaltungen gefunden. Das Unverwechselbare seiner Gedichte, das sich beim ersten Lesen als eine auffällige, öfter bis zur Widerborstigkeit gehende Rauheit der Diktion darstellt, offenbart sich bei näherem Zusehen als vorrangig bestimmt durch Gegenstand und Vokabular einer- und durch die Grundhaltung des poetischen Subjekts anderseits…
Davon läßt sich angemessen nur mit Blick auf Kirstens Leben und seine Entwicklung sprechen. Er stammt aus einer zwar unberühmten, jedoch keineswegs abgelegenen Landschaft, er kommt aus den linkselbischen Tälern zwischen Dresden und Meißen, an deren Rand er im häuslerwinkel von Klipphausen geboren wurde. Die südwestlich und westlich sich anschließenden fruchtbaren Gegenden, die Wilsdruffer, die Nossener und die Lommarzscher Pflege, gehören zum weiteren Raum seiner Heimat. Dort die straße alt und krumm, der schweifzug über die missingschen hügel, die Höhen um Meißen, gaben ihm, wie es in dem Gedicht „dorfstraße“ heißt, den anfang zur poesie. Damit sind die frühesten Verse aus der Mitte der fünfziger Jahre gemeint; ein kleines Sommergedicht von 1954 redet von den erntewagen, die dorfeinwärts schleifen. Das war in den Buchhalterjahren im benachbarten Taubenheim. Erst der Dreiundzwanzigjährige sollte, als er 1957 nach Leipzig ging, den engsten Kreis der Heimat verlassen. Entscheidende Entwicklungsjahre bringt er so in der betont bäuerlich-handwerklichen Welt seiner Herkunft zu. Das verzögert zwar den eigentlich literarischen und wissenschaftlichen Bildungsgang, doch was zunächst als Nachteil erscheinen mochte, erweist sich später als Vorteil, als entschiedener Lebens- und Weltgewinn. In diesen Jahren, als kaufmännischer Lehrling, auf dem Bau, hinter dem Schreibtisch, unterwegs auf der Straße, erwirbt sich Kirsten jene erstaunliche Sachkenntnis seiner Heimatwelt, die nicht nur jedem bloß gefühligen Verhältnis zu ihr entgegenwirkt, sondern auch einen entscheidenden Wesenszug in ihm zur Entfaltung bringt, die Liebe zur Genauigkeit im Detail, damit aufs engste verknüpft das, was seine Faktenversessenheit genannt werden darf. Die damals in vielseitiger Praxis sich bildende wie erfüllende Verbundenheit mit der dörflichen Heimat- und Arbeitswelt wird für Kirsten noch nach zwanzigjähriger Verlagstätigkeit im klassischen Weimar selbstverständlich sein.
Freilich, derselbe Kirsten, der – sieben Jahre nach der Bodenreform von 1946 – mit neunzehn Jahren in seinen Dörfern die Anfänge der Kollektivierung der Landwirtschaft sehr handfest und sehr bewußt als ein hartes Stück Umgestaltung der allernächsten Wirklichkeit erlebt, liest ungefähr gleichzeitig noch Hauptwerke der chauvinistisch-sentimentalen „Heimatkunst“, die Romane und Erzählungen Ludwig Ganghofers, Rudolf Herzogs und Hermann Löns’; das waren Lieblingsautoren der vorangegangenen Kleinbürgergenerationen. Was er davon allenfalls in die Zukunft mitnimmt, ist eine erste Vorstellung von literarischer Verarbeitung von lokalisierter Landschaft, Sitte und Lebensform. Doch rasch stößt er mit sicherem Gespür für das ihm Gemäßere auf Ehm Welk, vor allem aber auf Oskar Maria Graf; ihn nennt er viel später als eines seiner literarischen Vorbilder. Wie sich Heimat- und Volksverbundenheit mit Zeit- und Sozialkritik, mit drastischer Beschreibung des Dorf- und Kleinstadtlebens, nicht zuletzt mit Autobiographischem verbinden läßt (noch heute liest Kirsten mit Leidenschaft Autobiographien), das lernt der künftige Lyriker zunächst von dem bayrischen Erzähler in New York, mit dem er schließlich in Briefverbindung tritt.
Zu schreiben hat Kirsten erst mit zwanzig Jahren begonnen. Unmittelbaren Einfluß auf die lange Zeit tastenden lyrischen Versuche gewinnen damals Manfred Hausmann, Hermann Hesse und – schon einer der Vergessenen, denen seine Liebe später besonders gehört – Jakob Haringer. Stärker als diese einstigen Vaganten und Neuromantiker wirken freilich bald zwei Naturlyriker, deren Verse an konkrete Landschaften gebunden und von der Dichte der Naturdetails geprägt sind, der aus Franken stammende Friedrich Schnack und der in der Altmark aufgewachsene Peter Huchel. Von ihnen wie von den Neuromantikern bleibt die lyrische Suche lange Zeit hauptsächlich auf den Typus des vorwiegend kurzen Gedichts in vierzeiligen Reimstrophen festgelegt. Wo sie manchmal zu größeren Formen vorstößt, mag dies der frühen Beschäftigung mit dem Tschechen Petr Bezruč und dem Ungarn Attila Jószef, auf die Kirsten ebenfalls hinweist, zu verdanken sein. Zu einer wirklichen thematischen Profilierung gelangen die Versuche jener Jahre, sieht man von ihrer grundsätzlichen Naturnähe ab, nicht.
Um den poetischen Weg zu sich selbst zu finden, bedurfte es der Distanz zur Herkunftswelt ebenso wie neuer Anregungen und Eindrücke. So läßt der Dreiundzwanzigjährige sich zur Arbeiter-und-Bauern-Fakultät nach Leipzig delegieren, wechselt er vom sächsischen Dorf in die sächsische Großstadt über. Die eigentliche Bildungsstätte, sein zweites Zuhause, wird dort die Deutsche Bücherei. In dem gewaltigen Bücherschatzhaus beginnt er zielstrebig Lyrik zu lesen, legt er den Grund für eine riesige, bis heute ständig erweiterte Gedichtsammlung. Die ihm eingeborene Sammlernatur beweist sich hier genauso, wie wenn er zu Fuß oder per Rad wandernd unterwegs ist, wo immer er lebt; das Nützliche, das Bemerkenswerte, das Ungewöhnliche entgeht seinem Beobachter- und Sammlerblick kaum jemals.
Die systematische Lektüre von Lyrik gewinnt eine neue Qualität, als Kirsten nach dem Abitur in Leipzig mit dem Pädagogikstudium für Deutsch und Russisch beginnt und eher nebenher in die Germanistik hineinwächst. Er hört, in Zustimmung und Widerspruch vielseitig angeregt, nicht nur die Literaturvorlesungen Hans Mayers, sondern lernt auch ein Stück praktische Sprachwissenschaft kennen. Der Sammler wird zum freien Mitarbeiter des Wörterbuchs der obersächsischen Mundarten; als eifriger Wortsammler ist er dreieinhalb Jahre in der Wilsdruffer und Lommatzscher Pflege unterwegs und liefert gegen zwölfhundert Belegzettel ab, auf diese Weise die Heimatregion nun mit der inneren Distanz wie mit der wissenschaftlichen Neugier des Philologen durchstreifend.
Diese Zuwendung zur heimatlichen Dorfwelt auf einer neuen, höheren Stufe klärt und festigt nicht nur Kirstens Sprach- und Wortbewußtsein in Richtung auf Herkunft und Geschichte; sie hilft ebenso mit, das eigene lyrische Thema und damit zu sich selbst zu finden. Das heißt damals zuallererst, Klarheit zu gewinnen über die Tradition des deutschen Naturgedichts als Landschaftsgedichts, des Gedichts, das einen geographisch genau bestimmten Naturraum als zugleich menschlichen Lebens- und Arbeitsraum zum Gegenstand hat. In der Aufklärung setzt es mit den Ritzebütteler Gedichten von der Niederelbe des alten Gartenpoeten Brockes und mit Hallers großem Lehrgedicht „Die Alpen“ ein, findet im neunzehnten Jahrhundert seine prägnanteste Verwirklichung in den westfälischen und den Bodenseegedichten der Droste-Hülshoff und hat seine namhaftesten Vertreter in unserem Jahrhundert in Albin Zollinger, Theodor Kramer, Peter Huchel, Erich Jansen und Johannes Bobrowski. Sie alle hat Kirsten genau gelesen, in ihren Gedichtbänden und Einzeldrucken, in Anthologien und Zeitschriften verfolgt, Kramer, Jansen, Huchel und Bobrowski später auch ausdrücklich als Vorbilder benannt. Jeder von ihnen hat, sehr verschiedenartig motiviert und in je eigener Sprache, den heimatlichen Raum nicht nur als scharfgesichtig erfaßte Natur, sondern zugleich als historische, vor allem als soziale Realität ins Gedicht gebracht. Daneben studiert Kirsten die wenigen selten gewordenen Bände der Dresdner Zeitschrift Die Kolonne des Berliner Kreises um Peter Huchel, Günter Eich, Horst Lange, Oda Schaefer, Elisabeth Langgässer, aber ebenso die klassische Moderne, Brecht und Benn und was an neuer zeitgenössischer Lyrik dem allzeit Findigen und Fündigen erreichbar ist. Deutlichen Einfluß auf die eigenen Versuche gewinnt zu Beginn der sechziger Jahre vorübergehend der Hamburger Peter Rühmkorf mit der aggressiven Zeitkritik seiner ironisch-sarkastischen, Vulgär- wie Wissenschaftsjargon einbeziehenden Reimverse, ebenso dessen frühverstorbener Freund Werner Riegel.
Die allmähliche Versicherung der eigenen Tradition hat Kirsten, so zeigt sich, nicht in die Enge geführt; Heimatdichtung alten Stils, gar Heimattümelei, sind ihm nie eine Versuchung gewesen. Auch was er an Kunsttradition aus dem engeren Heimatraum in diesen Jahren aufnimmt, steht dem völlig entgegen, die Malerei und Dichtung des Expressionismus in Dresden bis in ihre vergessenen und verschollenen Vertreter, für die eigenen Intentionen wichtiger noch die Dresdner Neue Sachlichkeit mit Otto Dix an der Spitze, schließlich der von ihr herkommende Arbeiter-, später vor allem Bauernmaler Curt Querner (den Kirsten zuerst 1962 durch einen Essay von Hellmuth Heinz, später auch persönlich kennenlernt und bis zu dessen Tod besucht). Als er 1964 seine germanistische Examensarbeit schreibt, wendet er sich keinen sächsischen Dichtern, auch nicht berühmten Namen und Autoritäten, sondern solchen zu, die im Schatten der Großnamigen verblieben; er schreibt über den schwäbischen Klassizismus, über die vergessenen Zeitgenossen Schillers und des jungen Hölderlin.
Das eigene Thema und die eigene Sprache findet Kirsten während der Leipziger Studienjahre nicht schnell und sicher eher schrittweise und auf Umwegen. Die frühesten Verse, die er später, als er den Band satzanfang (1970) zusammenstellt, gelten läßt, stammen von 1961/62. Kurz vorher erst gelang auch die Lösung vom (nie ganz aufgegebenen) Reimstrophengedicht in die freiere Form aus größeren und reimlosen Versgruppen. In Kirstens Verständnis verlangte sie einen sicheren und festen Schluß des Gedichts; auf ihn hin arbeitet er die Gedichte später immer zielbewußter. Auch das ist ein langer Prozeß. Der weltoffene, geistig höchst flexible und vielseitig interessierte Kirsten ist, was die eigene Entwicklung angeht, von eher schwerer und spröder Natur. Was er tut, das tut er langsam und gründlich, bedenkt es umständlich und skeptisch, oft melancholisch. Was er schreibe, ist nie viel und ist immer ,gearbeitet‘, wenn man weiß, was das heißt: in der Sprache arbeiten. Das erinnert an die Steinmetzarbeit seines Vaters. Als er nach einem schwierigen, beinahe abenteuerlichen Jahr in Freiberg (das Lehrerdasein erwies sich ihm als völlig unlebbar) 1965 in Weimar Lektor im Aufbau-Verlag wird, erhält diese Arbeit in und mit der Sprache auch ihre weitausgreifende berufliche Dimension, die er gewissenhaft, fast darf man sagen: besessen ausfüllen wird. Bald betreut er die Reihe der Auswahlbände zur deutschsprachigen Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts und die vielbändige Ausgabe der Gesammelten Werke Johannes R. Bechers, setzt sich besonders für Autoren wie Oskar Maria Graf, Joseph Roth und Ernst Weiß ein und bereichert das Verlagsprogramm, aus der Weite seines Blickfelds und seiner Lektüre und auch in älteren Erbe-Bereichen, durch immer neue Anregungen und Vorschläge.
Mit Beiträgen in fünf Anthologien und mit einem Poesiealbum stellt sich Kirsten in den Jahren 1966 bis 1968 erstmals einem breiteren Publikum vor; da ist er Anfang dreißig. Das Warten, die geduldige Arbeit, Selbstdisziplin und Selbstkritik zahlen sich aus. Er ist sofort als eine völlig neue Stimme innerhalb der Lyrik unseres Landes kenntlich. Aus keinem Vers ist ein direktes Vorbild herauszuhören, weder Huchel noch Kramer noch Brecht und gleich gar nicht Bobrowski, dem er bereits im Sommer 1961 Gedichte vorlegte und der wenige Jahre später für so viele junge Lyriker zum nur allzu deutlich kopierten Vorbild wird. Kein begabter Anfänger, gewiß auch kein Fertiger präsentiert sich da, wohl aber einer, der sich selbst gefunden hat. Was er anderswo lernte, ist ins Eigene eingeschmolzen.
In seinem kleinen Essay „Entwurf einet Landschaft“, der den ersten Gedichtband begleitet, gebraucht Kirsten versteckt eine berühmte Formulierung Herders, wenn er eine auf sinnlich vollkommene Rede abzielende Gegenständlichkeit als möglichen Gewinn von landschaftsgebundener Naturlyrik bezeichnet. In den Kritischen Wäldern (1769) hatte Herder „das Wesen der Poesie“ als „sinnlich vollkommene Rede“ bestimmt. Darauf hatte sich – ohne daß Kirsten dies wissen konnte – schon Bobrowski 1960 in einem Vortrag über moderne Lyrik bezogen. Diese sinnlich vollkommene Rede der Poesie ist für den Jüngeren eine Sache der Gegenstände wie der Sprache.
Die Gegenstände seiner Verse werden desto konkreter und plastischer, je genauer und sicherer Kirsten sein Thema und ineins damit sich selbst findet. Gefunden ist es, als am Ende des Jahres 1964 in sechs großen reimlosen Strophen das Gedicht „die erde bei Meißen“ entsteht. Mit kühnen Strichen wird die Heimatlandschaft in herbstlich-deftiger Vielgestalt und Weite, aber auch in ihrer prallen Gegenwärtigkeit und ansatzweise in ihrer sozialgeschichtlichen Dimension entworfen; die stinkenden rübensilos und die ungeschlachten blechvögel der Agrarflugzeuge gehören ebenso dazu wie die Erinnerung an die gallebittere Zeit der fronde. Mitten darin steht breitspurig, mit großer Sicherheit alles überblickend, das lyrische Ich. Das hat etwas vom Pathos von Bezručs autobiographischen Gedichten. Die eigentlich zungelösende Kraft ging jedoch nicht von Bezruč, sondern von Bobrowski aus, und weniger von seinen Gedichten als von seinem Roman Levins Mühle, der im September 1964 erschien und den Kirsten sofort las. In diesem Roman hatte alles hand und fuss, ich habe meinen Bobrowski und bin im siebten himmel, hieß es im Oktober, inmitten einer beruflich-gesundheitlichen Krise, in einem Brief an Freunde. 1971 schreibt Kirsten rückblickend an H.D. Schäfer:
Huchel faszinierte mich schon lange, schon seit Anfang der fünfziger Jahre. Es mußte aber erst Bobrowski kommen, insbesondere sein Roman Lewins Mühle, um mich freischwimmen zu können.
Die wirklichkeitssatte, der Umgangssprache, der mündlichen Rede des Volks so stark verpflichtete Erzählprosa Bobrowskis gab erst den Mut und die Kraft, die eigene Heimatwelt in all ihren topographisch-landschaftlichen; historischen, sozialen, ökonomischen und sprachlichen Dimensionen als sein Thema im Gedicht anzunehmen und mit poetischer Freiheit und Konsequenz herauszustellen. Daß „die erde bei Meißen“ als unmittelbare Folge der Lektüre von Levins Mühle entstand, betont Kirsten noch heute. Unmittelbar darauf entstanden 1965 weitere thematisch zentrale Gedichte, darunter die „sieben sätze über meine dörfer“, die diese Überschrift erst in der zweiten, jetzt erst entsprechend gegliederten Fassung als geheime Huldigung an Bobrowski erhielten, dessen Roman im Untertitel „34 Sätze übet meinen Großvater“ hieß. So verhilft der Ost- und von weiterer Herkunft Westpreuße Bobrowski im Jahr seines frühen Todes dem sächsischen Kirsten zur lyrischen Darstellung der meißnischen Agrarlandschaft und ihres bäuerlichen Werktags, ohne daß irgendeine Art von Abhängigkeit entsteht. Wo der eine in seinen Versen von einer „Landschaft, die mit allem Recht verloren ist“ (J. B.) auf, traumhaft-visionäre Weise handelt, redet der andere in drastischer Deutlichkeit von der heutigen und ganz gegenwärtig-seinigen Welt.
Dieser bäurische Werk- und Alltag umschließt die kollektive Landwirtschaft und den Einsatz der modernen Technik. Was beide an wirklichem Fortschritt zu leisten vermögen, ist zunächst sichtbarer als die auch möglichen Gefährdungen und Verluste. Das gibt Kirstens Gedichten aus der Mitte der sechziger Jahre einen energischen und optimistischen Grundzug und macht es verständlich, daß einige Male, am deutlichsten in Kyleb, der forcierte Zukunftston Volker Brauns, der 1964/65 erste Gedichte veröffentlicht, als allgemeiner Sprachgestus vernehmbar wird.
Mitten in diese bäurische Gegenwarts- und Heimatwelt stellt Kirsten die eigene Biographie, das eigene Ich als dazugehöriges und mittätiges Subjekt. Aus einem geschlecht von handwerkern / und kleinbauern stammend, das nie aus dem Dunkel seiner Geschichte trat, versteht er sich als armer / karsthänse nachfahr, weiß er sich mit seinen duzbrüdern, / den kutschern und kombinefahrern… ein herz und eine seele. Er steht mitten in dieser Welt und doch ihr auch wieder gegenüber. Er begreift sich als ihr Sohn und zugleich als ihr chronist (die Vokabel findet sich im Schluß der ersten Fassung des Gedichts „landgasthof“). So ist die Zugehörigkeit alles andere als naiv. Wohl begegnet er uns auch ganz unmittelbar als Arbeiter, als mitwerktätig, aber weit häufiger doch als der Wanderer, als Fahrender, von Wegen, Straßen, Chausseen ist oft die Rede. Dieses Wandern ist ein Durchwandern, fast ein Durcharbeiten der Landschaft. Es schließt jedes herkömmliche „Erleben“, jede romantisierende Sicht aus. Nicht das Subjekt, sondern die Welt in der es sich vorfindet, ist Thema und Mittelpunkt von Kirstens Gedichten; das vor allem unterscheidet sie von den manchmal verwandt erscheinenden Gedichten des Landsmannes und späteren Freundes Czechowski. Die Kindheitsgedichte nicht mitgezählt, begegnet das lyrische Ich nur wenige Male noch so kraftvoll und scharf konturiert wie in „der erde bei Meißen“ und in, den „sieben sätzen über meine dörfer“. In der Hälfte der Gedichte des ersten, in zwei Drittel gar der Texte des zweiten Gedichtbandes ist kein Ich, kein Wir ausdrücklich anwesend; das hat als symptomatisch zu gelten. Die eigene Biographie ist vorrangig Mittel zum Zweck; nicht eigentlich sie, sondern die biografien aller sagbaren dinge / eines erdstrichs, das unberühmte leben der leute vom Dorf will der Autor „ans licht bringen“. Deshalb vor allem ist das Gefühl fast überall zurückgenommen, dominieren beschreibende, epische, manchmal gar balladeske Züge (bis hin zur späteren tatsächlichen ballade von den Zipser Rumäniendeutschen), strotzen die Gedichte von Faktenfülle und –dichte. Das strophische Gedicht tritt zurück, der große Versblock breitet sich aus. Erst von dieser chronistischen Grund- und Zurückhaltung, ja Bescheidung des lyrischen Subjekts her erklärt sich auch das Eigentümliche von Kirstens Sprache.
Am Schluß des Titelgedichts „satzanfang“ heißt es von dem unberühmt-gelobten Land: seine rauhe, rissige erde / nehm ich ins wort. Das ist nicht redensartlich oder metaphorisch, sondern wörtlich gemeint. Das genaue, das zutreffende Wort, wie es Kirsten im meißnischen Raum für jedes topographische, bäurisch-landwirtschaftliche und handwerkliche, aber auch allgemeine Lebensdetail sucht und findet, wird zum eigentlichen Sprachfundament des Gedichts. Mit seiner Hilfe vor allem erfüllt er, was Bobrowski 1961 die „Präzisierung der gemeinten Inhalte und der Bilder“ genannt hatte. Vom einzelnen charakteristischen Wort her oder, das ist dasselbe, auf dieses hin wird das Gedicht entworfen und gefügt. Wenn darin so etwas wie ,Erlebnis‘ noch faßbar ist, so zuallererst mittelbar in diesen Worten, die Kirsten „Grundworte“ nennt; es sind Erfahrungen und Erkundungen; die sich in ihnen spiegeln. Daraus hat er im Anfang fast eine ganze Theorie gemacht; das war für sein poetisches Selbstverständnis und Selbstbewußtsein vermutlich wichtiger als für seine Verse. Entscheidend ist die Unvoreingenommenheit, mit der er ältestes bäurisches Vokabular und den Wortschatz modernster Technik und Wissenschaft nebeneinanderstellt, wozu noch allerlei betont umgangssprachliches Wortmaterial kommt. Was aus konventioneller Sicht heterogen erscheint und doch die Kompliziertheit des Lebens von heute auch auf dem Lande bezeichnet, gewinnt in Kirstens Versen eine eigene poetische Qualität, die mit dem, was man ehemals ,schön‘ nannte, nichts mehr zu tun hat. Das führte anfangs öfter zu einer Überfülle des Spezialvokabulars, die aber ästhetisch eher als expressiv-barocke Ballung und Steigerung denn als Zeichen der Unrast oder Nervosität des Suchens zu gelten hat. Ist diese ,barocke‘ Phase im ganzen auch längst zu Gunsten von Gelöstheit überwunden, so ist Kirstens Poesie doch ohne sie nicht zu denken; ein Nachhall bleibt bis heute vernehmbar. Auch bekennt er sich gesprächsweise sehr offen und sehr einfach zu dem Nebenziel, mit solchem Zugriff einen nicht geringen Fundus alter Worte und Wendungen wenigstens an dieser Stelle vor dem gänzlichen Vergessenwerden retten zu wollen.
Darüber hinaus setzt Kirsten freilich in einem noch viel rigoroseren Sinn auf das Wort schlechthin. Das spiegelt sich schon in zahlreichen und ungewöhnlichen wort-Bildungen wider: Wo mitten im Gedicht wortbiegungen, wortfelder, wortfiguren, wortflügel, wortgespenster, wortmassen, worttrost, wortwurzeln stehen, wird damit ein höchst reflektiertes Verhältnis zur Sprache, wird Sprachbewußtsein zuallererst als Wortbewußtsein ausgewiesen. Davon spricht später ausdrücklich der Prosatext „der schreibtisch“, darin Kirsten sich als wortsüchtig erklärt. Dieser gezielte Einsatz des Einzelworts schlägt sich bald in der Häufung einsilbiger Wörter, bald im betonten Gebrauch ungeläufiger Wortkompositionen, mehr noch in der dichten Fügung ungewohnter, von Sachgehalt schwerer Vokabeln, auch im unvermittelt-kraftvollen Einsatz von Orts- und Familiennamen oder von bald anachronistisch-altertümlichen, bald modisch-modernen Fremdwörtern nieder. Er steht in engem Zusammenhang mit dem aufgerauhten, ,körnigen‘, zuweilen schier widerspenstigen, oft auf vertrackte Weise drastischen Duktus und Rhythmus von Kirstens Verssprache überhaupt. Auch ihre nicht selten derbkühne Metaphorik und ihre von Anfang an auffällige, später ständig zunehmende Prosanähe erwachsen daraus. Metrisch wird der Leser vor allem durch den Gebrauch des im deutschen Gedicht nie eigentlich heimisch gewordenen Spondeus, des Versfußes aus zwei betonten Silben, auf das Einzelwort verwiesen. Worte wie plumpsack oder einaug, schreibfleiß oder laubschleier, aber auch der Zusammenprall betonter selbständiger einsilbiger Worte leisten rhythmisch dem im Gedicht üblichen Sprach- wie dann dem Lesefluß erheblichen Widerstand; nicht die lyrische Periode, sondern das einzelne Wort oder die einzelne Wortgruppe . schieben sich in den Vordergrund, In alledem bekundet sich zugleich ,in prinzipielles Mißtrauen gegenüber jeder ,schönen‘ Rede, jedem herkömmlichen Sprachwohllaut. Wo er in seltenen Fällen und mit wenigen Worten doch zugelassen, empfängt er in solcher Umgebung einen neuen Glanz. Wenn Kirsten seit 1978 auch Prosagedichte schreibt, so ist das eine stilistisch-poetische Konsequenz, die zu erwarten war.
So sehr das lyrische Ich selbst zurücktritt oder verbal gar verschwindet, so sehr ist es in der allgemeinen Subjektivität der Verse doch ständig gegenwärtig. Diese äußert sich nicht nur in der schwerlippig-charakteristischen Sprache, im rauhen Rhythmus der Gedichte, sondern erst recht in den syntaktischen Verknappungen und Ellipsen. Die Bevorzugung unvollendeter Sätze, verbloser Aussage- und Bilderketten, eines summierenden Stichwort- und Partizipienstils deuten auf eine Darstellungsweise, die rigorose Verkürzung und Verdichtung anstrebt. Auch das verhindert jede leichte Lektüre und gibt keinen bequemen Realismus ab. Wenn mehrfach inmitten dichter Sachdarstellung Worte wie wirklichkeit oder ähnliche Abstrakta stehen, so ist das nur ein Indiz unter anderen für die Abwesenheit jeder platt-realistischen Tendenz; für das Vorwalten einer eher verfremdenden Distanzhaltung im Schreibprozeß, die auf ästhetische Souveränität gegenüber eben jenen Sachen aus ist, um derentwillen das Gedicht geschrieben wird. Erst diese Distanzhaltung erlaubt Kirsten auch jene grotesken, satirischen und ironischen Formulierungen, einschließlich der hochironischen Zitate, die vollends mithelfen, daß weder der Dichter noch der Leser in der dargestellten Welt sich wohlig einnistet.
„Die erde bei Meißen“ ist der Boden, in dem Kirstens Poesie ihr Fundament hat, von dorther gewinnt sie in stets erneuter Rückkehr bis heute gleichsam antäisch die Kraft und die Sicherheit ihrer Sprache. Das beweist noch der letzte Text dieses Bandes, der ganz in die Gegenwart gehobene abglanz eines Erntetags in der sächsischen Dorfkindheit. Als jedoch die Heimatwelt – primär als Kindheits- und als Arbeitswelt – sozusagen im ersten Durchgang poetisch Gestalt gewonnen hat, dringt Kirsten in den siebziger Jahren von ihr aus in neue Dimensionen vor, die bisher bestenfalls gestreift wurden. Seine Poesie gewinnt an Weite, Tiefe und Aktualität.
Hatte in den sechziger Jahren die Einbeziehung der kollektiven Landwirtschaft, der modernen Agrartechnik, der alten und der neuen Fachsprache in die Lyrik als neu und kühn und als im bisherigen Sinn ,unlyrisch‘ zu gelten, so nun die Rigorosität, mit der im Gedicht auch Schattenseiten der modernen Entwicklung benannt werden. Nur allmählich wurde erkannt, daß die soziale wie die Umweltentwicklung auch im Sozialismus widersprüchlicher verläuft, als Theorie und Elan der ersten Aufbaujahrzehnte nach dem Krieg glauben machten. Es spricht für Kirstens frühe kritische Intentionen, daß er schon 1963, noch vor so optimistischen Versen wie „Kyleb“, die erste Fassung des später „eisgang“ betitelten Gedichts schrieb, damals zunächst als zweiten Teil zu einem später verworfenen „brief aus der provinz“ voll ironischer Tristesse. Als „epilog“ erschienen die Verse ein Jahr später an entlegener Stelle mit drei andern Gedichten im Druck. Dann schob sich die eigentliche Konstituierung des meißnischen Landschaftsthemas machtvoll dazwischen. Bei der Zusammenstellung des ersten Gedichtbandes blieb das Gedicht beiseite, im Gegensatz zu den 1964 ebenfalls publizierten Priesterbäk-Versen. Zehn Jahre nach der ersten Niederschrift nimmt Kirsten das Gedicht wieder vor, kürzt es, komprimiert es, macht es strenger und schlanker, ohne die Konzeption zu verändern. Wohin eine unkontrollierte Entwicklung von Chemie und Technik führt; teilt das Gedicht in schlimmen Befunden mit, die ihre volle poetische Evidenz freilich erst durch die eingangs angedeuteten alten Bilder einer utopisch-unvergänglichen heilen Welt erhalten. Solcher Rückgriff schlägt auch in helleren Versen nie in Verklärung oder Nostalgie um, sondern verbleibt stets im Dienst von Kritik und Mahnung. Wird, wie in dem großen Christian-Wagner-Porträt, ein vergangener unversehrter, dämonisch erfüllter Naturbegriff erinnert, so in engstem Zusammenhang mit der Mühsal des bäuerlichen Werktags und mit dem Ausblick auf die gefährdete Bewohnbarkeit der Erde heute und morgen. Vergangene Größe hilft auch im Schluß des Titelgedichts „der bleibaum“ ein Stück schlimme Gegenwart ins Wort bringen. Wie hier ungenannt Montaigne (geist der gesetze) und Goethe (füllen wieder busch und tal), mit vollem Namen zuletzt Sappho vom Anfang der abendländischen Lyrik zitiert werden, um mit sublimer Ironie die vom Menschen verderbte heutige Natur zu verdeutlichen, das zeigt eine Höhe und eine Kraft des poetischen Zeitbewußseins an, wie sie sich auch in Kirstens Gedichten nur selten findet.
Das andere nicht weniger schmerzliche kritische Thema ist der Untergang des alten Dorfs und die Zerstörung der überkommenen bäurischen Landschaft. Nirgendwann und -wo will Kirsten ins Gewesene zurück, aber er hält schonungslos, sarkastisch, zuletzt zornig fest, was sich vor seinen Augen schier rasant vollzieht und was ein Recht darauf hat, poetisch benannt und festgehalten zu werden. Auch im Sozialismus bleibt der Mensch ein Mensch mit Vergangenheit, Herkunft und Kindheit. Von dorther ist er zu gutem Teile geprägt und in wesentlichen emotionalen Lebenswertungen bestimmt. Wenn das Dorf in seiner durch Jahrhunderte gewachsenen organischen Struktur und Lebensweise schwindet, wenn Territorialplanung und Großraumwirtschaft die Landschaft der Kindheit vernichten und altvertraute Lebensformen auflösen, so sind das schmerzhafte Prozesse, die objektive, auch psychische Verarmungen einschließen. Jeder Fortschritt hat auch seine Verlustseite. Dies ins Bewußtsein zu bringen und gleichzeitig zur Rettung des vielleicht noch Rettbaren beizutragen, gewachsene Landschaft als für den Menschen für alle Zukunft notwendiges Lebensreservat bewußt zu machen, da es die vom Menschen ,unberührte Natur‘ nicht mehr gibt, das ist eine legitime Aufgabe von Dichtung, die wirklich Gegenwartsdichtung ist, nicht anders wie einer Gesellschaft, der es um den Menschen geht. Kirsten findet eindrucksvolle Bilder. Im poetisch gesehen surrealen mahltrichter, der wörtlich genommen selbst in die bäuerliche Welt gehört, verschwinden die alten Dinge, die alten Worte, das Dorf selbst (dorf); der reißwolf des fortschritts verschlingt die Landschaft der eigenen Kindheit, die zugleich die Welt jener ist, die als bodenreformpioniere vor einem Vierteljahrhundert Träger des notwendigen und sinnvollen, des revolutionären Fortschritts auf dem Lande waren (das haus im acker). Was anstelle gewachsener Kultur die weltmaschine (wie das Fernsehen in einer früheren Fassung von „lebensspuren“ heißt) an Lebens- und Kunstsurrogaten vermittelt, das vermag Kirsten nur mit Spott aufzuzählen. Solche Bilder und Verse tragen in ihrer Härte und Offenheit dazu bei, jenes engagierte kritische Gegenwartsbewußtsein zu entwickeln, ohne das menschenmögliche, menschenwürdige Zukunft nicht mehr vorstellbar ist.
Diese rigoroseren Gedichte seit Beginn der siebziger Jahre sind wie selbstverständlich eingebettet in jene Texte, die zum kleineren Teil das meißnische Landschaftsthema ergänzend ausbauen, zum größeren Teil aber geographisch und historisch in die Weite und in die Tiefe führen. Beides gehört von Anfang an zusammen. Auch hier knüpft Kirsten an Vor-Meißnisches an. Die „erinnerung an Priesterbäk“ von 1963 griff ins Mecklenburgische aus und bot ein Stück gewissermaßen nachgelassener Kriegslandschaft, die er vier Jahre zuvor durchwandert hatte und die jahrelang ihm keine ruhe ließ, wie er noch im Oktober 1964 schrieb. Schon da war Landschaft als massive Vergegenständlichung von Geschichte erfahren und gestaltet. Trat das Ineinander von Geschichte und Landschaft in den Gedichten der sechziger Jahre nur im Ansatz und in betont sozialgeschichtlicher Perspektive hervor, so wird es jetzt in seiner Komplexität begriffen. Was bisher vor allem als überwundene, oder überstandene Geschichte erschien, stellt sich nun zunehmend als vergegenwärtigte und verdinglichte Geschichte dar. Darin war Bobrowski mit den geschichtsträchtigen Landschaften seiner sarmatischen Lyrik der unmittelbare, nicht übersehbare Vorgänger. Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der immer weiter ausgreifenden poetischen Landnahme. Während viele von Kirstens Lyrikkollegen in fernste Landschaften ausschweifen, um dort noch schöne oder gar exotische Natur zu finden, erarbeitet, erobert er sich die dem „Meißnischen“ benachbarten Weltgegenden, Lößnitz und Erzgebirge, Lausitz, Halle, Weimar und Thüringen, Böhmen und Mähren, schließlich Rumänien (eine Mittelasienreise bleibt bezeichnenderweise ohne lyrisches Echo), dazu die städtische Existenz.
Das erst jetzt voll ausgebildete Geschichtsbewußtsein äußert sich zunächst im erfaßten Material der Geschichte, das vom Bauernkrieg bis in die Gegenwart reicht. Wenn das Gedicht „abendgang“ am Schluß die blutspur der erhebungen in Halle von 1923 aufgreift, so assoziiert es gleichzeitig eingangs die sächsische Feudalgeschichte als Geschichte des Hauses Wettin, dessen gleichnamige Stammburg unweit von Halle im Saalkreis liegt. Ähnlich wird eine fahrt durch Mähren zugleich eine Fahrt durch seine Geschichte. Auch im Historischen geht es Kirsten um Konkretheit, um genaue Namen, um die unbeschnittene Aufnahme des tatsächlich Gewesenen. Als der dinge totes gedächtnis liegt Geschichte zum Ablesen greifbar in der Landschaft. Wenn er ihre Zeichen liest, geschieht auch das in jener grundsätzlichen Distanzhaltung, die jede Sentimentalisierung, jede Verklärung aus- und die suggestiv-kritische, nicht selten ironische, immer freilich betroffen-nachdenkliche Darstellung einschließt.
Gleichsam die Innenseite dieses Geschichtsbewußiseins ist die Wahrnehmung des Prozesses, der Gegenwart und Vergangenheit verbindet, des Vergehens. Geschichtlichkeit wird vom einzelnen zuallererst als Vergänglichkeit erlebt. So ist Geschichte immer auch mahlgang der geschichte, das unwiderrufliche Hin- und Verschwinden der vom Menschen geschaffenen Dinge, der schlichten wie der bedeutsamen Zeugen seines Daseins und Wirkens. Subjektiv erfährt es der Mensch vor allem als sein Altern. Altern und Vergehen des Menschen und seiner Dinge gehören in Kirstens Gedichten zum vollen Bild einer auf elementare Weise geschichtlich verstandenen Welt. Gelassen, selbstverständlich und mit Würde stehen der alte Mensch und die alten Dinge in seinen Versen. Indem er ihre Vergänglichkeit ins Bewußtsein hebt, macht er auch den Wert ihrer Einmaligkeit bewußt. Das fordert nicht weniger als existentiell den tag ausmessen in aller schönen und schrecklichen Vielfalt des Lebens und heißt eine der ältesten Aufgaben der Dichtung erfüllen, nämlich Gedächtnis zu stiften, den Reichtum des Vergangenen und des ständig Vergehenden für Gegenwart und Zukunft aufzubewahren in geformter Sprache.
Hierher gehören dann auch die Widmungs- und Porträtgedichte Kirstens, die, selber landschaftsgesättigt, die Landschaftsgedichte seit 1965 begleiten und in der hauptsächlich von Bobrowski begründeten, bald sich breit entfaltenden Tradition des Personengedichts sofort einen eigenen Platz einnehmen. Vorwiegend sprechen sie von Dichtern und Künstlern, die ihr Lebenswerk härtesten Bedingungen abrangen oder die tragisch gescheitert sind. Ihnen gilt Kirstens deutliche Sympathie, an ihnen orientiert sich offenbar sein eigenes Lebensverständnis, das – eben weil es so dicht an den Sachen bleibt – von jeher ein tiefernstes, ein verhalten melancholisches war. Trauer schwingt in vielen seiner Gedichte untergründig mit, in den immer weniger lokalisierbaren Abend- und Herbstbildern vornehmlich. Auch jene Texte, in denen es immer entschiedener um Grundsätzlichkeiten des Lebens geht, stehen auf solch verschwiegenem Trauerfundament. Es unsichtbar zu machen, scheint nicht die geringste Aufgabe der derbdrastischen, ironischen und humoristischen Verse zu sein. Die verfremdende Distanzhaltung trägt dazu das Ihre bei. Indem sie zugleich die ästhetische Freiheit inmitten der Faszination durch die Sachen bewirkt und festhält, schafft sie immer neuen Raum für einen sehr eigentümlichen und erweiterten Realismus, der, mit Novalis zu reden, „dem Zentro der Poesie“ nahesteht.
Eberhard Haufe, Nachwort
Worte wie grünende Saaten
„Saataufgang heißt mein satzanfang / die entwürfe in grün überflügeln / meiner wortfelder langsamen wuchs“, heißt es in dem Gedicht „satzanfang“, das auch dem ersten Lyrik-Band von Wulf Kirsten den Titel lieh. Bevor der Band des damals 36jährigen ausgeliefert war, war Kirsten auf der literarischen Bühne bereits als Lyriker bekannt. Der wohlbedachte Titel wie die zitierten Zeilen sprechen nicht für Schüchternheit des Verfassers. Sie sprechen viel eher für zurückhaltende Bewußtheit des Lyrikers. Wulf Kirsten ist ein Leiser unter den Lyrikern des Landes.
Heimat- und Naturthemen nahm er auf, durchglühte und schmiedete sie mit seiner ausdauernden dichterischen Kraft. Für den traditionsbewußten Lyriker war schnell ein Etikett zur Stelle. Kirsten wurde in die Reihe der Landschaftslyriker eingeordnet. Der ist er, und der ist er nicht nur. Das bestätigt die sparsame, das heißt sehr strikte erste Auswahl-Ausgabe der Gedichte. In das von Eberhard Haufe besorgte schmale Reclam-Bändchen die erde bei Meißen wurde Veröffentlichtes und Unveröffentlichtes aus gut zwei Jahrzehnten aufgenommen. Viele Verse könnten die Bezeichnung Dorflyrik vertragen. Nicht aus Städtischem erwachsen die Gedichte.
Der Lyriker kontrolliert nicht nur ständig seine Sicht. Er hält auch seine Sprache in Zucht. Er leistet Widerstand gegen oberflächliche Betrachtungen. Ohne elitär zu werden, hat Kirstens Lyrik, die zur erzählerischen Aufzählung neigt, doch etwas Erwähltes. Die Verse haben oft etwas vom Klang der Kirchenlieder, sind wie gregorianische Gesänge. In diesem Vielklang sind die sekundierenden Stimmen oft wichtiger als die ohnehin unüberhörbaren solistischen. Obwohl einer der Stillen und der Land-Leute, ist der jetzt in Weimar Lebende, in Sachsen Geborene, keiner von den Sanften, die Kanten abschleifen, um zu entschärfen, und Unterschiede zuschütten, um zu egalisieren.
Die nach Entstehungsjahren geordnete Auswahl hat den Vorzug, Vergleiche schnell zuzulassen. Das Titelgedicht „die erde bei Meißen“ ist lyrische Lokal- und Selbstbeschreibung. „Ich auf der erde bei Meißen“. Welche Ausflüge in die „große Welt” sich der Lyriker in den folgenden Jahren auch leistete, er bleibt seinen Entdeckungen im Ländlichen treu. Entscheidend für die Gedichte ist der Geschichtsbezug, den sie mit den Jahren bekamen. Provinz und Privates erhielten in den Poesien Welt- und Weitläufigkeit. Es muß da nicht nur auf ein so schlichtes Gedicht wie „mietshaus am Sonntag“ verwiesen werden. Verse zu Grabbe, Gottfried Silbermann, der Droste, zu Kleist, zu Christian Wagner, zu einem jüdischen Friedhof in Mähren umschreiben geographische, historische Räume.
Beschreibend erschreibt sich Wulf Kirsten das Schöne. Mit den Gedichten von Wulf Kirsten ist eine Lyriksammlung vorhanden, die nicht ständig von den Stützpfeilern spricht. Die Gedichte lenken die Blicke auch auf die vielen Querbalken, die das Lebensgebäude tatsächlich erst ausmachen.
Bernd Heimberger, Neue Zeit, 6.4.1987
Ein Sprach-Arbeiter
– Worte für Wulf Kirsten. –
Meine Laudatio auf den diesjährigen Preisträger des Fedor-Malchow-Lyrikpreises möchte ich mit Bemerkungen zu einem Thema beginnen, das, wie ich meine, immer stärker zu einem solchen Nachdenken über Lyrik gehört: das Überleben der Lyrik. Mike Hamburger, der vorzügliche Übersetzer der Lyrik Hölderlins und Celans ins Englische, der Lyriker und literarische Essayist, der Freund und Übersetzer von Johannes Bobrowski und Peter Huchel, hat einen Band mit Aufsätzen so überschrieben und sieht die Lyrik heute, in der zweiten, der elektronischen Industrierevolution, wie er sagt, nicht mehr wie in früheren Jahrhunderten bedroht durch das Analphabetentum, sondern im Gegenteil bedroht durch die Herausbildung einer Lesefähigkeit, die alles Geschriebene gleichermaßen nur noch unter Informationsgesichtspunkten auszuwerten vermag. Hamburger unterscheidet da zwischen der Literatur als Medium der Kommunikation, als Teil der Informationsindustrie und darin auch funktionierend – und der Lyrik, der Poesie, die ihrer Natur nach nie Teil der Informationsindustrie gewesen sei. Er zitiert den spanischen Lyriker Ramón Jiménez, der geschrieben hat: „Literatur ist Stand der Kultur, Dichtung ein Stand der Gnade, vor und nach aller Kultur.“ Wenn da auch Verklärung aufscheint – Jiménez’ Landsmann und literarischer Zeitgenosse García Lorca sah die Sache nüchterner, er sprach vom Zustand der Eingebung als einem Zustand der Sammlung –, so folge ich doch dem Gedankengang Hamburgers, denn er zielt auf jenen entscheidenden Bestandteil von Dichtung, der über Zeit und Ort hinausweist. Und er zielt weiter auf das Primat einer Sprache, die ihre Macht, ihre Kraft und Prägnanz wahrt, auch dann noch, wie Hamburger schreibt, „wenn viele der von ihr aufgenommenen Materialien nicht mehr Gemeingut irgendeines historisch bedingten Publikums sind“. Das ist unser Thema und verweist auch auf die Lyrik Kirstens. Vielleicht darf man mit Blick auf den Preisträger modifizieren: Grade auch dort, wo Sprache das Gemeingut des historisch bedingten Publikums sprengt, kann sie zu einer besonderen Intensität finden. Hamburger setzt die so definierte Dichtung gegen den Lärm der Literatur im Zeitalter der elektronischen Medien. In diesem Lärm einer literarischen Produktion für den Augenblick, die den Marktgesetzen gehorcht, kaum auf den Markt geworfen, schnell wieder vergessen und verschwunden ist, muß die Zeitlosigkeit von Dichtung, von Poesie wie ein Anachronismus erscheinen. Andererseits liegt in der Zeitlosigkeit auch ihr utopischer Bestand, sie verweist sozusagen in eine andere Dimension – und Hamburger setzt seine Hoffnung darein, daß die Automatisierung der Industrie mit ihren inhumanen Folgen und der Überdruß an der Totalvernetzung Kräfte freisetzt, die die Menschen wieder zur Dichtung zurückführen, weil Lyrik ein Bedürfnis befriedigt, das keine andere Sprache zu befriedigen vermag.
Ich bin da skeptischer. Wer z.B. die zurückgefahrenen Etats der Bibliotheken, des Deutschen Literaturfonds in Darmstadt und generell der Autorenförderung sieht, den Trend zur Kommerzialisierung und zur bloßen Unterhaltung an den Theatern, wer im Medium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hautnah erleben kann, wie dieser besonderen, ausschließlich informationsorientierten Lesefähigkeit nicht etwa entgegengearbeitet, sondern auch noch nachgegeben wird – wer miterlebt, wie das Fernsehen sich des kleinen Fernsehspiels und anderer literarisch anspruchsvoller dramatisch-theatralischer Ins-Bild-Setzungen entledigt, wer mitverfolgt, wie in den großen Verlagen immer öfter Lyrik zugunsten des Romans, der Novelle vor allem, auf die lange Bank geschoben oder ganz aus dem Programm genommen wird und welchen geringen Stellenwert Lyrik und ihre kritische Würdigung in den Zeitungen erfährt, der kommt nicht umhin, sich über das Überleben der Lyrik Gedanken zu machen, ohne daß daraus schon ein genereller Kulturpessimismus erwachsen müßte. Natürlich wird es Lyrik auch weiterhin geben – das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob sie in ihrem utopischen Gehalt auf Dauer weiterhin noch erkannt, noch gelesen werden kann.
Auf der anderen Seite gibt es bei der öffentlichen Hand und, wie man sieht, auch bei privaten Stiftern nach wie vor die Einsicht, daß hier ein Feld ist, das es zu bestellen gilt. Dies ermöglicht uns, daß wir mit Wulf Kirsten einen Schriftsteller auszeichnen dürfen, der in der Naturlyrik seinen so traditionsorientierten wie eigenständigen Ton gefunden hat.
Erste Schreibversuche Kirstens reichen bis ins Jahr 1954 zurück. 1955 begann ein Briefwechsel mit Oskar Maria Graf im New Yorker Exil, dem literarischen Rebellen und volksverbundenen Chronisten des bäuerlichen Lebens. 1961 begegnete Kirsten auf der Leipziger Buchmesse erstmalig Johannes Bobrowski, der damals noch vier Jahre zu leben hatte – „Huchel faszinierte mich schon lange, schon seit Anfang der fünfziger Jahre“, berichtete Kirsten später, „es mußte aber erst Bobrowski kommen, insbesondere sein Roman Levins Mühle, um mich freischwimmen zu können“. Eberhard Haufe hat in seinem grundlegenden Nachwort zu Kirstens Gedichtband Die erde bei Meißen darauf hingewiesen: Es war die wirklichkeitssatte, mündliche Rede des Volkes in Bobrowskis Roman, die Kirstens Weg in die Lyrik ganz entscheidend mitgeprägt hat. 1964 brachte er seine ersten Gedichte an die Öffentlichkeit. Ein erster eigenständiger Gedichtband erschien 1970 im Aufbau-Verlag unter dem Titel satzanfang. Das Titelgedicht sei seines programmatischen Inhalts wegen zitiert, es stammt aus dem Jahr 1967.
SATZANFANG
den winterschlaf abtun und
die wunschsätze verwandeln!
saataufgang heißt mein satzanfang.
die entwürfe in grün überflügeln
meiner wortfelder langsamen wuchs.
im überschwang sich erkühnen
zu trigonometrischer interpunktion!
ans licht bringen
die biografien aller sagbaren dinge
eines erdstrichs zwischenein.
inständig benennen: die leute vom dorf,
ihre ausdauer, ihre werktagsgeduld.
aus wortfiguren standbilder setzen
einer dynastie von feldbestellern
ohne resonanznamen.
den redefluß hinab im widerschein
die hafergelben flanken
meines gelobten lands.
seine rauhe, rissige erde
nehm ich ins wort.
Hier formuliert ein lyrisches Ich ein Arbeitsprogramm: den Versuch, Natur und Sprache wenigstens ansatzweise zur Deckung zu bringen: Saataufgang – Satzanfang. Grenzen zu setzen und alles, was in diesen Grenzen ans Licht zu bringen ist, auch in den Tiefen der Geschichte und der Mythen auszuloten. Zu benennen, zu Standbildern zu verdichten – die Leute und ihr Tun im Dorf. Gegen den Redefluß Worte finden für die rauhe, rissige Erde, den harschen Boden unter den Füßen der eigenen Biografie. Hier öffnet sich das Naturgedicht zum Landschaftsgedicht, versucht sich die Sprache ihrem Gegenstand so dicht wie möglich anzuschmiegen, wird Realität abgesteckt – und der Versuch unternommen zu sich selbst zu kommen.
Elf Jahre vor der Entstehung dieses Gedichtes „satzanfang“ hat sich Günter Eich auf einem Schriftstellertreffen über Literatur und Wirklichkeit geäußert, nicht in Form eines Gedichtes, sondern in einer Rede. Bis ins Vokabular erkennen wir ein ähnliches, fast gleiches Wollen:
Ich schreibe Gedichte
sagte Eich,
um mich in der Wirklichkeit zu orientieren. Ich betrachte sie als trigonometrische Punkte oder als Bojen, die in einer unbekannten Fläche den Kurs markieren. Erst durch das Schreiben erlangen für mich die Dinge Wirklichkeit. Sie ist nicht meine Voraussetzung, sondern mein Ziel. Ich muß sie erst herstellen. Ich bin Schriftsteller, das ist nicht nur ein Beruf, sondern die Entscheidung, die Welt als Sprache zu sehen. Als die eigentliche Sprache erscheint mir die, in der das Wort und das Ding zusammenfallen. Aus dieser Sprache, die sich rings um uns befindet, zugleich aber nicht vorhanden ist, gilt es zu übersetzen. Wir übersetzen, ohne den Urtext zu haben. Die gelungenste Übersetzung kommt ihm am nächsten und erreicht den höchsten Grad von Wirklichkeit. Ich muß gestehen, daß ich in diesem Übersetzen noch nicht weit fortgeschritten bin. Ich bin über das Dingwort noch nicht hinaus. Ich befinde mich in der Lage eines Kindes, das Baum, Mond, Berg sagt und sich so orientiert.
Eich und Kirsten – das ist von der Wortsammel-Leidenschaft bis in den bewußt eckigen Satzbau eine Nachbarschaft mit einer Traditionslinie, die sich bis in den Expressionismus, bis zu Trakl, Heym oder dem jungen Benn verlängern läßt. Bis in Kirstens letzten Gedichtband Stimmenschotter vermeine ich Anklänge an Eich zu hören. Da, wo Kirsten Sprachklischees und ideologisch aufgeladene Versatzstücke zu zeitkritischer, lyrischer Prosa reiht, in den Texten „muttersprache“ und „zuspruch“, wird man unwillkürlich an Eichs späte Kurzprosa „Maulwürfe“ erinnert – ohne daß davon Kirstens Eigenständigkeit berührt wäre.
Günter Eichs Satz „Ich schreibe Gedichte, um mich in der Wirklichkeit zu orientieren“ spiegelt sich in Wulf Kirstens Satz „Sein Thema finden heißt, zu sich selbst finden“. Beide Sätze zeugen von der kommunikativen Funktion des Gedichts, das bei Kirsten nicht als Informationsträger im Sinne Hamburgers Definition von Literatur gedacht ist, sondern als artifizieller Ausdruck einer Auseinandersetzung des lyrischen Ichs mit der Zeit, als Ausdruck eines Widerspruchs, den der Autor, der Dichter in erster Linie mit sich selbst austrägt. Bobrowski machte daraus eine Absage ans Publikum:
Gedichte gehen nicht aufs Publikum, sie sind als Selbstaussagen auch durchaus privater Natur. Die Teilnahme anderer ist Zufall, Glücksfall oder Irrtum. Im Grunde gehen sie nur den Erzeuger selbst an.
Dem würde Kirsten sicher widersprechen. Reine Poesie sind seine Gedichte, wie ja auch die von Bobrowski, nicht. Sie enthalten einen spürbaren moralischen Impuls, weisen Kirsten als einen politischen Autor aus, der Schönheit mit dem Anspruch nach Wahrheit verbindet, hierin neben Eich auch dem 1980 verstorbenen Erzähler und Lyriker Wolfgang Weyrauch nahe, der seine Gedichte verstand als seinen Versuch einer Auflehnung gegen die Entmenschlichung des Menschen durch den Menschen. Kirsten argumentiert ähnlich, aber lakonisch nüchtern. In seinem Essay „Entwurf einer Landschaft“, der den Band satzanfang beschließt, lesen wir:
Wichtig ist, daß aus der Sprache, wie immer sie zusammengesetzt sein mag, die Wirklichkeit hervorgeht. Sie wird nachgezeichnet in dem guten Glauben, ich könnte Einfluß nehmen auf mich und vielleicht auch auf andere. Die Landschaft steht pars pro toto für eine Welt, in der die Lebensbedingungen auf die Erhaltung der menschlichen Existenz angelegt sind.
Was ist das für eine Landschaft, von der hier die Rede ist? Wulf Kirsten wurde am 21. Juni 1934 als Sohn eines Steinmetzen im sächsischen Klipphausen geboren. Hier, in den linkselbischen Tälern zwischen Dresden und Meißen, ist der zentrale Ort seiner poetischen Provinz. Später, nach einem Studium in Leipzig, wo er auch am Wörterbuch der obersächsischen Mundarten mitgearbeitet hat und Student bei Hans Mayer im legendären Hörsaal 40 war, kam eine zweite hinzu: Kirsten zog 1966 ins thüringische Weimar um, wo er in der Dependance des Berliner Aufbau-Verlags Lektor wurde und sich auf die deutsche Literatur des frühen 20. Jahrhunderts spezialisierte. Weimar, Leipzig, Dresden – über die Lausitz nach Böhmen und Mähren, das ist die Region, in der Kirsten seine lyrischen Landschaften ansiedelt. Die Enge seiner Herkunft konterkarierte er mit seiner Neigung, den Dingen auf den Grund zu gehen, einer besonderen Sensibilität für Sprach-Nuancen und einem enzyklopädischen Literatur-Wissen, das hier und da auch in lyrischen Dichterporträts, z.B. über Kleist, Grabbe, van Hoddis, die Droste oder Marieluise Kaschnitz, ihren Ausdruck findet. Kirstens Lyrik ist auch Literatur aus Literatur, der Bogen der ihm Nahen reicht von Klopstock über Stifter, Storm, Raabe, Büchner bis zu den Impressionisten Otto Altenkirch oder Peter Hille, bis zu Hermann Lenz, zum Leipziger Freund aus den Studienjahren Heinz Czechowski, bis zu Georg Maurer oder Adolf Endler und ist damit nur sehr pauschal beschrieben. Sich im Sumpf des Bitterfelder Weges zu verlaufen, diese Gefahr bestand für Kirsten schon von seinem Literaturverständnis her nicht. Zwar wurde er in der DDR mit dem Johannes-R.-Becher-Preis und kurz vor der Wende mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet, dennoch blieb er im östlichen Teil Deutschlands das, was er auch im wiedervereinigten Deutschland ist: ein Außenseiter im Literaturbetrieb, ein Sprach-Arbeiter, ein Handwerker im Sinne Celans – „nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte“. Solche Gedichte laufen allerdings Gefahr, die von Mike Hamburger eingangs apostrophierte Lesefähigkeit des Publikums zu überfordern, sie finden nicht leicht ihr Publikum, obwohl sie doch genau das erreichen, was Hamburger beschreibt: eine besondere Lust des Lesers am Text. Wenn er sich denn erst darauf einlassen mag.
Kirsten zitiert Fontanes Satz „Man sieht nur, was man weiß“, um anzudeuten, unter welcher Voraussetzung er sich seine Welt als die Welt anzuverwandeln und auf jene Distanz zu rücken vermochte, die erst sichtbar macht. Dieses „Man sieht nur, was man weiß“ gilt für beide Horizonte von Kirstens lyrischer Provinz, den geistigen und den landschaftlichen. „Weil alle Erlebnisse an ein bestimmtes Stück Welt gebunden sind, wobei das Geographische nur als Modellfall gedacht ist“, heißt es im programmatischen Essay „Entwurf einer Landschaft“, „bot sich gerade jene bäurische Landschaft, aus der ich komme und die ich kenne, als Hintergrund für das Weltbild an. Von diesem überschaubaren Segment Welt fand ich Zugang zu meiner Zeit. Weil ich ein Teil dieser Zeit und Wirklichkeit geworden war, konnte sie zur eignen Sache werden. Sich selbst ausforschen heißt dann auch, die Landschaft ins lyrische Ich einbeziehen, indem historische, soziale, ökonomische, topographische und biographische Details miteinander in Beziehung gesetzt werden, und zwar so, daß Abläufe in Zeit und Raum erkennbar sind.“
Obwohl im lyrischen Werk Kirstens eine Entwicklung zu komplexeren Wortfeldern abzulesen ist, steht es thematisch doch weitgehend geschlossen da. Deshalb ist es erlaubt, seine Lyrik pauschal zu charakterisieren. Über den Gedichten könnte der Satz Christa Wolfs stehen: Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Denn Kirsten weiß Worte zu setzen, die deshalb unmittelbar Bild werden, weil sie die Aura der Vergangenheit in die Gegenwart holen oder als Wortschöpfung der Gegenwart gleichwohl vollgesogen sind mit Vergangenheit. Immer steht Kirsten mit beiden Beinen auf dem Boden einer Naturlandschaft, die zugleich auch historische Landschaft und Kulturlandschaft ist, der Boden ist getränkt mit dem Blut der Kriege aus Jahrhunderten, der Raubbau an der Natur ist allgegenwärtig – und doch bleiben die Verse wie im Selbstgespräch nach innen gewendet, gleichsam am Boden der Existenz, vermeiden jedes Pathos, jede Schwere durch Bedeutung, jede aufgeregte Emotionalität. Bis in die Zwischentitel, die Kirstens Gedichte ordnen, ist man mit nüchterner, akribischer Genauigkeit konfrontiert: in dem Band satzanfang lauten sie „herkunft“, „porträts“, „wege“, „blickfelder“. Und in dem Band die erde bei Meißen in der westdeutschen Ausgabe, die 1987 bei Suhrkamp erschien und Kirsten in der Bundesrepublik erstmalig einer größeren Leserschaft bekannt machte, „welt unmittelbar“, „unterwegs„, „schattenlage“, „lebenspläne“ und „herkunft“, Diese Lakonik setzt sich in den Gedichten fort, die durch eine verhaltene Melancholie grundiert sind. Eine große Ernsthaftigkeit ist spürbar, die im Band Stimmenschotter um eine vorsichtige Ironie erweitert wird.
Wer den Humoristen Wulf Kirsten kennenlernen will, dem empfehle ich seine Prosa, den in seiner Beschreibungswut eines Gemetzels absurden Bericht von der Schlacht bei Kesselsdorf 1745 und das satirische Kleinstadtbild Kleewunsch. Auch hier tut sich hinter dem Witz die Katastrophe, der Abgrund auf.
In Stimmenschotter finden wir die Themen wieder, die ich angesprochen habe. Wieder haben wir sechs thematische Abschnitte, die hier aber nur mit Zahlen gekennzeichnet sind. Es geht um Erinnerung und Herkunft, um den Stimmenschotter der Ideologie- und Sprach-Maschinen, es geht um das Gestern im Heute, um Ausblicke, um die zu traumatischen Nachtlandschaften verkommene Natur und um literarische Porträts. Wulf Kirsten, sagte ich eingangs, hat seinen so traditionsorientierten wie eigenständigen Ton gefunden. Es ist ein hart, konzentriert und konsequent erarbeiteter Ton jenseits aller Moden, der im Laufe der Jahrzehnte seines Klingens immer klarer und schwereloser wird, sich in bestimmten, besonderen Momenten gleichsam wie auf Flügeln davonmacht und ein Eigenleben entfaltet. Stimmenschotter ist in meinen Augen der Gedichtband Kirstens, aus dem uns die meisten und intensivsten Töne anfliegen. Wie formulierte es Celan?
Es gehört zum Wesen des Gedichts, daß es die Mitwisserschaft dessen, der es hervorbringt, nur solange duldet, als es braucht, um zu entstehen.
Und an anderer Stelle:
Wir leben unter finsteren Himmeln – und – es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte.
Wulf Kirsten verdanken wir einige der besten.
Wend Kässens, neue deutsche literatur, Heft 498, November/Dezember 1994
Annäherung an Wulf Kirsten
– Laudatio zur Verleihung des Heinrich-Mann-Preises an Wulf Kirsten, gehalten am 18. April 1989 in der Akademie der Künste der DDR. –
Heute und hier, in dieser Akademie und in dieser Stadt Berlin, die uns beiden, Wulf Kirsten und mir, wohl immer fremd bleiben wird, heute und hier also habe ich den Auftrag und die Freude, über Gedichte und Prosa zu reden, die mein Freund verfaßt hat und für die ihm heute der Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik verliehen wird.
Man will es nicht wahrhaben: Neunzehn Jahre sind vergangen, seitdem 1970 der erste Gedichtband des damals Fünfunddreißigjährigen erschien. Gedichte, die sogleich auf sich aufmerksam machten durch den Wortsinn ihres Autors und die besondere, durch Kirstens Texte verfremdete Sicht auf eine vertraute-unvertraute Landschaft, die erde bei meißen.
Irgend etwas hatten diese Gedichte mit Ansichtskarten gemeinsam, mit Ansichtskarten, die – bleiben wir im Bilde – zwei Seiten haben: die eine das Bild vorweisend, die andere den Text, die aber beide etwas Gemeinsames aufweisen, nämlich die Übermittlung einer Information durch Text und Bild. Der Text, die Sprache also, ist für Kirsten das Medium, durch das er in jenen Bereich des Vergessens eindringt, den man Kindheit, Jugend oder Vergangenheit und Geschichte nennt und den es transparent zu machen gilt. Das Erscheinen des Bildes aus dem Dunkel des Erinnerns erhellt uns in Wulf Kirstens Gedichten eine Welt, die vergangen ist, deren Gegenwart jedoch mit dem Mittel der Beschwörung durch Sprache aufgerufen wird.
Doch woher nehmen wir die Gewißheit, es handele sich bei einem Gebilde, das wir Text nennen, auch um Dichtung? Und woher die andere, das Bild entspräche der Wirklichkeit, die es abzubilden vorgibt?
Sicher ist: Wie wohl kaum ein anderer Lyriker seiner Generation hat Wulf Kirsten von bildender Kunst profitiert. Seine Wahlverwandtschaft zu Curt Querner ist keine Pose. Die Sachlichkeit der Dresdner Veristen um Otto Dix, zu denen auch Querner gehört, haben ihn, Kirsten, den Nachgeborenen, der 1934 in Klipphausen, einem Dorf halbwegs zwischen Dresden und Meißen gelegen, das Licht der Welt erblickte, gelehrt, die Dinge beim Wort zu nehmen:
Wie das Gedicht auf Grundworten ruht, so wird es auch von der Lexik her gebaut. Im Wort selbst liegt der Anfang der Poesie, nur darf es nicht bei sinnarmen Konstellationen bleiben. In die Gedichte geht (je nach Gegenstand) Wortgut aus dem bäurischen Lebensbereich ein, das nur so weit regional eingefärbt ist, als es sich mühelos in die Hochsprache nehmen läßt. Gerade aus dieser vom ,Saft des Populären genährten‘ Zwischenschicht profitiert die Sprache. Sie gibt der sprachlichen Gestalt das Kolorit. Insgesamt ist dieser Bereich aber nur eine sprachliche Quelle neben anderen. Wichtig ist, daß aus der Sprache, wie immer sie auch zusammengesetzt sein mag, die Wirklichkeit hervorgeht.
Die Worterklärungen am Schluß des Bandes verwiesen ebenso auf das Besondere von Kirstens Gedichten, die nicht ohne die Wörter: mondwölfe, pferdefluid, zanken, balkenfahrt, lehde, zille, schlempe oder hungerkorn auskamen und auskommen wollten. Kirstens Gedichte sind Texte eines Wortsuchers, Wortsammlers, ja eines Wortsüchtigen, wie ihn ein Kritiker wohl nicht zu Unrecht genannt hat. Was naturnahe Landschaftsdichtung heute noch vermag, hat Kirsten in den sozialen Rahmen gebracht, der seine Herkunft, sein Werden, seine Gegenwart umfaßt.
Kaum vereinbar scheint mir, was Kirsten, der auch nicht mehr zu den ganz Jungen unter uns gezählt werden kann, für sich zu vereinbaren vermag: Familienleben, Brotarbeit, das stunden- oder gar tagelange Erwandern seiner Landschaften in Sachsen, Thüringen oder in den Karpaten, Lektoratstätigkeit, Herausgeber, Berater jüngerer Lyriker, und vor allem sein kaum unterbrochenes Schreiben von Gedichten und Prosatexten über alle Jahre hinweg.
In einem Kreis Eingeweihter scheint es heute fast schon eine Blasphemie, Wulf Kirstens inzwischen berühmt gewordenen Satz „Sein Thema finden heißt zu sich selbst finden“ noch einmal zu zitieren. Doch denke ich ihn mir noch nach wie vor am Platz, wenn ich mich an jene Stunden erinnere, in denen ich seine Gedichte und Prosastücke noch einmal gelesen habe, um hier über sein bisheriges Werk zu sprechen. Innerhalb unserer Literatur, die ja an voluminösen Werken nicht arm ist, nehmen sich die Druckseiten, die uns Kirsten bisher überliefert hat, vergleichsweise bescheiden aus: drei Gedichtbände, ein Band Prosa, Verstreutes, wozu jene Stücke gehören, in denen er sich über seine Kindheit Rechenschaft gibt, entschlüsseln jedoch bei aufmerksamer Lektüre die Methode eines Schreibens, das auf Erfahrungen basiert, in denen sich der Dichter vor seine Zeit stellt und damit ein wenig von jener Arbeit leistet, in der, im Sinne Heinrich Manns, auch ein Zeitalter besichtigt wird, oder, um an ein Wort Wulf Kirstens zu erinnern, wenigstens das Segment eines Zeitalters. Denn Kirstens Werk beschreibt nicht zuletzt das Heraustreten einer poetischen Gestalt aus dem Bannkreis von dörflicher Kindheit und Jugend, indem diese Gestalt im Umgang mit ihrer Sprache jene Freiheit gewinnt, die auch von den historischen Erfahrungen vorausgegangener Generationen profitiert.
Ein Rückblick von dem, was Kirsten in den letzten Jahren geschrieben hat, auf seine Anfänge macht sehr schnell deutlich, was ich meine. Er, der es nicht eilig hatte, an die Öffentlichkeit zu treten, scheint von Anfang an gewußt zu haben, was er sich und seinen Lesern schuldig ist, wenn er damit begann, das ihm Vertraute aus jener Distanz zu beschreiben, die nötig ist, um zu gültigen und damit zu beständigen Texten zu gelangen.
Dabei stellen sich Lesarten ein, die scheinbar Entlegenes mit höchst Gegenwärtigem in Verbindung setzen, wie in Mickels Gedicht „Inferno XXXIV. Für Kirsten“, in dem in meiner Lesart, ganz im Gegensatz zu der von Rainer Kirsch, der Sachse Kirsten in einem Kontext erscheint, der ihn, Kirsten, keinesfalls zum Klageweib einer Miserabilität erniedrigt, die, nimmt man es schon genau, nicht auf Weimar begrenzt ist, wo Kirsten lebt und sein Brot verdient. Nein, Kirsten, der sich seinen genauen Blick auf Einzelheiten von Landschaft, Natur und Gesellschaft nicht durch Versuche trüben läßt, die ihn zum Statthalter der schönen Dorfnamen verkleinern wollen, öffnet uns – darin der Sarah Kirsch nicht unverwandt – den Blick auf seine Region, die mitunter zwar im Verborgenen blüht, sich aber zum Allgemeinen geweitet hat. Heute, da Kirsten, gedruckt, gerühmt und geehrt, vorweisen kann, was einer seiner Laudatoren als „unter lebensgeschichtlichen Bedingungen“ entstanden bezeichnet hat, erweisen sich seine Gedichte und Prosatexte als unverwechselbar. Dieses Unverwechselbare – man sollte es vielleicht genauer als das „Eigentliche“ bezeichnen – rührt aber, so sehe ich es heute, nicht nur aus Kirstens regionaler Bindung, die er sich bis heute erhalten hat, sondern vor allem aus seiner Insistenz, selber unverwechselbar zu sein. Wer Kirsten kennt, wird bestätigen, daß seine Kantigkeit, sein unkonziliantes Wesen seiner Art zu schreiben entsprechen. Berufe ich mich auf Texte, die er in den letzten beiden Jahren geschrieben hat und über die noch zu reden sein wird, so erkenne ich einen zunehmend unwirscheren Umgang mit seinen Themen und Gegenständen. Gegen den Strich zu schreiben war Kirstens Absicht von jeher. Doch nicht, daß Kirsten mit dieser Absicht bewußt angetreten wäre. Das Genuine scheint mir eher in einer gänzlich unliterarischen Absicht zu liegen, etwas in Poesie verwandeln zu wollen, das sich bisher der Literatur unseres Landes entzogen hatte. Gewiß, Kirsten war ein belesener Mann, als er zu schreiben begann. Aber schon die ersten Verse, die er publizierte, waren, auch wenn sie sich noch am Ton Volker Brauns orientierten, gegen den Duktus dieses Autors geschrieben. Insofern nämlich, als das „Kyleb, / he, du mein dorf dort“ zwar an Brauns frühe Attitüde erinnerte, jedoch die Evokation der Provinz, die Braun völlig fehlte, in den Vordergrund stellte, um zum eigenen Thema zu gelangen. Auch Bobrowski, der Kirsten nach eigener Aussage die Zunge löste, wurde von ihm nicht in epigonaler Weise bewältigt, sondern von seinem Wesen her aufgearbeitet.
Mich beeindruckte neulich ein Satz in einem Essay über eine bekannte Lyrikerin, daß „ohne sportive, aus dem Innersten angespornte Arbeitshärte… heute auf die Dauer kein Preis zu gewinnen sei“. (Hugo Dittberner). Auf Kirsten trifft zu, daß er seinen bis zur Sparsamkeit reichenden Umgang mit den Wörtern systematisch trainiert hat. Was Kirstens Gedichte kennzeichnet, ist unter anderem die Tatsache, daß sich hier ein Dichter nicht nur auf die alltägliche Subjektivität seiner Erlebnisse verläßt, sondern mit seinem Material ökonomischen Umgang pflegt. Was seine Gedichte schon ohne weiteres ausweisen – Kirstens Prosa „Die Schlacht bei Kesselsdorf“ bestätigt seine Zugehörigkeit zu den professionellen Schriftstellern. Hier ist – fast im Gegensinn zu dem anderen größeren Prosastück „Kleewunsch“ –, etwas gelungen, das, jede Durchmischung von Historie und Satire vermeidend, zu einer Konfession geraten ist, die jene dort beschriebene sinnlose Schlacht zu einem Antikriegsbild werden läßt, das die Sinnlosigkeit jeglichen Krieges noch einmal vergegenwärtigt. Darüber wäre von unserem Standpunkt aus nicht weiter zu reden, handelte es sich dabei nicht um ein Stück Literatur, dessen dichterische Intensität mit einer historiographischen Exaktheit in Verbindung steht, die an bedeutende Geschichtsschreiber erinnert. Kirsten – und das kennzeichnet seine Methode, ja seine Poetologie – hat das Schlachtfeld um Kesselsdorf mehrfach abgeschritten, sich so aller Einzelheiten vergewissernd, die er in seinen Quellen entdeckte. Indem er dabei sein Ziel, den Prosatext, nie aus dem Auge verlor, schuf er sich eine Basis, die es ihm erlaubte, mit den Details souverän umzugehen. Von Haus aus kein Aufklärer, schreibt er doch gegen das allgemeine Bild von Leben und Geschichte an, indem er das Konkrete aus dem Vergessen hebt:
In vier Marschsäulen wälzt sich der unübersehbare Strom der preußischen Armee, vom Fürsten von Anhalt befehligt, zu Fuß und zu Pferde über die vereisten und verharschten Wege auf den Elbhöhen, die sich von Dorf zu Dorf winden, eines abgelegener als das andere. Tiefes Hinterland im Winterschlaf. Von den elendesten Knochen- und Achsenbrechern geädert. Die Radgeleise tief ausgefahren, die Gefälle ausgewaschen. Viele Brücken und Brückchen so heruntergekommen, daß jedem ein Stoßseufzer der Erleichterung entfährt, der sie heil passiert hat. Hätte nicht der Frost für einen festen Grund gesorgt, wäre überhaupt kein Durchkommen. Es bleibt auch so noch anstrengend genug, auf den Unebenheiten des gefrorenen Schlammes zügig auszuschreiten. Knirschend splittert, unter den Hufen das Eis, das die mit Lehmbrühe gefüllten Schlaglöcher bedeckt. Der Winter hat der Landschaft eine dünne Schneedecke übergeworfen.
Es ist natürlich kein Zufall, sondern eine den geschichtlichen Tatsachen geschuldete Wahrheit, daß diese Schlachtbeschreibung mit einem Winterbild anfängt. Dennoch: Winterbilder sind in Kirstens Lyrik und Prosa auffällig, häufig. Das Prosastück „Winterfreuden“ schließt:
Zwei Jungen laufen auf der Kleinen Triebisch. Der kurvenreiche Eisweg durch verschneite Wiesen scheint niemals zu enden. Zwei immer kleiner werdende Punkte, die in einem Raum von grenzenloser Tiefe verschwinden. Der Erinnerung kommt es so vor, als habe an jenem Dezembertag im letzten Kriegswinter die Zeit den Atem angehalten für zwei Zehnjährige. Einer von beiden muß ich gewesen sein.
Seine bereits erwähnte Wahlverwandtschaft zu dem Maler Curt Querner, dessen Winterlandschaften mir bei der Lektüre von Kirstens entsprechenden Texten vor Augen stehen, hat er in dem Gedicht „märzlandschaft“ Ausdruck gegeben:
schneeflecke. die wiesen vom maulwurf
aufgeritten; umbrochen das jahr,
und eine stimme springt auf den hügeln
vom februar in den märz.
In dem Gedicht „eisgang“ findet er aber das Bild, das sich zur Metapher weitet, die Kindheit, Jugend, Vergangenheit und Gegenwart in sich einschließt:
eine stimme rudert über den fluß:
fährmann, hol über!
der schweiger beugt sich ins dunkel.
ertrinkende stille,
strudel inmitten,
fische bäuchlings und phenol.
es schwimmen die inseln
durch der flußvögel schlaf.
grelle schreie im ohr
seit herzlosen wintern.
bei klirrendem frost
ein tod –
scheffelweise die toten
auf den treibenden schollen.
auf die schwimmhäute fiel schnee.
aus dem wasser steigt
des flusses schlechter atem.
phönixleer der himmel.
rauch ist gestiegen,
ruß ist gefallen,
weich wie die flocken des schnees.
Es scheint, Kirsten bedarf solcher winterlichen Grundierungen. Sie sichern ihm den festen Boden unter den Füßen und lassen ihn auf dem Boden einer Landschaft ausschreiten, die ihm gewiß ist. Nicht Heimattümelei, sondern die Sicherheit, sieh auf bekanntem Terrain zu bewegen, gewährt Kirsten den Anblick der Spuren, die er in seinen Texten festhalten will. Ein Verfahren, das positivistisch anmutet, das er sich aber antrainiert hat, um seine Phantasie und seine eigene Stimme freisetzen zu können. Daß er sich bei dieser Spurensuche und -sicherung vornehmlich einer leidvollen Geschichte und einer nicht weniger leidvollen Gegenwart zuwendet, dürfte kaum nur seinem Temperament geschuldet sein: Es entspringt den Quellen, die Kirsten kennt und die er immer wieder aufsucht. Auch Kleewunsch, dieses „kommunale Negativbild“, ist bei aller Ironie und Distanziertheit, mit der Kirsten das Porträt dieser sächsischen Kleinstadt entwirft, als Versuch, sich von der Vergangenheit abzustoßen, in seiner Detailgenauigkeit und der Freude an der Beschreibung überständigen Lebens ein Stück innerster Kirsten. Denn er bedarf dieser Projektion der Vergangenheit auf die Gegenwart, deren negative Geschichte noch einmal heraufbeschworen wird, um sich dieser Gegenwart zu vergewissern. „Vermutlich“, so der Preisträger, „braucht der Bewohner einer landesherrlichen Metropole zur Aufrechterhaltung eines ungetrübten Weltbildes und zur Ausformung seines großstädtischen Selbstbewußtseins ein zur Groteske verzerrtes Kontrastbild. Heiße es nun, wie es wolle: Abdera, Seldwyla, Schilda, Kuhschnappel, Posemuckel oder Kötzschenbroda.“ Und es ist jene uns allen bekannte tageszeitungsübliche Selbstgefälligkeit, die Kirsten letzten Endes aufs Korn nimmt und von der es in „Kleewunsch“ heißt:
In Indien werden jedes Jahr gegen 80.000 Menschen durch Giftschlangen und Tiger getötet. So etwas ist bei uns gar nicht möglich, denn die wilden Tiere, die eine Gefahr für das Leben bedeuten, sind hier schon seit Jahrhunderten ausgerottet. Die einzig hier lebende Giftschlange kommt nur an wenigen Stellen vor. Außerdem wirkt ihr Gift nicht so schnell, daß der Arzt oder Apotheker nicht helfen könnten. Also auch in dieser Beziehung müssen wir sagen: Kleewunsch liegt in einer Gegend, wo der Mensch nicht von wilden Tieren bedroht wird. Kleewunsch ist seit langem von Seuchen verschont geblieben, auch deshalb ist es hier viel angenehmer als in Indien, Italien oder in den europäischen Hafenstädten. Sollten wir uns nicht glücklich schätzen, Bewohner einer solchen Stadt zu sein, die uns die Gewähr für ein Leben in Sicherheit bietet?
Ich bin mir nach einem derartigen Beispiel nicht mehr sicher, ob man Kirsten noch immer nur unter die Natur- und Landschaftsdichter einreihen soll. Abgesehen davon, daß „Natur“ und „Landschaft“ heute als Schlagwörter kaum noch taugen – es sei denn, man tue so, als hätten wir noch eine naturnahe Landschaft und eine „Natur“, die unreflektiert als ein An-sich zu betrachten wäre – hat sich in Kirstens Texten mehr und mehr eine historisch und gesellschaftsbezogene Realität Platz geschaffen, an die vom Autor Fragen gestellt werden, die nur durch unser gemeinsames Verhältnis zur Zeitgeschichte beantwortet werden können. Damit meine ich jene Themen, die auch nach neuen poetologischen Lösungen verlangen, nach einer der Wahrheit angemessenen Sprache, die nicht nur benennt, sondern die auch jenes geschichtliche Dickicht durchdringt, in dem wir uns zu befinden scheinen. Was Vorbilder angeht, die einem auf der, Suche nach der verlorenen Wahrheit beistehen können, so bekennt Kirsten:
Jeder, der sich im Gedicht zu verwirklichen sucht, wie real oder transzendental das sprachliche Abbild auch immer gemeint sein mag, schreibt auf eine Vorstellung von Vollkommenheit, das heißt auf ein ästhetisches Prinzip hin, wie unzulänglich die Ergebnisse auch immer ausfallen mögen. Jeder muß für sich selbst Beispiele suchen, die seinen Erwartungen, Ansprüchen, Maßstäben gerecht werden.
„Der Mann in der blauen Jacke“, von dem Günter Eich – zweifellos eines der großen Vorbilder Kirstens – meint, er fände sein Glück bei „Herdrauch, Kinderwäsche und Bescheidenheit“, vergegenwärtigt sich in Kirstens Lyrik auf eine neue, anderen gesellschaftlichen Bedingungen geschuldete Weise. Kirsten, der sich selbst als „armer karsthänse nachfahr“ bezeichnet, ist dem Bild, das Eich in seiner Lyrik von der Zukunft entwarf, ein ganzes Stück näher gekommen, er ist als lyrisches Ich gleichsam aus diesem Bild herausgetreten.
Selbstbildnisse sind in den Gedichten Wulf Kirstens nur schwer aufzufinden. Sein Ich verbirgt sich in den Gegenständen, die, er zu den Themen seiner Gedichte gemacht hat. Erst in den in den letzten Jahren entstandenen Prosastücken, in denen er Szenen seiner Kindheit gestaltet, wird nicht nur deutlicher sichtbar, woher Kirsten kommt, und auch, welche frühkindlichen Schwierigkeiten er überwinden mußte, um zu dem zu werden, der er ist: ein Dichter, dessen äußere Biographie nur unzulänglich den Weg beschreiben könnte, den er zurückgelegt hat. Und doch kann es dem Leser seiner Gedichte nicht entgehen, daß da keine fröhlich-unbeschwerte Herkunft zur Idylle verklärt wird, wenn er in dem Gedicht „klassenfoto anno domini 1948“ von sich und den Mitkonterfeiten berichtet:
kartoffeltheater-komparsen
auf hochglanz poliert.
fotogene fröbelohren,
dem gemeindesiegel entsprungen.
urbilder einer ochsentreibenden jugend,
die aus sich selbt heraus lebt.
der salon des kleinstadtfotografen
hält die plüschohren steif.
gerahmte elogen.
spitzenkragen, hahnenkamm,
dauerwelle, tupfenkleid
gruppiert um einen rosenstrauß.
der konfirmanden aufgerißne augenpaare.
ein exotischer vogel im weißen jackett,
künstlerschleife unters kinn gebunden:
der lehrer, ein geiger aus Glogau.
lebhaft befremdet sieht er in sich hinein.
wenn ihn der zorn packte,
griff er zur geige
und fiedelte ein carmen triviale furiose.
nur ein einziges kind,
das auf dem foto
noch wie ein kind lächelt.
das erlebnis des lebens lag hinter uns.
Ein solches Gedicht, meine ich, bedarf keiner wie auch immer gearteten weiterführenden Interpretation. Stattdessen will ich zum Schluß kommen. Sie werden unzweifelhaft bemerkt haben, daß diese Laudatio, dieser Versuch einer Annäherung an Wulf Kirsten durch Disparatheit gekennzeichnet ist. Aber ist nicht auch das Werk eines Dichters wie Wulf Kirsten durch eine Disparatheit gekennzeichnet, die im besten Sinne des Wortes betroffen macht? Wie kann man sich zwei so gegensätzliche, in einem Band vereinte Prosastücke wie „Die Schlacht bei Kesselsdorf“ und „Kleewunsch“ eigentlich erklären? Und wie ein Programm, das mit Versen wie „den winterschlaf abtun und / die wunschsätze verwandeln“ begann, aber mit Bitterkeit auf unsere unmittelbare Gegenwart reagiert? Gewiß, Kirsten war nie ein Mann der Utopie. Frühe Gedichte wie „nachricht vom icarus bucolicus“ oder „scharfenberger quartalsbericht“, Versuche, die sozialistische Landwirtschaft im Gedicht unterzubringen, sind Ausnahmen geblieben, obwohl sie im Werk Kirstens nicht übersehen werden sollten. Das Neue ließ sich offenbar nicht so schnell in den Vers integrieren wie die für Kirsten so poesieträchtige Vergangenheit. Spätestens in seinem 1977 erschienenen Gedichtband der bleibaum beginnt der grüblerisch veranlagte Wulf Kirsten sein Thema zu problematisieren. „der bleibaum vorm haus“ wird zur Metapher einer Situation, in der die Natur mehr und mehr „dem geist der gesetze“ unterworfen wird, der sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen des technischen Fortschritts kennzeichnet.
Diskontinuität und Disparatheit sind zweifellos auch zwei kennzeichnende Begriffe, mit deren Hilfe wir etwas von unserer Wirklichkeit zu begreifen vermögen. Die Entwicklung vollzieht sich in Sprüngen. Das lernten wir in der Schule. Aber es sind Sprünge, die buchstäblich atemberaubend sind und die uns an die Gurgel gehen können, wenn wir ihnen nicht ausweichen. Was ein heutiges Gedicht groß macht, kann die Tatsache sein, daß ein Dichter sein Erschrecken darüber zum Ausdruck bringt, daß das, was wirklich vergangen ist, auch unwiederbringlich dahin ist. Was heute jeder bessere Lyrik-Anfänger weiß, nämlich daß mit Idyllen kein Lorbeer zu erringen ist, läßt andererseits eine wahre Flut von Umweltlyrik ins Kraut schießen, die lediglich noch einmal verbalisiert, was ohnehin schon jeder weiß. In solche Klagelieder stimmt Kirsten nicht ein, sondern er weiß, wovon er spricht und womit er sich einläßt, wenn er in seinem großen und oft wörtlich zu nehmenden Gedicht „das haus im acker“ eine Situation beschreibt, die nicht durch das allgemeine Konstatieren eines Momentes, sondern vor allem durch das Besondere eines weiterwirkenden Prozesses gekennzeichnet ist. Das vorläufig noch von der Eile des Fortschritts vergessene Paar Philemon und Baucis kriegt die Rechnung am Ende doch noch präsentiert: sein „haus im acker“ wird „wegprofiliert / von territorialplanern am reißbrett“. In das Fazit aber dringt die eigene, unverwechselbare Vergangenheit ein, die in einer negativen Utopie mündet, die uns zum Widerstand gegen jene Veränderungen aufruft, die unvermeidlich im „mahlgang der geschichte“ enden:
das haus im acker – ein ziegelhaufen
ohne zukunft. meine kirschallee –
achtlos weggeworfen, meine niederste
pflaumenallee mit eisenketten als abraum
zum nächsten unratberg gezerrt, meine
feldraine gestürzt, meine quellen
vergiftet. alles versunken! verschlungen
vom reißwolf des fortschritts, was einst
mir gehört hat wie dem vogel die luft
und dem fisch das wasser. alle fußpfade
ins paradies nur im gedächtnis bewahrt.
Die Abwesenheit jeglichen Gottes, der als letzte Instanz anzurufen wäre und wie er in den Gedichten Loerkes, Wilhelm Lehmanns und Bobrowskis noch vorkommt, diese Abwesenheit Gottes verkünden nicht nur diese Verse, die einer negativen Gewißheit Raum schaffen, sondern alle in den letzten Jahren entstandenen Gedichte Kirstens. Auch andere Tatsachen geschichtlicher Manipulation, wie das Ausbluten ganzer Dörfer im Banat oder in Siebenbürgen, lassen nur Fragen zurück wie die der alten zurückbleibenden Frauen:
wer aber, herr pfarrer,
wer wird uns begraben,
die wir hierbleiben?
Wenn ich im Zusammenhang mit Kirstens Gedichten von Diskontinuität und Disparatheit sprach, so könnte ich natürlich auch das ganze Problem umdrehen und von einer Kontinuität des Fortschritts sprechen, die Tatsachen geschaffen hat, die sich kaum noch auf den poetischen Punkt bringen lassen. In Wulf Kirstens Werk ist die Kontinuität, mit der er sein heutiges poetisches Credo aufgebaut hat, bemerkenswert, auch das allmähliche Abklingen jeglicher Illusion und jeder geheimen Utopie. Gleichzeitig läßt sich aber dabei nicht übersehen, daß die Kontinuität der geschichtlichen Tatsachen dem Dichter zu Entscheidungen verholfen hat, die sein politisches Bewußtsein geschärft haben. Das genaue Benennen der Dinge, wie es Kirsten betreibt, wäre nicht möglich ohne die Wahrnehmung auch geschichtlich-politischer Tatsachen, mögen diese nun in unser Bild eines Lyrikers passen oder nicht. Nicht zufällig krönt manchen der in den letzten Jahren geschriebenen Texte keine Ganzheit mehr, überwiegt das Fragment, so in der ausdrücklich mit dem Untertitel „fragment“ benannten „poetologie“. Mit der refrainartigen Zeile „in jenen jahren“ werden die Schicksale der Dichter Kljujew, Markisch, Kornilow, Mandelstam, der Achmatowa, von Halas, Konstantin Biebl in jenen Jahren ins Gedächtnis gerufen, für die wir offenbar noch immer nur das Etikett „Zeit des Personenkults“ zur Verfügung haben, eine Ahnengalerie, die den leicht pathetisch klingenden Vers des Frantisek Halas „die poesie ist das blut der freiheit“ konkretisiert und damit von jedem falschen Verdacht des Pathetischen reinigt.
Am Schluß dieser Laudatio, die ja eine Lobrede ist, weiß ich für dich, lieber Wulf, kein größeres Lob auszusprechen, als jenes, daß du dir selbst den Anspruch, unter dem du angetreten bist, erfüllt hast, indem du deiner „wortfelder langsamen wuchs“ nicht künstlich forciertest, sondern abgewartet hast, was dir die Arbeit mit den Wörtern eines Tages einbringen würde. Ich denke, dieses Abwarten-Können, aber auch die damit verbundene „Dauerbeherrschung des Metiers“, von der Georg Maurer zu sprechen pflegte, hat sich gelohnt – und nicht nur um des Heinrich-Mann-Preises willen, zu dessen Verleihung ich dir hier und jetzt als erster von Herzen gratulieren kann!
Heinz Czechowski, Sinn und Form, Heft 5, September/Oktober 1989
Wulf Kirsten – einleitende Worte
Obwohl ich, wie wahrscheinlich jeder, der Literatur ,macht‘, immer ein eifriger Leser gewesen bin, vor allem auch von Lyrik, war mir lange Zeit der Name Wulf Kirsten unbekannt.
In den 80er-Jahren arbeitete ich regelmäßig bei der Zeitschrift Lynkeus des Wiener Literaten Hermann Hakel mit. Und Hakel war es, der mir knapp vor seinem Tod 1987 bei einem meiner Besuche bei ihm den schmalen Reclam-Band die erde bei Meissen von Wulf Kirsten schenkte. Das Buch war zwar mit einer persönlichen Widmung für Hakel versehen, aber für ihn, der sich besonders im Alter als Rabbi, als Lehrer verstand, war es wichtiger, mich, den er als einen seiner Schüler betrachtete, derart zur Konfrontation mit einem lyrischen Werk anzuregen, das er schätzte, obwohl es seinen Vorstellungen von Lyrik nicht entsprach. Lesen S’ das! sagte er, lesen S’ es, is ganz gut!
Als nach Hakels plötzlichem Tod ein Band mit Erinnerungen an ihn erschien, in dem auch ein Beitrag von mir war, schickte ich das Buch an Kirsten, einerseits als solidarische Geste gegenüber dem Verstorbenen, andererseits auch, weil ich mich damals hie und da zu der Bemühung veranlaßt sah, Kontakte mit Autoren aus dem deutschsprachigen Raum herzustellen, um meine Isolation in Duino, weitab vom hiesigen Literaturbetrieb, zu verringern. Und das keineswegs Selbstverständliche geschah: der inzwischen, nach der aufgetragenen Lektüre auch von mir bewunderte Autor schickte mir einen Dankesbrief. So entstand ein lockerer, aber für mich anregender Briefwechsel zwischen Weimar und Duino. Kirstens Briefe, bekümmert vor der ,Wende‘, noch bekümmerter danach, gaben mir, der ich sozusagen im Herzen des von ihm mit resignativer Sehnsucht aus der Ferne betrachteten Mitteleuropa saß, zu denken. Ich schickte ihm Literatur aus der Region, Slataper, eine Anthologie Triestiner Literatur. Er schickte mir eine Biografie Theodor Däublers, Bücher zeitgenössischer DDR-Lyriker. Und wie üblich unter Autoren, tauschten wir auch die eigenen Bücher aus, in der Hoffnung – zumindest was mich angeht –, so vielleicht einen Leser mehr zu haben.
Wulf Kirsten wurde 1934 in der Nähe von Meissen, im „häuslerwinkel“ von Klipphausen geboren. Sein Vater war Steinmetz (ein Beruf, der den Rezensenten und Germanisten unschätzbares Methaphernmaterial für die Beschreibung der späteren Arbeit des Sohnes am Wort liefern wird). Beim Durchlesen der Lebensdaten Kirstens fällt auf, daß er in den verschiedensten, auch nicht-intellektuellen Berufen tätig war. Nach dem Lehramtsstudium von Deutsch und Russisch in Leipzig unterrichtete er kurze Zeit. Danach längere Krankheit, steht lakonisch in seiner Vita. Das Lehrerdasein scheint ihm also nicht gefallen zu haben. In dieses Jahr fällt auch die erste Veröffentlichung seiner Gedichte. Seither hat Kirsten zahlreiche Preise erhalten, 1972 den Louis Fürnberg Preis, 1975 die Jiri Wolker Medaille, 1983 den Literatur- und Kunstpreis der Stadt Weimar, 1985 den Johannes R. Becher Preis, 1987 den Peter Huchel Preis, 1989 den Heinrich Mann Preis, den seit 1953 deutschsprachige Schriftsteller erhielten, die im Sinne Heinrich Manns durch Werke gesellschaftskritischen Charakters die demokratische und sozialistische Erziehung gefördert haben. Ich erwähne das vor allem als Hinweis darauf, daß Kirstens Texte, die von der bundesdeutschen Kritik zumeist in der Schublade ,Deutsche Naturlyrik‘ abgelegt werden, eminent politische Texte mit ausgeprägt didaktischer Komponente sind.
Das Reclam-Bändchen die erde bei Meissen enthält angeblich so ziemlich alles, was Kirsten bis 1987 geschrieben hatte. Prägend für ihn, den Lyriker, waren, wie er selber angibt, Autoren wie Johannes Bobrowski mit seinem Roman Levins Mühle, Peter Huchel, Oskar Maria Graf. Ein direkter Einfluß der Genannten ist aber im Gedichtwerk Kirstens, zumindest auf den ersten Blick, nicht festzustellen. Es imponiert, zäh gewachsen, durch eine vor allem sprachliche, aber auch formale Eigenständigkeit und läßt den Gedanken an Epigonentum in keiner Zeile aufkommen.
Beim wiederholten Lesen der Bücher Kirstens – neben die erde bei Meissen z.B. auch „Veilchenzeit“ oder „Das Haus im Acker“ – kam mir immer wieder ein heutzutage altväterliches Wort in den Sinn: Redlichkeit. Ich kann nur über das schreiben, was ich genau kenne, steht unter seinem Foto und über seiner Unterschrift auf der hinteren Umschlagseite des Bändchens Das Haus im Acker. Und Kirsten schreibt auch nur über das, worüber er schreiben kann, weil er es kennt. (Übrigens hat auch Hakel immer wieder von sich gesagt, er könne nur darüber schreiben, was er selbst erlebt habe, nur aus der eigenen Anschauung heraus könne er anschaulich schreiben.) Kirsten kennt das Land um Meissen, das zu seinem geistigen Besitz geworden ist – und das in exemplarischer Weise auch von ihm Besitz genommen hat. Besessen davon und versessen darauf, hat er diese Landschaft zum Gegenstand seiner Texte gemacht. Man könnte, in Analogie zum Begriff der Topografie, seine Gedichte als ,Topopoesie‘ bezeichnen. Allerdings: Kirstens Texte erschöpfen sich nie in der reinen Beschreibung, Abbildung, sind nie regionale Stimmungsgemälde. Auf den ,langen geduldigen Blick aufs Objekt‘ folgt bei Kirsten eine nicht immer gewaltlose, aber stets faszinierende, mit allen Wassern der deutschen Sprachgeschichte gewaschene Transponierung des visuell erfahrenen Gegenstands – der Landschaft – in die eigenständige und eigengesetzliche Welt der Sprache. Der Wirklichkeits-Gegenstand verwandelt sich im Text zum Sprach-Gegenstand.
Noch etwas anderes modifiziert den leichtfertigen Begriff der Topopoesie: während ein anderer ,Naturlyriker‘ oder ,Gegenstandslyriker‘, wie er sich selbst bezeichnet, Michael Hamburger nämlich, sich, nach eigener Angabe, aus Überdruß an den ,human matters‘ in die Natur, zu den Bäumen, Blumen, Tieren flüchtet, den Menschen an den Rand drängend, steht im Zentrum der Texte Kirstens immer die Beziehung des Menschen – eines Ich manchmal, zumeist aber eines Unbenannten – zur Landschaft, eine Beziehung aber, in der das vom Menschen in Betracht gezogen Subjekt nie zum Objekt wird. Es ist aber nicht diese eigentümliche Substanz der Texte Kirstens, nicht die so gar nicht naive, durchaus kritische Darstellung der Beziehung von Mensch und Landschaft, die das lyrische Werk Kirstens zum Erlebnis machen, sondern die Sprache. Jedes seiner Gedichte ist ein kleines Wort-Museum, in dem, sei es hölderlinsch hehr oder jeanpaulisch kalauernd, sei es landwirtschaftlich technologisch, die Wörter eines regionalen bäuerlichen Wortschatzes, der heutigen Landwirtschaftstechnologie, kunstvoll angeordnet, ausgestellt sind. Genau genommen, bräuchte man ein Glossar, um diese Gedichte tatsächlich zu verstehen, oder das Wörterbuch der obersächsischen Mundart, an dem der redliche Wort-Sammler und Wort-Leser Wulf Kirsten ja auch mitgearbeitet hat.
Hans Raimund, aus Hans Raimund: Das Raue in mir. Aufsätze zur Literatur und Autobiografisches 1981–2001, Literaturedition Niederösterreich, 2001
Die Nische in der Nische – kleine Hommage an Wulf Kirsten
1
Von Mitte der siebziger bis Anfang der neunziger Jahre fuhr ich regelmäßig nach Weimar. Als Westberliner konnte man mit Tagesvisum Ostberlin besuchen, aber Reisen in die DDR mussten vorher beantragt werden, und um die Prozedur zu vereinfachen, trat ich in die Goethe-Gesellschaft ein. Fortan erhielt ich problemlos ein Visum nicht bloß für den Kreis Weimar, sondern für die gesamte DDR – damals – ein Privileg!
In Thüringen war die Zeit stehen geblieben, und Weimar, so schien mir, war eine Nische in der Nische mit Zwiebelmarkt, Kartoffelklößen, Felsenkeller-Bier und Nordhäuser Doppelkorn. An der Bar des Hotels Elephant, wo Hitler logiert hatte, wurden Herrengedecke serviert, bestehend aus mit Sekt vermengtem Bier, und am Frühstücksbüfett wurde jede Scheibe Salami abgewogen und dem Gast in Rechnung gestellt. Später wohnte ich bei Freunden, die frühmorgens beim Bäcker anstanden, um frische Brötchen zu kaufen, grauer und kleiner als Westberliner Schrippen, aber schmackhafter. Dass die Frau meines Freundes der Stasi Bericht erstattete über mich, hat mich nicht gestört: Das war der Preis, der für Besuch aus dem Westen zu zahlen war.
Die DDR war eine Nische, in der es sich nicht gut, doch leidlich leben ließ: Eine kommode Diktatur, wie Günter Grass schrieb, sofern man bereit war, auf Westreisen und unbequeme Fragen zu verzichten. So waren Fragen zur deutschen Einheit tabu: Stattdessen war von der Einheit der Arbeiterklasse die Rede, symbolisiert durch den Handschlag von Pieck und Grotewohl, oder waren es Ulbricht und Grotewohl?
„Wenn Sie von Wiedervereinigung reden, müssen wir das Gespräch abbrechen“, beschied mich der Präsident der Goethe-Gesellschaft, Professor Hahn, auf einer Podiumsdiskussion, um nach der Wende zu beteuern, er sei stets für die Einheit Deutschlands gewesen: Kein Wunder bei einem Kriegsteilnehmer, der schwerverletzt aus Stalingrad ausgeflogen und frühzeitig in die SED eingetreten war. „Sie haben etwas für den Frieden getan“, lobte er mich, als ich darauf hinwies, dass Goethe kein Militarist oder Nationalist gewesen war.
Auch Menschenrechte waren tabu, und als ein Delegierter aus Frankfurt wissen wollte, warum die Stasi Friedensaktivisten in Jena verhaftet und in die BRD abgeschoben habe, herrschte eisiges Schweigen im Saal. „Ihr Name bitte?“, sagte die Protokollführerin. „Klaus H., Friedensbewegung Frankfurt!“ Dass Klaus H. fortan in Weimar persona non grata war, verstand sich von selbst, ähnlich wie die Leipziger Bibliothekarin, die auf Goethes Spuren Italien hatte besuchen wollen. „Ihr Name bitte?“
Beim Verlassen des Rokokoschlosses, wo eine sogenannte Aussprache stattfand, drohte mir der Herausgeber von Sinn und Form, Wilhelm Girnus, mit dem Zeigefinger:
Herr Buch, wir wissen, wes Geistes Kind Sie sind!
2
Dass die Goethe-Gesellschaft der SED als Aushängeschild diente, um Liberalität und Weltoffenheit vorzuspiegeln, sei nur am Rande vermerkt. Das Gegenprogramm zum verlogenen Goethe-Kult der DDR, die sich zu Unrecht auf den Ausruf des sterbenden Faust berief: „Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn“, ohne zu bedenken, dass Faust zu dieser Zeit erblindet war und die sein Grab schaufelnden Lemuren für Deichbauer hielt: Das Gegenprogramm war in der Paul-Schneider-Straße zu besichtigen, wo der Dichter und Verlagslektor Wulf Kirsten mit seiner Familie in einer mit Büchern vollgestopften Wohnung lebte. (Paul Schneider war ein Märtyrer der bekennenden Kirche, der in Buchenwald zu Tode gefoltert wurde – das nur in Klammern.)
Wulf Kirsten war kein wider den Stachel löckender Dissident, sondern mehr und weniger zugleich: Als renommierter Lyriker und Lektor der Thüringer Filiale des Aufbau-Verlags verteidigte er die Literatur gegen ideologische Zumutungen. Dabei berief er sich auf die Weimarer Klassik wie auch auf Traditionen der Moderne und auf seine Verwurzelung im kleinbäuerlichen Milieu, wie sie im Gedicht „werktätig“ zum Ausdruck kommt:
… kraut schlagen, rüben blatten,
einen reifen aufziehn, einen zaun anlatten,
eine schmelze abstechen, eine glocke gießen,
das brot in den backofen schießen,
kalk anstoßen, ein beil schärfen,
ein schwein ins salz werfen,
eine kammer mit weißkalk ausweißen,
die federfahnen vom kiel reißen,
einen giebel verbrettern, eine tür anschlagen,
die dachbalken zapfen und schragen,
eine leiter lehnen, haferstroh häckseln,
das zeitliche mit dem ewigen verwechseln.
„Kein anderes Wort wurde in der DDR so inflationär gebraucht und politisch missbraucht wie das Adjektiv werktätig“, schrieb ich dazu in einem Beitrag für Marcel Reich-Ranickis Frankfurter Anthologie, und fuhr fort:
Wulf Kirsten nimmt das Unwort beim Wort, indem er es von den lichten Höhen der Ideologie herunterholt und auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückführt: Eine Serie praktischer Verrichtungen, die wie die Wörter, die sie bezeichnen, aus unserem Vokabular verschwunden sind. Der Hinweis auf sach- und fachgerechtes Arbeiten enthält eine implizite Kritik am staatlich verordneten Murks, der durch die Berufung auf Marx nicht besser wurde. Dagegen ist Wulf Kirstens Gedicht ein solides Werkstück, gekonnt verfertigt nach allen Regeln der Kunst, die selbst ein Handwerk ist. Seine Freude an altertümlichen Redewendungen ist kein Ausdruck rückwärtsgewandter Nostalgie: Nicht der Dichter verwechselt das Zeitliche mit dem Ewigen, sondern die Partei, die den Sieg des Sozialismus verkündete, als dieser sein Verfallsdatum längst überschritten hatte.
3
Nach dem Mauerfall leitete Wulf Kirsten kurzfristig ein Bürgerkomitee zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, aber das war noch nicht vorstellbar, als ich kurz vor der Wende Weimar besuchte. Georgische Germanisten, die Robert Musil übersetzt und in Tiflis herausgebracht hatten, was in Moskau nicht möglich war, nahmen mich unter ihre Fittiche und führten mich zum Nietzsche-Haus, die Zeitschrift Sowjetunion heute schwenkend, die in der DDR verboten war, weil sie über Perestrojka und Glasnost berichtete. „Aufmachen, Komendantura“ riefen meine georgischen Freunde und rüttelten an der verschlossenen Tür, und mit ihrer Hilfe gelangte ich in das mit Vande-Velde-Möbeln ausgestattete Museum, perfekt eingerichtet für den Tag, an dem die SED, wie zuvor Luther und Bismarck, Nietzsche rehabilitieren würde, dessen Gedichte Wulf Kirsten auswendig konnte.
Hans Christoph Buch, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
MÖGE ES SEIN
Die Alter kommen und
Gehn, mit Wolken gedimmt,
Die Muschelkalkflanke
Harrt treulich im Rücken;
Die Lichtorgel träumt,
Von Ammoniten bestimmt,
Die Moräne befährt
Firmamentene Brücken.
Die Wälder leuchten,
Die Landschaft gerinnt,
Dich zu ehren: mit
Staunenden Blicken –
Möge es sein, daß
Die Aussicht gewinnt,
Und möge nichts sein,
Uns zu bedrücken.
Für Wulf Kirsten zum Geburtstag
André Schinkel
Lesung Wulf Kirsten am 27.11.1991 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


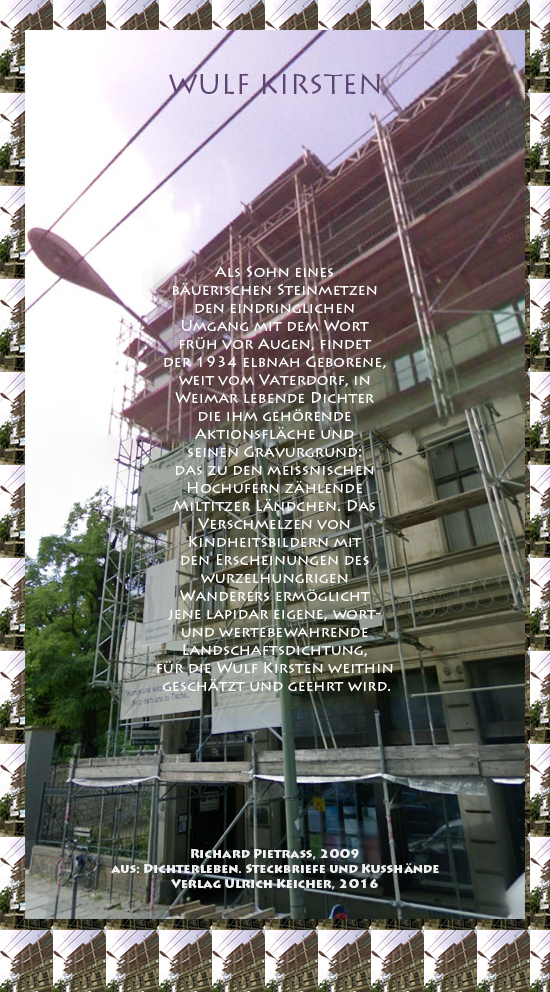












Schreibe einen Kommentar