Wulf Kirsten: erdanziehung
NIKOLAI KLUJEW
orphischer sänger der bauernhütten
waldiger dörfer endloser weiten
im taigahauch, Kitesch, märchenhafter ort,
mondnachts tönt der kiefern geläut
trauminsel Solowjezk, wo der wassermann
werg und hede spinnt im lichtgesims,
franziskanischer bauernapostel, der
in die feurigen abendrotbänder
seine altgläubigen gebete murmelt
und traumwandlerisch auf ein bauernparadies
setzt mit feldgeschworenen
wie zuzeiten Jemeljan Pugatschows,
ein einziger leidensweg im weltrauch,
den das schicksal ihm einbrockte,
gräserpsalm aus schwermutsfäden gewebt,
wortschöpfer mit prophetenstatus,
auferstandene worte in sprechendes seelenlicht getaucht,
vieläugige brüderlichkeit
herbeigedichtet, zeit, ach zeit vorbei,
halt nur einziges mal doch noch ein,
bis das letzte gedicht vollendet,
als kulakendichter verteufelt, verdammt,
feindliches element, also verbannt,
zu tode gebracht, als der tod umging
millionenfach, verscharrt ortlos
gleich einem räudigen köter.
Wulf Kirstens Gedichte
entziehen sich jeder Strömung, sie strömen selbst wie die Elbe durch das Gebirge und bahnen sich ihren Weg in das Empfinden der Leser, erzählen von der Sehnsucht, evozieren längst vergangene Kindheitstage, sind erdverbunden und haben zugleich Worte für die Leere, für die Stille, für die Gegenden, wo nur noch die Erinnerung haust und die Natur übernimmt.
erdanziehung versammelt seine Gedichte aus den Jahren 2011 bis 2018.
S. Fischer Verlag, Klappentext, 2019
Der Zauberer des Wortes
– Der im Umland Meißens geborene Dichter Wulf Kirsten wird heute 85 Jahre alt: Deutschlands bedeutendster Naturlyriker brilliert mit neuen Gedichten. –
Neben seinen verstorbenen Zeitgenossen Heinz Czechowski und Karl Mickel ist Wulf Kirsten der herausragendste Vertreter der Sächsischen Dichterschule. Seit Jahrzehnten in Weimar beheimatet, gilt er als geistiger Erbe Peter Huchels. Reiner Kunze rühmte ihn schon früh als „große Hoffnung“ der Lyrik. Seine jüngsten Strophen feiern die Sprache als Brunnen, aus denen jene seltenen Verben und Substantive sprudeln, die er verwendet. Der Autor entpuppt sich erneut als Merlin des Wortes, der Vokabeln in der Retorte einschmilzt und destilliert. Kein anderer aus seiner Zunft gebietet gegenwärtig über eine ähnlich reichhaltige Lexik wie er und niemand vermag sie so kreativ zu variieren. Die Verse des Ausdrucksalchemisten prägt oft ein Sound, der dem ähnelt, was Akustiker als Schwebung bezeichnen, nämlich dem Zusammenklang zweier Frequenzen. Raffiniert zum Tragen kommt diese geniale Form in einem Text von 2016:
teilhaber am abendlicht
als oft genug verlachter
weltbetrachter, gräben
geschachtet mit hacke und
schaufel, knochenhart,
versteinte berge superphosphat
pulverisiert, als ich wallraffte
im feldbau einst zu Riemsdorf.
Kirsten stammt aus dem hinter Meißen auf den südlichen Elbhöhen liegenden Dorf Klipphausen. Als Jugendlicher verließ er den Dunstkreis des Ortes selten. Erst mit 23 glückte es ihm, sich aus dem Elternhaus zu lösen und in Leipzig Germanistik zu studieren. Dort entwickelte sich die Deutsche Bücherei zu seiner eigentlichen Universität. In deren Lesesälen schloss er Bekanntschaft mit den Schätzen moderner Literatur. Trotzdem blieb das Milieu seiner Herkunft dauerhaft ein wichtiger Fundus für seinen poetischen Kosmos. Speziell die bäuerliche Atmosphäre liefert ihm noch immer Motive:
heute ein fachgespräch geführt,
wie ich bemerken musste, nicht
mehr ganz sattelfest wie seinerzeit,
als ich pferden das kumt aufsetzte,
wie leicht man sich täuscht, wenn es
um scheuklappen geht, um trense,
kandare, über die vorzüge von sielengeschirren
Wenn Wulf Kirsten beteuert, er sei stets „auf bodenhaftung bedacht“ gewesen, dann ist diese Aussage doppeldeutig. Zum einen floh er nicht in einen Elfenbeinturm, denn er betont:
Ich hatte es nie darauf abgesehen, das rustikale Idyll einer Heile-Welt-Parzelle zu zimmern und aus der Welt herauszumauern. Ich habe das soziale Gefüge in meinen Gedichten nicht ausgespart und die Sympathien für meinesgleichen darin zu erkennen gegeben.
Andererseits liebt es der Künstler, sich uneingeschränkt in jenen Gefilden zu bewegen, die ihn inspirieren. Doch diesbezüglich erwuchsen ihm inzwischen starke Einschränkungen:
Mir fehlt jetzt die Möglichkeit, immer wieder neuen Stoff aufzunehmen, wenn ich zu Fuß durch die Landschaft streife. Dass ich jetzt, mit über 80, nicht mehr freiweg im Gelände herumschweifen kann, das macht mir schwer zu schaffen. Also bin ich hauptsächlich darauf bedacht, von Erinnerungen zu zehren, zu überlegen, was hat dich geprägt, was hat dich so gemacht.
Genialen Naturhymnikern wie Johannes Bobrowski und Günter Eich verdankt Wulf Kirsten Anregungen, doch selbst wenn er es beharrlich leugnet, überflügelte er seine Vorbilder durch ästhetische Originalität. Skeptische Melancholie entwickelte sich zu seinem Markenzeichen. Anders als Karl Krolow verfällt er trotz seines hohen Alters nicht in Tiraden über Krankheit und Tod. Aber eine Portion Schwermut schwingt durchaus mit, wenn er Bilanz zieht:
da kannte ich
einen uralten, verborgen
unter bartgestrüpp, gesegnet
vom zeitlichen mit achtundachtzig,
da war ich gerade mal acht,
mir achtzig voraus, jahrgang 1854,
nun selbst achtzig verweht,
irrläufer meiner selbst, der
von verflossenen jahrhunderten
zu berichten weiß, zeitzeuge
wider willen nolens volens.
In den uneitlen Gedichten Wulf Kirstens spiegelt sich wider, was sein Bewunderer Martin Walser als „Empfindlichkeit für das Erlittene“ definiert. Genau betrachtet, enthüllen sie sich als Glanzlichter einer verdeckten Autobiografie.
Ulf Heise, Freie Presse, 21.6.2019
Welthäuslichkeit unter freiem Himmel
– Neue Gedichte von Wulf Kirsten, der am heutigen Freitag 85 Jahre alt wird. –
Wulf Kirsten denkt in Landschaften, wie andere in Begriffen. Er hört das „Gras wachsen“ – vom Meißnerischen und Weimarer Land bis zum Rhônetal. Das Meer spiele für Wulf Kirsten keine Rolle, er sei „kontinental“, hinterließ Rolf Haufs. Der Dichter aus Weimar ist kein Mensch der Ebene, er ist ein emphatischer „Landschreiter“ in Flusstälern, Hanglagen und im Bergland. Nur der Erdanziehung unterworfen, sucht er die „Welthäuslichkeit“ unter freiem Himmel. Aber zur Landschaft kommt das Menschengemachte. Aus dem Landschafter wird ein „Weltbetrachter“: Geschichte, Kultur, Biographie, mögliche Zerstörung eingeschlossen.
am grundfaden hängend, vernetzt,
wie ihn die spinne zu ziehen beliebt,
wirst du wohl oder übel mit deiner
hauteigenen geschichte leben müssen
Jüngst kam es zu einem flagranten Ausruf des letzten Dichters aus Weimar:
Ich schreibe wie ein Quartalssäufer.
Das ließ aufhorchen bei einem Mann, der für seine skrupulöse Arbeitsweise bekannt ist. Auf Pausen der Wahrnehmung und des Speicherns folgt ein Zerreißen des Raums, ein geballtes Arbeiten. Der Band erdanziehung zeigt jetzt fünfzig Gedichte, die Quartalsfrüchte der letzten acht Jahre. Aus dem Betrauern einer Kriegskindheit, aus dem inneren Widerstreit vor fliehenden Horizonten, dem Zweifel als „oft genug verlachter / weltbetrachter“, wachsen profunde Selbstbehauptungsgedichte. In genuinen Abschweifungen wird alles formuliert bis auf den Grund.
Jedes Gedicht ein Neubeginn in der abgestuften Dreieinigkeit von Landschaft, Geschichte und Biographie, wie in „spielplatz“:
damals, mitten im krieg,
ich sah ihn, Franz aus der Ukraine,
deportiert mit fünfzehn,
zum laufen am berg gebracht,
in trab gehalten, wehe,
dreimal wehe, er hätte die fuhre
geschmissen, ich hab ihn,
als ich zehn war, bewundert.
Gestohlenes Leben rankt sich in viele Gedichte, so auch in „morgen in Alzey“ als Fortentwicklung des Gedichtes, das bereits in Kirstens Band fliehende ansicht (2012) in einer frühen Fassung erschien: anderer Zeilenfall, die Verse weiter geschliffen. Und sich selbst eingefügt „als stiller betrachter“.
Karl Schloß zu ehren in Alzey, dessen leben als jude
in auschwitz endete,
in einem seiner gedichte
sah er jahrzehnte zuvor
die blumen in rauch aufgehn.
Der letzte Vers ist dem gleichnamigen Gedicht von Karl Schloß entnommen, einer Prophetie kommenden Schreckens schon 1905.
Nicht nur hier zeigt sich Kirsten als universeller Dichter, als ein sich keineswegs nur im Jahreskreis bewegender Landschafter. Er ist einer, der weiß und zählen kann, einer, der beim Namen ruft. Die Reverenz für den Bauerndichter Nikolai Kljujew gilt den vergessenen Stalinopfern.
… zeit. ach zeit vorbei,
halt nur einziges mal doch noch ein,
bis das letzte gedicht vollendet,
…
zu tode gebracht, als der tod umging
millionenfach, verscharrt ortlos
gleich einem räudigen köter.
Kirsten, Jahrgang 1934, hat die enge Verschwisterung von Idealismus und Gewalt immer auch als eigene Gefährdung gespürt, bis „die eskaladierwand“ aus seinem Leben verschwand:
welch ein glück, sagt man sich
am ende eines langen lebens,
nicht mehr strammstehen müssen,
hände hart an der hosennaht,
nicht mehr marschiern in kolonne
und gleichschritt halten.
Die Flucht vor den Zumutungen der Gesellschaft in die Landschaft, lässt sich auch als ein Betrauern des Versäumten verstehen. Der Dichter weiß, es gibt keinen Ausgleich für versäumtes Leben. Nicht anders Kafka. Dieser kreuzt 1912 auf einer Reise den Goethe-Garten Weimar und verliebt sich in die Tochter des Hausmeisters am Dichter-Museum. Auch Kirsten entflammt diese Legende:
in einen backfisch verschossen jählings,
namens Gretchen, eben sechzehn geworden,
das unterricht nahm im weißnähen,
bei hochsommerhitze sah Kafka
sie leichtgewandet ziehn
die Erfurter straße hoch, erotisiert
von ihrem durchsichtigen kleid.
So durchsichtig wird es nicht wieder. Kirsten scheidet weiter Natur und Landschaft:
Natur ist überall Natur, Landschaft ist aber überall anders.
Völlig anders auch der Erlebnispegel in der Felsenlandschaft über dem Rhônetal:
zikadengesang, wo immer wir schweiften,
wo immer zu hören, wir wußten,
das ist der Süden.
Wieder heimgekehrt, summen bei Kirsten auch Wort-Zikaden. Es „dräuscht“, es wird „gedemmelt“ oder „gereut“ und „lehden gequert“, „klunsen“ überwunden. Das Grimmsche Wörterbuch so nützlich wie nie. Ein frisches Beatmen alter Worte, verschlissen in Jahrhunderten. Wie im Sprachlichen ist Kirsten beständig in allem. Wenn er auf seine Zeit als Stadtschreiber kommt, gedenkt er schon in einem zweiten Gedicht einer Bücherfrau:
Monika Steinkopf zu Bergen-Enkheim
sei dank für den regen goldener früchte.
Für das „sofortige Erkennen“ und den poetischen Aufschluss des Wulf Kirsten gilt der Kafka-Satz beim ersten Anblick des Goethe-Hauses:
Fühlbare Beteiligung unseres ganzen Vorlebens an dem augenblicklichen Eindruck.
Heute feiert der Dichter aus Weimar, der immer mehr sein wird als ein Landschafter, seinen 85. Geburtstag.
Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 20.6.2019
Der Nachlass des Tages, der schon nach Herbst schmeckt
– Mit seinem aktuellen Gedichtband bringt der 85-jährige Dichter Wulf Kirsten ein wenig Zeitlosigkeit in eine Ära der Beschleunigung. Das ist nur vordergründig altmodisch. –
Einstmals schmückten unter der Sonne glänzende Schlösser und Burgen die Landschaften. Inzwischen trifft man dort, wo sie standen, auf „restholzbestände“ und „halbtrockenrasen“. Echtes Leben macht sich vor allem noch im Untergrund bemerkbar, wo „Endogene[] kräfte[]“ wirken, kaum sichtbare, geheime Strömungen, zu denen uns erst Wulf Kirstens Gedichte Zugang verschaffen. Den neuesten Band Erdanziehung des Peter-Huchel-Preisträgers, eine Sammlung der lyrischen Werke aus den Jahren 2011 bis 2018, kann man als eine poetische Tiefenbohrung sehen. Was die freilegt, sind historische und biografische Schichten. Darunter immer wieder Bilder des Kriegs: von Panzern in Sümpfen, selbst gebauten Bunkern und Gräberfeldern. Überall vernimmt der Leser „zermahlenes erdenweh“.
Angestimmt wird von dem 1934 in Klipphausen geborenen Dichter jedoch kein Lamento über die Vergänglichkeit allen Seins. Vielmehr weiß er um die konservierende Macht der Poesie. Seien es die Geschichten der Ahnen, der im Fernen verhallende Gesang der Zikaden oder weltverlorene Bahnstationen im Nirgendwo – Kirstens Verse bewahren, was allzu schnell verloren zu gehen droht, und knüpfen an eine ästhetisch höchst verspielte Gedenk- und Erinnerungskultur an, die schon seit geraumer Zeit die Literatur durchdringt. Man denke in der Prosa an Werke von Judith Schalanskys oder Sven Tillich oder in der Lyrik an Uwe Kolbe, Silke Scheuermann oder José F.A. Oliver. Auf Lichtgeschwindigkeit und Informationsflut der digitalen Spätmoderne antworten diese Autorinnen mit der Souveränität des gesetzten Wortes. Kirsten formuliert seine Kulturkritik nun sogar dezidiert in einer Miniatur über die Stille aus, die für ihn den Ausgangspunkt des poetischen Schreibens darstellt. Denn sie sei ein „summen“, woraus sich erst die „textur“, also das Gedicht bilde. Doch „wer“, so die Skepsis an der Gegenwart der anderen, „noch wollte / und sollte das überirdische hören, wo / alle ohren verstöpselt, alle blicke / weltab gerichtet auf smartphones, / die dazu verhelfen, nicht mehr gewahr / zu werden die sie umfangende welt“?
Manch einem mag es wie Nachahmung der Alten vorkommen, wenn Kirsten inmitten der Beschleunigungsgesellschaft um die zeitlosen Momente ringt, ja, versucht, einen einfachen und unverstellten Ton für abgelegene oder vergessene Räume zu finden. Man kann sein Bemühen aber auch als ganz gegenwärtige Kunst der Besinnung verstehen. Indem er nach dem Echten und Wahren strebt – zwei Kategorien, die wieder im Kommen sind! –, sinnt er auf eine Lyrik der Vitalität und Erfahrungssättigkeit. Er will das unmittelbare Gefühl, das pure Leben oder, wie er es selbst festhält, „die alltäglichen banalitäten, / die es zu fermentieren gilt, / in poetische rede“ kleiden.
Auf den ersten Blick altmodisch gleichen seine Texte somit einem frischen Wind durch sterile Zimmer – auch weil sein ästhetischer Ansatz in Opposition zu zumindest einem Teil der zeitgenössischen Lyrik steht, der sich deutlich in einer akademischen Denktradition verortet. Gedichte nehmen bei avancierten Dichtern wie Ulf Stolterfoht oder Stefan Schmitzer nicht selten den Charakter von Oberseminaren über Sprachkritik, Poststrukturalismus oder Diskursanalyse an. Klug ist deren Kunst, aber mitunter trocken. Diese Avantgarde hat zweifelsohne ihre Berechtigung. Dass indes wieder mehr und mehr Autoren – neben Kirsten wären beispielsweise Albert Ostermaier, Mirko Bonné oder Christine Langer zu erwähnen – wieder die affektive Dimension der Dichtung stärken, ist eine Wohltat. Sie feiern das Ästhetische an sich, die Schönheit, die Poesie so zart wie berauschend einzufangen weiß. Der ironische Blick auf die Welt liegt ihnen fern. Stattdessen fragen ihre Texte mit Inbrunst nach den existenziellen Urgründen des Daseins: der Natur, der Liebe, der Feier des Augenblicks. Kirstens stimmungsvolle Verse über das „land unterm licht“ oder den „nachlaß des tages, der schon / nach herbst schmeckt“, verdichten das Leben im unverblümten Genuss an der Sprache – genau so, als müsste man jeden Duft und jeden Eindruck noch einmal ganz in sich aufnehmen, bevor im sich anbahnenden Morgen schon wieder eine neue Saat aufgeht.
Björn Hayer, Die Zeit, 4.9.2019
Offen wie ein Stein
– Drei Gedichtbände erkunden unsere menschliche Beziehung zur mehr-als-menschlichen Welt. –
Welchen Anteil hat menschliches Tun an den Feuerwalzen, die im letzten Jahr durch Australien wüteten? Am Dürresommer in Europa? Am ständig steigenden Methanausstoß des auftauenden Permafrostbodens in Sibirien? Eine neue Wissenschaft, Attribution Science genannt, beschäftigt sich mit der Zuschreibung von Kausalitäten im Wettergeschehen. Die Umweltethik einer Zeit, in der Menschen zu geologischen Akteuren geworden sind, will belangbare Schuldige benennen können. Den meisten Zeitgenossen ist insgeheim bewusst, dass ihr Konsumverhalten unsere Welt von Grund auf verändert. Ob sie dafür den modischen Begriff „Anthropozän“ verwenden oder nicht, sie sind alle Bürger einer Zivilisation, die auf Kriegsfuß mit der Biosphäre steht.
In der Literatur finden sich frühe Zeugnisse einer intuitiven Ahnung, dass das kollektive Wirken des Menschen tief in den Naturhaushalt eingreift, etwa schon bei Johann Gottfried Herder Ende des 18. oder den dystopischen Visionen eines „letzten Menschen“ im frühen 19. Jahrhundert. 1924 veröffentlichte Alfred Döblin mit dem Geo-Epos Berge Meere und Giganten einen Urtext der Anthropozänliteratur – 80 Jahre bevor der Begriff geprägt wurde. 1979 verdichtet Max Frisch in seinem experimentellen Text Der Mensch erscheint im Holozän Reflexionen über die vom Menschen verursachte Veränderung der natürlichen Rahmenbedingungen unserer Existenz. Die Lyrik kam da naturgemäß später, ist sie doch vornehmlich interessiert am sinnlich Erfahrbaren und subjektiv Verdichteten. Doch auch in Gedichten hinterlässt die Wahrnehmung der Erde als System oder Organismus schon länger ihre Spuren, etwa bei Ingeborg Bachmann oder bei Wulf Kirsten. Dessen wichtigste Gedichte wurden nicht zufällig unter dem Titel Erdlebenbilder (2004) veröffentlicht, der Bezug nimmt auf den Anspruch des romantischen Malers Carl Gustav Carus, im Gemälde sowohl objektives Geotop (Erdleben) wie auch subjektives Landschaftsempfinden (Erleben) auszudrücken.
Nun hat Kirsten einen neuen Band vorgelegt, der Gedichte aus den Jahren 2011 bis 2018 versammelt und schon im Titel auf diesen Anspruch zurückverweist: erdanziehung. In einer entschlackten Sprache schreibt er von den Zentrifugalkräften, die uns zerstreuen und, wie Hannah Arendt schreibt, der „Erdentfremdung“ ausliefern. Trotz aller Freude, die viele der Gedichte verströmen, ist die titelgebende Erdanziehung auch eine schmerzhafte. Denn inwieweit man sich in diesen Landschaften – arbeitend, wandernd, betrachtend – noch selbst erleben kann, ist unsicher geworden. Diesen kulturellen Verlust buchstabiert Kirsten in teils melancholischen, teils sarkastischen Bildern aus:
weit und wüst
verstreut kaufhallen
im gelände, supermärkte
für heimwerker, die den herbst
festnageln wollen
Wie können wir, fragt er, in einer Zeit leben, die „entsorgt / die krumme wahrheit des raums“? Kein deutscher Schriftsteller hat das Nachdenken über den Menschen so tief in die Erdgeschichte eingebettet. Kirsten beschwört eine raumzeitliche Fülle, die uns unsere Erdvergessenheit austreiben will. Auch die Jahreszeiten wechseln bei ihm in der geologischen Tiefenzeit:
weit hinüber
zur breitwannigen Rhône hängt euterschwer
ein jahrgang wein an verknorzten rebstöcken
Nicht alle Gedichte sind von gleicher Güte; manche der literarischen Hommagen und der stilistisch verknappten Gedichte wirken etwas schlaff. Sein Element ist und bleibt die „welthäuslichkeit“ mit ihrer chaotischen Lebensverwobenheit, die er mit seinem unvergleichlichen Satzbau zu erhellen versteht. Glücklicherweise ist diese Satzbaukunst „den flurbereinigern entgangen“:
himmlisches frachtgut, wolkenballen-
geschiebe mit windantrieb, das sich
der erdanziehung widersetzt, vonwegen
v sei g mal t, mein bescheiden teil
blieb zu lebzeiten auf bodenhaftung
bedacht.
Bernhard Malkmus, der Freitag, 13.6.2020
Der Grundfaden gegen das große Taumeln
– In Tuchfühlung mit Eichendorff: Wulf Kirstens neuer Gedichtband feiert die Himmelsschwünge der Erdanziehung. –
Die jüngsten Gedichte Wulf Kirstens sind ein unerwartetes Geschenk. Der in Weimar lebende Autor, den 1986 die Beschwörung seiner linkselbischen Herkunftslandschaft, die erde bei Meißen, in Ost wie West berühmt machte, von Martin Walser emphatisch als Proviant gegen Beschleunigung und Weltverlust empfohlen, schien sich bereits 2004 mit der großen Werkschau erdlebenbilder aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen zu haben. 2012 meldete er sich mit fliehende ansicht erneut zu Wort, und nun, sein 85. Geburtstag steht ins Haus, gelingt ihm mit erdanziehung ein überraschender Coup, den man kaum als Nachlese wird bezeichnen wollen.
Weder werden hier vordergründig Altersweisheit kultiviert noch Lebensmüdigkeit wohlfeil ausgestellt, stattdessen gültige Gedichte vorgelegt, die von der Peripherie kommend, wo sich der „weltbetrachter“ verortet, unsere Gegenwart in neues Licht rücken. Einer Welt, der die Bodenhaftung abhandengekommen und die in virtuellem Schwindel aus den Fugen geraten scheint, stellen sie einen „grundfaden“ (so einer der Titel) gegenüber, der vermeintlich beiläufige und abseitige Details, Anekdoten, Biographien aufhebt und verdichtet – in geschliffenen Partizipialgruppen, die dinglich konkret benennen und aneinandergereiht eine eigene Dynamik entfalten, die durch sparsame Verbprädikate, oft Zeilen später nachgereicht, zusätzlich in Spannung gehalten wird. So entsteht der typische Kirsten-Sound, die Zentrifuge eines begnadeten Gedächtnisses, das nur von dem spricht, was es selber erfahren, erwandert, erlesen hat. Ein zugegeben ausschnitthafter, doch auf seine Art unendlicher Fundus, den Kirsten kongenial kultiviert. Kafkas erotisches Abenteuer in Weimar, das keines war, der als „Kulakendichter“ geschmähte Nikolaj Kljujew, der hellsichtige, als konservativ verschriene 1848er Philosoph Friedrich Rohmer – Kirsten porträtiert Wahlverwandte, als würde er aus dem eignen Leben schöpfen. Titel wie „verwerfungen im relief“, „am weidenpfad“, „physiognomie der landschaft“, „unter freiem himmel“ zeugen von der Passion für sein Lebensthema Landschaft, dem er sich aus nächster Anschauung der fußläufig durchstreiften thüringischen Provinz widmet, die so dem lyrischen Lexikon unbekannte Flecken wie Hottelstedt, Zottelstedt oder Gerega unverhofft schenkt. Das ist noch nicht alles.
Kirstens Gedichte schöpfen ohne jede Larmoyanz und Beschönigung aus dem Reservoir der Erinnerung, zitieren das Verschwindende oder längst Verschwundene, die aus dem Gebrauch gekommenen Wörter und Tätigkeiten eines ländlichen und landschaftlichen Wissens, die mehr denn je wie erratische Fremdkörper wirken. Neu ist dabei, dass der poetische „irrläufer“ sich selbst inzwischen fremdgeworden ist – und seine Weltfremdheit in mitunter beißendem Sarkasmus bekennt. Wulf Kirstens anachronistischer Chronist ist ungefragter „zeitzeuge“, der seine Memorabilien mit dem Abendlicht teilt und als Zeitgenosse aus der Zeit gefallen ist:
teilhaber am abendlicht
als oft genug verlachter
weltbetrachter, gräben
geschachtet mit hacke und
schaufel, knochenhart,
versteinte berge superphosphat
pulverisiert, als ich wallraffte
im feldbau einst zu Riemsdorf,
blau gefrorene winter den hohlweg
hinauf gleich hinterm elternhaus,
zugeschüttet mit schnee,
bunker gebaut, fast selber
im iglu vereist, das waren noch
winter, wenn einer starb,
mußte er eingekellert liegen,
bis er im pferdeschlitten
einzog aufs gräberfeld
des kirchspiels, da kannte ich
einen uralten, verborgen
unter bartgestrüpp, gesegnet
vom zeitlichen mit achtundachtzig,
da war ich gerade mal acht,
mir achtzig voraus, jahrgang 1854,
nun selbst achtzig verweht,
irrläufer meiner selbst, der
von verflossenen jahrhunderten
zu berichten weiß, zeitzeuge
wider willen nolens volens.
Wulf Kirsten hat aus verschiedenen Traditionslinien diese Art Gedicht entwickelt, das formstreng und flexibel, subjektiv und distanziert zugleich „die alltäglichen banalitäten“ in „poetische rede fermentiert“, wie es in „welthäuslichkeit“ heißt. Das Gedicht „Eichendorff“ betont, gleich dem Romantiker mit Blick auf ein Schloss zur Welt gekommen zu sein – dann hören die Gemeinsamkeiten auf, denn Kirstens Wiege stand unter einem zum Einsturz verurteilten Lehmgiebel, „über bäume und sträucher hinweg / bis zu den feldern der elpégé / ,O Täler weit, o Höhen‘, so blieb ich / in tuchfühlung jeden morgen / mit Joseph von Eichendorff“. Kirstens Maxime, Georges hohen Ton durch den Filter Brechtscher Profanierung zu brechen, gilt auch für seine unmittelbaren Vorbilder in Sachen Landschaft, Huchel und Bobrowski, denen er nicht so sehr in der Form, wohl aber mit dem Blick in die geschichtlichen Verwerfungen eines bäuerlichen Naturraums nah ist, der inzwischen selber Geschichte ist und jede Idylle widerlegt.
In seiner Schlichtheit ergreifend ist in dieser Hinsicht „spielplatz“, eine Apologie auf die Kunst des Heueinfahrens („in die holme des schiebbocks / gegriffen und bugsiert, / ein balanceakt“) und Denkmal für „Franz aus der Ukraine, / deportiert mit fünfzehn… ich hab ihn, / als ich zehn war, bewundert“. Meisterhaft schließlich Kirstens Zwiegespräch mit Rilke in einer Apostrophe an die Mauersegler über dem sommerlichen Stadthimmel. Hier findet er Verse, die sich mit den „kühnen / hohen Figuren des Herzschwungs“ der Fünften Duineser Elegie messen können und die doch trotz der himmlischen Erscheinung, der sie gelten, eine ganz irdische Freude vermitteln:
in eleganten schwüngen ziehen sie
bis in unsichtbare höhen hinauf,
zu schwarzen punkten vereinigt,
schweben sie wetterflüchtig
taglang über den wolken, heißt es,
mitunter den vollmond umkreisend,
dies sah ich mit eigenen augen.
Mögen die Freuden solcher Weltbetrachtung Wulf Kirsten und seinen Lesern lange erhalten bleiben.
Jan Volker Röhnert, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.6.2019
… so manch ein junger Kollege kann sich hier
mehr als eine Scheibe von abschneiden!
Von Wulf Kirsten hatte ich länger nichts gelesen, um so schöner, jetzt in diesem neuen Gedichtband den alten Dichter mit neuen Werken wiederzutreffen. Und was mich besonders freut, er bleibt aktuell: Er beschreibt mir den Ort Gerega und ich muss erst nachschauen ob es dieses Nest wirklich gibt, später schäme ich mich dafür, wie konnte ich nur…
Was Wulf Kirsten beschreibt das existiert und ich meine nicht nur gottverlassene Orte. Der Dichter selbst meinte einmal: Überall sei WeltMitte und er behält recht, mit Gerega und seinen Bewohnern beweist er es aufs neue!
Dieser Dichter ist Chronist in mancherlei Hinsicht. Er beschreibt die Natur, vor allem Veränderungen in ihr, sogar im „Staunässegebiet“ macht sich die Dürre bemerkbar und er versteht es mindestens ebenso, in politischen Fragen eine scharfe Klinge zu führen, gute Beispiele dafür wird der geneigte Leser schnell in diesem Büchlein finden.
Die Gedichte des Wulf Kirsten sind so bunt wie das Leben und sie verraten in aller Deutlichkeit den Standpunkt des Dichters, für Beliebigkeit ist hier kein Platz, so manch ein junger Kollege kann sich hier mehr als eine Scheibe von abschneiden!
Christian Döring, amazon.de, 27.5.2019
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Jens-F. Dwars: Widerborstige Sprachlust
Erstdruck in Palmbaum Heft 2, 2019
Wulf Kirsten zu Ehren
Ich hätte es nicht für möglich gehalten: Weil mir die Ehre zuteil wird, eine Laudatio auf Wulf Kirsten halten zu dürfen, wird mir zusätzlich die Ehre zuteil, Cuxhaven kennen zu lernen. Schuld daran ist Hans Bötticher, der sich Joachim Ringelnatz nannte. Er ist allerdings keineswegs in Cuxhaven geboren, sondern – was Wulf Kirsten viel näher liegt – in Wurzen bei Leipzig, im Freistaat Sachsen also.
Ringelnatz, der Mann mit 30 Berufen. Ein fahrender Gaukler, ein Nichtsesshafter, der sächsische Seemann, der als Kommandant eines Mienensuchbootes in Cuxhaven stationiert war, der Seemann unter den Dichtern des frühen 20. Jahrhunderts. Er gibt dem hoch angesehenen Preis seinen Namen. Er ist der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für Ihre freundliche Einladung. Ich bin neugierig auf Ihre Stadt.
Auf Peter Rühmkorf, Robert Gernhardt, Wolf Biermann, Barbara Köhler folgt in diesem Jahr Wulf Kirsten. Und das aus gutem Grund.
Wulf Kirsten zu loben, fällt mir leicht, denn ich bin ihm in seiner zweiten Heimat, in Thüringen, vornehmlich in Weimar, in den letzten fast 20 Jahren immer wieder begegnet. Ich habe große Hochachtung vor ihm und ich habe ihm viel zu danken. Er gehört zu den Persönlichkeiten, die mir geholfen haben, meinerseits meine zweite Heimat in Thüringen, in einem der jungen Länder zu finden.
Als ich im Februar 1992 nach Thüringen gerufen wurde – von den Thüringern und nicht, wie immer wieder behauptet wird, auf Weisung von Helmut Kohl – habe ich drei oder vier Thüringer mit Namen gekannt. Und von den Lebensverhältnissen in den fälschlicherweise als neue Länder bezeichneten ostdeutschen Ländern – sie alle sind viel älter als die westdeutschen Bindestrich-Kinder Nachkriegsdeutschlands – wusste ich soviel, wie eben ein Westdeutscher wissen konnte, der die DDR zwar regelmäßig besucht hatte – stets auffällig unauffällig von den Sicherheitskräften begleitet und der immer auf die Wiedervereinigung gehofft hatte, aber nicht geglaubt hatte, sie selbst noch zu erleben. Und wir wussten viel zu wenig, viel weniger als die Ostdeutschen von Westdeutschland.
Das sollte sich für mich, nachdem das größte Abenteuer meines Lebens begonnen hatte, bald ändern. Auch Dank Wulf Kirsten. Dank seiner Person und Dank seines Werkes. Ihn zu loben, fällt mir leicht. Das Lob zu begründen dagegen, ist für mich eine schwierige Herausforderung. Ich bin nur Politiker, habe Politische Wissenschaft und Geschichte studiert, aber ich bin kein Germanist und ich habe ein Wort Heinrich Bölls im Ohr, es gehöre zur Natur der Sache, dass Politiker „törichte Äußerungen über Literatur von sich geben.“ Ich werde mich also in Acht nehmen.
Gedichte zu lesen, macht mir Spaß; sie angemessen zu interpretieren, sie wissenschaftlich zu analysieren, habe ich nicht gelernt.
Wulf Kirsten ist ein Dichter von Rang. Er zählt zu den bedeutendsten deutschen Dichtern der Gegenwart und er ist zugleich eine Ausnahmegestalt in der deutschen Literatur, mit der sich – so Manfred Osten – Gedächtnis und Hoffnung verbinden. Sein umfangreiches literarisches Werk besteht aus einer Vielzahl von Lyrikbänden, aus Erzählprosa, Essays, Reden und Aufsätzen. Er ist in erster Linie Lyriker.
Reiner Kunze sah in ihm schon vor Jahrzehnten „die größte Hoffnung der ,DDR-Lyrik’“. Er ist Chronist, Wortsucher und Wortsammler, Wortbewahrer und Worterneuerer. Jochen Hieber nennt ihn „einen Landvermesser“.
Sein Hauptthema ist die Natur. In der Urkunde zur Verleihung des Weimar-Preises 1994 heißt es:
Wulf Kirsten ist der eigenständigste politische Landschafter in der deutschen Gegenwartsliteratur. Er hat dem Landschaftsgedicht […] durch die ihm eigene Gedächtnistreue, Sperrigkeit und Musikalität ein neues Gepräge gegeben.
Für ihn trägt die Landschaft immer auch soziale, historische und politische Züge. Ein Dichter, der genau hinschaut und der von sich selbst sagt, er sei „der Okularinspektion nie überdrüssig geworden“. Akribische Beobachtung und Spurensuche sind die ersten Schritte. Erst dann folgt die Verwandlung in Poesie. Aber wieder ist das Vorgehen von äußerster Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gekennzeichnet. Als „inständiges Benennen“ beschreibt er die sprachliche Umsetzung.
Heute mag es schwierig sein, darin eine künstlerische Haltung zu entdecken, die politisch höchst brisant sein kann. „Zur Zeit der Brüderküsse“ – die Formulierung stammt von Wulf Kirsten – war sie es. Und Wulf Kirsten muss dies sehr genau gewusst haben.
Er ist als Autor gegen die Kunstdoktrin der DDR resistent geblieben: kein Lobgesang auf die Partei, keine Verheißung einer strahlenden sozialistischen Zukunft. Arbeiterhelden und Aktivisten als Verkörperung eines „neuen Menschen“ fehlen. Kein falsches Pathos, keine ideologischen Phrasen und Parolen. Seine Gedichte, ihre Wirklichkeitsfülle, ihre sprachliche Präsenz, sein dichterisches Verantwortungsbewusstsein, kollidieren mit der Doktrin – mit dem „sozialistischen Realismus“, einer Ästhetik außerhalb jeder Realität, ohne Erfurcht vor Wahrheit und Wahrhaftigkeit, vor dem wirklichen Leben der Menschen und ihrer Geschichte.
Wo Literatur authentisch ist, wo sie auf Beweiskraft und Wahrheit setzt, tritt sie in Gegnerschaft zur Ideologie und ideologisch verbrämter Macht. Dass Wahrheit befreit, ist nicht nur die Botschaft des Evangeliums. Vaclav Havels „In Wahrheit leben“ war eine Tugend, die unter den Bedingungen der Diktatur schwer durchzuhalten war, die aber der friedlichen Revolution von 1989 den Weg bereitet hat.
Bertolt Brecht sagt:
Der einzelne hat zwei Augen – die Partei hat tausend Augen.
Wulf Kirsten hat seinen eigenen Augen mehr getraut und geriet dadurch in eine immer kritischere Haltung zu Partei und Staat. Er selbst hat einmal von einem „Stillhalte-Abkommen“ mit dem DDR-System gesprochen. Beide Seiten haben es nicht eingehalten. Über viele Jahre hinweg stand Wulf Kirsten unter „operativer Kontrolle“ der Stasi und er wurde zu einem, der sich aktiv einmischte.
Ich habe nie auf eine Doktrin gesetzt und geglaubt, dass Utopien Utopien sind. (Wulf Kirsten)
Sein künstlerischer Ansatz ist mit dem Fall der Mauer nicht obsolet geworden. Auch heute brauchen wir Sehhilfen für eine umfassende, sensible Wahrnehmung der Wirklichkeit. Dichter, die an einen verantwortlichen Sprachgebrauch appellieren, eine Literatur, die Trägerin unseres kulturellen Gedächtnisses und Gewissens ist, die historische Erinnerungen möglich und lebendig macht.
Dass Wulf Kirsten, was er schreibt, durchgehend klein schreibt, sei ihm gestattet. So lange er nur seine Aussagen groß schreibt. Martin Walser hat die Sprache Wulf Kirstens gewürdigt. Eine Sprache, „in der man sich verproviantieren kann“, gegen Geschwindigkeit, Anpassung, Verlust. Kirstens Sprache urteilt nicht. Sie schleppt Sachen heran gegen das Vergessen.
Da ich außer dieser, meiner Sprache, nichts wirklich besitze, muss ich ihr zentralen Wert beimessen. (Wulf Kirsten)
Geschichte wird für Wulf Kirsten ablesbar und greifbar in ihren Landschaften. Er geht Spuren nach, macht sie sichtbar, prüft sie kritisch. Spuren, die nicht verblassen dürfen, weil sie die Erinnerung wach halten.
Seine Heimat ist die „erde bei Meißen“. Das gleichnamige Gedicht gibt der Sammlung den Titel, die 1986 in Leipzig, 1987 auch in Frankfurt erstmals erschien. Seine Heimat ist die obersächsische Landschaft seiner Kindheitstage – ausgezehrt von „landschaftsausräumenden“, „megalomanischen Steppenfürsten“ und „kollektivistischen Bodenreform-Pionieren“. Er schildert seine „Frühprägung“ vor 1945 und die „wahrheitsscheuen, also wissentlich geschichtsverzerrenden Gegebenheiten im Osten Deutschlands nach 1945“, aber auch seine „Gegenwelten“, die ihm „mittels Lektüre die grenzüberschreitenden Freiräume“ gewährten.
In seiner zweiten, seiner Thüringer Wahlheimat, die er sich – wie auch ich – erwandert hat, hat ihn in Weimar vor allem der „Berg über der Stadt“, der Ettersberg, in seinen Bann gezogen. Ein Berg, der ihn nicht schlafen und nicht ruhen lässt. Ein Berg, der wie kein anderer Ort in Deutschland das Spannungsfeld zwischen Humanität und Barbarei, zwischen Freiheit und Totalitarismus deutlich machen kann.
Zwischen Goethe und Buchenwald – so der Untertitel seines Bildbandes, der 2003 noch bei Ammann in Zürich erschienen ist, der Unbeschreibliches zu beschreiben sucht. Nur 1.300 Meter von dem Ort entfernt, an dem Goethe als Orest in seiner Iphigenie auf Tauris brillierte und an dem Herder von seinem Ideal einer Gesellschaft der Humanität und der Toleranz sprach, entstand auf dem Ettersberg das Konzentrationslager Buchenwald, ein Ort des Grauens und der Menschenverachtung. Elie Wiesel und Jorge Semprun gehörten zu den Häftlingen, die vor 65 Jahren, am 11. April 1945, von den Amerikanern befreit wurden.
Ein Berg, auf dem mit der Internierung vieler Unschuldiger durch die sowjetische Besatzungsmacht erneut Unrecht geschah. Eine Tatsache, die zu DDR-Zeiten verschwiegen wurde.
Wulf Kirsten ist 1934 in Klipphausen auf den Elbhöhen zwischen Dresden und Meißen geboren. Der Steinmetzsohn wird Handelskaufmann, Bauhilfsarbeiter, Buchhalter, holt sein Abitur nach und studiert in Leipzig Deutsch und Russisch für das Lehrfach, arbeitet ein Jahr als Lehrer und wird 1965 für Jahrzehnte Lektor beim Aufbau-Verlag. Seit 1988 ist er freiberuflich tätig. Eine Chronik seiner Kindheit in Klipphausen – einem Dorf mit damals 60 Häusern und 300 Seelen, das er erst mit 23 Jahren verlässt – erscheint im Jahre 2002: Die Prinzessinnen im Krautgarten. Wir hoffen auf Fortsetzung.
Seit über 40 Jahren lebt er in Weimar, „seiner Stadt“, wie er selbst sagt. Weimar ist für ihn zum Lebensmittelpunkt geworden.
Natürlich hat sich Wulf Kirsten 1989/90 engagiert. Er beteiligt sich an der Bürgerbewegung und legt in Weimar selbst Hand an. An der Auflösung einer der unmenschlichsten Instrumente der SED-Diktatur, der Stasi, hat er aktiv mitgewirkt. Für das Neue Forum zieht er in den Stadtrat ein, wird Fraktionsvorsitzender. Heute hat Wulf Kirsten keine politischen Ämter mehr inne, aber er ist ein Poet, der – wie ein Kritiker schrieb – „mitten in der Realität arbeitet“ und das heißt, er ist dem Politischen niemals fern, er äußert sich entschieden, gelegentlich heftig. Gegen Rechtsradikalismus, gegen das Verdrängen der NS-, aber auch der DDR-Vergangenheit, bezieht er Stellung. „Ich protestiere. Toleranz gegen Intoleranz funktioniert nicht.“. „Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, die sich nicht leichtfertig aushöhlen lässt.“
Ich sprach über Wulf Kirsten – aber er soll auch selbst zu Wort kommen. Ich wähle die ersten zwei Strophen eines Gedichtes, das wohl bei einem späten Lokaltermin in Klipphausen entstanden ist, gegen Ende der DDR-Zeit. Es drückt seine Desillusionierung über die Entwicklung auf dem umverteilenden, bodenreformistischen, sozialistischen Lande aus. Eine Begegnung mit zwei alten Leuten, die er – man denke an den Schluss von Goethes Faust II – Philemon und Baucis nennt. Entschuldigen Sie, dass ich des Sächsischen immer noch nicht mächtig bin.
DAS HAUS IM ACKER
einsiedlerisch das haus, mitten im acker,
mit elbtalblick, hinweg über bewaldete schlüchte.
hemmschuh des fortschreitenden fortschritts.
bewohnt von zwei alten: Philemon und Baucis.
keine murre mehr in den knochen,
kollektivierte bodenreformpioniere,
auf rente gesetzt. am stocke der bauer,
die augen gerichtet auf eine andere welt,
präpelnd und bärmelnd die abgeschuftete,
wacklige frau im geschäftigen leerlauf:
die warten schunn, daß mehr baale schdärm.
dann kumpt de raupe un macht alls gleiche,
unser haus, alles, was mir uns gebaut ham
hier oum uffm bärche, werd wieder feld.
das haus im acker, dorn im auge
der planierstrategen, großraumdenker,
flurbereiniger, landschaftsausräumer,
megalomanischer steppenfürsten, die
von hundert-hektar-flächen, glatt wie
rennpisten, träumen. jede unebenheit
weggehobelt, jede erhebung glattgewalzt und
plattgedrückt. Die feldbestellung vollmechanisiert.
traktorenwettfahrten, wie aus der pistole
geschossen über den acker gedonnert
ratterndes, knatterndes, rotierendes
agrofuturum, keine lebende hecke, an der
sich ein auge vergafft. feldwege eingeackert,
flüsse verrohrt und begradigt, drainagen
gelegt, ganze täler zugeschüttet,
alleen geschleift, sträucher ausgerottet,
jeden baum ausgezogen. windschutz und
singvögel? unnützes zeug, romantik!
alles nur störenfriede. weg damit!
Eine bittere Bilanz. Eine Kapuzinerpredigt nennt Karl Corino in seinem Festvortrag zur Ehrenpromotion Wulf Kirstens in Jena vor ein paar Jahren das Gedicht und erinnert an Schillers Wallenstein.
Alles, was die in der DDR unterdrückte ökologische Bewegung schon immer sagen wollte, hier ist es gesagt mit gezügeltem Zorn, mit kontrollierter Wut. (Karl Corino)
Wulf Kirsten meinte einmal: „Selbst denken, selbst finden“ habe den Preis, dass er nur eine Außenseiterrolle spiele. Ich widerspreche: Wortbewahrer, Worterneuerer, politische Gedichteschreiber sind keine Außenseiter. Und ich rufe alle diejenigen als Zeugen an, mit deren Namen er in den letzten Jahren ausgezeichnet und geehrt worden ist: Johannes R. Becher (Preis 1985), Peter Huchel (Preis 1987), Heinrich Mann (Preis der Akademie der Künste der DDR 1989), Elisabeth Langgässer (Preis 1994), Erwin Strittmatter (Preis für Umweltliteratur 1994), Fedor Malchow (Preis 1994), Horst Bienek (Preis für Lyrik 1999), Marie-Luise Kaschnitz (Preis der Evangelischen Akademie Tutzing 2000), Friedrich Schiller (Ring 2003), Joseph von Eichendorff (Preis 2004), Joseph Breitbach (Preis 2006), Walter Bauer (Preis 2006), Christian Wagner (Preis 2008). Eine große Dichterfamilie hat sich um Wulf Kirsten versammelt. Ich zweifle, dass sie vollständig ist.
Der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit dem er 2005 – nach Herta Müller und vor Uwe Tellkamp ausgezeichnet wurde, sei noch erwähnt.
Der Vielgeehrte war Stadtschreiber in Salzburg (1992), in Dresden (1999) und in Bergen-Enkheim (2000). Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt), der Akademie der Künste (Berlin), der Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz), der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (München) und des PEN-Zentrums Deutschlands.
Das ist viel, aber was heute hinzukommt, ist die Krönung: der Joachim-Ringelnatz-Preis der Stadt Cuxhaven. Er möge ihm Freude bereiten und ihn ermutigen.
Wir erwarten noch viel von Ihnen und wir brauchen Sie in aller Unübersichtlichkeit unserer Gegenwart.
Herzlichen Glückwunsch Ihnen und der Stadt Cuxhaven!
Bernhard Vogel, Laudatio zur Verleihung des Joachim-Ringelnatz-Preises für Lyrik der Stadt Cuxhaven 2010, aus: Frank Möbus (Hrsg.): „Alte Liebe“, 2011
Dankrede zum Ringelnatz-Preis
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Stabbert, verehrter, lieber Herr Professor Vogel, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Während der Jeanette-Schocken-Literaturtage 2004 chauffierte Johann Tammen einige Teilnehmer von Bremerhaven nach Cuxhaven. Eine unerwartete Begegnung mit dieser Stadt, die aus meiner Perspektive hoch im Norden liegt. Rolf Haufs, der an dieser Exkursion teilnahm, konnte hinterher leicht sagen:
Kirsten ist nicht maritim.
Aus dem innersten Sachsen stammend, seit fast einem halben Jahrhundert in Weimar ansässig, bekenne ich, ein durch und durch kontinental geprägter Mensch zu sein, dessen Ideallandschaft Hügel im Relief aufweist, möglichst dreihundert Meter über dem Meeresspiegel gelegen.
Immerhin weiß ich seit jenem Mai-Ausflug, dass es hier ein Joachim Ringelnatz gewidmetes Museum gibt und wie es eingerichtet ist. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich, auch ein anderer großer Dichter hatte hier dichtbei sein Domizil: Barthold Hinrich Brooks (Brockes). Gerade las ich wieder zur Auffrischung den fundamentalen Essay von Eberhard Haufe, der der Auswahl Im grünen Feuer glüht das Laub (Kiepenheuer Verlag Weimar 1975) beigegeben wurde. Wenn das kein Spannungsbogen ist, weiß ich nicht. Wie heißt es doch so lapidar in einem Gedicht Elke Erbs, als sie Adolf Endlers gedachte:
Die Dichter wohnen in den Jahrhunderten.
Und dann noch mitunter in ein und demselben Straßenzug. Aber wie hätte ich ahnen sollen, aus welchem Anlass ich nach sieben Jahren wiederum nach Cuxhaven gelotst wurde. Welch ein Glück, dass es derzeit keine Minensuchboote zu besetzen gilt. Ohnehin hat mich der Ehrgeiz, militärische Ehren, Orden und Ränge einzuheimsen, nie geritten.
Auch wenn ich in diesem illustren Kreis wohl voraussetzen darf, dass die Biografie des Preis-Patrons wohlbekannt ist, werde ich mich auf die Vorführung einiger weniger kontinental gelegener Bötticher-Schauplätze beschränken, wohl wissend, dass ich hier nicht zu einem Familientag aller bürgerlichen und geadelten Böttichers geladen bin. Im Hinterland von Jena, dem Geburtsort von Vater Georg Bötticher, liegt noch immer abgeschieden waldinmitten das Dörfchen Tautenburg. 1879 kam der damalige Pfarrer Hermann Otto Stölten auf die moderne Idee, für eine Sommerfrische Reklame zu machen. 1882 dirigierte Elisabeth Förster-Nietzsche ihren Bruder dorthin, in der Absicht, besagter Pfarrer könne ihn von seiner immer religionsfeindlicher werdenden Haltung heilend abbringen. Den Gefallen tat er der Schwester mitnichten. Er lebte dort vielmehr in brennender Erwartung auf den Besuch der einundzwanzigjährigen Russin Lou Salomé. Die ihn allerdings wochenlang auf die Folter spannte, so dass genügend Zeit blieb, die Fröhliche Wissenschaft abzuschließen. Als sie endlich kam, fungierte die Schwester als eifrige-eifernde Tugendwächterin, was Friedrich und Lou zu ausgiebigen Waldspaziergängen zwang. Er logierte bei einem Gärtner Hahnemann, dessen Anwesen mit einer an den illustren Gast erinnernden Tafel geschmückt ist. Den lärmempfindlichen Philosophen störte das zu häufige und laute Krähen eines Hahns. Kategorisch verlangte er:
Das Tier muss weg!
Woraufhin der Hahn zum letzten Flug ohne Kopf ansetzte. Elisabeth und Lou wohnten im Gasthof. Ich verkneife mir, alle Gäste aufzuführen, die die Fremdenlisten verzeichnen. Sie werden es mir hoffentlich nachsehen, dass ich versucht war, die Biografie des Philosophen und die von Joachim Ringelnatz manipulativ so zu verschieben, um ein Zusammentreffen beider zu arrangieren. Die unbändige Wahrheitsliebe im Bunde mit historisch beglaubigten Daten hielt mich vor diesem Konstrukt zurück. Tatsache aber ist, Vater Bötticher, mit Pfarrer Stölten befreundet, verbrachte etliche Ferienaufenthalte in der Sommerfrische Tautenburg, woran sich der Sohn Hans in seinen Erinnerungen Mein Leben bis zum Kriege dankbar erinnerte. Im benachbarten Frauenprießnitz, wohin Stölten 1886 wegen Querelen mit der Dorfbevölkerung entwichen war, wurde Ringelnatz mit seinen Geschwistern 1893 getauft. Während es immerhin wieder eine Nietzsche gewidmete Waldbank gibt, steht dies für Ringelnatz noch aus. Auch der Dramatiker Reinhard Johannes Sorge, Ricarda Huch und James Krüss verdienten es, mittels einer gezimmerten Auszeichnung geehrt zu werden. Dass Ringelnatz auf Burg Lauenstein in Seppelhosen den Fremdenführer spielte, in Waltershausen bei Gotha dem wanderseligen August Trinius, der Thüringen die unsterbliche Kitsch-Metapher vom grünen Herzen Deutschlands anhing, seine Aufwartung machte, mag hingehen. Viel merkens-würdiger finde ich hingegen jene in Thüringen gelegenen Orte, in denen Ringelnatz unbemerkt auf den Spuren Nietzsches wandelte wie in Tautenburg. In dem nahe Schulpforta gelegenen Kösen trank der Heimschüler Nietzsche verbotenerweise ein Bier. Ringelnatz vermutlich eins mehr. In dem Gedicht „Ansprache eines Fremden an eine Geschminkte vor dem Wilberforcemonument“ (1920), in dem Ringelnatz an seinen Aufenthalt in der englischen Stadt Hull erinnert, denkt er an das Dorf Kunitz bei Jena. Bis heute berühmt, nicht weil Nietzsche und Ringelnatz dort waren, sondern wegen eines geheimnisumwitterten Eierkuchens, der noch immer schwer zu erlangen ist. Nietzsche soll das Wasser im Munde zusammengelaufen sein, wenn das Gespräch auf dieses Gebäck kam. Theodor Fontane, der sich 1867 und 1873 in Kösen aufhielt, muss auf seinen Wanderungen durch Thüringen auch in besagtes Dorf gelangt sein. Zu seiner Zeit wurde die Delikatesse im Gasthof Die Katze angeboten. Die Zubereitung ist bis heute ein streng gehütetes Geheimnis geblieben. Ringelnatz muss den Geschmack, den er in seiner Kindheit von der inzwischen abgebrannten Burgruinen-Restauration über dem Ort Kunitz mitnahm, auf der Zunge behalten haben, so dass er ihn vor dem Monument des Philanthropen, der sich für die Abschaffung der Sklaverei verdient gemacht hatte, nachschmecken konnte. In weit engerer Beziehung stand Ringelnatz zur Stadt Eisenach. Eine Bekannte aus München leitete dort ein Mädchenpensionat, in dem sie Sprachlehrerinnen ausbildete. Einer ihrer Schülerinnen, die ein schwarzes Samtkleid trug, gab Ringelnatz den Kosenamen Maulwurf. 1913 verlobte er sich mit ihr. Als er bei den Eltern der Braut um deren Hand anhielt und in treuherziger Wahrheitsliebe gestand, ein armer Schlucker zu sein, wurde ihm das Jawort verwehrt. Bei einem späteren Besuch im Eisenacher Pensionat von Dora Kurd (auch Kurtius) begegnete er der fünfzehn Jahre jüngeren Leonharda Pieper, die 1920 seine Frau wurde, fortan Muschelkalk genannt, wohl nach dem in Thüringen weit verbreiteten Grundgestein. Als er einmal am Unterricht der Mädchen teilnahm, fragte er examinierend nach Goethes Rinderbrust-Gedicht, wodurch er sich den Unmut der Lehrerin zuzog.
Als gebürtigem Sachsen war es ihm eine angeborene Urlust, heiligste Güter der Nation zu verhohnepiepeln. Bei allen Unterschieden zwischen dem residenzstädtischen Dresdner Sächsisch und dem des weltstädtischen Leipzig, das Ringelnatz mit der Muttermilch aufgesogen hatte, von meinem weniger geläufigen Elbhöhen-Südostmeißnisch der Wilsdruffer Pflege abgesehen, von dem Chemnitzer Gebirgs-Singsang mit ausgeprägtem zweigipfligem Silbentonwechsel ganz zu schweigen, treffen sich alle Varianten in einer ausgesprochenen Ulkfreudigkeit, womit schon vorgreifend Wesentliches zu Joachim Ringelnatz gesagt sein soll. Bei der Gelegenheit erlaube ich mir den Hinweis, das durch ausgezeichnete Kekse und den noch ausgezeichneteren Ringelnatz berühmt gewordene sächsische Städtchen Wurzen ist zwar Geburtsort und wird es auch bleiben. Aber da der Vater samt Familie bereits 1887 von der Mulde an die Pleiße übersiedelte, dankt der Dichter seine Prägungen dem Idiom und der Mentalität der weltläufigen Messe-, Universitäts-, Buch- und Verlagsstadt Leipzig. Vater Bötticher reimte in Leipziger Mundart. Filius Hans schrieb als Dreizehnjähriger in eben derselben „Änne Häringsgeschichte“. Zum Glück überließ er derartiges Getümel dann seinem Kollegen Hans Reimann. Der häufige Ortswechsel, vor allem die öffentlichen Auftritte im Münchner Simplicissimus müssen ihn dann rasch davon abgebracht haben. Allerdings ließ er es sich ungeachtet all seiner Vorlieben fürs Maritime nicht nehmen, in seinem Vortragsstil die Herkunft idiomatisch durchklingen zu lassen, was sich mir als gebürtigem Sachsen als sympathischer Vorzug darstellt.
Wenn ich es auch nicht auf 35 Berufe gebracht habe, die sich Ringelnatz – wohl doch etwas aufgerundet – zuschreibt, kann ich doch ebenso mit recht disparaten Branchen aufwarten, in denen Staub zu wischen war, so dass es mit der selbstbescheinigten krummbeinigen Biografie schon seine Richtigkeit hat. Ringelnatz sah sich „etwas schief ins Leben gebaut“. Bei aller Stilisierung gilt mir dies als eine ins Zentrum der Biografie treffende Feststellung, die nicht aus der Luft gegriffen ist. Mit Bemerkungen wie dieser kommt er mir nahe. Lebensstoff die Menge, erfahrungsgesättigt, kenntnisreich „von unten geholt“. Wohl liebte er es, Rollen zu spielen und dementsprechend auch Rollengedichte zu schreiben. Aber die Rollen wurden zu einer nicht mehr zu trennenden Identität. Auch so konnte der entbürgerlichte Bürger, ständig auf der Flucht in eine Gegenwelt und Gegensprache, der mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hatte, bestehen als Ich und der Andere in einer Person. Wie ihm wurde auch mir ein Lehrjahr erlassen. Während er sich mit der agrar-romantischen Idee trug, Ackerbau zu treiben, hatte ich eine ähnliche Idee, in der auf Baumschule gesetzt wurde, sehr früh hinter mich bringen können. Während er „in Dachpappe machte“, setzte ich auf Mehl. War gehalten, Hindenburglichter zu zählen, Staufferfett auszuwiegen, eine Sack-Kartei zu führen, Journalseiten zu addieren. Wollte ich alle Lebensstationen des von Ziellosigkeit getriebenen Unruhegeistes kommentierend ausleuchten, ginge darüber ein ganzer Tag hin. Ich verweise auf Herbert Günther, Walter Pape, Helga Bemmann, auf die beiden Erinnerungsbücher von Ringelnatz. Bei der Lektüre stieß ich auf den Bibliophilen Fritz Schirmer, Lehrer in Halle, vorwiegend jedoch Sammler. Bislang wusste ich lediglich, dass er sich mit dem Weimarer Schriftsteller Konrad Weichberger (1880-1948) angelegentlich beschäftigt hatte. Leider hat er außer Briefen so gut wie nichts überliefert. Seine Witwe starb vor wenigen Jahren fast hundertjährig im Weimarer Sophienhaus. Mehr über ihn weiß mein Freund, der Geologe Prof. Dr. Walter Steiner, dessen Lehrer er war.
Auf Ringelnatz kam ich vermutlich als Leser; als einer, der Gedichte abschrieb und auswendig lernte. Ich entsinne mich jedoch an eine regelrechte Ringelnatz-Begeisterungs-Woge, die 1957/58 eine Gruppe von Schülern der Leipziger ABF erfasste und zu einem Um-die-Wette-Dichten in Ringelnatz-Manier führte. Welch eine befreiende Gegenwelt der anarchisch-sinnige Unsinn, die ins Groteske gesteigerte Realität der Heimbewohner künstlerisch zu überhöhen. Gerade war ein Dozent gefeuert worden, weil er in einem nicht offiziellen Literaturzirkel über Albert Schweitzer und über Thomas Mann gesprochen hatte. Die Deutsche Bücherei am Deutschen Platz bot die Möglichkeit, mittels eines Selbsthelferprogramms das vorgeschriebene Pensum beträchtlich zu erweitern. Zu dieser außerplanmäßigen Lektüre zählten sehr früh die Bücher von Joachim Ringelnatz. Und wie sollten ausgeprägte Sportnullitäten nicht von seinen Turngedichten begeistert gewesen sein. Nachdem ich das Reck im freien Fall verlassen hatte und den Scheintoten mimte, war ich ein für allemal von derartigen Zumutungen befreit. Da war Ringelnatz, der mit seinen Gedichten die erfundene Sprache des ewig-unseligen Turnlehrers Friedrich Ludwig Jahn einfallsreich vergackeierte, ein guter Lehrmeister.
In der eben erschienenen Lyrik-Anthologie Beständig ist das leicht Verletzliche. Gedichte in deutscher Sprache von Nietzsche bis Celan (Amman Verlag Zürich) ist Joachim Ringelnatz mit sieben Gedichten vertreten: „Vorm Brunnen in Wimpfen“ (1920), „Frühling hinter Bad Nauheim“ (1924), „Komm, sage mir, was du für Sorgen hast“ (1928), „Die neuen Fernen“ (1931), „Schiff 1931, Nichts geschieht“ (1931), „Viel gesiebt“ (1933). Die Auswahl lässt leicht erkennen, wie sich der Schwerpunkt meiner Wertschätzung auf die nachdenklicher gewordenen lebensweisen Gedichte der letzten Lebensjahre verlagert hat.
Ohne Sie jetzt noch lang und breit literaturwissenschaftlich traktieren zu wollen, möchte ich Sie doch wenigstens in aller Kürze wissen lassen, wie ich den Dichter in seinen Stärken sehe, was er mir gilt. Das Erstaunliche ist, dass einer, der zu seinen Lebzeiten nie so recht für voll genommen wurde, sukzessiv in den unumstrittenen Rang eines Klassikers aufgerückt ist. Allein dieser Werdegang von der kabarettistischen Ulknudel zu einer festen Größe post mortem ist ungewöhnlich, also verrückt genug. Als Berufsbezeichnung gab Ringelnatz Artist an. Er war tatsächlich einer von hohen Graden. Ich denke dabei an einen aus dem Reitsport genommenen Begriff. Er verstand es meisterhaft, Volten zu schlagen, sprachlich umgesetzt, ein poetischer Kunstspringer, ein Voltigeur. So liebte er es, vermutlich ohne theoretische Grundierung und ohne darüber poetologisch zu reflektieren, weit auseinander liegende Bezüge kurzzuschließen und unter Spannung zu setzen. Eben jener Stromfluss gibt seinen Gedichten das unverwechselbar Spannende. Wie andere auch frage ich: Was macht seine Gedichte so haltbar? Gewiss auch sein Ergriffensein, seine Fähigkeit, noch über Banalstes staunen zu können. Wie er dabei Krudestes förmlich veredelt, indem er es dem allzu Prosaischen entzieht. Dass bei dieser Gratwanderung Texte abgestürzt sind, darf nicht verwundern. Zudem ging Ringelnatz mit seinem Einfallsreichtum und einer plebejisch gespeisten Sprach- und Formulierungslust doch reichlich unbekümmert um. Jedenfalls erweckt er stets den Eindruck, dies alles sei ihm so zugeflogen, als hätte er jeweils frisch drauflos improvisiert. Ob dies wirklich so war? Unverkennbar jedoch ist, dass in seine Gedichte spätestens in den Städtebildern aus den Reisebriefen eines Artisten (1927), deutlicher noch in den ab 1930 entstandenen Gedichten Lebensweisheit einfließt, der ein Denken über den Tag hinaus innewohnt. Wobei es dann gar nicht mehr vordergründig auf einen Gag oder ein Sprachspiel ankommt. Von Ringelnatz lässt sich lernen, wie ein vermeintlich Nebensächliches, Belangloses lebensprägend wird, sich als das Eigentliche erweist, wie es sich zur Kunst erheben und veredeln lässt. Eben indem man ihm die Wichtigkeit beimisst, es zu thematisieren. Allerdings bedarf es einer beträchtlichen Flügelspanne oder einer großen Schwingungsamplitude. Dies schließt die Fähigkeit ein, assoziativ denken zu können. Genau dabei zeigt sich, wie modern der naive oder sich naiv gebende Ringelnatz war. Gerade weil und wie er Logik hemmungslos außer Kraft setzte, übersprang, sich Absurditäten, ja geradezu surrealistische Vorgriffe leistete, mag dies auch nur zufällig gewesen sein. Er erreichte mit diesen Mixturen erstaunliche Poesiebereicherungen durch Erweiterungen, wobei er Geläufiges in einer verblüffenden Mundgerechtigkeit bietet, aber es in neue Zusammenhänge einrückt. Das heißt, dies schlichtweg neu sagt, womit er Fundamentales zur Poesie generell erfüllt. Alfred Polgar rühmte seine Verse. Sie schienen ihm so „glatt und rund wie auf der Töpferscheibe gedreht“.
Auch wenn Ringelnatz die eine oder andere Anleihe genommen haben mag, etwa bei den Dadaisten, am stärksten schlägt wohl doch englische Nonsens-Poesie durch. Einer Stilrichtung lässt er sich nicht zuordnen. Er ordnete seine Literatur keinem Dogma unter, was ihm alle Freiheiten ließ. Ein theoretischer Kopf war er gewiss nicht. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob tatsächlich alles unter Naivität zu subsumieren ist, ob er nicht auch damit eine Rolle neben so manch anderer gespielt hat. Es gibt da wohl Ambivalenzen und fließende Übergänge, so das es schwerfällt, strikte Trennungen vorzunehmen bei einer Bewertung aus historischer Distanz, bei der es natürlich vor allem darum geht, dem Werthaltigen und Bleibenden seiner Lyrik nachzufragen. Das Bild von der Persönlichkeit des Artisten Ringelnatz wurde zu seinen Lebzeiten sehr stark von seinen Auftritten geprägt. Als Matrose verkleidet, ein Weinglas in der Hand, hatte er sich auf eine Rolle festgelegt, die er nicht mehr ablegen konnte, um die Erwartungshaltung seiner Zuhörer nicht zu enttäuschen. Er musste und wollte ihr entsprechen. So fest, dass die Rolle am Ende mit ihm identisch geworden war. Samt seiner Requisiten wurde er zu einer stehenden Figur, die ihm entsprechende Beinamen eintrug, so wie er dann mit Bonmots der Geringschätzung zum „Troubadour der Kognakflasche“ avancierte, was sein literarisches Können verdeckte. Dies hat sich geändert. Der Rang, den er heute in einem Nachleben einnimmt, gründet sich vornehmlich auf die Qualität seiner originären Texte.
Walter Rösler sieht in Ringelnatz einen Glücksucher und Glücksspieler auf der Suche nach sich selbst, einen sich ständig Irrenden nach einer eigenen Biografie („Joachim Ringelnatz oder Die Flucht ins Glück“ in Sinn und Form, Heft 6/1983)· Für mich zeigt diese Charakteristik nur, wie schwer dieser Autor zu fassen ist. So treffend diese Bemerkung sein mag, der ganze Ringelnatz kann es nicht sein. Dafür ist er zu vielgestaltig, zu facettenreich. Von aktueller Politik hielt er sich betont fern, wohl aber bezeugen viele seiner Gedichte sein ausgeprägtes soziales Gewissen als Mitempfindender und Mitleidender. Von den Nationalsozialisten grenzte er sich strikt ab. Da gab es nicht den leisesten Versuch einer Annäherung. Als sie an die Macht kamen, zählte er zu den Unerwünschten. Ein Autor wie er, der in seinen „Turngedichten“ alles Völkische persifliert hatte, wurde ab 1933 missliebig, seine Werke als „undeutscher Schmutz“ geschmäht. Nachdem seine Bücher aus Bibliotheken entfernt und ihm Auftritte verwehrt wurden, geriet er zunehmend in materielle Schwierigkeiten, wozu dann auch die damals unheilbare Lungenkrankheit beitrug. Allein seine konsequente Haltung gegenüber Hitler und seinen Anhängern lässt an der ihm zugeschriebenen politischen Naivität zweifeln. Diesen Zweifeln auf den Grund zu gehen, soll wissenschaftlichen Tiefenbohrungen überlassen bleiben. Ich breche ab mit der Gewissheit, längst nicht alles angeführt zu haben, was Joachim Ringelnatz nachzurühmen wäre.
Ich danke der Stadt Cuxhaven für den Joachim-Ringelnatz-Preis, Dank sage ich vor allem dem Sponsor, der Stadtsparkasse Cuxhaven. Mein Dank gilt den Mitgliedern der Jury, die darauf verfallen sind, mir diesen ehrenvollen Lyrik-Preis zuzusprechen, namentlich Herrn Professor Möbus. Meinem Laudator Professor Dr. Bernhard Vogel bin ich für seine erhebende Rede verbunden. Ich habe gute Gründe, Joachim Ringelnatz, der den Preis selbst so nötig gehabt hätte, in meinen Dank nachdrücklich einzubeziehen.
Wulf Kirsten, Dankrede zur Verleihung des Joachim-Ringelnatz-Preises für Lyrik der Stadt Cuxhaven 2010, aus: Frank Möbus (Hrsg.): „Alte Liebe“, 2011
Wulf Kirsten und Annette von Droste-Hülshoff
Wenn Wulf Kirsten über Annette von Droste-Hülshoff spricht, spricht er auch über sich selbst. Die vorausweisenden Züge in Annettes Dichtung ermutigen ihn zu seinen eigenen Schöpfungen. Viele dieser Züge sind beiden Dichtern gemeinsam. Als erstes nenne ich die Genauigkeit der Beobachtung und ihrer sprachlichen Entsprechung. Nicht die geringste Scheu vor ungewöhnlichem, oft überaus speziellem Vokabular waltet in beider Texten. Im Gegenteil: Es gibt hier beiderseits eine Lust an ungewöhnlichen Details, z.B. aus der Geologie oder aus der Landwirtschaft oder, bei der Droste, aus dem Bereich der Jagd. Diese scheinbar antipoetischen Bestandteile folgen einer sowohl thematischen als sprachlichen Notwendigkeit, die, wie Wulf Kirsten ausführt, zu Wortketten sich entwickeln kann. Man kann in beiden Fällen von Sprachlandschaften sprechen. Celan sagt in den Materialien zum „Meridian“:
Gedichte als Wortlandschaften.
Es ist das Abschütteln jeglicher ästhetischer Schönfärbung, das hier fasziniert. Annette fügt sich nie einem zeitbedingten normativen Geschmackskanon. Oft wird man von einer Rebellion aus poetischer Notwendigkeit sprechen dürfen. Bei Wulf Kirsten spüre ich auch die politische Seite dieses Aufstands. Dieser macht den Dichter auch zum Kämpfer. Annette hat gleichfalls ein aufständisches Potential in sich, hat aber noch nicht die historischen Voraussetzungen gekannt, die es zu aktualisieren erlauben.
Was macht die vier Verse aus „Das Hirtenfeuer“ so einprägsam?:
Unke kauert im Sumpf,
Igel im Grase duckt,
In dem modernden Stumpf
Schlafend die Kröte zuckt
Zunächst die Artikellosigkeit der die ersten Zeilenanfänge bestimmenden Substantive. Sodann die nur einsibigen Reimwörter. Knappheit als Ideal der Wortfügungen. Das einzige lange Wort handelt von der Fäulnis: „modernden Stumpf“. So gäbe es denn hier eine Spannung zwischen Leben und Dahinsiechen. All dies ist aber sofort so versprachlicht, dass die Worte das zu Sagende ausstellen, gleichsam vorspielen. Sie haben eine magische Direktheit, die keine Umwege zulässt. Dass diese Eigenheiten Wulf Kirsten anziehen, leuchtet ein, wenn man seine Nähe zu nie zuvor poetisierter Wirklichkeit wahrnimmt. Dem Gedicht zuführen, was es in klassischen und romantischen Zeitläuften fernzuhalten pflegte: das Antipoetische. Dieses wird nun eingemeindet, von beiden Dichtern.
Schauen wir uns die von Wulf Kirsten besonders hervorgehobene „Mergelgrube“ daraufhin an:
als ob zur Gant
Natur die Trödelbude aufgeschlagen.
Die unordentliche Farbenfolge ist eine Form von Lebendigkeit:
Kein Pardelfell war je so bunt gefleckt,
Kein Rebhuhn, keine Wachtel so gescheckt
Die Steine fangen an, sich in heftiger Aktivität kundzutun, teils agressiv, teils gewitterhaft:
Wie zürnend sturt dich an der schwarze Gneus,
Spatkugeln kollern nieder, milchig weiß,
Und um den Glimmer fahren Silberblitze;
Eine Dynamik des Zorns durchzieht diese fremden, fernen steinigen Ankömmlinge. Die Weltuntergangserfahrung um die Arche Noah haftet den hergeschleuderten einzelnen Steinen an. Die Dichterin macht sich selber zum Petrefakt. Aber da gibt es kein Verstummen, kein tödliches Schweigen: der schwirrende Totenkäfer ist aktiv. Diese erstorbene Welt bewegt sich stets, ist voller überraschender Geschehnisse, voll Insektenleben, auch voll wollenen Lämmerhaars: das Kreatürliche der belebten Unterwelt geht hier in die animalische Welt der Herden über. Diese Übergänge sind bei der Droste das Faszinierende, weil sie sich selber solchen Verwandlungen hingibt, in Wortfolgen, die die einzelnen Etappen von Weltentstehungen aus den Versteinerungen befreien.
Dass Wulf Kirsten zwischen diesem Gedicht und der „Erzstufe“ aus dem „Sommertagstraum“ eine Verschwisterung herstellt, leuchtet sofort ein, wenn man die Dynamik dieses zweiten, von der tödlichen Gefahr der „Bergknappen“ handelnden Gedichts bedenkt. Die einzelnen Momente des lebenbedrohenden Prozesses, dem der Steiger ausgeliefert ist, werden von dämonischen Wesen umgeben, es gibt hier auch balladeske Begleitmusik. Manche Verse haben mit den aus dem „Hirtenfeuer“ zitierten die magische Knappheit gemeinsam:
Der Hammer pickt, die Stufe bricht.
Das Weglassen aller kommentierenden Reflexionen oder Abschweifungen macht die Handlung drängend und stets gefährlich. Die Todesdrohung dominiert den zwanghaft knappen Rhythmus. Es gibt in beiden von Wulf Kirsten verbundenen Gedichten eine unterweltliche Präsenz in genauester Sprachgestalt. Dass die geschilderten Vorgänge beidenorts so detailliert nachvollziehbar sind, enthebt sie der Gefahr romantischer Vagheit. Als hätte man es mit der Erfahrung solider Handwerker zu tun, verkünden die Verse Vorgänge, deren Materialität so genau wie möglich nachgezeichnet wird. Und dies in Verbindung mit apokalyptischen Imaginationen. So dass Wulf Kirstens Überzeugung, ein Gedicht müsse Mimesis und transzendente Imagination verbinden, sich hier erfüllt.
Ich gebe gerne zu, dass ich überaus glücklich war, als ich in Wulf Kirstens Lobrede auf Marie-Luise Kaschnitz einerseits als Zeugnis der Kaschnitz auf die „Mergelgrube“ der Droste stieß, andererseits auf ihren großen Lehrer Gustave Courbet, dessen Biographie, geschrieben in den Kriegsjahren, erschienen erst Jahre nach Kriegsende, für sie eine auch politisch ins Gewicht fallende Zäsur bedeutet hat: Courbet hat durch seine realistische Anteilnahme am Leben des Volkes, durch seine den düsteren Grotten und den Quellen des französischen Juras nachspürende innovative Malerei etwas repräsentiert, was in unseren Zusammenhang gehört: so etwa auch die Tatsache, dass er sich 1871 im Gefängnis als toten Fisch dargestellt hat oder seine magische Anschaulichkeit beim Malen toter Füchse auf Schneegrund im Beisein winterlicher Jäger, Bilder, die übrigens kürzlich erst bei der großen Pariser Ausstellung zu entdecken waren. Ich spanne hier den Bogen weit zu Wahlverwandten, weil ich diese Tugend in den von größter Belesenheit zeugenden Essays von Wulf Kirsten antreffe. Den Celan-Forscher freut in diesem Zusammenhang besonders auch die höchst exakte Kenntnis der jüdischen deutschsprachigen rumänischen Poesie, von der Wulf Kirsten Zeugnis ablegt in der Rede auf den hundertjährigen Alfred Kittner. Celan war ja nun der empfänglichste Droste-Liebhaber, den ich erlebt habe, mit seiner Vorliebe für den „Sommertagstraum“, dem die von Wulf Kirsten so gepriesene „Erzstufe“ angehört. Daher ist der kleine Umweg über die Bukowina hier keine Abschweifung.
Das Gedicht „aus dem leben der Droste“ bezeugt eine detaillierte Kenntnis des riesigen Briefkorpus der Droste. Darunter fällt die herrliche Formel, die die Fachgespräche der Mediävisten um den Freiherrn von Laßberg in Meersburg charakterisiert. Deren Gespräche erinnern die von fern sie vernehmende Schwägerin prosaisch an „Pferdebürsten“. Die Genialität liegt hier in der gänzlich unerwarteten, von Spottlust zeugenden Verfremdung. In diesem Gedicht wird von „swedenborggesichtern“ gesprochen, die als eine Art Zweitbilder sich als eine Form Droste’scher Spiegelbilder erkennen lassen. Das Gehämmerte dieser Dichtung kommt zur Sprache und meint die steinige Härte, die Paul Celan spät fasziniert hat. Ein Leben zwischen „stöckischem“ und Momenten des „aufbrodelns“, so beim Verfassen der „Heidebilder“ im entflammten Zustand der Liebe zu Levin Schücking. Auffallend ist in dieser Folge von Erinnerungen das nach verschiedenen Seiten sich äußernde Extreme. Es beginnt mit dem „abglanz des meeres“. Wird hier auch auf „Die Mergelgrube“ hingewiesen, trifft diese Formel doch auch auf „Die Steppe“ zu, wo eine Sandwüste sich in einen „gelben Ozean“ verwandelt, den Fichten wie Schiffsmasten bewachsen. Dieses Gedicht steht in der maßgebenden Ausgabe von 1844 unmittelbar vor der „Mergelgrube“.
Zu bedenken ist auch die Stellung des Gedichts „aus dem leben der Droste“ zwischen „Grabbe“ und „der meteor“, d.h. Rimbaud. Drei teilweise spät entdeckte Outsider. Der erste hier in unflätiger Umgebung, der letzte mit infernalischen, luziferischen Visionen begabt. Alle drei in provinziellem Kontext lebend und schreibend. Niemals wurde bisher die Droste in eine so kühne Umgebung gestellt. Ihre großartige poetische Unabhängigkeit lässt sie als Gleichberechigte neben dem Satiriker und dem kühnsten Innovator im Bereich der Poesie wohnen; unkonventioneller kann man sie nicht einteilen. Am erstaunlichsten ist hier ihre Nachbarschaft zu obszönen Formeln der beiden sie umgebenden Brüder. Gemeinsam allen dreien ist das Leben im Gefängnis. Das erste der drei Gedichte endet: „zu langjährigem detmold verurteilt“, das letzte enthält die Charakterisierung des „klatschverpesteten nests“, das mittlere, Drostische sagt Ähnliches in der Formel „zum stöckischwerden“. Und hier erinnert man sich an Wulf Kirstens Beschreibung der Vorteile provinziellen Aufwachsens für den geschärften Beobachtungssinn, dem zwanghaft gesetzte Grenzen zum Vorteil gereichen. So ermöglicht denn Provinzialität den poetischen Aufruhr gegen diese Zwänge, in Gestalt atemberaubender Innovation.
Bernhard Böschenstein, aus Wulf Kirsten – die Poesie der Landschaft. Gedichte, Gespräche, Lektüren herausgegeben von Jan Röhnert, Stiftung Lyrik Kabinett, 2016
Von der Poesie reich beschenkt.
Der Beginn einer Freundschaft
„Stéphane, hier ist Wulf“ – die Stimme klingt mir frisch im Ohr nach, als eine herzliche Kontaktaufnahme, die unmittelbar ins Vertrauliche führte. Mit diesen Worten meldete sich der Freund und Brückengänger, der mir im Dialog einen Weg ins Kreative der Sprache eröffnete. Über zwanzig Jahre entwickelte sich nicht nur ein reger Briefwechsel, auch die Gespräche am Telefon – in den letzten Jahren zunehmend sein Fenster zur Welt – gehörten zu unserem Austausch.
Für diese Gespräche bin ich besonders dankbar. Voller Geduld, mit persönlichem Engagement hat der Dichter Brücken zwischen uns gebaut, eine lebendige Beziehung gestaltet, aus der ich hier zwei Stationen herausgreifen möchte.
Der allererste Kontakt, Paris im März 2002, bleibt mir stark in Erinnerung. Wegbereiter für diese Begegnung war mein Freund Gerhard R. Kaiser, Ordinarius für Germanistik in Jena, der für ein Semester als Gastprofessor an der Sorbonne lehrte. Er lud Wulf zu einer Lesung in eine deutsche Buchhandlung im Marais-Viertel ein. Ich wohnte der Lesung bei und saß anschließend mit dem Dichter und einigen Kollegen aus der Universität in einem Café bei einem Umtrunk zusammen. Auf eine Frage, die ich an den Dichter über einen Passus seiner Kindheitserinnerungen stellte, antwortete er mit der Wiedergabe einer Erfahrung aus dem Jahr 1942. Damals, mitten im 2. Weltkrieg, war sein Vater, wie fast alle Männer, bei der Armee. Die Mutter, die im sächsischen Dorf Klipphausen für die fünf Kinder sorgte, bekam Besuch von ihrer Schwester aus Polen. Die ganze Familie schlief mit dem Gast in dem einzigen Schlafzimmer des Hauses. Beide Frauen, die Mutter des achtjährigen Wulf und seine Tante, schliefen im gleichen elterlichen Bett und sprachen vor dem Einschlafen mit leiser Stimme vertraulich miteinander. Die Kinder, dachten sie, schliefen bereits fest. Da hörte aber der Kleine, wie seine Tante der Mutter über die geheim gehaltenen Konzentrationslager in Polen und die dort ausgeübten Gewalttaten berichtete. Eine bedrückende Nachricht, die sein Bewusstsein umso schwerer belastete, als er unfreiwillig einem Gespräch gelauscht hatte, das er nie hätte hören dürfen und über das er mit niemandem sprechen konnte.
Auf mich entfaltete Wulfs Erzählung eine unglaubliche Sogwirkung. Die Vergangenheit rückte auf einmal mit einer atemberaubenden Unmittelbarkeit auf mich zu. Die deutsche Sprache und die deutsche Welt waren mir zwar seit einem Schuljahr, das ich mit 13–14 Jahren in einem Internat in Münster/Westfalen fern der Familie verbracht hatte, vertraut. Ich war hier so freundlich aufgenommen worden, dass Deutschland zu einem Stück meines Selbst wurde. Zwei Jahre, die ich später als Lektor in Heidelberg lebte, vertieften diese Beziehung. An dem Abend in Paris rissen Wulfs Worte in meinem Bewusstsein einen Blick in seine und zugleich in meine Geschichte auf. Auch bei Wulf blieb die Erinnerung an unsere erste Pariser Begegnung wach.
Im August des folgenden Jahres kam ich zur alljährlichen Goethe-Feier nach Weimar, um an der Stelle meines verhinderten französischen Doktorvaters, eines ausgewiesenen Heine-Spezialisten, einen Vortrag über den Romantiker zu halten. Wulf, dem Heine ein Wegweiser und Vorbild in der eigenen Lyrik war, saß in der ersten Reihe. Nach dieser wiederum intensiven Begegnung entstand in mir der Wunsch, Wulfs poetische Welt für die französischen Leser aufzuschließen. Wulf ließ mich wie in den neunziger Jahren bereits die Lyriker Yves Bonnefoy (1923–2016) und Michel Deguy (1930–2022), aber auch der in Ungarn geborene Maler Paul Kallas (1928–2001), mit wunderbarer Großzügigkeit in seine Schaffenswelt ein und schenkte mir sein Vertrauen.
Paul, der als 15-jähriger Jude nach Auschwitz verschleppt wurde, nach der Befreiung des KZs kurz Malerei in Budapest studierte und 1950 aus der kommunistischen Heimat nach Paris floh, war bald in die führende Galerie Pierre Loeb für moderne Kunst aufgenommen worden. Aus der schrecklichen Jugenderfahrung heraus beschloss er, sich als abstrakter Künstler der Licht- und Schönheitsseite der Welt zu widmen. Paul Kallas, Yves Bonnefoy und Michel Deguy, alle drei prominente schaffende Künstler, hatten mir jeweils einen Aspekt der Welt eröffnet, in die Wulf nun mehr und mehr gehörte.
Wie hätte ich ohne seine aktive Beteiligung seine Lyrik zu entschlüsseln vermocht? Im Mai 2004 schrieb ich ihm, dass ich beabsichtigte, sein poetisches Werk bei einer franko-italienischen komparatistischen Tagung in Rom vorzustellen und dass ich es ins Französische übersetzen wolle. Der Dichter antwortete wenige Tage später und ich kann nicht umhin, aus dem Brief zu zitieren:
Lieber Stéphane Michaud, welch ein Brief! Was soll ich sagen? Ich bin gerührt. Meine Antwort muss mit dem Wort Dank beginnen. Angesichts des Berges unbeantworteter Post, den ich wohl nie mehr abzutragen imstande sein werde, weiß ich genau, wovon Sie reden.
Wulf beförderte unseren Austausch; für ihn wurde ich zum Schenkenden, für mich wurde er es. Was schulde ich ihm nicht alles, angefangen von seiner Hilfe bei der Dechiffrierung seiner eigentümlichen und mitunter archaisch anmutenden poetischen Sprache, ihrer Verwurzelung in der bäuerlich-agrarischen Welt, zuvorderst der linkselbischen Täler und Höhen, später auch im Thüringischen, die sich mir als Stadtmenschen nur zögerlich auftat.
Ja, selbst manche Züge der Geschichte Ostdeutschlands schilderte er mir, mit denen ich mich bislang kaum befasst hatte, die jedoch mit seinem Leben eng verwoben waren. Unermüdlich führte er mich, mal im Brief, mal im Gespräch, nicht nur über mancherlei sprachliches Hindernis hinweg, sondern auch in die Konkretheit und Dynamik seiner Poetik ein. Er ebnete mir die Wege zur Nachdichtung seines sprachlich komplexen Werkes, indem er mit mir über die Wiedergabe des Tempos, der Spannung und der Wortfarbe sprach, die für ihn wesentliche Elemente einer gelungenen Dichtung wie einer gelungenen Nachdichtung waren.
Als er mir das Du anbot, fühlte ich mich längst in seine literarische Welt eingelassen und aufgenommen. Die Anfange unserer Freundschaft, von denen ich hier berichte, lassen die überreiche Gabe, die ich Wulf verdanke, nur erahnen. Dank ihr wurde meine Erfahrung des Übersetzens zu einem Freundschaftsdienst. In der Freundschaft wie in der Poesie blieb Wulf der grenzenlos Schenkende.
Stéphane Michaud, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
DELANY
für Wulf Kirsten
land unter mir nabel
der kindheit ganze welt
milchnaß und eben ein schoß
sollte mir bleiben ich hielt
die uhr an den atem besah mich
ein vergilbtes foto der großmutter im glas
erkannten meine augen die eignen
baum und anwesen die kuh
angeschirrt am eggebalken mit nägeln
den gekreuzigten dahinter
des gestundeten lebens ausgefahrenen rain
einen rahmen ein gitterstück
das mich im bilde hielt
angenabelt sah mich
mit den augen
von fremden
Róža Domašcyna
Wulf Kirsten liest seine beiden Gedichte „physiognomie der landschaft“ & „ödland“
Lesung Wulf Kirsten am 27.11.1991 im Deutschen Literaturarchiv Marbach
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


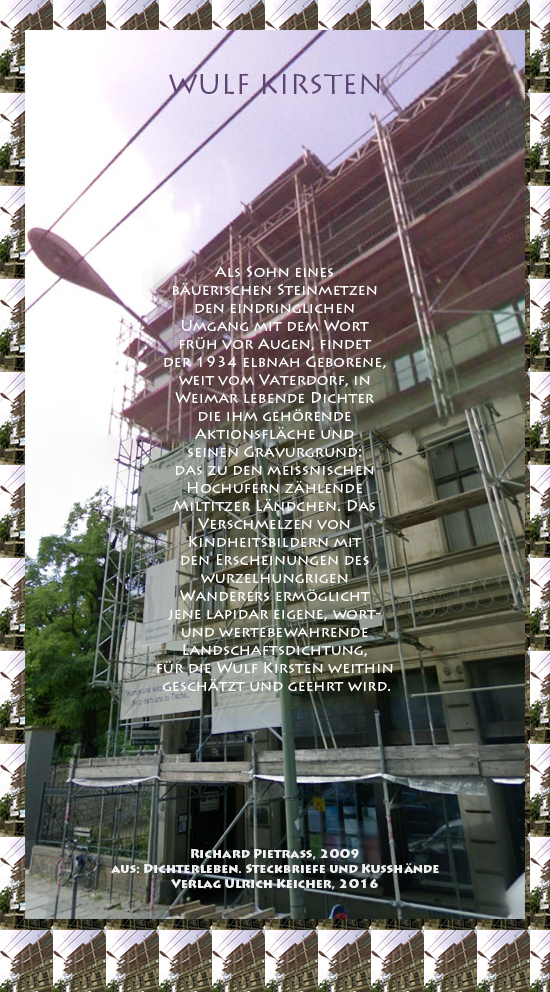












Schreibe einen Kommentar