Wulf Kirsten: Wettersturz
SOZUSAGEN
obschon wenngleich zu sagen wäre wenn nicht statt
aaaaadessen
unumwunden dergestalt aber diesbezüglich wiewohl
aaaaawessen
nötigenfalls hinsichtlich desohnerachtet in betreff
welchselbiges beifügig obzwar überdies aus dem effeff
solchermaßen wohlgemerkt mithin zumal ebendort
keineswegs ingleichen triffst du nur das zauberwort
zweifelsohne und insonderheit folglich nicht von ohngefähr
teils dieserhalb teils außerdem gleichwohl noch vielmehr
wie auch immer gleichermaßen wohingegen dergestalt
einerseits nichtsdestotrotz andererseits alsbald
möglicherweise jedoch auch infolgedessen sowieso
geschweige denn mitnichten insondergleichen irgendwaswiewo
allermaßen desumnachtet wie auch ohnedies ganz insgemein
bleibt es nunmehr wohlgemerkt bei einem klaren jein
widrigenfalls sind demzufolge ebenso ingleichen
zweckgebundene mittel kurzerhand zu streichen
zuweilen aber wenn nicht anders vorgeschrieben
gilt obgedachtes ansonsten freilich nach belieben
gegebenenfalls ist beim vorgesetzten amte nachzufragen
infrage stehnder fälle wegen derenthalben wenn nicht sozusagen
Tiefenschärfe
– Textlandschaften: Wulf Kirstens Reden und Gedichte. –
Innerhalb eines Jahres sind von Wulf Kirsten zwei Bände erschienen: ein Band mit Reden und Aufsätzen des letzten Jahrzehnts unter dem schönen Titel Textur sowie die Gedichte der Jahre 1993 bis 1998: Wettersturz.
(…)
In einem Gespräch, das wir vor einigen Jahren aus Anlaß einer Rundfunksendung führten, sagte Wulf Kirsten:
Verantwortung in dieser Zeit ist auf alle Fälle die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, die dann in den Gedichten eingelegt sein müßte…, die gewissermaßen in kleinen Punkten Gegenbilder setzen zu dem, was ich sonst feststelle im menschlichen Leben, also im menschlichen Beziehungsgefüge.
Der Band Stimmenschotter, der die Gedichte aus den Jahren 1987 bis 1992 vorstellt, hat diesen Weg festgehalten und einen ersten Ausblick auf die heraufkommende Zeit gegeben. Noch einmal finden sich hier große programmatische Gedichte, besonders „muttersprache“ und „zuspruch“ wären zu nennen. Dieser kräftigen Zwischenbilanz auch mit sarkastischen Tönen folgen in Wettersturz nun Gedichte, die manche Entwürfe in gewisser Weise ausführen, jedes Detail verdunkeln und erhellen.
Schon die Kapitelnamen geben die Richtung des zu Erwartenden an: „dunkle sprüche“, „verlorene sätze“, „abgetauchte begriffe“ und „selbstgespräche“. Es fällt auf, daß der Autor den Tiefenwirkungen der Gedichte vertraut, während die direkten Wirkungen ,im Zaum‘ gehalten sind. Das „Inkommensurable‘ des Lebens und der Dichtung – vielleicht ist es bei Kirsten noch nie so zum zentralen Thema geworden, mit drückenden Ahnungen:
die geschichte nimmt sich
spielend zurück, mich und auch dich.
(„dunkle sprüche“).
Erneut tritt der Dichter als Bewahrer hervor, der die Biographien erzählt „aller sagbaren dinge / eines erdstrichs zwischenein“, wie es einmal in „satzanfang“ hieß. Nun aber kommt hinzu, was aus den Biographien (aus den Menschen) geworden ist, Realitäten, denen sich Kirsten nicht ohne Trauer nähert. Ein dichterisches Nachdenken setzt ein, manchmal der Meditation nah, in dem die Räume auf neue Weise angenommen werden und das Scheitern mehr und mehr ins Blickfeld rückt:
gehabt euch wohl, betäubte
hintersättler, gelebt in sich hinein, gelebt
aus sich heraus, gelebt an sich schnurstracks
vorbei
(„lebensersatz“);
sowie dann, wie ein Urteil:
selbst die wörter sang- und
klanglos ausgewandert aus den dingen
(„memorabilien“).
Man muß sich den ,argen Weg der Erkenntnis‘ vorstellen von einem, der seine Herkunft ,von unten‘ nie verleugnet hat.
War in dem Programmgedicht „satzanfang“ der Anspruch zu lesen:
aus wortfiguren standbilder setzen
einer dynastie von feldbestellern
ohne resonanznamen
so fällt die bilanz nach drei Dezennien bitter aus:
landmaschinen bergeweise zu schrotthalden
getürmt, von ausrangierten feldbestellern
ins alteisen geworfen.
(„örtlich betäubt“).
Die Tragik, die über solchen Existenzen und solchem Vergehen liegt, ist Kirsten mit der weiteren Versenkung ins Wort gerecht geworden. Mögen die Töne leiser werden: die Schärfe ist ganz in die Worte und Zusammenhänge eingelebt, vielleicht eine der höchsten Verdichtungen, die man erreichen kann. Einige Gedichte nähern sich Rätseln, indem sie die Anlässe kaum benennen und nur noch die verhängnisvollen Wirkungen im Auge haben; Augenblicke von beklemmender Dichte, von beklemmender Aktualität und auch Zeitlosigkeit begegnen uns da. Das Kapitel „selbstgespräche“ schließt beinahe folgerichtig den Band Wettersturz ab. Hier finden sich erneut Bestandsaufnahmen aus der Gegenwart, nicht zuletzt Selbstermunterungen, auf die es immer wieder ankommt, soll dem Schweigen nicht das letzte Wort überlassen sein:
sobald das gedicht beginnt, läuft
eine schnecke über den weg, natur-
gesetzt, noch unverletzt, und alle
schöpfungslust wie last ihr haus.
(„anläßlich“)
Selbstgespräche sind die Gedichte dieses Bandes vielleicht alle, und wir erleben, wie dialogbereit solche Gespräche sein können: die das Gedächtnis bereithält, zu denen die Gegenwart uns führt.
„Wettersturz“, das bedeutet auch – in schweren Wettern sein. Vielleicht ist der Dichter Wulf Kirsten immer in solchen Wettern gewesen, vielleicht hat er sie gesucht: das Komplizierte, das Schwere, auch Freudige – die Orte und Ereignisse, auch inneren Erlebnisse, wo das wahre Leben sich zuträgt. Leere oder inhaltsarme Gebilde werden wir bei Kirsten nicht finden, und nicht selten verbindet sich die Dichtung mit erzählerischen Elementen, die zu anderen „Textlandschaften“ führen, die die Gedichte wiederum begleiten, die Werke und Schatten der anderen, wie wir es in dem Band Textur kennengelernt haben. Die Verhältnisse werden sich ändern, aber das letzte Wort wird nie gesprochen sein. Wulf Kirsten hat stets versucht, mit seiner Stimme einzugreifen, er hat die Sprache als einzigen Besitz empfunden – auf einem Lebensweg:
Der erlebte und gelebte Wortschatz hat mich getragen wie das Wasser den Schwimmer.
Was weiterhin möglich ist, und worauf es weiterhin ankommt, das hat er in „poesie“, dem letzten Gedicht des Bandes, benannt. Dichtung setzt manchmal gerade dort ein, wo alles andere aufhört; die letzten Lebensräume verteidigt sie, verbindet die Lebenden mit den Toten – auch wenn das eines Tages vielleicht niemand mehr weiß:
wenn tod, wenn grab,
dann kommt uns nicht,
was ist das: poesie,
die hingabe ans wort,
das feuer, das in den worten brennt,
der stachel, der schmerzhaft einsticht,
wohin er auch blindlings trifft.
die trauer aller dinge, auch
wenn sie gar kein gesicht haben,
aus dem zu lesen wäre, die aber tot
sind und leben und wie verrückt
anfangen zu leben, in jeder zeile
sich forttragen, in jeder faser
vibrieren und wissen, was es heißt,
schweigen in schwermut, schweigen
für immer, wenn tod, wenn grab,
viel zu jung sterben die dichter
in Polen.
Wolfgang Trampe, neue deutsche literatur, Heft 526, Juli/August 1999
DORF
die zersiedelte siedlung,
wie sie verwegen abhängt,
zerfleddert und zerpflückt
zwischen wilden müllkippen,
die sich verzetteln
von unort zu unort.
das lied der beerenpflückerinnen
ein erinnerungsfetzen
im schrumpfwald.
kahlschlaggesellschaften
in aufsteigender linie.
unentwegt fluß-lebensläufe begradigt.
abgespielter klaviere
resonanzböden kieloben.
geißfuß tritt das pedal.
der mahltrichter wird habhaft der dinge:
schrillte noch eine grille im schlehenstrauch?
flog himmelwärts des landmanns liedermeister?
der mahltrichter wird habhaft der worte:
der quell, die werre, das fohlen.
lebensabführungen.
das dorf,
sieh, wie es verschlungen wird,
am ende verschlingt es sich selbst,
sieh, wie es hingeht,
gegen die scherbenumkränzte leere!
sieh, wie ziegel um ziegel
im mahltrichter verschwindet.
Der Mensch in der Landschaft
– Dichtung deutscher Bauernsöhne. –
Der Autor dieser ebenso freien wie melancholischen Verse [„dorf“], meine sehr verehrten Damen und Herren, ist, wie Sie gewiß ahnen, Wulf Kirsten, dem die philosophische Fakultät der Universität Jena heute hochverdientermaßen den Ehrendoktorhut aufsetzt. Das ist ihm in seinem Heimatort Klipphausen nicht an der Wiege gesungen worden, und auch zu blühenden DDR-Zeiten wäre eine entsprechende Prophezeiung für das Jahr 2003 wahrscheinlich belächelt worden. Es war eine doch oft sehr gedrückte und bedrückte Existenz, die Wulf Kirsten, Lektor des Aufbau-Verlags, Außenstelle Weimar, damals führte.
Gipssmog in Weimar, Kirsten melancholisch.
Denn er obliegt dort deutscher Zeichensetzung
dichtete Karl Mickel, ein anderer weiland DDR-Autor, seinerzeit, ohne daß die Überwachung der Interpunktion in den Texten des Aufbau-Verlags der Hauptgrund für die Schwarzgalligkeit des Lektors und Autors Kirsten gewesen wäre. Aber Überwachung und Überwachtwerden – das wären zweifellos Stichworte seines damaligen Lebens gewesen.
Wenn man freilich „deutsche Zeichensetzung“ weiter faßt, als was die bloße Kontrolle von Punkt und Komma und Gedankenstrich angeht, dann eröffnet sich eine andere Dimension. Wulf Kirsten sah in der Tat überall in seiner Heimat Zeichen gesetzt, er las sie und transponierte sie in seine Texte. Ein Beispiel haben wir gerade gehört. Seine Überschrift könnte, wenn es um einen Zeitungsartikel und seinen alles vorwegnehmenden Titel ginge, lauten „Der Tod des alten Dorfes“, denn darum geht es, und dies ist eines der zentralen Themen in Wulf Kirstens Lyrik und Prosa. Kein Zweifel, er ist der poetische Geschichtsschreiber dieses Untergangs, – das bedeutet aber auch, daß es in seinen Versen gegenüber der bloßen Historiographie, der deutschen Agrar- und Sozialgeschichte, einen großen ästhetischen Mehrwert gibt, wenn dieser marxistische Terminus „Mehrwert“ hier noch gestattet ist.
Am Beispiel von Kirstens eben zitiertem „dorf“ könnte man ein ganzes germanistisches Interpretationsseminar abhalten: über das Polyptoton – „zersiedelte siedlung“, über Assonanz und Stabreim – „zersiedelt […] zerfleddert und zerpflückt“, über die Anapher – „der mahl trichter wird habhaft der dinge […] der mahltrichter wird habhaft der worte“ oder „sieh, wie es verschlungen wird […] sieh, wie es hingeht […] sieh, wie ziegel um ziegel im mahltrichter verschwindet“. Dann verschlingt, verflicht der Autor Polyptoton und Anapher: „sieh, wie es verschlungen wird, / am ende verschlingt es sich selbst“. Und damit noch längst nicht genug: Wenn jemand bei dem – offenbar zunehmend substanzloseren – Begriff „Landmann“ und seinem „Liedermeister“ an den „fröhlichen Landmann“ aus den Kinderszenen Robert Schumanns denkt und an das 19. Jahrhundert, dann muß man hinzufügen, die Anspielungen Kirstens führen noch weiter zurück, nämlich in das Ostpreußen des 18. Jahrhunderts, nach Königsberg. Dort gab es einen Staatsmann und Schriftsteller, einen Freund Kants, Theodor Gottlieb von Hippel, der einen dreibändigen Roman Lebensläufe nach aufsteigender Linie veröffentlichte. Kirsten zitiert diesen Titel und wandelt ihn ironisch ab, kombiniert ihn und die Waldvernichtung mit der Regulierung der fließenden Gewässer, deren natürlich mäandernder Verlauf den Agrar-Technikern immer ein Dorn im Auge und keine Träne wert war. „kahlschlaggesellschaften / in aufsteigender linie. / unentwegt fluß-lebensläufe begradigt“ – so das schmerzliche Pastiche Wulf Kirstens, in dem die nun linearen „fluß-lebensläufe“ wenig später in „lebensabführungen“ übergehen.
Bei Lichte besehen ist das Gedicht Kirstens über das Chaos eines Unorts ein ungeheuer genau gearbeitetes Gebilde, in dem das Verschwinden alter Ordnungen auf eine schlagende Weise Wort wird, wobei Unort und Unwort frappierend kongruent sind. Mit den Dingen sterben die Namen: eine von Pestiziden verseuchte Quelle ist kein Quell mehr, kein „Brunnquell guter Gaben“, wie es, mit männlichem Substantiv, im Choral heißt; in gefrästen und verdichteten Böden haust keine Werre, keine Maulwurfsgrille mehr, und vor den ebenso rohen wie effektiven Pferdekräften ist das Fohlen längst den begradigten Bach hinunter.
Es ist kein Zweifel, in vielen Gegenden Deutschlands – und von Mittelfranken, wo der Referent aufwuchs, kann er es persönlich bezeugen – dauerte das agrarische Mittelalter bis Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre: mit einem ganz hohen Anteil an menschlicher Handarbeit und tierischer Zugkraft, mit Dienstboten und Tagelöhnern, mit Dreifelderwirtschaft, mit Tier- und Pflanzenproduktion in einer Hand, mit vielen Selbstversorger-Betrieben von wenigen Morgen Land, deren Besitzer oft Handwerk und Kleinbauerntum miteinander verbanden. Wulf Kirsten stammt aus einer solchen Familie im Meißnischen: der Vater war Steinmetz in Klipphausen und trieb, wie man so sagt, eine kleine Landwirtschaft um, soweit er nicht von ihr umgetrieben wurde, um die hungrigen Mäuler seiner Kinder zu stopfen, und sie selbst hatten von früh nach Kräften mitzuhelfen. Kirstens frühe Jahre waren zunächst die des III. Reichs und des II. Weltkriegs, in denen ein kleines Anwesen mit ein paar Äckerchen und Wiesen und einer Handvoll Tiere noch am ehesten die Gewähr bot, daß man nicht hungerte. Wulf Kirsten hat jene Zeit in seinem Prosaband Die Prinzessinnen im Krautgarten mit großer Genauigkeit beschrieben, und auch seine Lyrik legt immer wieder poetisches Zeugnis davon ab. Die Verbindung von Handwerk und Bauerntum ist ihm von früh an in Fleisch und Blut übergegangen und er hat ihrer in folgenden Versen gedacht:
WERKTÄTIG
ein schmiedefeuer mit dem blasebalg entfachen,
den feldern ein schön ansehen machen,
einen baum auf den stock setzen,
die sense mitten im schwaden wetzen,
das getreide hinter dem mäher abraffen,
den halben abend aufs feld hinausschaffen,
korn aufschütten, ein pferd beschlagen,
den segen der kultur im korbe tragen,
[…]
Die ,Bauerei‘, und viele Handwerke gehen hier von Zweizeiler zu Zweizeiler immer Hand in Hand, Reim auf Reim, Bauer und Schmied, Bauer und Steinmetz, Bauer und Wagner, Bauer und Glockengießer, Metzger, Zimmermann und so fort. Wenn die DDR von ihren „Werktätigen“ sprach, meinte sie formelhaft immer Arbeiter und Bauern, aber nicht die Handwerker. Insofern ist Kirstens Gedicht eine Art Antiprogramm; es ist eine Art Abgesang auf das Handwerk, das – eine merkwürdige Konvergenz dies! – in Ost und West, in den Dörfern der DDR wie der alten Bundesrepublik, in den 50ern an ein vorläufiges Ende kam – in der DDR aufgrund staatlicher Politik, im Westen aufgrund verschiedener Prozesse, die noch nicht bis ins letzte durchleuchtet sind. Der Referent hat das fränkische Dorf seiner Kindheit, das er am genauesten kennt, Ehingen am Hesselberg in Mittelfranken, damals ein 1.000-Seelen-Ort, gemustert und festgestellt, daß es dort zwischen 1950 und 1960 noch fünf Metzger, vier Schmiede, vier Schuster, drei Zimmerleute, zwei Wagner, zwei Schneider, zwei Schreiner, zwei Bäcker, zwei Müller, zwei Maurer, zwei Molker, einen Sattler, einen Küfner, einen Dreher, einen Krautschneider, einen Schweine-Kastrierer, einen Schäfer und ca. 120 Bauern gab. Ein Bäcker ist übriggeblieben und etwa ein halbes Dutzend Bauern, die mittlerweile die gesamte Feldflur des Dorfes unter sich aufgeteilt haben – Konzentration im Zeichen der EU.
Ich habe Wulf Kirstens Lyrik einmal scherzhaft eine Art „literarischer Handwerkskammer“ genannt – man sollte vielleicht eher von einem Handwerksmuseum sprechen, weil viele der Tätigkeiten, die er poetisch konserviert, inzwischen längst nur noch in Museen oder Landschaftsparks wie etwa dem Hessen-Park bei Neu-Anspach zu besichtigen sind. Getreide mit der Sense mähen und es hinter ihr mit der Sichel aufnehmen („abraffen“) und es als „Sammlet“ zum Trocknen und Binden hinlegen, Weizen, Roggen, Gerste oder Hafer mit dem Flegel zu dreschen – das sind mittlerweile – und gottseidank möchte ich sagen – verschollene Tätigkeiten. Wer je nasse, vielleicht distlige Lagerfrucht hinter einer Sense aufgenommen hat oder wer als Kind zu nachtschlafender Winter-Zeit aufgeweckt wurde, um vor Schulbeginn beim Flegeldreschen zu helfen – „wenn’s a nix rauschdrescha, Hauptsach, sie halta in Takt“ –, der weiß, was das für eine gottverdammte Plackerei war. Dank Bindemäher, Dreschmaschine und Mähdrescher sind diese dornigen Handgriffe heute hierzulande nicht mehr nötig, so wie die Vollerntemaschinen das von Kirsten genannte Rübenblatten dem Menschen aus der Hand genommen haben. In Kirstens Versen sind diese archaischen Arbeiten wörtlich konserviert, aber es besteht die Gefahr, daß mit dem Ding und seiner Verrichtung auch das Verständnis für das Vokabular verloren zu gehen droht, so wie ja auch die großenteils agrarische Metaphorik der Bibel Hekuba, ohne Kommentar nicht mehr zugänglich werden dürfte. Wie soll ein Kind des Mähdrescherzeitalters den biblischen Rat noch verstehen, man solle dem Ochsen, der da drischet, das Maul nicht verbinden. Nur wer weiß, daß Jahrtausende lang das Getreide auf der Tenne von den Füßen der Rinder aus den Ähren gerieben wurde, bevor man es gegen das Wind werfen, worfeln und so von der Spreu befreien konnte, – nur wer dies erinnert und weiß, wie sich das Vieh bei solcher Arbeit immer wieder ein Maul voll Halme vom Boden nimmt, kann den Bibel-Vers begreifen, und schon der Göpel, der bei Kirsten vorkommt, ist ja gleichzeitig eine relativ moderne Technologie zur Kraftübertragung des rundlaufenden Viehs auf eine Dreschmaschine und ein Fossil des landwirtschaftlichen Maschinenparks. Kirsten liefert zu diesen Entwicklungen das Stichwort: „das zeitliche mit dem ewigen verwechseln“. Das Bauerntum in Deutschland, von Haus aus eher konservativ, war ja oft der Meinung, so wie es sei, so werde es bleiben, und es projizierte die Gegenwart in eine Zukunft, die dann doch ganz anders aussah. So ist es vielleicht auch zu erklären, weshalb es den Mähdrescher auf deutschen Feldern sechzig, siebzig Jahre später gab als in den USA, wo man diese überaus praktischen Ungetüme, gezogen von 18 oder 20 Pferden schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert über die weizenbestandenen Prärien trieb. Der Zusammenhang von Ökonomie und Technologie ist – gut marxistisch – ja in diesem Fall nicht zu übersehen: die Bewirtschaftung riesiger landwirtschaftlicher Flächen in Privathand machte andere Mittel nötig und möglich als die oft nur handtuchgroßer Flächen im Sachsen oder Franken und Schwaben der armen Fretter, die vielleicht durch Realteilung schier zu Johannen-ohne-Land geworden waren.
In Kirstens Heimatort Klipphausen gab es ein Nebeneinander von Klein- und Kleinstbauern und Auch-Bauern, zu denen die Kirstens gehörten, und das andere Ende des Spektrums – ein Rittergut, das zu Wulf Kirstens Jugend zwei Prinzessinnen Reuß, jüngere Linie, gehörte. Das Wort „Rittergut“ sagt dem heutigen Zeitgenossen meistens wenig oder gar nichts. Es war im alten Deutschen Reich eine „von den Landesherren dem ritterbürtigen Adel gegen die Verpflichtung zu Kriegsdiensten übertragene Gutsherrschaft mit Eigenwirtschaft und abhängigen Bauernwirtschaften. Neben anderen Vorrechten hatte der Ritterguts-Besitzer die niedere Gerichtsbarkeit und Polizeistrafgewalt über die erbuntertänigen Bauern. Die Vorrechte wurden [erst] durch die Bauernbefreiung, die Verwaltungsreformen im 19. Jahrhundert allmählich beseitigt.“ So der große Brockhaus. Das Rittergut, das über Klipphausen thronte, war nach dem II. Weltkrieg der Ausdruck der Klassengesellschaft, und so hatte es seine eiserne Logik, daß seine Ländereien durch die sowjetischen Behörden bald nach Kriegsende aufgeteilt wurden. „Im ersten Nachkriegsfrühjahr wurde auch der Landbesitz der beiden Prinzessinnen zu Reuß jüngerer Linie, Gertrud und Annemarie, aufgeteilt, in Kleinparzellen oder fünfhektarweise. Aus Fichtenstämmen wurden Grenzpfähle gesägt und angespitzt“, schreibt Kirsten in den Erzählungen über seine Dorfkindheit. Und mit bemerkenswerten Seitenblicken auf den Zusammenhang von Landschaftsmorphologie und der von ihr erzwungenen Technik berichtet Kirsten über die aus dem Osten nach Meißen geflüchteten Bauerntrecks.
Ging es bergab, schwitzten die Eigentümer der mit Hausrat hochbepackten Wagen Blut und Wasser. Denn bei ihnen zu Hause in der Ebenheit war keinerlei Bremswerk vonnöten gewesen. Anstelle der Schleifklötzer, die mit einer Spindel festgezogen werden konnten, banden sie irgendeinen armdicken Baumstamm, den sie von beiden Seiten mit aller Wucht andrückten, ohne den Wagen unter Kontrolle halten zu können. Einer dieser Trecks blieb in den fast leeren Pferdeställen des Ritterguts und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Die Bauern wußten nicht weiter. Ein Ziel gab es für sie nicht. Entnervt und überanstrengt von den nicht enden wollenden Berg- und Tal-Fahrten ließen sie sich nun von der Kriegswalze überrollen. Die Pferde, ihr kostbarstes Vermögen, waren abgetrieben. Das Risiko, daß sie den halsbrecherischen Strapazen eher zum Opfer fallen würden als ihre Besitzer, war zu groß geworden. Als im Jahr 1946 das Rittergutsland in vierundzwanzig Neubauernstellen parzelliert wurde, stellten die Bauern aus Niederschlesien, von denen es den meisten gelungen war, ihre Pferde durch die Nachkriegswirren zu bringen, das stärkste Kontingent. Und da sie es gewohnt waren, selbständig zu arbeiten, kamen sie mit der Bewirtschaftung der fünf Hektar Ackerland weit besser zurecht als die ehemaligen Gutsarbeiter, denen bislang der Inspektor oder der Leutevogt das Tagewerk allmorgendlich vor der Stalltür zugewiesen hatte.
Da war also, bei allem guten Willen, in den sozialistischen Anfang gleich wieder der Keim neuer Ungleichheit gelegt. Auch Kirstens Eltern profitierten von der Enteignung der Prinzessinnen Reuß ein wenig. Sie konnten ihren spärlichen Besitz arrondieren, freilich ohne daß sie sich hätten Pferde leisten können. Sie bildeten, wie das folgende Gedicht verrät, ihr eigenes Zugvieh:
DIE ACKERWALZE
meiner eltern gedenkend
mein vater, perfekter steinmetz
und nebenher landmann, mit sinn
fürs praktische, sah in einer gestürzten grabsäule,
aus dem block gehauen
und poliert für die ewigkeit,
eine ackerwalze über das feld rollen,
erdklumpen zerdrücken, das saatbeet bereiten.
wenn sich zwei vorspannen,
in die kopfseile stemmen,
ersetzt der sparsame starrsinn
das zugvieh im joch.
jahr um jahr zogen die walze
steinzeitlich
am eisengestänge über eignen grund
und reformierten boden
bergunter, bergauf,
vater und mutter, ohne zu murren und aufzustecken,
immer mit letzter kraft in den sielen.
längs der starren deichsel
zum gespann getreulich vereint,
walzten sie mit jeder umdrehung
des rollierenden grabsteins
in altmodischer schnörkelschrift,
zur spirale gedreht, in den lehm:
geliebt, beweint und unvergessen.
Aus jenen Nachkriegsjahren gibt es Fotos, aufgenommen in anderen Gegenden des deutschen Sprachraums, etwa in deutschen Tälern des Trentino, die zeigen, daß Menschen ohne Zugvieh sich vor die Ackergeräte spannten. Mir ist aber kein zweiter Fall bekannt, wo die Verhältnisse ein ähnlich meisterhaftes Gedicht hervorgebracht hätten. Hier schrieben sich die Menschen buchstäblich in die Landschaft, in die zerkrümelte Erde ein – zumindest bis der nächste Regenguß die Buchstaben verwischte und die Vegetation sie überwucherte. Es wäre eine Unvergessenheit für einige Wochen gewesen, wenn sich die Schnörkelschrift nicht unauslöschlich in das Gedächtnis des Sohnes geprägt hätte, bis sie eines Tages, Jahre später, wiedererstand im Vers.
Daß man in Kirstens Lyrik – wie in jeder – auf jedes einzelne Wort achten muß, versteht sich von selbst. Einzig aus der Wendung vom „reformierten Boden“ kann man schließen, daß das Gedicht nach der sowjetisch angeordneten Bodenreform spielt. Aus der Geschichte der Sowjetunion, wo der Landreform und der Aufteilung des Bodens aus Gutsbesitzershand alsbald die rigorose Kollektivierung der Landwirtschaft und die Liquidation der sogenannten Kulaken folgten, konnte man schließen, daß sich auch in der SBZ respektive der DDR über kurz oder lang etwas Ähnliches ereignen würde. Und so kam es auch. Es verging ein gutes Dutzend Jahre. Wulf Kirsten verbrachte die Sommerferien 1959, mittlerweile 25 Jahre alt, mit einem Kommilitonen auf einem Mecklenburger Bauernhof:
MECKLENBURGISCHER SOMMER
A. D. 1959
„Jeder Ort hütet seinen eigenen Traum.“
Alfons Paquet
alle metaphern für schweigen
unwirsch ausgesetzt und totgeschwiegen.
da knirscht nichts mehr im sand
des dunklen sommerwegs.
von wollzungen abgeschroten
die dorfgeschichten einfältiger seelen.
da prasselt kein korn
vom garbentisch in die große bauernmaschine.
kein flirrender staubtanz,
der sich erinnert:
damals auf der tenne.
ich stand im spelzengestöber hochauf
und stach ein weizenfuder ab.
den pferden zog ich die kumte
über die schädel
und sah sie unerschrocken an,
lammfromme tiere, sanftmütig
wie die sonnenuntergänge draußen
am brennesselweg, barfuß in schlorren,
abendhin der welt entwichen
über schwadenzeilen, schwalbenflügel
huschten tief und tiefer über die erde.
weiß der kuckuck, trauschauwem, das ende kommt,
der tag des jammers ist nahegerückt.
in sack und asche geht die jungfer im grünen,
hufschmieds tochter, die du wohntest
in den gärten deinerzeit.
was du gewußt, was ich gesehn:
Altmecklenburg, landinmitten
storchenpaare, sommergesichte,
spiegelbilder von spiegelbildern
spiegelverkehrt im scharfen lichtumriß
am nachtverwunschnen Leizener See,
verzaubert auf grasverwucherter trift.
alle worte sind verloren mit den dingen,
die der große schlingschlang fraß.
da knarrt kein hoftorflügel
in den angelbändern,
da dreht kein schwungrad mehr,
da bricht nichts mehr ins knie,
wo alles längst zerbrochen.
die kurbelwelleln, rüttelsiebe –
schrott, schrott, schrott.
Wulf Kirsten fand, wie er selbst in einem Kommentar zu diesem Gedicht schreibt, in dem Mecklenburger Idyll von 1959, das er erst 1991 wieder heraufbeschwor, seine „verlorene Kindheitswelt fast getreu wieder […], jedenfalls, was den von den Jahreszeiten bestimmten bäuerlichen Lebens- und Arbeitsrhythmus anbelangte“. Er war indes, wie doch das Zitat aus dem Propheten Hesekiel vermuten lassen könnte – „das ende kommt, / der tag des jammers ist nahegerückt“ –, kein Prophet und ahnte nicht, daß die Ära des privaten Bauerntums in der DDR so rasch zu Ende gehen würde. Die dunklen Töne des Nevermore stammen aus der Rückschau und aus einem späteren Lokaltermin:
Besagter Tag des Jammers folgte sehr rasch. Im folgenden Frühjahr, 1960, wurde der Berufsstand des Bauern landesweit mit rigiden Zwangsmaßnahmen rigoros abgeschafft, regelrecht ausgerottet nach sowjetischem Vorbild. Obwohl meine Eltern selbst keine Bauern [sprich: keine reinen Bauern] waren, brach für mich eine (meine eigentliche!) Welt zusammen. Die Bauernfamilie, die uns beherbergt hatte, floh wie so viele ihresgleichen Hals über Kopf und mit nichts in den Westen. Als ich viele Jahre später noch einmal in dieses Dorf gelangte, fand ich keinerlei Erinnerungszeichen mehr. Das Dorf hatte sich bis zur Unkenntlichkeit verändert und selbstentfremdet in Richtung „ningueño“ (der Verniemandung), um mit Octavio Paz zu sprechen.
So Wulf Kirsten in einem Selbst-Kommentar für den Hessischen Rundfunk.
Die Kollektivierung der Landwirtschaft bildete einen der großen Einschnitte in der Geschichte der DDR. Die Radio-Nachrichten von damals über das „Bauernlegen“ in der DDR sind dem Referenten noch heute im Ohr. Die Situation auf das elterliche Anwesen übertragend, stellte er sich vor, wie seine Familie von heute auf morgen von Haus und Hof fliehen, alles aufgeben müßte, was die Vorfahren in hundert Jahren erarbeitet hatten, wie man das ungemolkene Vieh zurückzulassen hätte, wie die Kühe an der eigenen Milch verrecken würden, wenn sie sie nicht laufen lassen könnten usf. … Die wenigsten Westdeutschen ahnten damals, daß die Pläne des holländischen Politikers Sicco Mansholt zur Schaffung des gemeinsamen Agrarmarkts in der EWG im Lauf der nächsten Jahrzehnte im Westen Deutschlands zu einem anderen Bauernsterben führen würde, wenn auch unter weniger grausamen Umständen als in der DDR. Niemand wurde zur Flucht über die Grüne Grenze, zur Aufgabe des ganzen Hab und Guts gezwungen, bis auf das, was man am Leibe und in der Hand trug. Viele DDR-Intellektuelle begrüßten dazumal die Abschaffung des privaten Bauerntums, auch Lyriker wie Volker Braun, er vielen voran. Die Verstaatlichung der Produktionsmittel, genauer: ihre Versammlung in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften brachte mit der Angleichung des Bauern an den Industriearbeiter auch gewisse Vorteile. Menschen, die ihr Lebtag, wie der drastische Ausdruck in Franken lautete, das ganze Jahr über nie von den Arschlöchern ihrer Kühe weggekommen waren, konnten nun plötzlich Urlaub machen. Es gab eine Nivellierung, aber auch Verstetigung des Einkommens, das Gemeinschaftsgefühl sollte gesteigert werden, das Streben nach Eigennutz gedämpft usw. Die Stimmung des Aufbruchs, die auch Wulf Kirsten erfaßt hatte, zeigt sich vielleicht am deutlichsten in Gedichten wie dem auf „Kyleb“, einen Ort, den man im Postleitzahlenbuch nicht findet, den es aber doch zu geben scheint, zumindest auf der poetischen Landkarte Kirstens:
Kyleb,
he, du mein dorf dort
am fuße niemals geschorner kälberrohrhänge
stirb nicht mit deinen
klapprigen mühlen
am rauschenden bach!
letztes klipp-klapp noch
wird verbacken zu gnadenbrot.
dorf, du mein dorf, ich müßt
deiner spotten und führn üble nachrede,
heißen
faulen jakob oder trantute dich,
anachronistischen winterschläfer
und liebhaber von mehlmotten.
hör auf, so romantisch
mit holzpantoffeln zu scheppern,
so störrisch zu zuckeln
ochsigen gemüts!
mein altes Kyleb, komm mir nicht länger
mit greisenallüren,
gestützt auf krücken!
ausgeschlummert! los einen galopp!
verruhn mag der kapphahn,
ort des gerichts,
im spinnenwinkel
hinter schattenmorellen
als sinnbild grausiger säkula.
sesam öffne dich
für mein altes klappriges dorf!
mit dem lehmbuden-klarschlag
in die aufgelaßnen steinbrüche,
wo die zerscherbten jahrzehnte
verrotten
in abgelegten galoschen.
fuderweise der hölle ins sperrmaul
gestopft altbacknen dreck!
nicht länger lotweise
soll holen der teufel
die denkmäler der fron:
schäbige hungerkorn-speicher
und krähwinkelhütten.
he, du mein stilles Kyleb,
leg los!
schnell und laut
kommt ins altväterliche dorf
das neue jahrtausend.
hinter dem mond –
gilt nicht mehr.
Es wäre angesichts der Sozialgeschichte der deutschen Landwirtschaft, speziell auch im Meißnischen, und angesichts der Kirstenschen Familiengeschichte fast unnatürlich gewesen, wenn es bei unserem Autor nicht auch Sympathien für das neue sozialistische Dorf gegeben hätte. Sammler, zu denen Wulf Kirsten unweigerlich gehört – nicht nur als Lemma-Jäger für das Wörterbuch der obersächsischen Mundarten –, Sammler neigen vielleicht zu Nostalgie und Verklärung des Gewesenen, aber angesichts des jahrhundertelangen Hungerleider-Daseins und der Ausbeutung durch den Feudal-Adel, die Schnapp- und Kapphähne, die ihre Suprematie durch die Gerichtsbarkeit zementierten, gab es keinen Anlaß zu falscher Romantik. Die „grausigen säkula“, die „denkmäler der fron“, „hungerkorn-speicher“ und „krähwinkelhütten“ sind noch allzu gegenwärtig, als daß man, gegen Brechts Rat, auf diese ländliche Bühne romantisch glotzen könnte. Zwar wurden in den Produktionsgenossenschaften der DDR die Ausweise ihrer Mitglieder nicht vom LPG-Vorsitzenden verwahrt, um ungenehmigte Ausflüge in die Stadt oder gar Landflucht zu verhindern, aber spätestens nach dem Mauerbau vom August 1961 war klar, daß der erste „Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden“ eine neue Leibeigenschaft für seine Staatsbürger etablierte. Insofern war Kirstens Haltung zum Sozialismus, wie mir scheint, bald tief gespalten. Er sagte ja zur Jakobiner-Mütze, hatte indes über kurz oder lang, wie Wolf Biermann, den Eindruck, das, was man ihnen da aufsetze, das sei der falsche Hut. Der „lehmbuden-klarschlag“ – in Ordnung; aber das, was schon rein baulich und ökologisch an die Stelle des Alten trat, die Brutal-Architektur der Kolchosen, die „stänker“ der „rübensilos“, die Ställe der Massenviehhaltung, umgeben von Jauche-Seen und abgestorbenen Wäldern, die am Ammoniak der Gülle eingingen – war das der Weg ins „neue jahrtausend“?
Unleugbar, „das tagwerk des gesindes / blieb randvoll gefüllt, / war nichts als schund und plack“, wie es in Kirstens Gedicht „das vorwerk“ heißt. Die Knechte und Mägde, und all die anderen armen Schlucker, die auf eigene Rechnung arbeiteten, – sie haben „auf lehden, in mergelsenken geschuftet wie die schiebbockhunde“. Aber nun, in der neuen Epoche, schmeckte den „säern […] die fronde“ nicht noch immer „gallenbitter wie rainfarn an wegrändern“? Man denke nur an den 17. Juni 1953, der sich in diesen Tagen zum 50. Male jährt… Kein Zweifel, der gewesene Fast-Proletarier, der Klipphausen entflohene Kleinhäusler Kirsten fühlte sich, wie es damals hieß, ,an der Seite des Proletariats‘, und er formulierte dies in den Gedichten aus den 60er Jahren unmißverständlich:
wie ein gemenge aus roggenschrot
und spelziger spreu
klingt mir
grobianischer scheffeldrescherdialekt,
überliefert meinen duzbrüdern,
den kutschern und kombinefahrern
aus zerstobener taglöhnerzeit.
[…]
im weichbild meiner dörfer
bin ich, armer
karsthänse nachfahr,
mit meinesgleichen
ein herz und eine seele.
(aus: „sieben sätze über meine dörfer“)
Kein Zweifel, die Not der Vergangenheit, die Entbehrung und Plackerei von Generationen saß Kirsten – wenn nicht in den Genen, so doch im Bewußtsein.
meine vorväter zum beispiel haben
pferde beschlagen und reifen
auf die speichenkränze von wagenrädern
gezogen. […]
am webstuhl saßen sie in stickiger,
niedriger stube, bleichgesichtige
hungerleider sie alle auf lebenszeit,
denen der brotkorb immer eine etage
zu hoch hing, die von fettlebe träumten,
von einem schubfach, gefüllt mit blanken,
klimpernden talern und gulden. armut blieb
ihr teil, solange sie schürgten und würgten.
viertelhüfner, achtelhüfner, die auf
das ackerwerk setzten und ihre feldstreifen
bestellten, gesträngt in den pflichtenkreis,
wie ihn herkommen und brotzirkel gezogen.
aus der eignen mitte leben konnte nur heißen
ewig und drei tage im göpel gehn
mit scheuklappen wie der spatlahme gaul.
eh noch die alte schuld getilgt, drückte
schon wieder eines neuen krieges kontribution
auf schulter und scheune. keine großen
kirchenlichter, keine heldentaten
vollbracht. ein geschlecht von handwerkern
und kleinbauern, nie aus dem dunkel
getreten seiner und meiner leibeigenen
geschichte, überliefert auf den wurmfressigen
seiten einer bibel, von deren buchenholzdeckeln
das schweinsleder in fetzen hängt.
über die sprossen der himmelsleiter
purzeln kopfunter kälberbeine
und birnhaken. darauf
mach ich mir einen vers.
(aus: „väterlicherseits, mütterlicherseits“)
Bei diesen Menschen, bei denen Schmalhans Küchenmeister war, muß es in der Tat eine Himmelsleiter gewesen sein, von der Kälberbeine und – üppig mit Früchten besetzte – Birnenäste herunterpurzelten, bei Gefahr, daß die am Fuß der Leiter von den guten Gaben gar erschlagen würden. Man weiß nach einem solchen Gedicht viel über Kirstens Herkunft und Ahnen, seine im wahren Wortsinn „leibeigene geschichte“, aber auch einiges über seine poetische Technik, die man über all den fesselnden sozialgeschichtlichen Befunden nicht vergessen sollte: über die Lautmalerei, mit der er ein Schiffchen „tschickend und tschackend“ über den Webstuhl schickt, über die Binnenreime, mit denen er seine Altvorderen „schürgen“ und „würgen“ läßt, über die Stabreime, mit denen er die Kriegskontribution auf „schulter und scheune“ drücken sieht.
Schließlich weiß man auch, mit welcher Selbstverständlichkeit er über die Terminologie der Tiermedizin verfügt: ein spatlahmer Gaul ist von einer wuchernden Knorpelerkrankung der Hinterbeine befallen. Ein solches Gedicht erklärt aber einmal mehr, weshalb Kirsten „Gefühlssozialist“ war, obgleich er sich dem „real existierenden Sozialismus“ mehr und mehr entfremdete.
Den Höhepunkt seiner Desillusionierung über die Entwicklung auf dem sozialistischen Lande erlebte er wohl bei einem Lokaltermin in Klipphausen und bei der Begegnung mit zwei alten Leutchen, die er, in Parallele zum Schlußteil von Goethes Faust II, Philemon und Baucis nennt.
DAS HAUS IM ACKER
einsiedlerisch das haus, mitten im acker,
mit elbtalblick, hinweg über bewaldete schlüchte.
hemmschuh des fortschreitenden fortschritts.
bewohnt von zwei alten: Philemon und Baucis.
keine murre mehr in den knochen,
kollektivierte bodenreformpioniere,
auf rente gesetzt. am stocke der bauer,
die augen gerichtet auf eine andere welt,
präpelnd und bärmelnd die abgeschuftete,
wacklige frau im geschäftigen leerlauf:
die warten schunn, daß mer baale schdärm.
dann kumpt de raupe un macht alls gleiche,
unser haus, alles, was mir uns gebaut ham
hier oum uffm bärche, werd wieder feld.
[…]
das haus im acker wegprofiliert
von territorialplanern am reißbrett.
bulldozer, bagger und dumper schieben
hinweg die unruh im gemäl. keine
anhaltspunkte, unkrautfreie bestände.
die landwirtschaft duldet kein weißes
im weizen. kamille, rade, zottelwicke –
ausgeräuchert mit pech und schwefel,
der himmelsgabe herbizid, ohne rücksicht
auf verluste gesprüht und gestäubt.
die flora mores gelehrt. kräftig dünger
gestreut aus der luft auf die äcker
und die scheitel verwitweter frauen.
so genau scheißt kein hund! klare
verhältnisse geschaffen. die erde,
unser untertan, gründlich auf vordermann
gebracht. vonwegen: natur im selbstlauf!
Eine wahrhaft bittere Bilanz-Ballade im 50. oder 55. Jahr des Autors, gegen Ende der DDR. Vier Strophen mit 14, 19, 17 und noch einmal 14 Zeilen, und eine bitterer als die andere. Ein menschlicher und ökologischer Bankrott im Namen des „fortschreitenden Fortschritts“, der, so müßte man dieses Polyptoton verwandeln, ein rückschreitender Rückschritt ist. Was sich die beiden Alten, „kollektivierte bodenreformpioniere“, ein Leben lang aufgebaut haben, was Gehäuse ihrer Existenz war, ist im Geiste schon zu ihren Lebzeiten wegrationalisiert, und in die Mundart der alten Frau übersetzt, werden die drohenden Sachverhalte noch brutaler. Die Dialektik diente in der Regel der Vernebelung der Fakten, der Dialekt nennt sie beim Namen. Es ist eine virtuose Schimpfrede und Kapuzinerpredigt Kirstens, die an jene aus Schillers Wallenstein erinnert; ein moderner Abraham a Santa Clara ist hier am rhetorischen Werke, der seinen Text, die anaphorischen Strophenanfänge nach dem Gesetz gnadenloser Steigerung baut: „einsiedlerisch das haus, mitten im acker […] das haus im acker, dorn im auge / der planierstrategen […] das haus im acker wegprofiliert / von territorialplanern […] das haus im acker – ein ziegelhaufen / ohne zukunft“
Variatio delectat? Nein, variatio terrificat. Alles, was die in der DDR unterdrückte ökologische Bewegung schon immer sagen wollte, hier ist es gesagt, mit gezügeltem Zorn, mit kontrollierter Wut, weil Schaum vor dem Mund der deutlichen Aussprache schadet. Das ganze Sündenregister einer seelenlosen, mechanisierten, nur auf kurzfristige Effizienz ausgerichteten Landwirtschaft – hier haben wir es in 64 Versen, und was zunächst am Fall der beiden alten Menschen exemplifiziert und dann zur allgemeinen Katastrophe ausgeweitet wird, führt schließlich zurück zum bodenlosen Unglück des lyrischen Subjekts, des Autors, der seine Kindheitswelt bis zur Unkenntlichkeit zerstört findet. „Alle fußpfade / ins paradies nur im gedächtnis bewahrt“. Und in der Poesie.
Was aus der Erde bei Meißen nach dem historischen Umbruch von 1989/90 geworden ist – wir werden es vielleicht eines Tages von Wulf Kirsten erfahren. Man kann heute, am Tag seiner Ehrenpromotion feststellen, daß – um bei der agrarischen Bildlichkeit zu bleiben – seine Saat auch im Westen Deutschlands aufgegangen ist. Es gibt heute im Westteil unseres Vaterlands eine Reihe von Autoren bäuerlicher oder bäuerlich-handwerklicher Herkunft – beispielsweise, in alphabetischer Reihenfolge: Martin Bullinger, Walle Sayer, Arnold Stadler, Olaf Velte. Während der aus dem Hohenlohischen stammende Martin Bullinger die agrarischen Themen in seinen hermetischen Prosa-Texten vorläufig völlig ausspart, Arnold Stadler, im Badischen gebürtig, sie anscheinend immer stärker in den Hintergrund drängt, gibt es in Hessen und Schwaben Autoren, die, ermutigt von Wulf Kirstens Beispiel, sich seiner Themen und literarischen Techniken angenommen haben. Da ist zum Beispiel Olaf Velte aus Wehrheim bei Bad Homburg, Jahrgang 1960, Sohn eines Taunus-Bauern und Maurers, der heute nach einer Lehre als Verlagskaufmann und dem Studium der Germanistik als Schafzüchter und freier Schriftsteller arbeitet. Er hat Wulf Kirsten während dessen Zeit als Stadtschreiber von Bergen-Enkheim persönlich kennengelernt, steht mit ihm in Korrespondenz und legt in seinen Gedichtbänden Landmarken, Niedriger Ackergang, Ein Kragen aus Erde wie in seinem Prosatext „Herr Auditeur Grabbe / Zur Stadt Frankfurt“ zahlreiche Affinitäten zum Werk Wulf Kirstens an den Tag, die bis zu wörtlichen Anspielungen reichen können. Auch im Taunus geht nämlich „der Wolf durchs Korn“. In Veltes Band Landmarken finden sich Verse wie die auf „Die Äcker meines Vaters“:
mein Vater wurde im Monat
der Sense geboren
schau dir seine Narben
an
vier Winde haben
seine Äcker gekämmt
da stehe ich eines Tages
auf einem Feldweg
und sehe seine Kühe
rotbunt und herrlich
den Pflug einen Schlußstrich
ziehen
Finis coronat opus, sagten die alten Römer, die einst nackt hinter dem Pflug gingen. Hier könnte es sich, ins Prosaische übersetzt, um das Ende des „Dreinutzungsrinds“ handeln, gezüchtet auf die Trias von Milch, Fleisch und Zugkraft, heute abgelöst durch die Turbo-Kuh, die nur noch wenige Kälber alt wird und dann, ausgemergelt von hohen Literzahlen, dem Metzger ins Messer läuft. Auch am Fuß der Saalburg ist das Zeitalter der „Letzten Fahrkuh“, das nicht immer „rotbunt und herrlich“ war, abgelaufen:
Die letzte Fahrkuh
steht am Scheuertor,
mit Stirnjoch und
im Kettenwerk,
Rippen stechen durch
das Fell.
Weit hinten
klein mit Hut,
ein Kind versunken
ins Zügelgewirr,
schreibt Olaf Velte in seinem Band Niedriger Ackergang, der schon im Titel die Ära des Schleppers eindieselt. Und man täusche sich nicht: der Schnappschuß von der „Letzten Fahrkuh“ ist kein Idyll. Der kleine Junge erinnert im Gewirr seiner Zügel nicht umsonst an Laokoon oder an Hippolyt, der von seinen Zugtieren zu Tode geschleift wurde. Man unterschätze nicht, wieviel Angst und Stress für die kleinen, oft überforderten Kutscher damit verbunden war, ihren Eltern mit dem mitunter störrischen oder scheuenden Zugvieh vom Hof aufs Feld nachzufahren. Insofern verschweigt das Gedicht mehr – typisches bäuerliches Understatement? – als es verbis expressis aussagt. Man sieht nicht auf den ersten Blick den Kloß im Hals des lederriemenumschlungenen Kindes.
Oder da ist Walle Sayer, ebenfalls 1960 geboren, und zwar in Bierlingen, Kreis Tübingen. Er ist, wie Olaf Velte, eine Generation jünger als Wulf Kirsten, hat indes eine ähnliche Sozialisation. Er stammt aus einer Handwerker- und Bauernfamilie, der Großvater war Zimmermann, der Vater Schreiner, der dann „beim Daimler“ schaffte. Das landwirtschaftliche Gütle mit einigen Hektar Land, einem kleinen Wald, einer Kuh, diente der Selbstversorgung und wurde nach Feierabend bewirtschaftet, bis man vor einigen Jahren Vieh und Feld abgeschafft, das kleine Anwesen verkauft hat. Walle Sayer hat die allgemeine Entwicklung in seiner Gegend beobachtet, die Verdrängung des Rinds durch die Strickmaschinen z.B.; die einstigen Nebenerwerbsbauern erzeugten in ihren umgebauten Ställen nun Strampelanzüge statt Milch, das war lukrativer, und nur ganz wenige, denen es „millionisch weh getan hätte“, ihr Vieh abzuschaffen, blieben bei der milchweißen Sache, weil ihnen klar war, mit dem Vieh sterbe das alte Dorf. Walle Sayer, der heute in Horb-Dettingen lebt, hat, wie so viele, der Verlust produktiv gemacht. Bekannt mit Wulf Kirsten – wie der mit ihm –, beschreibt er in seiner hochpointierten kurzen Prosa und in seinen Gedichten sozusagen ein schwäbisches Klipphausen, das zu ausführlichen Zitaten einlüde. Allein der Zyklus „Panoptikum“ mit seinen 48 Gedichten, der dem Andenken von Sayers verstorbener Mutter gewidmet ist, wäre eine ausführliche Zitation und Analyse wert. Ein paar Verse müssen hier für alle stehen:
Zwischen den Tischbeinen haben Hühner
Krumen aufgepickt, selbst Pfannenränder
sind Teil der Maserung geworden, Erbstück,
um das Generationen saßen, kein einziges
Gelage erlebt, nur verschüttete Mostlachen
an den nachgedunkelten Stellen, wo eine
donnernde Faust ihr Nein und ihr Amen
auf die Tischplatte hieb, einmal hat so
ein Urahn das Brotmesser hineingestochen,
Verzweiflungswut über einen Hagelschlag,
ließ es einen Tag und eine Nacht stecken,
dies ist noch die Kerbe davon.
Dies ist ein epigrammatisches Gedicht auf einen Tisch, ein Möbel, das viele Generationen überdauert hat, ein epigrammatisches Gedicht im Sinne und im Geiste Kirstens – die beiden kennen einander gut, zumindest was ihre Texte angeht.
Unter dem poetischen Blick wie unter einem Brennglas offenbart das Holz das Leben von Generationen schwäbischer Handwerker-Bauern. Tiere und Menschen lebten unter einem Dach, die Hühner, dortzulande Häher geheißen, sammelten die Brosamen auf, die von den Mahlzeiten auf den Boden fielen, und zu trinken gab es Generationen lang nur den selbstgemachten Apfel- und Birnenmost, flüssige Zukost zum Vesper, nichts für große bacchantische Aufschwünge oder gar Symposien. Das dionysische Leben hatte in diesen kargen Gehäusen keinen Ort, hier wurde niemand unter den Tisch getrunken. Der Tisch des Hauses, so kärglich er oft gedeckt gewesen sein mag, war dennoch etwas Sakrosanktes, und es war ein Frevel, das Messer in die Platte zu stechen, und sei es aus „Verzweiflungswut“ über einen Hagelschlag, der vielleicht die Ernte eines Jahres vernichtete und alles, was auf den Tisch kommen sollte, – ein messerstecherischer Frevel, fast wie eine Bluttat, der vom Vater an den Sohn weitererzählt wurde und von dem wieder an seinen Sohn. Dieser Tisch steht wirklich tief in der Familiengeschichte, er ist der Mittelpunkt seiner ländlichen Welt, eine Landschaft von einem oder anderthalb Quadratmetern, die gelesen werden muß – nicht anders als das Gesicht eines Menschen.
Ein letztes Beispiel, das solche Lese-Technik belegt, wenn auch diesmal mithilfe eines Trieders, aus ungewöhnlicher Perspektive: es ist die Nummer 44 aus dem Zyklus „Panoptikum“:
Nach einer Turmputzete einmal
haben wir von ganz oben herunterschaut,
Senkbleiernes im schwindligen Blick,
im Größtmöglichsten das Kleinstgemeinsamste:
lauter Gnomenhäuschen und die Straßen
als ein aufgerolltes Fadenknäuel,
während eine Hand hinzeigte auf das Gäu,
die Alb, die Katzenbuckel der Umgebung,
ich durchs herumgereichte Fernglas
das Schimmern eines Bodenflecks erkannte
in unserm offenen Küchenfenster,
Großvater, ihn rauchend dastehn sah
in schräger Aussparung im Vorgarten,
den Zementspritzer
auf seiner Wange.
Auch hier ist ein Mensch in der Landschaft, über der Landschaft, auf dem Kirchturm des Dorfes, aber sie ist relativ gleichgültig, sie wird gerade einmal genannt, kurz metaphorisch umschrieben „Katzenbuckel“, aber das eigentliche Interesse gilt dem Haus der Familie, und überlebensgroß zeigt sich mittels der Sehwinkelvergrößerung des Feldstechers ein „Bodenfleck“ im offnen Küchenfenster und davor, im Vorgarten der Großvater – schier unmöglich, ihn aus dieser Entfernung zu sehen – mit seinem „Zementspritzer“ auf der Wange, dem Merkmal einer eben beendeten Arbeit: werktätig auch er, um es mit Kirsten zu sagen, und er scheint, dem Feierabend hingegeben, das leichte Brennen auf der Backe nicht zu fühlen.
Lassen Sie mich zum Schluß kommen, obwohl noch viel zu sagen wäre über die Ähnlichkeiten von Walle Sayers Diktion mit der Kirstens, weil sie z.B. beide die Genauigkeit und Konzision des Dialektworts schätzen, „Turmputzete“, und es darum gezielt in den hochdeutschen Zusammenhang einbauen.
Lassen Sie mich zu guter Letzt bekennen, was Sie längst schon ahnen: daß ich auch ein bekennender Kirstenianer bin, seit ich seine Texte und ihn selbst um die Mitte der 70er Jahre kennenlernte. Wenn Sie Lust haben, durch die „Tür-Stürze“ zu treten, die ich 1980 bei S. Fischer veröffentlicht habe, werden Sie manches an gemeinsamen Strukturen entdecken: auch ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, einem mittleren Hof in Mittelfranken am Fuß des Hesselbergs unweit Dinkelsbühls, und die Prägung einer Kindheit mit früher Feldarbeit und Viehhüten, Melken und Misten, Kalben der Kühe und Abferkeln der Muttersauen war im Franken der 40er, 50er Jahre nicht anders als im Meißnischen. Mitunter genügen zwei Zeilen, um zu erkennen: das ist einer von uns, der weiß es, der hat es genauso gespürt: das Spritzen der Wasserperlen aus den Weizenstoppeln z.B., wenn man barfuß darüber ging. Das erste Gedicht in Kirstens Reclam-Band die erde bei Meißen redet davon. An einem solchen Detail, das man nicht erfinden kann, erkennen wir schreibenden Bauernsöhne einander, auch wenn wir der Scholle längst entlaufen sind. Da wir noch nicht wie die heutigen Zeitgenossen im Krankenhaus geboren sind, sondern auf dem Familiensitz und auf den halben Meter genau wissen, wo wir zur Welt gekommen sind, haben wir zu diesem Ort ein besonderes Verhältnis. Wulf Kirsten hat es zuletzt in seinem Prosaband Die Prinzessinnen im Krautgarten, vor allem im ersten Stück, „Der Hof“, bewiesen.
Ich habe vor kurzem, als meine Mutter unser Anwesen in Ehingen am Hesselberg verkaufte, weil sie mit ihren 86 Jahren den Gärten nicht mehr gewachsen war, ein Gedicht mit dem Titel „Wiederkehr der Lachse“ geschrieben, das von dem Verlust dieses Gehöfts handelt. Es mischt Trauer mit Zuversicht, weil nicht alles Verlust ist heutzutage und manches sich wiederbeleben und wiederholen läßt, auch wenn das zunächst ganz unmöglich scheint wie z.B. die allmähliche und freilich nicht unwiderrufliche Wiederbesiedlung des Rheins und seiner Nebenflüsse durch jenen edlen Fisch, den die Biologen „salmo salar“ nennen:
WIEDERKEHR DER LACHSE
aaaaaaaaaaIn memoriam Ehingen am Hesselberg
aaaaaaaaaaHaus Nr. 18
1
Aus tausend Wassern schmecken die
Lachse jenes erste heraus ihrer
Geburt
Aus weitesten Meeren kehren sie
heim
Kein Hemmnis zu hoch keine
Schnelle zu schnell
Von gläserner Schnur
gezogen steigen sie auf in ihren
Wasserstall
Um keinen Preis als den ihres
Lebens wollen sie sterben
anderswo: unweit der flachen Grube im Kies
2
Es gibt den Bach an dem ich
geschlüpft – über drei Flüsse könnt ich
tauchen in ihn – und den Brunnen neben der
Wiege
(Stoßweis gibt er sein
Wasser wie sein Blut das
Herz)
Flüssig gemacht aber der alte
Platz zerronnen das
Angestammte ortlos
der
Lieber Wulf Kirsten, wenn Sie damit einverstanden wären, möchte ich Ihnen diese Verse widmen – als Zeichen meiner Wertschätzung, „mit sympathetischer Tinte“.
Ich darf der philosophischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena danken für den rühmlichen Einfall, Sie als Schriftsteller und sich selber als Alma mater mit dieser Ehrenpromotion zu ehren, und verbinde mit meinen herzlichen Glückwünschen den Dank an Sie, meine Damen und Herren, für Ihre Geduld – beinahe hätte ich gesagt: Schafsgeduld.
Karl Corino, aus Gerhard R. Kaiser: Landschaft als literarischer Text. Der Dichter Wulf Kirsten, Glaux Verlag Christine Jäger, 2004
Gegenstandssüchtig
– Über Wulf Kirsten. Laudatio zur Verleihung des Marie-Luise-Kaschnitz-Preises an Wulf Kirsten gehalten am 19. November 2000 in Tutzing. –
Es soll Menschen geben, die es gar nicht bemerken, daß ihnen das Wertvollste, was ihnen mit dem Leben gegeben wurde, abhanden gekommen ist: die Kindheit. Andere verwinden diesen Verlust der Kindheit, mithin den Verlust der Unschuld, nie. Manche von ihnen, vorzugsweise die Dichter, bringen ein Leben hin auf der Suche nach der verlorenen Zeit, auf der Suche nach jenem springenden Brunnen, der wenigstens für die Dauer eines Romans oder eines Gedichts noch nicht völlig versiegt scheint. Dichter wird man als Kind, schrieb die russische Dichterin Marina Zwetajewa. Und weil das so ist, zieht es die Dichter unentwegt zurück zum Gelände ihrer dichterischen Erweckung, die gleichzeitig der eigentliche Akt ihrer Menschwerdung wurde. Erinnerung dient der Erneuerung dieser Menschwerdung, Erinnerung ist die eigentliche Domäne der Dichter. Oder wie Karl Kraus es (mit seiner Lust an der Pointe) ausgedrückt hat:
Ursprung ist das Ziel
Als Marie Luise Kaschnitz, in deren Name heute ein Preis verliehen wird, ihrerseits einen Preis erhielt – es war 1955 und es war der angesehenste deutsche Literaturpreis, der Büchner-Preis –, da bekannte sie in ihrer Dankrede:
Alle meine Gedichte waren eigentlich nur der Ausdruck des Heimwehs nach einer alten Unschuld.
Es gibt, meine ich, wenig Gemeinsamkeiten zwischen Marie Luise Kaschnitz mit ihrer aristokratischen Überlegenheit und Wulf Kirsten, der geprägt wurde von kleinbürgerlichen Unterlegenheitserfahrungen. Doch das Heimweh nach einer alten Unschuld verbindet den Steinmetzsohn aus dem Sächsischen mit der Freifrau aus der badischen Residenzstadt Karlsruhe gewiß. Kirstens lyrisches Werk, aber auch und erst recht sein unlängst erschienenes erstes Prosawerk Die Prinzessinnen im Krautgarten zehren ja von der Erinnerung an das Kindheitsland, in dem diese alte Unschuld zu Hause war, auch wenn die Geschichte immer wieder brutal und blutig über dieses Kindheitsland hinwegfegte.
Dieses Land der Elbhöhen zwischen Dresden und Meißen, wo seitab das kleine Rittergut lag, aus dessen Kuh- und Pferdestall-Dunstkreis Wulf Kirsten bis zum vierzehnten Lebensjahr nicht hinauskam, dieses Hinterland nennt Kirsten sein Gelobtes Land, sein „arkadia“, obwohl dort doch Enge „das alltägliche Maß“ war, Enge und Armut. Doch waren Enge und Armut für Wulf Kirsten offenbar kein Grund, mit dem Schicksal zu hadern, eher im Gegenteil, er empfand sie als eine Art Auszeichnung. „Gesegnet mit dem Privileg der Armut“, so heißt es in seinem Gedicht „Ruhm“, das er zwar einer sächsischen Botanikerin des 19. Jahrhunderts gewidmet hat, in dem er aber implizit von sich selbst spricht. Daß dieses Privileg der Armut schon seit jeher seine Vorfahren auszeichnete, erfahren wir aus seinem Gedicht „väterlicherseits, mütterlicherseits“:
[…]
am webstuhl saßen sie in stickiger,
niedriger stube, bleichgesichtige
hungerleider sie alle auf lebenszeit,
denen der brotkorb immer eine etage
zu hoch hing […]. armut blieb
ihr teil, solange sie schürgten und würgten.
viertelhüfner, achtelhüfner, die auf
das ackerwerk setzten und ihre feldstreifen
bestellten […]
aus der eignen mitte leben konnte nur heißen
ewig und drei tage im göpel gehn
mit scheuklappen wie der spatlahme gaul.
eh noch die alte schuld getilgt, drückte
schon wieder eines neuen krieges kontribution
auf schulter und scheune. keine großen
kirchenlichter, keine heldentaten
vollbracht, ein geschlecht von handwerkern
und kleinbauern, nie aus dem dunkel
getreten seiner und meiner leibeigenen
geschichte […]
Wulf Kirstens Reaktion auf diese „leibeigene Geschichte“ ist nicht Empörung, ist nicht Revolte, sondern eben das Gedicht, in dem er nur sagt, was war und was ist, aber indem er das zu sagen vermag und durch die Art und Weise, wie nur er es zu sagen vermag, tritt er bereits aus dem Dunkel dieser „leibeigenen Geschichte“ heraus. Und mit ihm und seinem Gedicht treten auch jene ins Licht, deren Teil früher einmal nur finstere Fron war, so etwa die Großmutter, die Tag für Tag vor Morgengrauen – in aller Herrgottsfrühe, wie man sagt – in den Dörfern die Butter aufkaufte, sie dann auf den Markt nach Dresden trug und jetzt im Gedicht des Enkels im „glorienschein der armut“ erscheint:
bald,
ehe im osten
der hausschlächter des himmels,
ein frühaufsteher,
den horizont beschickt
mit seinem zinnober-dekor,
in der ersten gräue,
wenn die karriere des lichts beginnt,
trägt eine butterfrau ihren buckelkorb
über sieben raine,
und ein grobschlächtiger zughund
zerrt ohne gehabe
den erblindeten glorienschein der armut
zu markte.
über den Elbhöhen
wird der tag gekrönt.
ein klumpen butter
kugelt über die grasigen scheiben
und schanzen.
Es war Robert Walser, der einmal schrieb, nur der Arme sei „fähig, vom engen Selbst geringschätzig wegzugehen, um sich an etwas Besseres zu verlieren. […] an die Bewegung, die nicht stockt, […] an das schwingende Allgemeine, an das nie erlöschende Gemeinsame, das uns trägt“. Es ist das Besondere an Wulf Kirstens poetischen Beschwörungen seines Kindheitslandes, daß in ihrem Mittelpunkt eigentlich nie das eigene Selbst steht – „das enge Selbst“, wie Robert Walser es nennt –, sondern dieses Allgemeine. Die Kindheitslandschaft wird nicht zum Resonanzboden bloßer nostalgischer Stimmungen, sondern wird immer oder in erster Linie als sozialer und geschichtlicher Raum gesehen und in unser Blickfeld gerückt. Daß das einem poetischen Programm Kirstens entspricht, davon zeugt schon sein 1967 geschriebenes Gedicht „satzanfang“. dessen Titel er auch für seinen allerersten, 1970 erschienenen Gedichtband übernahm:
[…]
ans licht bringen
die biografien aller sagbaren dinge
eines erdstrichs zwischenein.
inständig benennen: die leute vom dorf,
ihre ausdauer, ihre werktagsgeduld.
aus wortfiguren standbilder setzen
einer dynastie von feldbestellern
ohne resonanznamen.
den redefluß hinab im widerschein
die hafergelben flanken
meines gelobten lands.
seine rauhe, rissige erde
nehm ich ins wort.
Wörtlich genommen – und wörtlich sollte man Gedichte schon nehmen –, verspricht Kirstens programmatisches Gedicht dreierlei: 1. die Dinge wahrzunehmen und ins rechte Licht zu rücken mittels Sprache, 2. den Leuten vom Dorf, Leuten ohne Resonanznamen, Denkmäler in ihrer eigenen Sprache und sie damit erst ins Recht zu setzen und 3. die Erde – die „rauhe, rissige erde“ – selbst sprechen zu lassen. Ins banal Begriffliche übersetzt, lautet dieses Programm: richtig sehen, richtig hören, richtig benennen. „Man sieht nur, was man weiß“, schreibt Theodor Fontane einmal. Dasselbe gilt für das Hören und das Benennen. Wer nichts von Sprache und ihren Gesetzen weiß, überhört die Worte in ihrer Eigenart, ebenso wie der, der nichts von den Gesetzen der Musik weiß, die Eigenart einer Musik überhört. Wo aber erlernt man solches Wissen? Nirgends – und zum allerwenigsten, fürchte ich, in der Schule. Am besten lernt man es in der Kunst selbst, in Kirstens Fall in der Literatur, also durch Lektüre. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Literatur entsteht aus Literatur, das heißt aus dem Lesen. Wulf Kirsten ist ein kolossaler Leser – und sein Lesehunger war von Anfang an unersättlich und das auch schon deshalb, weil Lesehunger ja nichts anderes ist als Lebenshunger, Lebenshunger, der naturgemäß unstillbar bleiben muß. Dichter wird man als Kind auch durch die Bücher, die man liest.
Merkwürdigerweise – und das hören Pädagogen nicht so gern – scheint es zunächst fast gleichgültig zu sein, was das Kind liest, ob von der Literaturgeschichte als wertvoll kanonisierte oder als wertlos verworfene Bücher; gleichgültig deshalb, weil das Kind in Wahrheit gar nicht diese Bücher liest, sondern sie vielmehr lesend für sich umschreibt, das heißt, das Kind liest vor allem sich selbst. Und nicht nur das Kind: „Jeder Leser eines Buches ist erst einmal der Leser seiner selbst“, meinte Marcel Proust. Wulf Kirsten fand als Kind in dem winzigen Bücherschrank seiner Eltern nur Populärliteratur, Romane von Autoren wie Ganghofer, Rudolf Herzog, Ernst Zahn oder Hermann Löns. Doch mit ihrer Hilfe ließ sich ebensogut weggehen von der heimatlichen Enge und dem eigenen engen Selbst wie etwa mit Hilfe von Knaurs Konversationslexikon, das der Vater für 2,85 Reichsmark – damals ein Vermögen! – erworben hatte (und dabei fällt mir ein, daß es auch im elterlichen Haushalt des jungen Peter Bichsel lediglich ein Konversationslexikon gab, das aber zum poetischen Pfingsten, zum Erweckungserlebnis des jungen Schweizers wurde).
Es gab allerdings im elterlichen Bücherschrank der Kirstens noch zwei zerfledderte Lesebücher aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg, in denen das lesehungrige Kind erstmals auch Gedichte entdeckte, vornehmlich sicher Balladen, wie sie damals jedes Kind aufsagen mußte, aber auch ein Gedicht darunter, von dem eine einzige Zeile dem Kind nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte, obwohl es sie nicht zu verstehen glaubte, vielleicht aber auch gerade deshalb, weil sie so unverständlich anmutete. „Der Vogelsprache kund“, lautete diese Zeile, und erst viele Jahre später entdeckte Kirsten das ganze Gedicht. „Aus der Jugendzeit“ ist es betitelt, und geschrieben hat es Friedrich Rückert 1829:
O du Kindermund, o du Kindermund
Unbewußter Weisheit froh,
Vogelsprachekund, vogelsprachekund,
wie Salomo!
So lautet eine Strophe dieses Rückert-Gedichts, mit dem der junge Wulf Kirsten nicht nur die Befremdung über das seltsam ungewohnte Deutsch erfuhr, sondern unbewußt doch auch schon dies, daß nämlich jedes dichterische Sprechen erst einmal heißt, anders zu sprechen, ungewohnt zu sprechen. Kein Wunder, daß später der junge Dichter sich einen Dichter zum Vorbild erwählte der in der DDR gar nicht gut gelitten, weil als elitär verschrieen war: Stefan George. Georges – ich zitiere Kirsten – „abgrundtiefer Ekel angesichts der zu billigstem Verständigungskitsch verkommenen Butzenscheiben- und Goldschnittlyrik war mir nur zu begreiflich“. Freilich begriff er gleichzeitig schon, daß es darauf ankam, Georges Vorgabe gleichsam wieder zu entfeierlichen, zu säkularisieren. In eine solchermaßen säkularisierte Richtung gestoßen und damit in seine eigene wurde der junge Wulf Kirsten spätestens am Heiligabend 1952, als er in einem Antiquariat Wolfgang Weyrauchs 1947 im Aufbau-Verlag erschienene Lyrik-Anthologie Die Pflugschar fand und darin Gedichte von Peter Huchel, Elisabeth Langgässer, Günter Eich, Oda Schäfer und Marie Luise Kaschnitz, Gedichte des sogenannten magischen Realismus, Gedichte von Autoren, die man allesamt der sogenannten inneren Emigration zurechnete (damals konnte Wulf Kirsten noch nicht ahnen, daß er den Status des inneren Emigranten selbst einmal einnehmen würde).
Es war – um noch einen Augenblick bei den durch Lektüre gefundenen Vorbildern und Verbündeten Kirstens zu verweilen –, es war ein unbedingter Verfechter und Statthalter des Säkularen, und es war dazu ein antinazistischer Emigrant der ersten Stunde, der nach dem Krieg zur vielleicht wichtigsten literarischen Bezugsperson Kirstens wurde, obwohl er, von wenigen Gelegenheitsgedichten abgesehen, keine Gedichte schrieb. Es war ein Schriftsteller, dem unsere Starnberger-See-Gegend mehr verpflichtet sein sollte als jedem anderen Schriftsteller (doch das Gegenteil scheint mir der Fall), kurz und gut, es war Oskar Maria Graf aus Berg am Starnberger See, damals aber längst in New York lebend. Kirsten hatte von ihm Das Leben meiner Mutter gelesen und mußte ihm seine Ergriffenheit über dieses vielleicht schönste und sicher wahrhaftigste Buch, das von einem Bayern im 20. Jahrhundert geschrieben wurde, unbedingt mitteilen. Aus dem Briefwechsel, der sich daraufhin zwischen dem jungen Sachsen aus der DDR und dem alten Bayern aus New York entspann, bezog Wulf Kirsten eine Bestärkung seiner Eigenart und damit seines poetischen Themas. Ich möchte dieses Thema so umschreiben: poetische Landnahme und poetische Archäologie des eigenen Kindheitsgeländes und Spiritualisierung des Alltags und des Alleralltäglichsten in dem Sinne, wie es die letzte Strophe eines der seltenen gereimten Kirsten-Gedichte, das „werktätig“ betitelt ist, nahelegt:
eine leiter lehnen, haferstroh häckseln,
das zeitliche mit dem ewigen verwechseln.
Nicht Erhebung oder gar Entrückung ist das Ziel des Gedichts, sondern Bewegung und Belebung dessen, was ist. Schon Goethe hat in diese Richtung gedacht:
Schwerer Dienste tägliche Bewahrung,
sonst bedarf es keiner Offenbarung.
Was Elisabeth Langgässer einmal als Wilhelm Lehmanns „Originalität“ rühmte (und was Kirsten in seiner Dankrede für den ihm zuteil gewordenen Langgässer-Preis zitierte), nämlich Lehmanns „Fähigkeit, seine angeschauten, irdischen Realien ihrer Schwere zu entledigen und sie federleicht anmuten zu lassen, sie zum Schweben zu bringen“, ist nahezu das Gegenteil von dem, was Kirstens Originalität ausmacht: er beläßt den Realien – und den in sie eingeschlossenen Menschenschicksalen – ihre herbe und kantige Schwere, ihre Bodenverhaftung. Als Kirsten einmal in meiner jetzigen Funktion, als Laudator – für Sarah Kirsch –, auftrat, unterschlug er zwar nicht die fabelhafte Fähigkeit dieser Dichterin, Schweres und Schwerstes in schiere lyrische Luftgebilde zu verwandeln, aber er betonte doch vornehmlich die Vererdung ihrer Gedichte:
Das verrufene Wort ,Erde‘, von dem so viele meinen, es sei ,rechts‘ besetzt, also habe man es links liegenzulassen, hat sie zu einem Grundwort ihrer Gedichte werden lassen.
Auch vor den Gedichten Sarah Kirschs erwies sich der Leser Kirsten erst einmal als Leser seiner selbst. Bei ihm erscheint das Wort Erde bereits im Titel des Gedichtbandes, mit dem er 1987 erstmals im Westen des geteilten Landes als Lyriker hervortreten durfte (ich sage „durfte“, weil die Kulturverwalter der DDR ihm wohl nur zähneknirschend die Publikation erlaubten). Die Erde bei Meißen heißt dieser Band, in dem Kirsten auch noch jedem Ödland oder „Besenginsterland“ etwas ablockt, was er „erdlust“ nennt. Der Dichter tritt uns entgegen als „entschlossener landgänger“; als ebensolchen hat er jenen querköpfigen Bauernmaler Querner apostrophiert, dessen von Schwerstarbeit gezeichnete Figuren – Rübenfrauen, Kartoffelleser, Pflüger, Säer – „Inkarnationen der Landschaft“ sind und die mit Blut und Boden so wenig zu tun haben wie Kirstens Gedichte mit Verklärung der Scholle.
Zur Verklärung hat Kirsten keinerlei Talent, ihm geht es vielmehr um klären und erklären, um erfahren und erfassen. Als verhinderten Volkskundler hat er sich mir gegenüber einmal bezeichnet und bekannt, am liebsten hätte er ein Heimatmuseum geleitet. Es paßt ins Bild, daß dieser verhinderte Volkskundler nicht nur in seiner Zeit als freier Mitarbeiter des Wörterbuchs der obersächsischen Mundarten systematisch Wörter sammelte, die verlorenzugehen drohten oder bereits verlorengegangen waren, Wörter aus dem meißnischen – linkselbischen – Dialekt, Wörter seiner Kindheit und Wörter seiner Vorfahren, die er bei seinen entschlossenen Landgängen zu alten Bauern, zu Kutschern, Häuslern und Hofeweibern wieder zutage förderte und als Humus für seine Gedichte neu nutzbar machte. Man wird da an Béla Bartók oder Zoltán Kodály erinnert, die systematisch auf dem Lande ungarische und rumänische Volkslieder sammelten und sicher nicht aus Sammelwut, sondern weil sie darauf vertrauten, daß ihnen aus diesen Liedern eine Kraft, eine Substanz für ihr eigenes kompositorisches Schaffen zuwachsen würde, wie es ja auch der Fall war.
Triebkraft für Kirstens beharrliche Wörtersuche war sicher sein Vertrauen darauf, daß mit den wiedergefundenen Wörtern auch die von ihnen bezeichneten Dinge und auch die Menschen, die diese Wörter einmal gebrauchten, wieder zu neuem Leben gelangen müßten. Im Gedicht „Memorabilien“ aus seinem letzten, 1999 erschienenen Gedichtband Wettersturz heißt es zwar: „selbst die wörter sang- und / klanglos ausgewandert aus den dingen“, doch hat Kirsten viele dieser ausgewanderten Wörter wieder heimgeholt und sie in seiner Poesie nicht nur als Kolorit und Klang verwendet, sondern gleichsam als Spaten, mit dessen Hilfe er tiefer in sein Kindheitsgelände vorzudringen vermochte.
„Wie Kunstsprache aus der Volkssprache zwingend hervorgehen kann“, habe er bei Peter Huchel gelernt, bekannte Wulf Kirsten 1987 bei der Entgegennahme des Peter-Huchel-Preises. Doch so unübersehbar auch Kirstens Verwandtschaft zu Huchel – vor allem dem frühen Huchel – ist, den Durs Grünbein einmal einen „Landschaftshistoriker“ nannte, so zweifelsfrei scheint es mir auch, daß die spracharchäologische und landschaftshistorische Tendenz bei Kirsten noch stärker ausgebildet ist. Ein anderer Vergleich – ich ziehe ihn hier nicht zum ersten Mal – scheint mir fast ergiebiger, nämlich der zwischen Kirsten und dem nobelpreisgekrönten irischen Dichter Seamus Heaney, in dessen Gedichten sich viele Worte finden, die Heaneys deutsche Übersetzerin nicht im Oxford English Dictionary fand, so wie entsprechend viele Wörter aus Kirsten-Gedichten nicht mehr in Grimms Wörterbuch oder nur noch dort zu finden sind; ich nenne nur einige wenige: Krell, Hedel, lempeln, Geschwende, reiteln, schrappen oder Gezinge.
Weder Kirsten noch Heaney verwenden solche seltenen Wörter in der bloßen Absicht, ihre Gedichte „interessant“ aufzuputzen, beide sind sie vielmehr auf der Suche nach jenem einzigen Schatz, der eine Gemeinschaft zu begründen und zu binden vermag, dem Wortschatz. Und bei beiden kommt solch besessene Wortschatzsuche auch aus der frühen Erfahrung des Bedrohtseins einer solchen Gemeinschaft durch politische Unterdrückung. Wurde für den Nordiren die Herkunft von Kleinbauern und Torfstechern, die unter brutaler britischer Herrschaft zu leiden hatten, prägend, so wurde für Kirsten die Herkunft aus einer „Häuslerdynastie“, die sowohl der nazistischen wie der kommunistischen Diktatur ausgesetzt war, bewußtseinsbildend. Was beide zu solchen Wort-Bewahrern werden ließ, war also auch ihre Furcht vor der alles einebnenden, alles nivellierenden und alle sprachlos machenden Macht der Geschichte. „Die Geschichte hatte mit einem großen Kehrbesen gearbeitet und die Menschen wie Kehrricht durcheinandergewirbelt“, lesen wir in Kirstens Jugenderinnerungen Die Prinzessinnen im Krautgarten.
Und jetzt soll doch noch von der DDR gesprochen werden, von der DDR-Vergangenheit, die ebensowenig vergehen will und kann wie die ungleich schlimmere deutsche Vergangenheit, aus der die DDR und die deutsche Teilung hervorgingen. Ich weiß nicht, ob Wulf Kirsten je einmal in die Falle ging, die ich die antifaschistische Falle nennen möchte; wer wie ich im Westen des Landes in den fünfziger Jahren erlebte, wie die braune Vergangenheit unter den Tisch gekehrt und weggeschwiegen wurde und gleichzeitig die alten Parteigänger des Unheils die neuen Machtpositionen besetzten – Ingeborg Bachmann hat es in einem ihrer frühen Gedichte unvergeßlich ins Bild gebracht:
Sieben Jahre später,
in einem Totenhaus
trinken die Henker von gestern
den goldenen Becher aus
wer wie ich litt unter dem Wahnsinn der Wiederbewaffnung, unter Adenauers Restaurations-Wahnsinn und dazu diesem Wahnsinn Wirtschaftswunder, dem konnte ein deutscher Staat, der als oberstes Gesetz Antifaschismus ausrief und der die antifaschistischen Emigranten heimrief, schon als eine Alternative erscheinen. Ein Land, in dem Bertolt Brecht und Hanns Eisler, Arnold Zweig und Anna Seghers, Peter Huchel und Erich Arendt lebten und arbeiteten, durfte, so dachte ich damals, durchaus eine Lyrikanthologie mit dem Titel In diesem besseren Land herausbringen. Und es soll ja nicht vergessen sein, daß in dieser 1966 erschienenen Anthologie auch all jene vertreten waren, die später als Dissidenten betrachtet wurden und die DDR verließen oder verlassen mußten oder aber kaltgestellt wurden. Wulf Kirsten allerdings war in dieser Anthologie nicht vertreten, obwohl es ihn als Dichter doch bereits gab, schwerlich hätte ich sonst im selben Jahr 1966 in meiner in München verlegten Anthologie Aussichten – es war wohl die erste gesamtdeutsche Lyrikanthologie – acht Gedichte von ihm publizieren können. Freilich hatte Kirsten die DDR in einem gewissen Sinne längst verlassen, wenn auch nicht Richtung Westen, sondern in Richtung Vergangenheit, in Richtung Hinterland mit seinen vergessenen Wörtern und seinen vergessenen Werten. Die DDR nannte sich Arbeiter- und Bauernstaat. Aber wenn auch 1946 die Bodenreform einem Manne wie Kirstens Vater endlich ein Stückchen eigenes Land einbrachte und wenn auch diese Bodenreform selbst einen Dichter wie Peter Huchel zu einem rühmenden Gedichtzyklus animieren konnte, sehr bald war doch schon zu erkennen, daß der DDR-Führung nur der Kollektivbauer etwas galt. Und nun kam da ein junger Dichter daher, der nicht nur die gewünschten Loblieder auf die landwirtschaftliche Kollektivierung nicht anstimmte, sondern sogar ausdrücklich und eindringlich die offiziell zum Untergang verurteilte alte bäuerliche Welt beschwor und betrauerte. Wie hätten die DDR-Kulturfunktionäre mit ihrer Forderung nach sozialistischem Realismus, der freilich gerade nicht realistisch, vielmehr propagandistisch sein sollte, wie hätten sie das nun wirklich äußerst realistische Bild eines kaputten, dem Untergang bestimmten Dorfes gutheißen können, wie Wulf Kirsten es etwa in seinem Gedicht „dorf“ zeichnete, ein Gedicht, mit dem er allen den kaputtgemachten, geschleiften Dörfern der DDR ein Denkmal setzte:
die zersiedelte siedlung,
wie sie verwegen abhängt,
zerfleddert und zerpflückt
zwischen wilden müllkippen,
die sich verzetteln
von unort zu unort.
das lied der beerenpflückerinnen
ein erinnerungsfetzen
im schrumpfwald.
kahlschlaggesellschaften
in aufsteigender linie.
unentwegt fluß-lebensläufe begradigt.
abgespielter klaviere
resonanzböden kieloben.
geißfuß tritt das pedal.
der mahltrichter wird habhaft der dinge:
schrillte noch eine grille im schlehenstrauch?
flog himmelwärts des landmanns liedermeister?
der mahltrichter wird habhaft der worte:
der quell, die werre, das fohlen.
lebensabführungen.
das dorf,
sieh, wie es verschlungen wird,
am ende verschlingt es sich selbst,
wie es hingeht
gegen die scherbenumkränzte leere!
sieh, wie es ziegel um ziegel
im mahltrichter verschwindet.
Die DDR sah oder vielmehr verkannte sich als Avantgarde des gesellschaftlichen Fortschritts. Was sollten die Fortschrittsfixierten anfangen mit den Bauern, Häuslern, Flickschustern, Ziegelbrennern, Hausierern, Landstreichern, Straßenkehrern und Zigeunern, mit den vielen „Leuten ohne Resonanznamen“, die Kirstens Gedichte bevölkern? Für sie waren das überflüssige Menschen. Wulf Kirsten, dem es, wie wir aus seinen Kindheitserinnerungen erfahren, schon als Pimpf unmöglich war, „in einem Marschzug Schritt zu halten“, schwamm in der DDR nicht nur deshalb so beharrlich gegen den Mainstream, weil es ihm an Überzeugung oder Opportunismus gebrach, sondern weil ihm seine Natur keine Form von Gleichschritt erlaubte. Die verordnete Positivität und seine eigene eingeborene Positivität standen diametral zueinander, die seine rekurrierte auf Natur, die andere auf gesellschaftliche Macht.
Von heute aus sehen wir, daß das, was ihn zum real existierenden Sozialismus in Gegensatz brachte, nicht nur das war, was Sándor Márai mit dem treffenden Wort „Seelenverstaatlichung“ umschrieb. Es war etwas, was Kirsten auch unter den Bedingungen des real existierenden Kapitalismus zum Abweichler und Außenseiter gestempelt hätte, etwas, was schon im Titel seines Gedichtbandes Der Bleibaum unüberhörbar mitschwingt, nämlich der ökologische, der grüne Impetus. „wenn die rauchsäulen des zementwerks / füllen wieder busch und tal / mit ruß und staub. / o Sappho, wie der apfel sich rötet / am obersten aste / des bleibaums vorm haus“, endet das Titelgedicht dieses Lyrikbandes, der immerhin in der DDR erscheinen durfte und dazu in einer Zeit, als im Westen noch nicht einmal das inzwischen inflationäre Wort vom Waldsterben umging.
Im „Wörterbuch des Unmenschen“, wo es hingehört, steht das Wort „Flurbereinigung“ noch nicht. Das flurbereinigende Unmenschentum ist aber wahrlich gesamtdeutsch gewesen. Es hat in Wulf Kirsten früh einen erbitterten Feind gefunden, der „die weggebissene sprache der feldhecken“ sucht und der sich zum Anwalt der „vegetierenden vegetation“ gemacht hat; „auf astlosen baumstümpfen / die vegetierende vegetation“ heißt es im Gedicht „die straße“. Seinem Gerechtigkeitsgefühl gegenüber jenen „ohne Resonanznamen“, jenen Randfiguren der Geschichte, „die ohne Stimme sind“, entspricht Kirsten Gerechtigkeitsgefühl gegenüber einer geschändeten und an den Rand der Vernichtung gedrängten Natur, die immer mehr zum Spiegelbild unserer inneren Zerstörtheit wird.
Man kennt Brechts Zeilen:
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt.
Inzwischen muß der Dichter sich fragen, ob er noch über Bäume schweigen darf, weil diese zu Opfern unserer Untaten geworden sind. Die „kahlschlaggesellschaften“, von denen Kirsten in seinem Gedicht „dorf“ spricht, sind mit der Wiedervereinigung eher noch mächtiger geworden. Eines seiner letzten Gedichte führt in eine Zukunft von „schutthalden bar jeden anflugs / von natur“, bei denen „noch nicht zu erkennen (ist), ob eine nessel / wachsen wird aus eigenem entschluß“. Zu solcher Nesselwinzigkeit sollte Kirstens Hoffnung also inzwischen geschrumpft sein? Nein, sein letztes Wort darf und wird das nicht sein.
Die mir zugebilligte Lobredner-Zeit ist fast dahin, und noch habe ich von so vielem nicht gesprochen, was Wulf Kirstens lyrische Eigenart und Besonderheit ausmacht, etwa von seinen bewegenden Porträtgedichten, mit denen er fast so etwas wie ein eigenes lyrisches Genre begründete; meine Lieblingsgedichte sind darunter, Gedichte auf die Droste, auf Kleist, Grabbe, Weber, Nolde, van Hoddis, Joseph Roth, Ivar von Lücken, Paustowski, Brancusi und eines auf den genialen mit 24 Jahren verstorbenen tschechischen Lyriker Jiři Wolker, das mit einem Besuch im Wolker-Museum endet:
im museumsfundus der vaterstadt pietätvoll verwahrt
die briefschaften von dreiundzwanzig mädchen,
postlagernd bis zum jüngsten tag.
wer weiß, wie viele mädchen
der liebe gott ihm schuldig blieb.
in den städtischen anlagen sitzt seine eiserne braut,
vergilbt in lebenslanger einsamkeit,
gehüllt in ein schwarzes umhängetuch
und streut den vögeln brosamen.
sie hat ihre schönheit weitergegeben.
vielleicht an eine der näherinnen am fließband
oder an eine büglerin, unter deren händedruck
der plättstahl aufzischt wie ein schmerzerfülltes ach.
vielleicht an eins jener mädchen aus der schneiderschule.
jedes auge eine inbrünstige bitte um liebe.
vielleicht an jene verkäuferin im kupferhaar,
eine leibhaftige göttin der morgenröte, die tag für tag
mit vollendeter anmut schallplatten auflegt.
In diesen Porträtgedichten findet Kirsten immer wieder zu einer Plastizität, die an die Bilder alter Meister erinnert und nicht zuletzt auch seine handwerkliche Meisterschaft verrät. Was für eine berückende Bildlichkeit etwa am Ende des Gedichts „sonntagmorgen am Wilden Mann“:
auf dem asphalt
laufen zwei mädchen rollschuh
nebeneinander
im gleichmaß ausgewogener bewegung.
den langsam einsetzenden regen
ziehen sie sanft hinter sich her.
Apropos literarisches Handwerk: Der polnische Dichter Zbigniew Herbert meinte einmal:
Gäbe es eine Schule der Literatur, so müßte man in ihr vor allem die Beschreibung der Gegenstände üben und nicht die der Träume.
In einer solchen Schule könnte ich mir den geradezu gegenstandssüchtigen Wulf Kirsten gut als Lehrenden denken. Er weiß, daß erst das genaue Beschreiben der Dinge ihr Erleben bewirkt, was wiederum Voraussetzung dafür ist, daß das Gedicht zu dem wird, was es nach Peter Handke sein muß, ein „Ort der Gerechtigkeit“. „wahr ist nichts […] als die Sprache der Dinge“ heißt es in einem Kirsten-Gedicht.
Ich verstehe gut Martin Walser, nein, nicht den Walser der Paulskirchen-Rede, sondern jenen der Münchner Kammerspiel-Rede vom Oktober 1988, in der er bekannte, er könne sich nicht mit der deutschen Teilung abfinden, und für sein sozusagen gesamtdeutsches Deutschlandgefühl eine Leseerfahrung ins Feld führte: Gedichte von Wulf Kirsten. Walser rühmte an ihnen, sie seien „schwer von Vergangenheit“ und lebten nicht, wie westliche Gedichte, „von Urteil, Idee, mediengerechter Apokalypse“, sondern von „Dingen, Gegenständen, nächster Nähe“. Walser wörtlich:
Unsere westlichen Dichtersprachen sind, verglichen mit Kirsten, urteilssüchtig, aussagesüchtig. Über alles wird einfach befunden. Und es wird fast nichts als befunden. Genannt wird wenig. Bewahrt nichts. Wenn ich Wulf Kirsten lese, empfinde ich, was wir in Westdeutschland verloren haben.
So weit Walser, der da auch der DDR etwas gutschrieb, was als Gutschrift vielleicht eher Wulf Kirsten allein gebührt hätte. „Ich glaube, in der DDR sei uns etwas gespart“, sagte Walser damals, aber ich denke, es ist uns nur in den Gedichten Kirstens gespart, jedenfalls hat dieses Gesparte weit mehr mit Kirstens Verhaftung an sein Kindheitsland zu tun als mit seiner DDR-Haftung. Kirsten gab dieses Kindheitsland nie ganz verloren. Ein Lieblingssatz von ihm, er stammt von John Berger, lautet:
Das Gedicht kann zwar keinen Verlust ersetzen, aber es kann den Abstand zu dem Verlorenen verringern.
Ganz zuletzt soll Wulf Kirsten selbst sprechen, im Gedicht, versteht sich, und weil davon noch gar nicht die Rede war und sich jemand womöglich fragen könnte, ob dieses von Liebe zu den Dingen, zur Natur und zu den Menschen erfüllte Werk gar kein Liebesgedicht kenne, möchte ich mit einem ebensolchen schließen. Da es aber von Kirsten, mit seiner Scheu vor großen Gefühlen, stammt und da sein Lebens- und Schreibmotto die Brecht-Maxime „allem, was du empfindest, gib die kleinste Größe!“ sein könnte, stellt sich dieses Liebesgedicht nicht als ein solches aus, es richtet sich an kein Du, von einem Du ist in ihm nicht einmal die Rede, aber es enthält lauter Leerstellen, in denen nichts anderes als ein Du zu nisten vermag. Nichts benötigt die Liebe mehr als solche Leerstellen:
seestück
ein sommer, wie er nie wieder war. –
wahr ist nichts als der nachtatem des sees,
als die sprache der dinge, schwarzumrissen;
stille bis in die schlafplätze der vögel im röhricht hinein.
einen atemzug verruhte der sommer.
in den baumkronen tonlose schritte,
der sommerweg führte über wolkenwälle,
hautschrift in der nacht hut.
der see ein blinder spiegel,
in den kühlen atem des wassers
tauchte ein wortpaar:
vorgeschmack von handschlag und ortswechsel.
zwei atemzüge, flüchtiges gleichmaß, vom munde abgeweht.
beständiger ist nichts
als die himmelsrichtungen,
die uns fortziehen mit ihren langen armen.
Peter Hamm, Sinn und Form, Heft 2, März/April 2001
Dankrede zur Verleihung des Kaschnitz-Preises
am 19. November 2000
Ich benutze die deutsche Sprache, weil ich mich in keiner anderen auszudrücken weiß. Und ich kann diese Sprache mir nicht in einem luftleeren Raum denken. Diese Sprache lebt aus einem Geflecht weit zurückreichender Geschichte wie aus einem allzu flüchtiger politischer Gegenwart, ebenso gehören dazu soziale Bindungen, landschaftlich begrenzt, koloriert, eben all das, was Provinz an positiv und negativ besetzten Impulsen einschließt. Und es gäbe noch viele andere Aspekte, Bereiche aufzulisten, aus denen Sprache gespeist wird, teils bewahrend, teils verlebendigend, erneuernd. Mitunter sind die Einflüsse und Einflüsterungen aber auch weit eher destruktiv. Aus diesem Block nehme ich mir etwas heraus. Ich bin gewohnt, was ich auch sehe, als Text zu lesen, sei es eine Fläche, eine urbane Fassade, ein ehemaliges Gehöft, eine Landschaft. Und mitunter geht aus solch einem Text ein Gedicht hervor. Wobei ich nicht darauf aus bin, alles und jedes, was sich mir textiert, Gedichte werden zu lassen, in dem sich das Gesehene, Erlebte zur gesteigerten Szene auflädt. In den Gedichten anderer Lyriker, in denen ich Vorbilder erkenne, deren Texte mir modellhaft poetische Möglichkeiten vorstellen, nicht erklären, erfahre ich immer aufs neue die Gewißheit, daß es „das Gedicht“ nicht gibt, gar nicht geben kann. Diese Einsicht bietet Spielraum für neue Varianten des Gedichts. Texte dieser imaginativen, faszinierenden Beschaffenheit, auf die sich zusteuern läßt, sind mir nicht nur aus meiner Sprache zugeflossen. So etwa aus dem Spanischen, Neugriechischen, aus dem Polnischen, Tschechischen, Ungarischen, Russischen, Französischen, Schwedischen, nicht zuletzt aus dem Anglo-Amerikanischen. Soweit meine Informationen reichen, spielt die Musik derzeit dort. So wie dies vorzeiten für Frankreich, später für Spanien galt. Ganz und gar nicht im deutschen Sprachbereich. Dennoch muß ich um meiner selbst und meiner Texte willen das Deutsch bewahrend verteidigen, das mir zu Gebote steht und aus dessen überreichem Fundus ich eine neue Mischung hervorgehen lasse, die außer mir selbst möglichst auch noch einigen lesewilligen anderen einigermaßen verständlich bleibt. – Gedichte im Kontext. Deutsche Gedichte im Kontext vieler Sprachen, aus denen sich mein Poesieverständnis speist. Ich sage obersorbisch. Ich sage tschechisch. Ich sage rumänisch. Ebenso russisch. Wohl wissend, welche Spannweite zwischen Puschkin-Russisch und Prawda-Russisch beschlossen liegt. Für das Deutsche wäre sehr leicht ein entsprechender Vergleich ebensoleicht anzuzeigen, ich sage nicht zuletzt französisch. Dies alles nur beispielsweise herangezogen, gar nicht als Wertungsskala gedacht. Und just in diese mich selbst vergewissernden Überlegungen hinein fällt ein scheußliches Bürokratenwort. Muß ich es nun auch noch in den Mund nehmen, um es weiterzutragen? Derlei unüberlegte Prägungen, die etwas Verwaschenes meinen und demzufolge auch nicht prägnant zu benennen sind, verraten sich. Wer so unscharf formuliert, beweist, daß es mit seinem Kulturverständnis nicht weit her sein kann, Sprachkultur eingeschlossen. Vielleicht ist Kultur am Ende nur ein Ersatzwort, das zum Suffix tendiert. Als käme es auf Worte nicht an! Ich weiß von Schriftstellern, von Literaturkennern, die in Deutschland leben und in deutscher Sprache schreiben, die teils aus Marokko stammen wie Abdellatif Belfellah, teils aus England wie Kevin Perryman oder aus der Türkei wie Sövgi Özdamar, Zehra Çirak. Um nur einige wenige stellvertretend zu nennen, deren Beitrag zur deutschen Kultur ich besonders schätze. Von ihrer Sprachkultur, ihrem Verhältnis zur deutschen Sprache könnte sich so mancher ausdrucksschwache deutsche Politiker eine dicke Scheibe abschneiden. So wie die deutsche Literatur immer wieder gerade von den Sprachrändern und -inseln bereichernd aufgefrischt wurde, gilt dies in jüngster Zeit zunehmend auch von kreativen Köpfen anderer nationaler Herkunft, die unter uns leben, wenn auch noch nicht immer und überall als unseresgleichen erkannt und angenommen. Und im übrigen ist das Deutsch meiner Freunde, Kolleginnen, Kollegen ungleich niveauvoller als jener, die sich intolerant abgrenzen zu müssen meinen gegen alle und alles, was nicht ihrem vorgestrigen Primitivismus entspricht. Ganz zu schweigen von jenen zu Bürgern herangereiften Schlagetots, die in militanter Intoleranz ausschließlich auf Schlagkraft setzen und meinen, die wahren, die besseren Deutschen zu sein. Es geht überhaupt nicht um eine Konstruktion annähernder Gleichsetzung. Vielmehr sehe ich da eine fatale Kettenreaktion, die sich aus Versäumnissen, aus Defiziten gebildet hat. Unter anderem hat aber auch dazu beigetragen, daß wir fast alle um Vokabeln wie Heimat, Nation, national einen Bogen machen und mit den mißbrauchten, mit barbarisch-inhumanem Inhalt gefüllten Begriffen auch die Sache, die sich nicht erledigt hat, aus den Augen verlieren, was letztlich in Tabuisierungen mündet.
Heikle Problemfelder, die ein äußerst sensibles Differenzierungsvermögen erfordern, Fingerspitzengefühl bis in die Wortwahl hinein. Und Problemfelder, die von der demokratischen Mitte nicht besetzt werden, fallen allzuleicht den Rändern anheim, auch jenen Extremisten, die sich außerhalb jener Ränder bewegen und für sich einzunehmen suchen. In den letzten Tagen las ich, daß es in der PDS Streit gibt um die Verwendung der Begriffe Nation und Patriotismus, die es positiv zu besetzen gelte. Da wird sogleich gekontert, das sei Deutschtümelei, hebe auf deutsche Gesinnung oder Nationalismus ab. An einer solchen Debatte wird deutlich ablesbar, wohin flaches Schwarz-Weiß-Denken führt, wie schwer es den Deutschen immer noch, immer wieder und nun erst recht wird, zu differenzieren. Der Einfachheit halber wird national und nationalistisch in einen Topf geworfen. Eben weil die nationale Frage im öffentlichen Diskurs weithin ausgeblendet blieb. Jetzt plötzlich merkt man, das da noch etwas zu klären ist. Als ich 1999 in Bergen-Enkheim eingeführt wurde, kam ich auf meinen Vorredner zu sprechen. In den Weimarer Reden über Deutschland hatte Heiner Geißler am 2.4.1995 eine für Genre und Thema beispielhafte Rede gehalten, die ich bis auf eine Kleinigkeit annehmen und auf mich beziehen kann. Er sagte vor fünf Jahren:
[…] deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir über Deutschland reden. Das Nationale ist gut und schön. Es erlaubt uns eine Rückbesinnung auf das Land, aus dem wir kommen, auf unsere Heimat, die man am besten kennt, wo man am längsten gelebt hat, die Kultur, die Landschaften, unsere Dome, unsere Münster, unsere Berge, unsere Seen, unsere Flüsse, das Geistige, das Geistliche, die Sprache, das Menschliche. Aber das Nationale ist kein Grundwert. Grundwerte, das sind eben die Freiheit, die Gleichheit, die Brüderlichkeit. National waren die Kommunisten, national waren die Nazis. Das Nationale kann man mißbrauchen.
Letzteres vor allem dann, wenn man daraus ein Vakuum entstehen läßt. Ich weiß nicht, ob das Nationale ein Grundwert sein müßte. Zu fragen wäre, wem denn. Wenn sich einer als Kosmopolit fühlt, dazu auch so lebt, kann er vielleicht auf Werte dieser Art verzichten. Nur gibt es weit mehr Leute, die einer nationalen Bindung bedürfen, ohne extremistische Gelüste zu verspüren. Ganz gleich, wie erhaben ein Intellektueller darübersteht und dies für sich und möglicherweise auch für andere als vorgestrig ablehnt. Das Problem ist so nicht aus der Welt zu schaffen. Und: es sind zu viele, als daß es sich der Staat, die Gesellschaft, die wir bilden helfen, leisten könnte, in diesem Denken nicht mitzuziehen, sie im Stich zu lassen. Jeder Abfall von der Mitte schwächt die Demokratie, von der ich nicht so genau weiß, ob sie wirklich so stark ist, wie sie deren Repräsentanten wähnen. Ein Aphoristiker, ganz gewiß kein Deutscher, hat sich zu der Sottise hinreißen lassen:
Die Deutschen haben viel aus der Geschichte gelernt, nur nicht aus ihrer eigenen.
Kurz und schmerzlich, ich fühle mich als Deutscher, aber in Deutschland nicht immer wohl in meiner Haut, dennoch zugehörig. Also ist es mir nicht gleichgültig, wenn Politiker von einer deutschen Leithammelkultur schwärmen. Diese müßte dann wohl auch folgerichtig von einer Leitstelle aus kanonisiert und dirigiert werden. Ähnlich einer als Rechtschreibreform ausgegebenen und ministeriell abgesegneten Anordnung. Zuvor wünschte ich mir eine öffentliche Veranstaltung, in der sich politische Leitfiguren zur deutschen Kultur befragen ließen. Ein frommer Wunsch. Eine in die Welt gesetzte diffuse Vokabel von aufreizender Dürftigkeit offenbart ein riesiges Bewußtseinsdefizit.
Noch ruht die Demokratie, auf die auch ich im Herbst 1989 so hoffnungserfüllt zusteuerte, auf starken Säulen, wie ich mir immer wieder einzureden suche und versichern lasse. Unangreifbar allerdings ist sie nicht. Zu diesen Säulen zählen für mich vornehmlich die großen Parteien, die sich so ähnlich sind und doch so viel Kraft verpulvern, um sich gegenseitig zu diffamieren. Es gilt, allen deutschen Zerredungskünsten zum Trotz, diese Säulen nicht zu Bruch gehen zu lassen wie 1933. Es wäre schon gewonnen, wenn die marschierenden Horden, die ihre Haßorgien unter Polizeischutz herausschreien, von den Straßen verbannt würden – mittels der Gesetze, die es dafür bereits gibt.
Und nun darf gefragt werden, was hat das alles, was mich als Bürger bewegt, bedrängt, bedrückt, mit Marie Luise Kaschnitz zu tun. Ich habe in diesem Jahr Bücher, Texte von Marie Luise Kaschnitz gelesen, auch einiges über sie, teils zur Auffrischung und Vertiefung meines Bildes von ihr, teils erstmals wie die Tagebücher. Ich war dabei darauf aus, die Beziehung, die ich zu ihr im Laufe von Jahrzehnten peu à peu gewonnen hatte, zu überdenken und möglichst schärfer zu fassen, zu konzentrieren, auf das mir Gemäße, Wesentliche. Worin kann sie mir und vielleicht auch anderen Vorbild bleiben, wie wirkt sie anregend weiter. Wann immer sie charakterisiert wurde, tauchen vornehmlich ethisch-moralische Begriffe auf. Das muß ich nicht bestätigend wiederholen. Ich setze voraus, was feststeht, daß sie eine Persönlichkeit von auffällig seltener Integrität war, daß sich in ihrem Werk, das um eine humane Mitte kreist, Tradition und Moderne mischen. Beide bilden Pole, durchdringen sich, ergeben Spannung auf einer beträchtlichen Schwingungsamplitude.
Ethos, moralisch fundierte Prinzipien, ein Werk, das in seinen Grundzügen, Grundfesten um eine humane Mitte zentriert ist, gebunden an Worternst, das heißt, die Worte meinen das, was gesagt wird, ohne daraus eine puristische Doktrin abzuleiten. Anspielung, die auf Bildung, auf Lebensfülle basiert, und kunstvolles Spiel werden dabei nicht ausgeschlossen. Von diesen Positionen her engagiert sie sich in ihren Gedichten und Aufzeichnungen, die im Spätwerk dominieren. In ihrer Bekenntnishaftigkeit, in ihrem Engagement gegen die Gleichgültigkeit, gegen die destruktiven Kräfte, gegen die Gefahren globaler Lebensvernichtung, also Selbstzerstörung, gibt sie ein Beispiel, das für mich durchaus gültig geblieben ist. Was mich unmittelbar angeht: Wie sie es geschafft hat, sich Stufe um Stufe zu entwickeln und dabei literarisch immer freier und kühner zu werden. Der lange Prozeß des Freiwerdens und Sich-Freischreibens. Am eindrucksvollsten spiegelt sich dieser lange Weg, „die große Arbeit am Selbst“, die in Königsberg begann, in den Tagebüchern. Auch trotz der ausgesparten Jahre bilden sie eine erstaunlich frische Biographie. Gerade in der spontanen Tagesnotiz, die literarisches Rohmaterial bildet, zeigt sich, wie offen und vorurteilsfrei sie nach allen Seiten hin Welt aufnahm, wie breit das Spektrum ihrer Interessen und Wahrnehmungen war. Neben Begegnungen mit Prominenten, die einen relativ kleinen Kreis bilden, sind ihr die Schicksale kleiner, unberühmter Zeitgenossen, der eher Unauffälligen und Stillen im Lande, der Unterprivilegierten mindestens ebenso wichtig. Jede Notiz ein Mosaikstein. Die Mischung der Notate nennt sie „Durcheinandertagebuch“. Nach der Lektüre, das Ganze überblickend, gewinnt man den Eindruck, ein Gemälde vor sich zu haben, zu dem der Betrachter eine gewisse Distanz einlegen muß, ebenjene, von der aus man am deutlichsten sieht. Auffallend sind kurze geformte Prosastücke, als Skizzen zu Erzählungen angelegt, die im Anekdotenstil anheben und diesem Genre vollauf gerecht werden. Das Vorbild Johann Peter Hebel ist in solchen Texten nicht zu verkennen. Schade, daß Marie Luise Kaschnitz sich dieser spartanisch knappen, pointierten Erzählform nur nebenher bedient hat und wohl nie in der Absicht, das Aufzeichnen von Anekdoten zu kultivieren. Auch daß und wie sie das „Ungewöhnliche im Alltäglichen“ erkennt und fixiert, unterstreicht die Vorliebe für das Anekdotische, ob nun bedacht oder unbedacht. Eher doch wohl ersteres.
Wie oft habe ich gelesen, Marie Luise Kaschnitz sei erst nach 1945 zu einer Schriftstellerin von literarischer Relevanz geworden. Was die Publikationen und damit die Wirkungsmöglichkeiten anbelangt, trifft dies zu. Aber als ersten Bruch, als ersten entscheidenden Schritt dahin sehe ich die Courbet-Biographie. In Tage, Tage, Jahre schreibt sie:
Die Courbet-Biographie bildete einen Wendepunkt in meiner künstlerischen und menschlichen Entwicklung.
Die Ausstellung, die sie 1939, kurz vor Kriegsausbruch in Paris gesehen hatte, gab ihr den Schreibimpuls. Die Biographie, die sie 1942/43 ausführte, die jedoch erst 1950 erscheinen konnte, gilt mir neben der Prosadichtung Beschreibung eines Dorfes als eines ihrer bedeutendsten Bücher, bezogen auf Denk- und Schreibstil. Auch wenn Courbet, das Malergenie, ohne den die Moderne nicht zu denken ist, in vielen Charakterzügen, in seiner Protzerei und Eitelkeit, der, wo es nur irgend anging und die Ruhmkurve in die Höhe zu treiben vorsprach, als Skandaleur von sich reden machte, im Grunde das getreue Gegenbild zu ihr war, wurde die Beschäftigung mit seinem Leben und Werk zu einer Befreiung aus einer konventionsverhafteten Zurückhaltung, der so etwas wie Fatalismus und Schicksalsergebenheit nicht wesensfremd waren. An diesem Wendepunkt, vielleicht dem gründlichsten, entscheidendsten ihrer gesamten literarischen Entwicklung, die so manche Zäsur ausweist, ging sie mit sich selbst ins Gericht, erprobte Grenzerweiterung, Selbstbefreiung hieß fortan, sich aus den Ängsten, Zwängen herauszuschreiben. Dem Stilwechsel mußte ein Haltungswechsel vorausgehen. Also Courbet als einer der großen Lehrer. In diesem Sinne, auf diese Richtung hin erwähnt sie nicht von ungefähr den Spracherneuerer Walt Whitman oder die Droste als Dichterin der Mergelgrube. Wie schade, daß aus ihrer Beschäftigung mit Goya nicht auch eine Biographie hervorging und es bei dem einen, an entlegener Stelle gedruckten Aufsatz blieb: „Gedanken zur Gestaltenwelt Goyas“ (Aussaat, 1946). Schrieb Marie Luise Kaschnitz, die sich sehr wohl von Benn wie Brecht wie Lehmann anregen ließ, selbst jedoch mit Theorien und programmatischen Äußerungen zurückhielt, in der Biographie nicht auch weitsichtig zielgerichtet über sich:
Sein Ziel war die ,große Malerei‘, mit ihr wollte er der Welt den Kampf ansagen und sie bezwingen. Schon war er, auf dem Wege über das eigene Ich, dahin gelangt, in der Wiedergabe der wirklichen Dinge seine eigenste Aufgabe zu sehen. Aber fast ein Jahrzehnt verging, ehe er die nächste Stufe erklomm.
Gedichte, die sie in der Folgezeit, also ab 1944, schrieb, sind härter und dunkler, zeugen von neuen Einsichten und von einem anderen Schreibwillen, auch wenn sie vorerst noch nicht aus dem tradierten Formbewußtsein ausschert. In 1944 entstandenen Gedichten wie „Der Schritt um Mitternacht“, „Nichts und alles“, „Wie nie – wie immer“ setzt sie sehr direkt ihre existentiellen Erfahrungen um. Die Verheerungen des Krieges, die Zerstörung der Städte werden thematisiert. Das Ende der Naziherrschaft ist greifbar nahegerückt und zur unabweisbaren Gewißheit geworden. Angesichts der unmittelbaren Bedrückungen, durchlittener Gefahren, Entbehrungen, die keine Nische mehr bieten, wendet sie sich von bisherigen poetischen Wertvorstellungen ab, die auf künstlerischen Purismus, auf eine „reine Kunst“ hinauslaufen. Die Grenzerfahrungen, die sie erlebt, erleidet, versucht sie fortan literarisch zu gestalten. Davon sollte sie nicht mehr abgehen. Auch als die kurze Phase der Trümmerdichtung vorüber war, zu der eine Vielzahl von Dichtern beigesteuert haben. Wohl aber kein anderer so intensiv und nachhaltig wie Marie Luise Kaschnitz mit ihren drei Gedichtzyklen „Große Wanderschaft“, „Rückkehr nach Frankfurt“ und „Beschwörung“. Zusammengefaßt in dem 1947 erschienenen Band Totentanz und Gedichte zur Zeit, der sie berühmt machte.
In der kurzen Nachbemerkung zu dem Auswahlband Gedichte (1975) schreibt Peter Huchel:
Mitte der fünfziger Jahre findet ein radikaler Stilwechsel statt, der Wuchs der Verse wird härter, ohne dabei die Transparenz zu verlieren, keine wuchernde Metaphorik mehr, die Verknappung der Sprache ist das poetische Element. Gerade durch das Aussparen von Metaphern und Wörtern, durch das Weglassen halber Sätze gewinnt sie die Sicherheit und Kühnheit des sprachlichen Ausdrucks. Das Weltwissen, das Visionäre, in wenigen Zeilen zusammengedrängt […].
Marie Luise Kaschnitz setzte, wie sie es selbst formulierte, in ihren Gedichten der letzten Jahrzehnte auf eine „härtere innere Wahrheit“. Dieser Haltung entspricht auch die poetische Umsetzung. Ihr Freund Dolf Sternberger hörte aus diesen Gedichten „trotzige Klanglosigkeit“. In meinen Ohren, geschult an Sprechtonlyrik, am gestischen Sprechen, haben auch Wortfügungen der rauheren Sorte ihre Melodie, ihren Klang. Man muß ihn nur hören wollen als die ureigene Stimme, auf die hin der lange Selbstfindungsprozeß gelaufen ist. Lakonismus, Rigidität im Verknappen der Sprache wie gegen sich selbst, gipfelnd in dem Zuruf „Halte nicht ein bei der Schmerzgrenze“, die Kunst des harten Verschneidens tragen zur poetischen Verdichtung bei. Am charakteristischsten für diesen Spätstil ist das Anreißen. „Aber wer bin ich, daß –“. Wie man auf diese Weise Schweres lichtet und leicht werden läßt, ist bei Marie Luise Kaschnitz sehr wohl zu lernen. In dem Aufsatz „Schwierigkeiten, heute die Wahrheit zu schreiben“ bekennt sie:
Künstlerische Wahrheit ist Treue zu sich selbst und zu seiner Zeit, in diesem Sinne gibt es eine künstlerische Wahrheit auch in der Lyrik – auch noch im irrationalsten Gedicht muß man die historischen und soziologischen Erfahrungen abhören können, durch die sein Verfasser hindurchgegangen ist. […] Nur die Aufrichtigkeit trifft ins Schwarze, vielleicht sogar nur die Aufrichtigkeit einer bestimmten Lebensepoche, eines Augenblicks, in dem die Ausdrucksfähigkeit des Schriftstellers mit der Aufnahmefähigkeit des Lesers in geheimnisvoller Weise übereinstimmt. […] Daß die objektiven Werte sich im Lauf dieses Jahrhunderts so sehr verändert haben, glaube ich nicht. Zuneigung ist noch immer Zuneigung, Überwindung noch immer Überwindung, Standhaftigkeit noch immer Standhaftigkeit, Verrat noch immer Verrat.
Was sie da in einigen wenigen konzisen Sätzen bekennt, steht wie ein Credo. Das nehme ich an. Gut zu wissen, gut von ihr bestätigend zu erfahren, so wie es das Gedicht nicht gibt, kann es auch die Wahrheit an sich nicht geben, der Schriftsteller kann nur seine persönliche Wahrheit als Beitrag einbringen.
Wie schon bei früheren Gelegenheiten erwähne ich Wolfgang Weyrauchs Anthologie Die Pflugschar, erschienen 1947 im Aufbau-Verlag Berlin, leider bis heute nie nachgedruckt, als eines meiner Erweckungsbücher. In dieser „Sammlung neuer deutscher Dichtung“, die mir allerdings erst 1952 in die Hände fiel, ist Marie Luise Kaschnitz mit dem Gedicht „Große Wanderschaft“ vertreten, bereits im Jahr zuvor in der Gegenwart erstveröffentlicht. Seither ist mir ihr Name vertraut. Darauf baut sich alles, was ich späterhin von ihr las. Von einem Urlaub, der mich im Sommer 1956 bis nach Meersburg führte, brachte ich ein soeben erschienenes Fischer-Taschenbuch mit: Flügel der Zeit. Deutsche Gedichte 1900–1950, herausgegeben von Curt Hohoff. Dieses schmale Kompendium wurde regelrecht aufgesaugt, Gedicht für Gedicht, und es lehrte Gedichte zu lesen. Vor allem aber weckte es den starken Wunsch, von den in der Anthologie versammelten Lyrikern mehr kennenlernen zu wollen. Erst jüngst, als ich in Band 5 der Ausgabe nachsah, merkte ich zu meiner Verwunderung, das von Curt Hohoff gewählte Gedicht „Vater Feuerwerker“, ein Jahr zuvor im Jahresring erstgedruckt, nahm Marie Luise Kaschnitz in keine ihrer Gedichtsammlungen auf. Ausgerechnet dieses Gedicht, das mich damals gleich so vehement für sie eingenommen hatte! Ich hab so vieles außer Acht gelassen, was mich Verbindungslinien ziehen ließe. Kein Wort über die Kunst der Aufzeichnung, über das Zurückrufen von Orten bis hin zu der Beschreibung eines Dorfes, eben des ihren, das sie scheinbar, als gelte es zu inventarisieren, aufruft, und doch zu einem dichterischen Text werden läßt, der mich, der auch ein Dorf in sich trägt, wie kein anderes ihrer Prosastücke fasziniert hat.
Da ich aus Weimar komme, hätte ich natürlich auch ein Wort über die Weimarer Lehrlingsjahre beim Buchhändler Bruno Wollbrück und Prokuristen Max Wehner verlieren müssen, über ihren Arbeitsweg vom Horn 39 durch den Park, am Euphrosynestein und am Haus der Charlotte von Stein vorüber bis zur Buchhandlung in der Schillerstraße. Auch über die Freundschaft mit dem Maler Alfred Partikel, über den jüngst auch Christine Wolter in ihrem autobiographischen Roman Die Zimmer der Erinnerung (1996) berichtet hat und dem 2001 eine Ausstellung in Nürnberg gewidmet sein wird, hätte ich eingehen müssen. Ich belasse es bei diesen Abbreviaturen. Ich kann mich an so viele Gedichte und Texte der „ewigen Biographin“ halten. Das eine und andere habe ich für meine Arbeit daraus abgezogen und in meine Sprache übersetzt. Sie bestärkt mich in der Erfahrung, daß sich das scheinbar so Nebensächliche einer Biographie am Ende als das Eigentliche, als das Lebensbestimmende erweist, dank eines sehenden Gedächtnisses. Wie im Alter die Leuchtkraft des inneren Auges zunimmt. Was sie uns hinterlassen hat an bewahrtem Leben, wie sie sich selbst bewährt hat, würde ich mit meiner Rede gern weitergereicht haben. Ich nenne es ganz einfach „humane Mitte“. Ich habe versucht, mich in deutscher Sprache verständlich zu machen. Und diese meine Sprache möchte Ausdruck eines Kulturverständnisses sein, das von tausend Jahren Geschichte weiß. Aber das Wissen um das Eigene steht im Kontext zum Weltwissen, wie es Huchel für die Kaschnitz treffsicher formulierte. Ich setze hinzu, wo Weltwissen lebensbestimmend geworden ist, muß Weltgewissen die ethisch-moralische Grundlage bilden.
Wulf Kirsten, Deutsche Bücher, Heft 1, 2001
Die Frießnitzer Teiche. In memoriam Wulf Kirsten
Seitab, wo Wagners Geflügel schön Wasserski fährt
beim Landen, belauert von Tiervater und Vogelpastor,
legte dann Wulf als Austauschgroßmeister die Strecken,
ja ganze Suiten an Versen und andern Texturen.
Nahbei selbst entlegenste Heimatkundler erspäht,
Weimars Wendeltreppenschnitzer dingfest gemacht
da droben im Schömberger Forst und innegewohnt
der Zaubernuß an der Auma: der Freund nennt sie Rohna.
Dazu tausend Teiche ringsum zu des randgängers Schätzen:
Unzählbar das Rare im Blick, geschenkt stets die Rechnung,
Zuhandenes, oft auch vergebens, vergeben im Vers.
Und ohne den Landmann wogte die Schaumparty Weida.
Die Teiche! Wie fuhren wir weit da und setzten in Frießnitz
schon deshalb kein Schißchen auf Sieg beim Kuhfladenschach.
Auf meine Weise „seitab“ bin auch ich ein Randgänger wie Wulf Kirsten. In ein engeres persönliches Verhältnis kamen Wulf und ich 1988 als Teilnehmer am sogenannten Sonderkurs des Literaturinstituts in Leipzig, den unter anderen auch Harald Gerlach und Kurt Drawert belegt hatten. In den Seminaren und Veranstaltungen dieses Kurses wetterleuchtete schon aus der Ferne die Wendezeit. Wir debattierten damals mit besten Leuten ihres Fachs über Chaostheorie, Psychologie und Jugendforschung und Kunstgeschichte der Moderne, und vor allem hingen wir Ralf Schröder, dem Übersetzer aus dem Russischen, an den Lippen, der jeden Monat das Neueste aus dem Moskauer Perestroika-Nähkästchen auszuplaudern hatte. Seit dieser Zeit sahen Wulf und ich uns auch andernorts, meist in Weimar, und begann auch unser Briefwechsel. Sind wir seither gut befreundet gewesen? Ich denke schon. Wulf beendete seine meist handschriftlichen Briefe etwa so: „In herzlicher Freundschaft grüßt Dich Dein Wulf“ oder „Sey gegrüßt mittels herzlicher Umärmelung, Dein Wulf“ – das „y“ darin mochte ein Siegelzeichen dafür sein, daß er auch mich einschloß in einen Club der scheinbar aus der Zeit Gefallenen.
Von 1994 bis 2009 wohnte ich quasi in einem Lied von Franz Schubert, ich hatte da nämlich ein Schreibrefugium im ostthüringischen 60-Seelen-Dörfchen Rohna, und so manchen Brief an Wulf warf ich in den Briefkasten neben dem Spritzenhäuschen gleich gegenüber hinter der alten Steinbrücke über die Auma, oder die Postfrau reichte mir auch schon mal einen Brief von Wulf durchs Fenster. Es blieb dann freilich nicht aus, daß auch Wulf selber nach Rohna kam und wir uns ein paar Tage in Rohna selbst und in der Umgegend umtaten und wanderten, etwa in den sogenannten Talerdörfern – da vor allem im Renthendorf des Vogelpastors Brehm und seines Sohnes, des Tiervaters Alfred Brehm –, oder die stark mäandernde Auma entlang bis nach Weida, oder im Schömberger Forst, um dort vor allem den Mufflons zu begegnen, und dann auch quasi übern Berg am herzergreifend gedrungenen Rohnaer Kirchlein vorbei durch die Felder hin zu den Frießnitzer Teichen im Flußgebiet der Struth, der Ort, wo die Brehms die meisten ihrer Vögel erlegten für den nationalen und internationalen Austausch. Ausgangspunkt blieb dabei das so idyllische Rohna. Wulf schrieb mir dorthin am 5. Mai:
Neulich traf ich eine Frau aus Rohna. Sie … arbeitet in Weimar, fährt Tag für Tag mit dem Auto bis Gera, dann mit dem Zug. Hin und zurück! Erstaunlich. Da konnte ich mich ohne zu mogeln als ortskundiger Thebaner ausgeben.
„Seitab weltentlegen in einem Winkel“, wie Wulf mir viel später noch, am 2. Dezember 2002, über Rohna geschrieben hat. Was für intensive Gänge und Gespräche waren da doch gerade dort gewesen! Noch in einem Brief vom 17. August 2003 schrieb mir Wulf:
Als dieser Tage Niederpöllnitz in die Schlagzeilen geriet, sah ich mich dort ankommen und uns gen Rohna rollen.
Als er damals dort ankam und erste Blicke aus den Fenstern der Hauptstube des fränkischen Vierkanthofes geworfen hatte, entdeckte er unter den Bäumen am Rand der Auma einen, den ich bis dato noch gar nicht identifiziert hatte: eine Zaubernuß! Bleiben wir bei Bäumen: die osterländische Geschichte vom Mörder aus Weida, der Drechsler war und aus Sühne eine mächtige Eiche aus dem Schömberger Forst in jene Wendeltreppe verwandelt hatte, die noch heute die Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar ziert, habe ich so ausführlich und mehr faktenbasiert als legendenumwoben von Wulf in Rohna gehört.
Am erstaunlichsten für mich war dann unsere Begegnung mit einem Kellner der Aumühle bei Weida, wo wir ein Wanderbierchen zischten. Dieser zeigte sich überaus versiert in osterländischer, speziell der Heimatkunde der „Wiege des Vogtlands“, nämlich von Weida.
Und nun geschah das Wunder, zumindest das überaus Verwunderliche, aber für Wulf-Kirsten-Kenner auch das ganz Alltägliche zugleich: Inzwischen saß der Kellner meist an unserem Tisch und trank auch ein Bier mit, und vor allem redete er mit, aber anscheinend wirklich nur mit, denn der vielleicht Kenntnisreichere auch auf diesem Spezialgebiet und von dessen heimatkundlichen Sachwaltern und Herzbluterfüllern war Wulf, wenn er es auch hinter ihm größtmöglicher Höflichkeit und Mitfreude zu verbergen wußte. Und dabei dachte ich, der ich mich ja schon eine Weile unter den Leitermachern, Huckelkuchenbäckern und Süßfischköppen aufgehalten hatte, daß meine von mir durchaus fleißig gelesene Rohnaer Heimatliteraturbibliothek mich befähigt hätte, mit den Beiden mitzureden – am Ende des Gesprächs wenigstens mitzuseufzen über die Vergänglichkeiten auch des herrlichst krähwinkeligen Daseins oder doch dann wenigstens ein bißchen mitzuschimpfen auf die landschafts- und heimatvernichtenden Dummheiten gemäß Arno Schmidt:
Alle irgendwie Herrschenden oder Befehlenden sind Schufte!
Wulf schrieb mir, unter anderem aus Ärger über bestimmte Weimarer Ereignisse, am 28. April 2003 nach Rohna:
Tagesbefehl: Gegen 100 Fuder Mist anstinken. Sich nix vormachen (lassen.)
Aber wo gab es überhaupt noch Mist in Rohna? Mein Freund und Herbergsvater Dietmar war ja derjenige, der überhaupt noch ein paar Tiere, nämlich Schafe und Gänse, hielt in diesem Dorf, in dem es noch einen einzigen Bauern gab, sonst eher Germanisten, Bauingenieure und Jugendrichter. Dietmar war übrigens einmal der Bürgermeister des Örtleins gewesen, das an einem Naturschutzgebiet auf Grund von Flußmuscheln liegt, und hatte auch Wulf dadurch diebisch erfreut, daß er Jahre zuvor beim Landesdenkmalamt einen Schutztitel erwarb, indem er für Rohna die Siedlungsform eines „Bachzeilendorfes“ erfunden hatte, weil hier die Hauptstraße über die Doppelbrücke das Dorf quere und es nicht längs begleiten würde wie üblich. In Erfurt stellte man daraufhin fest, daß Rohna nicht nur tatsächlich ein Bachzeilendorf sei, sondern sogar das einzige Bachzeilendorf ganz Thüringens! Bei so etwas konnte Wulf bekanntlich das Herz ganz aufgehen.
Im Spätsommer vor Wulfs Tod saßen der Denkmalpfleger und Dichter Jörg Kowalski, ein immer heiterer werdender Wulf und ich wieder einmal in Weimar im Resi, gingen im Geist durch die Stadt und auf den „Berg über der Stadt“, auch gemeinsam durch Klipphausen und Dresden – und auch noch einmal durch Rohna, hinter Rohna, die Auma entlang an die Aumatalsperre. Dort stehen Schilder mit den Abbildungen einheimischer Fischarten, und dort hatte mir Wulf seine merkwürdige Geschichte aus Hamburg erzählt, die Kowalski noch gar nicht kannte. Wulf hatte in Hamburg eine Lesung gehabt, zu der auch der Oberförster der Stadt erschienen war. Beim Publikumsgespräch dann sagte der Förster:
Herr Kirsten! Ich hab mal alle ihre Bücher durchgeblättert. Da kommen ja gar keine Fische drin vor!
Wir lachten noch einmal selbdritt. Mit Durchblättern ist es halt bei Wulf Kirsten nicht getan.
Eher fängt nun eine Zeit an, wo wir uns noch viel ausführlicher als bisher in seinen Büchern und Schriften aufhalten sollten, und das schon deshalb, weil Wulf Kirsten auch ein so großer Meister des Miteinanders ist. Soll noch Zukunft stattfinden, werden Leute seiner Art dringend gebraucht.
Wilhelm Bartsch, aus Unterwegs mit Wulf Kirsten. Eine Freundesgabe, herausgegeben von Wolfgang Haak, Michael Knoche und Christoph Schmitz-Scholemann, Elsinor Verlag, 2023
WULF KIRSTEN
dem Wortgebälk verschrieben
alphabetisiere ich das gramattikale
Dorf in der Poetenebene wolf
kahl gestocherne Vokale durchziehn
das Tal, in dem mein Schriftzug rattert
Bis zum wiedererwecken das versagte
junge Mädchen vom Gedanken-
Strich gezeichet von der der
symikoholischen Welt
Aufgepirscht
Peter Wawerzinek
In der Reihe Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts präsentierten Autoren ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialsammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Bernd Jentzsch, Wulf Kirsten und Karl Mickel fand 1993 in der Literaturwerkstatt Berlin statt und ist hier online zu hören.
Zum 70. Geburtstag des Autors:
Nico Bleutge: Sprachschaufel
Süddeutsche Zeitung, 21.6.2004
Michael Braun: Der poetische Chronist
Neue Zürcher Zeitung, 21.6.2004
Wolfgang Heidenreich: Gegen das schäbige Vergessen
Badische Zeitung, 21.6.2004
Tobias Lehmkuhl: Das durchaus Scheißige unserer zeitigen Herrlichkeit
Berliner Zeitung, 21.6.2004
Hans-Dieter Schütt: „herzwillige streifzüge“
Neues Deutschland, 21.6.2004
Frank Quilitzsch: Chronist einer versunkenen Welt
Lese-Zeichen e.V., 19.6.2004
Zum 75. Geburtstag des Autors:
Christian Eger: Leidenschaftlicher Leser der mitteldeutschen Landschaft
Mitteldeutsche Zeitung, 19.6.2009
Jürgen Verdofsky: Querweltein durch die Literaturgeschichte
Badische Zeitung, 20.6.2009
Norbert Weiß (Hg.): Dieter Hoffmann und Wulf Kirsten zum fünfundsiebzigsten Geburtstag
Die Scheune, 2009
Zum 80. Geburtstag des Autors:
Lothar Müller: Aus dem unberühmten Landstrich in die Welt
Süddeutsche Zeitung, 21./22.6.2014
Thorsten Büker: Der Querkopf, der die Worte liebt
Thüringer Allgemeine, 22.6.2014
Jürgen Verdofsky: Querweltein mit aufsteigender Linie
Badische Zeitung, 21.6.2014
Zum 85. Geburtstag des Autors:
Frank Quilitzsch: Herbstwärts das Leben hinab
Thüringische Landeszeitung, 21.6.2019
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG +
IMDb + Archiv + Kalliope +
Interview + Laudatio 1 + 2 + 3 + 4
Dankesrede 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 + 8
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Dirk Skiba Autorenporträts + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口 1 + 2
Nachrufe auf Wulf Kirsten: FAZ ✝︎ Tagesspiegel ✝︎
Mitteldeutsche Zeitung ✝︎ Badische Zeitung ✝︎ FR ✝︎ Blog ✝︎
Sächsische Zeitung ✝︎ SZ ✝︎ TLZ 1 & 2 ✝︎ nd ✝︎ nnz ✝︎ faustkultur ✝︎
Wulf Kirsten – Dichter im Porträt.


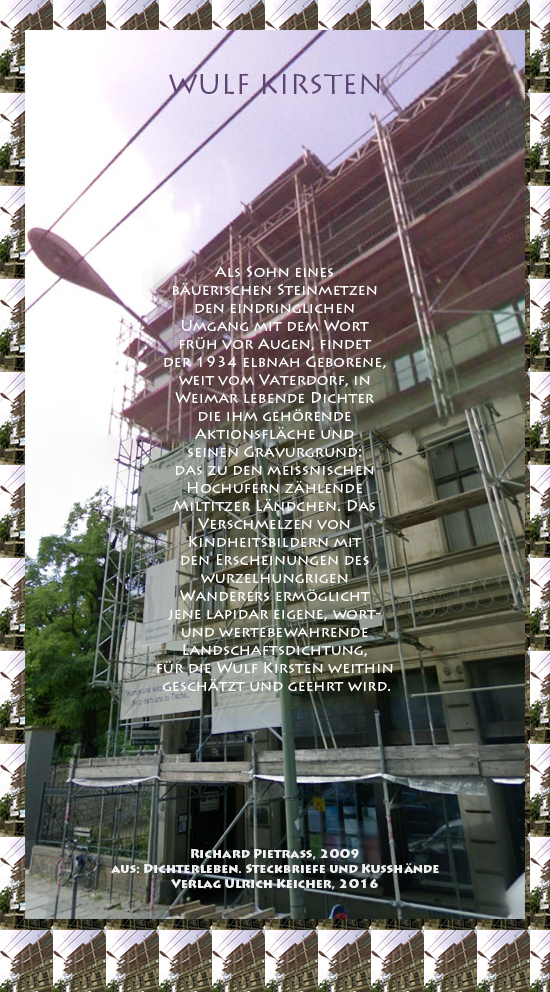












Danke für den Hinweis auf Hippel. Mir ist nicht ganz klar, wer der Autor des Beitrags ist.