Adolf Endler: Der Pudding der Apokalypse
VERKOMMENHEITS-BLUES
I
Der Dichter Sascha Anderson,
Hier vorder-, dort hintergründig,
Der Geistesfron, der Fron zum Hohn
Schlürft Schnaps selbst aus dem Mikrophon;
Man sehe es kurz oder bündig:
Sascha wird überall fündig…
Apropos:
Aber neulich wars meiner, verdammt!
Sieben Doppelte insgesamt!
2
An mehr abgelegenen Plätzen,
Ich darf ausnahmsweise mal petzen,
Saugt ihn Sasch’ gar aus Pfennigabsätzen
Der Meisjes, der Muttis, der Metzen;
Die Häufigkeit läßt sich nur schätzen…
Apropos:
Aber neulich wars mein Korn, verdammt!
Dreizehn Doppelte insgesamt!
(1982)
Erklärende Notiz
„… um Dich nicht am Telefon zu überfallen: ‚Die Expedition‘ gibt es in verschiedenen Varianten (Expedition nach XY…, in die Wüste usw.) 181mal im Verzeichnis des Buchhandels. Wäre nicht schlimm, aber auch ‚Die Expedition‘, ‚Eine Expedition‘, einfach nur ‚Expedition‘ gibt es darunter… Auf begeisterte Zustimmung stieß ein Vorschlag, den ich beim Durchgehen Deiner Gedichttitel in der Runde probierte: Der Pudding der Apokalypse…“ (Aus einem Brief des Lektors T. A.)
*
Das hätte man sich natürlich denken können, daß der zunächst intendierte Titel „Die Expedition“ – es hatt ‚mal etwas ganz Einfaches bzw. Kafkaeskes sein sollen –, daß dieses Kantige wie Schlichte bereits vielfach vergeben ist. T. A. schlägt nun also „Der Pudding der Apokalypse“ vor – ein Text aus dem Jahr 82 heißt so im Untertitel –, was mir halb gut gefallen will, was einigermaßen „endleresk“ wirkt. Vor zehn Jahren hieß einer meiner Prosabände „Vorbildlich schleimlösend“; es kann einem als folgerichtig erscheinen, wenn jetzt die Gedichte als „Pudding der Apokalypse“ serviert werden. (Hoffentlich taucht nicht demnächst ein endzeitliches Kochbuch auf – „Noch ’n paarmal lecker essen vor ’m Schluß!“ –, das den von T. A. ausgekundschafteten Titel trägt.) Der Untertitel sollte jedoch präzisere Auskunft geben und nicht nur, wie vorgeschlagen, „Gedichte“, sondern „Gedichte von 1963 bis 1998“ verheißen. Es ist aus verschiedenen Gründen wichtig, daß deutlich wir: Diese Gedichte sind seit 1963/64 entstanden, und zwar nach dem Bruch des Verfassers mit einem zu großen Teilen allzu epigonalen „Frühwerk“, das man vielleicht irgendwann / irgendwo einmal separat zusammenhäufeln mag. (Doch das gehört wirklich nicht zu meinen Haupt-Sorgen!) „Frühwerk“: das meint vor allem das 1960 erschienene Bändchen „Erwacht ohne Furcht“ – kaum vertrieben, war die Furcht, die Angst wieder an meiner Seite – sowie den zu Beginn des Jahres 1964 publizierten und etwas substantielleren Band „Die Kinder der Nibelungen“. Im Unterschied zu der in den achtziger Jahren im Leipziger Reclam-Verlag erschienenen und ein wenig korrupten Kraut-und-Rüben-Kollektion „Akte Endler“ – nun gut, ich habe es ohne Widerstand hingehen lassen! – wird „Der Pudding der Apokalypse“, sowohl reduzierte als auch komplettierte Sammlung, keinen einzigen Text aus den beiden ersten Lyrik-Publikationen aufnehmen – der Gefahr des primitiven Vorwurfs zum Trotz, der Verfasser versuche sein Beginner-Œuvre womöglich aus politischer Scham zu verstecken. (Tatsächlich habe ich in den letzten Jahren immer wieder die Genehmigung zum Abdruck solcher frühen Produkte gegeben, und selbst dann, wenn sie mich als tüchtigen Wirr- und Wahnkopf denunzieren; auf altersbedingt geläuterte Weise bin ich ja immer noch ein Wahn- und Wirrkopf gelegentlich, will es mir scheinen.) Man kann mühelos erkennen, daß es im wesentlichen ästhetische Motive sind, die mich einen Teil meiner Lyrik separieren lassen, wenn ich sie – wie in dem vorliegenden Buch – endlich einmal „repräsentativ“ vorstellen will, was mir aufgrund allerdings politischer Umstände bis heute verwehrt geblieben war. Das gilt auch für die wenigen Texte aus den siebziger Jahren, die ich kaltherzig eliminierte – man kann sie in dem Band „Akte Endler“ nachlesen! –, z.B. das vor-literarische „In dieser Stadt / Aus dem Notizbuch“, einen „Angriff auf die Volkspolizei“ bzw. den großmächtigen „Abschnittsbevollmächtigten“, ein kritisches Gedicht, das in der letzten Zeit mehrmals als besonders beweiskräftiges Beispiel für meine literarische „Widerstands“-Leistung in der DDR hervorgehoben und zitiert worden ist, in künstlerischer Hinsicht leider aber noch dürftiger daherkommt als so manches meiner knäbischen Agitprop-Gedichte…
Adolf Endler, aus dem Buch, 1999
Gleichgültig,
ob er über den Geräuschemacher schreibt oder über Bobbi Bergemann, über den Bückeburger Sonetten-Wettstreit oder den Badewannen-Wahn, die Oberlausitz oder den Prenzlauer Berg, immer hat dieser „verwegen zwischen Sub- und Hochliteratur interpolierende Dichter“ (Rühmkorf) die Welt in seinen Gedichten so in Bewegung versetzt, daß sie als „Pudding der Apokalypse“ in ihrem Chaos klare Konturen gewinnt.
Was Endler mit seinem Sprachvermögen und -witz ins Gedicht holt, ist in seiner Kombination stets überraschend und zugleich unverwechselbar Endler.
In der DDR konnte der Autor nach seinem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband kaum noch veröffentlichen, und so gelang ihm nach 1989 der Durchbruch ins Bewußtsein einer größeren Öffentlichkeit ironischerweise als Prosaautor; sein mehrfach preisgekröntes Buch Tarzan im Prenzlauer Berg gab das Stichwort, mit dem auch der Autor selbst zunehmend bezeichnet wurde.
Nun hat Endler sein gesamtes Werk gesichtet, zusammengestellt, was sich aus den letzten 35 Jahren als haltbar erwiesen hat, und zahlreiche neue Gedichte hinzugefügt. Dieses Buch zeigt Endler als einen singulären, ungemein virtuosen, mit lyrischen Formen raffiniert jonglierenden Dichter, der seine Welt und nicht zuletzt sich selbst einem zugleich amüsiert-ironischen und ernsten Blick aussetzt.
Suhrkamp Verlag, Klappentext, 1999
Lern, Bruder, zuzustechen mit der Silbe
− Über Adolf Endler. −
Im 1999 erschienenen Gedichtband Der Pudding der Apokalypse ist das dichterische Werk Adolf Endlers aus fünfunddreißig Jahren erstmals in diesem Umfang veröffentlicht. Das sich beendende Jahrhundert dreht sich hier direkt aus Eingeweide und Hirn – „das Blut entflammt im Kopf sich zum Gedicht“ – in die Schrift. Die Sprachgeschichte verrät, dass sich Europa unter dem Wort Pudding vor dem 18. Jahrhundert noch anders bekochte. Poding, puddyng bezeichnete im Mittelenglischen Wurst, Magen und Eingeweide, hergeleitet vom altfranzösischen bodin, ebenfalls Wurst, das wiederum in enger Verwandtschaft zum Wort bodine steht: Nabel oder Bauch. Erst seit 1720 tritt der Pudding als Süßspeise auf. Brummte hier nicht eben Endlers Stimme aus dem Off: „Das Herangehen an die Literatur geht von Tag zu Tag mehr auseinander, Madame“?
Die Gedichtgebilde Endlers gleichen in ihrer Skurrilität und Fabulierkunst nicht selten den zweckgelösten Erfindungen des Alphonse Allais, der für scheue Karpfen Aquarien aus Milchglas, das Ölen des Weltmeers, um die Fluten ungefährlicher zu machen, oder einen Korkenzieher, der sich dank der Kraft der Gezeiten dreht, erfinden wollte. Sie sind ebenso unwahrscheinlich wie mit Sicherheit wahr, nur wird man sie so in der Realität nicht finden können. Aber sie eröffnen einen Blick, eine bestimmte notwendige Sehweise, um in den bizarren Umleitungen des Lebens die Richtung nicht zu verlieren, den Kopf notfalls aus der Schlinge zu heben, lebensbejahend lachend, versteht sich.
Seine Art zu schreiben nennt Endler selbst eine phantasmagorische, eine „schwarzhumorige Verdrehtheit, […] Schleudertour, Gespensterbahn, nichts für schwache Nerven“. Sein sprachliches Vexierspiel mit den Zuständen, den Personen, der Zeit und selbst mit dem Tod versucht, angelehnt an einen Satz von Antonin Artaud, „das Geheimnis einer auf den Humor gründenden objektiven Poesie wiederzufinden“.
Wolfgang Hilbig schrieb vor nicht allzu langer Zeit in einer in der Frankfurter Rundschau abgedruckten Laudatio auf Adolf Endler unter dem bezeichnenden Titel „Der Wille zur Macht ist Feigheit“: „Ich habe nach deinen Büchern stets wie nach dem berühmten Strohhalm gegriffen“ und von ihnen „mich lange Zeit förmlich ernährt“. Ein schöneres Kompliment kann man einem Dichter wohl kaum machen.
Der Mensch wirkt, wie Charles Cros herb erkennt, nur als „Stenograph der brutalen Tatsachen“. Und der Dichter? Er kann immerhin dagegen aufbegehren, „Lern, Bruder, zuzustechen mit der Silbe! Lerne“, wie der „Irre Fürst“ alias Adolf Endler aus „seinen Heften“ ruft.
Symptomatisch für Endlers Schreiben liest sich wohl das Gedicht „Der Geräuschemacher“ in diesem Band, weil es das Prinzip, welches in seiner Dichtung schwingt, die innere Drehung und den Autor als unsichtbares Zentrum zeigt, das Wort als Zentrifugalkraft im Universum des Geschehens:
… ich dreh das Haus, ich fleder
Es jäh nach links und rechts (ihr spürt es, wie sichs dreht),
ich könnts zusammenklappen, freilich, das kann jeder,
Und deshalb bleibt es stehn…
Der letzte Passus deutet auf ein (nicht nur) in der damaligen DDR zentrales Thema, der vertretbare Umgang mit dem Explosivstoff Macht. Der potentielle Besitz von Macht und ihre reale Anwendung bedeuten nicht nur zweierlei, sondern beides hat auch unterschiedliche Konsequenzen zur Folge. Eine Hellsicht in dieser entscheidenden Frage besaß offenbar nur mehr noch die Sprache des Gedichts, nicht die praktizierenden Machtinhaber selbst. Sie widerstanden, in einer falschen Vorstellung vom Zustand „machtlos“, nicht der Versuchung des Machtmißbrauchs. Daß ihr gefledertes Haus zusammenklappte, konnten sie 1989 nicht mehr übersehen, aber auch nicht mehr überstehen. Die geheimnisvolle Stimme, „ich bins, ich mache die Geräusche“, die im Gedicht interveniert, die im Keller des Hauses aus den alten Leitungen, mürben Kellerwänden und der Gasuhr aufsteigt, ist eigentlich das Alter ego Endlers, es ist sein Votum, das aus dem Dunkel tönt.
Die immer wieder auftauchenden sprechenden Häuser haben übrigens viel damit zu tun, daß Endler jahrelang in den Gründerzeit-Mietskasernen des Ostberliner Stadtbezirks Prenzlauer Berg hauste, kaputte, marode Gebäude, zumeist nur mit Außentoiletten, die seit ihrer Entstehung oft keine Fürsorge mehr erhielten, die aber prallvoll waren und noch sind von den sichtbaren Spuren und Geschichten ihrer Bewohner.
Ob das Weib aus Parterre, die Kellnerin Coca aus dem Feuchten Eck, Elvira, Herr und Frau Betz, die Briefträgerin „mit ihrem unbelehrbaren Gärtnerinnengeruch ein Satansbraten ein Prachtweib“ Hildchen aus Hildegards Bierbar, Helene Knoll, ein Schlachtermesser schwingend, ob sie aus der Grenadierstraße, der Alten Schönhauser, „früher die Straße der Juden“,
oder dem sogenannten LSD-Viertel kommen (ein Schelm, wer der DDR Arges zutraut, diese drei Buchstaben stehen als volksmundliche Abkürzung für drei der bekanntesten Parallelstraßen inmitten des Prenzlauer Bergs: der Lychener-, der Schliemann- und der Dunckerstraße, über längere Zeit hinweg jeweils Asyle des Poeten) − all diese grotesken Hinterhofwesen, lebenspraktischen Kiezkönige und -königinnen, Überlebenskünstler, denen der Alltag Trapeznummern ohne Zuschauer abverlangt und die nicht selten auch abgrundtief abstürzen, die sich dann wie Frau Betz mit der Axt an der falschen Stelle wehren, dem Schädel des eigenen Ehemanns nämlich, sie alle holt Endler in den „Literaturbunker“, den „Überlebensbunker mit den siebenhundert Leichen in den Gängen“.
Im Gegensatz zu Jonathan Swift, der zwar das Lachen provoziert, sich aber nicht an ihm beteiligt, hält es Endler à la Lichtenberg mit dem logischen Schelmenstreich eines „Messers ohne Klinge, dem der Griff fehlt“. Lichtenbergs Humor ist von subtilster Art, sein Gesicht läßt sich förmlich mitlesen, wenn er bedauert: „Diesen mit Kaffee geschriebenen Brief wird Ihnen der Johann übergeben. Ich hätte Blut genommen, wenn ich keinen Kaffee gehabt hätte“.
Das Nachtschwarze an Endlers Humor irisiert ebenso in der Farbe scheinheiligen Leids, erst in zweiter Lesung entpuppt es sich als gezückte Waffe, dann aber zu spät, um noch auszuweichen. Ergriffen wird in unschuldiger Mimikry, welches nichts weiter als Warntracht bedeutet, nachgeahmt; das aber „lückenlos, lückenlos, lückenlos“, wie Endler an anderer Stelle äußerte. In listigem Wechsel der Ebenen, Bezüge, Orte, Zeiten, Personen und in einer permanenten Umkehrung des gesellschaftlichen Wertekatalogs, der solche Begriffe wie Dialektik und Fleiß enthält, stellt Endler die absurden Verhältnisse zwischen Mensch und Mensch wieder mit dem Kopf auf die Füße.
Dazu bietet sich ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles formales Mittel an. Wenn man gesellschaftliche Reizworte in ihrem Gebrauch tatsächlich wortwörtlich nimmt, kehren sie sich von selbst in ihr fatales Gegenteil und benutzen die Gliedmaßen. Stupide arbeitet Endler im „Lied vom Fleiß“. Im Grunde genommen immer wieder nur einen einzigen Satz ab. In einhundert Zeilenanläufen erklärt er, daß er, der Autor, jetzt ein hundertzeiliges Fleißgedicht verfassen wird:
Vers an Vers wie Spargelbeete […] Ich bin ein Preuße und erfüll es strikt.
Er kopiert den Dauersprint des Kleinbürgers und seine unsägliche Redlichkeit, und zieht so ein Leerlaufgedicht, eine Nullspur des Fleißes am Auge des Lesers vorbei wie eine monotone grüne Oszillographenlinie, die keinen Herzschlag mehr anzeigt. Am Ende ist Zeile Einhundert nur noch imstande auszurufen:
Gebt mir den Strick da, doch gut eingeseift!
Und prompt ergänzt die innere Stimme des Lesers:
… doch fleißig eingeseift!
Der Dichter spricht aus dem verhängnisvollen Schwung dieser Monotonie heraus selbst in seiner Abwesenheit weiter.
Jeder Text ist eine Widerspiegelung der Zustände, die dem Autor das Material zum Schreiben bieten. Endler fertigte daraus ganze Bücherserien, „eine böse und wüste Verjuxung der DDR, welche die Stasi-Offiziere nachweislich ratlos hat stehen lassen, ratlos und wütend zugleich“. André Breton würde ergänzen: „Rimbaud besteht darauf“, und der Name Rimbaud ist austauschbar, „sich mit seinen eigenen Mitteln zu verteidigen, wozu ihm die geistige und seelische Not der Menschen, die ihn umgeben, die Waffen liefert“.
Zu den berührendsten, stillen, nach innen ziehenden Gedichten Endlers zählen „Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann“ und „Vor dem Abbruch unseres Hauses“, zwei poetische Melancholien, ausgelöst durch die unmittelbare Erfahrung von Vergehen, Tod und Zerfall. „Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann“ ist die Beobachtung eines parallelen Abschiednehmens. Das Leben seines sterbenden Freunds wird angesichts des Todes leichter noch als Schnee; der in warmer Luft zerfließende, schon schmutziggraue Schneemann überlebt den Menschen. Selbst der verzweifelte Versuch des Dichters, mit seiner Wortmacht dem Freund Zeit zu gewinnen und den Wettlauf zu seinen Gunsten zu beeinflussen, „der Schnee schmilzt in meinen Augen, eh er schmilzt“, hält die Lebensuhr, „weshalb wolltest du die Uhrzeit wissen?“, nicht mehr auf. Wozu noch der Trost von Zeit, die Suche nach einem Maß, wenn nur der Tod noch tickt?
Ich hab, als keiner da war, deine Uhr gefilzt.
Ihr Zifferblatt zerfließt. Laut ticken deine Schritte.
Im zweiten Gedicht zerfallen und verschwinden die im alltäglichen Ablauf fest eingefügten Dinge, wie ein altes Haus, das im langen Miteinanderwohnen zum Gefährten – „seine Stimm gleicht der deinen“ – wurde, und das nun aus knarrendem Dachstuhl und knisternden Trägern, papieren leicht geworden, seine letzten Worte spricht. Das flüssige Leben selbst, bald unbehütet, sein „Atem nur trägt dieses Haus“. Ein Haus, welches bereits so federgewichtig ist wie das sich verflüchtigende Bild von Erinnerung. Endler verschränkt Person und Bauwerk, es ist ein schutzloses, spottloses gegenseitiges Stützen, beide sind einer Vernachlässigung ausgeliefert. Wem vertraut man da noch? Dem Atem? Der statisch gesehen am wenigsten trägt, der das Leben trägt? Ein Gedicht, Trost wie Zuspruch, solange man zu atmen imstande ist.
Endler nennt eine Reihe von Büchern, aus denen er sich über die Jahre hinweg nährte, aus denen er Enzyme, Vitamine und Botenstoffe aufnahm. Mitte der siebziger Jahre (in Tarzan am Prenzlauer Berg steht es irrtümlicherweise noch mit 66/67 angegeben) entdeckte er für sich Salvador Dalis Prosaschriften, die ihm der damals um die Ecke wohnende Erich Arendt lieh. Es folgten in der Reihe der „weiterführenden Bücher“ bzw. Autoren der Marquis de Sade, Alfred Jarry, Arno Schmidt, Theodor Kramer, Welemir Chlebnikow und Heiner Müller (auffällig: keine bundesdeutschen Lyriker), um im Ausschnitt eine ungefähre Vorstellung zu geben.
Aber vor allem brachte wohl die von André Breton herausgegebene und kommentierte Anthologie desSchwarzen Humors, die Endler um Neunzehnhundertachtzig regelrecht in die Hand fiel und die für ihn, wie er sagt, zur täglichen Bibel wurde, eine Initialzündung. In ihr stellt Breton fünfundvierzig Autoren, von Appolinaire über Kafka, Nietzsche, Picasso, Swift bis Synge in kurzen Textauszügen und einer poetischen Einleitung vor und gleichzeitig die verschiedenen Spiel- und Abarten, die surrealen Momente und subversive Kraft des „Verteidigungsreflexes Humor“. Die Stimmen sind unterschiedlicher als sie kaum sein könnten, „der Humor kommt zu sehr aus einem Gefühl, als daß er sich leicht in Worte fassen ließe“, so Jacques Vaché. Das Buch gibt ein Spektrum dessen, was literarisch möglich ist.
Das hatte für Endler Folgen. 1994 weist er im Vorwort zu seinem Band Die Exzesse Bubi Blazezaks imFocus des Kalten Krieges, welcher Texte von 1976-94 umfasste, auf das Unverständnis, dem sich seine Arbeiten ausgesetzt sahen, wohlgemerkt nicht bei den Lesern: „Das hier!, diese Collagen und Capriccios hier!; man wird sie schwerlich, wie es geschehen ist, ganz und gar unpolitisch nennen können, auch nicht raffiniert verschlüsselt“. Differenzieren in der Betrachtung war schon immer eine Sache von Anstand und Kultur. Aus diesem eingeengten Wahrnehmungskreis heraus war es nicht nur die Kritik der DDR gewohnt, sich zu Literatur zu äußern. Der von Literaturwissenschaft, Presse und Verlagen gleichermaßen auf das literarische Außenseitertum Fixierte fand sich zumindest im Handbuch des schwarzen Humors inmitten einer äußerst kommunikativen und unterhaltsamen Tischrunde mit gleichgesinnten Texten und Autoren wieder, denen wertende Äußerungen gegenüber Literatur wie „richtig oder falsch“ völlig absurd erschienen.
Humor ist mit den lateinischen Worten humus, welches Erde bedeutet, und umor, was Feuchtigkeit, Flüssigkeit oder Naß bezeichnet, eng verwandt. Das zweite Wort stand früher ebenso für Tränen, Speichel und Blut, galt also als Synonym für die menschlichen Lebenssäfte und insofern -kräfte. Endlers Humor läßt sich nicht verwechseln, weder mit trivialer Heiterkeit noch mit grinsendem Sarkasmus. Sowohl dem einen als auch dem anderen sind Leid wie Leiden fern, ebenso wie die daraus abgeleiteten Lebensflüssigkeiten; die Heiterkeit scheint beides noch nicht kennengelernt zu haben, und der Sarkasmus kann unter keinen Umständen beides noch einmal erleben. Der Humor, so steht es in besagter Anthologie, ist jenseits der unumschränkten Revolte der Jugend und der inneren Revolte des Erwachsenen eine höhere Revolte des Geistes.
Das Wort Initialzündung ist aber vielleicht nicht ganz zutreffend, da das Absurde, Skurrile und Schwarzhumorige in Endler ohnehin bereits relativ früh konstituiert lag. Dafür steht ein 1971, also bereits zehn Jahre zuvor, geschriebenes kurzes Gedicht, „Dies Sirren“. Es ist für Endler noch heute ein nicht völlig durchschautes Faktotum aus eigenen dunklen Urgründen.
Und wieder dies Sirren am Abend. Es gilt ihnen scheint es für Singen
ich boxe den Fensterladen auf und rufe He laßt mich nicht raten
Ihr seid es Liliputaner das greise Zwergenpaar van der Klompen
Cui bono ihr lieben Alterchen mit der Zirpstimm im Dunkel cui bono.
Dieses koboldartig Irrlichternde, vage wie gleichzeitig deutlich Vernehmbare − genaues Pendeln zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, Sagbarem und Unsagbarem − bestimmt die magischen Pole des Endlerschen Schreibens. In jener betörenden Magie des Zufalls, welchen Max Ernst nicht umsonst den Meister des Humors nannte, erscheint in diesem Gedicht der „Engel des Sonderbaren“, dem Endler erst ein Jahrzehnt später in Gestalt des gleichnamigen Textes von Edgar Alan Poe tatsächlich begegnen wird. Der zeitlichen Hierarchie folgend, verwandelt sich Poes Engel zum Widergänger des greisen Zwergenpaares mit der Zirpstimm.
Im 1967 entstandenen Gedicht „Die Versuchung“ wird dieses „Sirren“ noch mit den realen Hintergründen verknüpft oder läßt sich besser andersherum ahnen, woraus Endlers siebter Sinn für das Surreale gewachsen sein mag. Das Gedicht entstand als ironische Replik auf die unendlichen „Mühen zur Zurückerlangung der verlorenen Aufenthaltspapiere für Berlin“. Allein schon der Verlust eines amtlichen Scheins bedeutete in der ehemaligen DDR, wo erst zwanzig Gramm Papier einen Bürger als solchen hinlänglich legitimierten, den gesellschaftlichen Exitus. Die notwendige Beglaubigung mußte sich also der faktisch nicht Existente als anwesende Person in einem Marathon durch bürokratische Mühlen erlaufen, was sich bisweilen schwerer als die Geburt des eigenen Ichs erwies. Wen wundert es, daß sich der Autor sein eigenes Wertesystem schafft und das bewachte, eingegrenzte, nur mit Passierschein überbrückbare Reale gegen das grenzenlos Fiktionale eintauscht. „Kein Zöllner an den Grenzen der Begriffe / Von Raum und Zeit!“, nur so kann er sich bewegen, reisen, „in einem Wagen, Freund, der niemals bricht, / Zu Ländern namenlos wir Namenlosen, / Wir steuern listenreich: Von allen fort“. Der, zu dem er in diesen Gedichtzeilen spricht, dem er sich verbunden fühlt (Heinrich, der Wagen bricht… Ich glaub, es ist ein Band von meinem Herzen…), ist kein Mensch, sondern ein namenloses Autowrack ohne Nummernschild, zerbeult, räder-, wischer- und scheibenlos und abgestellt am Rande eines Feldes. In den abgenutzten Sitzen, in seinem Schoß, „mit Maden wir, in Sesseln grün von Schimmel“, kann sich der Dichter endlich niederlassen, hier darf er, nur durch sich selbst legitimiert, ungestört und nach seiner Façon sein, „du verlangst kein Aufenthaltspapier“.
Beider Existenzform, des Autos wie des Autors, am Rande eines Feldes, am Rande einer Gesellschaft, ist, aus der Perspektive derer, die sich die verbindlichen Definitionen für Existenz anmaßen, einem Verlöschen gleichzusetzen.
Ja, ich fahr mit dir […] So spricht man nur zum Tod, der kann nicht schaden. Vertraut er mir, als wäre ich der Tod.
Aus dem Dunkel gemeinsamer Einsamkeit heraus beginnen die Sinnesorgane plötzlich anders zu tasten, das Ohr genauer zu arbeiten, erlangen die Geräusche, die unsichtbaren Stimmen, das Sirren des Lebens eine andere Wertigkeit, eine andere Nuance. Denn die Stille formiert die Wahrnehmung neu. Aus diesem Innehalten, fast Stillstand steigt die schwarze Farbe des Todes, der lichtlosen Nichtmehrzeit, auf, wird wiedergeboren und verfügbar.
Dieses Schwarz ist verschwistert dem Lachen, das ebenfalls aus den dunklen Schichten eines Unterbewußtseins kommt. „Das Lachen, diese prachtvolle, ja geradezu lasterhafte Verschwendung, der der Mensch fähig ist, grenzt an das Nichts, gibt uns das Nichts als Unterpfand“, sagt der Franzose Pierre Piobb in Les Mystères des Dieux, und dieses Zitat leitet nicht umsonst die Anthologie des schwarzen Humors ein. Das von tief Innen aufsteigende Lachen ist der Ausdruck des Humors, seiner heiteren seelischen Grundhaltung gegenüber dem Dasein, es trägt die Kraft des Wiederauferstandenen im Wissen dessen, aus welchen Gefilden er zurückkehrt. Die Kraft bleibt durch den Fluch, ein Erinnerungsvermögen zu besitzen, erhalten.
In der antiken Geschichte von Orpheus, der in die Unterwelt hinab- und wieder heraufstieg, sollen der Überlieferung nach diese Schatten als besondere Tönung und Stimmung in seinem Gesang hörbar gewesen sein. Der Preis dafür ist, daß kein Zurückblicken, keine Fragen möglich sind. An dieser Stelle leuchtet nur das Schwarz aus den unteren Schichten des Bewußtseins, das aber läßt sich nicht mehr löschen, solange der Erinnerungsträger lebt, vielleicht das unaussprechbare Geheimnis von Unsterblichkeit. Es liegt darin eine Chance und die besondere Anziehungskraft dieses „Postulats des Verdunkelten“, wie Adorno den schwarzen Humor bezeichnete − für den, der schreibt, wie für den, der liest. „Daß die finstersten Momente der Kunst etwas wie Lust bereiten sollen“, meint Adorno weiter, „ist nichts anderes, als daß Kunst und ein richtiges Bewußtsein von ihr Glück einzig noch in der Fähigkeit des Standhaltens finden“.
Mit seinem in der zeitgenössisch-gesamtdeutschen Literatur einzigartigen schwarzen Humor parodiert Endler in seiner Dichtung vor allem die lichtlose Realität des Sozialismus. Ihr war er immerhin ebenso fast fünfunddreißig Jahre freiwillig ausgeliefert. Die janusköpfige Erfahrung des 1955 vollzogenen Grenzwechsels zwischen Ost und West hielt für ihn einen zweifellos doppelten Boden bereit, der sich nicht mehr auflöste. Endler war damals aus der BRD, gegenläufig zum üblichen Landeswechsel, in die DDR übergesiedelt. Sicherlich führte ihn nicht zuletzt die Erfahrung einer wiederholten Desillusion, erst im Westen, dann auch im Osten, dem exterritorialen Niemandsland Literatur zu. Gleichzeitig schützte ihn diese doppelte Ernüchterung zeit seines Schreibens vor jeglichem gesellschaftlichen Opportunismus. Und das nicht erst, nachdem die DDR ab Mitte der siebziger Jahre für ihn „so etwas wie die Absurdität in der Welt der Nußschale“, also ohnehin kein verläßlicher Grund mehr, wurde.
Im April 1991, nach dem Mauerfall, ergänzte er:
Die absurden Eigenarten der ehemaligen DDR waren für mich seit langem nur Facetten der absurden Weltläufe schlechthin; die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre sind schwerlich geeignet gewesen, mich in dieser Auffassung schwankend zu machen. Ich sehe nicht, daß ich in Zukunft anders oder weniger schreiben müßte als bisher.
Als gebürtiger Rheinländer und längstens Leipziger, Ost- und nun Gesamtberliner, in seiner Konfession weder reformiert noch katholisch, sondern eher von heidnischem Skeptizismus, wählte sich Adolf Endler nach allem Hin und Her lieber das Oben und Unten: er entflog diesem Dilemma als rabenschwarzer Sur-Realist. Vielleicht muß man diese Flugbewegung als einen der Gründe sehen, warum Adolf Endler zu lange in der gesamtdeutschen Literaturgeschichte marginalisiert wurde. Warum er vor allem innerhalb der DDR, gemessen an der Fülle seines Werkes, bis auf wenige Ausnahmen nicht publiziert wurde, ihn die allgemeine literaturbegleitende Diskussion ungebührlich zurückhaltend wahrnahm. Nach seinem Ausschluß aus dem Schriftstellerverband im Jahre 1979 (er wandte sich wie viele andere gegen die Ausbürgerung Biermanns) hatte man, bis auf den von ihm selbst als korruptes Buch bezeichneten Gedichtband Akte Endler, überhaupt nichts mehr veröffentlicht. Obwohl Kollegen sein Werk sehr schätzten, wie sich an zahlreichen zugeneigten Texten – von Rainer Kirsch, Elke Erb, Wolfgang Hilbig, Peter Rühmkorf, Bernd Jentzsch, Helmut Heissenbüttel, Karl Mickel bis Fritz Mierau – in dem von Gerrit-Jan Berendse herausgegebenen Band über Adolf Endler, Krawarnewall, nachlesen läßt. Den rein geographischen Landeswechsel Endlers nahm die offizielle Literaturrezension gern als Anlaß für vorsätzliche Mißverständnisse. So unterstellte man dem Gedicht „Das Sandkorn“ mit seinen Zeilen „Etage um Etage durchwandre ich den Staat, / Dich trifft es heut, wen morgen, mein leises Attentat?“ Und vor allem dem Autor anarchistische Tendenzen. (War der Autor nicht ein Import des Klassenfeinds?) Peter Gosse stellte es richtig, Endlers Dichtung „gibt eher den Hautlosen zu erkennen denn den Geharnischten“.
Der Verlust eines gesellschaftlich abgesicherten Grund und Bodens bescherte dem Dichter im Gegensatz zu statischen Berechnungen dennoch die Chance zu einer irrlichternden Freiheit. „Der Reiz seiner Literatur“, wie Gerrit-Jan Berendse in seinen Grenz-Fallstudien auf Seite 63 bemerkte, „liegt unter anderem in dem Vermeiden einer insbesondere in den siebziger Jahren florierenden Entweder-Oder-Haltung gegenüber dem als marode eingeschätzten Staat“. Der Staat rächte sich. Die Autoren, die sich dem abgenötigten Gang aufs Rednerpult verweigerten, fielen postwendend aus seiner Wahrnehmung heraus. „Wir werden nicht vermißt unsere worte sind / gefrorene fetzen und fallen in den geringen schnee“ schrieb Wolfgang Hilbig 1969 in seinem Gedicht „abwesenheit“.
Was Hilbig in seinen Arbeiten als Stalkersches Vakuum beschreibt, eine verlassene Landschaft, die langsam der bittere Staub von zerrinnenden Existenzen füllt, das genau war für Endler zum eigentümlich bewohnbaren Zwischenreich geworden. Sichtbar unsichtbar, als leibhaftiger Demiurg, hauste er hier und sendete Überlebenssignale in Form von gedichtartigen Gebilden. „Ja? // Wer ist da unten? Antwort! Hat da wer gesprochen?“ Die Potenz des doppelten Bodens befindet sich im nachtvogelschwarzen Freiraum zwischen den Ebenen. Endler nutzte diesen unendlich modifizierbaren, weil eigentlich nicht vorhandenen Aufenthaltsort als Modell für sein Schreibprinzip, seine poetische Stimme tönt als dunkles Gelächter aus einem uneinsehbaren und vor allem unantastbaren Terrain herauf, „mich laß die Rattenschnauze die hier meine hissen“. Als Test, inwiefern dieser Entwurf tatsächlich brauchbar sein könnte, ließ er deshalb als erstes seine Autorenperson in einem fiktionalen Spiel mit mehreren Identitäten verschwinden. Dasselbe Prinzip, der Tausch von Ein- und Mehrzahl, findet sich übrigens in den Arbeiten von Gerhard Falkner, er gab einem seiner Gedichtbände den TiteI X-te Person Einzahl, eine bewußt gewählte Negation der abendländischen Identitätsformel Ich bin. Falkner reagierte aber nicht auf eine Zwangsindividualisierung nach vorgegebenem Schnitt, sondern umgekehrt setzte er einen Widerstand gegen die mediale Auslöschung persönlicher Authentizität. Zunehmend wird alles und werden alle verwechselbar beliebig, daraus resultiert Einsamkeit. Das Auflösen des Autors Adolf Endler, seines Ichs, „Ich ist ein anderer. Karl May? Karl Mickel?“, in die Figuren und Anagramme seines Namens wie Bobbi „Bumke“ Bergermann, Eddi „Pferdefuß“ Endler, Bubi Blazezak, Dore Elfland, Dr. E. Ladenfol, Ede Nordfall, Alfred Nolde, Roald D. Enfer … (ist jemand vergessen worden?) gab den maroden Umständen die kongeniale Antwort eines Subjekts, das einfach entwischte.
Insofern ähnelt Endlers Schreibprinzip einem Eulen-Spiegel. Dieser würde sich vermutlich ebenso verweigert haben, das Bild der kampagnemäßig geforderten „lndividualisierung“ in der DDR (was ja immer in diesem Ausmaß schematisieren hieß) unkommentiert widerzugeben, er wäre kurzerhand in unübersichtlich einzelne Scherben zerfallen. „Daß man ihn endlich aus dem Land rausschlage / Auf jede Antwort weiß das Schwein die Frage“. Im Grimmschen Märchen gewann der Igel den Wettlauf gegen den Hasen bereits im selben Multiplikationsverfahren. Man kann diese Art Notwehr oder besser Not-Wendigkeit bis in ihre biologischen Konstitutionen zurückverfolgen.
Der Salamander, wenn er von Feinden attackiert wird, sichert sein Überleben, indem er sich rasch aufteilt. Er wirft sein Hinterteil, sofern man ihn daran packt, ab und verwirrt: denn er hat den Vorsprung einer klaren Entscheidung. Ein Forscher vom JeremyInstitute for Cancer Research in London fand heraus, daß, indem der Körper selbst bestimmte Hemmstoffe beseitigt, Entwicklungsprogramme im Salamander neu gestartet werden können. Allerdings wissen die Wissenschaftler nicht, weshalb diese Fähigkeit den Säugetieren verlorenging.
P.S.: Der Gedichtband erreichte den Leser, klarsichtig umhüllt, mit dem Gebrauchshinweis „umweltverträglich, recyclingfähig“. Sollte etwa Grüner Punkt ein noch unentdecktes Pseudonym von A. E. sein? Zirpt da nicht sein allerletzter Kommentar dem Ganzen hinterher?
Cornelia Jentzsch, Sprache im technischen Zeitalter, Heft 153, April 2000
Vagant und Rädelsführer
− Adolf Endlers Rezepturen. −
„Einen Dummerjahn kleinzukriegen, verfahre man dergestalt: Es gilt ihm ganz einfach die Hucke vollzulügen; nichts Schlimmeres, Leute! Im Nu fällt das Mensch uns zur Beute!“ Wer so sein Dichterhandwerk versteht, versteht die Poesie anders: Sie ist nicht mehr Botschafterin des Schönen, Stimme edler Absichten und hehrer Ziele, Offenbarung erlesener Gedanken und Wahrheiten, Sehertum und formale Vollendung. Sie ist, im Gegenteil, Lüge, ästhetischer Betrug, Menschenfischerei, Beutezug. Der Dichter als Jäger und Sammler, seiner Beute intellektuell überlegen, aber ohne genialen Glorienschein – diese Vorstellung paßt perfekt zum Bild, das sich die Moderne vom Dichter als Outcast gemacht hat. Villon, Charles Bukowski, Peter Hille – der Dichter als Vagant oder als Rädelsführer, als einer jedenfalls, der weiß, daß die einfachsten Mittel oft die besten sind. Gewaltexzesse („die Hucke vollhauen“) lehnt er ab, um „das Mensch“ zur wahren Lüge zu bekehren. Adolf Endlers Gedichte stecken den kurzen Weg ab von der Verfremdung der Wahrheit, die die „Dichtung“ nach alter Vorstellung immer schon bedeutete, bis zu Platons Vorwurf, daß die Dichter lügten und aus der Polis zu verdammen seien. Da setzt Endler gleich „Was Gereimtes“ drauf, „betitelt ‚Kleines Leckmichmal-Gedicht‘“.
Als überzeugter Kommunist zog der gebürtige Düsseldorfer 1955 aus der engherzigen Adenauerrepublik in den vermeintlich besseren Teil Deutschlands. 1966 gab er, zusammen mit Karl Mickel, einen Band „Gedichte der Deutschen Demokratischen Republik seit 1945“ heraus, unter dem Titel: In diesem besseren Land. Seine Lage wandelte sich zum schlechteren spätestens dann, als Endler 1979 aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen wurde, was einem Schreib- und Publikationsverbot gleichkam. 1990 wurde er dann wieder Bundesbürger. Sein Werk lag verstreut in zehn Verlagen vor (die zahlreichen Nachdichtungen und Übersetzungen nicht gerechnet), Gedichte und Reportagen, Theaterstücke und MiniDramen, Nebbich und Prosa.
Jetzt also ein best of im Enzensbergerschen Großformat, über 200 Seiten stark, ein sinnliches Ereignis: Man sieht richtig, wie das Sandkorn (im gleichnamigen Gedicht) durch die Verse rieselt. Was an diesem Band sogleich auffällt, ist die Formenvielfalt. Sie ist geradezu augenfällig inszeniert. Der hassende Zweizeiler („Rosa und Beige kommen wieder in Mode? / Wie ich Euch hasse mit Hirn und mit Hode!“) neben dem liebenden „Abenteuerbuch“ („Grün, wie ich dich liebe, Grün“), das kurze Gedicht neben dem langen („Das Lied vom Fleiß“ in hundert Zeilen), die einfache Liedform, gereimt oder ungereimt, die Ballade, das Haiku, Prosagedicht und „Memoire“, „Verse der Entsagung“ neben „Versen echter Dankbarkeit“, ein Fragment aus einer szenischen Dichtung („Soldaten / Kinder / Lied“) neben einem „Romananfang“ in drei Strophen und zwölf Versen.
Endlers Direktheit, seine Schnoddrigkeit, sein kauziger Witz, seine Sinnlichkeit ergeben einen ganz eigenen black pudding. Wo sonst kann man vom Blut der Läuse als Färbemittel lesen? „Dein rotes Haar erglänzt wie viele Tropfen Blut“, heißt es in dem Gedicht „Läusesuchen“ (1970). „Ich, der Henker“ zupft Läuse aus den Haaren „wie Rosinen aus dem Kuchen“. Eigentlich auf das Leben seines Opfers aus, ist ihm das Blut der Läuse Blut genug: „Du wirst begnadigt.“
Endlers Gedichte haben viele Väter: Spurenelemente von Benn und Brecht, Celan und Rilke, Johannes Bobrowski und Günter Eich, Volker Braun, Karl Mickel und Peter Rühmkorf, Breton und Whitman, Lorca und Majakowski haben sich erhalten. Überhaupt die Internationale! Wenn man bedenkt, wie fremd Gottfried Benn das Englische noch war (schauderhaft sein „Nevermore“, gereimt auf „Terpsichore“) – da ist Adolf Endler erfreulich gewitzt, da reimt sich „Oscar Wilde“ auf „beeilt“ und „loves“ auf „Kaffs“ („Die düstere Legende vom Karl Mickel“). Der Band ist schön „endleresk“ überschrieben, genauso wie die vier Kapitel: „Dies Sirren“ heißt das erste, „Akte Endler“ im schönsten Gauck-Deutsch das zweite, „Immer wieder was Neues“
das dritte, „Trotzes halber“ das vierte und letzte. Die Einteilung signalisiert, daß es an „Brüchen“ in Endlers Œuvre nicht mangelt. Hilfreich daher die Anmerkungen, die – wo es Endler erforderlich schien – kurz etwas zum Hintergrund des Textes sagen, sowie das Nachwort, wo der Dichter von seinen Bekenntnissen und Irrtümern, seinen Abwegen und Vorbildern Zeugnis ablegt.
Lutz Hagestedt, Literaturkritik.de, Januar 2000
Sticht sternenwärts
− Adolf Endlers Gedichte. −
Im nächsten Jahr wird der Lyriker Adolf Endler siebzig, und rechtzeitig erscheint bei Suhrkamp ein Band mit Gedichten und Prosa. Rechtzeitig heißt, dass man sich mit dem Dichter vertraut machen kann, ehe Feiern seine Bedeutung umwölken. Aber kennen wir ihn nicht längst? Manch einer wird das von sich behaupten dürfen, viele Deutsche aber, vor allem in den alten Bundesländern, könnten ratlos gucken. Damit sind wir beim Thema, einem, das dem Poesieverehrer kunstfeindlich klingen mag und doch aus der Dichtung nicht wegzudenken ist: bei der Politik. Auf der Reise durch Endlers Schaffensjahrzehnte in der Suhrkamp-Sammlung wird diese Bindung dem Kenner sofort deutlich. Da wir aber, was Endlers Lebens- und Arbeitsumstände betrifft, keine breite Kennergemeinde voraussetzen, schauen wir uns das Stück Historie genauer an, das ihm zuteil wurde. Der Dichter Endler ist ein Produkt und ein Protokollant deutscher Zeitgeschichte.
Er war um die zwanzig und wohnte im heimischen Düsseldorf, als er seine ersten Verse versuchte. Die wenigsten lässt er heute noch gelten, auch wir müssen uns nicht mit ihnen befassen. Reden aber müssen wir von seiner politischen Haltung: ein blutjunger Nachkriegsdeutscher, sah er mit Abscheu auf das, was die Generation der Eltern angerichtet hatte. Wie viele seiner Altersgefährten, fühlte er sich zum Aufbau einer besseren Welt berufen, und zwar nach dem einzig rechten Rezept, dem strikten Antifaschismus. Also lieh er sein Ohr den Verkündern des strikten Programms, den Kommunisten. In Deutschland herrschte Kalter Krieg, der junge Endler bekam Ärger, als er 1951 für die Ost-Berliner Weltjugendfestspiele warb. Vier Jahre später ging er in die DDR.
1955 konnte es keinen Zweifel mehr geben, welchen Prinzipien der kommunistische deutsche Staat gehorchte, es sei denn, jemandes Horizont war mit Gesinnungskulissen verbaut. Darum mühte sich, auch im Falle Endler, die Partei. Sie verschaffte dem Zuwanderer das Hochgefühl, an Aufbauunternehmen fortschrittlicher Jugend beteiligt zu sein; in Reportagen und Gedichten, gesammelt im 1960 erschienenen Band „Weg in die Wische“, berichtete er davon. Sie schickte ihn zum Lernen ins Leipziger Literaturinstitut, eine Gründung des orthodoxen Kulturfunktionärs Alfred Kurella, seit 1958, nachdem der Kulturminister und Kurella-Feind Becher tot war, mit dem Namen „Johannes R. Becher“ geschmückt. Die SED ließ nichts aus, schien aber von ihrem pädagogischen Erfolg wenig überzeugt zu sein. Ihr Deutsches Schriftsteller-Lexikon verschwieg in seinen ersten Ausgaben von 1960 und 1961 den jungen Nachwuchs aus dem Westen. Erst die Edition von 1967 erwähnte ihn, aber kurz und ohne Zuneigung. Dies, obwohl Endler im Jahr davor, zusammen mit Karl Mickel, eine Lyrik-Anthologie unter dem DDR-marktgerechten Titel In diesem besseren Land herausgegeben hatte.
Ihm zeigte sich um diese Zeit die DDR schon nicht mehr als gutes, geschweige besseres Land. 1963 waren Wolf Biermann samt seinem Förderer Stephan Hermlin, Reiner Kunze, Bernd Jentzsch und Rainer Kirsch wegen ihrer „kritischen Lyrik“ in Ungnade geraten. Auch Endler bekam als Schilderer „gebrochener Gefühle“ sein Fett ab. In seiner Antwort an den „ungebrochenen Rezensenten“ motzte er:
Wie ist ein ungebrochenes Gefühl? Mit glatten Rändern?
Meins jubelt heute, morgen schon in Not!
Meins ist gebrochen. Kann ich es denn ändern?
Willst aber du es ändern, schlag mich tot!
Diese Verse, man kann sie im neuen Suhrkamp-Band nachlesen, schrieb Endler 1963, doch veröffentlichen konnte er sie erst zwölf Jahre später. Nach dem Machtantritt Honeckers also, dessen Verheißung kulturpolitischer Toleranz, „wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht“, in den Ohren der Kulturschaffenden süß klang. Wie sie alle übersah Endler, dass Honecker der Hauptakteur des 11. ZK-Plenums von 1965 gewesen war, des kulturpolitischen Autodafés für alle nicht total SED-konformen Ideen, kämen sie auch aus den Köpfen aufrichtiger Parteigänger. Doch wer jahrelang für die Schublade dichtet und dann vor offenen Verlagstüren steht, kann politische Zusammenhänge mal vergessen. Sie bringen sich später von alleine wieder zur Geltung.
So geschehen mit dem Gedicht „Das Sandkorn“, geschrieben 1967, veröffentlicht 1974 in einem Buch, dem es den Titel gab. Endler meinte mit dem Sandkorn sich selbst, als Sand im parteipolitischen Getriebe; nicht, weil er sich so empfand, sondern weil die SED ihn so sah. „Das Sandkorn“ hat dreizehn Jahre nach der Niederschrift, sechs Jahre nach dem Druck Mielkes Staatssicherheit beschäftigt. In seinem Nachwort zum Suhrkamp-Band zitiert Endler aus einem „Gutachten“ der Stasi-Hauptabteilung XX:
Hier tauchen faktisch alle gesellschaftlichen Organe, einschließlich der Schutz- und Sicherheitsorgane auf. Das Sandkorn ist Symbol für den Skrupel, Zweifel, Gewissensrest der Verantwortlichen und überhaupt für alle Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft. Der Hauptvorwurf lautet: „Die hätten auch dem Hitler wie Barzelstrauß gedient.“ (Also wieder Vorwurf des latenten Faschismus in der DDR.)
1980, im Jahr dieser Stasi-Rezension, lebte Endler außerhalb jeder Gnade. Er hatte im Jahr zuvor jenen Brief an Honecker mit unterzeichnet, in dem Schriftsteller der DDR ihrer „wachsenden Sorge“ über die kulturpolitische Entwicklung Ausdruck gaben. Anlass waren die Verfolgungsmaßnahmen gegen Stefan Heym und Robert Havemann. Im Juni 1979 verstieß der Schriftstellerverband der DDR, unter dem Kommando seines Präsidenten Hermann Kant, neun Mitglieder, unter ihnen Adolf Endler. Der unkundige Westler mag sagen, dass die Verstoßenen in einem Zwangsverband nichts zu suchen hatten. Gelernte DDR-Deutsche wissen, dass der Schriftstellerverband nicht bloß eine politische Formation war, sondern die unabdingbare existenzielle Basis, Sesam-öffne-dich für Verlage und Voraussetzung für Krankengelder und Altersrenten. Endler war um die fünfzig, als er vogelfrei wurde. Da zeigt die Lebenssonne die ersten abendroten Ränder. Was blieb ihm? Der Prenzlauer Berg mit seinen Dichternestern und mit Möglichkeiten zu kleinen Veröffentlichungen. Endler gedenkt in seinem Nachwort der Westausgabe seines „Sandkorns“, ediert 1975 bei Wagenbach, und nennt sie „mein einziger ,richtiger‘ Gedichtband bis heute“. Sein Inhalt sei 1985 in einer Dokumentation in den Vereinigten Staaten „frenetisch“ beurteilt worden, er habe das 1990, nach der Wende, „so stolz wie müde“ zur Kenntnis nehmen dürfen. „Was wäre gewesen“, sinnt er, „wenn mich der ,Zuspruch‘ 15 Jahre früher erreicht hätte?“
Das hätte ihm vielleicht jene Stimmung erspart, in der die „Hefte des Irren Fürsten“ entstanden, nach Endlers Bekundung „Gedichte, in denen mit der Gefahr des Absturzes ins Irre-Sein wohl nicht nur kokettiert wird“. Man kann ein poetisches Lebenswerk verdauen, auch wenn es aus Schmerz geboren wurde. Anders, wenn aus dem Poesiefreund der Mitmensch hervortritt. Wir sollten nicht herumlesen, sondern des Schicksals gedenken, das hinter jeder Zeile steht und das eigene hätte sein können.
Seine Suhrkamp-Ausgabe umfasst Arbeiten von 1963 bis 1998. Er hat keine Irrungen weggelassen. Dass er nur aufnahm, was künstlerisch vor ihm Bestand hat, widerspricht dem nicht. Er kommentiert das in seinem Nachwort: „Ursprünglich war es dem jugendlichen Helden Endler darum gegangen, ein sozialistischer, ein kommunistischer Sänger auch im Gefolge Majakowskis zu werden, ein Unterfangen, das dann von Jahr zu Jahr brüchiger wird; endlich kippt das alles kreischend ins Wüste und Kaputte um und sticht zerbeult sternenwärts…“ Treffender, vor allem schöner hätte das niemand ausdrücken können. Allein die Schlussformulierung – „und sticht zerbeult sternenwärts“ – strahlt so viel Magie aus, dass man sich das übrige Sprachwerk in diesem Buch nicht entgehen lassen sollte.
Sabine Brandt, Frankfurter Allgemeine, 4.12.1999
Gründlich vergiftete Leckereien
− Adolf Endler serviert zum Jahrhundertende den Pudding der Apokalypse. −
Wie soll man die Gedichte von Adolf Endler erklären? Sie sind aus vielerlei Materialien kunstvoll-kunstlos zusammengebacken, aus Dreck und Lehm sozusagen, aus Tradition und Versgeklingel, verfüllt mit dem Müll des zeitgenössischen Denkens, collagiert mit Originalzitaten, golemartige Gebilde von höhnischer Lebendigkeit. Endler ist sozusagen der Frankenstein unter den deutschen Lyrikern, er bastelt mit Leichenteilen und schickt das absichtsvoll schlecht Vernähte auf Vortragsreise, damit wir in den „fratzenhaften“ Gedichten (sein eigener Ausdruck) die Fratze unseres unaufgeklärten, tödlich verwirrten Zeitalters erkennen. Denn so heiter, so verspielt und demonstrativ verantwortungslos Endler sich aufzutreten bemüht, so bitter und böse und letztlich gesellschaftsfeindlich ist er in Wahrheit, und zwar feindlich jeder Gesellschaft gegenüber, nicht nur der sozialistischen. In dem Gedicht, das Todespatienten im Sterbezimmer eines Krankenhauses beim Skat beobachtet, heißt es
Nur ich verschlagen wie in eisige Fremde
Ein Staatsfeind fast ich kann kein Kartenspiel
Ich sitz verstummt im weißen Sterbehemde
Der Einzige mit trübem Vorgefühl.
Vielleicht muss man den Sozialismus mit seinem ideologisch begründeten Kampf gegen alle Abseitsstehenden gekannt haben, um die Bitterkeit der Verse ganz auszuschmecken, vielleicht aber auch nicht. Sich nicht dem Spiel des Lebens angesichts seines drohenden Endes hingeben zu können ist ein Motiv, das überall Außenseiter schafft, zumal Außenseiter der Dichtung.
Endler spielt nämlich durchaus selbst, nicht mit Karten, sondern mit Versen, mit dem tradierten Vanitas-Motiv, mit den abgetrabten Rhythmen, mit dem höhnischen Bruch des Pathos, der sich in der absichtlich zu schwach gewählten Schlusspointe vom „trüben Vorgefühl“ zeigt. Es gibt etwas Äffisches, Grundparodistisches, auch immer den Vorgang des Dichtens Parodierendes bei Endler, das die Bitterkeit verstärkt, weil es die Hilflosigkeit des Dichters zeigt, der mit vorgefundenen, nahezu restlos abgenutzten Materialien arbeiten muss.
Seien wir alle brüderlich zueinander
Alle hier brüderlich zueinander
Alle ohne Ausnahme brüderlich
Dröhnte der große Jacques Pimmel
(Flüchtendes Menschengewimmel)
Für keinen ne Extrawurst.
Die Materialien gehören nicht dem Dichter, es sind die Materialien, die sich über die Zeiten hinweg in den Köpfen seines Publikums abgelagert haben, aus Propaganda, Reklame und Deutschunterricht, er bastelt sozusagen mit dem Abfall einer Zivilisation und Gesellschaft, die seine nicht ist, an deren Rand er aber lebt wie ein streunender Hund. Als Dichter erinnert Endler an Bewohner der Dritten Welt, die ihre Kunst aus den Blechresten jener Konservendosen fertigen, durch deren Import die Wirtschaft ihrer Heimat zerstört wurde.
Es sind aber nicht nur Sprachmaterial und Motive der kapitalistischen wie sozialistischen Moderne, aus denen Endler seine Gedichte bastelt; zu den höhnisch recycelten Altmaterialien gehören auch Versmuster, rhetorische Haltungen und inflationierte Worte. Von großartiger Komik ist „Das Lied vom Fleiß“, das sich selbst als Produkt eben dieses Fleißes austeilt und feiert.
Einhundert Zeilen wird mein Fleiß erzwingen
Und fünfzig Doppelreime. Also still!
Hier wird das Lied auf meinen Fleiß geschrieben:
O großer Fleiß, der schon die Zeile sechs
(Sie war ’s), der also schon die Zeile sieben
Mit Lippen abzählt.
Das wäre nichts als ein Pennälerscherz, wenn nicht die Verse, rein technisch gesehen, tatsächlich ausgezeichnet und das wirkliche Ergebnis wirklichen, hoch gelehrsamen Fleißes wären.
So dieses Epos, Lieschen:
Nicht Geistesblitze kennt ’s noch Phantasie,
Ich pflanze hundert Zeilen wie Radieschen,
Brech Reim um Reim wie Kleinholz übers Knie.
Nicht zufällig kommen Vergleiche und Metaphern aus der Produktion; neben vielem anderen Material wird hier auch die sozialistische Arbeiterrhetorik verarbeitet. Das Ende verlangt allerdings nach durchaus vorindustriellem Produkt:
Stolz verwundert
Seh ich das Lied auf meinen Fleiß gereift.
Hier ist der Gipfel, hier die Zeile hundert:
„Gebt mir den Strick da, doch gut eingeseift!“
Der Tod steht am bitteren oder höhnischen Schluss vieler Endlerscher Gedichte. Im unendlichen Prozess von Produktion und Reproduktion ist nur eines definitiv und endlich: das individuelle Leben, dessen Beiläufigkeit sich in der Warenwelt erst recht offenbart.
Was interessiert mich das Lausitzer Land
Was die Kundschaft von meinem Bockwurststand
Da wird ’s ohne mich Bockwürste geben
Was interessiert mich
Mein Leben.
Das Gedicht, das seinen Trash-Charakter schon mit dem Titel „Sunlight-Serenade“ andeutet, motiviert sich eingangs durch gekränkte Liebe, die zugleich mit einem existenziellen Ruck dem Kioskbetreiber seine Auswechselbarkeit, schließlich kosmische Bedeutungslosigkeit offenbart. Man darf sich von dem parodierten Heine-Ton nicht täuschen lassen, wie überhaupt in dem Endlerschen Spiel von Spott und Selbstverspottung am Ende eine Verzweiflung sichtbar wird, die so radikal in der Lyrik seit Menschengedenken nicht mehr artikuliert wurde. Diese Verzweiflung nährt und stärkt sich auch an dem Spiel mit historischen Versmustern. Ihr Einsatz zeigt die Antiquiertheit des Menschen und seiner Gefühle; seht her, zeigt Endler, mit dieser alten Sprache dieser alten Dichter kann man es noch (immer) sagen, woran ihr leidet; aber ihr habt diese Sprache im Zuge des Fortschritts auf den Müll geworfen und deshalb lassen sich eure Gefühle auch nur noch wie Müll zeigen, klein und hässlich neben den glänzenden neuen Produkten des Fortschritts.
Endler demonstriert das natürlich nicht ohne Ironie. Er weiß wohl, dass die Empfindung, die er freisetzt, nicht unähnlich ist jenem Weltschmerz des Pubertierenden, der sich von niemandem in seiner Umgebung verstanden fühlt, wohl aber von Heinrich Heine, und der ist seit hundertfünfzig Jahren tot! (Und ich werde gewiss auch bald sterben.) Freilich haben diese Formen, zu denen auch Endler lieber, als dass er sie verspottete, Zuflucht nehmen würde, gegen den menschenverachtenden Fortschritt nichts auszurichten vermocht, sie sind im Gegenteil nur mehr höchst zerbeult und lädiert auf uns gekommen, und als solche zeigt sie Endler auch; am eindrucksvollsten vielleicht in dem Gedicht „Des Freundes Wettlauf mit dem Schneemann“. Es ist in Anlage und Ton ein Sonett; aber auf die ersten beiden Quartette folgen keine Terzette, sondern abermals zwei Quartette. Es gibt keine Auflösung, es ist keine Summe zu ziehen, der Freund stirbt, und zwar genauso, wie er es vorhergesagt hat: nämlich schneller als der Schneemann schmilzt, den beide, der Dichter wie sein Freund, dabei beobachten. Der Tod ist ein Prozess, der voranschreitet ganz ohne Dialektik und Aussicht auf höheren Sinn.
Ich hab, als keiner da war, deine Uhr gefilzt.
Ihr Zifferblatt zerschmilzt. Laut ticken deine Schritte
Die Gedichte, die dieser Band aus der Zeit von 1963 bis 1998 versammelt, setzen in dem Moment ein, in dem Endler, wie er in seinem Nachwort schreibt, „fast von einem Tage auf den anderen so entschieden wie torkelnd von der gepriesenen ,Hauptstraße der DDR-Lyrik‘ abgebogen zu sein“ scheint. Vom ersten dieser „zerbeulten und absurden Gebilde“ bis zum letzten setzt sich der Prozess der bald spielerischen, bald sarkastischen, bald verzweifelten Deformation fort; einige der spätesten sind nur noch fragmentarische Eingebungen und Collagen aufgeschnappter Torheiten des Zeitgeistes, nicht unähnlich der Notate, auf denen Flauberts „Bouvard und Pécuchet“ beruht.
Der Titel Pudding der Apokalypse zeigt recht gut, was Endler von der Zukunft erwartet, aber auch was er von dieser seiner Erwartung hält; Im Nachwort teilt er seine Befürchtung mit, dass der Titel eines Tages für ein Kochbuch Verwendung finden könnte, und zwar mit dem Untertitel „Noch ’n paar Mal locker essen vorm Schluß“. Von solcher Art ist der grimmig überschäumende Humor des Adolf Endler. Was er „vorm Schluß“ gedichtet hat, sind jedenfalls gründlich vergiftete Leckereien. Dieser Band, von dem er annimmt, dass er ihn „als eine der verwachsensten Gurken der neuen Poesie zeigen wird“, ist in Wahrheit der bedeutendste Gedichtband vom Ende dieses Jahrhunderts.
Jens Jessen, Berliner Zeitung, 12.10.1999
Im Irrgarten der Poesie
– Adolf Endlers gesammelte Gedichte. –
Der „Hustler“? Verhinderte Sekretärinnen und Kleinstdiven, die man – wie die Orangen bei Edeka – der Appetenz wegen durch Gelatine gezogen hat, damit sie nun ihre Schmollmünder und (wie man seit Nicholson Baker auch in der Hochsprache sagen darf) Nippel in offenbar prinzipiell verhauchte Kameralinsen recken dürfen? Ja nun, der „Hustler“ ist ein bißchen auch am Prenzlauer Berg heimisch geworden. Im Haus des vorerst letzten Dada-Einmannbetriebs, des Reimewerfers und Verskabarettisten Adolf („Eddie“) Endlers jedenfalls, und der hat seine (vorerst) letzten Dichterworte „An den Rand des ,Hustler‘ gekritzelt“:
1.) Säbeltanz auf fetten Wintersocken.
2.) Anstatt der versprochenen Badeanstalt: Im Huflattich Nattern.
3.) Seinem engeren Freundeskreis noch ungesotten entschlüpftes wasserfallgrünes Intimschrauben-Necessaire
So geht es los, kapriolenschlagend wie nur je. „Und jetzt noch ,was ganz Schweinisches‘ – mein Alterswerk!“, das H.-D.-Hüsch-Parlando einer Eddie-E.-Performance (sind das die Gene?) muß man sich am besten gleich dazudenken. In der Mitte, bei Nr. 17f dieser Einverszirkusnummern, der (vorerst) lustigste Nachruf auf den realen Traum vom besseren Sozialismus: „17.) Dafür“ – nämlich für die Nippel-Hochglanzmagazine – „sind wir im Herbst 89 nicht auf die Straße gegangen! 18.) Verführerischste Haftbedingungen fürwahr; meint Daniela Dahn.“
35 Jahre Dichterleben klingen so (vorerst) aus, gesiebt, gesammelt und gezwängt zwischen zwei hübsche Suhrkamp-Deckel. (Thorsten Ahrend – der „T. A.“, an den das glänzende, selbstironische Nachwort gerichtet ist – hat Endler dorthin mitgenommen.) Läßt man die Seiten so à la Daumenkino durch die Fingerkuppen schnurren, bleibt man hängen bei S. 62: Hier fängt es an mit der Ausdünnung des Gedichtes, bis nur noch numerierte Listen einsamer Verse stehenbleiben. Ganz kurz, ganz schüchtern ist diese Form plötzlich da, 1971 unter der Überschrift „Februar“, als wäre der Dichteratem geschrumpft vor all der Kälte rundherum, als ließe sich nur so, hinter vorgehaltener Hand, ein Gran Utopie bewahren. (Ein Silberstreif am Beginn der Ära Honecker, nach dem VIII. Parteitag?) Dadaistisch ist noch gar nichts, nur melancholisch wortkarg:
1.) Die Weltraumkälte sickert ein in meine Haut
2.) Ich höre dem Schnee der Erde zu Er taut und taut
Und schon ist das Gedicht zu Ende, dann folgt das Titelblatt zum zweiten Teil des Buches – Akte Endler, das Gesammelte aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre – und man betritt ganz neuen, oskarpastiorischen Boden:
Schwarzwolkpruetsch
1) Gilbstes Wölkchen
2) Betrüblicherseits
3) Schwarzwolkpruetsch
Rünnachathnem Gebürge […].
Eine eigene Art der „Rettung der Poesie im Unsinn“, wie man (P.H. Neumann) über Eich einmal gesagt hat, ist das wohl, ziemlich zur gleichen Zeit, als Papenfuß seinen ersten Gedichtband vorbereitet, nicht lange nach der Ächtung Kunzes, der Biermann-Ausbürgerung und der Berliner Konferenz 1976. (Bei Eich hießen diese numerierten Listen loser Verse 1964 „Formeln“ – Eich wehrte sich in einem Brief an Unseld gegen die Unterstellung, daß diese Einversstrophen untereinander in einem inhaltlichen Zusammenhang stünden.) Und überhaupt Eich: Das berühmte (und dementsprechend bis zur Unschädlichkeit zitierte) „Seid Sand im Getriebe der Welt!“ – findet das nicht ein ebenbürtiges Echo in Endlers „Das Sandkorn“, dem großartig blechgetrommelten Hymnus auf das widerborstig-unscheinbare Bröselchen, das als Störfaktor ins Getriebe des Dichters gerät und unversehens zum poetisch-anarchischen Hauptgeschäft wird?
Vielleicht
hätte sich Trapezunt gelohnt.
Die schwarze Nordküste
mit Vokabeln der Volksbücher
so hatte Eich „Nach dem Ende der Biographie“ Anfang der 70er Jahre gedichtet. Kurz darauf grübelt Endler, auch er am ,Ende einer Biographie‘, wenn auch nur der realsozialistischen:
Eventuell Nordbrabant wo die Maler die Mühlen malen die
Gegend von Eindhoven (Geh nach Haus jetzt van Gogh)
[…] Eventuell Nordbrabant
Dieses Damenrad kriegen wir hin
So radikal Eichs Lehre vom „Nichteinverstandensein“ war, Endler geht in einem Punkt darüber hinaus: Er verschont nicht, was für Eich unangetastet blieb, Sinn und Überlegenheit des dichterischen Geschäftes selbst. „Aufgrund sehr komplexer, nicht zuletzt politisch-sozialer Motive ist mein Schreiben seit längerem ein stetes Anschreiben gegen Festgeschriebenes geworden, und stamme es aus der eigenen Feder!“, hat er zur Zeit der Akte Endler gesagt. (Endlers Sandkorn tut sein anarchisch zersetzendes und zugleich produktives Werk nicht nur in der äußeren Welt, sondern vor allem auch in Kehle und Schlund des Poeten selbst.) Die Gelegenheit diktiert Form und Tonlage jeweils neu. Das Gedicht wird allergisch gegen alles vorab Festgelegte, gegen Weltanschauung und Ideologie zumal, und es tendiert, wie bei Eich, mehr und mehr zur Prosa (vgl. „Ichkannixdafür“, „Die Übungsperücke Ichthiander“, „Winterreise“, „Frau Holle“). Endlers Formenrepertoire jedoch verringert sich dadurch nicht, im Gegenteil. Mit der Entdeckung der dadaistischen Silben- und Buchstabenverdrehungskunst verschwindet keine der zuvor gepflegten Formen – kauzige Gesänge von Alltäglichkeiten rund um die Schönhauser Allee finden sich weiterhin („Ende einer Tour“,
„Die Wirtin vom feuchten Eck oder der Sprung“, „Sunlight-Serenade“, „Stimmungsbericht“,
„Gedenken an zwei Stammgäste“); auch das Epigramm und der Notizzettel im „Tarzan“-Stil, („Denkmal für A. W.“, „Inschrift“, „Nulluhrdreißig“), liedhaft Scherzgereimtes („Der Betriebsausflug“, „Gedenken und Mahnung“). Die erhabene Genitivmetapher („die hundertsträhnige peitsche der sonne“), in der sich der junge Endler schon einmal geübt hat, überlebt in die 70er und 80er Jahre hinein (nun allerdings schroff verschnitten mit profaneren Dingen) und auch die surrealistische Methode der unwillkürlichen Wortassoziation („Zwei Lesezeichen“). Das Allzueindeutige und bloß Anschauliche wird mehr und mehr verdrängt – „santiago“, ein nüchtern-makelloses Schreckensbild aus der Diktatur, so klar, daß nichts kommentiert oder verfremdet werden muß, ist nur in den 60er Jahren möglich (Ausnahmen wie „Liebeslied für M.“ bestätigen die Regel). Verteidigt der Endler der 60er Jahre das ,gebrochene Gefühl‘ gegen offiziell verordnete Homogenität, so wird in den Gedichten der späten siebziger Jahre die Gebrochenheit zur Form – „Aus den Heften des Irren Fürsten M.“ ist die umfangreiche Bilanz der dichterischen Existenz jener Jahre.
Kohärenz und Anschaulichkeit werden immer öfter zurückgelassen; in eigentümlicher Gegenbewegung dazu öffnet sich das Gedicht für Augenblicke der ganz großen Dimension. Kosmische Irrlichter blitzen hinein (eine Nachwirkung der Freundschaft mit dem alten Erich Arendt, wie Peter Gosse vermutete). Manchmal ist es nicht mehr als ein kokettes Blinzeln in die Hemisphären:
Er tilgt den Gedankenstrich
Und er tüpfelt drei Pünktchen
Mitten in unser Sonnensystem
Springt der Dichter ans Telefon
Das Schluchzen des Weltalls
Manchmal ist es kombiniert mit der Endlerschen Lust am grotesken Fratzenschneiden:
Erster Koch Du im Himmel!
Die Suppen (dünn-, dicken?),
In die wir uns schicken,
Ja, rühr sie!
(„Gebet / Aus den Heften des Irren Fürsten“).
Endlers Dichten wechselt in den 70er Jahren schneller, kapriziöser, virtuoser zwischen den Stilhöhen, nicht nur von Werk zu Werk, sondern auch innerhalb eines einzigen: Das Anekdotische und Alltägliche wird nun manchmal – wenn es zum Beispiel darum geht, dem Lieblingsfeind Endlers, der Germanistik, eine Nase zu drehen – übergangslos durchsetzt mit Ulk und silbenspielerischem Nonsens („Für acht Groschen Hefte“, „Unterm ,Großen Wagen‘“). Endler findet zu seiner, mit Witz und Wortakrobatik (im doppelten Sinne des Wortes) hakenschlagenden Verskunst, doch er erobert sich zugleich auch neue Formen, das „Dokumentargedicht“ zum Beispiel wie „Brahms“, einem amüsanten Pasticchio aus populärbiographischen Schnipseln, oder „Der älteste Mensch der Welt“,
einer Satire auf realsozialistische Schulterklopfrituale, gedrechselt aus realsozialistischen Zeitungsnotizen.
„Mein frühes Gedicht, wie sprichts mir mit unverständlichem Vokabular“, heißt es im Gedicht „Prognostische Selbstverpflichtung“ von 1965. Jetzt steht es dem „Sandkorn“ gegenüber, diesem programmatischen Neuanfang im Zeichen der Programmlosigkeit und – nur zu wahr, das Frühwerk fällt ausnahmslos durch das Sieb von Endlers Lebensauswahl. (Nur bescheidene Blüten am Wegesrand wie „Verdammt das Weib aus Parterre“ und „Hymnus nach dem Besuch des großen Mannes“ dürfen, ein bißchen aufpoliert, weiterleben.) Agitpropreime wie „Hier wird ein Weg, / eine Straße sein / dank jugendlicher Tat. / […] Dank Arbeiter-Bauernrat“, nun gut, die mögen nicht mehr viel zählen, und niemand versteht es besser, solche halbwüchsigen Heldentaten mit Humor zu nehmen als Endler selbst. Doch um die Wegstrecke zu ermessen, die Endler brauchte, um zu seinem Ton zu finden, müßte man sie da nicht doch kennen? „Anderswo treibt man Kanäle ins Land, / Verse wie Spaten, / Du aber hebst drei Körner Sand / und siehst sie fallen“ – auch das, den frühesten Versuch, mit Versen zu sandeln, müssen wir jetzt woanders suchen. Das Bitterste aber – der gesammelte Endler ist nun ohne „Papiermühle, Wasserwerk, Henkel, / Dreieck, in dem ich wohne, / Gelände der Kindheit“: Das ist, als hätte man sich ein Denkmal gesetzt und gleich von vorneherein die Nase abgeschlagen (die kindisch-gescheite „Ode auf eine vernachlässigte Sportart“ kann da auch nicht ganz darüberhinwegtrösten.)
Natürlich, die summa poetica könnte nicht würdiger beginnen als mit der „Brennessel“, dem „Sandkorn“, dem, „Sirren“, und vielleicht kommen jetzt die Meisterstücke der Endlerschen „Zähl-art“ (J. Engler) „Das Lied vom Fleiß“, „Läusesuchen“ und der „Schneemann“ – an ihr wohlverdientes größeres Publikum. Auf daß einem mißgnädigen Schicksal – das Endler, dem knorrig bedeutenden Versegaukler, die Lesergunst stahl vermittels eines talentierten Prosaisten namens Endler – ein Schnippchen geschlagen werde.
Wer schon seit je den einen A. E. nicht gegen den anderen aufwiegen wollte, dem schenkt der Sammelband nicht nur Wiedersehensfreude mit Dingen, ohne die die Geschichte der DDR-Lyrik (und nicht nur sie) nicht geschrieben werden kann (oder darf). Der letzte Part des Buches, enthaltend die Werke, die nach dem Exodus der DDR entstanden und, wenn überhaupt, nur in Zeitschriften gedruckt wurden, strotzt vor surrealem Elan: Die Lust an Assoziation, Ulk (nachgerade das Gegenteil von „comedy“), an Wortverdrehung und Dingverschraubung ist jetzt dominierend geworden, nur daß ein Abgesang auf die Poesie und ein bißehen (nur ein bißchen) auch aufs Leben den anderen jagt:
Ja, Schluß mit der Dichtkunst,
Schluß mit dem lyrischen Krampf!
[…] Stattdessen Windmühlen, niedlich
basteln und Eisenbahnbrücklein
Eine regelrechte Limerick-Poetik des Abgesanges formiert sich da – mit dem brillant-komischen „Resumé“ als Kronkorken obendrauf.
Dem fortgeschrittenen Leser hat Endler ein paar Sternchenthemen in seine summa einkomponiert: Das leichtgewichtige „Absage“ – „Rosa und Beige kommen wieder in Mode? / Wie ich Euch hasse mit Hirn und mit Hode!“ – lesen wir anders, jetzt, wo es dem Gedicht „Abenteuerbuch“ gegenübersteht, dem abenteuerlichen Ritt auf dem Rücken des Wortes „grün“, das von jeder Zeile zur nächsten Gesicht und Partner wechselt. Nicht daß es an sich übermäßig gewichtig würde in dieser Gegenüberstellung, doch verstehen wir nun: Die zwei so nebenbei gesponnenen Verse sind Fäden des Ganzen, dünne Fäden vielleicht, doch keine überflüssigen im fleckigen Riesenknäuellebenswerk des Adolf Endler. Das Blechtrommel-Sandkorn, das im gleichnamigen Gedicht auch schon einmal verlorenging – „Das Sandkorn (siehe oben)“ fügt der Dichter ein und holt es zurück –, taucht nun, in der wohlabgewogenen Anordnung dieses Buches, im übernächsten Gedicht („Der Geräuschemacher“) plötzlich ein weiteres Mal auf:
Der Hund, […]
der jede Nacht uns quält mit harschen oder süßen
Geräuschen (Sandkorn, trippelnd, Holz, das kreischt und lacht)
Und ganz am Ende des ersten Teiles wettert der Dichter gegen einen bösen Geist:
Du wirst mich lachen hörn durch tausend Decken
ich sieb dich aus dem Sand als Faust die Bö
Man blättert zurück und findet einen koboldhaften „Geräuschemacher“ von 1967, der das Heim des Poeten rupft und schüttelt; dann blättert man einige Seiten vor, man ist im Jahr 1972, aus dem Kobold ist eine „Foltermaske“ geworden – und ist froh, auf der gegenüberliegenden Seite eine Eichendorffsche „Dämmerung“ vorzufinden, wohlgereimt, vier Verse je Strophe, wie es sich gehört. Doch in Vers 7 geht es auch hier wieder ins Dunkel eines Kellers – Endlers summa ist kein Buch zum Durchlesen. Man muß durchhüpfen in Rösselsprüngen, deren Mechanismus man nicht versteht. Es ist ein Irrgarten, aber was für einer. Undurchschaubar wie die Poesie selbst.
Sebastian Kiefer, neue deutsche literatur, Heft 529, Januar/Februar 2000
Was wird hier gespielt?
Die in Der Pudding der Apokalypse versammelten Gedichte Adolf Endlers haben mir aus vielen Gründen viel Freude gemacht, einer liegt mir besonders am Herzen.
„Die subjektivste der drei Gattungen der Dichtung; unmittelbare Gestaltung innerseelischer Vorgänge im Dichter“ – so definiert Gero von Wilpert in seinem Sachwörterbuch der Literatur das Stichwort Lyrik.
„Warum kommt es uns manchmal so vor, als hafte der ganzen Sache, der Lyrik etwas Trübes, Zähes, Dumpfes, Muffiges an?“ fragt Hans Magnus Enzensberger im Vorwort seiner Anthologie Das Wasserzeichen der Poesie und fährt fort: „Aber war da nicht irgendwann irgendwo was Anderes? Ein Lufthauch? Eine Verführung? Ein Versprechen? Ein freies Feld? Ein Spiel?“
Adolf Endlers Sammlung seiner „Gedichte 1963–1998“ enthält all das, was Enzensberger als vergangen betrauert, ja mehr noch: nicht nur Spiel, sondern auch – nicht immer, aber immer wieder – Unterhaltung, ja Belustigung.
Wer da spielt? Selbstredend der Dichter. Womit? Natürlich mit der Sprache.
Gegen wen? Gegen die Sprache und sich selber. Zu wessen Unterhaltung? Vorerst zur eigenen, sodann, wenn das Spiel funktioniert, auch zu der des Lesers.
Zum Spiel gehört die Regel, und um deren Ansehen steht es in einer Zeit, die dem erweiterten Kunstbegriff huldigt, nicht gut.
Regel wird einerseits gern mit Beschränkung, ja Beschränktheit und unpersönlichem Zwang gleichgesetzt, andererseits gilt sie als starr, leblos, wenn nicht tot. Auf jeden Fall ist sie streng, rigide und unerbittlich, ein Korsett, das dem, der sie befolgt, abverlangt, sich ihr sklavisch zu unterwerfen – eigentlich ein Wunder, daß diesem Repressionssystem trotz der im Grundgesetz verankerten Freiheit der Kunst noch nicht der juristische Garaus gemacht worden ist…
Dem milderen Blick manches Lyrikliebhabers mag sich die Regel weniger totalitär darstellen. Er wird die Tatsache, daß da jemand noch reimt, Strophen metrisch strukturiert oder tradierte Gedichtformen nutzt, mit höflichem Interesse konstatieren, ihr vielleicht sogar applaudieren: Chapeau!
Regelrechte Terzinen! Oder was der Reimeschmied noch so alles auf der Pfanne hat: regelrechte Stanzen! Ein regelrechtes Sonett!
Mit all dem kann und will Adolf Endler nicht dienen. Statt sich überkommenen Regeln zu fügen, und das auch noch sklavisch, ist er so frei, selber Regeln zu erfinden und im Gedicht, meist nur in einem einzigen, zu erproben.
Im „Lied vom Fleiß“ führt Endler auf exemplarische Weise vor, wie diese Art Regelerfindung und Regelerfüllung das Gedicht provoziert und produziert:
Laßt mich allein nun! Endlich laßt michs singen
Das Lied vom Fleiße, das ich singen will.
Einhundert Zeilen will mein Fleiß erzwingen
Und fünfzig Doppelreime. Also still!
Wir schreiben das Jahr 1972. Endler lebt und dichtet im Arbeiter- und Bauernstaat. Doch der Dichter übertrifft all die Helden der Arbeit:
Der ich nicht Wochen-, Monatslohn empfange,
Ich übertreffe alle! Freunde, geht,
Ein Hymnus, lang wie eine Bohnenstange
Und spannend wie ein Defa-Film entsteht!
Immer wieder vergewissert sich der Fleißige seiner Fortschritte, zeilenweise ist dieses Fortschreiten auch schon alles, was er zu sagen hat:
Die Zeile einundvierzig ist errungen!
Die Zeile zweiundvierzig liegt schon vor!
Die Zeile dreiundvierzig wird gesungen!
Die Zeile vierundvierzig summt ums Ohr!
Und so fortan. Der Dichtermann Endler hält sein Dichterwort:
Die siebnundneunzig! Stolz verwundert
Seh ich das Lied auf meinem Fleiß gereift.
Hier ist der Gipfel, hier die Zeile hundert:
– „Gebt mir den Strick da, doch gut eingeseift!“
Neues Spiel, neues Glück. Dem Gedicht „Abenteuerbuch“ hat Endler einen Satz von Federico García Lorca vorangestellt, der zugleich die Regel errichtet:
Grün, wie ich dich liebe, Grün.
Die einsame Spur in der endlos grünen Savanne
Das Grün auf das wir dann endlich wie wahnsinnig schossen
Im Herzen der grünen Hölle die Lastwagenpanne
– durchgehendes „Grün“ also ist angesagt, auch wenn Endler es nicht immer hinschreibt, sondern vom Leser mitdenken läßt –
Der Pfefferminzlikör als Letztes runtergegossen
Das seltsame Grün von dem Konsul Meyer berichtet
Das Diamantengrün das Graugrün des Elefanten
Der grüne Mantel auf dem Amazonas gesichtet
– und wieder überläßt es Endler dem Leser, das Spiel mitzuspielen und das zum Loden gehörige „Grün“ zu imaginieren:
Ein alter Lodenmantel wie wir deutlich erkannten
– so weit acht von insgesamt zwanzig grüngetränkten Zeilen, die gut und gern ebenso viele Abenteuerbücher aufwiegen: das Gedicht verdichtet.
Aller guten Spiele sind drei, und diesmal nennt Endler im Gedichttitel sogar seinen Spielpartner: „Für Edgar“. Aber natürlich kann, ja muß jeder Leser mitspielen, sobald ihm Endlers Vorgabe eingeleuchtet hat, jedem Menschen sei eine schicksalhafte Silbe zugeteilt, dem Edgar beispielsweise – aber hören wir den Dichter:
Geheime Schicksalssilbe RI, wen macht sie wild?
Wer, wenn er solch ein RI hört, schwankt, ja, wirkt zerknittert?
Jetzt wißt Ihr: Edgar Schmoll! (Ich hab mirs eingedRIllt!)
Die meine lautet… Daß es Edgar nur nie wittert!
Das walte Gott! Denn wer im Besitz der Geheimsilbe des anderen ist, hat den praktisch in der Hand:
RI ist die Silbe Edgars, meint nicht Hinz und Kunz,
Hört er ein RI, muß er sogleich erschütternd niesen,
Falls ihm nichts Schwärzres dank der Silbe widerfährt,
Ein Herzinfarkt vielleicht, Koliken –
Und kaltblütig beginnt der Dichter damit, seine RIs auf den Wehrlosen zu feuern: „RIalto, RImini, RIenzi – tut das gut!“ – also mehr davon: „RInaldo RInaldini! RItter! RIngelnatz!“ werden ins Feld geführt, vor „REvival“ wird nicht zurückgeschreckt, Edgar zeigt Wirkung:
Ich bin gespannt – oh RIeselfeld, URIn, verRInnend! –,
Ob er, Ihr Tod, RIgid kommt, RÜstig… RIdi-kühl?
(Noch dutzendweise RIs halt ich für Sie in petto!)
Wird Ihnen, Edgar, nicht bei RÜbezahl schon schwül?
Wie dann erst beim „RIng von RIchard Wagner“, der angeblich in „RIo de Janeiro“ auf dem Spielplan steht oder gar bei der „RIngeRInnenRIege“ – so um die Zeile 40 kommt Endler in die Gänge, um die Zeile 50 in Fahrt und bei Zeile 60 ins Schleudern:
RI in Radieschen – nein, nun dies gerade nicht!
Erst bei Zeile 70 kommt der Dichter mit kreischenden Bremsen zum Stehen:
Ein Verslein mehr des Werks hier –
Edgar brach zusammen!
Spiel-Ende, doch der animierte Leserkopf kommt nicht so rasch zur Ruhe: PRIma Schiene! Wie kam der Dichter auf den TRIchter?
„Für Edgar“ findet sich in einem Zyklus, welcher „Aus den Heften des Irren Fürsten M.“ überschrieben ist. Der sei „einem Tiefpunkt meiner Existenz gedankt“, merkt Endler an, „Gedichte, in denen mit der Gefahr des Absturzes ins Irre-Sein wohl nicht nur kokettiert wird. (Oh, die wahnwitzige Vielzahl der Reime!)“
Der Spieler nämlich ist nur eine der vielen Rollen, die der Dichter Endler im Laufe der letzten 35 Jahre verkörpert und in seinem Buch versammelt hat.
1971, ein Jahr vor dem 100-Zeilen-Fleiß-Gedicht, schrieb der häufig und gern Ausschweifende ein regelrechtes Epigramm, den so einprägsamen wie lebenswahren Zweizeiler „Der Unbequeme“:
Daß man ihn endlich aus dem Land rausschlage
Auf jede Antwort weiß das Schwein die Frage
Im Nachwort bezeichnet sich Endler als „eine der verwachsensten Gurken der neuen Poesie“. Da kann der Lyrikwart nur zweifelnd den Kopf schütteln: Müßte es nicht „eine der erwachsensten Gurken“ heißen?
Robert Gernhardt, Die Zeit, 30.3.2000
Weitere Beiträge zu diesem Buch:
Frauke Meyer-Gosau: Eine Kopfnutz in Gold
die tageszeitung, 24.9.1999
Michael Braun: An den Rand des „Hustler“ gekritzelt
Freitag, 8.10.1999
Hannes Schwenger: Tabus? Wat denn, wat denn
Die Welt, 6.11.1999
Kurt Oesterle: Adolf Endlers Expedition ins Land der Enttäuschung
Süddeutsche Zeitung, 9.12.1999
Jürgen Verdofsky: Goldstaub aus Geheimnisverrat
Stuttgarter Zeitung, 11.2.2000
Harald Kiesel: Schwarzhumorig
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 3.3.2000
Doris Meierhenrich: Das Schwein weiß die Frage
Der Tagesspiegel, Berlin, 24.4.2000
Zerbeult, himmelwärts
− Laudatio zur Verleihung des Peter-Huchel-Preises an Adolf Endler. –
„Meine ganze Welt ist kantig, / und die Bäume sind verrückt. / Sage Wilhelm, sage Sauhirt, / warum gehst du so gebückt.“. Als ich vor einiger Zeit auf diese Zeilen von Paul Scheerbart stieß, mußte ich an jenen Moment in einer schneeklaren Dezembernacht des Jahres 1989 denken, als Adolf Endler am Connewitzer Kreuz in Leipzig im Reden innehielt, nach oben blickte und lapidar bemerkte, da wäre nichts, aber auch gar nichts mehr dazwischen. Der gestirnte Sternenhimmel über uns war der gestirnte Sternenhimmel über uns. Leergeräumt. Das konnte jemand sagen, der Jahrzehnte gelernt hatte, diesen Auf-Blick auszuhalten. Der seine Schichtenflotz-Welt dagegen gekantet hatte und eingeladen, in den verrückten Bäumen andere Bewegungsarten zu probieren.
Mit dem Peter Huchel Preis wird der herausragende Gedichtband des letzten Jahres geehrt; in diesem Jahr gebührt der Preis einer Auswahl aus dem lyrischen Schaffen aus 35 Jahren, einer Spanne, die die Hälfte gelebten Lebens umfaßt, und er gebührt einem Dichter, dessen Rang in der europäischen Literatur inzwischen kaum noch zu bestreiten ist. Es ist ein Auswahlband, der nach strengen Gültigkeitskriterien zusammengestellt wurde, und Adolf Endler wäre nicht Endler, hätte er nicht Auskunft über die Gründe des Aussparung des nicht unbeträchtlichen Verswerkes bis zum 35. Lebensjahr gegeben. Die die zum Teil harrschen Selbstzensuren: „Zeugnis eines teils großfressigen, teils versonnenen Junglyrikers“ (zu „Kinder der Nibelungen“), „knäbische Agitpropgedichte“ („Erwacht ohne Furcht“), sie entspringen ästhetischen Erwägungen, die in einer „Erklärenden Notiz“ einleuchtend begründet werden. Es gehörte stets zum Faszinosum der Endlerschen Essays, daß sie bei aller politischen Verve auf wirkungsgerichtete Maßgaben dessen pochen, was die Gelungenheit eines Gedichtes bestimmt: daß es eingefahrene Sehweisen durchstört, daß es die sprachlich stringente Berührung von Ungeahntem kundgibt. Um so größer war denn doch die Überraschung, in einem bereits 1952/53 geschriebenen, freilich erst in der Materialiensammlung „Krawarnewall“ publizierten Gedicht ganz und gar schon die Ingridenzien zu entdecken, die das Endlereske ausmachen: „Traumsplitter“. Die Vorliebe für schrille Lautballungen, die scharfen Endreimschläge, die in Gleisslicht getauchte Szenerie, die Wortketten der Beschädigung und Verletzung, die Starkverben schneller Bewegtheit, die Brüche, die Aussparungen, die Restbilder blühender Sehnsucht, der – mit Bachtin – groteske Realismus – alles da. Nach seiner Übersiedelung in die „kunstfreundlichere“ DDR 1955, dem gehöriger Ärger mit dem westdeutschen Verfassungsschutz vorausgegangen war, konnte dieser Ansatz wohl eine Weile überlegt werden mit freundlicheren Bildern aus – ehe sie zugestellt wurde – vorgestellter Gesellschaftsvision und eingekernt in den Zeitbündnissen… Traditionen, ehe er ihn einem weiteren Desillusionierungsschub überantwortete: das nach Endlers Auskunft erste Gedicht, das seinen poetologischen Kern aus dem Hoffens-Schlick befreite, war „Einem ungebrochenen Rezensenten“ – Es signalisierte ja nicht nur Verbundenheitssignale mit den Dichterfreunden und -freundinnen in der Ahnung weiterer Zernichtungseinbrüche, sondern geht darüber hinaus: Sind die ersten Zeilen durchaus noch verwandt der sanften Polemik etwa des Rainer Kirsch, so reißt die letzte Verszeile nun in der Tat eine existentielle Dimension auf, die über die in dieser Zeit in der jüngeren DDR-Lyrik üblichen Denk- und Verständigungekategorien hinauswies. Die letzte direkte Kontaktnahme mit einigen der angesprochenen Spezies von Rezensenten fand zehn Jahre später statt, nachdem Endler zuvor einen Großteil der DDR-Literaturwissenschaft mit einer Gouvernante verglichen hatte, die den blühenden Garten der Poesie beschimpft. Im April 1973 fand in Berlin beim Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, o Genitiv, ein Kolloquium unter dem etwas hochtrabenden Titel „Welt im sozialistischen Gedicht“ statt, zu der, es war die kurze Spanne der Liberalisierung, auch Adolf Endler geladen war. Die Adressaten „Einiger Randbemerkungen, einiger Binsenweisheiten“ saßen also im Saale, als Endler ihnen nach Verweisen auf Gedichte von Vallejo, Halas, zu verstehen gab: „Hört man sie nicht, die Stimmen derer, die das widerspruchsvolle Leben der Poesie zurechtschneiden wollen und dabei immer das Herz der Poesie zerschneiden?“. Es sei deshalb an die etwas untypische Rede vom „Herz der Poesie“ erinnert, weil dieser Kompaß der Leidenschaft verbündet war und ist, mit der Endler bedeutende und oft genug marginalisierte Dichtung gegen die Abschnittsbevollmächtigten der DDR-Literaturpolizei wie auch gegen die konjunkturellen In-aut-Listenverwalter verteidigte. Die Lyrikdebatten der sechziger und frühen siebziger Jahre hatten jedenfalls in Endler einen ihrer couragiertesten Kombattanten gefunden; die Folgen sind bekannt: Was in der „Düsteren Legende von Karl Mickel“ – im Pudding der Apokalypse mit ausführlicherer Anmerkung zu den kulturpolitischen Hintergründen bedacht – den Mitstreiter der maßstabsetzenden Anthologie In diesem besseren Land (1966) und nunmehr „Heros düsterer Ballade“ ereilt, war kaum weniger auf Endler selber gemünzt:
Ob mit Eheringen, güldnen, ob mit Beilen
Zielten sie auf was man lustvoll schiebt.
(Drei Doktoren gründlich tilgen Mickels Zeilen,
Bis es keine auf der ganzen Welt mehr gibt.)
Eisig nunmehr, Heros düsterer Ballade,
Er skandierte: Each man kills the thing he loves.
Und sie taten es und schnürten ihn zum Rade.
Konnte keiner Englisch in dem Rund des Kaffs?
Dieses Gedicht gehört ebenso wie die programmatische „Brennessel“, das ultimative „Lied vom Fleiß“ oder das titelgebende „Sandkorn“ zu den mittlerweile Klassischen Endler-Texten und zum unhintergehbaren Fundus der DDR-Lyrik. Sie konnten erst 1974 erscheinen – und avancierten unter damals Jugendlichen zum Erkennungszeichen. Nein, als „umfassende feindliche Stellungnahme in Lyrikform“, wie ein ganz geheimer Kritiker 1980 gut acht&bann-mäßig befand, habe ich den Band damals wohl wirklich nicht gelesen, aber die weiland angestrichenen Stellen waren doch schon so etwas wie Signalwörter. In diesem Band nun ist die mäandrierende inhärente Ästhetik, flankiert durch Schutzumschlagauskünfte, gleichsam an einigen Oberflächen freigekratzt, während gleichzeitig ermuntert wird, den Mut für „Ausflüge in die Exorbitanz“ (Karl-Otto Burger) aufzubringen. Diesem Prinzip des „Hakenschlagens durch die literarische Landschaft“ ist Endler im übrigen bis heute treu geblieben, will heißen: Es waltet ein untergründiger Ehrgeiz, für jedwede normative Ästhetik ungreifbar zu sein. In den sechziger Jahren raffiniert der Lyriker die Methode, Ideologie über Zitatcollagen und Hyperbeln zu destruieren. Gegen die eingeforderte „Himmelstapezierer“-Panegyrik setzt eine Gegenwelt des Berliner Hinterhof- und Kneipenmilieus, bevölkert mit Dachdecker Peschel, den „stets Geduckten, ewig Zuckersüßen“, die „Wirtin vom Feuchten Eck“, faschistoiden Hauswarten, Kiezköniginnen und -königen. Auch keine sozialromantische Attitüde, wenn: aus seinen Gedichten die Salpeterwände atmen: „Wenn der Dichter Endler seinen Kopf zum Fenster rausstreckt, / Sieht er nach, ob die Müllkübel leer sind“ endigt Elke Erb das Poträtgedicht „Die Dichter wohnen in den Jahrhunderten“ und Dauerthema bis in die achtziger Jahre ist der Horror, eine menschenwürdige Wohnung zu finden. Dieser Hinterhofkosmos – durchaus korrespondierend mit dem Ofenall Uwe Gressmanns −, er wird besetzt von kichernden, fiependen, bellenden, grunzenden Geräuschen, als Leitlautung tönt, schrillt, kichert, irrlichterhaft ein Lachen Rabelaisscher und Chlebnikowscher Abkunft, das sich zum Hohnlachen steigert. Diese unverschämte Körperlichkeit, gewiß, sie wirft die Sinnlichkeit gegen die Instrumentierung von Körpermetaphern: „Nicht seit zwei Planjahrfünften – gelt, Bello? – den Herzschlag der Menschen verhört!“ (aus: „Prognostische Selbstverpflichtung“), sie stellt aber vorzugsweise Versehrung aus: „abgeschnittene Zunge“, das „blutige Lachen“, „Gesicht, von Gluten aufgerissen und zersägt“, „Die Augenhöhle wie die Lippe roh zerschlissen“ – lange bevor in den achtziger Jahren die eher narzißtisch besetzten „Körperdiskurse“ Mode wurden, zentrieren viele Gedichte die Verletzbarkeit des Körpers. All dies ist zusammengestichelt durch schier unglaubliche Reimketten, vernäht mit Polemikspitzen und intertextuellen Fäden zu Nahverwandten wie Paul Gurk und Schwitters oder zu Günter Bruno Fuchs. Dessen SECHSZEILENGEDICHT:
Dies ist die erste Zeile.
Mit der zweiten beginnt mein Gedicht zu wachsen.
Wenn ich so weitermache, komme ich bald an den Schluß.
Die vierte Zeile hilft mir dabei. (Schönen Dank, vierte Zeile!)
Der Gerichtsvollzieher, sage ich noch, trägt seine Eier ins Kuckucksnest.
So, ich habe meine Arbeit getan und lege mich schlafen.
Was bei Fuchs noch als eher nette Arabeske daherkommt, wächst sich bei Endler im berühmten „Lied vom Fleiß“ zu einer monströsen Farce aus. 100 Zeilen verstechnisch perfekte Zeilenschinderei, an deren Ende der Tod steht:
Stolz verwundert
Seh ich das Lied auf meinen Fleiß gereift.
Hier ist der Gipfel, hier die Zeile hundert:
– Gebt mir den Strick da, doch gut eingeseift!
„ich opponiere indessen gegen diese ständig zur Erstarrung und Abtötung des Lebens strebende Welt“, sagt eine Selbstauskunft. Und Mickel in seinem frühen, 1962 geschriebenen „Porträt A.E.“:
Der kann lachen und weinen
Laßt auch uns nicht versteinen.
Deshalb verhackstückte Ideologiefragmente, die in neuer Montierung jenen Tanguyischen Maschinen gleichen, die sinnlos und reizvoll die Mechanik der Arbeit simulieren. Im Grunde ist den meisten Gedichte Endlers eine Verve eingeschrieben gegen die depravierende Enteignung menschlicher Schöpferkraft in den funktionalen Zurichtungen einseitiger Arbeit: „Das Lied vom Fleiß“ weiß davon ebenso ein garstig Lied zu krächzen wie die „Wiedererweckung“. An dieser Stelle will ich es mir nicht verbieten, jene wundervolle Liebeserklärung Wolfgang Hilbigs zu zitieren, die dem Endlerschen Lebendigungs-Gelächter auf den Grund geht:
Jedes Mal, wenn man etwas von Dir liest, glaubt man, man müsse sich augenblicklich totlachen. Doch dann merkt man plötzlich, daß man schon tot war, und daß man sich wieder lebendig gelacht hat.
Es ist freilich ein Lachen, das den tödlichen Unterboden nicht verleugnet: „Das Lachen, diese prachtvolle, ja geradezu lasterhafte Verschwendung, der der Mensch fähig ist, grenzt an das Nichts, gibt uns das Nichts als Unterpfand.“ (so der Oberkommandierende Gefreite André Breton in der Anthologie des Schwarzen Humors).
1976 zählt Endler zu den Erstunterzeichnern der Biermann-Petition, in die kulturpolitische Eiszeit hinein wird der Autor als Mitverfasser eines Protestbriefes an Honecker 1979 aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Es entwickelt sich in der DDR ein von den staatlichen Institutionen weitgehend unabhängiges Literaturtableau, in dem Adolf Endler und Elke Erb eine Mentorfunktion übernehmen. Jedenfalls hatte sich der Wunsch Helmut Heißenbüttels aus dem Jahre 1983, es möge sich „eines Tages eine Endlergemeinde bilden“, bereits zu diesem Zeitpunkt erfüllt. Im jüngst erschienenen Band Durchgangszimmer Prenzlauer Berg ist nachzulesen, welch nachgerade enthusiastisches Echo die Wohnzimmerlesungen erfuhren. „An ein paar Lesungen kann ich mich erinnern“, berichtet Barbara Fessmann. „Die allerschönste war die mit Adolf Endler bei Heiner Sylvester in der Dunckerstraße. Ich hatte Endler bis dahin live noch nicht erlebt, kannte nur ein paar Gedichte von ihm, mit denen ich allerdings nicht viel anfangen konnte. Das war mir damals peinlich, weil alle so von ihm schwärmten. Und dann las er dort seine Sachen vor, so lebendig und so witzig! Ich amüsierte mich köstlich und bekam endlich zu seinen Texten Zugang.“ Unvergeßlich für mich eine Lesung im Klubhaus in der Leipziger Steinstraße: Eigentlich sollte Bert Papenfuß lesen, nur war dessen Lesung verboten worden. Adolf Endler sprang kurzentschlossen ein und baute in einen seiner phantasmagorischen Devils Lake – Berichte aus dem Jahre 2010 eine Fernsehsendung ein, die das Jugendwerk des berühmten Dichters vorstellte. Es folgte eine Lesung Papenfußscher Texte, während der inkrimminierte Autor feixend in der ersten Reihe saß. Ich erwähne diese Episode vor allem deshalb, weil sie ein Schlaglicht wirft auf den unbedingten Einsatz von Brigitte und Adolf für junge Autoren, für die Ermutigungen: Die auch mal Rippenstöße sein konnten, die bspw. bei mir, der ich zwischen Universität und „Szene“ pendelte, zumindest einige Feigheiten bekämpfen halfen. Die Erinnerungsfragmente deuten an, daß die Fülle des alltäglich erlebten Absurden in den achtziger Jahren mehr und mehr in die Prosa floß, ein wucherndes Werk von Fachsprachen, Funktions- und Funktionärs-Grammatiken, Hinterhofdialogen und Kaderwelsch, Romanexposés und Dramolettes mit verschiedenen Spaltungsfiguren: Bobbi Bumke Bergermann, Robert F. Kellerman, Robert Bubi Blazezak, und und und. Doch auch die Lyrik begann mehr und mehr phantasmagorisch zu wuchern in der Steigerungsform Schwarzen Humor Bretonscher Provenienz: schwärzester schwarzer Humor, Stakkati und Blitzbildgewitter, „fratzenhafte Gedichte“, in denen wir die Fratzen dieses Jahrhunderts erblicken, nachdem die die man mit „Moderne“ verharmlost. „Seien wir brüderlich zueinander…“ Es entstehen Gedichte, in denen „mit der Gefahr des Absturzes ins Irre-Sein wohl nicht nur kokettiert wird.“ Wenn z.B. „Das Sandkorn“ noch in alexandrinischer Stringenz das Gemeinwesen durchsetzt, sind sie im Plural Jahre später eher zersetzende Partikel, schutzarm imaginär und tödlich vor allem:
ich schließ meine augen
ich schließ mich tief ein
unter mein lid meine wimper
sandkörner fallen verbrannt
über fuß über wange und hand
tödlicher sand
Oder: „Mit Howhannes Thumerjan“:
In Sommers Mittagsglut mein Herz Gefallen
Am Boden ich Mein Ziel verlor ich Jüngst
Mein Täglichbrot Zerwürfnis Hohn Verleumdung
Nicht schmäh ich länger das Exil das süße
Die „Hefte des irren Fürste“ wie auch zerspleißende Texte wie „Schwarzwolkpruetsch“, die Bedeutungszuweisen im Wortansatz bereits stören, sind wohl auch deshalb als Dokumente der Verstörung zu lesen, weil der Autor diese weitere Radikalisierung der Materialerhitzung nicht mehr traditionell-avantgardistisch als Weiterschreiten apostrophieren konnte. Wenn er etwa Georg Heyms „Deine Wimpern, die langen“ ummodelt in „Deine Blicke, die langen, / Rührn mit riesigen Stangen / Zoll für Zoll, Zoll für Zoll / Hier das Menschengewimmel, / Erster Koch Du im Himmel!“, dann beginnen waghalsige Balanceakte ins Ungesicherte, Erfahrungs-Verrrückung ins Extrem zu dehnen: Schuberts Winterreise und „ein übereitriger frühzeitig geafterter Seesack im wirbelnden Schnee“, wie soll das zusammengehen: Es geht zusammen in einer Versart, die restromantische Zitatpanzerungen und/oder das Formgestänge lyrischer Genres von Ghaseel bis Sonett mit Menschlichem, Allzumenschlichem verfußt – und dabei das hervortreibt, was Bataille das „obszöne Werk“ genannt hat: In einer Schlicksprache, die die glatten Oberflächen gesellschaftlicher Konvention, nun ja, porentief verschnmutzt. Anders als in der postmodernen Spaßkultur, nach Alexander Kluge der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, thematisiert Endler dabei immer noch die Fallhöhe: zum Plafond ehemaliger Hoffnungen ebenso wie zum Fond der Dichtungstradition. Die Destruktion phraseologischer Erkennungscodes wird nun ins Aberwitzige getrieben: „Die Zipfelmütze im Panzerschrank der Geschichte pendelt und stinkt, Kamerad!, hinkt wie von abgespreizter Ginster-Hand heimlich gezinkt, Kamerad!; der aus dem toten Winkel heraus nur noch mündlich gezipfelte Pendelschlag des Panzerschranks der Geschichte.“ „endlich kippt das alles kreischend ins Wüste und Kaputte um und sticht zerbeult sternenwärts“, bringt es E. auf den Punkt. Und auch der scheinbare Überhebungssatz „Wahrscheinlich bin ich der Erfinder der DDR.“ gewinnt Plausibilität, wenn man sich anschaut, wie die Texte als genaue Lagekorrelate, pralle Konstrukte und lyrische Polyedergebilde zugleich funktionieren. Ausdruck einer Freiheit, den Focus des Kalten Krieges neu zu vermessen.und die Derivate einer Ästhetik des Guten, Wahren, Schönen hineinzumontieren. Und in dieser Schrägsicht von außen-unten bringen sich die Texte ins Ultra-Täterätä und Ultra-Bimbam ins größere Deutschland ein:
Die DDR war für mich schon lange… sowas wie die Absurdität der Welt in der Nußschale. Vielleicht habe ich da die Bedeutung der DDR überschätzt. Die Absurdität der Welt ist natürlich geblieben, auch wenn die Nußschale geplatzt ist.
Deshalb auch kein Ausweg „Schluß mit der Dichtkunst, / Schluß mit dem lyrischen Krampf!“ O nein, auf ein „fadenscheiniges Protesvergißmeinnicht, fiepend; / und mit grinsend verblühender Pfote“ – dürfen wir uns weiterhin gefaßt machen. – „Hörts nie auf das Kreischen und Brechen?“
Peter Geist, neue deutsche literatur, Heft 5, 2000
Mitschnitt der Preisverleihung des Peter-Huchel-Preises vom 3.4.2000
Hundert Sätze über Adolf Endler
Paßt der Pate des Preises zum Preisträger? Rudolf Alexander Schröder schreibt, immerhin leicht indigniert, vom „Hang“ seines Vaters „zu skurriler Komik“. Auch berichtet der Dichter, der als sein gelungenstes Werk einmal den Speisesaal des Ozeandampfers Bremen nannte und im Ersten Weltkrieg als Zensor wirkte, in seiner Kindheit habe die Hausnäherin Johanne Thiessen gern „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ gesungen.
Der Bremer Literaturwissenschaftler Wolfgang Emmerich, Autor der gültigen Literaturgeschichte der DDR, nennt Adolf Endler einen „der wichtigsten Lyriker der DDR“. „Endlers Witz und Heiterkeit“, schreibt Wolfgang Emmerich, „sind einer ebensogroßen Trauer und einem nicht geringen Zorn darüber abgewonnen, daß das System DDR den erträumten Lebensentwurf aus einer Offizialität ins gesellschaflliche Off vertrieben hat.“
In der historisch-kritischen Hölderlin-Ausgabe des Bremers Dietrich E. Sattler findet sich im „Odenfaszikel I“ Hölderlins Satz: „Vortreffliche Menschen müssen wohl auch wissen, daß sie es sind…“.
Der Name, die Namen: er heißt Adolf Edmond Endler, auch Edmond Amay, Trudka Rumburg, Bubi Blazezak, Bobbi „Bumke“ Bergermann und sein Traum wäre „Band-Leader einer Swing Bigband unter Leitung von Eddy Carrera“ zu sein. „Adolf“ könnte bei dem gelernten Katholiken Endler leichter von Adolf Kolping, dem Vater der wandernden Handwerksgesellen, kommen, als von Adolf H. – der ergriff erst drei Jahre nach Adolf Endlers Geburt die Macht.
Die Titel, hintereinander weg: Erwacht ohne Furcht, Die Kinder der Nibelungen, Weg in die Wische, In diesem besseren Land, Georgische Poesie aus acht Jahrhunderten (zusammen mit Rainer Kirsch), Das Sandkorn, Nackt mit Brille, Zwei Versuche, über Georgien zu erzählen, Verwirrte klare Botschaften, Nadelkissen, Neue Nachrichten vom ,Nebbich‘, Akte Endler, Bubi Blazezaks gedenkend, Ohne Nennung von Gründen, Schichtenflotz, Vorbildlich schleimlösend – Nachrichten aus einer Hauptstadt 1972–2008, Den Tiger reiten, Citatteria und Zackendulst, Tarzan am Prenzlauer Berg, Die Antwort des Poeten, Die Exzesse Bub Blazezaks im Fokus des Kalten Krieges, Warnung vor Utah, Der Pudding der Apokalypse.
Die Verlage, hintereinander weg: Mitteldeutscher Verlag, Volk und Welt / Kultur und Fortschritt, Wagenbach, Rowohlt, Walter, Reclam, Rotbuch, Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstraße, Kiepenheuer, Suhrkamp.
Ein Viertelhundert Bücher in zehn Verlagen.
Chronist seines Lebens
Im Prolog von Die Kinder der Nibelungen, 1964 erschienen, schreibt der Autor, zweifellos sich selbst meinend:
ich schreib ruhlos, doch ruhig dieses wilde Stück Zeit / und mein Leben als Lesebuch…
Endler ist Chronist seines Lebens in seiner Zeit – dazu gehören: der Niederrhein, die Tiefflieger und die Kinderlandverschickung, der praktizierte Antifaschismus – Werbung für die Weltfestspiele der Jugend und Studenten – und die Restauration – Anklage wegen „Staatsgefährdung“, der deutsch-deutsche Umzug, das Meliorationsprojekt Wische, Arbeit als Transportarbeiter, am Kran, im Schwefel, das kurze schöne Gefühl, im besseren Deutschland angekommen zu sein, das Johannes-R.-Becher-Institut, die Enttäuschung, der fruchtbare Exkurs ins Georgische, die Wendung des Enttäuschten ins Aktive, erst ins grimmig Phantastische, dann ins Wörtlichnehmen – „Naja, die üblichen kühnen Entwürfe eben“ – so könnte Adolf Endler über die Titel seiner Bücher urteilen.
Was Adolf Endler ist: ein Feind der Verwalter, ein Bedroher der Bürokraten, ein Anti-Autoritärer In der DDR. Er ist der älteste der so genannten „mittleren Generation“, er gehört nicht eigentlich zur „Sächsischen Dichterschule“, ist aber mit diesen Dichterinnen und Dichtern befreundet, erklärt anderen ihr Tun, kritisiert und verteidigt es. Endler ist zudem ein vorzüglicher Selbstinterpret – seiner acht Seiten langen „Erklärenden Notiz“ im Pudding der Apokalypse kann man kaum etwas hinzufügen.
Das heißt aber auch: wie oft muß sich dieser Autor falsch beurteilt gefühlt haben in den Kritiken und Arbeiten über ihn. Obwohl: einen richtigen Verriss eines Endlerschen Buches – den gibt es bisher nicht.
Was Adolf Endler außerdem ist: erfahrener Teebereiter, langjähriger Raucher, erfolgreicher Pilzsammler. Oder, mehr literarisch: ein großer Übersetzer. Seine Autoren: Okudshawa, Jessenin, Tschikowani, Martynow, Tumanjan, Bashan, Davico, Block, Kavafis, Gerow, Petrarca. Unser Pech, wenn wir mit einigen der Namen kein Werk verbinden.
Endlers Glück: Nachdichtungen waren das Brot, der Adlershofer Wodka, die „Karo“-Zigaretten. Geld und Freude brachten die Theaterstücke für Kinder. Kein Geld, aber Ärger und Ansehen bei den einen und den anderen und manchmal beides zugleich bei denselben waren verbunden mit den Kritiken, mit den Polemiken, mit den Invektiven – solange sie gedruckt wurden.
Endler ist, sagt er, „schrill“, „höhnisch“, die „Krähe“ am Literaturhimmel, ein „Destruktions-Artist“. Er war früher Bewohner, kritischer Wächter, genauer Chronist des Prenzlauer Bergs. Adolf Endler erkennt sofort das Groteske einer Situation, er erkennt die Differenz zwischen Gewolltem, Gemeintem, Gesagtem, Getanem.
Endler will Ordnung bewahren im Durcheinander des Falschen, seine Ordnung. Er diszipliniert sich dabei immer wieder auch selbst, unterwirft sich eigenen Ordnungsrufen, spornt sich an, fleißig zu bleiben und zählt gern auf, wie fleißig er ist. 1700 Zeilen hat er 1969 in Georgien nachgedichtet – und wie! – darauf ist Adolf Endler stolz.
Dabei liebt er es, einfach zu schreiben, aufzuhören, wenn er denkt, es ist genug – ihr, meine Leserinnen und Leser habt mich verstanden, denkt euch selbst den Rest. Oder zögert er, ganz klar auszusprechen, was er meint? Ist da nicht diese Lust am Kichern, am Fratzenschneiden, am Irrlichtern? Ist da nicht dieses Nebeneinander von radikalem Ernst und bewußter Kalauerei, dieses extrafeine „Etepetete“ und der grelle, blanke Hohn? Muß man so werden als West-Ost-Gänger, als Dichter, der Stalin und Peter Altenberg einander begegnen lassen will, als Opfer einer immer krampfhafter sich aggressiv-albern gebärdenden DDR-Bürokratie?
Helmut Heissenbüttel schrieb:
Ich kenne kaum ein Werk der unmittelbaren Gegenwartsliteratur, das so genau und so wortökonomisch den Zustand umreißt, in dem wir leben, ohne etwas preiszugeben.
Endler – die Zahl der Bücher täuscht, es gibt eine lange Veröffentlichungslücke, nie bekam eines seiner opera in den DDR-Zeitungen und -Zeitschriften mehr als eine Verlegenheitsrezension – Endler ist notgedrungen Vorleser geworden, Kneipen- und Klubhaus-Besucher – dort hörte man ihm zu und diese Art Öffentlichkeit wirkte zurück, wenn der sorgfältige Studierer der DDR-Presse für seine Lieben Lesefrüchte sammelte, sie einander zuordnete, kommentierte.
Ein Liebhaber des Ausrufezeichens
Immer schreibt Endler auf jemanden zu, zu jemandem hin, vermeidet aber dabei Jargon und spitzfindige Anspielungen, geht nur einfach und sanft radikal vor, an die Wurzeln eben. Das Aggressive, das Hämische kommt dann von allein, wenn er wieder ein Wort in diesem DDR-Feuerwehrdeutsch erkannt hat, „volksliedhaftes Schaffen“ zum Beispiel.
Adolf Endler mag das Platte, das Mediokre von ganzem Herzen nicht, er riecht es und er verabscheut es. Er erkennt aber auch sofort das Richtige, das Wichtige, das Gute: er liebte und begleitete den letzten lebenden deutschen Expressionisten Erich Arendt, er tat alles, um das Werk von Uwe Greßmann zu fördern, er schrieb und sprach immer wieder über Kito Lorenc, über Inge Müller, über Uwe Kolbe – nicht immer mit Erfolg, aber mit wirklicher, kenntnisreicher Zuneigung.
Adolf Endler ist ein Liebhaber des Ausrufezeichens, er schreibt ironisch gegen Festgeschriebenes an und das muß man in Deutschland markieren. Endler ist zäh treu, er ruft: „Hoch die Geige“ und „Man betrachte mich als Zigeunergeiger“ – aber als Heym und Havemann abgewatscht und bestraft wurden, da protestierte er und wurde prompt aus dem Verband der Schriftsteller ausgeschlossen, zusammen mit acht Kollegen. Wo waren die anderen? Aber das ist eine andere Geschichte.
Was Adolf Endler nicht ist, wäre jetzt zu erklären. Heissenbüttel sagte: „Er ist nicht auf Bedeutung aus“. Was nicht heißt: Endler wäre uneitel. Er kennt das Handwerk, die Effektkiste. Er kann eben, sagt sein Freund Rainer Kirsch, ausladende, altmodische Verse schreiben, mit Redundanzen, Floskeln, Kreuzreimen spielen und er weiß es. Seine Übertragungen der georgischen Poesie – ein Jahrhundertwerk, ein wichtiger Beitrag zur Hebung des deutschen Ansehens in Transkaukasien – bleiben, sagt der erfahrene Kirsch, „Geniestücke der Reimkunst“.
Aber Endlers Lyrik und Prosa sind spröde, sie schmeicheln sich nicht ein, ein volksliedhafter Ton – bei ihm nicht. „Meine… Lyrik dürfte… eigenbrötlerisch wirken“ schreibt er einmal. Das ist die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit über Adolf Endler ist: er hält auf Abstand. Er ist eher der Bildung und Kenntnisse verbergende Konservative, der Aristokrat, der „irre Fürst“, keiner der sich gemein macht, keiner, der rechtzeitig naiv daherkommen kann. Endler will auch nicht der letzte deutsche Inhaber des surrealistischen Blicks sein, zu dem ihn manche Verehrer machen wollen, weil sie wissen, daß Endler Breton zeitweise mit sich herumtrug und ihn zitieren kann.
Endler ist nicht: ein Marx-Brother, der Swift, der Lichtenberg, der Heine, der Schwitters, der Karl Kraus unserer Zeit und auch Vergleiche mit Eckhard Henscheid oder Harry Rowohlt gehen letztlich fehl. Es gehört zu den Vernebelungsbemühungen, zur Mystifizierung des Helden, solche Namen als Vorbilder zu nennen, aber er ist, dank Biographie, Gaben, Fleiß und Absichten, ganz anders, vor allem: Endler ist nie am Ende.
Das klingt blöde, meint aber Ernsthaftes. Endler sagt und schreibt immer wieder, das seien „Papiere aus dem Seesack eines Hundertjährigen“, das seien „Nachrichten aus einer Hauptstadt 1972–2008“, das alles sei ebenso vorläufig wie sein „Mammutroman“ mit dem Titel „Nebbich“, der mal aus vier Bänden mit je 736 Seiten, mal aus acht Bänden mit je 2000 Seiten, mal aus 13 Bänden ohne nähere Seitenangabe bestehen soll. Und klingt Pudding der Apokalypse etwa endgültig?
Ein Künstler, ein Spalter
Wir waren bei dem, was Adolf Endler nicht ist. Er ist kein Freund von Erik Neutsch, Günter Deicke, Günter Görlich, Eva Strittmatter, Inge von Wangenheim, Gisela Steineckert, Helmut Preißler – jemand vergessen? Sicher. Das sind Autorinnen und Autoren, die in der DDR offiziell und auch privat weithin hoch geschätzt waren. Ihre Bücher entschieden zu kritisieren, war zu DDR-Zeiten, sagen wir, folgenreich.
Endler kann nicht, will nicht: Kompromisse schließen. Er nannte die DDR-Germanistik eine „dürre Gouvernante“, Reiner Kunze eine „Lokomotive“, Wolf Biermann (versteckt) einen Geräuschmacher, Heinz Kahlau eine „Zentrifuge“, Ernst Jünger eine „Knallerbse“, Heiner Müller einen „Irren“. So macht man sich Freunde.
Endler, ist kein Versöhner, Endler ist ein Künstler, also ein Spalter. Er findet das Falsche und muß es sagen und er sagt es deutlich, zum Mitschreiben – da schreibt er es gleich selber auf, der Ältere, der von draußen kommt, der den Extrakt liebt und die große expressiv geladene Rhetorik dazu. Was Adolf Endler noch nicht ist: altersbedingt hoffnungsvoll. Er scheint, Jens Jessen hat es gesagt, oft hilflos, oft verzweifelt, weil die, die er angreift, kritisiert, nicht auf ihn hören.
Eine Geschichte von Johannes Bobrowski heißt „Der Mahner“. Der Mahner ist ein Sonntagssäufer, also ein Mensch, der sonntags von Gottesdienst zu Gottesdienst eilt, um einen Schluck Abendmahlswein abzubekommen – der Sonntagssäufer geht 1933 in Königsberg auf die Hitlerleute zu:
Haltet Gottes Gebote, ruft er ihnen entgegen, als sie kommen. Aber das tun die nicht
schreibt Bobrowski. Nun weiß ich nicht, ob Endler Bobrowski mag und ob er seinen „Mahner“ mag – es gab Zeiten, da habe ich, still für mich, Endler als Mahner, als einen solchen vergeblichen Mahner gesehen.
Endler ist nicht wirklich ein Anarchist, er ist ganz bestimmt kein theoretischer Terrorist, ja, er ist überhaupt, trotz seiner klugen Ansätze und Essays, kein Theoretiker. Er nimmt fallweise alles beim Wort und was er dabei feststellt, das reicht ihm. Er mag nicht, ja er haßt Farben wie Rosa und Beige, so Mischfarben eben, er liebt Grün; Wörter wie „Singebewegung“ oder „Poetenseminar“ kann er nur mit gehobener Stimme sprechen, weil sie für ihn unrein sind.
Ein Autor probiert sich aus
Reden wir über den Band, das Buch, den Pudding. Endler ist nicht lustig zu lesen und man braucht ein bißchen Zeit, um die Mehrfach-Valenzen zu erkennen – was hat der nur mit seinem Sirren? Was sind das für Liliputaner? Was heißt „cui bono“ wörtlich und was bedeuten die Wörter hier?
Es ist eine Auswahl, eine vom Autor selbst kommentierte, unter literarisch-ästhetischen Gesichtspunkten getroffene Auswahl. Es ist nicht der ganze Endler, sondern der Lyrische, der halbe, höchstens – und der verdankt nicht alles „der Presse“, der hat selbst gelebt, der lebt. Menschen und Zustände werden wach, Lektüre wird erinnert, der Autor probiert sich in dieser und jener Richtung und Form keineswegs bruchlos aus – wann wird das Klopstocksche „Oh“ zum ersten Mal ausgerufen? Und wie verändert sich das Selbstbild von der „Brennnessel“ und vom „Sandkorn“ hin zum „Resüme“ von 1997? Wird Endler ernster in diesen 35 Jahren? Wird er endleresk? Mit welchem Gedicht hebt, wenn, das Alterswerk an?
Das zeitlich zuletzt entstandene Gedicht ruft aus der Badewanne nach dem Handtuch – das ist der Fortschritt – die meisten der vielen, sehr vielen früheren Wohnungen Endlers hatten kein Bad. Das letzte Gedicht des Bandes, 1997 entstanden, weist auf die Heine-Lektüre Endlers im Jahre 1987 hin. Die Wimper hätte auch 1967 in das Buch fallen können.
Das „Sirren“ aber war schon 1964, im dritten Gedichtband zu hören gewesen: in „Winter ’43: die Mutter“ „sirrt“ ein Messer aus gefrorenem Schilf. 1971 gilt „dies Sirren“, scheint es, für Singen, beunruhigendes – es „sirren“ kleine, alte Menschen, warnend, Beobachtung, Überwachung mitteilend, sich, dem Autor? Der weiß es, sagt es aber nicht.
Er ist der Wissende, der Kluge, er nennt uns Beispiele und sagt:
Es gibt Leute, die meine Texte verstehen, und andere, die sie nicht verstehen, diese verachte ich, jene treffe der Blitzstrahl meiner Hochachtung!
Wen meint er? Haben wir den Text verstanden? „Ich laufe als Außenseiter – und dann noch die verkehrte Strecke“ sagt der Autor. Adolf Endler – läuft weiter und hört dabei: dies Sirren.
Konrad Franke, Laudatio, gehalten anläßlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises (1999) am 26. Januar 2000 im Alten Rathaus zu Bremen.
„Ich selber auch wundere mich ja zuweilen…“
Sehr geehrte Damen und Herren! – Eingangs ein paar Zitate aus einer unveröffentlichten und etwas verräterischen Satire – Sie werden mich hoffentlich nicht ausbuhen dafür –, die ich irgendwann in den späten Achtzigern niedergeschrieben habe und die von nichts anderem als einer Preisverleihung handelt, von der Stiftung eines Preises, eines Hinterhof-Preises, durch Bruder Adolf Endler, von der Verleihung dieses Preises an Bruder Adolf Endler. Der Ort des wüsten Geschehens: Die berühmte Gaststätte KEGLERHEIM in der Lychener Straße im Prenzlauer Berg. „Menschenskind, det ist ja Kino! Det is ja Kinomatographie reinsten Wassers, absolut, total…“, röhrt es einem gleich zu Beginn der Story aus der Kneipe entgegen, in welcher die einigermaßen verwahrloste Jury des INTERNATIONALEN BUBI-BLAZEZAK-PREISES tagt oder auch nächtigt und das gezackte Für und Wider ordentlich begießt, vor allem das Für…:
Und auch gedanklich enorm sei das ganze Wiesollichesnennen, zumal in gedanklicher Hinsicht…
Panizza redivitzus – und ’ne Prise Peret hintendrüber jestreut!
Zrrrlett, zrrrlett: mülk!
Und endlich ’mal wieder frische Worthaftigkeit in die Welt hinaus statt der üblichen hundertmal abgekauten Fingernagelübungen…
Ja, Fellini hätte das umzusetzen jewußt, Fellini allein, aber jetzt isset zu spät…
Und mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit wären die poetischen Strukturen immer jenau an der richtigen Stelle aufgeraut oder nachsichtig niedergebügelt…
Würden Sie, bitte, noch 13 Doppelpinten bringen und einen einfachen Klaren dazu, Sir Walther!
Ungedrafft, Schnafft zu Schnafft!
Und wenn man das an geruhsamen Sonntagen läse, dann wäre es einem ganz so, als spielte man eine erstklassige Schachpartie… –
Ich möchte fast meinen: Wie zu Weihnachten Bach auf der Silbermannorgel im Lausitzer Bergland bei dichtestem Pulverschneefall…
Und nicht zu vergessen die äußerst delikat gesetzten Displitrikoden, die immer wieder vollkommen überzeugend durchbrennen, und so gut wie keine von ihnen nicht duplivant! –
Fabelhaft, fabelhaft, jawohl, Bach auf der Silbermannorgel, Strich für Strich…
Ehe ich weitere einleuchtende Begründungen für die VERLEIHUNG DES INTERNATIONALEN BUBI-BLAZEZAK-PREISES an den Hinterhaus-Maestro Adolf „Eddy“ Endler wiederhole, und ich könnte es eine Viertelstunde lang und länger, und Rudolf Alexander Schröder würde vom Himmel herab ein Borchardtsches Hagelgewitter auf mich niederstürzen lassen; ehe ich mich ganz und gar in Jeckereien verliere, das ernst gemeinte Geständnis, auf das ich recht eigentlich hinaus will: Viele Jahre lang habe ich Preisen, Medaillen, so genannten „Würdigungen“ gegenüber eine vielleicht nicht ganz ehrliche, aber schön provokante Verachtung gezeigt; kein Kunststück, wenn man bedenkt, daß ich derlei Wohltaten bis zu meinem sechzigsten Geburtstag schwerlich zu erwarten hatte. Was dann kam, war zum Teil ein wenig ekelhaft schmeckende „Wiedergutmachung“. So ist es zum Beispiel bei der Verleihung des Heinrich-Mann-Preises 1990 durch eine im Grunde unwillige Akademie der Künste (damals noch Ostberlin) gewesen, als meine gleichfalls recht unwillige Danksagung aus nichts anderem als der Lesung eines höhnischen Kapitels meines Buches SCHICHTENFLOTZ bestand – die Jury des Bremer Literaturpreises braucht sich wirklich nicht betroffen zu fühlen – gipfelnd in der Bemerkung:
Oh, André Breton, verzeihe, verzeih’ mir!: Ein echter Surrealist nimmt prinzipiell keinen Preis an, von wem er auch immer gereicht werden mag. – Mh, aber bin ich denn ’n Surrealist? Ich bin ein Vertreter des deutschen Humors!, auch wenn Frau Professor Löffler meint…
So weit das Zitat aus Schichtenflotz: Empörte, ja hasserfüllte Blicke damals aus dem Publikum, die mir wohl bedeuten sollten, daß man mit einer so hehren Institution wie einer Akademie der Künste keinesfalls so schnoddrigschnöde verfahren dürfe; dabei waren die größten Hauptleute der Akademie – nein, ich will keine Namen nennen – der feierlichen Ehrung des Widerlings und Renegaten E. ohnehin fern geblieben. Das ist es, was ich sagen will: Erst seit wenigen Jahren darf ich mich bedenkenlos freuen, wenn mir ein Preis verliehen wird, und nun ist es sogar der fabulöse Bremer Literaturpreis, den ich erhalte, Anlaß für doppelte Freude. Weshalb ich zeitweise quasi „verfemt“ gewesen bin, das kann man vielleicht meinen Tagebuchblättern TARZAN AM PRENZLAUER BERG entnehmen, indirekt sicher auch der Gedichtsammlung DER PUDDING DER APOKALYPSE… „Heinerich, der Wagen bricht!“ Es läßt sich nicht leicht formulieren; deshalb formuliere ich es lieber ein bißchen überdreht: Ich komme mir zur Zeit manchmal wie ein Märchenprinz vor, ein schon etwas wackeliger, ja, der von einem bösen Zauber befreit worden ist, ich darf mich freuen, ich darf danken, ohne sarkastische Untertöne zu aktivieren, ich danke… Oder macht das das Alter, Brigitte?
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich gebe zu, daß es manchmal verwirrend gewesen sein muß, was ich der Welt geboten habe. Ich selber auch wundere mich ja zuweilen über die halsbrecherisch anmutende Zickzackroute, die ich nicht nur zwischen den extremen Polen Sozialistischer Realismus und Dadaismus/Surrealismus, sondern nicht minder zwischen Mecklenburg und Oberlausitz, Berlin-Mitte und Leipzig-Connewitz gekurvt bin. Schon als Dreißigjähriger, ich erinnere mich genau, habe ich mich manchmal gefragt: Na, ob du das noch lange aushältst? Und auch heute stehe ich von Zeit zu Zeit vorm Spiegel und prüfe mein nunmehr zerknittertes Auge: Wie ist es möglich, daß du überhaupt noch lebst, dirty old man? Sich solche Fragen zu stellen heißt neben anderem, eine ganze Serie von Danksagungen zu beschwören, an deren Spitze der Dank an meine Frau Brigitte steht, die mir nicht nur im übertragenen Sinn mehrmals das Leben gerettet hat und ohne deren Sorge mir auch dieser 26. Januar 2000 in Bremen nicht beschieden gewesen wäre; meine Werkliste wäre um sechs oder sieben Titel ärmer. Da ich auf meine letzten Bücher, unter ihnen TARZAN AM PRENZLAUER BERG und DER PUDDING DER APOKALYPSE, anspiele, stellt sich selbstverständlich der Name dessen ein, dem ich nicht allein solche schnittigen Buchtitel verdanke – mir selber gelingt immer so Holzschnittartiges wie „Kontakte“ oder aber „Die Expedition“
–, sondern viel, viel mehr: Ohne den Lektor Thorsten Ahrend wäre ich heute mit Sicherheit nur noch partiell sichtbar, genauer, so gut wie verschwunden (das hätte auch meine Frau nicht verhindern können); er hat mich alle zwei Jahre neu entdeckt, könnte man sagen. Immer wieder entdeckt hat mich ebenfalls eine Hand voll rheinischer Kritiker – ja, in der Tat, Kritiker! – und eine Hand voll Dichter-Kollegen vom nunmehr zerspellten Prenzlauer Berg (Andreas Koziol, Frank-Wolf Matthies, Peter Wawerzinek, Jan Faktor, Wolfgang Hilbig), durch deren Gedichte, Essays, Erzählungen ich gleißend hin- und hergeistere, daß es nur so fetzt. Nie aus den Augen gelassen haben mich, wie es scheint, auch die zwei Herren Gerrit-Jan Berendse und Manfred Behn, die sich in unterschiedlicher Weise und sicher oft verzagend um den Ruhm und das Verständnis meiner Prosa, meiner Poesie bemüht haben; Berendse, der niederländische Germanist, hat zum Beispiel in seinem gerade erschienenen Büchlein Grenz-Fallstudien unsereinen nicht nur als „Grenzfall“ und erstaunlichen „DDR-Beatnik“ beschrieben, sondern auch eine Erklärung gesucht für die offensichtliche Rat- und Sprachlosigkeit seiner deutschen Kollegen im Hinblick auf die Produktionen des „Tarzan am Prenzlauer Berg“, nach Berendse „schwer faßbar“ diese Sachen „mit dem in der bisherigen DDR-Forschung bereit gelegten Handwerkzeug“, und zwar nicht allein im Osten; Manfred Behn, Herausgeber einiger meiner Essays im Luchterhand-Verlag, würde mir, wie er drucken läßt, sogar dann die Stange halten (Zitat.), „wenn sich herausstellen sollte, daß er…“ – nämlich: ich! – „als Agent/Informeller Mitarbeiter einen schwungvollen Nachrichten- und Waffenhandel mit zahlreichen finsteren Mächten getrieben hätte…“ (So 1993, als manches noch unklar war.) Sehr geehrte Damen und Herren, muß das einen nicht geradezu umhauen? Nicht viele, die so etwas erleben, nicht wahr?
Im Kontrast zu so schönen Stimmen endet übrigens die eingangs erwähnte Geschichte über die Verleihung eines imaginären BUBI-BLAZEZAK-PREISES mit dem rabiaten Rausschmiss des Stifters und ersten Preisträgers Endler aus der Gaststätte KEGLERHEIM, nämlich
… hinaus und hinunter auf das Trottoir der Dunckerstraße und den Umrissen jenes Pissoirs zu, jener sog. Öffentlichen Bedürfnisanstalt ausschließlich für Herren, unbeleuchtet draußen und drinnen, in welcher Ledermantel-Jenny ihrem abendlichen Nebenerwerb nachgeht… –
Später dann:
… Auf der Raumerstraße überholte mich ein in glitzerndes Leder gehüllter Motorradfahrer, hielt, kehrte um und brauste direkt auf mich zu, stoppte, spuckte mir ins Gesicht: „Mit den besten Grüßen von Louis Ferdinand Poensgen! Wenn du dich noch einmal bei uns sehen läßt, kann er für nix garantieren“.
Dieser Ort hier ist glücklicherweise Bremen; und es ist glücklicherweise die Verleihung, die ganz und gar reale, des Bremer Literaturpreises … Vielen Dank Ihnen allen!
Adolf Endler, Dankrede gehalten anläßlich der Verleihung des Bremer Literaturpreises (1999) am 26. Januar 2000 im Alten Rathaus zu Bremen.
ASQUII, eDiT und Endler
Im Jahr 1997 stellte ich gemeinsam mit Jana Hensel ein Sonderheft der Literaturzeitschrift eDiT zum damaligen Leipziger Literarischen Herbst zusammen. Jana Hensel war noch nicht berühmt, und der Literarische Herbst war ein fein durchkomponiertes und von mehreren Vereinen getragenes Lesefest, das es so mittlerweile nicht mehr gibt. Die eDiT ist eines jener Hefte, die junge Autoren immer mal wieder gegründet haben, um in von ihnen selbst geleiteten Literatur-Zeitschriften Lyrik oder Prosa oder gar lyrische Prosa zu veröffentlichen und somit ein Schriftsteller-Dasein anzustoßen. „Lyrische Prosa“ allerdings galt manchem schon Mitte der neunziger Jahre nicht mehr als verwegen und grenzgängerisch, sondern als überambitionierte Häke- oder Bimmelei; besser, man schrieb ein richtiges Prosa-Gedicht. Am 1995 wiederbelebten Leipziger Literaturinstitut – ich erinnere mich – warben drei Studenten einmal für ihre Lesung mit der Überschrift:
Alles. Nur keine lyrische Prosa!
Einem, der sich zum Beispiel als Lyriker verstand, konnte das durchaus wehtun, und zugleich wies es schon auf das hin, was in den nächsten Jahren literarisch abgehen würde und was sich auch in der von mir seinerzeit mit herausgegebenen eDiT bereits andeutete: Es waren, in mehrfacher Hinsicht, Jahre des Übergangs. Nicht nur der Literaturbetrieb und die Verlagsprogramme, auch die Produktionsbedingungen der Schriftsteller änderten sich. Wir saßen, als Literaturzeitschrift-Redakteure im Jahr 1997, in einem Zwischenreich. Manuskripte kamen als Papierstapel und dazu oft auch schon als Diskette, aber wegen der seinerzeit noch häufigen Umwandlungs- und Decodierungsprobleme gehörte das Abtippen der Texte noch zum gewöhnlichen Arbeitsalltag. Wir hatten sogar eine ABM-Kraft, die manchmal ihre zwölfjährige Tochter mitbrachte, die dann, als Ferienbeschäftigungsprogramm, ebenfalls zur Texterfassung mit eingesetzt wurde. Während wir also in unserem Büro im ehemaligen Leipziger Industrieareal Werk II Gedichte von Bert Papenfuß oder eine Erzählung von Katja Lange-Müller (Die Frau soll ich drücken, nicht das Heroin!) abtippten, gründeten sich in Berlin, Hamburg und München die Literatur-Agenturen und schickten die (ersten) Fräuleinwunder ins Rennen. Für einige, kaum dreißigjährige Autorinnen und Autoren ging es nicht mehr schlicht darum, bei einem großen Verlag anzuheuern, sondern bei diesem großen Verlag auch noch einen großen Vorschuss auszuhandeln. Die junge deutsche Literatur ging fremd mit dem Geld, die sogenannte Wasserglas-Lesung wurde hier und dort bereits abgelöst durch die Literatur-Disko. Wie sollte man in dieser Zeit eine Literaturzeitschrift machen – und vor allem für wen? Sollte man als Zeitschriftenmacher stolz sein, wenn ein Autor auf Grund einer Veröffentlichung in der eDiT von einer Agentin angerufen worden war oder sollte man eher jene mit einer Veröffentlichung ehren und in ihrem Trotz bestärken, denen – etwa weil sie lyrische Prosa schrieben – sowieso niemals ein Agent eine Visitenkarte überreichen würde?
Das Sonderheft der eDiT zum Literarischen Herbst 1997 kann noch beide Tendenzen einklammern: Die Lyriker Oskar Pastior und Adolf Endler, Randgänger beide, stehen zusammen mit Sibylle Berg, die bald zu jenen gehören würde, die das Feuilleton zu den literarischen Popstars einer neuen Generation von Autoren ernannte. Sibylle Berg hatte im Jahr 1996 in ihrem bei der inzwischen abgewickelten Leipziger Reclam-Abteilung erschienenen Debüt Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot die Leser gebeten, nur fleißig ihr Buch zu kaufen, da sie auf ein Haus im Tessin spare. Auf so eine Idee wäre bis dato nicht mal Eddi Endler, einer der komischsten deutschen Lyriker seiner Generation, gekommen. Endler, so wusste man ja, lebte viel zu gern am Prenzlauer Berg, auch wenn es dort so eng und dunkel war, dass Endler mit dem Kopf gegen die Mülltonne knallte, wenn er zum Hof zu aus dem Fenster guckte. Endler nun hatte ich in jenem Jahr 1997 ebenfalls um einen Text für das eDiT-Sonderheft zum Leipziger Literarischen Herbst gebeten, und ich hatte mich von der mit den neuen Konfigurationen schon gut vertrauten Jana Hensel dazu anstiften lassen, Endler gleich noch ein paar Format-Empfehlungen, ein paar beherzt formulierte technische Tipps mitzugeben. Er möge doch bitte, so hatte ich geschrieben, sein Gedicht in ASCII abspeichern und außerdem ein MS-DOS-Format verwenden, und das Ganze dann auf Diskette an die eDiT schicken. Nun ist es immer schwierig, einen anderen Menschen über Dinge belehren zu wollen, die man selber kein bisschen begriffen hat – und einer wie Endler merkte so was natürlich sofort. Leider ist mir Endlers Antwortbrief über die Jahre verloren gegangen, aber die Sätze habe ich noch im Kopf:
Lieber Herr Schieke!
Was ist Ascii??
Auf meiner Schreibmaschine habe ich MS DOS gar nicht gefunden!
Für alle Fälle habe ich ein Gedicht auf ein Blatt Papier geschrieben.
Vielleicht geht es ja auch so!
Ihr Adolf Endler.
Das Gedicht war in fünfzehn Minuten in den Rechner getippt, Endler kam zur Lesung nach Leipzig (wo er ja lange gelebt hatte), und ich kündigte ihm einige weitere Briefe von der eDiT an, da noch bestimmte Verträge und Honorarvereinbarungen hin und her geschickt werden müssten. Das aber könne, wegen spezieller Fördermodalitäten, erst in einigen Monaten geschehen! Bloß nicht, entgegnete Endler, bald sei er nämlich in Wiepersdorf, im dortigen Stipendienschloss, und die Organisation einer dreimonatigen Abwesenheit aus Berlin sei so schon kompliziert genug. Letztlich habe ich Endler dann nach Wiepersdorf geschrieben – und ich habe, wie mir jetzt, über die Erinnerung an den 2009 verstorbenen Endler klar wird, in meinen zwei eDiT-Redaktionsjahren ziemlich oft nach Wiepersdorf geschrieben bzw. von dort Post erhalten – und ich habe diesen Absender „z.Z. Wiepersdorf“ in dieser Zeit als so etwas wie einen Garanten für einen eDiT-tauglichen Text genommen.
Eine solche Existenzform, die einen Autor nach Wiepersdorf oder Schöppingen oder Schreyahn (wo im Jahr 1997 der spätere Büchner-Preisträger Jirgl saß, auch er damals von der eDiT umworben) trieb, war es nämlich, die die am besten für die eDiT geeigneten Texte hervorbrachte. Wer „z.Z. Wiepersdorf“ als Absender raufschreiben konnte, hatte beste Chancen. Die andere Seite der Fräuleinwunder-Literatur war in diesen Jahren womöglich die sogenannte Stipendien-Literatur, und vielleicht konnte man sich gerade in Wiepersdorf noch tiefer in jene asciiesque Gelassenheit einüben, die man brauchen würde als ein Lyriker, der bis an sein Lebensende öfter mit jungschen Literaturredakteuren über Programmierformate als mit Agenten über Vorschüsse debattieren sollte.
Ja, die Züge sind abgefahren, Mary, dein Fahrkartenschalter:
geschlossen, klirrpeng! Die restlichen sechshundert Fahrscheine
mögen sich als Lesezeichen in vergilbenden Kursbüchern nützlich erweisen
(Adolf Endler: „Beendete Station / Blues“).
Ich erinnere mich an eDiT-Veranstaltungen, bei denen ausgewiesene Lyriker davon erzählten, dass sie ja nun auch einen Roman schreiben würden – weil sie für drei Monate nach Wiepersdorf gingen, und dort könne man wohl nicht vom Frühstück bis zum Abendbrot lang Gedichte zusammenbosseln. Anders herum konnte es allerdings passieren, dass jemand von einem verheißungsvollen Romananfang erzählte und von der versammelten Runde junger Autoren mit einem: „Na, komm du erst mal nach Wiepersdorf!“ oder: „Warst du damit schon in Wiepersdorf?“ wieder eingefangen wurde. In Wiepersdorf gab es angeblich ein strenges Regime der diensthabenden Küchenfrauen, und die meisten Autoren erzählten hinterher, dass sie im Schloss die erste echte Schreib-Blockade ihres Lebens ausgesessen hatten. Viele wurden in dieser Zeit richtig gute Tischtennisspieler, weil sie die Tage mit endlosen chinesischen Runden rumbrachten. Traditionell wird an einer Tischtennisplatte – und besonders beim Chinesisch – kräftig geschäkert, und so nahmen auch viele Trennungen, Fremdgehereien und Neuverbindungen in Wiepersdorf ihren Anfang; oft sogar genreübergreifend zwischen Malern und Literaten und Musikern. Das, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Künste, ist übrigens eine weitere Parallele von Stipendiendorf und Literaturzeitschrift: Wurde und wird bis heute doch in jedem eDiT-Heft die Literatur von einem meist noch unbekannten bildenden Künstler begleitet. Über die Jahre lässt sich so die Entwicklung von simpler Grafik/Malerei/Fotografie hin zur offenen Konzeptkunst verfolgen – und fast könnte man sagen: Was in der Literatur die lyrische Prosa, ist in der bildenden Kunst das solide gearbeitete grafische Blatt (mit einem Titel wie: o.T. oder 33. Versuch über Ikarus).
Ja, und manche haben zu Fuß die ganze Welt durchquert, ohne dass der Tabak, den sie in der Jackentasche bei sich trugen, auch nur einmal nass geworden wäre.
Wiepersdorf genauso wie die eDiT waren über die Jahre immer mal vom Aussterben bedroht und konnten nach Diskussionen und Protesten dann doch weiter in den entsprechenden Kultur-Etats verankert werden. Derzeit, so ist auf der Web-Site des Künstlerhauses Wiepersdorf zu lesen, sind dort z.B. Thomas Rosenlöcher, Judith Zander und Marion Brasch am Schreiben und Leiden; Judith Zander hat auch schon in der eDiT veröffentlicht, der meist in Dresden, also in eDiTs Stammland Sachsen lebende Rosenlöcher merkwürdigerweise noch nicht. ASCII bedeutet „American Standard Code for Information Interchange“ und wird wohl auch heute noch in der Computer- und Datentechnik verwendet. Das Gedicht von Endler, das ich im Sommer 1997 für das eDiT-Heft 15 abgetippt habe, heißt: „Beendete Station / Blues“ und ist in Endlers Band Der Pudding der Apokalypse enthalten. Es schließt mit einer Bahnhofs- und Tischtennisszene:
Wir aber wollen mit den zwei Kellen, der Sonntags-,
der Wochenkelle, tagelang pingpong spielen zwischen den
Schienen!
Jörg Schieke, die horen, Heft 250, 2. Quartal 2013
In der Reihe „Die Jahrzehnte. Das deutsche Gedicht in der 2. Hälfte des XX. Jahrhunderts“ präsentierten Autoren je ein frei gewähltes „fremdes“ und ein eigenes Gedicht aus einem Jahrzehnt. So entstanden Zeitbilder und eine poetologische Materialiensammlung zur Dichtung eines Jahrhunderts. Das Gespräch zwischen Stephan Hermlin, Adolf Endler und Karl Mickel fand 1992 in der Literaturwerkstatt Berlin statt.
Gespräch im LCB am 16.9.2008 zwischen Adolf Endler, Maike Albath, Cornelia Jentzsch und Gerrit-Jan Berendse über Endlers Erfahrung in einem totalitären Staat und seine Vorstellungen von Literatur.
Gerhard Wolf: Die selbsterlittene Geschichte mit dem Lob. Laudatio für Elke Erb und Adolf Endler zum Heinrich-Mann-Preis 1990.
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram + KLG + IMDb +
Archiv + Internet Archive + Kalliope
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
Brigitte Friedrich Autorenfotos + Keystone-SDA +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Nachrufe auf Adolf Endler: FAZ ✝ FR ✝ Die Zeit ✝ Basler Zeitung ✝
Mitteldeutsche Zeitung ✝ Süddeutsche Zeitung ✝ Spiegel ✝
Focus ✝ Märkische Allgemeine ✝ Badische Allgemeine ✝
Die Welt ✝ Deutschlandradio ✝ Berliner Zeitung ✝ die horen ✝
Schreibheft ✝ Partisanen


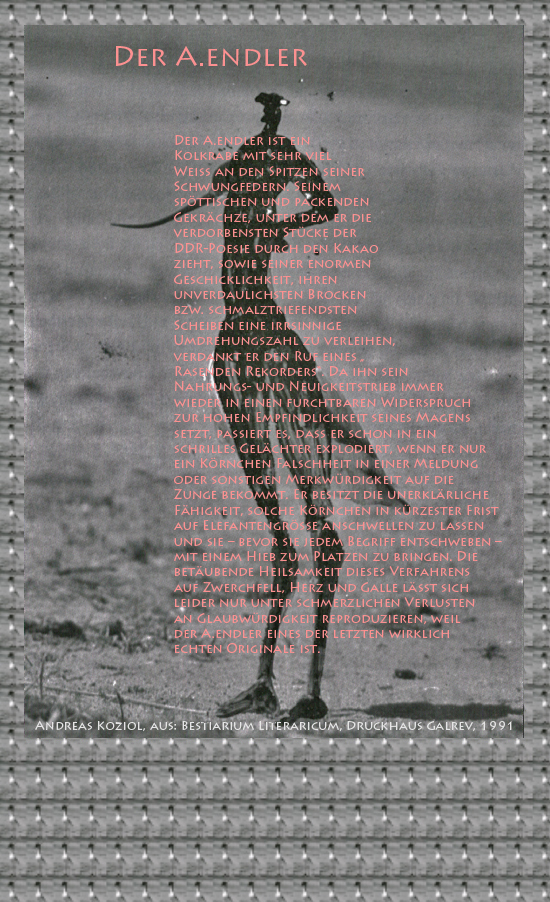
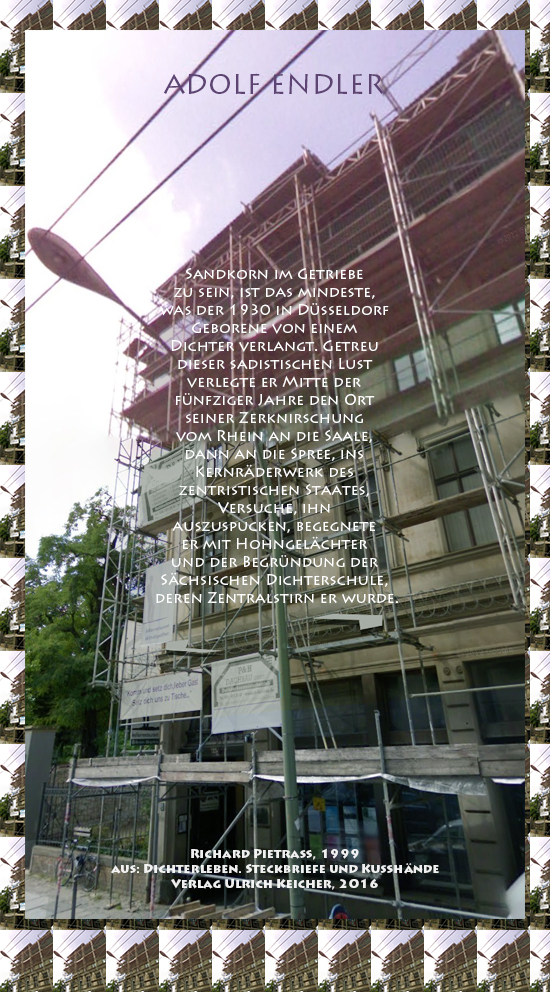












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wie sie sich selber sehen, nennt sich, wie Sie wissen, die nun schon ziemlich dicke Sammlung der kleinen Texte, mit denen sich die neu gewählten Mitglieder der Akademie vorstellen, ein Titel, der einen sogleich unsicher werden läßt und zögern. Wie weit ist man denn in der Lage sich selbst ins Auge zu fassen oder zu erkennen? Die große Hannah Arendt zum Beispiel bezweifelt allein schon die Möglichkeit, ja, rät gelegentlich sogar eindringlich davon ab, sich selber in die Karten blicken zu wollen, also in die Hinter- und Untergründe dessen, was man für die Umwelt darstellt. Mir jedenfalls ist es immer ein wenig schwindlig geworden, wenn ich die Motive nennen sollte für die oder jene Wende in meinem Leben – „Weshalb sind Sie 55 in die DDR gegangen?, weshalb hat Sie 79 der Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen?“ −, für die Motive auch meiner geradezu unübersichtlichen und vielgliedrigen literarischen Produktion; Lyrik, Essay, erzählende Prosa, Kindertheater, Nachdichtung; was gibt es noch?
Wenn einen andere, ob Freund oder Feind, porträtieren, findet man sich freilich auch in der Regel einem Wirrbild konfrontiert, das von einem anderen Stern zu künden scheint. In Jürgen Fuchsens Stasi-Roman Magdalena zum Beispiel stößt man irgendwo auf ein Kurzporträt des A.E., das ich nicht zitiere, um mich lange nach dem Tod des Jürgen Fuchs zu rächen. Fuchs schreibt, und man sieht den Schaum vor seinem Mund: „Revolution! Ha! Sklaven! Ha! Wolf Biermann und Erich Weinert! Haha! Ich Adolf Endler! Adolf? Ich Adolf Endler! Prenzlauer Berg! Poesie! Und Sascha A? Poesiealbum! Und Papenfuß-Gorek! Poesiebum! Moderne Lyrik!, moderne Prosa! §§§§ Iiicchh! Ginsberg weg, Brinkmann weg, alle weg weg weg.“ So weit Fuchs; ich zitiere ihn auch, um Ihnen zu zeigen, aus welchen sumpfigen Schwaden ich allmählich ins Hellere getreten bin und jetzt sogar… Folgt man der fuchsschen Darstellung, die vermutlich keiner der Anwesenden auch nur ansatzweise versteht, dann muß unsereins vor maßloser Selbstüberhebung geprägt sein, die nichts und niemanden neben sich gelten läßt. Sie müssen es mir glauben: Ich habe bedauerlicherweise nie einen Satz über Brinkmann geschrieben oder gesprochen, dem Beat-Dichter Ginsberg habe ich mit der Nachdichtung einiger seiner späten Gedichte gehuldigt.
„Alle weg weg weg…“? Volker Braun und Wulf Kirsten wissen es besser, vor allem aber meine Frau, die seit einem Vierteljahrhundert unter der eintönigen Leier leidet: „Ach, das ist doch alles nix, was ich da fabriziert habe…“ Tatsächlich neige ich trotz reger Publikationstätigkeit (auch mittels Pseudonymen) dazu, mich auf irgendeine Weise zum Verschwinden zu bringen, einer bei Dichtern nicht seltenen Krankheit; Traven und Pynchon sind mir ganz einleuchtende Gestalten. Vielleicht mußte es auch deshalb bis nach meinem 75sten Geburtstag dauern, ehe mich die Akademie für Sprache und Dichtung zu einem ihrer Mitglieder gewählt hat, was mich nun doch sehr gefreut hat.
Eine besondere Rolle spielt bei meinen zwiespältigen und mehrdeutigen Selbstdestruktionsversuchen das von zahlreichen Betrachtern verwundert wahrgenommene Spiel mit meinem Namen. „Ich habe schon immer meinen Namen gehaßt“, lautet die Überschrift eines Artikels über mich. Am verrücktesten und widersprüchlichsten wird solches Selbst-Gemetzel absolviert in dem 1992 in kleiner Auflage bei Reclam Leipzig erschienenen Büchlein Die Antwort des Poeten, in welchem mein Name in zahlreiche Anagramme aufgelöst erscheint; man findet einen Endolf Adler, einen Ole Erdfladn, einen Radlof Elend, einen Alfred Nolde, einen Automechaniker namens Della Fronde, eine Lea Nordfeld, eine Dore Elfland undsoweiter, undsoweiter … vielleicht doch auf verdrehte Weise ein vervielfachtes „Ichichich“? Sie sehen, in welches Dilemma mich der Versuch stürzt, hier eine Antrittsrede zu halten. Aber gewiß, ich bin nicht zufrieden mit meinem Namen, obwohl ich bereits am 20.9.1930 in Düsseldorf geboren bin, meine Mutter stammt aus Flandern, mein Vater aus Böhmen, wo der Name Adolf recht verbreitet gewesen ist.
Aber weshalb veröffentlicht solch ein Kerl zwanzig oder fünfundzwanzig Bücher und Büchelchen – Sie müssen es mir glauben, ich hatte mir in den siebziger/achtziger Jahren die geradezu selbstmörderische Absicht eingeredet, möglichst „unauffällig“ zu publizieren, etwa in Handpressen o.ä. −, weshalb veröffentlicht er im Jahr 1999 seine gesammelten Gedichte Der Pudding der Apokalypse und im Jahr 1994 ein Buch Tarzan am Prenzlauer Berg? Beide etwas reißerisch klingenden Titel stammen nicht vom Autor selber. Weshalb glaubt er, im Jahr 2005 die Öffentlichkeit mit einer naturgemäß aus Splittern bestehenden Autobiographie behelligen zu dürfen, der er den Titel Nebbich gibt nach einem Begriff aus dem Jiddischen, der soviel wie „Ist schon egal“ bedeutet?
P.S. Eines ist bei allem Tohuwabohu sicher: Ich wollte im Grunde immer ein Lyriker sein – und sonst gar nichts … Und ich habe mit einem Gedicht begonnen, als ich 16 war, im Oktober 1947 in der Augsburger Zeitschrift Ende und Anfang veröffentlicht und jüngst von dem fast allwissenden Akademie-Mitglied Wulf Kirsten wiederentdeckt; die Rede ist in dem im borchertschen Stil ‚Große Stadt, irgendwo‘ genannte Quasigedicht, wie Sie sich denken können, von „dämmernden Trümmern“ und „verwesenden Leichnamen“. Mein erster ganz ernst zu nehmender Gedichtband Das Sandkorn ist dann erst 1974 in Halle/Saale erschienen, darin mein Lieblingsgedicht bis heute: ‚Dies Sirren‘ genannt:
Dies Sirren
Und wieder dies Sirren am Abend. Es gilt ihnen scheint es für Singen
Ich boxe den Fensterladen auf und rufe He laßt mich nicht raten
Ihr seid es Liliputaner das greise Zwergenpaar van der Klompen
Cui bono ihr lieben Alterchen mit der Zirpstimm im Dunkel.
So 1971. Eines meiner letzten Gedichte steht im Jahrbuch der Lyrik 2006. Es endet mit den Zeilen: „Ei niemals im Leben einen Schuhplattler auf die Reihe gekriegt / Ei das wars.“ Nein, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, in die Akademie für Sprache und Dichtung gewählt zu sein.
Adolf Endler, Darmstadt, 21.10.2006
Aus dem Buch: Adolf Endler: Dies Sirren, Wallstein Verlag, 2010