Durs Grünbein: Vom Stellenwert der Worte
Verse was a special illness of the ear
W.H. Auden: „Rimbaud“
JENSEITS DER AVANTGARDEN
Es gibt keine literarischen Manifeste mehr. Nicht nur ist das Wort aus der Mode gekommen, auch die Herausforderung, die mit ihm einherging, hat sich verbraucht und erledigt – jener ästhetische Egoismus, der einzelne Abenteurer oder verschworene Gruppen zur programmatischen Verkündigung in Kunstdingen trieb. Beim Publikum unbeliebt wie der Kriegsdienst und die Bürokratie ist das Diktat der Künstler und Literaten in eigener Sache. Diese haben daraus ihre Schlüsse gezogen und sich in ihre sicheren Reviere zurückgezogen. Aus dem Getümmel lärmender Hegemonialkämpfe ist ein Betrieb der professionell verwalteten Koexistenzen geworden, intoniert vom Tagesgeschäft der Produktwerbung, des Rezensionswesens, der Preisjurys – eine ununterbrochene Frankfurter Buchmesse gewissermaßen.
Der Ortsname sei hier erwähnt, weil es wie immer nicht ganz unwichtig ist, von wo aus einer spricht, der zur öffentlichen Rechenschaft aufgefordert wurde. Geradezu übergehen kann ich ihn also nicht, den Schauplatz der nun folgenden Vorlesung, dazu ist er zu schaurig und geschichtsbeladen. Daß ich ausgerechnet hier, hinter dem ehemaligen IG-Farben-Haus, meine Ansichten zur Poesie kundtun soll, hat seine eigene bittere Ironie. Können Sie sich einen Zeugen wie Paul Celan in dieser Lage vorstellen? Es hat etwas Heimtückisches, einem Dichter die Realitätsferne seiner Kunst vor Augen zu führen, ihre essentielle Vergeblichkeit, indem man ihn an einen solchen Tatort einbestellt. Die Architektur als brutales Faktum entlarvt die moralische Folgenlosigkeit seiner luftigen Poeterei, bevor er noch ein Wort gesagt hat. Was anderes als Ästhetizismus kann ein Nachdenken über Gedichte sein, wenn es in der Zentrale geschieht, in der einst die Geschäftsunterlagen bearbeitet wurden zur Beihilfe an einem millionenfachen industriellen Mord? Es ist nicht neu, daß die Materie über den Menschen triumphiert, hier aber bekommt man es im Postkartenmotiv veranschaulicht. Wenn solches möglich war, dann scheint der Vorwurf, Dichtung sei unnütz, sie zähle nicht, wohl seine Berechtigung zu haben. Dann findet Literatur offensichtlich in einer schönen Parallelwelt statt, die im verborgenen Einfluß haben mag auf die Moral einiger Menschen, den gewaltsamen Routinen der Geschichte gegenüber jedoch ohnmächtig bleibt. Diese Ohnmacht war das Kennzeichen der schönen Künste insgesamt, in der Poesie findet sie ihren einsamsten, beredtesten Ausdruck.
Ich dachte mir, es ist besser, die Sache gleich beim Namen zu nennen, als dem Verstummen der Erinnerung ein weiteres beredtes Beispiel zu liefern. Doch gestatten Sie mir auch noch diese Anmerkung: Ist es nicht sonderbar, daß auf der einen Seite jener Frankfurter Hörsaal 6, der den Namen des Philosophen trug, der einmal ernsthaft die Frage stellte, ob es nach Auschwitz noch opportun sei, Gedichte zu schreiben, abgerissen werden soll, während zur gleichen Zeit ein Hauptquartier, den schlimmsten Orwellschen Phantasien entsprungen, in den Rang einer Alma mater aufsteigt? Man kann daraus keine Schlüsse ziehen, fürchte ich. Aber wer hier an Ironie der Geschichte denkt, der ist schon auf halbem Wege zu einer Poetik des Sarkasmus, wie sie mir seit meinen frühesten Schreibversuchen den Ton diktiert.
Ich komme zum Ausgangspunkt zurück: es gibt keine Manifeste im Namen der Dichtkunst mehr. Aber nicht nur dies, es gibt, sehr viel länger schon, auch keine normenbildenden, maßstabsetzenden Poetiken mehr. Das literarische Manifest war in den letzten einhundertfünfzig Jahren zum Ersatz geworden für eine Poetik unter den Bedingungen der Moderne. Es ist ihre verkürzte, beschleunigte und vor allem stark lobbyistische Version, Poetik als Flugblatt und Strategiepapier. Zumindest in dieser Form scheint es nun, wie seine ehrwürdige Vorläuferin, ausgedient zu haben. Was einmal aufwühlend war und alle Wahrnehmung auf den Kopf stellte, wird heute in Anthologien wie in Retrospektiven vor großem Publikum ausgebreitet und kunsthistorisch neutralisiert. Symbolismus und Expressionismus, Imagismus und Akmeismus, Surrealismus oder Lettrismus usf. (ich spreche von literarischen Strömungen) sind zu magischen Künstlerformeln von gestern geronnen, Markennamen für Produkte, die keiner mehr herstellt und die man bei Christie’s und Sotheby’s, wären es Gemälde und Zeichnungen, zu Höchstpreisen ersteigern müßte. Der harte Kern klassischer Moderne ist ausgeglüht. Der letzte Ismus blieb irgendwann in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts auf der Strecke. Aber hatte nicht ein großer Kenner der Szene wie der Romanist Hugo Friedrich in den 50er Jahren bereits warnend festgestellt, fundamental Neues habe die Lyrik des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr hervorgebracht „so qualitätvoll auch einige ihrer Dichter sind“, wie er als Liebhaber zugestand? Die Verblüffung über ein solches Urteil dürfte seither eher gewachsen sein. Allein eine Erscheinung wie die Paul Celans entlarvt derlei pauschale Bilanzen als grobe Ignoranz. Es gab und es gibt immer wieder Höhepunkte, singuläre lyrische Werke jenseits der Avantgarden. Doch war der kritische Zwiespalt, den der Lyrikanalytiker offenbarte, nie mehr ganz auszuräumen. Einerseits Bewunderung der klassischen Modernisten, ungebrochenes Staunen über Schockeffekte und Formrevolutionen, die ihre Frische bewahrt haben bis heute, andererseits Reduktion noch ihrer spektakulärsten Neuerfindungen auf die gemeinsame Stilherkunft von Baudelaire, Rimbaud und Mallarmé, den drei Aposteln moderner Ausdruckskunst in der europäischen Lyrik: Wie ging das zusammen?
Natürlich konnte, wer in der zweiten Jahrhunderthälfte Gedichte zu schreiben begann, von solchen Einschätzungen völlig unbeeindruckt loslegen. Schon darum, weil die Entwicklung unterdessen so offensichtliche Sprünge gemacht hatte, daß keine Zeit mehr blieb für Abstammungsfragen. Kaum war Die Struktur der modernen Lyrik erschienen, diese verwegene Abschlußbilanz der freibeuterischen Moderne in der Verskunst, begann international ein solcher Aufbruch in allen Künsten, daß die Befunde von Stagnation, Rückwärtsgewandtheit und Epigonentum wie weggeblasen waren. Nun waren es die Photographie, das Autorenkino, die neue Malerei mit Informel und abstraktem Expressionismus, die multimedialen und konzeptuellen Künste, auch der kritische Journalismus, die zum Schrittmacher wurden für das Gedicht, das sich unter ihrem Einfluß bis zur Unkenntlichkeit verformte. Der Ton hatte sich radikal abgekühlt, er war noch einmal nüchterner geworden, von einer Sachlichkeit, die selbst noch das Pathos der Sachlichkeit, wie es die Großstadtdichter der Weimarer Zeit kultiviert hatten, romantisch aussehen ließ.
Der vollständigen rhetorischen Abrüstung in der Sprache der Kriegsheimkehrer (Günter Eich, Peter Huchel) folgte bei den Jüngeren die strikte Besinnung auf den Kommunikationsaspekt der poetischen Sprache (Enzensberger, Rühmkorf oder im Osten Heiner Müller und Volker Braun). Die Metapher wurde, wie bei dem allgegenwärtigen Bertolt Brecht, zu einer Funktion lyrischer Algebra. Das Gedicht war nun endgültig auf die normale Körpertemperatur abgestimmt. Und es war dies eine Bewegung, die ganz Europa erfaßt hatte, von Skandinavien bis Sizilien und auch über Systemgrenzen hinweg in Ost und West, analog den international sich angleichenden Architekturformen in Glas und Stahlbeton. Typisch für den Gestus jener Jahre ist eine Zeile Pier Paolo Pasolinis aus seinem langen Gedicht-Selbstportrait Who is me – die dort mehrmals, geradezu als Beschwörungsformel, gebraucht wird: „Damit du mich nicht liest, wie man einen Dichter liest.“ Der Barde des Industriezeitalters war ein erklärter Anti-Orpheus. Er mochte es nicht, daß man ihn mit einem Singvogel verwechselte, einer Engelszunge, einem Belcanto-Tenor. Die Revolution der elektronischen Medien brachte ihm den Gebrauchsaspekt seiner Arbeit zur Besinnung. Er reihte sich ein in das Team der Sprachingenieure, um mit Stalin zu reden; er machte nun einen rein technischen, von Erhabenheit freien Gebrauch vom lyrischen Wort. An die Stelle der künstlichen, elaborierten Stile der europäischen Dichtereliten, von denen jedes Land seine eigene nationalsprachliche Schule hatte, war das selbstreflexive Parlando des soziologischen Durchschnittsmenschen getreten, ein chemisch gereinigtes Idiom, dem die unklaren Träumereien, Melancholien und anmaßenden Ästhetizismen der Großväter als ferne Archaik erschienen. Wer hätte jetzt noch, wie einst Baudelaire, vollmundig sagen können, die Poesie sei das Gift gegen das Laster der Banalität? Im Rückblick mag man von Ausdrucksverarmung reden: Damals wurde es als demokratische Errungenschaft empfunden, als Zuwachs an Reaktionsschnelligkeit, politischem Spürsinn, intellektueller Wachsamkeit, und dementsprechend deklariert. Das Gedicht war nun superaktuell, offen für beinah jedes Thema, eine Cloaca minima aller gesellschaftlichen Probleme. Es war aber auch die tägliche Schnellmahlzeit geworden, Lyrik ein Stoffwechsel zur Verdauung des Banalen in Permanenz. Der Vers, der einmal ein aristokratisches Vergnügen der Seele war, geboren aus der Sehnsucht, zu mißfallen, zu glänzen und zu verwirren, machte sich bald mit allem, was ihm unterkam, gemein. Darin lag seine neue Unverwüstlichkeit, aber vielleicht auch sein größtes Manko. Später versuchte die Konkrete Poesie im systematischen Experiment zu vernichten, was an metaphysischen Restbeständen im lyrischen Wort etwa noch überdauert hatte. Der Vers als Zeugnis einer einzelnen Existenz wurde dem kunstfertigen Sprachspiel und seiner linguistischen Aufarbeitung geopfert. Damit war der Kreis des Sublimen in der Dichtung, im Sinne eines Stefan George, aber auch eines Wallace Stevens etwa, gesprengt, der Weg frei für Dichterei als folgenloses Gesellschaftsspiel zahlreicher Dilettanten. Daß einer sein Leben hätte ändern sollen, nur weil gewisse Stellen in einem Kunstwerk ihm ins Herz gesehen hatten, wäre seither etwas zu viel verlangt gewesen. Literatur war nun wieder der schönste Zeitvertreib, die Poesie ihr apartes Nebenprogramm. Kaum einer hätte jetzt noch den Satz T.S. Eliots unterschreiben können, die Summe eines Wagnis reichen, von Krisen und Katastrophen gezeichneten, erfüllten Dichterlebens: „The experience of a poem is the experience both of a moment and of a lifetime.“ (Die Erfahrung eines Gedichts ist die Erfahrung eines Augenblicks und gleichzeitig die eines ganzen Lebens.)
Inhalt
Von der Feststellung ausgehend, daß eine normenbildende, maßstabsetzende Poetik nicht mehr existiere, zeichnet Grünbein seinen dichterischen Werdegang als „Skizze zu einer persönlichen Psychopoetik“. Es geht dabei um die Idee vom genauen Wort, das seine maximale Aufladung erst als Resultante der Lebenssituation, seiner Stellung im kompositorischen Ganzen des Gedichts sowie im Gesamtsystem aller Arbeiten eines Autors erfährt. Unter dem Leitwort „Poesie ist Subjektmagie als Sprachereignis“ bietet der Dichter am Ende seiner Vorlesung zehn Thesen auf dem gegenwärtigen Stand einer voraussichtlich unabschließbaren Sinnfindung: nicht als Poetik und nicht als Manifest, nicht als Theorie oder Methode, sondern als eigensinnigen Modus operandi des Dichtens in nachmagischer Zeit.
Suhrkamp Verlag, Ankündigung
Energisches Nachdenken
Durs Grünbeins Frankfurter Poetikvorlesungen führen über Stock und Stein quer durch ein seit dreissig Jahren andauerndes Schreiben. Wenn Grünbein selber von „Stock und Stein“ spricht, hat das nicht nur mit den Risiken zu tun, die jedem neuen Gedicht drohen, sondern auch mit der deutschen Geschichte. Man wird mit dem „bolschewistisch-byzantinischen Grossreich“ konfrontiert, in das der Dresdener 1962 hineingeboren wurde und wo 1988 sein erstes Buch, Grauzone morgens, auf die fahlen Farben des abgeschotteten Geländes antwortete.
Antrieb aus archaischer Zeit
Zu „Stock und Stein“ gehört die zerstörte Heimatstadt, gehört aber auch der Mauerfall, der als Befreiung und neue Ortlosigkeit zugleich erlebt wurde. Jeden seiner älteren Bände rechnet er daher einem anderen politischen Zeitalter zu. Und doch kommt der entscheidende Antrieb aus einer früheren, einer archaischen Zeit. Die Urgestalt dieser Kunst ist das Kind. Über verlassene Vorstadtstrassen konnte es in die Sommerhitze der angrenzenden Felder verschwinden. Das Klappern der Flügel einer aufschiessenden Taube, die vom Streunen durch Goldruten und Lupinen brennenden Knie betrachtet der Autor heute als Epiphanie seines Schreibens und zitiert entsprechende Strophen.
Eine andere unabdingbare Voraussetzung ist die existenziell erfahrene Literatur: von Arthur Rimbaud und Annette von Droste-Hülshoff, Gottfried Benn und Johannes Bobrowski, T.S. Eliot, Ezra Pound und Isaak Babel bis zurück zu den Griechen und Römern. Und dann war da der „vom Himmel“ gesandte Mentor, der Dramatiker Heiner Müller, der den vor sich hin „werkelnden“ Jungdichter aus der Prenzlauer-Berg-Isolation holte und dem Suhrkamp-Verleger empfahl.
Eine Art Trance
Da geht es rücksichtslos um den Satz und um das Verhältnis der Wörter darin. Im „elektrischen Feld eines präzisen Kontexts“ können sie Funken schlagen, die auf den Leser überspringen. Grünbeins aus äusserster Konzentration, in einer Art Trance entstehende „absolute Wortkonstellationen“ erzeugen eine Aura, die wir so sonst nirgends finden. Erfahrung, Gedanke und Bild kommen in den extrem verdichteten Versen zur Deckung. Ihre vibrierende Präsenz wiegt das Zurücktreten des lyrischen Melos auf.
Beatrice von Matt, Neue Zürcher Zeitung, 9.6.2010
„Poesie ist das schlechte Gewissen der Literatur“
− Durs Grünbeins Frankfurter Poetikvorlesung. −
Nach Durs Grünbein sei die Zeit der literarischen Manifeste vorbei. Die Literatur sei nur noch durch den Rhythmus des Buchmarkts skandiert, für das Diktat des Dichters – oder der Dichtergruppen – gebe es keinen Platz mehr. Die Poetik als Maßstab setzende Norm einer Strömung, als dogmatisches „Flugblatt oder Strategiepapier“ existiere nicht mehr – dafür aber kann jeder Dichter für sich selbst sprechen und die eigene Poetik als persönlicher Orientierungsversuch im Reich der Sprache schätzen.
In der Vorlesung „Vom Stellenwert der Worte“, die Grünbein Ende 2009 zum 50. Jubiläum der berühmten Frankfurter Poetikdozentur gehalten hat, skizziert der Dresdner Schriftsteller die Grundzüge seiner „Psychopoetik“. All die Ingredienzien seiner Produktion werden erwähnt, von der bitteren Darstellung der eigenen DDR-Erfahrung zum elegischen Gesang der zerstörten und wiederaufgebauten Stadt Dresden, vom Primat des Körpers als Einspruch gegen die Utopien bis zur Entdeckung der Antike als „Archäologie der […] überdauernden Motive“, von der Auffassung der Poesie als Trancezustand zum Sarkasmus als Gegengift gegen die Verstellungen der Rhetorik und der Metaphysik.
Gerne listet der omnivore Leser und poeta doctus die Prosaautoren und die Lyriker auf, die zu seiner autodidaktischen Bildung beigetragen haben. Und er lässt die wichtigsten Etappen seiner biografischen und literarischen Entwicklung mit Rührung und Erkenntlichkeit vorüberziehen, von den auratischen Anfängen seiner Schriftstellerei zum durch Heiner Müller vermittelten Kontakt zum Suhrkamp Verlag, bis hin zur internationalen Akklamation zum bedeutendsten Dichter des wiedervereinigten Deutschlands.
Mit diesem Bändchen macht Grünbein – nach dem lesenswerten Die Bars von Atlantis – einen weiteren Schritt im Sinne einer akkuraten Systematisierung des eigenen Werkes einerseits und einer selbstgefälligen Konstruktion des eigenen image andererseits: Die Poetikvorlesung liest sich wie eine Bilanz der Erfahrung Durs Grünbeins als Dichter eher als eine Rede über die Dichtkunst. Und das absichtlich.
Nicht als einen präskriptiven Dekalog sondern als eine deskriptive Reflexion über den eigenen modus poetandi müssen also die zehn Punkte gedeutet werden, die die Vorlesung abschließen. Es geht dabei um die bescheidene „Theorie vom Ortssinn der Worte“, von der genauen Stellung des Wortes innerhalb einer Zeile, eines Gedichtes, eines ganzen Opus: „Alles kommt darauf an, das Wort an der richtigen Stelle im Vers anklingen zu lassen, nicht zu früh, nicht zu spät“.
Im postavantgardistischen und postutopischen Zeitalter sei Poesie „Subjektmagie als Sprachereignis“, Dichtung stelle laut Grünbein „eine Periphrase des Menschenlebens“ dar, jeder Vers sei mit Physis und Psyche seines Verfassers unentwirrbar verbunden. Die Worte gewinnen „[i]hre wahre Bedeutung […] erst im Licht der Erfahrung“, jedes Wort „bekommt im Leben in einem bestimmten Moment erst seinen durchschlagenden Sinn und wird erst dann gleichsam scharfgestellt“.
Lyrik wird als das Genre des extrem Subjektiven gepriesen, als das „Absolutum der Sprache“. Das Gedicht, sagt uns Grünbein am Ende, ist alles, was bleibt – jenseits des Rampenlichtes der literarischen Szene, jenseits aller ökonomischen Interessen der Verleger, jenseits der verstaubten Pedanterie alter Akademiker und der Kritik der Rezensenten.
Daniele Vecchiato, literaturkritik.de, November 2010
Weiterere Beiträge zu diesem Buch:
Michael Braun: Jenseits der Avantgarden
Rheinischer Merkur, 17.6.2010
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Dichtung legt sich nicht mit der Realität an
− Dichtung sei unerlässlich, hat Jean Cocteau einmal gesagt, man wisse nur nicht genau, wofür. Was wie eine Pointe klingt, trifft die Essenz der Sache, meint der Lyriker Durs Grünbein und beschreibt damit eine Gegenposition zum Dichtungsverständnis von Günter Grass. −
Ich habe die Straße der modernen Poesie an ihrem oberen Ende betreten, dort, wo sie überging in die schmucklosen, tristen Vorstädte, bei den Endhaltestellen der Straßenbahnen, den Autobahnzufahrten. Was ich als Erstes sah, waren graue Mauerstücke, Lücken zwischen den Häusern, Gräben entlang der Straße, das Erdreich aufgerissen, zerwühlt. Meine Heimatstadt war vom Krieg zerstört.
Ich musste feststellen, dass zuletzt beinah alles auf der Strecke geblieben war: die Versformen, der Grundrhythmus der Strophen, die großen balladenhaften Spannungsbögen, der Geheimnischarakter, die feine Lineatur der bedeutungsreichen Worte, schließlich die Poesie selbst. Wenn jemand erklärt hätte, sein Dichten verfolge die Absicht, dem Ausdruck Klarheit zu verschaffen, dem Versbau Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben, man hätte ihn ausgelacht. Es galt als abgemacht, dass das meiste, was die konventionelle Lyrik bereithielt, nurmehr Plunder war, etwas Unbrauchbares, das dem direkten Ausdruck im Wege stand. Ich las Rimbauds Schilderungen von seiner Jahreszeit in der Hölle und nahm es als realistischen Bericht, die Umwelt darin war mir vertraut. So fing mein Dichterleben an.
Es war eine Befreiung, die den innersten Kern des Poetischen sprengte und dabei ungeahnte Kräfte freisetzte. Wer sich mit der Musik vieler Jahrhunderte angereichert fühlte, mochte getrost dem Lockruf ins Offene folgen, er würde sich in der nackten Gegenwart aufgehoben fühlen wie in Abrahams Schoß. Wer sein Vertrauen zum Wort behielt, dem kam nun die Komik, die allem Ausdruck innewohnt, von allen Seiten zu Hilfe, und das Absurde war ihm ein Trost.
Über die Grenzen der geschlossenen Gesellschaft hinaus
Es hatte sich erwiesen, dass Gedichte mehr sind als feststehende Rituale in lange befestigten Formen. Mochten sie auch ihre Würde dem uralten Status der Elegie verdanken, sie waren doch mehr als nur Verlust- und Vergänglichkeitsbilanzen, Feiertagsgeschenke oder Zutat auf Trauerannoncen. Seit den Tagen der frühen Moderne war jeder Stilbruch erlaubt – im Namen der Überraschung. Ausdruck war nun etwas Unmittelbares, man erzwang ihn durch Inkongruenz, Disharmonie, gewagte Sprünge, die Kombination des scheinbar Unvereinbaren. Damals hat das Gedicht, mit einem verführerisch jungen Lächeln, all seinen zeremoniellen Befangenheiten adieu gesagt. Damals hat es, neben den entlegeneren Nerven, auch seine Muskeln entdeckt, sein freches Grinsen, die Süße, die in der Zerstörung der Formen lag. Den Verlust seiner Schmuckfunktionen sollte, wie sich zeigte, ein Zuwachs an Mimik aufwiegen, eine erhöhte Alarmbereitschaft für die kleinen tragischen wie die großen komischen Dinge des Lebens. Der Augenblick zog in das Gedicht ein, sein Stilmerkmal war das scharf beobachtete Detail. Und wachsam hielt er von nun an dort die Stellung, im Zentrum des Gedichts, misstrauisch gegen die dunklen Heere der hysterischen Ideen, mit ihrem Potential, alles ringsum zu verwüsten.
Nach vielen Jahren ununterbrochener Praxis kann ich sagen: Das Gedichteschreiben ist wohl zuallererst eine Übung in radikaler Selbsterforschung. Es wendet sich gegen die Generalisierungen. Es unterläuft den Roman der Geschichte, die immer kollektiv voranschreitet, rechthaberisch in ihrem Anspruch, den Einzelnen mit seinen Eigenheiten zu vereinnahmen. Dagegen steht das Gedicht, das aus den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts gelernt hat. Ich erinnere mich, dass ich der großen Erzählungen sehr müde war, schon am Beginn, als ich anfing, regelmäßig zu schreiben.
Ich war siebzehn, als ich mit der modernen Poesie mein Glück versuchte. Es war wirklich nichts Besonderes. Man kratzte sein weniges Erspartes zusammen und setzte auf ein paar magere Zeilen. Ich begann mit einer einfachen Lektion. Sie betraf diesen Körper – das Einzige, was der Staat, in den ich durch genetischen Loswurf hineingeraten war (der glorreiche Arbeiter-und-Bauern-Staat DDR), beschlagnahmen konnte, indem er mich zum Militär einberief und in die Großbetriebe zur Produktion. Dann fand ich bei dem jungen Ossip Mandelstam den Vers: „Man gab mir einen Körper – wer / sagt mir, wozu? Er ist nur mein, nur er“, und fortan war es um mich geschehen. Aus der Sicht dieses Körpers musste etwas getan werden, wollte man nicht als Gefangener enden eines Regimes, das auf ebendiesen Körper Anspruch erhob, indem es ihm geographische Grenzen setzte, ihn disziplinierte und als Geisel einbehielt für etwas, dessen es anders nicht habhaft wurde – nennen wir es Ich oder Seele oder Bewusstsein. Dafür, dass es dies Unfassbare, stets Unzuverlässige nie ganz vereinnahmen konnte, rächte es sich mit der Beschlagnahmung jenes, der nur allzu sichtbar war, eine leichte Beute. Not macht erfinderisch: Das Schreiben war damals mein erster Schritt über die Grenzen des Körpers und der geschlossenen Gesellschaft hinaus.
Einsiedler inmitten der Gesellschaft
Jede Generation entwickelt ihre eigene Sensibilität, heißt es. Man versteht dies unmittelbar, wenn man eine Gruppe junger Menschen beobachtet, dem Krachen ihrer Skateboards lauscht, ihren angesagten Songs zuhört, ihre Gesten studiert. Es ist eine neue Art, auf der Welt zu sein und auf diese zu reagieren. Die Landstraße mag noch dieselbe sein, aber die Kinder, die sich auf ihr zum Spiel verabreden, sind andere, sie sprechen andere Sätze, ihre Träume haben sich verändert – wohin, wird die Zukunft zeigen. Genauso verhält es sich mit der Poesie. Über diese schlichteste und zugleich rätselhafteste aller Künste hat Jean Cocteau gesagt: „Sie ist unerlässlich, aber ich weiß nicht genau, wofür.“ An dieser Unbegründbarkeit liegt sehr viel. Sie ist vermutlich sogar die Essenz der Sache, darum bleibt das Zitat auch über die erste Erheiterung hinaus gültig.
Was ihre Gegenstände betrifft, so sind sie tatsächlich uralt und bei allem Variantenreichtum beinah stereotyp, wie es scheint. Es sind die Liebe, das Begehren, das Rätsel der Zeit, die Schocks der Erkenntnis, die einer am eigenen Leib macht – und der immer wiederkehrende Glücksmoment, sich als Teil des Universums lebendig zu fühlen. Dies drängt im Gedicht zur Sprache, koste es, was es wolle. Aber es ist das spezifische Erlebnis eines Einzelnen, das hier für Abwechslung sorgt und die Dinge von Zeit zu Zeit neu erstrahlen lässt – so noch nie zuvor angeschaut.
Heute kann ich hinzufügen: Der Dichter ist wirklich das Wesen, das seinem Leitstern folgen muss, seinem daimon, wie es in der Sprache des Sokrates hieß. Dass es ein Philosoph war, der mit dem Ausdruck auf der Rolle des Individuums beharrte, sagt uns, wie eng das Erwachen der Persönlichkeit im frühen Griechenland mit dem Erwachen des Geistes einherging. Niemand sollte sich von der später so bequemen Trennung in Dichten und Denken irremachen lassen. Besser, man geht von einer Arbeitsteilung aus, die am Ende allen zugute kommt. Der Dichter muss seiner eigenen Traumwirklichkeit folgen, nicht selten auch seiner abgründigen Psyche, wie es alle die Zerrissenen taten, die sich ins goldene Buch der Menschheit eintrugen – hier hat jeder seinen Favoriten parat. Der Dichter ist einer, der lernen musste, allein zu sein, nonkonform, keinem verpflichtet – keiner äußeren Macht, keinem höheren (religiösen oder philosophischen) Prinzip, nicht einmal einer vorherrschenden literarischen Strömung. Er wird aber, bei aller sozialen Kontaktfreudigkeit, auch dann noch der Einsiedler inmitten der Gesellschaft sein, wenn alle Religionen, alle demokratischen Ideale zu kollektiver Routine verkommen sind.
Die Unabhängigkeitserklärung der Poesie
„Dichtung ist der Triumph der Kontemplation“, sagt Wallace Stevens, und er tat es mit herausforderndem Blick auf die Philosophie. Das erinnert an das platonische „Selbstgespräch der Seele“, das bei den Griechen begann, nein, früher noch, im Alten Ägypten mit dem lyrischen Liebesgeflüster einiger Hofdamen, und im Grunde nie aufgehört hat. Dieses Selbstgespräch, unter Einbeziehung eines heimlichen Mitwissers, als welcher der Leser ins Spiel kommt, sobald das Gedicht das Licht einer Buchseite erblickt, ist die Grundbewegung, der innerste Antrieb der Poesie.
Dabei gilt: Die poetische Wirklichkeit ist eine andere als jene, die uns unterm Namen Realität immer neu verkauft werden soll. Sie ist zugleich flüchtiger und dauerhafter als diese. Sie legt sich nicht mir ihr an, warum auch? Sie sieht das Fadenscheinige jeder Realität, die menschlichen Konstruktionen dahinter und überwindet sie spielend mit Hilfe der Imagination. Sie erzieht den, in dem sie erwacht, zum permanenten Widerstand gegen den Fatalismus der Fakten und ist damit politischer als jede Politik. So ist die Unabhängigkeitserklärung der Poesie auch mehr als ein bloßer ästhetischer Akt. Sie verdeutlicht das Lebensprinzip, dem jeder Mensch, wie verstrickt und von den Umständen korrumpiert er auch immer sich durchwindet, in der Sehnsucht doch folgt, ob er nun schreibt oder nicht. Das Wagnis der Dichtung besteht nur darin, dass sie dies demonstrativ tut, für jeden nachprüfbar, der an der unvergesslichen Wendung, der Aussagekraft von Metapher und Gleichnis einen Halt zu finden sucht, während Zeit ihn davonreißt. Dichtung ist die Garantie dafür, dass es sich gelohnt hat, die Muttersprache zu erlernen. Wenn es ihr gelingt, findet sie hin und wieder das schlagende Bild, das auf der inneren Retina bleibt und einen lebenslang schützt und begleitet.
Durs Grünbein, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.5.2012
Fakten und Vermutungen zum Autor + Instagram 1 & 2 + Facebook +
KLG + IMDb + PIA + ÖM + Archiv + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 + Orden Pour le mérite
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Galerie Foto Gezett +
deutsche FOTOTHEK
shi 詩 yan 言 kou 口
Durs Grünbein–Sternstunde Philosophie vom 14.6.2009.


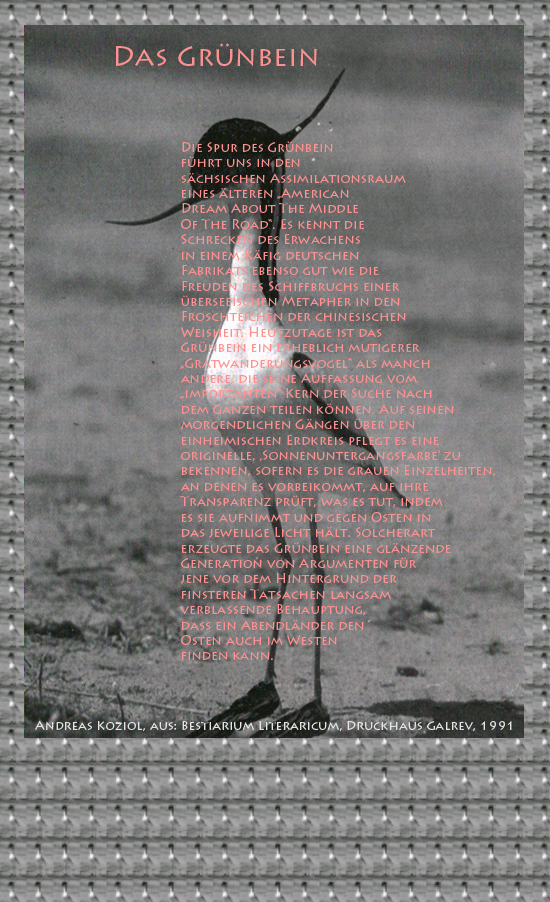
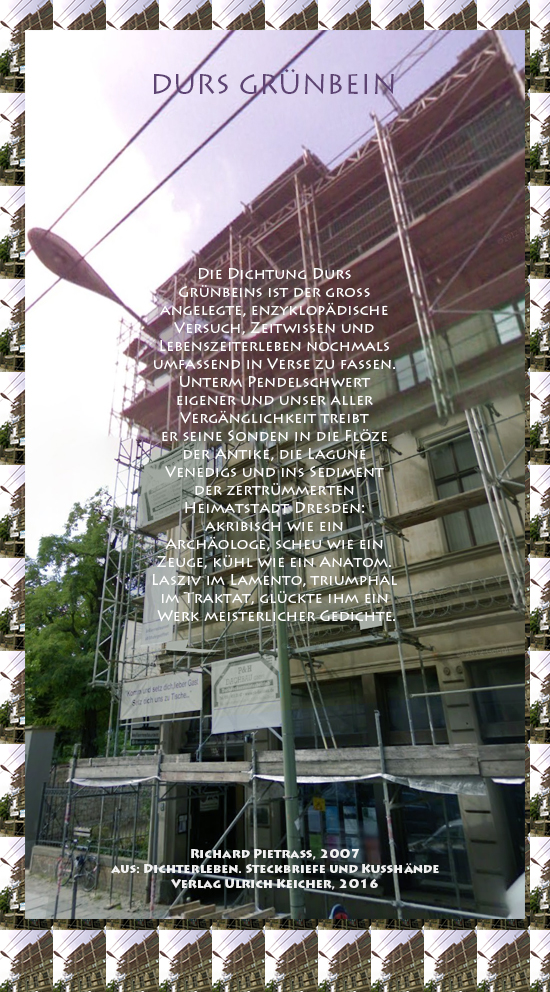












Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Kurzer Bericht an eine Akademie
Wie stellt man jemanden vor, den man nur flüchtig kennt? Mir hat nie eingeleuchtet, warum einem ausgerechnet diese eine Person, nur weil sie immer im Weg stand, bekannt sein müßte. So kann ich bis heute nur sagen, daß ich am neunten Oktober 1962 in Dresden geboren wurde und nachher dort aufwuchs, als einziges Kind junger Eltern.
Vater und Mutter waren 22, als ich mit dem üblichen Geschrei eines Nachmittags aufdringlich zum Vorschein kam, traumatisiert von der Geburt genauso wie jeder andere. Bei dem französischen Dichter Jean-Jouve fand ich Jahrzehnte später ein Gedicht, das mir noch einmal den Schock in Erinnerung rief.
Ich sah eine Lache grünen Öles
Ausgeflossen aus einer Maschine, und dachte lange
Auf dem heißen Pflaster des verworfenen Viertels
Lange, lange an das Blut meiner Mutter.
Was darauf folgte, war eine fröhlich durchlebte Provinzkindheit, wobei mir recht bald der Akzent auf durchlebte zu liegen kam, das heißt, die Sache war schneller vorbei als gedacht, und bis heute läßt mich die Gewißheit nicht los, daß in die ausgestreckten Arme, die das Leben umfassen wollen, sofort der Wind fährt und einen weitertreibt, mit dem Rücken zur Zukunft, und eine Lebensphase ist immer großartiger als die vorige und somit wächst bald ins Unermeßliche das Verlustgefühl. Kein Trost kann für mich demnach das Ende sein, nur eine Grenze in diesem infinitesimalen Glück.
Die Provinz hieß übrigens Sachsen, eine alte Kulturlandschaft, aschgrau geworden, darin ein Brandherd von städtischem Ausmaß oder was nach dem Krieg übriggeblieben war von einer Stadt namens Dresden. All meine Bildung in ihr, die Schuljahre und Bibliotheksstunden, das Abitur und die langen Wanderungen, haben schließlich nur zu dem einen, leicht rachsüchtigen Fazit geführt. In einem Abschiedsgedicht sah ich die Stadt als das, was sie war, ein Barockwrack an der EIbe.
So blieb der frühe Wunsch, Indianer zu werden, eine Anfälligkeit für das Nomadische, die schon so viele Sachsen verbunden hat – ebenso wie der Drang zur Hochstapelei, die das Fortleben der Träume sichert, bis hinein in die Niederungen des Erwachsenenlebens. Als aus den Träumen nichts wurde (sich im Jahrhundert zu irren, ist typisch für Leute aus diesem Landstrich), wollte ich Tierarzt werden, mit Afrika als neuem Schauplatz für mein Berufsziel. Doch die Realität eines Alltags als Veterinärmediziner, im Beratungsgespräch drastisch ausgemalt, hatte mich so sehr erschreckt, daß ich enttäuscht davon Abstand nahm; die Serengeti mußte ohne mich sterben.
Es kam wie es kommen mußte, ich blieb in der Enge, im Schatten einer Chinesischen Mauer, territoral eingeschränkt auf einen Raum, der nur wenig größer und für Fremde kaum weniger unheimlich war als etwa Albanien. Und eines Tages, urplötzlich und unangekündigt, begann ich Gedichte zu schreiben, wie jemand, der sich einer eigenen Sache zuwendet, nachdem er gemerkt hat, daß die aller anderen ganz gut ohne ihn auskommt. Novalis und Hölderlin sind die ersten Ahnen gewesen – des einen Blütenstaub und der verstörende Lockruf seiner Hymnen an die Nacht, des andern Gebet für die Unheilbaren, sein verwüsteter Götterspielplatz. „Wie Bäche reißt das Ende von Etwas mich hin, welches sich wie Asien ausdehnet“ – Zeilen wie diese überrollten mich, bevor ein Verständnis sie auffangen konnte. Mit siebzehn lieh mir ein Freund ein zerfleddertes Taschenbuch der Cantos von Ezra Pound, und damit nahm das Unheil erst seinen Lauf. Seither schreibe ich in einer Erwartung, die gleichzeitig rückwärts- und vorwärtsgewandt ist, und dieser unmögliche Zustand, einige Atemlängen zwischen Antike und X, läßt sich nur aushalten, indem ich mich langsam und zeilenweise meiner Stimme vergewissere, dieses Körpers und dessen, was sich im Innenohr fing.
Eines Tages, und es war nicht im Traum, stellte ich mir meine zeitliche Lage paradox als die eines Schwimmers vor, eines Schwimmers im Rückstrom, der aus der Zukunft kommt.
Kein Wunder also, daß mir vieles nur Anlaß wurde, Sensation und persönliches Chronogramm. Immer seltener kam es mir in den Sinn, gegen das Zeitgeschehn Einspruch zu erheben, seit das Begreifen und Deuten mir mehr abverlangte als jedes Meinen und Handeln. Ich habe, so sehr es mich manchmal beschämt, den Zerfall der Diktaturen im Osten tatsächlich als einen Zerfall erfahren, das heißt grundsätzlich passiv, als parteiloser Tagedieb, wenn auch mit gelegentlich amüsierter Teilnahme an Kritik und Demonstration. So überwältigend als Erlebnis der Untergang des Sozialistischen Reiches war, ergiebig wurde er für mich erst: fünf Jahre später während eines Italienaufenthalts, beim Besuch der Ausgrabungsstätten von Herculaneum und Pompeji. Erst dort sah ich die Wirkung dieser gewaltigen Detonation Zeit, sah das verzögerte Niederregnen der zivilisatorischen Splitter und in der berühmten Katastrophe, in Gegenwart des Vulkans, den Beweis fÜr eine Art gedächtnisloses Gedächtnis – deus absconditus, oder wie immer man es noch nennen will. Dichtung, das hatte ich lange geahnt, würde ihm auf die Spur kommen, wozu sonst war sie da. Im Haus der verkohlten Möbel ließ es sich innehalten, für Stunden war alle historische Bewegung aufgehoben, beruhigt vor den Wandgemälden in der Mysterienvilla. In diesen kleinen, oft nur schweinestallgroßen Räumen mit ihren hingekritzelten Dichterzitaten und dekorativen Malereien fand ich mehr Aufschluß über mein Leben als in allen den Klassenzimmern, Kasernenfluren und Mansarden, an die ich zurückdenken mußte. Damals, beim Anblick des anonymen Freskos mit der Darstellung von Traum und Geburt, den Verstrickungen von Geschlecht und Wissen, Lebensaltern und Jahreszeiten – leuchtete auf, worum es im Schreiben vielleicht, durch alle Aktualität hindurch, gehen könnte. Daß die Motive sich alle, wie im Mysterienfries von Pompeji, wieder versammelten vor Kalliopes Thron, hat mich unendlich ermutigt.
Seit dem entscheidenen Jahr 1989 bin ich auf Reisen. Berlin, die Stadt in der ich seit zehn Jahren wohne, ist der Transitraum, von dem aus ich den verschiedenen Einladungen folge, es könnte ebensogut auch New York sein, ihr Gegenüber und mein Metropolis seit frühesten Tagen. Ich habe ein Studium abgebrochen und längere Zeit im Theater gearbeitet, bevor es, durch einen Zufall vielleicht, zum ersten Buch kam. Bis heute kann ich nur mit einer gewissen Nervosiät zurückdenken an die besondere Wendung, die seither alles in meinem Leben nahm.
Zum Schluß noch, um Mißverständnissen vorzubeugen, eine Art eidesstattlicher Erklärung. Mein Name, so voraussetzungslos seltsam er scheint, ist kein artistischer Einfall. Es ist genau der Name, den das bürgerliche Familienrecht und der Eigensinn meiner Eltern mir nicht ersparen wollten. Daß es Ihnen in den Sinn kam, ihn unter die Namen der Mitglieder dieser Akademie einzureihen, ermutigt mich wie ein Zuruf von unerwarteter Seite. Ich danke Ihnen dafür.
Durs Grünbein 1995, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.