Peter-Huchel-Preis 1993: Sarah Kirsch
ZWISCHENLANDUNG
Wenn es auf Weihnachten geht
kehren die Dichter
zu ihren tüchtigen Frauen zurück
Ach was sind sie das ganze Jahr
über die Erde gelaufen
was haben sie alles gehört was
nachgedacht, ihre Zeitung geschrieben
durch Fabriken gestiegen, den Kartoffeln
brachten sie menschliche Umgangsformen bei, sahn
dem Rauch nach der kriecht und steigt
sie haben alles geschluckt manchmal Manhattan-
Cocktails wegen des Namens, sie verschärften
den Klassenkampf meditierten
über das Abstrakte bei Fischen, bis eines Tags
durch ihre dünnen Mäntel die Kälte kommt
Sehnsucht
nach einem wirklichen Fisch in der Schüssel
sie jäh überfällt und Erinnerung
an die Frau die sich am Feuer gewärmt hat
da bleibt
der Zorn in den großen Städten zurück, sie kommen
mit seltsamen Hüten für ihre Kinder
spüln sogar Wäsche spielen Klavier, bis
sie es satt haben nach Neujahr, da
brechen sie Streit vom Zaun, gehen erleichtert
weg in den Handschuhn von unterm Weihnachtsbaum
Vom solitären Anspruch eines jeden Gedichts
Die Maßstäbe, nach denen wir heute Preise verleihen, brauchen morgen schon nicht mehr zu gelten. Wir lesen, was uns die Dichter alljährlich stiften, doch was davon bleiben wird, wissen wir nicht. Man wußte es nie – und dieses Nie ist für jede Jury ein Trost.
Der unsrigen gehörten an: Bazon Brock, Peter Hamm, Agnes Hüfner, Wulf Kirsten, Beatrice von Matt, Peter Horst Neumann und Hans Wollschläger. Wir hatten den Jahresertrag deutschschreibender Poeten zu prüfen, an die vierzig Gedichtbände, die Ernte 92, und ich versichere Ihnen: es war auch diesmal ein skrupulöses Geschäft. Sieben durch einige Kennerschaft ausgewiesene begeisterungswillige Skeptiker stellten ihre Vorurteile nebeneinander und begründeten sie. Das waren wunderbare poetische Kolloquien, Exerzitien der Literaturkritik. Aber am Ende hatten wir, womöglich einhellig, den einen Gedichtband für huchelpreiswürdig zu erklären. Im Falle von Sarah Kirsch mag die Entscheidung hernach als mühelos erscheinen. Aber sie war es auch diesmal nicht.
Kunstwerke sind (nach Roman Ingardens Begriff), „intentionale“ und keine „objektiven“ Gegenstände. Ihr Dasein definiert sich zuletzt im Leser, im Betrachter, im Hörenden. Nicht daß sie der Beliebigkeit unserer Meinungen ausgeliefert wären: Immer ist uns die Art, wie wir sie wahrnehmen, zuvor durch Aufführungs-, Deutungs- und Rezeptionstraditionen vermittelt worden. Die freilich verändern sich, so daß ein Bildwerk oder Gedicht unter anderen historischen oder individuellen Bedingungen zwar nicht schon ein völlig anderes ist, uns aber doch auf je andere Art, vielleicht mit veränderter Botschaft, mit größerer oder minderer Eindringlichkeit berührt. Dieses Fehlen von Objektivität ist jedoch beileibe kein Mangel, sondern ein Wesensmerkmal künstlerischer, also „intentionaler“ Gegenstände. Sie sind und das gilt auf besondere Art für Gedichte – an den affizierbaren, versenkungswilligen unbekannten einzelnen adressiert, bei dem sie ein kulturelles Grundeinverständnis voraussetzen, und dies auch dann, ja gerade dann, wenn sie dieses Einverständnis etwa durchbrechen.
Mit diesen Sentenzen wollte ich Sie, wenigstens im Vorübergehen, daran erinnern, daß ästhetische Urteile und preisrichterliche Entscheidungen in keinem Fall justizierbar sind. Sie lassen sich zwar begründen und womöglich plausibel machen, aber eben nicht obtektivieren. Auch eine breite spontane Zustimmung ändert an diesem Sachverhalt nichts. Demokratie und Ästhetik unterhalten ein ziemlich prekäres Verhältnis. Wenn es sich anders verhielte, wäre die Kunst und wären Gedichte noch sehr viel entbehrlicher, als sie es vielen ohnehin sind oder scheinen. Man wird gewiß verstehen, daß die Mitglieder einer Jury, die aus vierzig Gedichtbänden eines Jahrgangs nur jenen einen auszuwählen beauftragt war, dabei auch von Unrechts- und Ohnmachtsgefühlen geplagt wurden. Jedes Gedicht erhebt den Anspruch, ein solitäres Wesen zu sein. Es muß diesen Anspruch durch seine Sprache beweisen, und oft genug ist er illegitim. Doch mit diesem Anspruch allein behauptet es sich als Gedicht. In jedem tönt die Stimme eines Menschen – eine stilisierte, nach selbstgewählten Zwängen der Kunst geführte, also immer verfremdete Stimme, weil sie im verfremdenden Medium einer Sprache, die allen gehört, anders nicht tönen kann. Und dennoch ist das Ziel solcher Stilisierung und Verfremdung die stimmhafte Kenntlichkeit dieses einzelnen. Das ist paradox, und entsprechend selten gelingt es. Daß die meisten niemals dorthin gelangen, schließt aber nicht aus, daß manches ihrer Gedichte interessant und lesenswert sein kann. Das eigentümliche Timbre aber, die Unverwechselbarkeit individuellen Tonfalls und jene kleinen willkürlich-unwillkürlichen Irrsinnsblitze, die im poetischen Text ein so noch nicht Wahrgenommenes aufleuchten lassen – das hat einen hohen Seltenheitswert. Und selbst da noch sind Täuschungen möglich. Wir erkennen das Bleibende erst, wenn es blieb.
Es mag Sie verwundern, daß ich gerade in einer Lobrede auf Sarah Kirsch auf jene Unrechts- und Ohnmachtsempfindungen der Jury hinweise. Sarah Kirsch hat in ihren Gedichten, nicht erst in denen ihres jüngsten Bandes, einen so hohen Grad personenhafter Kenntlichkeit gewonnen, und das Timbre ihrer Sprachkunst hat sich vielen Lesern (und Nachahmern) längst als so unverwechselbar eingeprägt, daß ihr der Peter-Huchel-Preis eine noch größere öffentliche Beachtung kaum wird verschaffen können, schon gar nicht, wenn er der zwölfte oder fünfzehnte Preis ist, den sie heute erhält, und nicht einmal der einzige für den Gedichtband Erlkönigs Tochter. Man könnte sagen: Die Jury hatte den Mut zu einer populären, leicht vorauszusagenden Entscheidung. Um solcher Ironie die Spitze zu nehmen, bekenne ich gern, daß wir bestochen waren. Eine unbestechliche Jury wäre eine schlechte Jury – aber sie darf durch nichts „korrumpierbar“ sein als durch poetische Qualität. Die aber war uns auch diesmal so unzweifelhaft wie bei früheren, nicht voraussagbaren Jury-Entscheidungen, denen der Peter-Huchel-Preis seine Reputation verdankt. Zwei davon möchte ich nennen: Manfred Peter Hein und Ludwig Greve.
Manfred Peter Hein, der in Helsinki lebt und Unschätzbares für die Vermittlung skandinavischer Literatur ins deutsche Sprachgebiet geleistet hat, erhielt diesen Preis als erster. Das Preisgeld reichte aus, um die Druckkosten seines Gedichtbandes Gegenzeichnung zu begleichen. Gedichte, die nach zehn Jahren nichts von ihrer Eindringlichkeit und Sprachkraft verloren haben – und dafür, sozusagen als Druckkostenzuschuß, den Peter-Huchel-Preis. Wir erfuhren es hinterher und waren beschämt. Und als man im vorigen Jahr Ludwig Greve die Reverenz erwies, war der 68jährige im Sommer davor gestorben – als Dichter beinahe unbekannt. Seine Sammlung Sie lacht und andere Gedichte war soeben bei S. Fischer erschienen. Daß der Preis gerade auf Greve fiel, war nicht etwa als Totenehrung gedacht, sondern sollte der Dank für lebendigste, formbewußte Poesie sein, für Gedichte von tiefem Ernst und großer Gelassenheit. Solche unvoraussagbaren Preisentscheidungen sind vielleicht nur möglich, weil eine kluge Satzung zur Sichtung von Jahresernten zwingt.
Unter den Neuerscheinungen des vorigen Jahres – ein für die deutsche Lyrik bemerkenswert guter Jahrgang – wären wohl einige huchelpreiswürdig gewesen. Aber zuletzt sprach fast alles für Sarah Kirsch, also für Erlkönigs Tochter.
Der Titel ist zauberhaft, in jeder Bedeutung dieses Wortes. Er hat einen Zug ins Dämonisch-Verführerische und verführt auch zum Lesen. Zaubersprüche hieß ein früherer Band, und auch Titel wie Katzenleben oder Erdreich hatten die Aura des nicht ganz Geheueren. Dieser aber ist wie ein Wetterleuchten, hervorgerufen durch zwei zitierte Worte: ein poesiegeschichtlicher Horizont leuchtet auf. Wenn man sie wiederfindet, auf Seite 50 des Bändchens, sind diese zwei Worte so vollkommen ins Gedicht eingegangen, daß zwischen dem eigenen und dem Zitat kein Unterschied mehr besteht ein Augenblick großer Poesie. Der Titel dieses Gedichts ist eine Ortsangabe – „Watt“ nennt den nur bei Ebbe betretbaren Meeresboden, also gefährlichen Grund, doppelt gefährlich bei Nacht. Das Gedicht ist ein Nachtstück, wie alle Erlkönig-Gedichte:
Watt III
Ich Erlkönigs Tochter hab eine
Ernsthafte Verabredung mit zwei
Apokalyptischen Reitern im Watt ein
Techtelmechtel auf unsicherem Boden
Jetzt ehe der Morgen sich rötet.
Drehender Nebelqualm bemerkenswert
Eiliger Schneefall stellen ne schöne
Verbindlichkeit her das legt sich
Auf Möwenkadaver Colabüchsen der
Abgeblaßte Mond auf der Hurtigroute
Zwischen kopulierenden Wolken bezeugt er
Dem Albatros höchste Bewunderung wie der
Von Süden herüberkömmt während Jupiter
Über dem Kuhstall später der Bohrinsel glänzt.
Happy Neujahr! rufen die Seenotraketen
Und der Jung aus Büsum wird niemals
Gefunden es fallen die Krähen
Schwarze Äpfel vom einzigen Baum.
Der Ellerkonge oder Erlkönig ist uns durch Herders Fehlübersetzung als Erlkönig bekannt −, ein tückischer Naturgeist, umtriebig in Nacht und Nebel. Über die Zahl seiner Töchter, die zu meiden sich ebenfalls dringend empfiehlt, ist aus Goethes Gedicht nichts Näheres zu erfahren. Daß sie „am düsteren Ort“ sich die Zeit vertreiben mit sogenannten „schönen Spielen“, hat sich uns eingeprägt. Von einer einzelnen Erlkönigstochter ist in Herders Geisterballade die Rede, einer Nachdichtung aus dem Dänischen, und die heißt denn auch „Erlkönigs Tochter“. Da reitet ein gewisser Herr Oluf „spät und weit, / zu bieten auf die Hochzeitsleut. // Da tanzen die Elfen auf grünem Land, / Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand“. Und weil Bräutigam Oluf dieses erotische Werbegeschenk nicht annehmen mag, erreicht er am Ende zwar seinen Hof mit Müh und Not, aber lakonisch schließt das Gedicht (wie später das andere) mit: „er war tot“. Wer sich an diese beiden naturmagischen Balladen erinnert, wird in Sarah Kirschs Gedicht manche Bezüge entdecken, die zu erkennen vielleicht nicht unbedingt nötig ist, aber die Wirkung der Verse vertieft. Das moderne Gedicht stellt sich in eine motivgeschichtliche Reihe, besinnt sich auf eine erlauchte poetische Tradition und beweist doch mit jeder sprachlichen Wendung seine Modernität. Naturmagisch ist demnach auch der Stammbaum des sprechenden Ichs: Erlkönigs Tochter. Nebel und Watt bezeichnen den düsteren Ort eines Zusammentreffens, „ernsthafte Verabredung“ genannt, und es wird auch geritten: je ein Reiter bei Herder und Goethe; hier aber sind es zwei Reiter, die apokalyptischen, zu denen die Erlkönigstochter eine offenbar ernsthafte Beziehung unterhält. Naturmagie verbindet sich mit den biblischen Endzeitboten der Apokalypse. Der Boden ist „unsicher“, magischer Naturgrund, gewiß, aber er ist auch zugleich historische Landschaft des 20. Jahrhunderts, mit Bohrinsel, Seenotraketen und Colabüchsen im Schlick. Die Stunde ist Geisterstunde: Silvestermitternacht, ausgerufen in typisch zeitgenössischem Deutsch: „Happy Neujahr!“ Und der Junge aus Büsum, der niemals wieder gefunden wird, wo ist der wohl geblieben? Sollte der wirklich nichts mit Erlkönigs Tochter zu tun gehabt haben? Da wird man sich doch an jene Knaben- und Jünglingsleichen aus Goethes und Herders Balladen erinnern dürfen.
Und schließlich: Wenn das Gedicht mit den Worten „Ich Erlkönigs Tochter“ beginnt – wer spricht da eigentlich, wer ist dieses Ich? Ist es ein Rollen-Ich oder Sarah Kirsch – soll oder kann, ja will man es noch unterscheiden? Mir scheint, auch hier klingt einiges an – Erinnerungen an berühmte Ich-Gedichte: „Ich, François Villon“ – „Ich, Bertolt Brecht“ – „Ich Erlkönigs Tochter“. Eine Ich-Figur im Grenzbereich von phantastischer Imagination und leibhafter Erfahrung, ganz aus Sprache, identisch und nicht-identisch mit der Meisterin solcher Verse, ein unverwechselbar-kenntliches, aber zugleich beunruhigend fremdes Ich. Eine solche Vergleichzeitigung gibt es nur in der Poesie, und Gedichte wie dieses gelingen nicht oft. Auch der Band Erlkönigs Tochter enthält Gedichte geringeren Ranges – wie könnte es anders sein. Aber immer wieder stößt man beim Lesen und Wiederlesen auf Verse, die jemand, für den Gedichte ein geistiges Grundnahrungsmittel bedeuten, vielleicht im Gedächtnis behält. Etwa das Gedicht „Traum“, ein Text von gedämpfter politischer Aggressivität (die man nicht unbedingt teilen muß). Von Zivildienst und Wehrdienst ist da die Rede, und die Metapher „Molotow-Cocktail“ dient einem zweideutig-lässigen Sprachspiel:
TRAUM
Kam an der gotischen Insel vorüber
Die Stadtmauer war mit Rosen bespannt zärtlich
Erblühten Elke blickte hindurch sagte Konrad
Will Berufssoldat werden! Wie ist das
Möglich. Ob er der Wechselbalg ist? In solch
Einem Fall genügt es den Molotow-Cocktail
Kräftig zu schütteln bevor man das Feuerzeug
Dreht ist das Wesen verschwunden im
Korridor steht das richtige etwas größere
Kind und geht zum Zivildienst Vögel beringen.
Ich werde mich hüten, das, was hier und in anderen Gedichten von Sarah Kirsch immer wieder geschieht, eine Poetisierung von Alltäglichkeiten zu nennen – diese Bezeichnung wäre gewiß nicht falsch, aber sie könnte verharmlosend klingen. Ich sage lieber, daß im Bewußtseinsraum dieser Gedichte sich Triviales und (nun ja) Erhabenes ineinander verschlingen und daß es nichts Alltägliches, nichts Triviales gibt – vom Wehrdienstverweigerer über einen Autokühlerdefekt im amerikanischen Mittelwesten bis zur „schmalen Sichel sich verpissenden Monds“ (was mir überhaupt nicht gefällt) −, nichts, was in der immer ganz eigen timbrierten Sprache dieser Gedichte nicht gesagt und also poesiefähig werden könnte. Immer sind es welthaltige, oft wirklichkeitssatte Gedichte, und fast immer ist Magie im poetischen Spiel, Sprachmagie, Traummagie – es sind Gedichte von Erlkönigs nie ganz geheurer aufmüpfiger Tochter. Aber darf ein Gedicht etwa je ganz geheuer sein? Nicht einmal die alten Kirchenlieder sind es gewesen.
Noch ein Naturgedicht möchte ich vorlesen. Dieses poetische Genre ist seit langem, und vermutlich für immer, in etwa demselben Zustand wie die Natur durch uns alle: gefährdet, vielleicht schon nicht mehr zu retten. Aber dieses hier ist eins. Es nennt nur naturhafte Dinge, die Landschaft ist nordisch. Im letzten Satz gibt sich das Heute zu erkennen:
Auf einer Klippe
Das Meer brüllte im
Wind und übertraf ihn.
Ich ging
In seinem und seinem
Schreien und Wehen
Auf Lavastufen. Der
Wind ist alt er
Lachte als er mich
Sah. Übergab mir der
Meergänse Schrei.
Wie wenig bedeutet ein Mensch in dieser Landschaft. Hier überbrüllt die Natur eines Menschen Stimme. Sein Schrei, wenn er schriee, bliebe ungehört. Der alte Wind – naturmagisch-märchenhaft als Person erfahren – lacht, wie einer, der alles weiß, ist aber hilfreich: „Übergab mir der Meergänse Schrei.“ Dieser Schrei wird zum Stellvertreter:
Naturlaut vertritt den Schrei des historischen Ichs, das auf einer Klippe steht. Mehr wird nicht gesagt und nicht weniger. Man braucht diesen Schrei nicht zu deuten: das Gedicht selbst ist wie eine Interjektion.
Der Peter-Huchel-Preis, liebe Sarah Kirsch – für solche Gedichte.
Peter Horst Neumann, Laudatio auf Sarah Kirsch, 1993
Ohne Fleiß kein Preis
I.
Sie sind hier und ich bin ebenfalls hier da Sie die Mehrheit abgeben scheinen Sie etwas von mir zu erwarten was könnte es sein. Nicht daß ich schweige oder diese Bücher zerreiße obwohl ich zu beidem fähig ja wäre weil es nicht seine meine einzigen sind solche die ich an jeder Ecke zu der Zeit bestellen und wieder erwerben könnte jetzt und ein paar Jahre rein in die Zukunft also das ist es nicht was Sie von mir erwarten eher daß ich dieses Mäppchen aufschlage irgendwo loslege ja und so taufrisch Ihnen das herbete als wäre es gerade aus meinem Schreibpult geschlüpft Sie hören den Deckel desselben leise rumoren was soll nun werden. Ich lese einen Text aber keinen von mir und dann noch einen eigenen und Sie können annehmen es geschähe Sie bei Laune zu halten mich zu bedanken oder ne Weile später grob zu schockieren Publikumsbeschimpfungen sind eine gängige sehr ergiebige Kunst-Art Kunst-Kunst meinetwegen aber es könnte auch sein daß ich diesen Text steigen lasse wie einen schönen beweglichen geschwänzten Drachen vielleicht am Strand von Rømø er fliegt schon ganz wacker ich muß die Schnur nachlassen kaum daß ich anfing erreicht er Höhen in denen Möwen spazierenfliegen etwas laute zänkische Möwen die sich später auf Kaminen niederlassen dem Küstenbewohner Übles nachsagen was er mit Gleichem vergilt aber der kleine hellgrüne Drache mit seinen Troddeln dem Schwänzgen hat sie längst überflogen wie meine Stimme die ehrenwerte Versammlung an diesem und an anderen Orten schon vorher Marktflecken mit fürchterlichen Sälen von Schulen gar Volkshochschulen so bin ich mit mir zufrieden mit Ihnen ja auch weil Sie mich nicht unentwegt stören ich mich an Ihren Anblick gewöhne es mir später gelingt Sie glatt zu vergessen zurückzulassen wie einen x-beliebigen Bahnhof zur Hauptverkehrszeit und Obacht gebe daß man mir nicht auf die Füße tritt die Knöpfe nicht abreißt und meinen kleinen silbernen Koffer durchgehen läßt ohne etwas darin zu beanstanden ich lese also über die geschätzten Häupter hinweg und höre meine vertraure Stimme wie sie von Reihe zu Reihe springt die Augen sammeln heute blaue Töne Blau steht nicht jedem es gibt sehr viele seltsame Blaus aber die Blaugraus und Graublaus sind mir die Liebsten in der vierten Reihe links eine taubengraue Seele und davor eine türkisene auch die wie grüne Seife erscheint interessiert mIch und für Sie das Auditorium lese Ich den „Hauptdrachen die Verkörperung des anderen Schreibens“ die mich gerettet hat im ersten Teil meines Landes. Huchel sei Dank und darnach folgt das Schwänzchen daran welches auf meinem Miste später dann wuchs und ich bin sehr gespannt was Sie sich fragen werden und worauf ich auch nicht antworten kann ich erinnere mich an keine interessante Diskussion nach einer Lesung denke entzückt nur an die Stille die ein paar Stunden danach in diesem Raum wiederum herrscht wenn wir gemeinsam den Ort hier verlassen jeder bereichert uns wieder vereinzeln was das Schöne an solcher Zusammenkunft ist: ihre Begrenzung.
II:
Peter Huchel:
HUBERTUSWEG
Märzmitternacht, sagte der Gärtner,
wir kamen vom Bahnhof
und sahen das Schlußlicht des späten Zuges
im Nebel erlöschen. Einer ging hinter uns,
wir sprachen vom Wetter.
Der Wind wirft Regen
aufs Eis der Teiche,
langsam dreht sich das Jahr ins Licht.
Und in der Nacht
das Sausen in den Schlüssellöchern.
Die Wut des Halms
zerreißt die Erde.
Und gegen Morgen wühlt
das Licht das Dunkel auf.
Die Kiefern harken Nebel von den Fenstern.
Dort unten steht,
armselig wie abgestandener Tabakrauch,
mein Nachbar, mein Schatten
auf der Spur meiner Füße, verlass ich das Haus.
Mißmutig gähnend
im stäubenden Regen der kahlen Bäume
bastelt er heute am rostigen Maschendraht.
Was fällt für ihn ab, schreibt er die Fahndung
ins blaue Oktavheft, die Autonummern meiner Freunde,
die leicht verwundbare Straße belauernd,
die Konterbande,
verbotene Bücher,
Brosamen für die Eingeweide,
versteckt im Mantelfutter.
Ein schwaches Feuer nähre mit einem Ast.
Ich bin nicht gekommen,
das Dunkel aufzuwühlen.
Nicht streuen will ich vor die Schwelle
die Asche meiner Verse,
den Eintritt böser Geister zu bannen.
An diesem Morgen
mit nassem Nebel
auf sächsisch-preußischer Montur,
verlöschenden Lampen an der Grenze,
der Staat die Hacke,
das Volk die Distel,
steig ich wie immer
die altersschwache Treppe hinunter.
Vor der Keilschrift von Ras Schamra
seh ich im Zimmer meinen Sohn
den ugaritischen Test entziffern,
die Umklammerung
von Traum und Leben,
den friedlichen Feldzug des Königs Keret.
Am siebenten Tag,
wie IL der Gott verkündet,
kam heiße Luft und trank die Brunnen aus,
die Hunde heulten,
die Esel schrieen laut vor Durst.
Und ohne Sturmbock ergab sich eine Stadt.
KATZENLEBEN
Aber die Dichter lieben die Katzen
Die nicht kontrollierbaren sanften
Freien die den Novemberregen
Auf seidenen Sesseln oder in Lumpen
Verschlafen verträumen stumm
Antwort geben sich schütteln und
Weiterleben hinter dem Jägerzaun
Wenn die besessenen Nachbarn
immer noch Autonummern notieren
Der Überwachte in seinen vier Wänden
Längst die Grenzen hinter sich ließ.
Sarah Kirsch, Dankesrede, 1993
Mitschnitt der Preisverleihung vom 3.4.1993
Andrea Marggraf: Ein Besuch bei Sarah Kirsch
Versprengte Engel – Wolfgang Hilbig und Sarah Kirsch ein Briefwechsel
Lesung in der Quichotte-Buchhandlung in Tübingen am 8.12.2023 mit Wilhelm Bartsch und Nancy Hünger sowie Marit Heuß im Studio Gezett in Berlin.
Begrüßung: Wolfgang Zwierzynski, Buchhandlung Quichotte
Einleitung: Katrin Hanisch, Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft e.V.
Zum 60. Geburtstag der Autorin:
Jens Jessen: Versteckte Aggressivität
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.4.1995
Zum 65. Geburtstag der Autorin:
Jürgen P. Wallmann: Verspielte Vision
Rheinische Post, 14.4.2000
Heinz Ludwig Arnold: Ein paar Abgründe überwinden
Frankfurter Rundschau, 15.4.2000
Peter Mohr: Meine schönsten Akwareller sint weck
General-Anzeiger, Bonn, 15./16.4.2000
Jürgen Israel: Das Herz hat einen Riss
Unsere Kirche, 16.4.2000
Horst H. Lehmann: Bibliophile Werkausgabe auf Büttenpapier
Neues Deutschland, 17.4.2000
Hans Joachim Schädlich: Sarah. Ein Geburtstagsgruß
Neue Rundschau, Heft 3, 2000
Zum 70. Geburtstag der Autorin:
Marion Poschmann/ Iris Radisch: Man muss demütig und einfach sein. Gespräch
Die Zeit, 14.4.2005
Michael Braun: Landschaften mit Endzeit-Boten
Basler Zeitung, 15.4.2005
Unter dem Titel Idyllische Apokalypse
Stuttgarter Zeitung, 15.4.2005
Helmut Böttiger: Hier ist das Versmaß elegisch
Badische Zeitung, 16.4.2005
Michael Braun: Die Schmerzzeitlose
Der Tagesspiegel, 16.4.2005
Johann Holzner: Das Leben verlängern
Die Furche, 14.4.2005
Christian Eger: Unter dem Flug des Bussards
Mitteldeutsche Zeitung, 16.4.2005
Alexander Kluy: Den Himmel vergleichen
Frankfurter Rundschau, 16.4.2005
Dorothea von Törne: Schütteln und weiterleben
Literarische Welt, 16.4.2005
Gunnar Decker: Fisch, der am Grund lebt
Neues Deutschland, 16./17.4.2005
Samuel Moser: Verse vom Rand der Welt
Neue Zürcher Zeitung, 16./17.4.2005
Hans-Herbert Räkel: Ein Elefant muss über die Alpen
Süddeutsche Zeitung, 16./17.4.2005
Sabine Rohlf: Läuse bei Mäusen in der Umgebung von Halle
Berliner Zeitung, 16./17.4.2005
Zum 75. Geburtstag der Autorin:
Andrea Marggraf: „Bevor ich stürze, bin ich weiter“
Deutschlandradio Kultur, 13.4.2010
Erich Malezke: Natürliche Distanz zur Außenwelt
SHZ, 15.4.2010
Jürgen Verdofsky: Remmidemmi in Tielenhemmi
Frankfurter Rundschau, 15.4.2010
Wilfried F. Schoeller: Hier bin ich gern und immerdar
Der Tagesspiegel, 15.4.2010
Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
Thüringer Allgemeine, 16.4.2010
Rebekka Haubold: Sarah Kirsch feiert 75. Geburtstag
Radio für Kopfhörer, 16.4.2010
Gunnar Decker: Pirol unter Krähen
Neues Deutschland, 16.4.2010
Brita Janssen: Sarah Kirsch zum 75. Geburtstag
BZ, 16.4.2010
Peter Mohr: Meine Naivität war mein Glück
literaturkritik.de, Mai 2010
Michael Braun: „Alles ist auffindbar in meinen Spuren“
Konrad Adenauer Stiftung, April 2010
Zum 5. Todestag der Autorin:
Heidelore Kneffel: 1997 bei Sarah Kirsch in Tielenhemme
nnz, 5.5.2018
Zum 10. Todestag der Autorin:
Karin Kisker: Zum zehnten Todestag der Dichterin Sarah Kirsch
Neue Nordhäuser Zeitung, 5.5.2023
Wulf Kirsten: Rede auf Sarah Kirsch zur Verleihung der Ehrengabe der Heine-Gesellschaft 1992.
Fakten und Vermutungen zur Autorin + Instagram + KLG +
Archiv + Internet Archive + Kalliope + DAS&D +
Georg-Büchner-Preis 1 & 2 und weiteres
Porträtgalerie: Autorenarchiv Isolde Ohlbaum + Keystone-SDA +
Autorenarchiv Susanne Schleyer + Brigitte Friedrich Autorenfotos +
deutsche FOTOTHEK
Nachrufe auf Sarah Kirsch: Spiegel ✝ FAZ ✝ FR ✝ Tagesspiegel ✝
Die Zeit ✝ Focus ✝ Die Welt ✝ SZ ✝ NZZ ✝ WAZ ✝ MZ ✝
KAS ✝ junge Welt ✝ Tagesschau ✝ titelblog


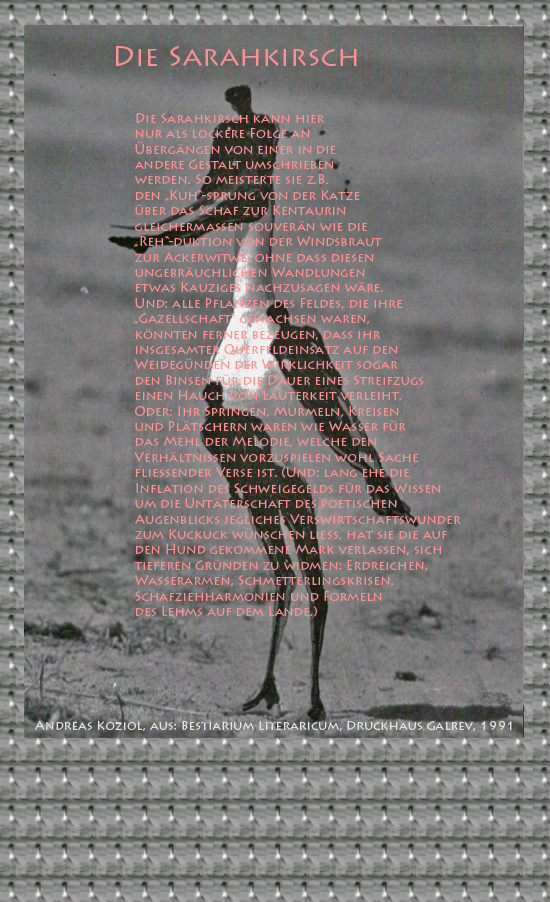













Selbstvorstellung
Anläßlich der Aufnahme in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
Meine Damen und Herren, verehrte Akademie-Mitglieder, ich bedaure es aufrichtig, daß ich meinen Dank für die Ehre, die Sie mir seinerzeit durch die Wahl zum Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erwiesen, erst so spät, gewissermaßen nach Jahren im Winter, hier zu sagen vermag. Kann ja sein, daß es bei mir so lange dauert, bis ich Fuß gefaßt habe. Möglich, daß ich nun sicherer bin.
Wie kommt Literatur zustande?
Ganz einfach, es ist nur eine Fata aus dem Gebiet der Papierkörbe eben, indem du etwas nicht wegschmeißt bleibt etwas übrig was ein anderer (Mann Frau Kind Tier Pflanze) vielleicht zu lesen vermag wenn er sie es es vermöchte und immer vorausgesetzt man hat etwas gefunden eine Institution ein Verlagshaus welches einem den Bettel dann abnimmt und zwischen zwei Buchdeckel haut und dann hängt alles von den Buchhändlern ab, Gestalten wie Barbara, Helga die selber Bücher noch lesen und ihren Kunden begeisterte Zettel schreiben: dieses oder jenes oder beides müssen Sie lesen, das ist herrlich erschwindelt atemberaubend erlogen Mein Gott! wie das durch die Gehirnkammern und Herzräume geistert, wie die schönen Gefilde entstehen der Leser die Leserin oder beide zusammen zauberhafte Orte nicht nur erblicken nein im nächsten Moment darin traben von einer Ebene schon in die folgende, zwischendurch finstere klangvolle Wälder wo einem die bekannten oder unbekannten Wesen entgegentreten, welche man immer schon treffen wollte, andere mit denen man niemals gerechnet noch hat, Stars können mir natürlich gestohlen bleiben, lieber gehe ich durch ein vogelstrotzendes Wäldchen und treffe zum Beispiel auf einer Lichtung sämtliche Katzen die mir im Lauf meines Lebens begegnet sind, herrliche selbständige Katzen, das geht mit Thymian los und ich bin ein unmündiges Kind und andere minzen mich an, ich kann mich über alle lange verbreiten weil zu bestimmten Lebensabschnitten die besonderen Katzen gehören, in Rom die berühmten verwilderten Ausgrabungskatzen, da werde ich ausführlich drauf eingehen, wenn ich nach der Methode Gertrude Stein von einem ins andere Heft diese Sätze abschreibe und wieder verändere, hinzufüge verwerfe, ins Gebiet des Papierkorb gerate, was stets ein Segen für alle ist wie ich bemerke. Punkt. Wenn ich so schreibe und auch nach der Methode Gertrude Stein, vom Hundertsten ins Tausendste – Abschweifungen! die schönen Figuren Bögen und sanften Schwünge bereite wie in einem raffinierten Landschaftspark, auf kleinem Raum alles! aber auch alles! über tellurische Verhältnisse setzen, sehr ähnlich verhält es sich mit einem Stück Prosa, und wie ein unheimlicher Wasserfall rauschend im Nebel so verläuft auch das automatische Schreiben es strömt wie es strömt ich habe es täglich trainiert, es zu vollführen ist äußerster Lustgewinn, Schreiberin vergißt alles darbey, aber ich weiß nit immer ob ich es wirklich so will, eigentlich schätze ich solche knappen gegenständlicheren Stücke wie in seinerzeit Irrstern oder was ich später ausgestanzt habe, etwas das einen Anfang und dann einen Schluß hat, einen kleinen Aufbau und die gesetzte Spannung – solche Stückchen wie sie Herr Robert Walser gemacht hat Robert muß man doch stets betonen in diesem Lande in dieser Zeit, also ich übe das Strömen, die Leichtigkeit ein und später finde ich für mich: meine Bröselein dann doch in einem schönen Gebilde mit irdischen Weiten, die Erde, wenn auch meine, beschreibend, nicht mein Inneres fortwährend betrachtend, wenn das die Feder natürlich auch lenkt, aber ich will nicht mein Inneres abfotografieren weil ich mich auch nicht preisgeben will oder mich nicht außerordentlich finde höchstens den Blickwinkel noch ein gewisses zärtliches Schielen aber das ist bloß das Lachen zwischen den Zeilen.
Sarah Kirsch 1990, aus: Michael Assmann (Hrsg.): Wie sie sich selber sehen. Antrittsreden der Mitglieder vor dem Kollegium der Deutschen Akademie, Wallstein Verlag, 1999.